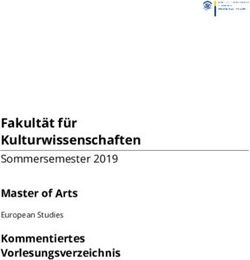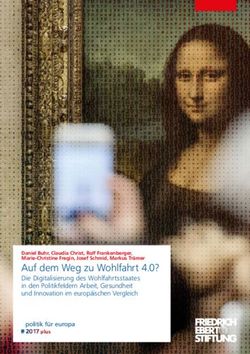QUALITÄTSRAHMEN KOMMUNALE GESAMTSTRATEGIE - GELINGENDES AUFWACHSEN ERMÖGLICHEN
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Vera Deffte, Eva-Maria Frühling, Dr. Heinz-Jürgen Stolz QUALITÄTSRAHMEN KOMMUNALE GESAMTSTRATEGIE G E L I NG E N DES AUFWACH SE N ERMÖGLIC HEN
Vera Deffte, Eva-Maria Frühling, Dr. Heinz-Jürgen Stolz
QUALITÄTSRAHMEN
KOMMUNALE
GESAMTSTRATEGIE
G E L I N G E NDES AUFWACH SE N ERMÖGLICHEN
I N H ALTSV E RZ EICHNIS
Vorwort zur Neuausgabe .......................................................................................... 5
Fachliche Rahmung ................................................................................................... 6
Sinnfokussierung . ................................................................................................... 10
„WHY?“ – Kommunale Daseinsvorsorge als Gemeingut 11
„HOW?“ – Die Präventionskette als Gestaltungsansatz 14
„WHAT?“ – Formate der kommunalen Handlungsstrategie 16
Die Basis des Qualitätsrahmens 20
Der Qualitätskreislauf ............................................................................................. 22
Allgemeine Präventionsleitlinien 23
Die vier Stationen des Qualitätskreislaufs 27
Station 1: Kommunales Präventionsleitbild 28
Station 2: Strategische Steuerung und Zielentwicklung 32
Station 3: Zielkonkretisierung und -umsetzung 39
Station 4: Reflexion und Neuausrichtung 44
Wissensbasiertes Handeln ..................................................................................... 52
Literatur . .................................................................................................................. 574 Vorwort zur Neuausgabe
Vorwort zur Neuausgabe 5
VORWORT ZUR
NEUAUSGABE
Kindern und Jugendlichen in Nordrhein-Westfalen Diese drei neuen Elemente werden in der Prozesslogik
gelingendes Aufwachsen zu ermöglichen, ist das Ziel des Qualitätsrahmens miteinander verknüpft: Das
des Landesprogramms „kinderstark – NRW schafft Wechselspiel von Sinnfokussierung und Wissensbasie-
Chancen“. Die Programmkommunen arbeiten mit die- rung hält dabei die innovative Dynamik des Gestaltungs-
sem klaren Ziel und einem darauf aufbauenden Leitbild ansatzes wach. Die stärkere konzeptionelle Ausrichtung
an der Umsetzung und Übersetzung in die Praxis. Der von Zielen an kommunalen Handlungsmöglichkeiten
Auf- und Ausbau der dazu benötigten Präventionsket- lässt dann konkrete Umsetzungsschritte und darauf
ten zeichnet sich durch eine intensive, bereichs- und bezogene Wirkungsannahmen – aber auch realistisch
trägerübergreifende Netzwerkarbeit aus, die auf einen zu bewältigende Herausforderungen – sichtbarer werden.
gemeinsamen Sinn fokussiert: Jungen Menschen ein Und ein erweitertes Wirkungsverständnis ermöglicht
chancengerechtes Aufwachsen zu gewährleisten. auf eben diese Wirkungsannahmen bezogene, klein-
schrittige Erfolgskontrollen und befördert somit orga-
Aus der fünfjährigen Begleitung von 18 Modellkom- nisationales Lernen. Wie dies alles jeweils geschehen
munen (2012–2016) im Vorgänger-Projekt „Kein Kind kann, ist Gegenstand der weiteren Ausführungen. Dass
zurücklassen“ wurde in enger Abstimmung mit den es geschieht, dient einer Absicherung der Nachhaltig-
teilnehmenden Kommunen ein empirisch belastbarer keit der kommunalen Gesamtstrategie.
Qualitätsrahmen erarbeitet. Dieser diente den 22 neuen
Kommunen der zweiten Projektphase (2017–2019) als Auch dieser Qualitätsrahmen liefert keine „Schritt-für-
Arbeitsgrundlage – und allen 40 Programmkommunen Schritt-Anleitung“ für den Aufbau von Präventions-
als Arbeitsinstrument. Nicht zuletzt auf der Grundlage ketten, sondern vielmehr eine fachliche Rahmung und
der breiten Rückmeldungen aus der Praxis in Kommu- theoretische Grundlage. Das „Handbuch für Kommu-
nen konnte der Qualitätsrahmen weiterentwickelt und nen“ bietet zudem praxisbezogene Umsetzungshilfen
aktualisiert werden, sodass er nun als Neuausgabe und Tools, etwa in Form von Checklisten und Praxis-
vorliegt. Wesentliche Änderungen beziehen sich auf die handreichungen. Sie dienen als ergänzende Arbeitsma-
terialien und schlagen so die Brücke von der Theorie in
Hervorhebung der Sinnfokussierung und Wissens- die Praxis – oder von der strategischen auf die operative
basierung in jedem Umsetzungsschritt, Ebene.
stärker an den kommunalen Handlungsmöglich-
keiten orientierte Zielkonkretisierung sowie
die Erarbeitung eines erweiterten Wirkungsver
ständnisses.6 Fachliche Rahmung
FACHLICHE RAHMUNG
Das primäre Ziel im Landesprojekt „kinderstark – NRW gemeinsame Gestaltungsaufgabe explizit, viele andere
schafft Chancen“, allen Kindern und Jugendlichen Elemente des Qualitätsrahmens (z.B. die Präventions-
ein chancengerechtes, gelingendes Aufwachsen zu leitlinie „Soziale Inklusion“) implizit.
ermöglichen, ist nur durch enge Zusammenarbeit zu
erreichen. Zur Umsetzung des Aufbaus kommunaler Präven
In den Kommunen wird vor Ort daran gearbeitet, ein tionsketten versammeln sich die Programmkommunen
bereichsübergreifendes Netzwerk aufzubauen, um unter der Leitprogrammatik eines gelingenden
Kindern, Jugendlichen und Familien durch passgenaue Aufwachsens. Sie fassen diese Leitorientierung in
und aufeinander abgestimmte Angebote wirksame strategische Zieldimensionen wie Bildungs- und
Unterstützung anbieten zu können. Chancengerechtigkeit, gesundes Aufwachsen, um-
Die „Servicestelle Prävention“ reflektiert und verdichtet fassende Teilhabe sowie Förderung einer kinder- und
die einzelkommunalen Erfahrungen und die vor Ort familienfreundlichen Gesellschaft. Sie müssen dabei –
jeweils eingeschlagenen Wege mithilfe von Methoden ungeachtet der oftmals hoch gesteckten strategischen
der Qualitätsentwicklung, speist im Lernnetzwerk den Ziele – ihre durchaus begrenzten kommunalen Hand-
wissenschaftlichen und fachdiskursiven State of the lungsmöglichkeiten berücksichtigen, um zu praxis
Art ein, stellt zielführende Formate für den interkom- relevanten Lösungen zu gelangen. Dennoch wollen
munalen Wissenstransfer zur Verfügung und bildet die sie die Chance ergreifen, die sich ihnen durch das
Schnittstelle zu Landespolitik und zu themenrelevanten gemeinsame Wirken („Collective Impact“) ihrer jewei-
landesweiten Institutionen und Programmen. ligen institutionellen und persönlichen Beiträge bietet:
das Finden passgenauer Lösungen für eine Überwindung
Um das gemeinsame Ziel zu erreichen, müssen alle ungleicher Lebenslagen. Lösungen, die der Lebenswirk-
beteiligten Institutionen, Träger und Einrichtungen ler- lichkeit der vor Ort lebenden Menschen entsprechen.
nen, gemeinsam „vom Kind her zu denken“ und noch Dies ist nur durch die umfassende und zielgenaue Betei-
besser koordiniert zusammenzuarbeiten. Dabei ist zu ligung eben dieser Menschen an kommunalen Planungen
berücksichtigen, dass es ungeachtet übergreifender und eine breite Trägerschaft auf allen Ebenen möglich.
Entwicklungsherausforderungen und institutioneller Dies ist immer noch eine große und herausfordernde
Regulierungen (z.B. Schulpflicht) keine einheitlich Aufgabe, für die der überarbeitete Qualitätsrahmen
geprägte „Lebensphase Kindheit“ gibt (vgl. Betz 2008). grundlegende Herangehensweisen aufzeigt!
Die Startchancen und Lebenslagen von Kindern und
Jugendlichen sind durch gesellschaftliche Ungleich Mit den konzeptionellen Neuerungen des überarbei-
heiten geprägt. Diese drücken sich in vielen, sich teten Qualitätsrahmens soll erreicht werden, dass der
überschneidenden Ausprägungen aus, z.B. Sozialmi Präventionskettenansatz zum einen Wirkung in der un-
lieuzugehörigkeit, sozialräumliche Segregation, mittelbaren Praxis mit den Adressat*innen zeigt – und
Stadt-Land-Differenz, Familienform und Kinderzahl, Ge- zum anderen eben diese Praxis konzeptionell reflektiert
schlecht, (Selbst-)Ethnisierung, sexuelle Orientierung, weiterentwickelt wird.
psychische und/oder physische Beeinträchtigung. Die
Überschneidungen sind vielschichtig und bündeln sich Der Weg zwischen strategischer und operativer Ebene
oftmals zu mehrfach benachteiligenden Lebenslagen. erscheint aus Sicht der „Servicestelle Prävention“
Aus der Ungleichheit ergeben sich Herausforderungen, in der kommunalen Praxis oft langwierig und häufig
die sich sämtlich in der kommunalen Lebenswirklichkeit auch als Einbahnstraße etabliert zu sein, in der Praxis
niederschlagen, ohne aber im Wirkungsfeld Kommune erfahrungen nicht immer hinreichend strategisch
umfassend bearbeitbar zu sein. Die Präventionsleitlinie reflektiert werden. Auch das Planen und Handeln mit
„Ungleiches ungleich behandeln“ erfasst diese Adressat*innen anstatt für Zielgruppen soll deutlicherFachliche Rahmung 7
Collective Impact/Gemeinsam Wirken Machtpromotor*innen treiben Veränderungs-
prozesse qua Amts- und Entscheidungskompetenz
Komplexe gesellschaftliche Probleme können nur aktiv voran. Um Innovationen durchzusetzen,
durch eine bereichsübergreifende Kooperation muss die Macht allerdings nicht ausgeübt werden,
all jener Akteure, die von ihnen tangiert sind, viel mehr ist allein die Möglichkeit ausreichend.
erfolgreich bearbeitet werden. Um ein entspre-
chendes gemeinsames Wirken zu erzielen, muss Fachpromotor*innen verfügen über das nötige
man dabei Fach- und Methodenwissen, um Innovationspro-
zesse intensiv zu fördern. Im Prozess entwickeln
eine gemeinsame Vision und Zielsetzung sie sich immer mehr zu Spezialist*innen und
erarbeiten, geben ihre Kenntnisse an die anderen Beteilig-
ten weiter, ihre hierarchische Position ist dabei
sich auf realistische und praxisnahe Wir- unerheblich.
kungsannahmen verständigen,
Quelle: vgl. Wienzek, T. (2014)
Maßnahmen so konzipieren, dass sich ihre
intendierten Effekte wechselseitig verstärken
und jeder Akteur seine besondere Stärke und
Expertise einbringen kann,
Für ein solches Vorhaben kann es keinen universellen
miteinander im transparenten Wirksamkeits- Masterplan geben, denn keine kommunal und so
dialog stehen und zialräumlich geprägte Lebenswirklichkeit ist wie die
andere. Jede Kommune hat auf institutioneller Ebene
das gemeinsame kommunale Handlungskon- ihre eigene Ausgangslage, Kultur der Zusammenarbeit
zept durch eine hauptamtliche, verbindliche und Ressourcenausstattung. Umso wichtiger ist es,
Koordinierung begleiten und absichern. einen verbindenden Orientierungsrahmen zur Verfü-
gung zu stellen, mit dem die Kommunen einzeln – und
Die Lokomotivfunktion von Fach- und gemeinsam im Lernnetzwerk – arbeiten können, um
Machtpromotor*innen ist bei der Umsetzung ihren individuellen Weg beim Aufbau der kommunalen
von großer Bedeutung. Gesamtstrategie mit den eingeschlagenen Routen
anderer Programmkommunen zu vergleichen.
Quelle: vgl. FSG/Bertelsmann Stiftung (2016)
Als zentrale Lesehilfe zur Nutzung des Qualitätsrah-
mens wird im ersten Teil das Konzept der Sinnfo-
kussierung als Charakteristikum für die Gestaltung
kommunaler Präventionsketten erläutert: Soll deren
Innovationskraft in den Routinen von Kommunalverwal-
tung und anderen beteiligten Institutionen dauerhaft
in den Fokus gestellt werden. Denn nur so kann das bestehen bleiben, muss man sich im Netzwerk fort-
Alltagswissen der von ungleichen Lebenslagen Betrof- während vergegenwärtigen und ggf. neu orientieren.
fenen hinreichend in die Maßnahmenplanungen ein- Welche Ziele wollte und will man eigentlich gemeinsam
fließen. Angebote und Maßnahmen werden so passge- erreichen? Und warum soll dies effizienter in Koope-
nauer und den Bedarfen der Adressat*innen gerechter. ration mit anderen gelingen? Im Qualitätskreislauf8 Fachliche Rahmung
selbst (zweiter Teil) werden zunächst die allgemeinen Praxisformen (und nichts anderes sind Präventions-
Präventionsleitlinien vorgestellt, die sich als primär- ketten) vornehmen: Demnach formen nicht Men-
präventive Hintergrundfolie auf die Präventionskette schen soziale Praxis, vielmehr werden Letztere als
als Ganzes beziehen. Aufbauend auf den Leitlinien wird „Partizipand*innen“ (vgl. Bollig/Kelle 2014) durch ihr
der Aufbau einer kommunalen Gesamtstrategie im Einbezogensein in diese Praxis erst in spezifischer
Detail beschrieben. Die vier Stationen formatieren den Weise zu Individuen geformt bzw. umgeformt. Und
Prozess des Auf- und Ausbaus von Präventionsketten deshalb ist es etwas grundlegend anderes, in defizito-
und bieten fachliche Orientierung für die inhaltliche rientierter Weise „Zielgruppen“ (z.B. Alleinerziehende,
Ausgestaltung. In einem dritten Teil wird dann das Mehrkindfamilien, Migrant*innen) zu definieren – und
Konzept der „Wissensbasierung“ als fachlich leitende für diese dann Angebote zu konzipieren – als sie als
Gesamtperspektive dargestellt. Adressat*innen zu verstehen, von deren artikulierten
Bedarfen her eben diese Angebote entwickelt werden.
Der so entstehende konzeptionelle Rahmen umfasst Je nachdem, wie diese Basisentscheidung (z.B. fach-
die Prozesslogik des Aufbaus kommunaler Präven planerisch) getroffen wird, bekommt man eine andere
tionsketten als eine aus Sicht der Qualitätsentwicklung soziale Wirklichkeit – im Sinne einer in Ko-Konstruktion
sinnvolle und auch notwendige Herangehensweise. von Institutionen und Betroffenen erzeugten Praxis-
form „Präventionskette“ – in den Blick.
Dazu ein Beispiel: Die von einer Architektin bei der
Planung eines sehr individuell gestalteten Hausbaus Zusätzlich zu dem hier vorgelegten Qualitätsrahmen
zu beachtende Prozesslogik umfasst zum Beispiel die findet sich ein detaillierteres Qualitätshandbuch, das
Prüfung der Tragfähigkeit des Untergrundes, die Konzi- Einzelthemen und Gestaltungsherausforderungen
pierung eines stabilen Fundaments und die Befolgung methodisch-fachlich vertiefend aufarbeitet und Ar-
der Gesetze der Statik; auch wird sie gewisse Leitlinien beitshilfen zur Umsetzung bereitstellt.
und Standards der Bauzeichnung berücksichtigen.
Vor allem aber wird sie die Koordination der Gesamt- Diese Qualitätsmaterialien der „Servicestelle Präven-
planung, das „Big Picture“, im Auge behalten müssen, tion“ leiten die landesweite Umsetzung des als erfolg-
denn niemand wird sie für ihre Arbeit entlohnen, wenn reich nachgewiesenen1 Aufbaus kommunaler Präven
sie zwar alle Standards und Normen befolgt hat, die tionsketten im Sinne einer Gesamtstrategieentwicklung
Gesamtplanung aber im wahrsten Sinne des Wortes in Nordrhein-Westfalen an.
„nicht tragfähig“ ist.
Beim Aufbau kommunaler Präventionsketten sind
es die hauptamtlichen Koordinator*innen, die als
Architekt*innen dieses „Big Picture“ vornehmlich im
Auge behalten müssen – auch wenn die Vorgaben vom
„Bauherren“ (kommunale Spitze, Steuerungsgruppe)
sowie aus dem Netzwerk kommen. An eben diese
Koordinationsfachkräfte richtet sich der vorliegende
1
Siehe externe Programm
Qualitätsrahmen daher an erster Stelle. Darüber hinaus
evaluation von Ramboll
soll er aber auch in den übergreifenden Fachdiskurs Management Consulting GmbH.
einfließen und Brücken zu wissenschaftlichen Debat- Online: www.kinderstark.nrw/
ten (sogenannte Praxistheorien) schlagen, die eine toolbox/publikationen
alltagspraktisch sehr ungewohnte Analyse sozialerFachliche Rahmung 9 Vom Zielgruppenansatz zum Einbezug von Adressat*innen Die Frage der Adressat*innenbeteiligung markiert Outcome und Impact zu artikulieren. Und sie können eine grundlegende Richtungsentscheidung in der dies kleinschrittig, z.B. schon während der Auswahl Gestaltung eines kommunalen Netzwerks. Ohne das von Angebotsschwerpunkten und -formaten sowie der kleinschrittige, an den einzelnen Prozessschritten Formulierung entsprechender Wirkungsannahmen von Angebotsplanung und -umsetzung orientierte tun. An diesen Rückmeldungen kann sich die Lern Einholen von Feedbacks der Adressat*innen sind kurve der gemeinsamen Optimierung dann ausrichten. die am Netzwerk beteiligten Institutionen bei der objektivierenden Definition von Zielgruppen auf die Damit verändert sich die Prozesslogik des Netzwerks, Einschätzung ihrer Fachkräfte sowie auf sozialstatis- weil sich dessen Erfolgskontrolle an einem anderen tische Analysen beschränkt. Feedback erhält man im Maßstab ausrichtet. Sozial konstruierte Zielgruppen Netzwerk dann nur voneinander bzw. über das Maß an sind keine Partizipand*innen der Präventionskette, (Nicht-)Inanspruchnahme, Outcome und Impact bei Adressat*innen sind dies durchaus. Zugleich defi- der Zielgruppenerreichung. Dieses Feedback bezieht niert das Präventionsnetzwerk als Ganzes, welcher sich immer auf fertig vorkonzipierte und durchgeführte Akteurstatus Letzteren dabei zugewiesen wird. In Angebote und Maßnahmen. Zur sozialen Realität des diesem spezifischen Sinne wird im Weiteren der Begriff Netzwerks gehört lediglich das verwendete Zielgrup- „Adressat*innen“ verwendet. penkonzept und darauf bezogene Wirkungsannahmen – als Akteur im Netzwerk tritt die Zielgruppe dabei aber dann nicht auf. Werden die Menschen, um die es geht, hingegen als Adressat*innen in die Gestaltung des Netzwerks einbezogen, so werden sie auch in die Lage versetzt, sich selbst zu Gründen von (Nicht-)Inanspruchnahme,
10 Sinnfokussierung
SINNFOKUSSIERUNG
Das Ziel, dass alle Kinder und Jugendlichen in Nordrhein- das WIE (› HOW) und das WAS (› WHAT). Ein jedes
Westfalen in einer gesunden sowie lernförderlichen Vorhaben soll demnach nicht mit den Überlegungen
Umgebung aufwachsen sollten, ist unumstritten. Es zum Ergebnis, zum Produkt oder zu einer konkreten
bleibt aber die Frage, weshalb dieses anspruchsvolle Handlung beginnen, sondern mit jener inneren Über-
Vorhaben mit dem Präventionskettenansatz auf der zeugung und Motivation, die überhaupt erst legitimiert
Ebene der Kommunalverwaltungen angegangen wer- und motiviert, dass etwas getan wird. Erst im zweiten
den sollte. Diese Frage wird nachfolgend anhand des Schritt wird dann erarbeitet, wie was umgesetzt und
„Golden-Circle“-Modells von Simon Sinek beantwortet. implementiert werden kann, um etwas zu erschaffen,
das dem fokussierten Sinn entspricht.
Simon Sinek entwickelte 2009 den „Golden Circle”, der
besagt, dass jeder Mensch, jeder Konzern, jedes Pro- Im Folgenden werden die drei Ebenen des „Golden
jekt erfolgreicher ist, wenn am Beginn eine Überzeu- Circle“ der Präventionskette im Detail erläutert, um die
gung, ein höherer Sinn, eine Vision steht. Diese Wurzel Sinnfokussierung der Gesamtstrategie zu verdeutlichen.
der Leidenschaft und Inspiration nennt er das WARUM
bzw. WOFÜR (› WHY). Erst aus dem WHY entstehen
Sinnfokussierte Strukturierung
Eine sinnfokussierte Strukturierung kommunaler
Präventionsketten zeichnet sich im Anschluss an
dieses Modell dadurch aus, dass sie
das Warum und Wofür (› WHY) des gemein-
WHAT? samen Handelns grundwertorientiert beant-
wortet: „Ein kinder- und familienfreundliches
Gemeinwesen sein zu wollen, prägt uns als
HOW? Kommune“;
das Wie (› HOW) am Modell der „lernenden
Organisation“ (Senge 2011) in Kategorien von
WHY?
Qualitätsentwicklung orientiert: „Über
getrennte Zuständigkeiten und Organisa
tionsinteressen hinaus wollen wir gemeinsam
besser werden“; und
das Was (› WHAT), also die Entwicklung kon-
kreter Netzwerkstrukturen und Maßnahmen,
wissensbasiert ausrichtet: „Das vorhandene,
verteilte Wissen bündeln wir, um unsere ge-
meinsamen Ziele zu erreichen.“
Literaturtipp: Sinek/Mead/Docker (2019)Sinnfokussierung 11
»WHY?« – KOMMUNALE DASEINSVORSORGE
ALS GEMEINGUT
„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen“ – Commons
mit diesem Sprichwort wird häufig auf die Bedeutung
des Gemeinwesens für gelingendes Aufwachsen ver- Der angelsächsische Fachbegriff wird im Deut-
wiesen. Ungeachtet der die Dorfgemeinschaft unge- schen häufig als „Gemeingut“ oder „Gemein-
rechtfertigt romantisierenden Anklänge überschneiden schaftseigentum“ übersetzt. Als Commoning
sich dabei mehrere Bedeutungsebenen, und zwar die bezeichnet er den Prozess der Erzeugung von
Betonung der Rolle als „Gemeingütern“ geltenden Produkten.
Man lenkt den Blick dabei auf Nutzungs- und
kommunaler Daseinsvorsorge im Grundverständnis Zugangsregeln zu eben diesen Produkten und
von Kommune als einem über die Kommunalverwal- Dienstleistungen. Durch Gebührenerhebung für
tung hinausreichenden Gemeinwesen, die Nutzung von Allgemeingütern können diese
zur Ware werden (z.B. Maut für die Straßennut-
der gemeinschaftlich getragenen Verantwortung im zung). Andersherum kann der Warencharakter
Sinne einer kinder- und familienfreundlichen Gesell- auch (eingeschränkt) aufgehoben werden (z.B.
schaft, Lernmittelfreiheit, kostenloser Kitazugang).
eines bereichsübergreifenden und multiprofessio- Literaturtipp: Helfrich/Heinrich-Böll-Stiftung
nellen Handelns und (Hrsg.) (2014). Freier Volltextzugang unter:
www.transcript-verlag.de/978-3-8376-2835-7/
der subjektorientierten Perspektive auf die Einma- commons/
ligkeit und Unverwechselbarkeit eines jeden Kindes.
Nicht ganz unproblematisch ist dabei die Dorf
metapher: Gemeinschaftsaufgaben und die damit
zusammenhängende Produktion von Gemeingütern für alle sowie die umfängliche Gestaltung anregender
(„Commons“) stellen nämlich permanente Herausfor- Lern- und Lebensumgebungen im Nahraum der Men-
derungen für moderne Gesellschaften dar, sind also schen voranbringen. Damit wird die Präventionskette
keineswegs ein Überbleibsel in einer im Kern markt- zum „Common“ – und das adressat*innenorientierte
und profitorientierten Gesellschaftsordnung. Gerade Netzwerken in ihr zum „Commoning“. Auch zwischen
Erziehung ist das Musterbeispiel für ein Handlungsfeld, den an der Präventionskette beteiligten Institutionen
das sich nicht markt- und organisationsförmigen Hand- und Organisationen sucht man nicht nur nach einer
lungslogiken unterordnen lässt, sondern die Gemein- Win/Win-Situation im Sinne der interinstitutionellen
schaft (vor allem im Familienkontext) voraussetzt. Die Schnittstellenoptimierung, sondern versucht, gemein-
institutionell fokussierte Gestaltung kommunaler Prä- sam vom Kind her zu denken und die jeweiligen Res-
ventionsketten sollte diese zentrale Funktion lebens- sourcen entsprechend zu bündeln. Schon der gemein-
und alltagsweltlich fundierter Gemeinschaften immer same ernsthafte Versuch, sich diesem Ziel anzunähern,
im Blick behalten, da sonst eine wesentliche Quelle von irritiert dabei sehr stark das eingeschliffene Denken
Chancenungleichheit – aber auch eine zentrale Res- in getrennten Zuständigkeiten und die vorrangige
source zu deren Abbau – aus dem Blick geraten kann. Orientierung auf den Vorteil der eigenen Organisation,
Einrichtung oder Verwaltungseinheit.
Unter Leitbegriffen wie Primär- und Verhältnispräven-
tion will man bei der Gestaltung kommunaler Präven- In der Präventionskette sollten daher Gemeinschaf-
tionsketten niedrigschwellige Zugänge zu Angeboten ten wie Familien, Peer Groups, Communities etc. die12 Sinnfokussierung
pädagogisch inszenierten Settings stützen. Dafür ist es Möglichkeit nicht rein additiv zu diesen hinzugefügt
wichtig, dass Angebote und Maßnahmen werden. Kommunale Präventionsketten eignen sich
dazu, diese verhältnispräventive Gestaltungsperspek-
möglichst stigmatisierungsfrei im Kontext gemein- tive aufzunehmen. Denn auf dieser Ebene braucht man
samen Lebens und Lernens, in der Tat das „ganze Dorf“, um Rahmenbedingungen
gelingenden Aufwachsens zu gestalten und zu verbes-
vorrangig primärpräventiv mit Zugang für alle sern. Dies macht einen wesentlichen Teil des Sinns (des
Kinder, Jugendlichen und Familien, › WHY) der kommunalen Netzwerkbildung zur Gestal-
tung der kommunalen Gesamtstrategie aus.
mit dem Schwerpunkt Verhältnisprävention sowie
Das Wirkungsfeld Kommune eignet sich besonders
beteiligungsorientiert und wertschätzend gut, um Verhältnisprävention systematisch, kleinräu-
mig gestaffelt und einrichtungsnah umzusetzen. Im
in diese Gemeinschaften eingebettet werden. Er- Unterschied zu häufig bereits sozial stark entmischten
schwert wird dies mitunter durch hohe Zugangsvor- Quartieren und Einrichtungen sind die Ressourcen der
aussetzungen zu den Angeboten. Diese können dann Gesamtkommune in der Regel groß genug, um der
(ungewollt) zu sozialen Sortier- und Stigmatisierungs fachlichen Leitlinie „Ungleiches ungleich behandeln“
effekten führen und Teilhabe verhindern (z.B. teure folgen zu können. Kommunen verfügen zudem in der
Schulausflüge; ungünstige Angebotszeiten; das Sicht- Regel über präventionsrelevante Infrastrukturen und
barwerden von Kostenbefreiungen; Beschaffungskos- Helfersysteme (z.B. alle weiterführenden Schulstufen;
ten für Equipment und Instrumente bei sportlichen und pädiatrische Praxen). Außerdem erlaubt die einzel
musisch-kulturellen Aktivitäten). kommunale Ebene einen fachplanerischen Überblick
über konkrete Lebenslagen, Ausgangs- und Problem-
Es ist schwer, in einer vorwiegend verhaltens konstellationen.
präventiven, am einzelnen Kind ansetzenden Pers-
pektive diese Zugangsbarrieren vollständig zu vermei- Welche Voraussetzungen und Gelingensbedingungen
den. Hilfreich ist es daher, wenn solche Barrieren im lassen sich im Sinne der weiter oben ausgeführten Pro-
vertrauensvollen Zusammenspiel von Eltern, Kindern zesslogik benennen, um kommunale Präventionsketten
und Fachkräften schon im Vorfeld beseitigt und als Gemeingut zu verankern? Zunächst muss dafür das
entsprechende Unterstützungsmöglichkeiten (z.B. Gemeinwesen versammelt werden und sich zu diesem
im Kontext „Bildungs- und Teilhabepaket“) stigmati- gemeinsamen Vorhaben bekennen. Neben der Ver-
sierungsfrei zugänglich gemacht werden. Kommunale waltungsspitze, den präventionsrelevanten Bereichen
Präventionsketten gehen daher einen anderen, stärker der Kommunalverwaltung und Repräsentant*innen
verhältnispräventiv ausgerichteten Weg. Dabei folgt aus Zivilgesellschaft, Schulaufsicht und weiteren
man einer Strategie der Kontextbeeinflussung, deren Akteuren, wie z.B. aus Wirtschaft, Sport und Kultur,
Potenziale bislang bei Weitem nicht ausgeschöpft sind: braucht es dafür auch das konkrete Fachkräftewis-
Anstatt unmittelbar auf das individuelle Verhalten der sen. Ein wichtiges künftiges Entwicklungsfeld ist die
Adressat*innen einzuwirken, verändert man relevante systematische und zielführende Einbeziehung der
Umfeldbedingungen, um anregende Lern- und Le- Adressat*innenperspektiven, sei es im Rahmen
bensumgebungen zu schaffen und so indirekt auf das direkter Beteiligung bei der Entwicklung von Ange-
Verhalten einzuwirken. So sollten neue Angebote und boten, der Quartiersgestaltung sowie bei themen
Strukturen systematisch mit Regeleinrichtungen, relevanten Planungsvorhaben oder auch in der Form
Quartieren und Netzwerken verknüpft und nach des Einbezugs zivilgesellschaftlicher OrganisationenSinnfokussierung 13 und Interessenvertretungen (z.B. Eltern-/ Heterogen zusammengesetzte Versammlungen Schüler*innenvertretungen, Vereine, Kinder- und können sich nur dann auf eine kommunale Agenda ver- Jugendgremien, Migrant*innenselbstorganisationen). ständigen und diese über einen längeren Zeitraum mit Wo dies nicht möglich oder zielführend erscheint, Engagement verfolgen, wenn sie sich dafür auf einen sollten Adressat*innenperspektiven zumindest durch gemeinsamen, handlungsleitenden Sinn fokussieren. entsprechende Befragungen und Bedarfsermittlungen Unabhängig vom konkreten Inhalt muss eine Vertrau- in den Blick geraten. Weniger zielführend ist es, in ensbasis entstehen und die Idee eines kommunalen Planungsämtern und Gremien auf der Basis (klein- Gemeinwesens und einer kommunalen Daseinsvorsor- räumiger) sozialstatistischer Analysen von objektiven ge als gemeinsamer Aufgabe lebendig sein. Risikolagen direkt auf daraus vermeintlich resultierende subjektive Belastungssituationen der Betroffenen zu schließen.
14 Sinnfokussierung
»HOW?« – DIE PRÄVENTIONSKETTE ALS
GESTALTUNGSANSATZ
Ist die grundlegende Entscheidung gefallen, im Sinne benendifferenzierung in der Präventions-
E
einer kommunalen Gesamtstrategie die kommunale kette: In den strategisch als prioritär ausgewählten
Präventionskette als Gemeingut zu etablieren, dann Gebietskulissen, Altersgruppen und Schwer-
gilt es diese mit dem notwendigen „Equipment“ aus- punktthemen muss sichergestellt werden, dass
zurüsten. Dieses umfasst mindestens die folgenden präventionsrelevante Maßnahmen passgenau und
Elemente: beteiligungsorientiert aufeinander abgestimmt
sind und weiterentwickelt werden. Es sind also
Hauptamtliche Koordinierung: Das sehr an- auch wiederum auf diesen konkreteren, operativen
spruchsvolle Aufgabenspektrum und -profil erfor- Handlungsebenen Strukturen und Verfahrensschrit-
dert eine Personalressource von mindestens einer te zu etablieren, die eine träger- und bereichsüber-
Vollzeitstelle. greifende Gleichsinnigkeit der Angebotsentwicklung
ermöglichen, um so ein gemeinsames Wirken zu
teuerungsstruktur: Ein hochrangig besetztes
S ermöglichen. Wesentlich sind die Vernetzung und
Steuerungsgremium auf mindestens Amtsleitungs- die enge Kommunikation zwischen strategischen
und Fachplanungsebene bietet die Voraussetzung und operativen Handlungsebenen in beide Richtun-
für eine verwaltungsbereichs- und ggf. auch träger- gen („Gegenstromprinzip").
übergreifende Zusammenarbeit auf allen nachge-
ordneten Ebenen der Linienorganisation sowie eine Während am › HOW der Umsetzung des Präven
zielführende Kommunikation und Vertretung des tionskettenansatzes gearbeitet wird, darf das › WHY,
fokussierten Sinns auf höheren Ebenen. Die Steue- also der Sinn und Zweck, nicht aus den Augen verloren
rungsstruktur ist strategischer Teil eines umfassen- werden. Daher ist es wichtig, dass die hauptamtliche
den Netzwerks, das in geteilter Verantwortung am Koordinierung dafür Sorge trägt, dass sich das Netz-
gemeinsamen Sinn des Vorhabens arbeitet. werk immer wieder auf die Gemeingutorientierung
fokussiert und sich bewusst bleibt, dass das Ziel nur
Ablauforganisation und verbindliches Projekt- gemeinschaftlich und sinnfokussiert erreicht werden
management: Die bereichsübergreifende Zusam- kann. Schnell verselbstständigen sich die Aktivitäten
menarbeit muss sich auf eine Beschlusslage (z.B. zu einem auf Verwaltungs- und Organisationslogiken
des Verwaltungsvorstands und der zuständigen fixierten Ansatz der ämterübergreifenden und inter
Ausschüsse) stützen können: Leitbilderstellung, institutionellen Schnittstellenoptimierung.
Ausarbeitung von Zielkaskaden und Optimierung
der Datengewinnungsstrategien zur Ermöglichung Eine gute Möglichkeit, diesen Ansatz zu erweitern,
wissensbasierten Handelns sind dann Schritte zur besteht darin, Fachkräfte, Eltern, Kinder und Jugendli-
Erarbeitung einer kommunalen Gesamtstrategie. che angemessen und strukturbildend zu beteiligen, also
keine starre „Systemgrenze“ zwischen Institutionen und
ormate und Tools zur Erarbeitung einer kom-
F Adressat*innen entstehen zu lassen bzw. fortzuschrei-
munalen Gesamtstrategie: Das Spektrum reicht ben. Wie bereits erwähnt, ist diese direkte Beteiligung
von Veranstaltungsformaten (Auftakt-, Zwischen auf der gesamtstrategischen Ebene nicht immer mög-
bilanzworkshop etc.) über IT-Tools zur verwaltungs- lich (bzw. häufig eher durch den Einbezug von Ergeb-
übergreifenden Datennutzung (z.B. einheitliches nissen aus Adressat*innenbefragungen als durch die
Geoinformationssystem) bis zu Apps zur (nutzer- direkte Interaktion), im stärker operativen Bereich wird
freundlichen und planungskompatiblen) Erfassung sie dann aber zur Gelingensbedingung, insbesondere
und Reflexion des Angebotsspektrums. mit Blick auf eine verstärkte Wirkungsorientierung.Sinnfokussierung 15
Handlungsfelder sind: (Kleinräumig gestaffelte) Vernetzung von Einrich-
tungen und Helfersystemen im Sinne des Aufbaus
Weiterentwicklung von Regeleinrichtungen (z.B. von Präventionsketten und Bildungslandschaften.
Kitas, Familienzentren und Schulen) mit den
Schwerpunkten Die Prozesslogik zur Weiterentwicklung der kommunalen
Gesamtstrategie kann dann im Rahmen des Qualitäts-
Stärkung lebensweltbezogener, beteiligungs managements als Qualitätskreislauf immer wieder
orientiert zu entwickelnder Aktivitäten der Kinder durchlaufen werden. In der Praxis umfasst dies (zumin-
und Jugendlichen (z.B. im Ganztag) dest zu Beginn) häufig auch Parallelaktivitäten an den
einzelnen Stationen des Qualitätskreislaufs. Die Prozess-
Verankerung fachlicher Präventionsperspektiven logik übersetzt sich also nicht zwingend in ein chronologi-
direkt in der (pädagogischen) Grundversorgung sches Durchlaufen der einzelnen Stationen. Dabei werden
(z.B. durch gezielte didaktische Förderung per- zunächst die als relevant gesetzten kommunalen Akteure
sonaler und sozialer Kompetenzentwicklung im
Schulunterricht) zur Fixierung eines Leitbilds (Station 1) und
Vernetzung und Bündelung in der Einrichtung be- einer Steuerung und Zielentwicklung zur Gestal-
reits vorhandener Helfersysteme (z.B. Schul- und tung der Präventionskette (Station 2) versammelt,
Kita-Sozialarbeit, Personal im Ganztag, Integra um den so gewonnenen strategischen Bezugsrah-
tionshelfer*innen) men dann
Intensivierung und Einbindung primär verhält- auf die realen Handlungsmöglichkeiten und
nispräventiv ausgerichteter Angebote und Maß- entsprechende Wirkungsannahmen im kommu-
nahmen im Bereich Gesundheitsförderung nalen Gemeinwesen hin zu konkretisieren und ein
entsprechendes kommunales Handlungskonzept
Quartiersentwicklung als umzusetzen (Station 3), um schließlich
Schaffung von Ankerpunkten im Nahraum mit die aufgestellten Wirkungsannahmen so engma-
Unterstützungsangeboten auch für Eltern (z.B. schig wie möglich auf sachliche Angemessenheit
Familienbüros, Familienzentren) und Erfüllungsgrad hin zu analysieren, um den
Gesamtansatz daraufhin zu reflektieren und ggf.
Etablierung von Clearing- und Lotsensystemen neu auszurichten bzw. anzupassen (Station 4).
zur passgenauen Bedarfsermittlung und be-
reichsübergreifenden Weitervermittlung inner- Diese umfassende Wissensbasierung transformiert
halb der Präventionskette den eher konventionellen Ansatz des Qualitätsmanage-
ments in einen Institutions- und Organisationsgrenzen
Einbindung offener Angebote und Einrichtungen überschreitenden, innovativen Netzwerkansatz. Man
der Jugendarbeit, von Vereinsaktivitäten und konzentriert sich dabei im Netzwerk nicht auf sich
bürgerschaftlichem Engagement selbst, sondern darauf, gemeinsam „vom Kind her zu
denken“. Eine der wichtigsten Entwicklungsherausfor-
enge Verknüpfung pädagogisch und gesundheits- derungen ist es dabei, Kinder und Jugendliche selbst
fördernd ausgerichteter Aktivitäten mit der Stadt- altersgemäß an allen sie betreffenden Angelegenheiten
und Raumplanung zu beteiligen.16 Sinnfokussierung
»WHAT?« – FORMATE DER KOMMUNALEN
HANDLUNGSSTRATEGIE
Aufbauend auf dem Sinn der kommunalen Präven uftakt- und Zwischenbilanz-Workshops: Die
A
tionskette, geht es im › WHAT um die sinnfokussierte kommunalen Entscheidungsträger*innen versam-
Erstellung einer kommunalen Handlungsstrategie. meln sich in Abstimmung mit der hauptamtlichen
Dies bedeutet zum einen, dass in jedem Umsetzungs- Koordination als relevant gesetzten Akteure der
schritt die gemeinsame Bindung („Commitment“) der strategischen Ebene zu einem Kreativprozess, um
beteiligten Akteure an die Leitorientierung der Förde- eine gemeinsame Trägerschaft zur Gestaltung der
rung gelingenden Aufwachsens sichtbar bleibt. Und es Präventionskette zu erarbeiten bzw. zu erneuern.
bedeutet zum anderen, das verteilte (implizite) „Wissen In den dazu durchzuführenden Workshops werden
im System“ zielführend zu objektivieren und zusam- strukturelle wie auch inhaltliche Rahmensetzungen
menzubringen. Alle Gremien (z.B. Steuerungs- und zur Entfaltung bzw. Weiterentwicklung der Ge-
Arbeitsgruppen), Funktionsstellen (z.B. hauptamtliche samtstrategie erarbeitet.
Koordination), Veranstaltungsformate und Tools (z.B.
Geoinformationssysteme, Präventionsmonitoring, El- Gremienentwicklung und Beschlusslage:
ternsuchmaschinen für Angebote) sollten so gestaltet Die konkrete Umsetzung der Gesamtstrategie im
und dialogisch eingebunden sein, dass der zusammen- Sinne einer entsprechenden Aufbau- und Ablauf
führende Blick auf das Ganze erhalten bleibt. organisation muss durch die Herbeiführung von
Rollenklarheit für alle Akteure und (Entscheidungs-)
Gremien begleitet sein. Dabei empfehlen sich Me-
thoden des agilen Managements, in deren Rahmen
sich Selbstbeauftragung und Zuständigkeitsrege-
lungen für die Akteure nachvollziehbar miteinander
Commitment explizieren und vereinbaren lassen. Dies kann z.B.
in eine Visualisierung der konkreten Steuerungs-,
Als Commitment bezeichnet man (im Kontext Koordinierungs- und Arbeitsstrukturen überführt
der Präventionsketten) werden, die für alle Akteure (selbst-)bindend ist.
die freiwillige Selbstbindung von Personen an Planung:
eine Organisation oder ein Netzwerk, Das Herunterbrechen der allgemeinen Leitbild-
und Zielorientierung auf die konkreten Handlungs-
eine dort getroffene gemeinsame Vereinbarung möglichkeiten im kommunalen Gemeinwesen erfor-
(z.B. in Form eines Leitbilds) sowie dert reflexive Planungsformate, sowohl hinsichtlich
eines gesamtkommunalen Rahmenplans als auch
die in diesen Kontexten per Selbstbeauftra- bezüglich seiner Spiegelung auf die eher operativen
gung übernommenen Verpflichtungen, Rollen Ebenen (kleinräumige bzw. themen- und alters-
und Aufgaben. gruppen bezogenene Handlungsebenen):
Diese Bindewirkung kann sich als emotionale Für den Einsatz kleinräumiger Visualisierungen
Identifikation, normative Übereinstimmung mit von Lebenslagen (umgesetzt per Geoinforma-
dem Organisationszweck und/oder als rationales tionssystem oder durch Stadtkarten im Be-
Kalkül ausdrücken, insofern ein Verlassen der richtswesen) bedeutet dies, dass man sich der
Organisation oder des Netzwerks zu hohe Trans- Funktion des Wissens bewusst ist, das damit er-
aktionskosten mit sich brächte. zeugt wird: eines Wissens, das für die empirische
Analyse ungleicher Lebens- und BelastungslagenSinnfokussierung 17
genutzt werden kann, nicht aber als Instru- Agilität
ment zur Wirkungsmessung präventiver Ak-
tivitäten taugt. Dieses Wissen muss dann in Mit „Agilität“ wird eine netzwerkförmige Orga-
dialogische Formate mit Fachkräften und ggf. nisationsgestaltung bezeichnet, die vor allem
Adressat*innengruppen eingebunden werden: bei sehr dynamischen Organisationsumwelten
„Was sehen wir hier? Wie sind diese Befunde zu (z.B. Märkten) mit dem prioritären Ziel einer
verstehen?“ – Objektive Daten weisen auf priori- Ausrichtung an den Kundenwünschen eingesetzt
täre Handlungsbedarfe hin, erklären aber nicht, wird. Ein agiles Management erfordert von den
was diesbezüglich zu tun ist. Entscheidungsträger*innen einen wertschätzen-
den Kommunikationsstil sowie eine Ausrichtung
Konkrete Handlungskonzepte (z.B. im Quartier) der Ablauforganisation an beteiligungsorientier-
sollten in einer Weise mit Einrichtungen, Fachkräf- ten, kurzen Feedbackschleifen und kurzfristigen
ten und Adressat*innen erarbeitet werden, dass (Teil-)Ergebnissen. Man erstellt also nicht „ins
man nicht nur deren Expertise nutzt, sondern zu- Leere hinein“ ein fertiges Produkt, sondern ver-
gleich auch aktivierende Beteiligungsformate gewissert sich in wiederholten, sich schrittweise
schafft. Sie alle sind nicht nur „Informant*innen“ annähernden Prozess- und Kommunikations-
zum Zwecke der fachplanerischen Bedarfsermitt- schritten der kundenorientierten Passgenauigkeit
lung, sondern auch Umsetzungsakteure – und des eingeschlagenen Wegs.
auch von vorneherein in dieser Funktion zu adres- Agilität und klassisches Qualitätsmanagement
sieren. stehen in hierarchieorientierten Organisationen
wie der Kommunalverwaltung derzeit noch weit-
Wichtig ist die zielführende Zusammenarbeit gehend unverbunden nebeneinander. In Präven-
aller kommunalen Detailplanungsprozesse (z.B. tionsketten drückt sich dies als Spannungsver-
Jugendhilfe-, Bildungs-, Schulentwicklungs-, hältnis von (verwaltungs- und trägerbezogenen)
Sozial- und Stadtplanung), etwa im Rahmen Linienorganisationen und kommunal koordinier-
regelmäßiger Fachplanungskonferenzen ten Netzwerken aus.
auf der Basisämter- und bereichsübergreifend
kompatibel aufbereiteter Planungsdaten. Weiterführende Information: https://www.
haufe.de/personal/hr-management/agilitaet/
rfolgskontrolle: Um dies bei Planung und Umset-
E definition-agilitaet-als-hoechste-form-der-anpas-
zung zu gewährleisten, braucht es prozessbeglei- sungsfaehigkeit_80_378520.html (letzter Abruf:
tende Rückmeldesysteme, etwa durch Formate wie 15.08.2019)
Wirksamkeitsdialoge, kommunale Qualitätszirkel
oder auch Sozialraumkonferenzen.
Lernende Organisation: Im Rahmen eines jeg- einbeziehenden vertrauensvollen Arbeitsbündnis
lichen Qualitätsmanagements geht es darum, Rück- auch Misserfolge kommuniziert werden können,
meldungen zur Erfolgskontrolle nach der Maßgabe ohne deshalb um die Ressourcenausstattung
„Gemeinsam besser werden“ einzusetzen. Wichtig fürchten zu müssen. Lernprozesse und Optimie-
ist also nicht nur die Erfolgskontrolle selbst, son- rungen innerhalb der Präventionskette können nur
dern ebenso deren zielführende und sinnkonkreti- durch einen offenen Umgang mit Fehlern und die
sierende Kommunikation im Netzwerk. Dies ist nur Möglichkeit, auch (partielle) Fehlschläge zu kom-
möglich, wenn in einem Fach- und Finanzcontrolling munizieren, gelingen.18 Sinnfokussierung
Charakteristisch und innovativ wird das › WHAT der hierarchischer Beauftragung und netzwerkförmig-
Präventionskettengestaltung dadurch, dass jedes konsensualer Selbstbeauftragung abhängig. Diese
Format zur partizipativen und reflexiven Bündelung des doppelte Verortung von Rollen im Spannungsfeld von
im jeweiligen System bislang nur verteilt vorhandenen getrennter Zuständigkeit und gemeinsamer Verant-
Wissens beiträgt. wortung ist für die Akteure durchaus anspruchsvoll.
So gehört es z.B. zu den Aufgaben der hauptamtlichen
Mit der die Leitbild- und Zielentwicklung mitumfassen- Koordination, dafür Sorge zu tragen, dass alle zur Ent-
den Dimension des Versammelns, der Ausrüstung der wicklung und Umsetzung der Gesamtstrategie erfor-
Präventionskette im Sinne der Etablierung einer derlichen Aufgaben und Rollen auch wahrgenommen
verbindlichen Aufbau- und Ablauforganisation sowie werden. Dieses „Wächteramt“ muss ihr dazu auch von
der reflexiven, möglichst kleinschrittigen Überprüfung hierarchiehöheren Akteuren (etwa den Mitgliedern des
des Handlungserfolgs sind die Grundzüge einer quali- Steuerungsgremiums) zugestanden werden. Umge-
tätsorientierten Prozesslogik skizziert. kehrt sollten die Mitglieder des Steuerungsgremiums
als Mitglieder des Netzwerks der Handlungslogik der
Deren Maß an Sinnfokussierung wiederum ist von Selbstbeauftragung folgen. Die hochrangig aufgestellte
einem Wechselspiel zwischen zuständigkeitsorientiert- strategische Steuerung ist auch deshalb so wichtig,
Lernende Organisation
emeinsame Vision: Gelingt es, an persönliche
G
Lernende Organisationen basieren auf fünf Prinzipien: Visionen zusammenwirkend anzuknüpfen, um
etwas Gemeinsames zu schaffen, so entstehen
Individuelles Wachstum: Die Fach- und Führungs- dadurch neue Denkweisen und persönliches
kräfte zeichnet es aus, über eine persönliche Vision Commitment mit der Organisation.
zu verfügen und allgemeine Maßstäbe persönlicher
Reife wie Mitgefühl, Verbundenheit mit der Welt, Lernen im Team: Anknüpfend an die gemeinsame
Integration von Intuition und Vernunft sowie die Vision kann in moderierten Teamprozessen eine
Nutzung unterbewusster Prozesse einzulösen. gemeinsame Ausrichtung entstehen, die das Team
Diese persönlichen Qualitäten gelten als Selbst- zu mehr als der Summe seiner Mitglieder macht.
zweck, der Nutzen für die Organisation gilt als
abgeleitet. enken in Systemen: Eine systemische Orientie-
D
rung kann Problemlösungen und Wirkungsan-
Mentale Modelle: Grundannahmen über Leben nahmen generieren, die sich nicht in Teufelskreis-
und Arbeiten prägen individuelles Handeln und Handlungslogiken wie z.B. „Mehr vom Selben“
Selbstwirksamkeitserleben. Es ist wichtig, diese verfangen.
Kernüberzeugungen kritisch zu reflektieren und
sich ihrer Relativität und Bedingtheit bewusst zu Um eine lernende Organisation zu schaffen, müssen
werden, um Lernen zu befördern. Führungskräfte immer alle fünf Disziplinen im Gesamtzusammenhang
müssen diese Reflexion vorleben und Mitarbeiten- umgesetzt werden.
den entsprechende Räume eröffnen und Reflexions
prozesse ermutigen. Literatur: Senge (2017)Sinnfokussierung 19
weil diese Dynamik der Selbstbeauftragung von der (z.B. Sozialpädagogik, Kinder- und Jugendärzt*innen)
Amtshierarchie – bis hin zum Verwaltungsvorstand – sowie Ressourcen der beteiligten Akteure erheblich
legitimiert sein muss. Wie sich diese Ambivalenz von voneinander. Brücken der Verständigung müssen
amtshierarchiebezogener Beauftragung und Selbst- daher auf ein gemeinsames Drittes zwischen den
beauftragung optimal austarieren lässt, muss vor Ort Akteuren bezogen werden – in diesem Fall also den
passgenau erprobt und ausgehandelt werden; dafür oben erläuterten Aufbau der örtlichen Gesamtstrategie
gibt es kein allgemeingültiges strukturelles und/oder als Gemeingut. Dafür sollten Präventionsketten als
funktionales Modell. kulturelles Projekt betrachtet werden, das als zentrales
Element zur Schaffung eines kinder- und familien-
Ganz generell gehört die Bewältigung von Ambivalen- freundlicheren kommunalen Gemeinwesens fungiert.
zen und Paradoxien zu den großen Herausforderungen
beim Aufbau kommunaler Präventionsketten. Neben
dem soeben Genannten unterscheiden sich auch
die jeweiligen institutionellen Handlungslogiken (z.B.
Jugendhilfe, Schule, Jobcenter), Einzelinteressen (z.B.
freie und öffentliche Träger), Professionshintergründe20 Sinnfokussierung
DIE BASIS DES QUALITÄTSRAHMENS
Wissensbasierung und Sinnfokussierung ergänzen zum Beispiel sozialstatistische Analysen ohne erfah-
einander und bilden die Basis des Qualitätsrahmens. rungsbasierte Interpretation wenig wert. Durch eine
intelligente Kombination dieser Wissensformen lassen
Nur durch einen gemeinsam sich derartige Fehlschlüsse häufig vermeiden.
fokussierten Sinn wird deutlich,
Mit dem Begriff „Wirkungsorientierung“ soll ausge-
welche Wissensbestände überhaupt drückt werden, dass sich das Handeln immer wieder
anhand von Rückmeldungen zu wahrgenommenen
relevant und wie aufeinander zu Handlungsfolgen neu orientiert. So werden Anpas-
beziehen sind. sung und Lernen möglich. Diese Rückmeldekreisläufe
(Feedbackschleifen) werden allerdings immer dann
Neben dem Einbezug von Betroffenenperspektiven unterbrochen,
(z.B. zum Zweck der Bedarfsermittlung) geht es dabei
insbesondere um die Verknüpfung von Fachkräfte- wenn Ereignisse nicht mehr als konkrete Hand-
perspektiven und quantitativen Daten, wie sie etwa lungsfolgen erkennbar sind, weil die Handelnden
durch Sozialstatistiken geliefert oder auch in Sozial- den Gesamtzusammenhang aufgrund der
raumanalysen eigens erhoben werden. Voneinander Komplexität des Geschehens nicht mehr durch-
isoliert betrachtet können beide Wissensformen in die schauen oder
Irre führen!
sich (wie etwa im Fall der Primärprävention) die
Auf der einen Seite ist Fachkräftewissen wichtig, aber Abfolge von Handlungsursache und erzielter
keineswegs unfehlbar, was auch für die Fachkräf- Wirkung zeitlich zu weit auseinanderzieht;
tewahrnehmung statistischer Analysen gilt. Selbst
erfahrene Fachkräfte können durch Sozialstatistiken umgekehrt lassen sich auch Ereignisse kausal als
überrascht werden und diese in ihr Praxiswissen „Handlungsfolgen“ zurechnen, die in Wirklichkeit
integrieren. Auf der anderen Seite sind auch Statistiken ganz anders verursacht sind und nur zufällig zeitlich
allein nicht aussagekräftig genug. Statistische Daten mit der vermeintlichen Handlungsursache koinzi-
können auf den ersten Blick z.B. nahelegen, dass das dieren oder aber gemeinsam mit dieser auf einen
gemessene Merkmal „Migrationshintergrund“ Armut anderen, dritten Faktor zurückzuführen sind.
und Bildungsbenachteiligung erkläre, und dafür dann
vorschnell „kulturelle Differenzen“ verantwortlich Je komplexer diese Gesamtkonstellationen sind – und
machen. Bei näherer sozialstatistischer Analyse und im Fall der „Verursachung“ von Kinderarmut sind sie
durch vertiefende wissenschaftliche Studien kann aber sehr komplex –, desto stärker schlägt dieser Zurech-
gezeigt werden, dass der Effekt auf die sozioökono- nungsfehler zu Buche.
mische Lage zurückzuführen ist – und Menschen mit
Migrationshintergrund, die der Mittelschicht angehö- Mit dem Konzept des wissensbasierten Handelns wird
ren, ungeachtet ihrer „Herkunft“, diese Probleme nicht ein Neuansatz gewählt, der diesen Zurechnungsfehler
haben. Der Fokus läge dann auf Armutsbekämpfung, durch dialogische Verfahren minimieren soll. Dabei
nicht auf Kulturfragen. bringt man objektivierte Daten (z.B. aus einem klein-
räumigen Präventionsmonitoring) mit den Interpreta-
Die Beispiele zeigen: Professionelles Erfahrungswissen tionen verschiedener Bezugsgruppen (Politik, Fachpla-
ist wichtig, es ist aber auch anfällig für vorschnelle und nung, Fachkräfte, Adressat*innen) zusammen – und
sachlich falsche Kategorisierungen. Umgekehrt sind verständigt sich in entsprechenden AustauschformatenSinnfokussierung 21
(z.B. Sozialraumkonferenzen, Wirksamkeitsdialogen) primärpräventive Strategien und Maßnahmen häufig
auf gemeinsame Ursachenanalysen, Bedarfsermitt- unter Legitimationsdruck, da sie ihre Wirkungen an-
lungen, Wirkungsannahmen und Handlungskonzepte. hand von Kenngrößen nicht nachweisen können.
Wird dieser partizipative Ansatz nicht nur punktuell als
einmaliges Beteiligungsformat, sondern als Partizipa- Um in dieser Hinsicht weiterzukommen, braucht es
tionsprozess aufgebaut, erhalten die Akteure zudem ein erweitertes Wirkungsverständnis, das sich an einer
verhältnismäßig kleinschrittige Rückmeldungen zu engmaschigen, handlungsnahen Erfolgskontrolle als
ihrem Handeln, was die Zurechnung von Sachverhalten Voraussetzung der fehlerfreundlich-reflexiven Hand-
als „Handlungsfolgen“ objektiviert und somit Lernen lungsoptimierung orientiert.
fördert.
Im Idealfall bindet man in jedem Planungs-,
In dieser wissensbasierten Perspektive werden die
Adressat*innen nicht zur Zielgruppe objektiviert und
Umsetzungs- und evaluativen Prozessschritt
dadurch schon bei der Bedarfsermittlung als reine kontinuierlich das Fachkräftewissen und
Informant*innen auf Distanz gebracht. Vielmehr sucht
man nach Wegen zu einer partizipativen, aktivierenden die Adressat*innenperspektiven ein
Angebotsentwicklung, bei der valide Informationen
zur Bedarfsermittlung quasi nebenbei anfallen. Dazu – und vermeidet so eine starre Systemgrenze
braucht es eine große Praxisnähe der Angebotsent- zwischen Entscheidung, Planung, Ausführung und
wicklung, d.h., dass Fachkräfte vor Ort bei der Konzi- adressat*innenbezogener Wirkungsanalyse. Mit dem
pierung maßgeblich involviert sein müssen. Anderswo Fokus Reflexivität wird somit auf eine beteiligungs
bereits bewährte und ggf. evaluierte Programme und orientierte Art der Erfolgskontrolle rekurriert, die über
Angebote (etwa die auf der „Grünen Liste Prävention“ das klassische Wirkungsverständnis hinausweist, die
aufgeführten) können dabei zwar durchaus einbezo- Überprüfung plausibler, handlungsschrittnaher Wir-
gen, müssen aber immer auf ihre konkrete Passgenau- kungsannahmen aber mit umfasst. In diesem erweiter-
igkeit hin analysiert werden. ten Verständnis sollte die Gestaltung der kommunalen
Präventionskette wissensbasiert erfolgen.
Beteiligung ist eine unabdingbare
Voraussetzung, um das nötige Maß
Grüne Liste Prävention – CTC
an Reflexivität in die Gestaltung der
Präventionskette einfließen zu lassen. Die „Grüne Liste Prävention“ des Landesprä-
ventionsrats Niedersachsen listet evaluierte
Denn globale (vermeintliche) Wirkungsindikatoren Programme, die auf dem Weg zum Ziel der
sind für sich genommen oft nicht aussagekräftig. So Erlangung „kausaler Beweiskraft“ auf der Basis
kann beispielsweise eine Steigerung der Fallzahlen von Zufallsexperimenten mit Kontrollgruppen
bei den „Hilfen zur Erziehung“ sowohl auf ein Versa- sind.
gen von Präventionsmaßnahmen als auch auf eine
effektivere Erreichung institutionsferner Gruppen von Quelle: www.gruene-liste-praevention.de/nano.
Adressat*innen hinweisen. Ohne den Einbezug des cms/datenbank/information (letzter Zugriff:
Kontextwissens der Fachkräfte lässt sich dies kaum 16.08.2019)
interpretieren. In Politik und Fachcontrolling geratenSie können auch lesen