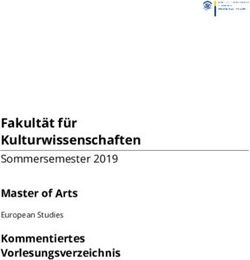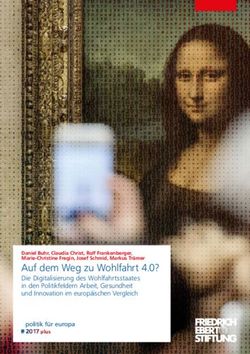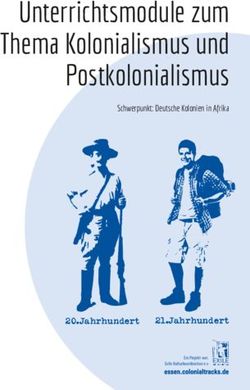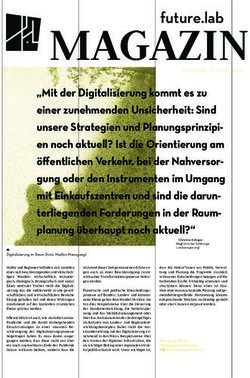NICCOLÒ MACHIAVELLI UND DIE REZEPTION SEINES POLITISCHEN DENKENS IM ZEITALTER DER EXTREME
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
NICCOLÒ MACHIAVELLI
UND DIE REZEPTION
SEINES POLITISCHEN DENKENS
IM ZEITALTER DER EXTREME
Masterarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
einer Magistra der Philosophie/
eines Magisters der Philosophie
an der Karl-Franzens-Universität Graz
vorgelegt von
Christoph DE MARINIS, MA Bakk.phil.
am Institut für Romanistik
Begutachterin
Ao.Univ.-Prof. Dr.phil. Susanne KNALLER
Graz, 20212
INHALTSVERZEICHNIS
Niccolò Machiavelli: Einleitung .............................................................................. 3
1. Die Entwicklung der politischen Theorie bei Niccolò Machiavelli .................... 8
1.1 Die Entwicklung des politischen Denkens bei Machiavelli vor
Il Principe und I Discorsi ............................................................................. 10
1.1.1 Schriften zur Toskana........................................................................ 12
1.1.2 Schriften zur Miliz ............................................................................ 14
1.1.3 Schriften zu anderen Nationen .......................................................... 16
1.2 I Discorsi und Il Principe ............................................................................. 22
1.2.1 I Discorsi ........................................................................................... 22
1.2.2 Il Principe.......................................................................................... 25
2. Die Rezeption der politischen Schriften von Niccolò Machiavelli bis zum
20. Jahrhundert .................................................................................................. 29
3. Machiavellis Werk als intertextueller Faden der politischen Theorie des
20. Jahrhunderts ................................................................................................ 34
4. Machiavelli im Zeitalter der Extreme ............................................................... 42
4.1 Methodik, Programm und Motiv .................................................................. 43
4.2 Die Beziehung zwischen Tugend (virtù), Glück (fortuna) und Moral ......... 47
4.3 Die ,Natur‘ des Menschen und die Rahmenbedingungen menschlichen
Zusammenlebens .......................................................................................... 49
4.4 Der Souverän: Fürst oder Volk ..................................................................... 56
4.5 Gesetz, Staat, Nation und Vaterland ............................................................. 61
Zusammenfassung und Diskussion ........................................................................ 71
Bibliografie ............................................................................................................ 763 NICCOLÒ MACHIAVELLI: EINLEITUNG Anlass dieser Arbeit ist das persönliche Interesse an den hier vorgebrachten Thematiken, die gleichsam als Schnittmenge meiner beiden Studiendisziplinen Romanistik/Italienisch und Soziologie angesehen werden können: Für den Romanisten beinhalten die Texte von Niccolò Machiavelli und ihre Rezeptionsgeschichte eine lange, intensive Tradition in der gesamten romanischen Literatur und wirken in vielfältiger Weise auf ihre literarischen Erzeugnisse. Machiavellis Texte, ihre Konzepte und ihre Rezeption sind ein häufiger Bezugspunkt wesentlicher Beiträge zur romanischen Literatur. Ein tiefgehendes Verständnis der Interpretationslinien ermöglicht es, Bezüge und Referenzen in anderen Texten zu entdecken, Nuancen in der Argumentation wahrzunehmen und neue Bedeutungen zu generieren. Für den Soziologen hingegen sind Fragen zum gesellschaftlichen Zusammenleben, der Diskussion seiner Bedingungen und Möglichkeiten seiner Stabilisierung wesentliche Problemstellungen seiner Disziplin. Die Rezeption von Machiavellis politischen Schriften bietet einen unerschöpflichen, spannenden Diskurs dieser Themen, die Machiavelli zu Beginn des 16. Jahrhunderts pointiert und provozierend formuliert und zugleich für sich beantwortet hat. Auf Basis der Diskussion seiner Konzepte von Tugend (virtù), Staat (stato) oder Vaterland (patria) haben sich zahlreiche Dialoge über das ‚gute‘ Zusammenleben entwickelt und diese Dialoge selbst können uns über die zentralen Herausforderungen ihrer Zeit informieren.
4
In Abschnitt 1, Die Entwicklung der politischen Theorie bei Niccolò
Machiavelli werden die zentralen Themen seines literarischen Lebenswerks
präsentiert. Eine entsprechende thematische Einführung ist für das Verständnis der
Rezeptionsgeschichte notwendig. Auch wenn Kommentare zu Machiavellis Texten
aufgrund der posthumen Veröffentlichung seiner Hauptwerke De Principatibus (Il
Principe) und Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio (I Discorsi) erst nach
seinem Ableben in Schwung kommen, so sind sie dennoch stets eng mit der
politischen Person des einstigen Segretario della Seconda Cancelleria della
Repubblica di Firenze verbunden. Die Kritik seiner Werke beschränkte sich
aufgrund ihres provozierenden Inhalts nicht auf die Qualität seiner literarischen
Erzeugnisse, der Charakter des Autors selbst wurde von Rezipient*innen verurteilt.
Seine Texte wurden um kolportierte (geheime) politische Agenden des Florentiners
erweitert und beeinflussten damit die weitere Rezeptionsgeschichte. Die
administrativen Schriftstücke, welche in der Zeit seiner diplomatischen Tätigkeit
verfasst wurden, entwickeln bereits die thematischen und konzeptionellen
Grundlagen für Machiavellis Hauptwerke Il Principe und I Discorsi und führen in
jene Motive ein, die später auch von seinen Rezipient*innen aufgenommen wurden.
Die Rezeption von Machiavellis Texten beschäftigte sich bis zum 20.
Jahrhundert vorrangig mit den ‚wahren‘ Intentionen des Autors und kritisierte
entweder seine Motive, seine politischen Konzepte oder beides. Zudem beschränkte
sich die Lektüre seiner Rezipient*innen größtenteils auf Il Principe und bereits viel
seltener I Discorsi. In Abschnitt 2, Die Rezeption der politischen Schriften von
Niccolò Machiavelli bis zum 20. Jahrhundert wird die lange Traditionsgeschichte
kursorisch präsentiert. Die verschiedenen Autor*innen lassen sich dabei mehr oder
weniger eindeutig bestimmten Rezeptionsströmungen zuordnen und bilden damit
jene Interpretationslinien, die für alle weiteren Rezipient*innen wichtige
Bezugspunkte darstellen.5
Als methodische Basis für die Aufarbeitung der Rezeption von Machiavellis
Texten wurde eine intertextuelle Betrachtung gewählt. Mit Hilfe dieser Perspektive
können Zusammenhänge und Unterschiede zwischen Rezipient*innen entdeckt und
strukturiert werden. Die intertextuelle Analyse wird von folgender Forschungsfrage
geleitet: Welche Bedeutungen ziehen die Autor*innen aus den Texten Machiavellis
in Hinblick auf traditionelle Interpretationslinien und ihrer eigenen Position in
diesem Diskursfeld? Machiavellis Werke zeichnen sich durch ihre
außergewöhnliche Stellung in Bezug zu Text und Kontext seiner Zeit und ihre
vielfältige Rezeptionsgeschichte aus. Sie sind mit ambivalenten und
traditionsreichen Konzepten, Begriffen und Ideen gespickt, die eine intertextuelle
Betrachtung notwendig machen, um sie in Bezug zu ihren Ursprüngen und
Rezeptionen positionieren zu können. Durch den, für den Autor typischen Einsatz
von Sarkasmus und Ironie, öffnet Machiavelli Leerstellen für unterschiedliche
Interpretationen der Rezipient*innen. Und nicht zuletzt haben seine Hauptwerke
politische, teils täuschend hinterlistige Strategieführung zum Thema und einige
Rezipient*innen vermuteten eine entsprechende verborgene Strategie unter der
Textoberfläche seiner Werke. In Abschnitt 3, Machiavellis Werk als intertextueller
Faden der politischen Theorie des 20. Jahrhunderts werden die Grundlagen der
Intertextualitätstheorien besprochen und darauf eingegangen, wie dieses Konzept
für die vorliegende Arbeit nutzbar gemacht wird.
Für die vorliegende Untersuchung bilden ausgewählte Autor*innen des 20.
Jahrhunderts den Analyserahmen. Die politischen Umwälzungen des Zeitalters der
Extreme (Hobsbawn 1995) versprechen eine intensive Auseinandersetzung über
Fragen des sozialen Zusammenlebens, stabiler Regierungsformen, Souveränität,
Volk und Nation auf Basis divergierender politischer Vorstellungen. Die Rezeption
von Machiavellis Texten kann als Verbindungsfaden der teilweise diametralen
Perspektiven genutzt werden und ermöglicht somit eine Analyse der präsentierten
Konzepte. Bei der Auswahl der Texte wurde auf eine gewisse Homogenität bei der
Betrachtung von Machiavellis Werk geachtet. Die Rezipient*innen verbindet eine6
theoretisch fundierte Auseinandersetzung mit den Bedingungen des
gesellschaftspolitischen Zusammenlebens im Allgemeinen, wobei sie Machiavellis
Texte als argumentative Ankerpunkte verwenden, um sie auf Basis ihrer
Vorstellungen zu beurteilen. Ausgespart wurde die konkrete Rezeption
Machiavellis unter Autor*innen des Nazi-Faschismus, wenn auch Francesco
Ercoles Ausführungen diese wesentlich beeinflussten. Die Rezeption von
Machiavellis Theorien im Nazi-Faschismus stellt dennoch einen aus meiner Sicht
separaten Diskursrahmen dar (siehe dazu z. B. Krull 1993, Rauscher 2001, Taurek
2010). Die Texte, die in dieser Arbeit herangezogen wurden, sind in den Jahren nach
ihrer Verfassung die zentralen Werke der Rezeption von Machiavellis politischer
Theorie bzw. wurde teilweise erst Jahre später veröffentlicht und rezipiert. Am Ende
des Zeitalters der Extreme (Ende der 1970er, 1980er-Jahre) verlagert sich die
Aufmerksamkeit der Rezipient*innen verstärkt auf historische und linguistische
Studien (De Camilli 2001: 171ff), während der politische Gehalt von Machiavellis
Texten in der Rezeption an Bedeutung verliert.
Aktuell gibt es eine Reihe von komparativen Zusammenfassungen der
Rezeption von Machiavellis Texten bis zum 20. Jahrhundert (z. B. Del Lucchese
2015, Angolo 2005 oder De Camilli 2000), bis dato fehlt aber eine Zusammenschau
zwischen den Positionen der Rezipient*innen des Zeitalters der Extreme. In der
vorliegenden Literatur finden sich einzelne Abschnitte zu Autoren (sic!) des 20.
Jahrhunderts wie Chabod, Gramsci oder Strauss, es fehlt aber eine intensive,
intertextuelle Auseinandersetzung. Ihre Ausführungen werden vorwiegend isoliert
voneinander präsentiert. Diese Arbeit möchte diese Forschungslücke in Abschnitt
4, Machiavelli im Zeitalter der Extreme füllen und Texte anhand einer
intertextuellen Kritik miteinander in Verbindung bringen. Zu diesem Zwecke
werden ihre Beziehungen anhand einer thematischen Struktur aufgearbeitet, die von
der ‚Natur‘ des Individuums bis hin zur Idee des ‚Vaterlandes‘ reicht. Die Auswahl
der Autor*innen wurde anhand ihrer Verbundenheit zu gesellschaftspolitischen
Fragen des 20. Jahrhunderts gewählt. Ihre Positionen, die anhand ihrer Machiavelli-7
Rezeption illustriert werden, trugen nicht nur zur Entwicklung der literarischen
Interpretation bei, sondern allgemein zum gesellschaftspolitischen Diskurs ihrer
Zeit. Damit spannt die vorliegende Arbeit einen Bogen von grundlegenden Fragen
des sozialen Zusammenlebens, wie sie Machiavelli am Übergang vom 15. ins 16.
Jahrhundert aufgeworfen hat, zu ihrer Diskussion inmitten der Dynamiken des
Zeitalters der Extreme, in dem neuerlich die Möglichkeit stabiler
Gesellschaftsformen diskutiert wird.
In der Zusammenfassung und Diskussion werden die Ergebnisse der
intertextuellen Betrachtung summiert und gezeigt, wie das neu entstandene
Textgewebe einen Beitrag zur Sinngenerierung der Ur-Texte sowie der
referierenden Texte leisten konnte. Damit war es möglich Autor*innen, die diverse
Perspektiven auf die selben Ausgangstexte einnehmen, miteinander in einen Dialog
treten zu lassen und konkreten Momente zu benennen, an denen ihre politische
Theorie zu unterschiedlichen Bewertungen der Ursprungstexte führte.8 1. DIE ENTWICKLUNG DER POLITISCHEN THEORIE BEI NICCOLÒ MACHIAVELLI Niccolò Machiavelli (*1469) wird in einer angesehenen florentinischen Familie großgezogen und erfährt eine umfassende humanistische Bildung. Anders als es die familiäre Tradition von Juristen erwarten ließe, schließt Machiavelli kein Studium ab, womöglich aufgrund ökonomischer Einschränkungen oder seines unkonventionellen und unbändigen Charakters (Bruscagli 2008: 11). In Florenz regiert zu dieser Zeit die Familie der Medici, die jedoch in den folgenden Jahrzehnten ihre politische Macht immer stärker den Balìe, der kommunalen Justizbehörde, abtreten muss. Im Jahr 1494 werden die Medici, dank eines Zusammenschlusses der alten Aristokratie und des Gemeinvolks, aus Florenz vertrieben. Die Bevölkerung von Florenz will in Zukunft die Republik am Wohl aller ausrichten und sich auf verlorene Werte zurückbesinnen. Zu diesem Zwecke müssen strenge Gesetze eine neue moralische und politische Grundlage bilden (Reinhardt 2012: 45). Dies ebnet dem Dominikanermönch Girolamo Savonarola die politische Bühne von Florenz für knapp vier Jahre. Er predigt von Buße, Läuterung und Besserung oder der bevorstehenden unbarmherzigen Strafe Gottes, sollte sich Florenz nicht bekehren lassen. Dabei macht sich Savonarola durch seine ausschweifende Kritik der bestehenden Verhältnisse auch zahlreiche Feinde in der katholischen Kirche. Machiavelli steht den Lehren des Bußpredigers von Anfang an kritisch gegenüber, sieht den Einsatz von Religion bei Savonarola als Instrument der Beherrschung und Unterdrückung. Im Jahr 1498 verändert sich die politische Lage in Florenz, Savonarola hatte sich ins Abseits manövriert und mangels politischer Unterstützung wird er wegen Häresie festgenommen und schließlich auf der Piazza della Signoria verbrannt.
9
Im Frühjahr 1498, nach der Hinrichtung Savonarolas, tritt Machiavelli in
den Beamtendienst der Republik von Florenz ein, indem er zum Segretario della
Seconda Cancelleria della Repubblica fiorentina (Sekretär der Zweiten Kanzlei)
gewählt wird. Die zweite Kanzlei beschäftigt sich vorrangig mit innenpolitischen
Angelegenheiten, während die Aufgabe der ersten Kanzlei die Außenpolitik
darstellt. Aufgrund der unsicheren außenpolitischen Lage von Florenz wird
Machiavelli bald aber auch als mandatario mit diplomatischen Agenden betraut.
Dies auch dank seiner guten Beziehung zu Piero Soderini, welcher 1502 zum
gonfaloniere a vita gewählt wird. Im Rahmen seiner Tätigkeiten verfasst
Machiavelli eine Reihe von formalen und bürokratischen Texten und entwickelt
Teile jener wissenschaftlichen Konzepte, die sich später in seinen Hauptwerken
wiederfinden werden (Bruscagli 2008: 16).
Mit der Rückkehr der Medici 1512 und der damit einhergehenden
Absetzung Soderinis, muss auch Machiavelli seinen Posten räumen. Er gilt als
versteckter Widersacher der Medici und wird in weiterer Folge sogar eines
Komplotts beschuldigt. Machiavelli wird eingesperrt, gefoltert und nach 22 Tagen
freigelassen. Nach seiner Freilassung muss sich Machiavelli auf den Familiensitz
in San Casciano zurückziehen. Eine Rückkehr in politische Ämter bleibt ihm, trotz
einiger Anstrengungen, bis zu seinem Tod (†1528) verwehrt.
Dieser kurze Abriss von Machiavellis Lebensgeschichte zeigt bereits,
woraus sich seine politischen Ideen speisen bzw. auf welchen Säulen die Produktion
seiner späteren politischen Hauptwerke fußt. Die Entwicklung seiner Theorien baut
auf drei unterschiedliche Momente auf, nämlich die Zeit der Kindheit und Jugend,
in der Machiavelli auf die umfangreiche Bibliothek des Vaters zurückgreifen konnte
und im (1) Selbststudium mit den Werken antiker Klassiker in Berührung
kommt. Die politischen Umwälzungen in Florenz und seine Verbindungen
verschaffen ihm einen (2) administrativen Posten in der Stadtverwaltung und
durch seine zahlreichen diplomatischen Missionen und reflektierten
Korrespondenzen sammelt il Segretario eine Vielzahl von Erfahrungen und10
Erkenntnissen. Nach der Rückkehr der Medici wendet sich das Blatt für
Machiavelli und er ist gezwungen auf dem Gutshof seiner Familie, mit direktem
Blick auf den Dom von Florenz, seiner politischen Karriere nachzutrauern und über
seine Erkenntnisse zu philosophieren. Das Ergebnis sind u.a. seine (3) Hauptwerke
Il Principe und I Discorsi. Niccolò Machiavelli hinterlässt uns ein umfangreiches
literarisches Werk, welches De Camilli (2000: 20f) in fünf unterschiedliche
Textsorten gliedert:
(1) relazioni e comunicazioni epistolari
(2) scritti politici
(3) opere del carattere storico
(4) testi d’invenzione
(5) corrispondenza privata
In dieser Masterarbeit wird es um die Rezeption seiner politischen Schriften
gehen. In der ausgedehnten literarischen Diskussion, die unmittelbar nach dem
posthumen Erscheinen seiner Hauptwerke Il Principe und I Discorsi entstand,
finden die anderen Texte Machiavellis eine geringfügige bis gar keine
Berücksichtigung. Diese Texte werden erst allmählich bei tiefergehenden Analysen
von seinen Rezipient*innen dazu herangezogen, seinen Theorien bestimmte
Bedeutungen zu entlocken und Entwicklungen nachzuzeichnen.
1.1 Die Entwicklung des politischen Denkens bei Machiavelli vor Il Principe
und I Discorsi
Eine diachrone Gliederung von Machiavellis politischen Schriften ist nützlich, um
die thematische Entwicklung seiner Arbeit wahrzunehmen. Obwohl sich seine
politischen Texte sehr stark nach Stand der Ausarbeitung, Übermittlungsform und
Ausgangsmotivation voneinander unterscheiden, gibt Marchand (1975) einen11
überzeugenden Rahmen vor, indem er sie nach seinen drei Hauptaktivitäten als
Beamter in Florenz aufgliedert1:
(1) Schriften zur Toskana: interne Verwaltung des florentinischen
Herrschaftsgebiets
(2) Schriften zur Miliz: Organisation und Strukturierung einer Miliz
(3) Schriften zu anderen Nationen / zur Außenpolitik: diplomatische Aufträge
in Italien und Europa
Tabelle 1: Machiavellis politische Schriften vor Il Principe und I Discorsi (Gliederung nach
Marchand 1975 und Bruscagli 2008)
Schriften zur Toskana Schriften zur Miliz Schriften zu anderen
Nationen / zur Außenpolitik
Discorsi sopra Pisa (1499) La cagione dell’ordinanza … Discursus de pace inter
(1506) imperatorem et regem (1501)
De rebus Pistoriensibus (1502) Provisione della ordinanza 2. Teil der Parole di dirle sopra
(1506) la provisione del danaio (1503)
1. Teil der Parole di dirle sopra Discorso sulla milizia a cavallo De natura Gallorum (1503)
la provisione del danaio (1503) (1510)
Del modo di trattare i popoli L’ordinanza de’ cavalli (1510-2) Il tradimento del duca Valentino
della Valdichiana ribellatti (1503)
(1503)
Provvedimenti per la riconquista Ghiribizio circa Iacopo Savello Rapporto delle cose della Magna
di Pisa (1509) (1511) (1508)
Ai Palleschi (1512) Discorso sopra le cose della
Magna e sopra l’Imperatore
(1509)
Ritratto di cose di Francia
(1512)
Ritratto delle cose della Magna
(1512)
1 Bruscagli (2008: 16f) folgt ebenfalls größtenteils dieser Gliederung und erweitert sie um
Machiavellis Erfahrungen in Frankreich und Deutschland als separate Kategorie. Die Zuteilung von
Machiavellis einzelnen kleineren politischen Schriften zwischen 1499 und 1512 zeigt Tabelle 1.12
Im Folgenden werden die theoretischen Inhalte der drei Kategorien kurz
umrissen und die wichtigsten konzeptionellen Themen in Machiavellis
theoretischem Denken angesprochen. Diese Themen finden sich in einer
systematischeren Ordnung in seinen Hauptwerken wieder.
1.1.1 Schriften zur Toskana
In den Schriften zur Toskana kommentiert Machiavelli im Allgemeinen die
politische Ausrichtung von Florenz in der Zeit seiner Anstellung als Segretario
della Seconda Cancelleria della Repubblica di Firenze. Besonderes Augenmerk
gibt er in diesen Texten der Beziehung zwischen Herrschenden und ihren
Untergebenen, welche stets durch das Binom Liebe-Gewalt geprägt ist. Für
Machiavelli kann das Vertrauensverhältnis zwischen Herrscher und Untergebenen
ausschließlich auf liebevoller Zuneigung oder respektvoller Stärke basieren. Er
scheint in seinen Texten jedoch meist eine Politik der Stärke und Repression zu
empfehlen und wurde daher als hart und herzlos kritisiert. Marchand (1975: 318)
argumentiert, dass Machiavelli in seinen Texten die Vorteile von friedfertigem
Handeln anspricht, in seinen Analysen aber nach Prüfung aller pazifistischen
Optionen oftmals zu dem Schluss gelangt, dass ein Vorgehen mit Härte die einzige
Lösung darstelle. Für Machiavelli ist der Einsatz von Gewalt kein repressives
Mittel, sondern dient als vertrauensbildende Maßnahme in Hinblick auf
Untergebene, um ein Klima der Sicherheit zu schaffen.
Puòssi per questa deliberazione considerare, come i Romani nel giudicare di queste
loro terre ribellate pensarono che bisognasse o guadagnare la fede loro con benefizi,
o trattarli in modo che mai più ne potessero dubitare; e per questo giudicarono
dannosa ogni altra via di mezzo che si pigliasse. (Machiavelli 2011: 381)13
Der Einsatz von Härte und Gewalt muss für jede politische Situation neu
abgewogen werden, denn die Beziehung zwischen Herrscher und Untergebenen ist
von einer gegenseitigen Verpflichtung gekennzeichnet. Für Machiavelli führt ein zu
großes Maß an Autonomie lediglich zu Unordnung und dazu, dass die Bevölkerung
leichter für aufständische Einflüsse empfänglich ist. Eine friedfertige
Vorgehensweise ist zu bevorzugen und der Einsatz von Stärke nur dann und nur so
lange gerechtfertigt, solange sie der Verteidigung der Untergebenen dient. Hier
kristallisiert sich auch Machiavellis Abneigung gegenüber einer inkonsequenten
politischen Haltung, einer via di mezzo ab, die er als typische politische Haltung der
florentinischen Regierung seiner Zeit wahrnimmt (Bruscagli 2008: 16).
Ein weiterer Aspekt seiner frühen politischen Texte zur Toskana ist
Machiavellis Verständnis von Geschichte als didaktische Quelle. Er startet seine
Entwicklung mit der Prämisse, dass sich geschichtliche Ereignisse wiederholen und
es daher so etwas wie historische Präzedenzfälle gäbe. Machiavelli bedient sich
dieser historischen Ereignisse, um Handlungsentscheidungen abzuleiten, Beispiele
von Vorgehensweisen in Situationen mit ähnlichen Rahmenbedingungen zu geben
und schließlich auch, um Geschichte als allgemeingültiges Modell zu konzipieren.
Für ihn wird dadurch Geschichte in seiner zyklischen Vorstellung zu einer sich
wiederholenden Anreihung von ähnlichen Ereignissen. Dieses Modell macht eine
Wissenschaft der Politik auf Grundlage von Ursache und Wirkung erst möglich und
das Studium antiker Autoren nützlich. Machiavellis Vorstellung beruht auf seiner
Annahme der Unveränderlichkeit bestimmter Phänomene, wie jenes des
menschlichen Wesens, ihrer Leidenschaften, ihrer sozialen Bedingungen,
Beziehungen und Verhaltensweisen.14
In Bezug zu den Beziehungen von Florenz mit dem ‚Ausland‘ sind für
Machiavelli zwei Dinge entscheidend: Zum einen die Unmöglichkeit auf schnelle
Hilfe von außen zu hoffen, die nicht mit egoistischen Interessen der Unterstützer
einhergeht, zum anderen die daraus resultierende Notwendigkeit, interne Probleme
mit eigenen Kräften zu bewältigen. Hinzu ist Machiavelli der Meinung, dass eine
stabile Beziehung zwischen zwei Nationen nur über gegenseitigen Respekt
hinsichtlich ihrer militärischen Stärken bestehen kann. Daher plädiert Machiavelli
für eine mutigere Politik, indem er auch von einem Fall der Republik warnt.
Et di nuovo vi replico che, sanza forte, le città non si mantengono, ma vengono al
fine loro. El fine è o per desolatione, o per servitù. Voi sete stati preso, questo anno,
ad l’uno et l’altro; et vi ritornerete, se non mutate sententia. Io ve lo protexto.
(Machiavelli 2011: 378)
1.1.2 Schriften zur Miliz
In Machiavellis Schriften zur Ordnung von Florenz und der damit verbundenen
Formierung einer eigenen Miliz wird der Einsatz von militärischer Kraft (forza) von
einer konkreten Handlungsanweisung für bestimmte Situationen, zu einer
grundlegenden Basis für die Stabilität eines Staates. Für Machiavelli sind
hierarchische Beziehungen zwischen Menschen in jedem Entwicklungsstadium
von Gesellschaften notwendig und diese Hierarchie beruht auf dem Verhältnis von
Stärke. Dieses Konzept überträgt er auf die Makroebene der Beziehung zwischen
Staaten und setzt sich deshalb für die Formierung einer nationalen Miliz ein, im
Gegensatz zur seinerzeit üblichen Rekrutierung von illoyalen Söldnertruppen.
Seine Argumentation verläuft zunächst nur entlang der Verurteilung von Söldnern,
die für einen Staat entweder eine stete Bedrohung darstellen oder sich durch höchste
Ineffizienz auszeichnen würden. Diese Darlegungen werden nach und nach mit den
Vorteilen einer eigenständigen Miliz angereichert. Eine nationale Miliz zeichne sich
vor allem durch ihre Disziplin und innere Kohäsion sowie durch ihre Motivation
aus, den eigenen Besitz bis zuletzt zu verteidigen. Machiavelli verknüpft mit diesem15
Konzept von Stärke (forza) die Vorteile einer Miliz auf der Makroebene – Sicherheit
nach Außen sowie Ansehen gegenüber anderen Staaten – mit jenen auf der
Mikroebene – Sicherheit im Inneren, vor allem im Kampf gegen revolutionäre
Kräfte und damit Stabilität der Republik.
[…] cognosciuto quanta poca speranza si possi avere nelle genti e arme esterne e
mercenarie, perché se sono assai e reputate, non sono o insopportabili o sospette, e
se sono poche o sanza reputazione, non sono d’alcuna utilità, giudicano esser bene
d’armarsi d’arme proprie, e d’uomini suoi proprii, […] (Machiavelli 2011: 410)
Eng mit der Formierung einer eigenständigen Miliz und somit der
Bewaffnung der eigenen Bevölkerung, geht die Frage nach dem Vertrauen in die
Untergebenen einher. Die ausgehändigten Waffen könnten zu privaten Zwecken
und im schlimmsten Fall zu einer Rebellion genützt werden. Für Machiavelli
hingegen würde die Bewaffnung der Bevölkerung das Risiko eines Aufstandes
verringern, denn eine nationale Miliz würde die menschlichen und bürgerlichen
Werte wiederbeleben. Die Wertschätzung und das Vertrauen, das die Formierung
einer Miliz ausdrücken würde, werde eine Zusammenarbeit der Herrscher und
Beherrschten ermöglichen, denn ein Klima der Gerechtigkeit würde der
Bevölkerung die Angst nehmen und somit aufbegehrenden Kräften den Boden
entziehen. Die Sicherheit der Bevölkerung war vor allem zu Beginn der Formierung
einer Miliz von höchster Bedeutung. Machiavelli legt deshalb zunächst sehr viel
Wert auf die genaue Darstellung der Ausbildung, Ordnung und Disziplinierung der
Truppen. Die Einflussbereiche und Macht der Miliz werden, auf parlamentarischen
Druck hin, klar abgegrenzt und stark eingeschränkt.
Et vi adverdrete anchora a’ vostri dì che differentia è havere de’ vostri cittadini
soldati per electione et non per corruptione, come havete al presente; perché, se
alcuno non ha voluto ubbidire al padre, allevatosi su per li bordelli, diverrà soldato;
ma uscendo dalle squole honeste et dalle buone educationi, potranno honorare sé
et la patria loro. (Machiavelli 2011: 410).16
Einmal diese Leitlinien definiert, scheint das Risiko einer eigenen Miliz
nicht mehr als vordergründiges Thema wahrgenommen zu werden. Die Schriften
zur Miliz sind Machiavellis einziger Versuch, seine politischen Prinzipien mit der
realen Situation in der Toskana in Einklang zu bringen. Sie sind weder Grundsätze
einer utopischen Gesellschaft noch Ausdruck rein militärischer Ambitionen
(Marchand 1975: 422).
1.1.3 Schriften zu anderen Nationen
In den Schriften zu anderen Nationen interessiert sich Machiavelli für die innere
Struktur und Organisation dieser, beschäftigt sich aber auch mit den
Persönlichkeiten der Souveräne jener Länder, die er als Sekretär bereisen konnte.
Dabei gehen seine Reflexionen bereits über einen momentanen Nutzen für die ihm
aufgetragenen Missionen hinaus. Machiavelli geht seiner Neugier nach, wenn er
versucht die Charakteristika zusammenzutragen, die einen Staat stark bzw. schwach
machen. Er geht stets nach dem gleichen Schema vor: Zunächst werden die
Einzelfälle deskriptiv beschrieben, dann analytisch miteinander in Beziehung
gesetzt und schlussendlich werden in vielen Fällen normative Schlüsse gezogen,
die in diesen Schriften noch nicht in allen Aspekten komplett ausgereift sind.
Seine Texte beinhalten für die Figur des Souveräns noch keine einheitlichen,
normativen Handlungsanweisungen. Machiavelli zeigt lediglich anhand einiger
Beispiele auf, dass Souveräne im Allgemeinen die Tendenz pflegen, sich nicht
besonders um Gerechtigkeit zu kümmern, sondern viel öfters eine Politik des
persönlichen Vorteils, der Stärke und vollendeten Tatsachen verfolgen. Anhand von
Cesare Borgia (Il Duca Valentino) beschreibt Machiavelli (2011: 374-7) die
beispielhafte Entwicklung, wie ein Souverän eine ausweglose Situation in einen
totalen Triumpf verwandeln kann, wenn er über die nötigen Eigenschaften verfügt:
Zum ersten die Fähigkeit, die Gelegenheiten (occasioni) zu ergreifen, die ihm das
Glück (fortuna) verschafft. Zum zweiten die Fähigkeit zu täuschen (simulare e
dissimulare), zum dritten die nötige Kraft und Stärke (forza, virtù) und zum vierten17
die Fähigkeit im Geheimen zu agieren. Die Fähigkeit zu täuschen und seine
Handlungen geheim zu halten, sorgen für eine größere Effizienz beim Einsatz von
Stärke. In Machiavellis Ausführungen zum Heiligen Römischen Reich kritisiert er
Souveräne, die nicht über diese Eigenschaften verfügen und stattdessen
improvisieren, nicht resolut vorgehen und dazu noch inkompetent sind, so wie
Maximilian I.
L'imperatore non chiede consiglio a persona, ed è consigliato da ciascuno; vuol
fare ogni cosa da sé, e nulla fa a suo modo, perché non ostante che non iscuopra
mai i suoi segreti ad alcuno sponte, come la materia gli scuopre, lui è svolto da
quelli ch’egli ha intorno e ritirato da quel suo primo ordine: e queste due parti, la
liberalità e la facilità, che lo fanno laudare a molti, sono quelle che lo ruinano.
(Machiavelli 2011: 438)
Diese Beschreibungen von Einzelfällen werden miteinander in Beziehung
gebracht und verglichen. Zunächst nur untereinander, erst später mit dem
unpersönlichen, zeitlosen Modell des idealen Souveräns.
Machiavelli reflektiert in diesen Schriften auch über die Rolle der
Zwischenmächte, die zwischen dem Souverän und seinem Volk stehen. Dabei
kommt er zu dem Schluss, dass eine zu große Autonomie der Aristokratie in Bezug
zum Souverän das Haupthindernis für das Schaffen eines starken Staates darstellt.
Das Fehlen einer starken zentralen Macht verhindert zum einen imperialistische
Aktionen, zum anderen lässt es einen offenen Kampf zwischen den einzelnen
Interessensgruppen zu. Für Machiavelli ist klar, dass eine Ausschaltung dieser
Zwischenkräfte einen Hauptgrund für die Stärke eines Staates darstellt.
In der innenpolitischen Organisation des Staates werden die Freiheiten der
einzelnen Fürsten wieder aufgegriffen. Eine schwache Zentralmacht lässt Neid
zwischen den Interessensgruppen entstehen und die Diversität der Institutionen
behindert die Koordination ihrer Aktionen, selbst wenn der Souverän und die
Fürsten das gleiche Ziel verfolgen. Für Machiavelli hängt somit der Erfolg eines
Staates nicht von einem Ausverhandeln zwischen Autoritäten ab, sondern wird
durch eine zentralisierte Politikstruktur gewährleistet, die Kontrolle über lokale18
Machthaber ausübt. Als Beispiel dafür bringt Machiavelli Frankreich, wo der König
in allen Bereichen – Besteuerung, Rechtssystem, Administration, Verteidigung –
präsent ist. „Le terre suddite alla corona non hanno fra loro altro ordine che quello
che li fa el re in fare danari o pagare dazii, ut supra.” (Machiavelli 2011: 432). Hier
verliert Machiavelli kein Wort mehr über den Charakter des Souveräns. Das
erweckt den Anschein, als ob ein Staat, der eine gewisse Homogenität erreicht hat,
keine Notwendigkeit für einen Souverän besitzt, der über spezielle Eigenschaften
verfügt. Die Stabilität der Struktur und die Kontinuität der Dynastie scheinen
zumindest für die innere Ordnung ausreichend.
Die Organisation des Militärs ist zunächst nie zentraler Fokus von
Machiavellis Analysen, das Heer wird stets als Mittel beschrieben, um ein
bestimmtes Ziel zu erreichen. Erst später entwickelt er ein Interesse für seine
Organisation, wenn er Frankreichs Beispiel erläutert, das kaum Geld für die
Verteidigung des Landes ausgeben muss, dessen Soldaten aber nur gegen
großzügige Bezahlung auf ein Schlachtfeld gehen. Weiters interessiert sich
Machiavelli für die Art und Weise, wie der Souverän auf das Heer zugreifen kann
und plädiert für eine direkte Unterstellung. Die militärische Struktur sollte die
politische wiederspiegeln. Ferner beschäftigte sich Machiavelli auch mit den
‚technischen‘ Aspekten von Militär und Kriegsführung, in dem er z. B. die
kämpferischen Qualitäten von bestimmten Völkern, Truppen oder Ausrüstungen
beschreibt. Dabei liefert er sowohl technische als auch psychologische
Erklärungsversuche.
Le fanterie che si fanno in Francia non possono essere molto buone, perché è gran
tempo che non hanno avuto guerra, e per questo non hanno esperienzia alcuna. E
di poi sono per le terre tutti ignobili e gente di mestiero; e stanno sottoposti a’ nobili
e tanto sono in ogni azione depressi che sono vili. (Machiavelli 2011: 428)
In diesen Schriften kann noch keine einheitliche Theorie
eines ,idealen‘ Staates herausgelesen werden. Vielmehr handelt es sich um eine
erste Phase des Studiums der besten Organisationsformen für verschiedene Arten
politischer Herrschaft. Vom aufstrebenden, neuformierenden Staat in der Romagna,19
dem Staat mit etablierten Strukturen im Heiligen Römischen Reich, in dem jedoch
große Teile dem Einfluss des Souveräns entweichen, bis hin zum Staat in seiner
letzten Phase der Konsolidierung am Beispiel Frankreichs, analysiert Machiavelli
die Staatsstrukturen in jeder Kategorie.
Als Chef der zweiten Kanzlei beschäftigt sich Machiavelli vorwiegend mit
der Innenpolitik von Florenz und beschränkt sich oftmals auf eine praktische
Anwendbarkeit seiner Analysen. Er verfügt zwar nur über eine eingeschränkte
Autonomie, dürfte aber als Teil der administrativen Körperschaft von Florenz über
Innen- sowie Außenpolitik äußerst gut informiert gewesen sein. Langsam
entwickelt sich auf Grundlage dieser Erfahrungen ein objektiveres und
allgemeineres Verständnis der politischen Ereignisse, die über eine lebhafte
Diskussion mit seiner Kollegenschaft weiter geschult wird. Zunächst betreibt
Machiavelli noch eine traditionelle, vernunftgeleitete und bewertende Analyse, von
der er sich aber im Zuge seiner außenpolitischen Missionen in Frankreich und der
Romagna befreien wird.
In Frankreich lernt Machiavelli die Wichtigkeit einer stabilen Staatsstruktur
kennen. Machiavelli ist beeindruckt von der Stärke des französischen Staates, hält
aber bereits an dem Glauben fest, dass eine solche Stabilität auch von einem
italienischen Staat erreicht werden kann. Am Hofe Cesare Borgia hingegen kommt
Machiavelli zu dem Schluss, dass Staaten bzw. Fürsten über gewisse
Charakteristika verfügen müssen, wenn sie ihre Unabhängigkeit erreichen oder
behalten wollen: Die Ereignisse in Senigallia2 haben gezeigt, dass Stärke, List und
die Fähigkeit zur Täuschung sowie eine rasche Analyse und Entscheidungsfindung
essenziell für den politischen Erfolg sind. Er analysiert die gesamte Vorgeschichte
des Massakers in Senigallia inklusive der notwendigen Voraussetzungen für ihr
Gelingen. Machiavelli beschreibt beispielhafte Modelle aus der Vergangenheit und
stellt somit erstmals eine kontinuierliche Verbindung zwischen antiker Geschichte
2 Cesare Borgia lädt seine Feinde unter dem Vorwand nach Senigallia ein, einen Friedenspakt
beschließen zu wollen. Stattdessen werden seine Gegner eingesperrt und in weiterer Folge
hingerichtet.20
und aktuellen Ereignissen her. In einem nächsten Schritt münzt er seine
Erkenntnisse auf die politische Situation von Florenz um. Dabei orientiert sich
Machiavelli größtenteils an einer traditionellen Analyse, geht aber in einigen
Aspekten auch darüber hinaus:
Anders als die traditionelle Vorstellung ist die Schwäche von Florenz für
Machiavelli keine unveränderliche Konstante. Die Unterordnung unter eine
Schutzmacht wie Frankreich führe zu ineffizienten Entscheidungen. Ohne eine
politische und militärische Stärkung sei Florenz dem Gutdünken anderer
ausgeliefert und werde früher oder später untergehen. In Bezug auf die staatlichen
Institutionen wurden traditionell die Gründe für Probleme bei den Personen
gesucht, die diese Positionen bekleiden. Machiavelli stellt hingegen erstmals die
Effizienz der Institutionen als solche in Frage. Wie bereits bei anderen
kontemporären Autoren ist für Machiavelli die Geschichte eine Lehrmeisterin, bei
ihm wird diese Vorstellung über die Prämisse der Unveränderbarkeit der
menschlichen Leidenschaften aber beinahe auf ein wissenschaftliches Fundament
gestellt. Traditionell wurde das Glück als eine heidnische Göttin angesehen, die den
Menschen schicksalshaft Möglichkeiten bereitet. Machiavelli vertritt jedoch die
Vorstellung, dass der Mensch durch energisches und resolutes Handeln Einfluss auf
sein Glück nehmen bzw. den Handlungsspielraum einschränken kann. Weiters nutzt
Machiavelli die Vernunft nicht nur zu bestimmten Analysen, sondern durchgehend.
Sie stellt den einzigen Weg zu gesicherter Erkenntnis dar. Vernunft und Kraft,
nämlich die Kraft, die durch Vernunft erzielten Erkenntnisse durchzusetzen, gehen
Hand in Hand. Machiavelli ist sich sicher, dass alles über die Vernunft analysierbar
ist.
Die weiteren geschichtlichen Ereignisse – nämlich der Triumpf von Julius
II. und der Fall von Cesare Borgia – lassen Machiavellis Sicherheiten einstürzen.
Julius II. war ohne große Vorbereitung und mit nur wenigen Männern nach Perugia
gereist und hatte triumphiert, während die Baglionis entgegen aller Regeln, die
Möglichkeit zu einer Handlung wie in Senigallia nicht genutzt haben. Dieser Erfolg21
von Julius II. widerspricht allen Glaubenssätzen Machiavellis und er ist von dieser
Irrationalität überwältigt, versucht aber dennoch die Ereignisse zu analysieren.
Dabei kommt er zu dem Schluss, dass sich die Zeiten geändert hätten. Der Grund,
warum Menschen mit denselben Handlungen zweitweise Pech, zeitweise Erfolg
haben, ist in den veränderten Umständen zu suchen. Weil sich aber die Zeiten
ändern, die Menschen jedoch nicht, regiert stets das Glück. Um das Glück zu
beherrschen sind Intuition, Kühnheit und Mut gefragt. Mit der nötigen Initiative
kann der Mensch sein Schicksal also selbst in die Hand nehmen. Das ist eine
Erweiterung über das sture Lernen von historischen Präzedenzfällen hinaus, die
Durchsetzungskraft des Menschen unter den herrschenden Umständen wird zum
treibenden Motor.
In weiterer Folge entfernt sich Machiavelli von der Vorstellung einer
Politikwissenschaft, die rein auf Erfahrung beruht. Er geht auf die Suche nach den
fundamentalen Grundsteinen für die Existenz von Staaten und findet sie in der
militärischen Kraft und seiner Ordnung. Zunächst sind für Machiavelli noch Kraft
(forza) und Klugheit (prudentia) gleichbedeutend für die staatliche Ordnung. Diese
Begrifflichkeiten entwickeln sich hin zu Gerechtigkeit (giustizia) und Waffen bzw.
Militär (armi). Machiavelli verliert zunehmend das Vertrauen in den Verstand als
Werkzeug, das alles ordnen kann. Er spricht sich daher für Gerechtigkeit aus,
verstanden als resolute Anwendung der Gesetze auf Grundlage der Unfähigkeit des
Menschen, die gesamte Komplexität von politischen Problemen zu begreifen.
Bei seiner Analyse der Niederlage von Maximilian I. gegen die schwächeren
Venezianer geht Machiavelli nicht nur auf militärische, sondern auch auf die
politischen, sozialen, ökonomischen und historischen Gründe ein. Dabei ist für ihn
die Autorität Maximilian I. im Verhältnis zu jener der Feudalherren und der damit
einhergehende Zugriff auf das Militär ein wesentliches Merkmal.
[…] perché chi non ardisce farli guerra, ardisce negarli aiuti; e chi non ardisce
negargnene, ha adire, promissi che li ha, non li osservare, e chi non ardisce ancora
questo, ardisce differire tanto le promisse che non sono in tempo che se ne vaglia:
e tutte queste cose impediscono e perturbano e disegni. (Machiavelli 2011: 443)22
Machiavelli definiert das Erbschaftsrecht, die absolute Macht und die
direkte Unterstellung des Militärs unter die Autorität des Souveräns, die
Eliminierung aller Feudalherren, die Zentralisierung aller Kräfte und Ressourcen,
das Bestehen eines großen, reichen und privilegierten Hofstaates sowie die
Sicherheit der Grenzen als wichtigste Charakteristika eines starken Staates.
In den politischen Texten hin zu I Discorsi und Il Principe haben sich
Machiavellis Interessen von einem Studium des Fürsten, auf ein Studium der
politischen Strukturen, die unabhängig von den Qualitäten des Souveräns für eine
maximale Stabilität und Macht des Staates sorgen, verlagert. Machiavellis Texte
sind zwar von keiner eindeutigen, geradlinigen Entwicklung seiner Vorstellungen
getragen, dennoch lässt sich grob eine Evolution nachzeichnen. Nachdem
Machiavelli zunächst alle Hoffnungen in die Kraft der Vernunft gelegt hatte, fügt er
später der Vernunft die machtvolle Durchsetzungsfähigkeit hinzu. In seinen
späteren Texten beschreibt er die militärische Macht und die staatliche Struktur als
wesentliche Aspekte für einen erfolgreichen Staat.
1.2 I Discorsi und Il Principe
Die beiden posthum erschienenen Hauptwerke Niccolò Machiavellis, Discorsi
sopra la prima Deca di Tito Livio und Il Principe (ursprünglich De principatibus),
haben eine intensive, bis heute andauernde Diskussion über die ‚wahren‘ Absichten
des Autors nach sich gezogen.
1.2.1 I Discorsi
Die Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio (I Discorsi) sind laut Capata (2011:
4) Machiavellis Hauptwerk, obwohl sie nicht die Rezeption von Il Principe
erfahren. In diesem Werk legt Machiavelli eine Gesamtschau auf das organische
Leben von Republiken, den notwendigen zivilen Gründungsvoraussetzungen, den
institutionellen Rahmenbedingungen und ihren Untergang. I Discorsi werden 1531
posthum veröffentlicht.23
Das Werk umfasst drei Büchern, die sich thematisch in (1) Angelegenheiten
der Innenpolitik einer Republik (I Libro), (2) Angelegenheiten außerhalb und zur
Erweiterung der Republik (II Libro) und (3) die Qualitäten berühmter römischer
Persönlichkeiten (III Libro) einteilen lassen. Sie entsprechen in ihrer Struktur nicht
dem klassischen Kommentar eines antiken Textes, denn Machiavelli gibt die
chronologische Struktur immer wieder für thematische Referenzen auf andere
Bücher des Titus Livius auf. Ob dies der Tatsache geschuldet ist, dass I Discorsi in
verschiedenen Phasen geschrieben wurden, oder es eine bewusste Entscheidung des
Autors war, ist Gegenstand von Diskussion (vgl. dazu Richardson 1973, Gilbert
1953).
Für Machiavelli ist vor allem die Qualität des Gründungsakts eines
republikanischen Staates von essenzieller Bedeutung für dessen Fortbestand. Zu
diesem Zeitpunkt muss die absolute Tugend (virtù) in Form eines
außergewöhnlichen Gründervaters bei der Gestaltung der Institutionen wirken.
Sobald Ordnung und Regeln hergestellt sind, ist es an der Zeit für den Herrscher
abzudanken, nur für diese Einsicht benötige es ein seltenes Maß an Selbstlosigkeit.
Debbi bene in tanto essere prudente e virtuoso [der Gründervater], che quella
autorità che si ha presa non la lasci ereditaria a un altro: perché, sendo gli uomini
più pronti al male che al bene, potrebbe il suo successore usare ambiziosamente
quello che virtuosamente da lui fusse stato usato. Oltre a di questo, se uno è atto a
ordinare, non è la cosa ordinata per durare molto, quando rimanga sopra le spalle
d’uno. (Machiavelli 2011: 75)
Als Beispiel für eine ‚goldene Zeit‘ der Republik dienen Machiavelli die
dreieinhalb Jahrhunderte der römischen Republik nach der Vertreibung des
Tyrannenkönigs Tarquinius, in denen die Geschicke Roms von den tüchtigsten
Menschen geleitet wurden (Reinhardt 2012: 263). Die eingeführten Institutionen
und Ordnungen würden mit der Zeit immer stärker der Korruption und dem
Niedergang verfallen, wenn die partikulären Interessen der einzelnen Amtsträger
die öffentliche Sache zu ihrer privaten machen. Für die Stabilität der Republik sei
es unverzichtbar, den persönlichen gesellschaftlichen Status von den24
administrativen Funktionen zu trennen und die Bürger*innen arm zu halten,
während die Staatskassen gefüllt sind. Die ewig gleiche Natur des Menschen,
getrieben von seiner Gier und Missgunst, sei der Grund für den dauerhaften
zyklischen Charakter der Geschichte und den daraus folgenden organischen Phasen
der Geburt, des Wachstums und des Niedergangs von Staaten und Staatsformen.
[…] perché nessuno rimedio può farvi, a fare che non sdruccioli nel suo contrario,
per la similtudine che ha in questo caso la virtute ed il vizio. (Machiavelli 2011:
61)
E questo è il cerchio nel quale girando tutte le republiche si sono governate e si
governano. (Machiavelli 2011: 63)
Dieser Niedergang ließe sich durch die regelmäßige Erneuerung und
Rückbesinnung auf die originären Werte und Tugenden verzögern, jedoch nicht
vermeiden. Machiavelli stellt sich die zentrale Frage, ob Florenz zu einer solchen
Erneuerung überhaupt fähig ist und war bis zuletzt zwischen Pessimismus und
Hoffnung hin- und hergerissen (Reinhardt 2012: 266). Am Beispiel der römischen
Verfassung demonstriert Machiavelli, wie die Vor- und Nachteile der Staatsformen
kombiniert werden können, um dem natürlichen Untergang zu entgehen.
Für den Niedergang von Florenz macht Machiavelli auch die Kirche
verantwortlich: Sie habe jede Hingabe und jede Religion verloren und würde
darüber hinaus die Vereinigung Italiens verhindern. Die christliche Religion, wie
sie das Papsttum lehrt, ist schädlich und Päpste handeln ohnehin konträr zu ihren
eigenen Idealen. Die Kirche würde Menschen verherrlichen, die jede
Abscheulichkeit, jede Unterdrückung passiv ertragen, anstatt Kraft und Tapferkeit
zu loben. Die Religion müsse sich den Bedürfnissen der Republik unterstellen, so
wie es im Römischen Reich praktiziert wurde:
E veramente, mai fu alcuno ordinatore di leggi straordinarie in uno popolo che non
ricorresse a Dio; perché altrimenti non sarebbero accettate. (Machiavelli 2011: 79)
[…] in ogni azione loro importante, o civile o militare; né mai sarebbero iti ad una
espedizione, che non avessono persuaso ai soldati che gli Die promettevano loro la
vittoria. (Machiavelli 2011: 83)25
Diese harte Verurteilung hätte, so De Camilli (2002: 30), zum Bruch
zwischen Machiavelli und der katholischen Kirche geführt. Religion ist ein
Herrschaftsinstrument, das Legitimation für Ordnung und Gesetze erzeugen kann.
Da sie diese Funktion in Italien nicht erfüllt, wäre sie unnütz (Reinhardt 2012: 269).
Das Funktionieren eines Staates bedingt weiters den offenen Kampf
zwischen Adeligen und dem Plebs, an dem sich die tüchtigsten Personen verdient
machen. In diesem Zusammenhang ist es nötig, dass Mächtige zu jederzeit und von
jedem angeklagt werden können. Selbst wenn sich herausstellen sollte, dass
Anklage und Verurteilung unrechtmäßig sind, ist die Tatsache nützlich, dass die
Großen sich vor den Mechanismen des Staates fürchten müssen.
I Discorsi stellen in dieser Form ein breites „laboratorio teorico-politico”
(Capata 2011: 3) dar, dass ausgehenden von einigen Kommentaren zu Titus Livius
Texten weitreichendere Argumente verfolgt.
1.2.2 Il Principe
Machiavelli schreibt sein bekanntestes Werk De principatibus (Il Principe) in
wenigen Monaten im Jahr 1513 und widmet es den Medici, mit der Motivation sich
die Gunst dieser zu sichern und wieder ein politisches Amt in Florenz bekleiden zu
dürfen. Capata (2011: 2) betont den politischen und biografischen Kontext, in dem
Il Principe verfasst wurde, denn dieser wurde und werde von vielen
Interpretationen nicht berücksichtigt (vgl. dazu De Camilli 2000: 22). Das Werk
kursiert lange Zeit als Manuskript bevor es 1532 posthum veröffentlicht wird. Es
reiht sich in die Tradition der Fürstenspiegel ein, welche bis dato als Anleitung zur
guten Herrschaft dem Fürsten Tugenden wie Milde, Gerechtigkeit und
Aufrichtigkeit lehren sollten (Reinhardt 2012: 251f). Machiavelli betont jedoch,
dass er einen anderen Weg einschlagen möchte.
E molti si sono immaginati republiche e principati che non si sono mai visti né
conosciuti in vero essere. Perché gli è tanto discosto da come si vive a come si
doverrebbe vivere, che colui che lascia quello che si fa, per quello che si doverrebbe
fare, impara più presto la ruina che la perservazione sua. (Machiavelli 2011: 33f)26
Für Reinhardt (2012: 261) ist der Inhalt des Principe eine Zusammenfassung
seiner früheren politischen Schriften, in ihrer Zusammenstellung und Konzentration
würden sie jedoch einen überwältigenden Eindruck bei den Lesenden hinterlassen.
Machiavelli wählt lateinische Kapitelüberschriften, ganz der Gattungstradition
folgend, verfasst den Inhalt aber auf Italienisch. Dies würde bereits darauf
hindeuten, dass Il Principe nicht für die Gelehrtenkreise bestimmt, sondern an jene
gerichtet war, die täglich Politik betrieben (De Camilli 2000: 23f).
Die 26 Kapiteln lassen sich in folgende Themengebiete gliedern: Die Kapitel
1 bis 11 sind der Einteilung von verschiedenen Kategorien von Fürsten gewidmet,
je nach der Art und Weise, wie sie zu ihrem Reich gelangt sind. Machiavelli
unterscheidet zwischen vererbten, neuen, gemischten und kirchlichen
Fürstentümern. Je nach Entstehungsgeschichte des Fürstentums sind andere
Herausforderungen zu bewältigen und andere Mitteln zu wählen, damit der Fürst
seine Macht ausüben und für Stabilität sorgen kann. Hier treffen wir wieder auf
Cesare Borgia als ersten Prototypen des idealen Fürsten.
[…] Cesare Borgia, chiamato dal vulgo duca Valentino, acquistò lo stato con la
fortuna del padre e con quella lo perdé, non ostante che per lui si usassi ogni opera
e facessinsi tutte quelle cose che per uno prudente e virtuoso uomo si doveva fare
[…] Se adunque si considerrà tutti e’ progressi del duca, si vedrà lui aversi fatti
grandi fondamenti alla futura potenza; e’ quali non iudico superfluo discorrere
perché io non saprei quali precetti mi dare migliori, a uno principe nuovo, che lo
esemplo delle azioni sue. (Machiavelli 2011: 17)
Die kirchlichen Fürstentümer sind für Machiavelli ein Sonderfall. Sie
werden durch die Religion zusammengehalten, gleich wie sich ihre Fürsten
anstellen. Obwohl sie nicht verteidigt werden, bleiben sie bestehen und ihre
Bevölkerung bleibt gehorsam, obwohl sie nicht regiert wird.
In den Kapiteln 12 bis 14 widmet sich Machiavelli der Organisation der
militärischen Macht, die seiner Ansicht nach sehr eng mit dem Fürsten und dem
Staat verbunden sein sollte. „Debbe dunque uno principe non avere altro obietto né
altro pensiero né prendere cosa alcuna per sua arte, fuora della guerra e ordini e
disciplina di essa” (Machiavelli 2011: 32). Er spricht sich deutlich gegen den27
Einsatz von Söldnertruppen aus und führt hierfür Beispiele aus den jüngsten
Invasionsfeldzügen in Italien an.
Die darauffolgenden Kapitel bis hin zum Kapitel 23 beschäftigen sich mit
der Beschreibung von Verhaltensregeln für einen Fürsten, wenn er oder sie die
Führung seines Fürstentums behalten möchte. Dabei spricht Machiavelli von einer
Perspektive der verità effetuale (Machiavelli 2011: 33ff) im Gegensatz zu jenen
Autoren, die utopische Vorschläge propagieren würden. In diesen Kapiteln werden
die notwendigen Charaktereigenschaften, Kompetenzen und Methoden dargelegt,
die einen erfolgreichen Fürsten ausmachen. Machiavelli beginnt mit der Analyse
der Beherrschten und ihren Eigenschaften, mit denen der Fürst umgehen muss und
der daraus ableitbaren Frage, ob es besser für den Fürsten ist, geliebt oder gehasst
zu werden? „Rispondesi che si vorrebbe essere l’uno e l’altro; ma perché e’ gli è
difficile accozzarli insieme, è molto più sicuro essere temuto che amato, quando si
abbi a mancare dell’uno de’ dua” (Machiavelli 2011: 36). Auf diesen Prinzipien
baut laut Reinhardt (2012: 254) das Konzept der Staatsräson auf: Die Kategorien
der Moral und Ethik sind nicht auf den Staat anwendbar, wenn sie damit seine
Existenz bedrohen. Vermeintlich ethische Maximen wie die Überschrift von Kapitel
19 In che modo si abbia a fuggire lo essere sprezzato e odiato sind lediglich in ihrer
Funktion zur Erhaltung der Macht zu verstehen (Reinhardt 2012: 255).
Das Kapitel 24 rekapituliert die Gründe für die schwache politische Position
der italienischen Staaten, die auf die mangelhaften Fähigkeiten der heimischen
Fürsten zurückzuführen sei.
Pertanto questi nostri principi, e’ quali erano stati molti anni nel loro principato,
per averlo di poi perso, non accusino la fortuna, ma la ignavia loro: perché, non
avendo mai ne’ tempi quieti pensato ch’e’ possino mutarsi […] quando poi vennono
e’ tempi avversi, pensorno a fuggirsi non a defendersi […]. (Machiavelli 2011: 51)Sie können auch lesen