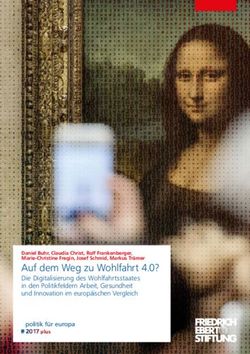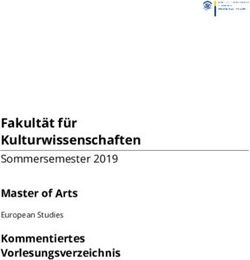Stay queer? Eine empirische Auseinandersetzung mit trans* Theoriearbeit HS 13 / FS 14 Betreuung: Simon Graf, Klaus Schönberger Autor_innen: Sarah ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Stay queer?
Eine empirische Auseinandersetzung mit trans*
Theoriearbeit HS 13 / FS 14
Betreuung: Simon Graf, Klaus Schönberger
Autor_innen: Sarah Lauener, Anja Zuberbühler
Zürcher Hochschule der Künste
Bachelor Medien und Kunst
Vertiefung Theorie2 Dank In erster Linie wollen wir uns bei den Menschen bedanken, die sich konkret an dieser Arbeit beteiligt haben, uns ihre Zeit, Offenheit und ihr Vertrauen entgegenbrachten, indem sie sich auf sehr persönliche Gespräche mit uns einliessen. Die Treffen waren meist berührend und freundschaftlich, manchmal auch aufwühlend oder verwirrend, in allen Fällen aber sehr bereichernd und lehrreich. Vielen Dank auch an unsere Dozent_innen Annemarie Bucher, Martina Fritschy, Simon Graf, Francis Müller und Klaus Schönberger, die uns inhaltlich und formal unterstützt haben. Ohne das Zutun dieser Personen wäre diese Arbeit nie zu Stande gekommen und deshalb sind wir sehr dankbar für alle Inputs und Auseinandersetzungen, jede Kritik und Empfehlung. Und ebenfalls ein grosses Merci an unsere Partner_innen, Familien und Freund_innen, die uns Anregungen zu diesem Thema gaben, uns stets unterstützend zur Seite standen und vorab die Arbeit korrigiert und kritisiert haben.
3 Abstract In dieser Arbeit setzen wir uns mit Fragen zum Thema trans*gender auseinander. Als Grundlage dazu dienen uns Gespräche, welche wir mit Trans*personen geführt haben, die sich entweder in einer Transition befinden, diese bereits abgeschlossen haben oder ein queeres Selbstverständnis haben und keinen eindeutigen ›Geschlechterwechsel‹ anstreben. Dies beinhaltet immer auch eine Kritik an der binären Geschlechterordnung, die sie auch verkörpern. Viele Trans*menschen, für die eine Transition ein wesentlicher Schritt ist, sehen in einem Passing eine wichtige Bedingung, um gesellschaftlich anerkannt zu werden. Während einige unserer Gesprächspartner_innen diesen Anerkennungsprozess kritisch reflektieren, fordern andere Verständnis und Akzeptanz für die Norm der Zweigschlechtlichkeit und begreifen trans* als ›Abweichung‹. Aus queer-feministischer Perspektive ist es für uns hierbei interessant, wie sich Trans*personen innerhalb der Zweigeschlechtlichkeit bewegen, aber gerade auch wo sich Alternativen dazu aufzeigen lassen und inwiefern trans* die scheinbare Starrheit der heteronormativen Gesellschaft als konstruiert ausweist. Vor diesem Hintergrund befragen wir die Trans*personen zu Massnahmen wie geschlechtsangleichende Operationen, Hormoneinnahme und die damit teilweise verbundene Eingliederung in die dichotome Geschlechterordnung. Ebenso befassen wir uns mit ihren individuellen Lebensgeschichten, Aussagen, Vorstellungen und Überlebenstaktiken.
4
Inhaltsverzeichnis
1
Einleitung ............................................................................................................................. 6
1.1
Relevanz ........................................................................................................................ 8
1.2
Zur Terminologie ........................................................................................................ 10
1.3
Aufbau der Arbeit........................................................................................................ 12
1.4
Methodik - Vorgehen .................................................................................................. 13
1.4.1
Newsletter Transgender Network Switzerland ..................................................... 15
2
Theorie ............................................................................................................................... 18
2.1
Performative Körperakte ............................................................................................. 18
2.2
Heteronormativität ...................................................................................................... 22
3
Gesprächspartner_innen ..................................................................................................... 26
Chris ..................................................................................................................................... 27
Daniela ................................................................................................................................. 28
Helena................................................................................................................................... 29
Kai ........................................................................................................................................ 30
Katja ..................................................................................................................................... 31
Lio ........................................................................................................................................ 32
Luisa ..................................................................................................................................... 33
Romeo Koyote Rosen........................................................................................................... 34
Stephanie .............................................................................................................................. 35
4
Aus dem Alltag von Trans*menschen ............................................................................... 36
4.1
Soziales Umfeld .......................................................................................................... 37
4.2
Coming-out .................................................................................................................. 40
4.3
Passing ........................................................................................................................ 43
4.4
Diskriminierung .......................................................................................................... 46
4.5
Umgang mit Normen und Begriffen ........................................................................... 50
5
Fazit / Schlussbemerkungen ............................................................................................... 56
6
Glossar / Begriffserklärungen ............................................................................................ 60
7
Literaturverzeichnis ............................................................................................................ 68
8
Links ................................................................................................................................... 70
9
Anhang ............................................................................................................................... 72
9.1
Gerichtsurteil: Registrierung der Geschlechts- und Namensänderung ....................... 72
9.2
Abstract: Transpersonen und Arbeitsmarkt................................................................. 78
9.3
Weiterführende Literatur zu trans*, Gender und Empirie........................................... 80
9.4
Links ............................................................................................................................ 81
9.5
Links zu Texte ............................................................................................................. 82
9.6
Links zu Glossars (Begriffe) ....................................................................................... 82
5 9.7 Fragebogen .................................................................................................................. 84 10 Eigenständigkeitserklärung .............................................................................................. 85
6
1 Einleitung
Aufgrund eigener alltäglichen Erlebnisse, Erfahrungen und Beobachtungen interessieren wir
uns für Phänomene wie Selbstdarstellung, gesellschaftliche Normen und Identitäten. Wir
hinterfragen jene Konzepte, welche uns in Schranken weisen und aus scheinbar
unerklärlichen Gründen einfach existieren. So befassen wir uns damit wie Vorstellungen von
Weiblichkeit und Männlichkeit entstehen. Warum wirkt eine Frau mit viel Gesichts- oder
Beinbehaarung männlich oder ein Mann ohne Bartwuchs und einer schmalen Statur weiblich?
Wie wird eine bestimmte Person als ›normal‹ und eine andere als ›Abweichung‹
ausgewiesen? Wie entstehen gesellschaftliche Vorschriften, die besagen wie sich eine Frau zu
kleiden, zu verhalten und zu sprechen hat? Wie wird das Konzept Mann (re)produziert? Wie
werden bestimmte Handlungsformen zu Tabus und andere zu legitimierten, normativen
Akten? Wie kommt die Idee einer geschlechtlichen Identität auf, wenn sie nicht durch die
Sprache ausformuliert würde? In dem Zusammenhang: wie bilden sich Annahmen von zwei
voneinander getrennten Geschlechtern, die sich in ihrem Sexus, in ihrem Begehren und in
ihrer sexuellen Praxis unterscheiden?
Vor allem durch unser Studium haben wir uns eine kritische Denkweise in Bezug auf
Geschlechternormen und (Über)Lebenstaktiken angeeignet und hinterfragen Normen,
Strukturen, Begrifflichkeiten und ihren diskursiven Entstehungszusammenhang. Wir haben
Interesse an queer-feministischen und philosophischen Theorien entwickelt und befassen uns
genauer mit Taktiken, die die rigide Zweigeschlechterordnung in Frage stellen. Mit Michel de
Certeau verwenden wir anstelle von Strategien den Begriff der Taktiken. Weil nach Certeau
die Taktik die List ist, die »überraschend in eine Ordnung eindringt«, ein Witz, eine
Taschenspielerei. Die Taktik hat keinen Ort, »sie hat nur den Ort des Anderen. [...] Ohne
eigenen Ort, ohne Gesamtübersicht, blind und scharfsinnig wie im direkten Handgemenge,
abhängig von momentanen Zufällen, wird die Taktik durch das Fehlen von Macht bestimmt,
während die Strategie durch eine Macht organisiert wird«. Strategien schaffen totalitäre
Systeme und Diskurse, Taktiken hingegen sind Handlungen, »die auf einen geschickten
Gebrauch der Zeit, der Gelegenheit, die sie bietet, und auch der Spiele, die sie in die
Grundlagen einer Macht einbringt, setzten«. So ist die Taktik mobil, sie ist eine Bewegung,
die für Überraschung sorgt und sie tritt dort auf, »wo man sie nicht erwartet«.1
1
Certeau (1988), S.85f7
Wir haben Menschen getroffen, die sich als trans 2 , und/oder queer verstehen, sich in,
zwischen oder neben den Geschlechterkategorien Frau und Mann bewegen, sich als
»Transform«, FtM, MtF, als Tomboy, geschlechtslos, LesBiSchwul beschreiben oder sich gar
nicht über bestimmte Begriffe definieren wollen, beziehungsweise je nach Situation,
Stimmung, Vorstellung und Dringlichkeit ihre Kategorien frei wählen. Menschen, die weder
ihr Geschlecht, noch ihr sexuelles Begehren aussprechen und somit festlegen wollen. Die
Gespräche waren für uns sehr lehrreich in vielerlei Hinsicht. Vor allem, dass trotz all den
Rastern und Regelungen eine emanzipatorische Lebenskonzeption stattfinden kann und soll,
um innerhalb gesellschaftlichen Schranken neue Räume und Möglichkeiten von Autonomie
zu schaffen und Geschlechtervielfalt zu leben. Die vorherigen Fragen und folgende Themen
sind in unserer empirischen Arbeit zentral und stellen die Basis dar, um über unterschiedliche
Positionen und Lebenskonzepte von Menschen zu sprechen, die sich zwischen oder neben den
herkömmlichen Kategorien Frau und Mann verorten lassen, die damit die vermeintliche
›Natürlichkeit‹ von Geschlecht in Frage stellen. ›Natur‹ dient in dem Zusammenhang oftmals
als Legitimation, welche die Geschlechterkategorien Frau und Mann nicht als Konstrukte,
sondern als unhinterfragt gegeben ausweisen.
Wir werden verschiedene Auffassungen von trans* und/oder queer beleuchten, wobei keine
als dominant erscheinen soll. Wir diskutieren mit welchen Begriffen sich die befragten
Trans*menschen beschreiben, wie sie mit der Norm der Zweigeschlechtlichkeit umgehen und
ob sie Frau und Mann als einschränkende Begriffe empfinden. Wir fragen nach Taktiken, die
sie innerhalb der Rasterung und Normierung der Geschlechter entwickeln. Wir wollen wissen
wie ihr Umfeld reagiert hat, ob das Coming-out befreiend, die Transition ein unumgehbarer
Weg war und welchen alltäglichen Herausforderungen sie sich stellen müssen. Wir möchten
herausfinden, ob sie normative Auffassungen aufgrund ihrer Geschlechtsangleichung
bestätigen oder neue, festgefahrene Bilder generieren und aus welchem Bedürfnis heraus der
Wunsch nach einer geschlechtsangleichenden Operation entsteht.
2
trans und weitere Begriffsklärungen (kursiv) Glossar ab S.588
1.1 Relevanz
Butler beschreibt, dass »wir zwar Normen brauchen, um leben zu können, und gut leben zu
können, und um zu wissen, in welche Richtung wir unsere soziale Welt verändern wollen,
dass wir aber auch von den Normen in Weisen gezwungen werden, die uns manchmal Gewalt
antun, so dass wir sie aus Gründen sozialer Gerechtigkeit bekämpfen müssen«.3
Normen sind festgefahrene, kulturelle Bilder, Grundsätze und Regeln, die sich unterscheiden
und vor allem verändern können. Das traditionell bürgerliche Konzept der Hausfrau, die
Kinder gebärt und hauptsächlich für die Erziehung und Hausarbeit zuständig ist, war in der
Schweiz über Jahre hinweg ein gängiges Leitbild der Familienpolitik, welches in den letzten
fünfzig Jahren durch viele, neue Familien- und Lebensmodelle in Frage gestellt wurde. Oder
die Regulierung des Adoptionsrechts für gleichgeschlechtliche Paare, das in den letzten paar
Jahren immer wieder neu gesetzt und wohl zukünftig noch weiterhin diskutiert wird.4 Es sind
Prozesse, die langwierig, teilweise mühsam und sehr vertrackt sind, so dass Veränderungen
und neue Perspektiven nicht von heute auf morgen generiert werden. Doch unserer Ansicht
nach ist es trotzdem wichtig, sich in solche Prozesse einzuschalten und gesellschaftliche
Veränderungen zu unterstützen. Diesen Text verstehen wir auch als einen solchen Eingriff.
Wir wollen nicht nur die Aufmerksamkeit auf die Thematik lenken und persönliche
Geschichten von Menschen erzählen, sondern uns damit auch in den Geschlechterdiskurs
einmischen. Wir wollen auf die Marginalisierung von Menschen hinweisen, die aufgrund
ihres Geschlechts, ihrer Lebenskonzeption und Überlebenstaktiken Ausgrenzung,
Diskriminierung und Gewalt erfahren. Und wir wollen aufzeigen, dass aufgrund des
konstruierten Charakters des Geschlechts ein Potential im Prozess der Wiederholung inhärent
ist, der Verschiebungen von Normen zulässt und auslöst.
Infolge unserer kritischen Position gegenüber hegemonialen Strukturen und Normen erachten
wir es als unerlässlich uns in politische Gefilde wie dem der Geschlechtertheorien
einzumischen um dabei auf Missstände, Ungerechtigkeiten, aber auch auf Taktiken, die einen
möglichen Wandel hervorrufen, hinzuweisen. Wir wollen nicht nur unser eigenes
Bewusstsein stärken und uns solidarisch zeigen, sondern in eine gesellschaftliche und
politische Debatte eingreifen und uns gegen (hetero)sexistische Praktiken positionieren und
Konstruktionen wie jene der Geschlechter hinterfragen.
3
Butler (2009), S.327
4
Sozialinfo (2012): Adoptionsrecht – Homosexuelle dürfen Stiefkinder adoptieren9
Diese Aufgabe innerhalb der Theorie, die wir uns selber aufgeben und der wir uns in dieser
Arbeit stellen, verstehen wir über Butler als eine politische Praxis. Sie begreift Theorie selbst
als verändernd, betont aber auch, dass zusätzlich eine »Einmischung auf gesellschaftlicher
und politischer Ebene, zu denen Aktionen, ausdauernde Bemühungen und institutionalisierte
Praxis gehören«5, notwendig sei um soziale und politische Veränderung anzustreben. So
besteht unsere Arbeit nicht aus einer rein theoretischen Abhandlung, sondern hat ein explizit
gesellschaftspolitischer Anspruch und versucht die beiden Ebenen zu verschränken. Durch
einen bewussten Umgang mit der Sprache, mit bestimmten Begriffen und Kategorien wollen
wir einerseits einen Rahmen bilden, der auch einen Zugang für Leser_innen schafft, die sich
mit der Trans*thematik nicht auskennen. Auf der anderen Seite stellte sich uns die Frage, wie
wir über ein Thema sprechen können ohne eine begriffliche Setzung, ohne selber wieder
einzuordnen und festzuschreiben. Wie sollen wir über ein übergeordnetes Thema diskutieren,
wobei sich viele Beteiligte nicht über diese Kategorien definieren? Einzig möglich war die
Einigung auf einige Begriffe, die nicht vereinheitlichen sollen und Erweiterungen zulassen,
die nicht definieren sollen, sondern einen Diskussionsraum eröffnen, der Verhandlungen
zulässt und festgefahrene und festschreibende Begriffe kritisch behandelt.
5
Butler (2009), S.32510 1.2 Zur Terminologie Wir haben uns für den englischen Begriff trans*gender entschieden, da er alle möglichen Untergruppierungen und Beschreibungen zulässt und von Menschen positiv angeeignet wird, »die den heteronormativen Kategorien von ›Mann‹ oder ›Frau‹ nicht entsprechen können oder wollen. Das kann Transvestiten, CrossdresserInnen, Drag Kings und Queens umfassen, genau so wie Butches, Femmes oder sehr weibliche Schwule«. 6 Aber auch Trans*frauen, Trans*männer, zwischengeschlechtliche oder LesBiSchwule Menschen, die sich als queer verorten und Menschen, die Lebenskonzepte aufzeigen, »die verschiedene Räume und Denkmöglichkeiten [eröffnen], welche die starre Einteilung der Menschheit in ›zwei Geschlechter‹ infrage stellen«.7 Die Verwendung des Begriffes auf diese Weise ist in vielerlei Hinsicht problematisch, da sich einerseits nicht alle Trans*menschen als ›im falschen Körper geboren/lebend‹ verstehen und andererseits sich nicht alle Trans*menschen weiterhin als trans* auffassen wollen. Ebenso sehen sich zwischengeschlechtliche Menschen nicht unbedingt in der Gruppierung von queer, trans*gender und LesBiSchwulen Menschen. Dennoch möchten wir einen Oberbegriff benützen, nicht um rechtliche Unterschiede oder individuelle Umgänge und verschiedene Interessen unter den Teppich zu kehren, sondern um mit einer Kategorie zu arbeiten, die eine grössere, wenn auch differenzierte Masse fasst und die dadurch auch eine politische Relevanz erhält. »Der gemeinsame Nenner ist das Interesse an Differenz und an einer Gesellschaft, in der Differenzen lebbar sind.«8 Hierbei geht es um fliessende Begriffe, um ein ständiges Bewegen, Verändern, Schwanken und immer wieder neu Formieren. trans* gebrauchen wir so als einen erweiterbaren Begriff (wie -gender, -mensch, -mann, - frau). Das Sternchen deutet auf eine Öffnung hin, das trans* ist somit nicht festgelegt und wird mit dem Ausdruck ergänzt, den die Personen jeweils für sich verwenden.9 Wir deuten trans* aus einer queeren Perspektive, im Sinne von übersteigend, überschreitend, ewig- unendlich und transformativ, also die Möglichkeit zur Umformung, Umgestaltung. Somit entspricht es einem Prozess, der sich nicht zu einem Ideal hin bewegt, sondern nie abgeschlossen sein wird und sich stetig verändert. 6 polymorph (2002), S.14 7 polymorph (2002), S.9 8 Raunig (2000), S.46f 9 Schuster 2008, S.129
11 In der direkten oder indirekten Rede verzichten wir bei dem Begriff trans auf den zusätzlichen Stern, da wir unseren Gesprächspartner_innen keine Begriffsdefinitionen vorschreiben möchten. Die Bezeichnungen Frau, beziehungsweise Mann sehen wir als vermeintlich ›natürliche‹ und somit dominante Kategorien innerhalb der »heterosexuellen Matrix« und setzen sie deshalb kursiv, wenn sie alleine stehen. Viele unserer Gesprächspartner_innen verwenden während unseren Gesprächen das Wort ›mer‹, was wir im Text mit ›man‹ übersetzt haben. ›Man‹ ist der Nominativ Singular einer Vorläuferform von Mann und hat ursprünglich die Bedeutung ›jeder beliebige Mensch‹. Wir wollen ›mer‹ als ›nicht-gegenderte‹, also geschlechtsneutrale Form/Figur insbesondere der Alltagssprache nicht gänzlich aus der Arbeit streichen, da wir den Gesprächspartner_innen keine Formen vorgeben und ihre Sprache, beziehungsweise den Stil ihrer Sprache nicht verändern wollen. So setzen wir ›man‹ kursiv. Dasselbe gilt für ›jemand‹, was für ›öpper‹ steht. Den Unterstrich, gender gap, benutzen wir um einen Spielraum zwischen der weiblichen und männlichen Form aufzutun und um auf ein mögliches Jenseits des Zweigeschlechterregimes hinzuweisen. Wir haben uns gegen Formen wie Gesprächspartnerin/Gesprächspartner entschieden, da sie wiederum Menschen ausschliessen, die sich als weder weiblich noch männlich verstehen. Wir gebrauchen stets Formen wie Gesprächspartner_innen und verwenden Sie_Er oder Er_Sie. Die männliche Form bei Gesprächspartner_innen steht aus rein praktischen und leser_innenfreundlichen Gründen an erster Stelle. Ansonsten setzten wir die weibliche Form wie bei Sie_Er, Frau_Mann zuerst, um uns dem üblichen Sprachgebrauch zu widersetzen. In einigen Absätzen haben wir unsere Regelungen durchbrochen und die Reihenfolgen verändert, einerseits um aus einem eigenen Bedürfnis heraus mit diesem spielerischen Umgang der Sprache der Arbeit und der Idee der Auflösung der Geschlechter gerecht zu werden und andererseits auf Wunsch der Gesprächspartner_innen, die sich nicht durch Pronomina oder Benennungen festlegen möchten. Ein ›wir‹ bezieht sich, wenn nicht anders gekennzeichnet immer auf uns als Verfasser_innen.
12 1.3 Aufbau der Arbeit Der erste Teil dieser Arbeit widmet sich der Methodik und insbesondere der Kontaktaufnahme zu unseren Gesprächspartner_innen. Im Theorieteil konzentrieren wir uns aus einem poststrukturalistischen Blickwinkel auf performative Körperakte und befassen uns mit dem Begriff der Heteronormativität und ihrer Bedeutung für Trans*menschen. Diese theoretische Auseinandersetzung soll die Basis für den empirischen Teil darstellen. In der Empirie werden neun Gesprächspartner_innen einzeln vorgestellt, indem wir auf ihre ganz unterschiedlichen Lebensgeschichten eingehen. Darauffolgend werden ihre Positionen, Gedanken und Theorien analysiert und unter unterschiedliche Kategorien gefasst. In diesen Abschnitten geht es uns darum, die Diversität der verschiedenen Auffassungen und Positionen zu veranschaulichen. Die Arbeit wird mit einem persönlichen Fazit abgerundet, in welchem unsere Erkenntnisse der geführten Gespräche zusammengefasst werden, wir unsere Schlüsse aus der Arbeit ziehen und einen möglichen zukünftigen Umgang mit trans* und Geschlecht ausformulieren.
13 1.4 Methodik - Vorgehen Für diese empirische Arbeit wurden leitfadenorientierte Gespräche mit insgesamt elf in der Deutschschweiz lebenden Trans*menschen im Alter zwischen 20 und 57 Jahren durchgeführt. Der Kontakt zu den Personen wurde über die Newsletter der Organisation Transgender Network Switzerland (TGNS) und des Sündikats hergestellt. In den Newslettern wurde mit einem Abstract zur Teilnahme an der Befragung für die vorliegende Bachelorarbeit aufgerufen. Vereinzelt wurden persönliche Bekannte auch gezielt kontaktiert. Der erste Austausch erfolgte jeweils über persönliche E-Mails, wobei die Interessent_innen über den aktuellen Arbeitsstand informiert und zu einem Treffen eingeladen wurden. Vor dem vereinbarten Treffen wurden die Gesprächsteilnehmer_innen gebeten einen Fragebogen mit persönlichen Eckdaten (Name, Alter, Beruf, etc.) auszufüllen. Der Fragebogen beinhaltete teils aufgeladene Begriffe, wie Coming-out, Passing oder ›biologisches‹/›seelisches Geschlecht‹ und eröffnete dadurch einen Raum für Diskussionen. Viele Begriffe, die in den queer-feministischen Debatte benutzt und problematisiert werden, blieben von unseren Gesprächspartner_innen unhinterfragt und so realisierten auch wir teilweise erst während des Arbeitsprozesses die Dimension gewisser Begrifflichkeiten, mit denen wir anfänglich arbeiteten. Wir wollen auch darauf verweisen, dass es sich sowohl in den Gesprächen, als auch im generellen Diskurs als schwierig erweist, sich über ein Thema zu unterhalten, welches so viele aufgeladene und prekäre Begriffe beinhaltet. Wir waren uns während der Gespräche und sind uns auch jetzt unserer Verantwortung bewusst. Wir haben versucht mit sehr viel Vorsicht und Sensibilität auf die Personen und ihre Bedürfnisse einzugehen und haben in jedem Fall ihre Kritiken oder Empfehlungen berücksichtigt. So machte Romeo Koyote Rosen uns darauf aufmerksam, dass der Fragebogen ein Trigger für ihn_sie dargestellt hätte. Die Fragen nach einem ›biologischen‹/sozialen Geschlecht, nach den Eltern und seiner_ihrer ›Herkunft‹, seien für ihn_sie schwierig zu beantworten gewesen. Damit ist unsere vorhergehende Unterhaltung per E-Mail gemeint, bei der wir den Fragebogen als Datei angehängt hatten. Diese Anmerkung wollen wir ernst nehmen und deswegen schicken wir eine Triggerwarnung voraus. Im empirischen Teil, bei dem wir die Gesprächspartner_innen erzählen lassen, werden Mehrfachdiskriminierungen und Gewaltdarstellungen beschrieben. Trans*menschen werden im medizinisch-pathologischen Diskurs als ›krank‹ (beziehungsweise als Menschen mit Identitätsstörungen) bezeichnet, wovon wir uns stark distanzieren wollen.
14 Die Gespräche fanden im Zeitraum zwischen November 2013 und März 2014 statt und wurden meist zu dritt im Atelier der Vertiefung Theorie an der Förrlibuckstrasse in Zürich durchgeführt, vereinzelt auch in Cafés oder auf Wunsch bei den jeweiligen Personen zu Hause. Die Gespräche dauerten jeweils zwischen 60 und 90 Minuten und wurden mit Einwilligung der Befragten mit der iPhone-App Sprachmemos digital aufgezeichnet. Die Gespräche wurden teilweise ganz und andere entlang der Kategorienbildung selektiv transkribiert, analysiert und ausgewertet. Die Gespräche wurden mittels der Methode des autobiografisch narrativen Interviews 10 durchgeführt, wobei sie möglichst offen gehalten wurden. Im Zentrum standen die Erzählungen der Personen in Bezug auf ihr Trans*dasein, also Themen wie Coming-out, soziales Umfeld, geschlechtsangleichende Massnahmen und bürokratische, juristische Regelungen zum Thema trans* im jeweiligen Kanton. Der zweite Strang stellte die jeweilige Positionierung zur Trans*thematik dar, beziehungsweise die Verortung im Feld der dichotomen Geschlechterkategorien Frau und Mann. Aus zeitlichen Gründen konnten wir leider die Positionen von zwei von den insgesamt elf Gesprächsteilnehmer_innen in dieser Arbeit nicht weiter ausführen. Ronja und Daniel hinterfragen ihr eigenes Geschlecht, ihre Sexualität, ihre Begehren und somit die heterosexuelle Norm, sind jedoch nicht von denselben Diskriminierungsformen betroffen wie die anderen neun Trans*menschen, die wir getroffen haben. Sie haben diese Arbeit durch Inputs, ihre Ausführungen und Erzählungen nachhaltig beeinflusst, wofür wir uns nochmals herzlich bei ihnen bedanken möchten. Der Austausch mit Ronja und Daniel hat uns ebenso motiviert das Geschriebene fortwährend zu überdenken, anders zu denken, umzuschreiben und uns auf einen endlosen Prozess von Veränderung und Neuorientierung einzulassen. 10 Schütze (1983): S.285: »Das autobiografisch narrative Interview erzeugt Datentexte, welche die Ereignisverstrickungen und die lebensgeschichtliche Erfahrungsaufschichtung des Biographieträgers so lückenlos reproduzieren, wie das im Rahmen systematischer sozialwissenschaftlicher Forschung überhaupt nur möglich ist.«
15 1.4.1 Newsletter Transgender Network Switzerland Die erste E-Mail an TGNS im Oktober 2013, mit der Bitte zur Aufnahme in den Verteiler, beinhaltete folgenden Aufruf: »Liebe Freund_innen Seit einiger Zeit setze ich mich mit gender studies auseinander (dafür war ich kürzlich auch ein halbes Jahr in Berlin an der Humboldt Universität, was mir wiederum einen anderen Blick auf die ganze Thematik gezeigt hat). Vertieft beschäftige ich mich mit dem Thema trans, nicht als eigens betroffener Mensch, sondern aus Interesse und Solidarisation. Viele Freund_innen und Bekannte von mir befinden sich vor, in oder nach der Transition. Durch die gender studies (und Theorien wie z.B. die von Judith Butler) habe ich eine kritische Haltung gegenüber gesellschaftlichen Normen und Strukturen entwickelt, aber genau so hinterfrage ich für mich immer wieder die geschlechtsangleichenden Massnahmen, denen sich Transmenschen mit sehr viel Geduld, Leid und Schmerz unterziehen wollen, vielleicht auch sogar müssen, um gesellschaftlich anerkannt zu werden. Hierbei wäre auch die Frage zentral inwiefern der Wunsch des Strebens nach einem Ideal gesellschaftlich verankert ist oder beim Individuum selber stattfindet. Zurzeit studiere ich im fünften Semester an der Zürcher Hochschule der Künste, in der Vertiefung Theorie. Für meine Bachelor-Arbeit wünschte ich mir eine enge Zusammenarbeit mit einer Transperson, die sich genau so kritisch positioniert (sei das gesellschaftlich oder gewissen Theorien gegenüber oder auch medizinischen Massnahmen wie Operationen, Hormoneinnahme usw.) und Interesse daran hätte mit mir zusammen einen Text zu veröffentlichen. Im Zentrum dieses Textes steht die Transperson. Mir geht es bei dieser Arbeit einerseits um Sichtbarkeit der Transthematik und andererseits um ein Portrait einer Transperson und genau so darum für mich einige Fragen klären zu können. Ein Teil des Formates würden unsere Gespräche ausmachen, die so gedruckt würden und der zweite Teil beinhaltet eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Thema trans in der Gesellschaft (und dabei gehe ich von einer westlichen, weiss geprägten Gesellschaft aus). Privat setze ich mich im Verein homo-sapiens ein, den einige von euch womöglich bereits kennen. Wenn nicht, könnt ihr euch sehr gerne auf unserer Homepage informieren: http://weare.homo-sapiens.ch Falls Interesse besteht, schreibt mich an und dann könnten wir uns treffen um alles weitere zu besprechen.
16 Es gibt genau so die Möglichkeit das ganze anonym zu verfassen, so dass sich keine Person outen muss. Es geht mir jedoch um eine tatsächliche Lebensgeschichte, die ich versuche in den Text einfliessen zu lassen. Der Text sollte für möglichst viele Menschen zugänglich sein und je nachdem lässt er sich auch in einem Magazin drucken oder auf einer Internetseite platzieren, je nachdem wie das Ergebnis ausschaut und was die Möglichkeiten schlussendlich wären. Dazu kann ich zurzeit noch nicht viel sagen. Vorab also bloss eine Art Skizzierung von diesem Projekt. Vielen Dank und ich freue mich auf Inputs, Anregungen und vielleicht Menschen, die Freude an so einem Projekt hätten! Herzlich, anja« Auf diese E-Mail reagierte Henry Hohmann, der Co-Präsident von TGNS, mit folgender Anmerkung, welche bereits als Positionierung im Feld gelesen werden kann. »Hallo Anja [...] Und noch eine kleine Randbemerkung: Du schreibst von den geschlechtsangleichenden Massnahmen, denen man sich unterziehen muss, um gesellschaftlich anerkannt zu werden. Das stimmt, ist aber nur eine Seite der Medaille, denn das tönt für mich jetzt so, als würden es die Transleute nur machen, um sich dem gesellschaftlichen Druck zu beugen. Für viele ist aber genauso wichtig - und für manche sogar noch wichtiger -, dass der Körper stimmt. Und das machen sie für sich, nicht für die Gesellschaft. Das wäre also schon mal ein interessanter Diskussionspunkt für Deine Arbeit... :-) Herzliche Grüsse [...]« Daraufhin wurde die E-Mail folgendermassen angepasst: »[...] denen sich Transmenschen mit sehr viel Geduld, Leid und Schmerz unterziehen wollen, vielleicht auch sogar müssen, um gesellschaftlich anerkannt zu werden. Hierbei wäre auch die Frage zentral inwiefern der Wunsch des Strebens nach einem Ideal gesellschaftlich verankert ist oder im Individuum entsteht. [...]« Innerhalb von einer Woche erhielten wir fünfzehn Reaktionen, welche meist mit Interesse an einer Zusammenarbeit verbunden waren. Teilweise wurden Zustimmung oder Kritik geäussert oder Nachfragen gestellt. Aufgrund des unerwartet grossen Feedbacks wurde daraufhin entschieden, die Arbeit nicht mit nur einer Trans*person durchzuführen, sondern eine Auseinandersetzung mit
17 verschiedenen Trans*positionen zu realisieren. Das Abstract wurde dementsprechend angepasst und im gleichen Zuge wurde entschlossen, dass diese Arbeit zu zweit im Sinne eines Kollektivs durchgeführt wird, worauf durch einen klasseninternen Aufruf Sarah zur Arbeit dazu stiess. Der Entschluss zur Zusammenarbeit erfolgte einerseits aus praktischen Gründen, da durch die Erweiterung von einer auf mehrere Trans*personen der Aufwand der Arbeit in einer Zeitspanne von neun Monaten alleine nicht zu bewältigen gewesen wäre. Andererseits schien uns eine Arbeit als Kollektiv als eine logische Konsequenz, um die vielen unterschiedlichen Aspekte rund um das Thema trans* und die verschiedenen Positionen aus nicht nur einer Perspektive zu betrachten, sondern um damit einen Diskussionsraum zu eröffnen. Die meist verwendete Dreierkonstellation hat die Gesprächssituation von einer strikten Interviewsituation hin zu einem persönlichen Gespräch geöffnet.
18
2 Theorie
2.1 Performative Körperakte
Das folgende Kapitel beschäftigt sich mit den theoretischen Konzepten, auf die wir uns in
dieser Arbeit stützen. In einer Auseinandersetzung mit trans* sind für uns Begriffe wie
Subjektwerdung, Identität, somit auch Geschlechtsidentität, Körper, Kohärenz,
Zweigeschlechtlichkeit und Inszenierung sowie Performativität zentral. Ausserdem möchten
wir den Begriff der Heteronormativität fassen können, wobei wir uns vor allem auf Judith
Butler stützen und anfügen müssen, dass in den queer-feministischen Diskussionen
unterschiedliche Heteronormativitätskonzepte bestehen, die sich auf verschiedene Facetten
des heterosexuellen Machtregimes konzentrieren. »Allen ist gemeinsam, dass sie die
Machtverhältnisse, die sich um Heterosexualität(en) entfalten, kritisch untersuchen.«11
Anstatt Apriori von einer Identität auszugehen, wollen wir von dem butlerschen Begriff der
Subjektwerdung Gebrauch machen. Über Foucault, der die Subjektwerdung als
12
»Unterwerfungsprozess in machtdurchzogenen, diskursiven Strukturen« beschreibt, versteht
Butler die Subjektivierung einerseits als Existenzstreben, nicht als Anerkennungsstreben, und
andererseits als »eine Abgrenzung und Ausblendung von unserer fundamentalen
Abhängigkeit«. 13 Subjekte werden abhängig geboren, indem sie auf Menschen, auf ein
soziales Umfeld und Normen angewiesen sind und versuchen unabhängig zu werden, indem
sie deren Wichtigkeit verweigern und sich als individuelle Wesen und selbständig
existierende Identitäten begreifen. Wir gehen nicht von einer gegebenen Identität, von einer
Seele oder einem ursprünglichen Geschlecht aus, sondern wir verstehen Identität und so auch
Geschlechtsidentität als Kategorien, die innerhalb einer heteronormativen Struktur und
diskursiv zum Vorschein kommen. »Geschlechtszugehörigkeit ist keine stabile Identität,
vielmehr ist sie eine Identität, die stets zerbrechlich in der Zeit konstituiert ist – eine Identität,
die durch eine stilisierte Wiederholung von Akten zustande kommt. [...] Geschlechtsidentität
wird durch Äusserungen und Ausdrucksformen performativ hervorgebracht.«14 Auf dieser
Basis stellen wir Fragen nach Begrifflichkeiten, nach anderen Geschlechtsmodellen und
möglichen ›neuen‹15 Kategorien. Wir wollen die Tatsache, dass die Kategorien Frau und
Mann im Normgefüge der Zweigeschlechterordnung bestehen nicht von der Hand weisen,
11
Hartmann, Klesse, Wagenknecht, Fritzsche, Hackmann (Hrsg.) (2007), S.11
12
Redecker (2011), S.47
13
Redecker (2011), S.97
14
Hauer und Paul in Gigi (2006), S.2
15
Butler (2009), S.347: »Weil die Normen, welche die Realität reagieren, diesen Genderformen nicht
zugestanden haben, real zu sein, werden wir sie notgedrungen als neu bezeichnen. Ich hoffe allerdings,
wir werden wissend lachend, sobald wir das tun.«19
ebenso bestreiten wir nicht die »Existenz körperlicher Geschlechtsteile und die körperlichen
Unterschiede, vielmehr wollen wir die Weise, [wie] diese diskursiv in Beschlag genommen
werden« und die Dichotomie der Zweigeschlechtlichkeit »radikal in Frage stellen«.16 Mit
Butler denken wir, dass ein Ausserhalb der symbolischen Zweigeschlechterordnung möglich
ist, doch alle Menschen, die sich nicht im Raster der Zweigeschlechtlichkeit befinden, gelten
in der Welt der Heteronormativität als unlesbar, nicht verständlich und sind somit inexistent.
»Intelligible Geschlechtsidentitäten sind solche, die in bestimmtem Sinne Beziehungen der
Kohärenz und Kontinuität zwischen dem anatomischen Geschlecht (sex), der
Geschlechtsidentität (gender), der sexuellen Praxis und dem Begehren stiften und
17
aufrechterhalten.« Alle Identitäten, die sich also ausserhalb dieser »Matrix der
Intelligibilität«, Matrix des Erkennbaren, befinden und innerhalb der heterosexuellen Struktur
nicht als kohärent zu beschreiben sind, erscheinen also »als Entwicklungsstörungen und
logische Unmöglichkeiten«.18
Doch wie funktioniert die »heterosexuelle Matrix«, wie sie Butler beschreibt? Wie entsteht
ein Netz von Regulierungen und Machtmechanismen, das Körper kategorisiert? Wie werden
Körper als weiblich oder männlich beschrieben und wie werden Körper überhaupt
geschlechtlich? Wie haben sich die Identitätskategorien von Frau und Mann etabliert,
während andere als unglaubwürdig und ›unnatürlich‹ erachtet werden? Wie wird über ein
ganzes Leben bestimmt? Wir sprechen hier von der Definition des Kindes, das bereits im
Mutterleib vergeschlechtlicht wird, dem geschlechtliche Eigenschaften zugeschrieben werden
und so zu einem Feminium oder Maskulinum herangezogen wird. Ab dem Augenblick der
Geburt wird das Geschlecht besonders relevant. Ist es (das Kind) ein Mädchen oder ein
Junge? Was spielt es für eine Rolle, was wird es für eine Rolle spielen (müssen)? Es wird
nicht automatisch zu einem Sie oder Er. Es wird zu einem Sie oder Er gemacht. Und wenn es
nicht der Vorstellung von einem Sie oder Er entspricht, dann wird es angepasst. »Frauen und
Männer existieren als soziale Norm, könnte man sagen, und sie sind der Perspektive der
Geschlechterdifferenz zufolge Formen, in denen die Geschlechterdifferenz Gehalt
angenommen hat.« 19 Weiterhin besteht also eine normative Auffassung von dual sich
entgegengesetzten Geschlechtern. Das eine Geschlecht ist ohne das andere nicht denkbar. Die
Geschlechtsmerkmale, und dabei gibt es innerhalb eines medizinisch-pathologischen
Diskurses primäre, sekundäre und tertiäre, sind bestimmend für die Sozialisierung des
16
Redecker (2011), S.68
17
Butler (1991), S.38
18
Butler (1991), S.39
19
Butler (2009), S.33320
Kindes. Vor allem die augenscheinlichen, primären Geschlechtsmerkmale weisen uns in klare
Schranken. Werde ich als Frau oder als Mann gelesen? Welchen Verhaltenscodes muss ich
entsprechen, ab wann werde ich für andere unlesbar und was passiert, wenn ich mich dem
gänzlich zu entziehen versuche? Kann ich mich dem überhaupt entziehen? Diese und weitere
Fragen versuchen wir im Folgenden theoretischen und im anschliessenden empirischen Teil
zu klären.
Vorab verstehen wir Körper nicht als eine gegebene oder unveränderliche Materialität. Wir
gehen nicht von einem Standpunkt aus, der entscheidet, welche Körper und
Geschlechtlichkeiten ›natürlich‹ und welche ›unnatürlich‹ sind. Wir verstehen Körper als
durchlässiges Medium, das sich beschreiben lässt und selber definieren kann, auf, und in dem
Einschreibungen stattfinden und zur Körperlichkeit/Geschlechtlichkeit werden. Dieser Körper
besitzt absolut keine Grenzen, ist empfänglich für Festschreibungen, genau so aber auch
Umschreibungen und Veränderung. Mit Redecker bezeichnen wir »Körper [...] nicht als Sitz
einer inneren ›Wahrheit‹ des Geschlechts, sondern Körper als in Veränderungs- und
Austauschprozessen befindliches Phänomen, dessen Auftreten und Erscheinung
vereinheitlichenden Identitätskategorien voraus- und immer auch entgeht«.20 Die Körper sind
also nicht passiv, auch wenn sie teilweise gewaltsam beschrieben werden und angepasst
werden müssen um in die hegemoniale Geschlechterordnung eingereiht werden zu können.
Die Körper, beziehungsweise die Subjekte mit ihren fluiden Körpern können sich aktiv gegen
eine Anpassung entscheiden und dadurch eigene Subjektivierungsweisen hervorbringen. So
denken wir unter anderem an Butches und Femmes, an Tomboys, an Tunten, Sissyboys, Bears,
aber auch Dragkings und Dragqueens oder Transvestit_innen, Crossdresser_innen, und
Trans*menschen, die sich selbst benennen und sich nicht als weibliche oder männliche
Kopien verstehen, sondern als eigenständige Kategorien, die die Grenzen der Geschlechter
vermischen, ihre ›Natürlichkeit‹ anzweifeln und die Schranken der Körper aufbrechen. So
können neue Vorstellungen von Körpern und Geschlechtern geschaffen werden, die durch
eine verschobene Wiederholung von performativen Akten erzeugt werden. »Wenn Gender
performativ ist, dann folgt daraus, dass die Realität der Geschlechter selbst als ein Effekt der
Darstellung produziert wird.« 21 Wenn sich eine Frau den Vorstellungen des Weiblichen
entsprechend verhält, kleidet und spricht, dann wird ihre Weiblichkeit, ihr Frausein bestärkt.
So bald sich eine Frau ›anders‹ gibt, vielleicht nicht rasiert, kurze Haare trägt und eine tiefe
Stimme besitzt, und hier sprechen wir Klischees an, die oft mit Lesben, Tomboys oder
20
Redecker (2011), S.67
21
Butler (2009), S.34621 Butches in Verbindung gebracht werden, dann wird ihre ›Natürlichkeit‹, ihr Frausein in Frage gestellt. Ihr Gender ist somit nicht mehr sicher und sie verschiebt die gängigen Vorstellungen, in dem sie sich männlich konnotierte Verhaltensweisen aneignet. Auf dieselbe Weise wie die normativen Geschlechterkategorien kopiert werden, können alternative Formen entstehen. Wir sprechen hier von Kopie, da wir, wie bereits erwähnt, nicht von einem ›wahren‹ Geschlecht oder einer ›wahren‹ Geschlechtsidentität ausgehen, sondern wir denken mit Butler, dass es kein Original gibt, sondern, »dass das Original immer schon abgeleitet war«22 und somit gibt es auch nur die Kopie einer Kopie. Indem ein Mädchen seiner Mutter beim Haare kämmen oder schminken zuschaut und diese Handlungen später nachahmt, inszeniert es unbewusst sogenannte Weiblichkeit. Butler erklärt Geschlecht als Effekt, der durch diese performativen Akte entsteht.23 Dieser Effekt soll darauf verweisen, dass eine Realität eines Geschlechts bloss auf sich wiederholendem Tun basiert, was nicht bedeutet, dass dieser Effekt weniger ›real‹ wäre. Mit Redecker ergänzen wir diesen butlerschen Ausdruck deshalb und nennen es »Show-Effekt« 24 , welcher andeutet, dass weder die Realität, noch die Inszenierung, die Kopie der Kopie ›echt‹ ist. Die weibliche und die männliche Inszenierung strebt immer ein Ideal an, das nie erreicht werden kann. Im übertragenen Sinn wird so ein Bild oder eher ein Konzept einer Frau und das eines Mannes als ursprüngliches betrachtet, welches in einer Endlosschlaufe reproduziert wird und sich so in und mit der Zeit festigt, ohne dass dabei an dessen Legitimität gezweifelt wird. Es fungiert als Geschichte, an die geglaubt wird und die sich bewährt, weil sie sich tagtäglich wiederholt und als nutzbar erweist. Genau an dem Punkt greift Butlers Konzept der Performativität, welches besagt, »dass Möglichkeiten zur Veränderung der Geschlechtsidentität gerade in dieser arbiträren Beziehung zwischen den Akten zu sehen sind, d.h. in der Möglichkeit, die Wiederholung zu verfehlen, beziehungsweise in einer De-Formation oder parodistischen Wiederholung, die den phantasmatischen Identitätseffekt als eine politisch schwache Konstruktion entlarvt«.25 Um die butlersche Performativität in einen grösseren Zusammenhang zu stellen, diskutieren wir im nächsten Kapitel den Begriff der Heteronormativität, der den Begriff des Performativen und den von ihr geprägten Ausdruck der »heterosexuellen Matrix« fasst. 22 Butler (1991), S.204 23 Butler (2009), S.346 24 Redecker (2011), S.65 25 Butler (1991), S.207
22 2.2 Heteronormativität In einer heteronormativen Gesellschaft wird eine Person meistens aus einer heterosexuellen Perspektive betrachtet, als Versuch zwischen den zwei Geschlechtern, Frau und Mann, zu unterscheiden. Über reproduzierte Geschlechtsmerkmale werden nach Indizien gesucht, welche Hinweise über das Geschlecht einer Person geben. Um sich dieser Praxis zu entziehen, muss das Gesehene, also die Körper und somit die Geschlechtsteile, als Konnotiertes begriffen werden, welches mit Bedeutungen aufgeladen ist und nur in einem gewissen kulturellen Raster verständlich wird. Fraglich ist, ob ein Wissen über das Geschlecht der betreffenden Person, ihre sexuellen Begehren und Geschlechtsattribute zwingend notwendig ist. Um in einer sozialen Ordnung funktionieren zu können, wird meist Eindeutigkeit, Zuordnungsfähigkeit und Offenheit jedweder privaten und persönlichen Sache verlangt. In jeder bürokratischen Angelegenheit wird nach dem Geschlecht und dem Zivilstand gefragt, sei das beim Arzt, bei der Einwohnerkontrolle, bei einer Bewerbung für eine Arbeitsstelle oder eine Schule. In jedem dieser Fälle wird von einem heteronormativen Konsens ausgegangen. Wenn eine Trans*person sich in einer bestimmten Umgebung bewegt (so zum Beispiel auch in der LesBisSchwulen Szene), dann wird oftmals von ihr_ihm erwartet, dass sie_er zu ihrem_seinen Trans*dasein steht. Aber wieso sollte sich eine Cisfrau oder ein Cismann nicht gleichermassen ausweisen? Im Gegensatz zu heterosexuellen Menschen wird häufig verlangt, dass die_der Homosexuelle, die trans*- und intersex Person ihre_seine Sexualität äussert, wobei dies immer die Dichotomie zwischen homo- und heterosexuell bestätigt und Heterosexualität als die einzig ›richtige‹, ›wahre‹ und ›natürliche‹ Sexualität ausweist. Oder wie es Sabine Hark ausführt: »Das heterosexuelle Paar ist die ultimative Rationale menschlicher Beziehungen, die unteilbare Basis jeglicher Gemeinschaft, die scheinbar unhintergehbare Bedingung der Reproduktion, ohne die es überhaupt keine Gesellschaft gäbe [...].«26 Die oben genannten Beispiele unterstreichen das Konzept der Heteronormativität, welche Heterosexualität als Konstrukt aufzeigt. Dabei wird Sexualität nicht als etwas ›Natürliches‹ verstanden, »sondern im Sinne Michel Foucaults als Dispositiv: als Ergebnis eines strategischen Zusammenspiels von Diskursen, Praktiken und Institutionen [...]«.27 Butler spricht in dem Zusammenhang von einer kulturellen Matrix, der »heterosexuellen Matrix«, oder später auch von der »heterosexuellen Hegemonie«28, die Geschlechtskörper 26 Hark in Krass (2009), S.31 27 Krass (2009), S.9, zur Sexualität als Dispositiv vgl. Foucault (1977) 28 Redecker (2011), S.58
23
diskursiv hervorbringt. Die Matrix ist Teil ihres Heteronormativitätskonzept, das offenlegt
wie die Macht der herrschenden Geschlechterordnung Körper reguliert, er- und anerkennen
lässt und solche, die nicht in diese Bipolarität einzuordnen sind ausgeschlossen und als nicht
(an-)erkennbar ausgewiesen werden. Dies geschieht über Normen, die den Anschein
erwecken, dass es eine ›Wahrheit‹ oder ›Ursprünglichkeit‹ des Geschlechts, des Sexus, gibt,
auf die zurückgegriffen werden kann. Die Regulierungsverfahren der »heterosexuellen
Matrix« bringen Vorstellungen von kohärenten Identitäten hervor, was bedeutet, dass die
Geschlechtsidentität (gender) vom anatomischen Geschlecht (sex) hervorgeht und die
Praktiken des Begehrens (desire) aus den beiden entsteht.29 Somit haben Frauen automatisch
einen weiblichen Geschlechtskörper, werden weiblich sozialisiert und haben ein weibliches,
heterosexuelles Begehren. Männer hingegen haben einen männlichen Geschlechtskörper,
werden männlich sozialisiert und haben ein männliches, heterosexuelles Begehren. Die
Geschlechtskörper werden jeweils als ›biologisch‹ und dadurch ›natürlich‹ erachtet, aufgrund
dessen, dass »das anatomische Geschlecht in der hegemonialen Sprache als Substanz oder –
metaphysisch gesprochen – als selbstidentisches Seiendes«30 verstanden wird. Dabei wird
nicht das Ontologische der Sprache hinterfragt, beziehungsweise ihre ›Wahrheit‹
angezweifelt, sondern die Geschlechtsidentität erweist sich laut Butler innerhalb des
überlieferten Diskurses der Metaphysik der Substanz als performativ, was bedeutet, dass die
Geschlechtsidentität ihre eigene Identität, die sie angeblich sei, konstituiere.31
Heteronormativität verstehen wir so als dominierende heterosexuelle Struktur, welche
diejenigen Menschen, die von der heterosexuellen Norm abweichen als ihr Äusseres, Anderes
erscheinen lässt. Die hegemoniale Heterosexualität ist tief in der westlichen Gesellschaft
verankert und lässt sich in vielen Bereichen wiederfinden. Es ist »ein zentrales
Machtverhältnis, das alle wesentlichen gesellschaftlichen und kulturellen Bereiche, ja die
32
Subjekte selbst durchzieht«. Die Subjekte selbst bilden untereinander dieses
Machtverhältnis, ohne sich dessen wahrhaftig bewusst zu sein. Es ist nicht eine Macht, die
einfach existiert, sondern sie wird hergestellt, stetig bestärkt, ohne dass diese hinterfragt wird.
Solche Machtverhältnisse bilden die Basis im Sozialgefüge und sind dafür zuständig, dass
normative Auffassungen von Geschlechtern, Geschlechtlichkeiten, sexuellem Begehren und
Beziehungen hergestellt und gefestigt werden. Laut Foucault gibt es nichts ausserhalb der
Macht, beziehungsweise sagt er, »nicht weil sie alles umfasst, sondern weil sie von überall
29
Butler (1991), S.38f
30
Ebd. S.40
31
Ebd. S.49
32
Hartmann, Klesse, Wagenknecht, Fritzsche, Hackmann (Hrsg.) (2007): S.924
kommt, ist die Macht überall«. 33 Jede Gesellschaft ist durchzogen von bestimmten
Machtverhältnissen und Strukturen, die Normen und Regulierungen hervorbringen, welche
Normalisierungsprozesse fördern, die hegemoniale Vorstellungen von Körpern und
Geschlechtern stärken. So sind Geschlechterdiskurse in mehrfacher Weise heterosexualisiert
und erschaffen ein ›natürliches‹ Bild von Heterosexualität und heterosexuellem Begehren.
Dieses diskursive Regime hegemonialer Heterosexualität bringt Annahmen über ›natürliche‹
und ›gesunde‹ Körperlichkeiten hervor. Ebenso bestimmt sie normalisierende
Identitätszuschreibungen und Kategorien, die auf dem vorherrschenden Glauben an die
›Natürlichkeit‹, Eindeutigkeit und Unveränderbarkeit von Geschlecht und sexuellem
Begehren basieren, was alles andere (wie LesBiSchwul, trans* und intersex) als
›Abweichungen‹ ausweist.34 In dem Raster der Heterosexualität werden nicht-heterosexuelle
Geschlechtlichkeiten und Begehren als ›unnatürlich‹ und ›abnormal‹ beschrieben. Oft fallen
sie in ein Raster des Unverständlichen, Unzumutbaren und ›Kranken‹. So gilt zum Beispiel
ein Trans*dasein weiterhin als ›Krankheit‹, welche im Diagnoseklassifikationssystem (ICD-
10 = Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter
Gesundheitsprobleme) als Störung der Geschlechtsidentität unter der Klasse F (Psychische
Störungen und Verhaltensstörungen) unter Punkt ›F64.o – Transsexualismus‹ gefasst wird.
Einerseits können Trans*menschen aufgrund dieser Pathologisierung Ansprüche auf
Krankenkassenleistungen erhalten, durch welche sie eine Hormonbehandlung und/oder
geschlechtsangleichende Massnahmen finanziert bekommen, andererseits werden sie so in der
Gesellschaft als ›krank‹ oder ›widernatürlich‹ verstanden, was Ausgrenzung, Diskriminierung
und Gewalt zur Folge hat. Trans* und intersex gelten als Geschlechtlichkeiten, die nicht
existieren sollen. In der Struktur der klaren Trennung von zwei dominierenden Geschlechtern,
Frau und Mann, und dem einen hegemonialen, heterosexuellen Begehren finden davon
abweichende Geschlechtlichkeiten und Begehren keinen Platz und erscheinen somit
inexistent.
Gemäss ICD-10 müssen Menschen folgende Kriterien erfüllen um die Diagnose
›Transsexualismus‹ zu erhalten: »Der Wunsch, als Angehöriger des anderen Geschlechtes zu
leben und anerkannt zu werden. Dieser geht meist mit Unbehagen oder dem Gefühl der
Nichtzugehörigkeit zum eigenen anatomischen Geschlecht einher. Es besteht der Wunsch
nach chirurgischer und hormoneller Behandlung, um den eigenen Körper dem bevorzugten
Geschlecht soweit wie möglich anzugleichen. [...] Die transsexuelle Identität muss
33
Foucault (1977), S.94
34
Hartmann, Klesse, Wagenknecht, Fritzsche, Hackmann (Hrsg.) (2007): S.9Sie können auch lesen