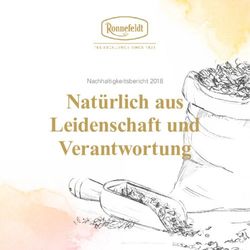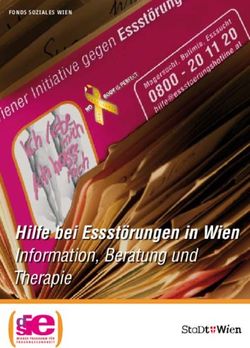Rechnungswesen und Controlling 2015
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Inhaltsverzeichnis Einführung 3 Rechnungswesen Finanzwirtschaftliche Grundlagen 6 Einführung in die internationale Rechnungslegung/Bilanzierung 7 Controlling Geprüfte/-r Controller/- in in Versicherungsunternehmen (DVA) 8 Controlling in Versicherungsunternehmen 10 Controlling von Sachversicherungen 11 Controlling von Lebens- und Krankenversicherungen 12 Projekt- und Investitionscontrolling Neu 13 Grundlagen des Kapitalanlage-Controlling 14 Kostenmanagement/Kostenverteilung 15 Intensivseminar Management-Reporting Neu 16 Profitcenter-Steuerung 17 Vertriebs-Controlling 18 Kundensegmentorientiertes Controlling 19 Controlling von Operations- und Servicebereichen 20 Schaden-Controlling 21 Prozess-Controlling 22 Workshop: Gestaltung eines Frühwarnsystems mittels Indikatoren nach MaRisk (VA) 23 IFRS und Solvency II als Controllinginstrument 24 Strategisches Controlling 25 Wertorientierte Steuerung 26 Operative Geschäftssteuerung auf Basis einer effektiven Nutzung der Informationssysteme Neu 27 Operationelle Risiken 28 Controlling im Bereich Kapitalanlagen Grundlagen von Kapitalmarktprodukten 29 Kapitalanlagen und Aufsichtsrecht 30 Kapitalanlagen: Buchung und Bilanzierung nach HGB und IFRS 31 Kapitalanlagen: Prüfung des Risikomanagements 32 Beurteilung von Risikokapitalmodellen 33 Referentenübersicht 34 Terminübersicht 36 Wichtige Seminarinformationen 37 Anmeldung 38 Anmeldebedingungen 39 Zur Verbesserung der Lesbarkeit wird in den Texten nur die männliche Form gebraucht. Weibliche und männliche Personen sind damit gleichermaßen gemeint.
r
e Traine
che n e rfahren
g 40 0
bran
Rechnungswesen und Controlling und Re
ferente
is ch
n
e W eiterbil
dungen
g Fac
hspezif V
Von Anfang an auf der sicheren Seite G DV und AG
mit
Die ständig steigenden Anforderungen an die fach- Experten statt Exzentriker
lichen Kompetenzen und die immer komplexer Die Lehrkräfte der Deutschen Versicherungsakademie
werdenden Unternehmensabläufe verlangen von
Führungskräften und Mitarbeitern in der Versiche- Für die Qualitätssicherung unserer Bildungskonzepte
rungsbranche ein breites Wissen über betriebs- und und einen größtmöglichen Nutzen für unsere Kunden
finanzwirtschaftliche Aspekte in den Unternehmen. werden die Aus- und Weiterbildungen der Deutschen
Versicherungsakademie ausschließlich von Trainern
Das Rechnungswesen dient der systematischen
und Referenten mit umfassender Branchenerfahrung
Erfassung, Überwachung und informatorischen
durchgeführt. Für speziellen Schulungsbedarf greift
Verdichtung der durch den betrieblichen Leistungs-
die DVA auf die gute Vernetzung und enge Zusam-
prozess entstehenden Geld- und Leistungsströme.
menarbeit mit Branchenverbänden zurück. Tagungen
Diese Dokumentation erfolgt einerseits um gegen-
und spezielle Fachseminare werden unter anderem
über Außenstehenden Rechenschaft (externes Rech-
auch durch erfahrene Referenten und Dozenten aus
nungswesen) ablegen zu können und liefert auf der
den Verbänden AGV und GDV durchgeführt.
anderen Seite dem Unternehmen wichtige Daten für
das Controlling und die Unternehmenssteuerung.
Das Controlling sollte in der Lage sein Chancen,
Risiken, Stärken und Schwächen zu erkennen.
Zusätzlich kommt den Controllern immer mehr eine
Beraterfunktion zu. Sie sind gefordert, ständig aus-
sagekräftige Informationen und Einschätzungen für
die strategischen Entscheidungen des Managements
bereitzustellen.
Umso wichtiger ist eine entsprechende Qualifikation.
Die Seminare der Deutschen Versicherungsakademie Für Fragen und weitere Informationen
richten sich ausschließlich an Mitarbeiter der Ver- stehen wir gerne zur Verfügung:
sicherungswirtschaft und werden von erfahrenen Christiane von Spreckelsen
Referenten branchenbezogen und praxisnah durch- Telefon 030 2020-5096
geführt. christiane.v.spreckelsen@
versicherungsakademie.de
Bildungsangebote, die in Zusammenarbeit mit Katharina Hermann
dem Gesamtverband der Deutschen Versiche- Telefon 030 2020-5088
rungswirtschaft (GDV) entwickelt wurden, sind katharina.hermann@
im vorliegenden Programmfolder entsprechend versicherungsakademie.de
gekennzeichnet.
Sie finden uns auch unter:
www.versicherungsakademie.de
in Kooperation
mit dem
Information
"Was der Controller heute leisten muss, ist, vorhandene Zahlen zu interpretieren,
sich eine Meinung zu bilden und diese auch zu vertreten."
Jürgen Weber
3Bei uns ist Bildung alles.
Außer gewöhnlich.
Schön, dass Sie sich für uns interessieren!
Seit Gründung der Deutschen Versicherungsakade- In kurz:
mie (DVA) durch die Versicherungswirtschaft im
g Lebenslanges Lernen bedeutet mehr Erfolg
Jahr 1949 bieten wir allen Mitarbeitern unterneh-
im Handeln
mensübergreifend ein speziell auf unsere Branche
ausgerichtetes Weiterbildungsangebot auf höchstem g Erfahrener Partner für professionelle
Niveau und mit messbar großem Erfolg. Wir prägen Branchenbildung
seit über 65 Jahren die berufsbegleitende Fach- und g Erstklassige Bedarfs- und Bildungsangebote
Führungskräfteweiterbildung der gesamten Branche g Engagement für Qualität und noch mehr
– für den Innen- und Außendienst sowie für freie Kundenzufriedenheit
Vermittler und Makler. Dank der Vernetzung und
Zusammenarbeit mit den wichtigen Branchenver-
g Aus guten Gründen seit Jahrzehnten
bänden und DVA-Gesellschaftern – Gesamtverband innovativ
der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), g Flexibilität als Voraussetzung für Qualität
Arbeitgeberverband der Versicherungsunternehmen
in Deutschland (AGV) und Berufsbildungswerk der
Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) – sowie
den Vermittlerverbänden garantieren wir unseren
Kunden Vielfalt, Flexibilität und Aktualität für das
Die Vorteile der Deutschen Versicherungsakademie
gesamte Bildungsangebot.
Der Gründer der Howard University in Washington,
Oliver Otis Howard, beschrieb die Notwendigkeit
Fortschritt statt Gleichschritt des lebenslangen Lernens einmal mit den Worten:
Die Qualitäten der Deutschen Versicherungsakademie „Jedesmal, wenn du alle Antworten gelernt hast,
wechseln sie alle Fragen.“ Das gilt für alle Bereiche
Einer der vielen guten Gründe, sich für die Deutsche des Lebens und ganz besonders für Menschen, die
Versicherungsakademie zu entscheiden, ist die in der Versicherungswirtschaft arbeiten.
kontinuierliche Entwicklung unseres Angebotes. Umso wichtiger sind die regelmäßige Weiterbildung
Aktualität spielt gleichermaßen eine wichtige Rolle. und die Qualität der Bildungsinstitute. Mit der Deut-
Unsere Kunden bewerten die Seminar-Vorberei- schen Versicherungsakademie entscheiden Sie sich
tungen und die Veranstaltungsorte jeweils mit der für einen zuverlässigen Partner, denn als Branchen-
Note 1,5. In Seminaren und Zukunftswerkstätten akademie kennen wir die Bedürfnisse und Heraus-
vermitteln wir schon heute die Inhalte, die morgen forderungen der Assekuranz seit Jahrzehnten – und
höchste Relevanz besitzen. Ändert sich ein Gesetz, damit so gut wie niemand sonst. Was uns von ande-
können wir umgehend darauf reagieren und unsere ren Anbietern unterscheidet? Der Anspruch, mit
Weiterbildungsangebote dem Bedarf der Branche qualitätsgesicherten Aus- und Weiterbildungskon-
anpassen. Das ist Qualität nach Maß bei der Deut- zepten Einzelpersonen, Unternehmen und damit
schen Versicherungsakademie. die gesamte Branche auf höchstem Niveau zu pro-
fessionalisieren. Denn nur so ist eine nachhaltige
Kundenzufriedenheit gewährleistet, ebenso wie Ihr
beruflicher Erfolg!
4Maßarbeit statt Mehrarbeit
Die Bildungskonzepte der Deutschen Versicherungsakademie
Manchmal muss es maßgefertigt sein – in Form von
Seminaren, Trainings, Workshops und Moderationen In kurz:
bis hin zu zertifizierten DVA-Lehrgängen bieten
g So aktuell wie Ihr Geschäft
wir Ihnen ganz nach Ihrem Bedarf maßgefertigte
Inhouse Inhouse-Lösungen an. g Branchenprofessionalisierung muss
bezahlbar sein
Inhouse-Lösungen passen, wenn Sie … g DVA-Abschlüsse als Qualitätssiegel für
g eine größere Teilnehmerzahl speziell auf Ihren professionelle Weiterbildung
Bedarf zugeschnitten qualifizieren wollen, g Erfahrungen und Vielfalt an Fachwissen
g zu einem Spezial-Thema Trainerwissen im
eigenen Unternehmen erst aufbauen müssen,
g eine Weiterbildung nur teilweise brauchen,
weil Sie Ausschnitte selbst leisten können.
Die Vorteile liegen klar auf der Hand:
g attraktive Konditionen und Rabattmodelle, Kontaktieren Sie uns für eine individuelle
g schnelle Reaktion auf einen individuellen unter- Beratung:
nehmensinternen Weiterbildungsbedarf, Thérése Carstens
g speziell auf das Unternehmen und die Mitarbeiter
Telefon 030 2020-5095
abgestimmte Konzepte, Fax 030 2020-6095
g Zugriff auf ein breites Themenspektrum und
therese.carstens@
vielfältige Trainerkompetenzen. versicherungsakademie.de
Ihre Anforderungen sind unsere Herausforderungen! Wir freuen uns auf Sie und Ihre
Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen auf Projekte.
Basis Ihres Bedarfs ein unverbindliches Angebot.
Inhouse
Schritt für Schritt: Von der Bedarfsanalyse zur Umsetzung
Bedarfs- Lösungs- Feinab- Auftrags- Umsetzung Feedback +
analyse vorschlag stimmung erteilung Evaluation
5Finanzwirtschaftliche Grundlagen
Versicherungsspezifisches und praxisnahes Finanzwissen
Zielgruppe Kapitalanlagepolitik von Versicherungsunternehmen
g Kapitalvorschriften
Führungskräfte, Nachwuchsführungskräfte,
g Formen der Kapitalanlage
Mitarbeiter, die versicherungsbezogenes, finanz-
g Aktives Fondsmanagement
wirtschaftliches Wissen aufbauen, erweitern oder
vertiefen wollen. Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten in
Versicherungsunternehmen
Ziele/Nutzen g Formen von derivaten Finanzinstrumenten
g Optionen, Call-Option, Put-Option
Die Teilnehmer erhalten einen fundierten Einblick in
g Futures, Swaps
finanzwirtschaftliche Themen, die zum Verständnis
der finanzwirtschaftlichen Steuerung eines moder- Finanzwirtschaftliche Grundbegriffe und Ziele in
nen Versicherungsunternehmens notwendig sind. Versicherungsunternehmen
Die Teilnehmer lernen Solvabilitätsbestimmungen mit Ausblick
g die wichtigsten betriebswirtschaftlichen Grund-
Systematik zur Erleichterung der Rechnungslegung
lagen kennen und zielgerichtet einzusetzen,
g Gewinn- und Verlustrechnung
g verschiedene Kapitalanlagestrategien von
g Versicherungstechnische Rückstellungen
Versicherungsunternehmen zu verstehen,
g Beitragsüberträge
g den Jahresabschluss in einem Versicherungs-
g Deckungsrückstellung
unternehmen richtig zu analysieren.
g Schwankungsrückstellung
Durch das Aufgreifen der wichtigsten finanzwirt-
Ausgewählte Kennzahlen zur Jahresabschluss-
schaftlichen Fragen können Zusammenhänge im
analyse mit abschließender Fallstudie
Versicherungsunternehmen besser verstanden und
g Kostenansätze
damit Anregungen zu Effizienz- und Effektivitäts-
g Grundlagen zur Konzernrechnungslegung
steigerungen geschaffen werden.
g Formen der Rückversicherung
Inhalte
Methodik
Aktuelle Entwicklungen in der Versicherungswirtschaft
g Diskussionen
g Unternehmenssteuerung
g Fachlicher Input
g Shareholder Value
g Fallstudien
g Betriebswirtschaftliche Kennzahlen
g Praxisbeispiele
Datum Ort Uhrzeit Referent Teilnahmegebühr
22. – 24.06.2015 Köln Mo 09:00 – Mi 16:30 Uhr Erik Barndt 1.090,– € zzgl. MwSt.
Johannes Glößner
Web-Code: V503
6 in Kooperation
mit demEinführung in die
internationale Rechnungslegung/Bilanzierung
Grundlagen und Entwicklungen nach IAS/IFRS
Zielgruppe Inhalte
Mitarbeiter aller Fachabteilungen, auch mit geringen Rechnungslegung nach IAS/IFRS
Grundkenntnissen in der Rechnungslegung nach g Ziele und Funktionen
HGB. Führungskräfte, die sich Wissen über die inter- g Gründe für internationale Rechnungslegung
nationale Rechnungslegung aneignen wollen. g Entstehungsprozess eines Konzernabschlusses
g Assets, Liabilities, Equity
Ziele/Nutzen
Bilanzierung von Kapitalanlagen nach IAS/IFRS
Die Rechnungslegung in Versicherungsunternehmen g Bewertung von Kapitalanlagen
unterliegt in den letzten Jahren stetig neuen An- g Finanzinstrumente
forderungen. Während sich die Bilanzierung bisher g Sicherungsgeschäft
nach dem spezifischen Geschäft der Versicherungs- g Grundgeschäfte
wirtschaft gerichtet hat, werden strategische Ent- g Fair Value-Hedge, Cashflow-Hedge, Spezialfonds
scheidungen im Versicherungsunternehmen immer
Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte
stärker von den Bilanzierungsnormen beeinflusst.
Bilanzierung der Versicherungstechnik
Die Rechnungslegung von Versicherungsunter-
nehmen ist nicht mehr ausschließlich ein Thema Angabepflichten nach IFRS
für Bilanzierungsspezialisten, sondern betrifft die
Rechnungslegung von Pensionsverpflichtungen
gesamte Unternehmenssteuerung und -leitung.
nach IFRS
Die Teilnehmer
Bilanzierung der versicherungstechnischen
g lernen die wichtigsten konzeptionellen und
Rückstellungen
materiellen Veränderungen der Bilanzierung der
Versicherungstechnik und der Kapitalanlagen Bilanzierung der Rückversicherung
kennen,
Aktueller Stand der Entwicklung des IFRS
g wiederholen Regelungen nach HGB,
„Versicherungsverträge“
g erkennen die praktischen Implikationen der
Entwicklung für das gesamte Versicherungsunter-
Methodik
nehmen.
g Lehrvortrag
g Lehrgespräche
g Diskussionen
g Gruppenarbeiten
Datum Ort Uhrzeit Referent Teilnahmegebühr
15. – 17.06.2015 Berlin Mo 09:00 – Mi 16:30 Uhr Erik Barndt 1.090,– € zzgl. MwSt.
Web-Code: V504
in Kooperation
mit dem
7Geprüfte/-r Controller/-in
in Versicherungsunternehmen (DVA)
Branchenspezifisches Grundlagen- und Vertiefungswissen
Konzept
Steigender Wettbewerbsdruck und eine zunehmende Komplexität der Märkte und Unternehmen
erfordern eine immer höhere Effizienz der Unternehmenssteuerung. Versicherungsunterneh-
men verfügen über umfassende Informationen, die zur Beurteilung und Einschätzung des Risi-
kos, zur Tarifierung sowie zur Antrags-, Vertrags-, Schaden- und Rückversicherungsbearbeitung
erforderlich sind. Das Controlling ist gefordert, ständig aussagekräftige Informationen und
Einschätzungen für die strategischen Entscheidungen des Managements bereitzustellen.
Die Wandlung vom Informationsprovider zum internen Berater erhöht zusätzlich die Anforde-
rungen an die fachliche und persönliche Qualifikation der Mitarbeiter im Controlling. Der
Lehrgang zum/- r „Geprüften Controller/-in in Versicherungsunternehmen (DVA)“ bietet ein
flexibles Konzept, das den individuellen Marktanforderungen der Branche gerecht wird.
Zielgruppe
Führungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen Controlling, Rechnungswesen,
Betriebswirtschaft und Planung sowie interessierte Mitarbeiter aus allen Abteilungen.
Module des Lehrgangs
Geprüfte/-r Controller/-in in Versicherungsunternehmen (DVA)
Vertiefungsseminare (wählen Sie drei Seminare aus)
Controlling von Operations- Operative Geschäftssteuerung Intensivseminar
und Servicebereichen Management-Reporting
Gestaltung eines Frühwarn- Grundlagen des IFRS und Solvency II
systems mittels Indikatoren Kapitalanlage-Controlling als Controllinginstrument
unter MaRisk (VA)
Kostenmanagement/ Kundensegmentorientiertes Projekt- und
Kostenverteilung Controlling Investitionscontrolling
Profitcenter-Steuerung Prozess-Controlling Schaden-Controlling
Strategisches Controlling Wertorientierte Steuerung Vertriebs-Controlling
Grundlagenseminare (wählen Sie ein Seminar aus)
Controlling in Controlling von Controlling von Lebens- und
Versicherungsunternehmen Sachversicherungen Krankenversicherungen
Eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Module finden Sie auf den nachfolgenden Seiten. Bitte beachten
Sie die Kennzeichnung der Module.
"Controller kommen immer mehr in die Beraterrolle. Sie müssen heute wissen,
8 was der Wettbewerb macht oder wie welche Zahlen auf Analysten wirken.“
UnbekanntZiele/Nutzen
Die Grundlagen- und Vertiefungsmodule versetzen Controller in die Lage, den vielfältigen
Anforderungen gerecht zu werden und ihren individuellen Beitrag zu einer systematischen
Weiterentwicklung einer effizienten Unternehmenssteuerung zu leisten. Durch das umfang-
reiche Angebot können sie sich ihre benötigten Bausteine flexibel auf ihre Anforderungen,
Bedürfnisse und Interessen zuschneiden.
Die Teilnehmer lernen,
g wichtige Methoden und Instrumente des Versicherungscontrollings kennen,
g Steuerungssysteme im eigenen Unternehmen effizient einzusetzen und weiterzuentwickeln,
g ihre Fähigkeiten in der Koordination, der Planung und der Prozess-Steuerung einzusetzen,
g Informationen zu filtern, auszuwerten und aufzubereiten.
Abschluss
Für den Branchen-Abschluss ist die Teilnahme an einem Grundlagenmodul und an drei Ver-
tiefungsmodulen erforderlich. Mit Bestehen der schriftlichen Prüfung erhalten die Teilnehmer
das Zertifikat zum/-r „Geprüften Controller/-in in Versicherungsunternehmen (DVA)“.
Fachliche Leitung
Dr. Heinz-Theo Fürtjes
Leiter Controlling in einem Versicherungsunternehmen
Teilnahmegebühr
Die Gebühr für den Lehrgang beträgt 2.995,– € zzgl. gesetzl. MwSt. Ihre Ersparnis gegenüber
Einzelbuchung von vier Seminaren liegt bei bis zu 38 %. Hinzu kommen Prüfungsgebühren in
Höhe von 150,– € zzgl. gesetzl. MwSt. Die Rechnungsstellung erfolgt vor jedem Modul separat.
Der Lehrgang sollte innerhalb von zwei Jahren absolviert werden. Ansonsten behält sich die
DVA eine Nachberechnung in Höhe der Preisersparnis vor.
Prüfung Prüfungstermine
Nach Besuchen der vier Seminare wird eine schriftliche 20.06.2015 Berlin 12:00 – 14:00 Uhr
Prüfung über die gelernten Inhalte durchgeführt. 12.12.2015 Berlin 12:00 – 14:00 Uhr
Vorteile für den/die Geprüfte/n Controller/in in Versicherungsunternehmen:
g Maßgeschneiderte Ausbildung: „Aus der Branche für die Branche“
g Zielgerichtete Erweiterung der persönlichen Handlungskompetenzen
g Erhöhung der Flexibilität
g Abdeckung der unterschiedlichsten fachlichen Voraussetzungen für die Arbeit als
Controller/in in einem Versicherungsunternehmen
9Controlling in Versicherungsunternehmen
Praxisorientierter Überblick
Zielgruppe Inhalte
Grundlagenmodul
Führungskräfte und Mitarbeiter aus dem Controlling Operatives Controlling
sowie aller Bereiche, insbesondere aus Betriebswirt- g Budgetierung
schaft, Planung und Rechnungswesen. g Prozesskostenrechnung
g Deckungsbeitragsrechnung
Ziele/Nutzen g weitere Instrumente
Diese komprimierte Einführung in das Controlling Investives Controlling
bietet einen praxisorientierten Überblick über g Organisation des Investitionscontrollings
Geprüfte/r Controller/in in Versicherungsunternehmen
Rahmenbedingungen, Aufgaben und eingesetzte g Statische und dynamische Investitions-
Methoden, um Planungs-, Informations- und rechnungen
Überwachungssysteme im Versicherungsunter-
Strategisches Controlling
nehmen einzurichten und zu koordinieren.
g Voraussetzungen und Organisation des
Die Teilnehmer lernen strategischen Controllings
g das Controlling, seine Notwendigkeit, Bedeutung g Instrumente des strategischen Controllings
und wichtigsten Aufgaben kennen,
Technische Unterstützung des Controllings
g inhaltlich und methodisch die drei Felder der
g Controller Werkzeuge
Unternehmenssteuerung – Ertragsmöglichkeiten,
g EDV-gestützte Planungs- und Informations-
Leistungsfähigkeit und Ergebnis – zu erarbeiten,
systeme
g technische Unterstützung des Controllings durch
EDV-gestützte Planungs- und Informations- Methodische Grundlagen des Controllings
systeme kennen. g Organisation des Controllings
g Controller Arbeitsweisen
Das Seminar befähigt die Teilnehmer, in zentralen
g Anforderungsprofil des Controllers
und dezentralen Stellen an Controlleraufgaben
mitzuarbeiten, fehlende Instrumente zu entwickeln Führung und Controlling
und mittelfristig ein Gesamt-Controlling-Konzept zu g Kultur für Controlling
realisieren. g Kommunikation und Führung für und im
Controlling
Methodik
g Fachlicher Input
g Diskussionen
g Gruppenarbeiten
g Fallstudien
Datum Ort Uhrzeit Referenten Teilnahmegebühr
23. – 25.09.2015 Köln Mi 09:00 – Fr 16:30 Uhr Stefan Burkhardt 1.290,– € zzgl. MwSt.
André Zierenner
Web-Code: V506
10 in Kooperation
mit demControlling von Sachversicherungen
Steuerungsgrößen und steuerungsrelevante Merkmale
Zielgruppe Die wesentlichen Produkte des SHUK-Geschäftes
Grundlagenmodul
g Konzepte, Deckungsumfang
Führungskräfte und Mitarbeiter aus dem Controlling
g Grundzüge der Kalkulation
sowie aller Bereiche, insbesondere aus Betriebswirt-
g Relevante Charakteristika für die Steuerung
schaft, Planung und Rechnungswesen.
Grundlagen der Rechnungslegung
Ziele/Nutzen
Beschreibung der wesentlichen steuerungs-
Vor dem Hintergrund einer zunehmenden Markt- relevanten Komponenten der GuV
dynamik und einer sich weiter verschärfenden g Beiträge (Definition und steuerungsrelevante
Geprüfte/r Controller/in in Versicherungsunternehmen
Wettbewerbssituation ist eine präzise volumen- und Komponenten)
ertragsorientierte Steuerung des Geschäftes eine g Schäden (Definitionen und steuerungsrelevante
wesentliche Voraussetzung für den nachhaltigen Komponenten: u. a. Eintrittsjahresschäden;
Unternehmenserfolg. Meldejahresschäden; Spätschäden; Normal-/
Groß-/Elementarschäden)
Die Teilnehmer
g Kosten (Definition und steuerungsrelevante
g lernen die wesentlichen Produktkategorien mit
Komponenten: u. a. direkte/zugerechnete
ihren steuerungsrelevanten Merkmalen kennen,
Kosten; Verfahren der Kostenallokation auf
g erfahren die erforderlichen Besonderheiten der
Funktionsbereiche und Sparten)
Steuerung von Sachversicherungsunternehmen,
g Rückversicherung (RV-Arten; Ergebnis-
g lernen die Steuerungsgrößen für Sachversiche-
komponenten)
rungen kennen,
g erhalten Hinweise für die Anwendung und Wesentliche strategische und operative
Umsetzung einer wertorientierten Unternehmens- Steuerungsgrößen für Sachversicherungen zur
steuerung. Steuerung von Volumen/Absatz, Kosten und
Profitabilität
Durch branchenspezifisches Controlling Know-how
gelingt es den Teilnehmern, präziser zu planen und Verzahnung von strategischer und operativer
schon heute die Weichen für morgen zu stellen. Steuerung
Wertorientierte Steuerung für Sachversicherungen
Inhalte
Zielsetzung und Bausteine der Unternehmens- Methodik
steuerung
g Fachlicher Input
Besonderheiten der Steuerung von Sach- g Diskussionen
versicherungen g Gruppenarbeit
g Fallstudien
Datum Ort Uhrzeit Referent Teilnahmegebühr
06. – 07.05.2015 Köln Mi 09:00 – Do 16:30 Uhr Dr. Heinz-Theo Fürtjes 890,– € zzgl. MwSt.
Web-Code: V507
in Kooperation
mit dem
11Controlling von
Lebens- und Krankenversicherungen
Steuerungsgrößen und steuerungsrelevante Merkmale
Zielgruppe Die wesentlichen Produkte des Lebens- und
Grundlagenmodul
Krankenversicherungs-Geschäftes
Führungskräfte und Mitarbeiter aus dem Controlling
g Konzepte, Deckungsumfang
sowie anderer Bereiche, insbesondere aus Betriebs-
g Grundzüge der Kalkulation
wirtschaft, Planung und Rechnungswesen.
g Relevante Charakteristika für die Steuerung
Ziele/Nutzen Grundlagen der Rechnungslegung
Die Langfristigkeit des Versicherungsgeschäfts ist Beschreibung der wesentlichen steuerungs-
eine wesentliche Controlling-Herausforderung. relevanten Komponenten der GuV
Geprüfte/r Controller/in in Versicherungsunternehmen
Gerade in der Lebensversicherung existieren die g Beiträge (Definitionen und steuerungsrelevante
Vertragsbeziehungen über mehrere Jahrzehnte. Bei Komponenten)
der Lebens- wie auch Krankenversicherung sind in- g Leistungen (Definitionen und steuerungs-
nerhalb der Vertragslaufzeit kaum Anpassungen der relevante Komponenten: u. a. Abläufe;
Preis/Leistungs-Relation möglich. Aus diesem Grund Rückkäufe; Schäden)
ist die Etablierung eines Controllingsystems von g Kosten (Definitionen und steuerungsrelevante
besonderer Bedeutung. Komponenten: u. a. direkte/zugerechnete
Kosten; Verfahren der Kostenkalkulation auf
Die Teilnehmer
Funktionsbereiche und Sparten)
g lernen die wesentlichen Produktkategorien mit
g Rückversicherung (RV-Arten; Ergebniskompo-
ihren steuerungsrelevanten Merkmalen kennen,
nenten)
g erfahren die erforderlichen Besonderheiten der
Steuerung von Lebens- und Krankenversiche- Wesentliche strategische und operative Steuerungs-
rungsunternehmen, größen für Lebens- und Krankenversicherungen
g lernen die Steuerungsgrößen für Lebens- und zur Steuerung von Volumen/Absatz, Kosten und
Krankenversicherungen kennen, Profitabilität
g erhalten Hinweise für die Anwendung und
Verzahnung von strategischer und operativer
Umsetzung einer wertorientierten Unternehmens-
Steuerung
steuerung.
Wertorientierte Steuerung für Lebens- und
Durch branchenspezifisches Controlling Know-how
Krankenversicherungen
gelingt es den Teilnehmern, präziser zu planen und
schon heute die Weichen für morgen zu stellen.
Methodik
Inhalte g Fachlicher Input
g Diskussionen
Zielsetzung und Bausteine der Unternehmens-
g Gruppenarbeit
steuerung
g Fallstudien
Besonderheiten der Steuerung von Lebens- und
Krankenversicherungen
Datum Ort Uhrzeit Referent Teilnahmegebühr
04. – 05.05.2015 Köln Mo 09:00 – Di 16:30 Uhr Dr. Heinz-Theo Fürtjes 890,– € zzgl. MwSt.
Web-Code: V508
12 in Kooperation
mit demProjekt- und Investitionscontrolling
Methoden und Kenngrößen der Projektsteuerung und -bewertung
Zielgruppe Projekt-/Investitionsbewertung
Vertiefungsmodul
g Projektdefinition und –ziele als Ausgangspunkt
Führungskräfte und Mitarbeiter aus den Bereichen
der Bewertung
Rechnungswesen und Controlling, Unternehmens- g Grundkonzept zur Bewertung von Investitionen/
entwicklung, Projektmanagement sowie Mitarbeiter
Projekten
aus den Sparten – und Funktionsbereichen, die mit g Die Dimensionen Kosten und Nutzen
Projektthemen betraut sind. g KPIs zur Erfassung quantitativer und qualita-
tiver Effekte
Ziele/Nutzen g Messkonzepte
g Verfahren der Investitionsrechnung
Geprüfte/r Controller/in in Versicherungsunternehmen
Ein erheblicher Teil der Ressourcen eines Versiche-
g Erstellung eines Business Cases (BC)
rungsunternehmens sind in Projekten (d.h. in
g Tool zur Bewertung von Projekten
Verfahrens- und Sachinvestitionen) gebunden.
g Fallstricke der Projektbewertung und deren
Mehrstellige Millionenbeträge werden hier aufge-
wandt, um das Versicherungsunternehmen auf Behandlung (z.B. die „Optimismusfalle“)
derzeitige und künftige Anforderungen auszurichten. Multiprojektsteuerung
Investitionsvorhaben sind aufgrund ihres hohen g Kriterien zur Priorisierung von Projekten
Innovationsgehaltes i.d.R. auch mit höheren finan- g Der Entscheidungs- und Auswahlprozess
ziellen Risiken verbunden, die sich in Abweichungen g Tools zur (Multi-)Projektsteuerung
zwischen erwarteten und tatsächlich realisierten
Projektsteuerung
Kosten- und Nutzeneffekten widerspiegeln.
g Definition und Operationalisierung der Projektziele
Die Teilnehmer g Zielkategorien (Time, Budget, Spezifikation)
g erhalten einen umfassenden Einblick in die g Ableitung von Indikatoren zur Messung der
wesentlichen Methoden und Kenngrößen der Zielerreichung während der Projektlaufzeit
Projektsteuerung und -bewertung, g Das Projekt-Reporting
g lernen deren Anwendung in der Praxis kennen
Projekt–Nachkalkulation
und vertiefen ihre Kenntnisse anhand von praxis- g Stolpersteine
nahen Übungen und einer Fallstudie. g Wie stelle ich eine konsequente und valide
Nachkalkulation sicher?
Inhalte g Wie stelle ich ein konsequentes „ Nutzeninkasso”
Zielsetzung/Inhalte des Projekt- und Investitions- sicher?
controllings
g Bedeutung und Funktion des Projektcontrollings Methodik
g Einordnung in die Gesamtsteuerung
g Fachlicher Input
g Arten von Investitionen
g Diskussionen
g Erfahrungsaustausch
g Übungen
g Fallstudie
Datum Ort Uhrzeit Referent Teilnahmegebühr
27. – 28.04.2015 Berlin Mo 09:00 – Di 16:30 Uhr Dr. Heinz-Theo Fürtjes 890,– € zzgl. MwSt.
Web-Code: V554
in Kooperation
mit dem
13Grundlagen des Kapitalanlage-Controlling
Erfolgreiche Steuerung des Kapitalanlageportfolios
Zielgruppe Kapitalanlage-Controlling am Beispiel ausgewählter
Vertiefungsmodul
Kapitalanlagen
Führungskräfte und Mitarbeiter aus dem Controlling g Festzinsanlagen (Bewertung, Duration,
sowie anderer Bereiche, insbesondere aus Betriebs-
Konvexität, Risiken)
wirtschaft, Planung und Rechnungswesen. g Aktien (Bewertung, Risiken, Value-at-Risk-
Analysen)
Ziele/Nutzen g Investmentzertifikate (Markt, Bewertung,
Anspruchsvolle Zielrenditen erfordern ein kompe- Risiken, Controllinginstrumente)
g Immobilien (Bewertung, Controllingaspekte)
tentes Controlling der Kapitalanlagerisiken.
g Derivate Finanzinstrumente (Systematisierung,
Geprüfte/r Controller/in in Versicherungsunternehmen
Die Teilnehmer lernen Optionsgeschäfte, Futures, Swaps, BaFin R3/2000)
g die Zusammenhänge eines praxisnahen, struktu- g Strukturierte Produkte (BaFin R3/1999)
rierten Kapitalanlagecontrolling-Prozesses kennen, g Alternative Investments (Hedge Fonds, Private
g die Verfahren zur Identifikation, Messung und
Equity, Asset Backed Securities)
Steuerung der Kapitalanlagerisiken zu verstehen
und Risiko-Controlling für Kapitalanlagen
g eine risikojustierte Kapitalanlagestrategie struktu-
g Identifikation von Kapitalanlagerisiken
g Instrumente zur Risikomessung und -analyse
riert zu entwickeln.
Strategisches Kapitalanlage-Controlling
Die Teilnehmer erhalten praxisorientierte Anregungen
g Strategische Asset Allocation
zur Umsetzung eines strukturierten Kapitalanlage-
g Prozess der Kapitalanlageplanung
Controllings in Versicherungsunternehmen und zur g Ansätze eines Asset Liability Managements (ALM)
Optimierung der Kapitalanlagerisiken und -chancen
im Gesamtportfolio. Ausgewählte Beispiele zur Berichterstattung über
Kapitalanlagen
Inhalte g Monatsbericht Kapitalanlagen
g Management Summary
Einführung
g Die Bedeutung der Kapitalanlage Überblick über Solvency II
g Der Investmentprozess
g Bilanzielle Aspekte der Kapitalanlage Methodik
g Gesetzliche Rahmenbedingungen für die
g Fachlicher Input
Kapitalanlagen gemäß VAG g Praxisbeispiele
Kapitalanlage-Controlling als Instrument der g Diskussionen
Unternehmensführung g Gruppenarbeiten
g Veränderungen im Umfeld der Kapitalanlage
g Renditekennziffern
Datum Ort Uhrzeit Referent Teilnahmegebühr
15. – 17.06.2015 Köln Mo 09:00 – Mi 16:30 Uhr Dr. Volker Becker 1.090,– € zzgl. MwSt.
25. – 27.11.2015 Berlin Mi 09:00 – Fr 16:30 Uhr Dr. Volker Becker 1.090,– € zzgl. MwSt.
Web-Code: V509
14 in Kooperation
mit demKostenmanagement/Kostenverteilung
Methoden und Instrumente für erfolgreiche Wirtschaftlichkeitssteuerung
Zielgruppe Kostenartenrechnung
Vertiefungsmodul
g Definition / Zielsetzung
Führungskräfte und Mitarbeiter aus dem Controlling
g Übersicht der Kostenarten
sowie anderer Bereiche, insbesondere aus Betriebs-
g Personal- und Sachkosten
wirtschaft, Planung und Rechnungswesen.
g Provisionen
g Variable vs. Fixe Kosten
Ziele/Nutzen
Kostenstellenrechnung
Erfolgreiches Kostenmanagement ermöglicht, die
g Definition / Zielsetzung
Kosten in einem Unternehmen zu analysieren, die
g Typen von Kostenstellen
Geprüfte/r Controller/in in Versicherungsunternehmen
Entwicklung der Kosten zu bewerten, Kostentreiber
g Direkte vs indirekte Kosten
zu identifizieren und nicht zuletzt die Entwicklung
g Die Kostenverrechnung auf Kostenstellen
der Kosten zielgerichtet zu beeinflussen.
g Budgetierung
Die Teilnehmer lernen
Kostenträgerrechnung
g aufbauend auf der klassischen Struktur der
g Defintion / Zielsetzung
Kostenrechnung neue Steuerungsansätze kennen,
g Typen von Kostenträgern
g Methoden und Ansätze der Kostenverteilung
g Prinzipien der Kostenverrechnung auf Kostenträger
kennen und
g Verfahren und Kriterien zur Kostenverrechnung
g verfahrenstechnische und mentale Erfolgskompo-
g Beispiel einer Kostenverrechnung in 5 Schritten
nenten des Kostenmanagements zu bewerten.
Profit-Center-Rechnung
Das Seminar gibt einen systematischen Einblick in
das Kostenmanagement und vermittelt Methoden Kostensteuerung
und Instrumente zur nachhaltigen Wirtschaftlich- g Regelkreis der Steuerung
keitssteuerung. g Ableitung von Kostenzielen
g Instrumente der Kostenplanung
Inhalte g Berichterstattung
Zielsetzung / Grundlagen
Methodik
g Zielsetzung des internen Rechnungswesens
g Bausteine des internen Rechnungswesens g Fachlicher Input
g Grundlegende Begriffe g Diskussionen
g Grundkonzept der (Kosten-)Steuerung g Gruppenarbeiten
g Fallstudie
Datum Ort Uhrzeit Referent Teilnahmegebühr
30.11. – 01.12.2015 Köln Mo 09:00 – Di 16:30 Uhr Dr. Heinz-Theo Fürtjes 890,– € zzgl. MwSt.
Web-Code: V510
in Kooperation
mit dem
15Intensivseminar Management-Reporting
Komplexe quantitative Zusammenhänge aussagekräftig und
zielgruppenadäquat transportieren
Zielgruppe Inhalte
Vertiefungsmodul
Alle Mitarbeiter von Versicherungen, die mit Zahlen g Ziele von betriebswirtschaftlichem Berichtswesen
kommunizieren oder für ein (Management-) in der Versicherungswirtschaft
Berichtswesen verantwortlich sind, also z.B. Mit- g Kennzahlendefinition und -auswahl
arbeiter im Bereich Finanzen, Controlling, aber auch g Umgang mit Prozentwerten und anderen statisti-
Unternehmenskommunikation etc. schen Scheingenauigkeiten
g Kennzeichen aussagekräftiger Reports und
Ziele/Nutzen Diagramme (Botschaft, Einheitlichkeit, Farb-
gebung, Informationsdichte)
Geprüfte/r Controller/in in Versicherungsunternehmen
Zur Steuerung von Versicherungsunternehmen lie-
g Darstellung von Kennzahlenaussagen
fern diverse Systeme eine Vielzahl an Kennzahlen,
(mit Visualisierung)
die als Grundlage für wichtige Unternehmensent-
g Anspruchsvolle Diagramme mit MS Office
scheidungen dienen. Aufgrund der Vielzahl und
realisieren
Komplexität fällt es den Berichtszielgruppen immer
g Regeln zur Gestaltung aussagekräftiger Tabellen
schwerer, die Zahlen und Diagramme auf einen Blick
g Zielgruppenanalyse für das Reporting
zu erfassen und richtig zu interpretieren.
In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie Zahlen und
Methodik
komplexen Zusammenhänge eine Bedeutung geben
und sie so aufbereiten, dass sie leichter und besser Das Seminar zeichnet sich durch seinen interaktiven
verständlich sind. Ihre Zielgruppe wird Ihre Aus- Workshop-Charakter aus. Theorie-Input wird mit
sage leichter erfassen und interpretieren können. Übungen durchsetzt. Auch der persönliche Austausch
der Teilnehmer untereinander kommt nicht zu kurz.
Die Teilnehmer lernen
g durch zielgerichtete Kommunikation von Zahlen
zu unterstützen,
g bei der Interpretation von Statistiken und
Diagrammen die richtigen Fragen zu stellen,
g sich selbst nicht manipulieren zu lassen.
Im Rahmen des Seminars werden Tipps und Tricks
für MS Excel und PowerPoint sowie SAP gegeben.
der Charakter des Seminars ist jedoch ein Fach-
training als eine EDV- Weiterbildung.
Datum Ort Uhrzeit Referent Teilnahmegebühr
21. – 22.09.2015 Berlin Mo 09:00 – Di 16:30 Uhr Dr. Frank Hartmann 1.090,– € zzgl. MwSt.
Alexander Hennig
Web-Code: V552
16 in Kooperation
mit demProfitcenter-Steuerung
Inhalte und Methoden der Profitcenter-Rechnung (PCR)
Zielgruppe Ausgewählte Fragestellungen zum Aufbau und
Vertiefungsmodul
Anwendung einer PCR
Führungskräfte und Mitarbeiter aus dem Controlling
g Prozess und Kriterien zur Preisbildung für
sowie anderer Bereiche, insbesondere aus Betriebs-
interne Dienstleistungen
wirtschaft, Planung und Rechnungswesen.
g das Preis-/Mengen-Dilemma
g Kongruenz zwischen Kostenallokation und
Ziele/Nutzen
Kostenverantwortung
Das Profitcenter ist ein autonomer organisatorischer g Kongruenz zwischen PC-Steuerung und
Teilbereich, für den ein eigener Periodenerfolg er- Anreizsysteme
Geprüfte/r Controller/in in Versicherungsunternehmen
mittelt wird. Die Profitcenter-Steuerung erleichtert
Ausgestaltung und konkrete Anwendungen der PCR
der Unternehmensführung die gewinnorientierte
im Versicherungsunternehmen zur Messung und
Steuerung der Teilbereichsaktivitäten und macht sie
Steuerung der
am Markt mit anderen Profitcentern vergleichbar.
g Profitabilität von Geschäftsbereichen
Für die Umsetzung einer konsequent ertragsorien-
(u.a. Sparten; Regionen)
tierten Unternehmenssteuerung ist die Profitcenter-
g Effizienz von Vertrieben/Vertriebseinheiten
Steuerung ein wichtiger Baustein.
g Effizienz von Servicebereichen
Die Teilnehmer (u.a. EDV; Antrags-/Bestandsverwaltung;
g erhalten einen Überblick über die wesentlichen Personalverwaltung)
Inhalte und Methoden der Profitcenter-Rechnung
Grenzen einer Profitcenter-Steuerung
(PCR),
g lernen verschiedene Möglichkeiten der praktischen Prozess der Implementierung einer PCR im
Anwendung der PCR kennen, Unternehmen
g bekommen konkrete Hinweise zur Implemen- g Von der Idee zum Projekt und zur organi-
tierung einer PCR. satorischen Implementierung
g Anforderungen an die (Informations-)Systeme
Das Seminar zielt auf die Weiterentwicklung des Fach-
g Stolpersteine bei der Entwicklung, Implemen-
und Erfahrungswissens der Teilnehmer ab und bietet
tierung und Anwendung der PCR
Anregungen für die (Weiter-)Entwicklung und An-
wendung der PCR zur Ertrags- und Kostensteuerung.
Methodik
Inhalte g Fachlicher Input
g Diskussionen
Zielsetzung der Profitcenter-Rechnung (PCR)
g Gruppenarbeit
Grundkonzept der PCR g Fallstudien
Die Deckungsbeitragsrechnung (DBR) als Basis einer
PCR
Die Bausteine einer PCR
Datum Ort Uhrzeit Referent Teilnahmegebühr
09. – 10.11.2015 Köln Mo 09:00 – Di 16:30 Uhr Dr. Heinz-Theo Fürtjes 890,– € zzgl. MwSt.
Web-Code: V511
in Kooperation
mit dem
17Vertriebs-Controlling
Inhalte, Prozesse und Instrumente einer effizienten Vertriebssteuerung
Zielgruppe Strategische Vertriebssteuerung
Vertiefungsmodul
g Inhalte/Bestandteile einer Vertriebsstrategie
Führungskräfte und Mitarbeiter aus dem Controlling
g Strategische Steuerungsgrößen für den Vertrieb
sowie anderer Bereiche, insbesondere aus Betriebs-
g Strategieentwicklungsprozess
wirtschaft, Planung und Rechnungswesen.
g Strategiekontrolle/-evaluierung
Ziele/Nutzen Operative Vertriebssteuerung
g Die vier Dimensionen des Vertriebscontrollings
Vor dem Hintergrund eines geringen Marktwachs-
g Steuerungsgrößen
tums und eines zunehmenden Wettbewerbs kommt
Geprüfte/r Controller/in in Versicherungsunternehmen
einer wirksamen Vertriebssteuerung eine wachsende Vertriebsplanung
Bedeutung zu. Es gilt, effiziente und kostensenkende g Zielgrößen
Prozesse aufzusetzen, um den Kosten- und Margen- g Planungsprozess
druck im Vertrieb aktiv begegnen zu können. Pro- g Regeln/Ansätze für den Zielvereinbarungsprozess
zessablaufcontrolling und Benchmarkingprozesse g Bestandteile des Vertriebsplanes
sind hierbei wesentliche Bausteine und Erfolgsfakto- g Orientierungsgrößen/Informationsquellen
ren des Vertriebs-Controllings.
Berichterstattung
Die Teilnehmer g Inhalte der Vertriebsberichte
g lernen die wesentlichen Inhalte, Prozesse und g Grundregeln
Methoden der Vertriebssteuerung kennen und g Controlling-Gespräch
anzuwenden, g Maßnahmen-Controlling
g erkennen die Möglichkeiten und Grenzen einer
Die Informationsversorgung des Vertriebs
effizienten Vertriebssteuerung,
g Externe und interne Informationsquellen
g erhalten konkrete Hinweise für die steigende Wir-
g EIS-System für den Vertrieb
kung einer (wertorientierten) Vertriebssteuerung.
Anreizsysteme
Das Seminar zielt auf die Weiterentwicklung des Fach-
g Kongruenz zwischen Anreizsystem und Unter-
wissens und der Erfahrung der Teilnehmer ab und
nehmenszielen
bietet darüber hinaus weitergehende Anregungen
g Ertrags- und Wachstumsziele – ein Widerspruch?
zum Vertriebs-Controlling im eigenen Unternehmen.
Ansätze einer wertorientierten Vertriebssteuerung
Inhalte
Methodik
Vertrieb im Versicherungsunternehmen
g Aufgaben und Bedeutung vor dem Hintergrund g Fachlicher Input
sich verändernder Rahmenbedingungen g Diskussionen
g Charakterisierung verschiedener Vertriebswege g Gruppenarbeit
g Fallstudien
Einführung in die Vertriebssteuerung
g Ziele und Aufgaben
g Steuerungs-Prozesse
Datum Ort Uhrzeit Referent Teilnahmegebühr
20. – 22.04.2015 Köln Mo 09:00 – Mi 16:30 Uhr Dr. Heinz-Theo Fürtjes 1.090,– € zzgl. MwSt.
Web-Code: V512
18 in Kooperation
mit demKundensegmentorientiertes Controlling
Integration einer ganzheitlichen Kundenbetrachtung
Zielgruppe Notwendigkeit einer Integration der Dimension
Vertiefungsmodul
„Kunde“ in die strategische und operative
Führungskräfte und Mitarbeiter aus dem Controlling
Unternehmenssteuerung
sowie anderer Bereiche, insbesondere aus Betriebs-
wirtschaft, Planung und Marketing. Grundlagen einer kundensegmentorientierten
Unternehmenssteuerung
Ziele/Nutzen g Methoden, Konzepte und Kriterien
Die konsequente Ausrichtung der Unternehmens- Kundeninformation(ssysteme)
aktivitäten auf die Bedürfnisse der Kunden ist der g Verfahren und Quellen zur systematischen
Geprüfte/r Controller/in in Versicherungsunternehmen
zentrale Erfolgsfaktor für nachhaltigen Unterneh- Erfassung von Kundendaten
menserfolg. Die traditionellen spartenorientierten g Aufbau eines Kundeninformationssystems
Unternehmensstrukturen und Steuerungskonzepte g Tools/Verfahren zur Auswertung und Nutzung von
erschweren eine ganzheitliche Betrachtung des Kundendaten
Kunden sowie die gezielte Ausrichtung des Leistungs-
Nutzung von Kundeninformationen
angebotes an die spezifischen Anforderungen unter-
schiedlicher Kundengruppen. Praxisnahe Lösungen Kundenprofitabilitätsanalysen: Was ist ein Kunde wert?
und Konzepte für eine stärkere Integration einer g (wertorientierte) Messkonzepte zur Ermittlung der
ganzheitlichen Kundensicht in die strategische und Kundenprofitabilität
operative Unternehmenssteuerung werden vorge- g Identifikation profitabler Kunden(segmente)
stellt und diskutiert.
Integration des Kunden in die Unternehmens-
Die Teilnehmer steuerung
g lernen verschiedene Ansätze für Kundentypo- g Bausteine einer kunden(segment)orientierten
logien und -segmentierungen kennen, Unternehmensstrategie
g erhalten Beispiele für die Integration der Dimen- g Integration einer Kunden(segment)orientierung in
sion „Kunde“ in die strategische und operative die operative Geschäftsfeld- und Vertriebssteuerung
Unternehmenssteuerung,
Kunden(segment)orientiertes Steuerungssystem
g lernen die Performanceindikatoren und Steue-
g Die zentralen Steuerungsgrößen
rungsgrößen für eine kunden(segment)-orien-
g Der Planungs- und Monitoring-Prozess
tierte Unternehmenssteuerung kennen,
g Verzahnung von Kunden-, Sparten- und
g erhalten Hinweise für die erfolgreiche Implemen-
Vertriebssteuerung
tierung einer kundenorientierten Unternehmens-
g Kunden(segment)orientiertes Berichtssystem
steuerung anhand von Beispielen.
Der Prozess der Implementierung
Inhalte
Methodik
Kundenorientierung als zentraler Erfolgsfaktor
g Fachlicher Input
Integration der Dimension „Kunde“
g Diskussion
g Gruppenarbeit
Datum Ort Uhrzeit Referent Teilnahmegebühr
23. – 24.11.2015 Köln Mo 09:00 – Di 16:30 Uhr Dr. Heinz-Theo Fürtjes 890,– € zzgl. MwSt.
Web-Code: V513
in Kooperation
mit dem
19Controlling von Operations- und Servicebereichen
Wesentliche Steuerungskonzepte, -größen und -instrumente
Zielgruppe Inhalte
Vertiefungsmodul
Führungskräfte und Mitarbeiter aus dem Controlling Ziele und Aufgaben der Servicebereiche
sowie anderer Bereiche, insbesondere aus Betriebs-
Bedeutung der Servicebereiche für die langfristige
wirtschaft, Planung und Rechnungswesen.
Absicherung der Wettbewerbsfähigkeit und
Ertragskraft des Versicherungsunternehmens
Ziele/Nutzen
Dimensionen der Steuerung für Serviceeinheiten
Die von Kunden erlebbare Servicequalität ist ein
g Leistung
wesentlicher Einflussfaktor für ein nachhaltiges
g Qualität
Geprüfte/r Controller/in in Versicherungsunternehmen
Unternehmenswachstum. Darüber hinaus können
g Produktivität
die Servicebereiche, wie z. B. die Antrags-/Bestands-
g Profitabilität
bearbeitung, Schaden-/Leistungsbearbeitung oder
Telefonie/Call-Center einen Beitrag zur Steigerung Wesentliche Performance-Indikatoren für die vier
der Ertragskraft im Unternehmen leisten. Eine Grund- Dimensionen
lage für die nachhaltige Absicherung von hoher Ser-
Steuerungsgrößen für verschiedene Service-
vicequalität und Effizienz ist ein Steuerungssystem
funktionen
mit konkreten (Service-)Zielen und einem laufenden
g Telefonie
Monitoring.
g Antragsbearbeitung
Die Teilnehmer g Bestandsbearbeitung
g erhalten einen Einblick in praxiserprobte g Schadenbearbeitung
Konzepte zur Steuerung der Servicebereiche,
Ableitung von Zielen
g lernen die wesentlichen Steuerungsgrößen und
Instrumente kennen und anzuwenden, Controlling der Zielerreichung
g erhalten konkrete Hinweise zum Aufbau und zur g Operationalisierung der Ziele in messbare
Einführung eines Steuerungssystems für die Zielgrößen/Indikatoren
verschiedenen Servicefunktionen. g Festlegung der Messpunkte und Messvorschriften
g Aufbau eines Berichtssystems
Die Teilnehmer erhalten praxisnahe Anregungen für
die Weiterentwicklung der Steuerungssysteme im Technische und organisatorische Voraussetzungen
eigenen Unternehmen, um die Leistung und Effizienz für den Aufbau eines Controlling-Systems
ihrer Servicebereiche kontinuierlich verbessern zu
Prozess der Implementierung eines Steuerungs-
können.
systems
Methodik
g Fachlicher Input
g Diskussionen
g Gruppenarbeit
g Fallstudie
Datum Ort Uhrzeit Referent Teilnahmegebühr
25. – 26.11.2015 Köln Mi 09:00 – Do 16:30 Uhr Dr. Heinz-Theo Fürtjes 890,– € zzgl. MwSt.
Web-Code: V514
20 in Kooperation
mit demSchaden-Controlling
Service- und ertragsorientierte Steuerung der Schadenbereiche
Zielgruppe Dimensionen der Schaden-/Leistungsbereiche
Vertiefungsmodul
g Leistung
Führungskräfte und Mitarbeiter aus dem Controlling
g Qualität
sowie anderer Bereiche, insbesondere aus Betriebs-
g Produktivität
wirtschaft, Planung und Rechnungswesen.
g Profitabilität
Ziele/Nutzen Steuerungsgrößen für die Schadenregulierung/
Leistungsbereiche von Sach-, Leben- und Kranken-
Die Qualität der Schadenregulierung nimmt wesent-
versicherungsunternehmen
lichen Einfluss auf den nachhaltigen Unternehmens-
Geprüfte/r Controller/in in Versicherungsunternehmen
erfolg. Hier beweist sich das bei Vertragsunter- Schadenanalyse
zeichnung gegebene Leistungsversprechen. Darüber g Verfahren zur Schadenprognose und -reservierung
hinaus liegen in den Schaden- und Leistungsberei- g Analyse der Schadenabwicklungsergebnisse auf
chen noch erhebliche Ertragspotenziale, die es zur der Basis von Schadendreiecken
weiteren Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit und g Identifikation von „Schadennestern“
Ertragskraft des Versicherungsunternehmen zu reali-
Ableitung von Zielen
sieren gilt.
Controlling der Zielerreichung
Die Teilnehmer
g Operationalisierung in messbare Zielgrößen/
g bearbeiten praxiserprobte Konzepte zur service-
Indikatoren
und ertragsorientierten Steuerung der Schaden-
g Festlegung der Messpunkte und Messvor schriften
bereiche,
g Aufbau eines Berichtssystems
g lernen die wesentlichen Steuerungsgrößen und
Instrumente kennen und anzuwenden, Maßnahmen-Controlling
g erhalten konkrete Hinweise zum Aufbau und
Vernetzung zwischen dem Funktionsbereich
Einführung eines Steuerungssystems für die
„Schadenregulierung“ und den Bereichen „Produkt-
Schaden- und Leistungsbereiche der Sach-,
entwicklung“, „Spartensteuerung“ und „Vertrieb“
Leben- und Krankenversicherungsunternehmen.
Technische und organisatorische Voraussetzungen
Inhalte für den Aufbau eines Controlling-Systems
Ziele/Aufgaben der Schaden-/Leistungsbereiche Prozess der Implementierung eines Steuerungs-
systems
Bedeutung der Schaden-/Leistungsbereiche für die
langfristige Absicherung der Wettbewerbsfähigkeit
Methodik
und Ertragskraft des Versicherungsunternehmens
g Diskussionen
g Fachlicher Input
g Fallstudien
g Praxisbeispiele
Datum Ort Uhrzeit Referent Teilnahmegebühr
08. – 09.06.2015 Berlin Mo 09:00 – Di 16:30 Uhr Dr. Heinz-Theo Fürtjes 890,– € zzgl. MwSt.
Web-Code: V515
in Kooperation
mit dem
21Prozess-Controlling
Ziel- und kennzahlenbezogene Steuerung von Prozessen
Zielgruppe Inhalte
Vertiefungsmodul
Mitarbeiter in Versicherungsunternehmen oder g Grundlagen des Prozess-Controllings
angrenzender Branchen, Prozesscontroller, Prozess-
g Prozessorientierte Sichtweisen
verantwortliche, Prozessmanager, Prozessbeteiligte,
Controller, Messverantwortliche, Qualitäts- g Verbindung von Strategie und Prozessen
beauftragte, Mitarbeiter Organisationsentwicklung.
g Ableitung von Prozesszielen top-down und
bottom-up
Ziele/Nutzen
g Festlegung von SMARTen Prozesszielen
Geprüfte/r Controller/in in Versicherungsunternehmen
In einer komplexer werdenden Umwelt treten
Geschäftsprozesse als Steuerungsprojekte immer g Die Prinzipien von guten Zielen
stärker in den Vordergrund. Die daraus resultieren-
g Balanced Scorecard als Werkzeug
den Veränderungen erfordern in zunehmendem
Maße einen prozessorientierten Aufbau der internen g Prozessreporting und Monitoring
Organisationsstruktur im Unternehmen und machen
g Zielerreichung messen, darstellen, interpretieren,
somit ein effektives und effizientes Controlling der
kommunizieren und verbessern
Geschäftsprozesse zu einem neuen Instrument der
Unternehmenssteuerung. g Der Verbesserungsprozess / KVP-Prinzip
g Steuerung der Kernprozesse mittels Schlüssel-
Die Teilnehmer werden
kennzahlen
g ein Instrumentarium zur Zielsetzung, Planung,
Messung und Steuerung relevanter Kenngrößen g Ziel- und Kennzahlenbezogene Steuerung des
der Prozesse aufbauen und auf dieser Basis Prozessmodells und der einzelnen Prozesse
gezielte Maßnahmen zur Prozessverbesserung
g Prozesse analysieren
einleiten,
g ein Berichtswesen und Monitoring aufbauen,
Methodik
g Optimierungspotenziale ableiten,
g Quantitative Methoden zur Prozess- und g Vortrag
Leistungsbewertung anwenden. g Übungen
g Fallbeispiele
g Diskussionen
g Erfahrungsaustausch
Datum Ort Uhrzeit Referenten Teilnahmegebühr
14. – 15.09.2015 Berlin Mo 09:00 – Di 16:30 Uhr Dr. Frank Hartmann 1.090,– € zzgl. MwSt.
Alexander Henning
Web-Code: V531
22 in Kooperation
mit demWorkshop: Gestaltung eines Frühwarnsystems
mittels Indikatoren nach MaRisk (VA)
Aufbau eines Indikatorensystems
Voraussetzungen Inhalte
Vertiefungsmodul
Kenntnisse zu Internen Kontrollsystemen (IKS) Grundlagen Frühwarnsysteme
g Definition
Zielgruppe g Abgrenzung zu Limit- und Schwellenwert- sowie
RBC-Systemen
Führungskräfte und Mitarbeiter aus dem Controlling
g Rechtliche Rahmenbedingungen (MaRisk,
sowie anderer Bereiche, insbesondere aus Betriebs-
R 4/2011)
wirtschaft, Planung und Rechnungswesen.
Indikatorensysteme
Geprüfte/r Controller/in in Versicherungsunternehmen
Ziele/Nutzen g Vorgehensweise bei Identifikation, Analyse und
Zusammenstellung von Frühwarnindikatoren
Durch die Mindestanforderungen an das Risiko-
g Ausgesuchte Frühwarnindikatoren der
management (MaRisk) gewinnt die Risikosteuerung
Versicherungstechnik und operationelle Risiken,
und -überwachung in Versicherungsunternehmen eine
Kapitalanlagen
noch größere Bedeutung. Doch was sind die ent-
g Bestimmung von Schwellenwerten
scheidenden Risikotreiber, die den Anstieg des
g Regelmäßige Prüfung der Risikosensitivität
notwendigen Risikokapitals bewirken?
g Praktisches Beispiel: Ableitung von Risikotreibern
Für eine vollständige Steuerung gilt es genau diese aus einem Internen Modell
Treiber regelmäßig zu überwachen und zu limitieren.
Verbindung von Internen Kontrollsystemen und
Nur so kann frühzeitig auf negative Entwicklungen
Risikomanagementsystemen mittels Indikatoren
reagiert und Veränderungen des notwendigen
g Der Weg zu einem ganzheitlichen System
Risikokapitals plausibel erklärt werden.
aus qualitativem und quantitativem Risiko-
Die Teilnehmer lernen management
g Risiken kennen, die sich mit Indikatoren über- g Funktionsfähigkeit von Kontrollen
wachen lassen,
g spezielle Anforderungen eines Indikatoren- Methodik
systems kennen,
g Fachlicher Input
g Frühwarnsysteme festzulegen und in bestehende
g Praktische Fallbeispiele
Unternehmensprozesse zu integrieren.
Nach Abschluss des Seminars sind die Teilnehmer
für die speziellen Anforderungen eines Indikatoren-
systems sensibilisiert und können selbstständig
Frühwarnsysteme festlegen und in bestehende
Unternehmensprozesse integrieren.
Datum Ort Uhrzeit Referent Teilnahmegebühr
10.11.2015 Berlin Di 10:00 – 17:30 Uhr Jan-Hendrik Uhlenberg 590,– € zzgl. MwSt.
Web-Code: V516
in Kooperation
mit dem
23Sie können auch lesen