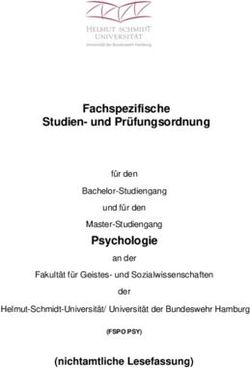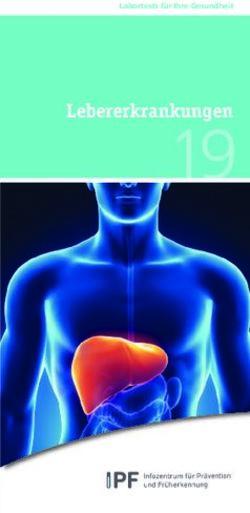Seminar - Leber und Pankreas
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
4. Seminar – Leber und Pankreas
Erarbeitet von Leif, Enno, Juli
4. Seminar – Leber und Pankreas
Verweise mit [U] beziehen sich auf „Kurzlehrbuch Embryologie“ von Ulfig im Thieme Verlag, 1.
Auflage. Verweise mit [b] beziehen sich auf „Taschenbuch Anatomie“ von Benninghoff und
Drenckhahn im Urban&Fischer‐ Verlag, 1. Auflage. Angaben mit [P] beziehen sich auf „Prometheus –
Hals und innere Organe“ vom Thieme Verlag, 1. Auflage.
Allgemeines
von Juli
‐ die Leber ist das größte Stoffwechselorgan des Körpers, sie nimmt alle Stoffe auf, die ihr mit
dem Pfortaderblut zugeleitet werden, verarbeitet oder speichert sie, oder gibt sie entweder
in Ausführungsgänge oder in Blutgefäße ab
‐ in der Fetalzeit ist die Leber an der Blutbildung beteiligt
‐ die Leber erreicht als größte Drüse des Körpers ein Gewicht von 1500‐ 2000gr
‐ bei Gesunden hat sie eine dunkelbraune Farbe
Leber: klassische Läppchen, portales Läppchen, Azinus
von Juli
‐ Die strukturelleund funktionelle Einheit der Leber sind Leberläppchen, je nach
Betrachtungsweise werden unterschieden Lobulus hepatis, portales Läppchen und
Leberazinus
‐ Beim Lobulus hepatis liegt die v. centralis im Läppchenmittelpunkt, die Läppchen sind
unregelmäßige geformte, meist längliche Gebilde mit Kanten und Flächen
‐ Ihr Durchmesser beträgt etwa 1mm,ihre Höhe 1,5‐ 2 mm
‐ Benachbarte Läppchen sind durch spärliche Bingdegewebszüge voneinander getrennt
‐ Nur dort wo mehrere Läppchen mit ihren Kanten zusammen stoßen , verdichtet sich das
Bindegewebe und bildet Bindegewebszwickel, periportale Felder
‐ Hier liegen die feineren Äste der zuführenden Blutgefäße, die Vv. interlobulares (A.
hepatica), sowie die ableitenden Gallengänge, Ducti interlobulares, sie bilden zusammen die
Glisson‐Trias
‐ beim portalen Läppchen befindet sich das periportale Feld im Mittelpunkt eines im Schnitt
dreieckigen Gebietes
‐ die Ecken des portalen Läppchens bilden die Vv.centrales
‐ in einem portalen Leberläppchen fließt die Galle in den zentral gelegenen
Gallenausführungsgang
‐ an der Bildung eines portalen Läppchens sind Teile von drei angrenzenden klassischen
Leberläppchen beteiligt
‐ ein Leberazinus hat die Form eines Rhombus, bei dem die Ecken jeweils von 2
gegenüberliegenden Zentralvenen und 2 gegenüberliegenden periportalen Feldern gebildet
werden
‐ die Achse bilden Endäste der A. und V. interlobularis, die gleichzeitig die Grenze zwischen 2
benachbarten klassischen Leberläppchen markieren
‐ an einem Leberazinus sind Teile von 2 benachbarten klassischen Läppchen beteiligt
-1-4. Seminar – Leber und Pankreas
Erarbeitet von Leif, Enno, Juli
Gallenkanälchen, Gallengänge; extrahepatische Gallenwege
von Leif
Makroskopie und Topographie
‐ Ductus cysticus vereinigt sich mit Ductus hepaticus communis zum Ductus choledochus, der
an papilla doudeni major ins Duodenum mündet (s.u.); Vesica wird durch Rückstau gefüllt
intrahepatische Gallengänge
‐ [P] S. 210 b
‐ Canalinculi biliferi (Gallenkanälchen; zwischen benachbarten Leberepithelzellen) münden in
interlobuläre Gallengänge
‐ interlobuläre Gallengänge vereinigen sich zu immer größeren Stämmen (Ductus biliferi
interlobulares), aus denen ein rechter und ein linker Ductus hepaticus hervorgehen
extrahepatische Gallengänge
‐ [P] S. 210 b
‐ Ductus hepaticus dexter und sinister vereinigen sich an Leberpforte zum Ductus hepaticus
communis
‐ Ductus hepaticus communis und Ductus cysticus begrenzen (mit Unterfläche der Leber) das
Trigonum cholezystohepaticum (CALOT‐ Dreieck ([b] Abb. 6‐43)), vereinigen sich zum Ductus
choledochus
‐ Ductus choledochus
o Pars supraduodenalis im Lig. hepatoduodenale ventral der V. portae
o Pars ventroduodenalis hinter dem Duodenum
o Pars pancreatica durch den Pankreaskopf
o Pars intraduodenalis durch die Wand des Duodenum descendens
o mündet auf Papilla duodeni major (= Papilla VATERI)
‐ glatte Muskulatur bildet den M. sphincter ductus choledochi
o Pars superior umschlingt Ductus choledochus
o Pars inferior (= M. sphincter ampullae) umschlingt Ampulla und Mündung
Klinik
‐ CALOT‐ Dreieck ist wichtige Orientierungshilfe für operative Eingriffe: hier entspringt in 70%
der Fälle die A. cystica aus R. dexter der A. hepatica propria
‐ da Ductus choledochus durch Pankreas verläuft kann es bei Pankreaserkrankungen zu
Gallenrückstau (Cholestase) ins Blut kommen
portokavale Anastomosen
von Leif
‐ venöse Kurzschlüsse zwischen V. portae hepatis und V. cava superior/inferior
Entstehung
‐ entstehen physiologisch
‐ Ursachen:
o Überlappung von venösen Stromgebieten in Organen (Venenplexus; z.B. an
Oesophagus, Rectum)
o Offenbleiben von Gefäßen die normalerweise postnatal veröden (Vv. umbilicales, Vv.
paraumbilicales)
klinische Relevanz
‐ es kommt im Krankheitsfall bei insuffizientem Abfluss zu einem Rückstau und zu einer
Flussumkehr
-2-4. Seminar – Leber und Pankreas
Erarbeitet von Leif, Enno, Juli
‐ Blut gelangt über Umwege zum Herzen
‐ intravasaler Druck steigt → erhöhte Gefahr von Varizen
‐ wichtige Anastomosen
o vier Anastomosen sind besonders wichtig ([P] S. 293; [b] Abb. 6‐40):
V. portae ← Vv. gastricae Vv. oesophageales V. azygos/hemiazygos
→ V. cava sup.
V. portae ← V. umbilicalis Vv. paraumbilicales V. epigastrica inf. → V. iliaca
ext. → V. cava inf.
V. epigastrica sup. → V.
thoracica inf. → V. subclavia
→ V. cava sup.
V. portae ← V. mesenterica Vv. colicae Vv. lumbales ascendentes →
sup. + inf. V. azygos/hemiazygos → V.
cava sup.
V. portae ← V. mesent. inf. Vv. rectales med./inf. V. iliaca interna → V. cava inf.
← V. rectalis sup.
Entwicklung des Pankreas
von Leif
‐ eine ventrale und eine dorsale Pankreasknospe bilden sich im Vorderdarm
o ventrale Knospe steht in enger Beziehung zum Gallengang (Ductus choledochus) ([U]
Abb. 7.9 a)
o dorsale Knospe wächst in Mesogastrium dorsale ein
‐ durch Magendrehungen gelangt die dorsale Anlage auf die linke Seite des Duodenums,
ventrale Anlage verlagert sich nach unterhalb der dorsalen Anlage ([U] Abb. 7.9 c)
‐ in 6. – 7. Woche: Verschmelzung der Anlagen
o ventrale Anlage → unterer Teil des Caput pancreatis; Process uncinatus
o dorsale Anlage → oberer Teil des Caput pancreatis; Corpus und Cauda pancreatis
‐ Pankreas wird während der Entwicklung der Bursa omentalis nach retroperitoneal verlagert
(= sekundär Retroperitoneal)
‐ Proc. uncinatus umgreift Stiel von A. + V. mesenterica superior
Ausführungsgänge des Pankreas
‐ Ausführungsgänge der ventralen und dorsalen Pankreas vereinigen sich
o Ductus pancreaticus major entstammt in Corpus und Cauda der dorsalen Anlage, im
Caput der ventralen Anlage; mündet in Papilla duodeni major (im Pars descendens
duodeni) ([U] Abb. 7.9 d)
o mündungsnaher Abschnitt des Gangs der dorsalen Anlage bildet sich meist zurück;
kann als Ductus pancreaticus minor auf Papilla duodeni minor (cranial der Pap. duod.
major) münden, in 10% der Fälle ist er sogar Hauptausführungsgang
endokrines und exokrines Pankreas
‐ an 2./3. Monat verzweigendes Gangsystem histologisch erkennbar
‐ an Spitzen der Gänge → Azini (exokrine Pankreas)
‐ aus Gängen wachsen Zellen aus → LANGERHANS’sche Inselzellen (endokrine Pankreas)
o bereits ab 9. Woche lassen sich endokrine Zellen mit Insulin‐ und
Glukagonproduktion nachweisen
-3-4. Seminar – Leber und Pankreas
Erarbeitet von Leif, Enno, Juli
Bauchspeichel: Enzyme, Bicarbonat, Regulation der Sekretion
von Enno
‐ Pankreassekret enthält über 20 der wichtigsten Verdauungsenzyme
‐ tgl. etwa 1500ml Pankreassaft produziert (abhängig von Nahrungzufuhr)
Inhaltsstoffe
Enzymatisch inaktive Protease‐Vorstufen (Zymogene)
‐ im Darmlumen werden Peptide abgespalten → es entstehen aktive Proteasen und
Peptidasen
o Trypsinogen
an Enterozyten des Duodenums von Enteropeptidase zu Trypsin aktiviert
Trypsin ist eine Endopeptidase → aktiviert weitere Zymogene, v.a. Vorstufen
des Chymotrypsins und der Carboxypeptidasen
o Chymotrypsin
als Endopeptidase an Verdauung beteiligt
o Carboxypeptidasen A und B
sind Exopeptidasen
spalten von Substraten die carboxyterminale Aminosäure ab
die Carboxypeptidase A hat eine besondere Affinität zu aromatischen Endgruppen
(Phenylalanin, Tyrosin, Tryptophan)
die Carboxypeptidase B zu basischen Endgruppen (Lysin, Arginin, Histidin)
Aktive Enzyme
o Pankreaslipase
Hydrolyse von Triglyceriden im Darmlumen
(Reaktionsprodukte v.a. Monoacylglycerine, daneben Fettsäuren, Glycerin und in
geringem Umfang Diacylglycerine)
zur Fettverdauung unbedingt erforderlich
o Phospholipase A2
Hydrolyse von Phospholipiden (Bestandteile biolog. Membranen)
o Cholesterin‐Esterase
spaltet Ester aus Cholesterin und Fettsäuren
hydrolysiert aber auch andere Ester (relativ unspezifische Esterase)
o α‐Amylase
spaltet Polysaccharide (1,4‐α‐glycosidischen Bindungen) in Disaccharide
o RNase und DNase
spalten Nukleinsäuren (aus RNA bzw. DNA) in Nukleotide
Bicarbonat (Hydrogencarbonat)
Pankreassaft hat durch hohen Konzentration von HCO3‐ einen pH von 8
→ Neutralisation des sauren Mageninhalts
Produktion
‐ Verdauungsenzyme von Azinuszellen gebildet → in Zymogengranula (intrazelluläre Vesikel)
gespeichert
‐ durch Exozytose in Ausführungsgänge freigesetzt
‐ im Bereich der Schaltstücke in den Ausführungsgängen wird durch Sekretin (s.u.) die
Produktion und Sezernierung großer Mengen an HCO3‐ und Wasser in das Lumen vermittelt
‐ Pankreassaft weiter in Ductus pancreaticus und durch diesen ins Duodenum bzw. (in 60% der
Fälle) in den Dustus choledochus
-4-4. Seminar – Leber und Pankreas
Erarbeitet von Leif, Enno, Juli
Regulation der PankreassekretProduktion
‐ Produktion des Pankreassekrets sowohl nerval als auch hormonal gesteuert
‐ Azinuszellen und Epithelzellen der Schaltstücke durch unterschiedliche Mechanismen
aktiviert
kephale Phase (Aktivierung des Pankreas)
o Azinuszellen über N. vagus innerviert
bereits Geruch u. Geschmack der Nahrung führt durch Vagusreiz zur
Freisetzung des Neurotransmitter Acetylcholin
ACh bindet an muscarinische Acetylcholinrezeptoren des Typs M1
→ Anstieg der intrazellulären Ca2+ ‐Konzentration in Azinuszellen
→ Aktivierung der Enzymproduktion
o Cotransmitter vasoaktives intestinales Peptid (=VIP)
Peptid von 28 AS, das meist zusammen mit Acetylcholin im Verdauungstrakt
ausgeschüttet wird
bewirkt in Epithelzellen der Schaltstücke einen Anstieg der intrazellulären
cAMP‐Konzentration
→ Zellen zur Sekretion angeregt
gastrische Phase
o im Anschluss an kephale Phase
o sobald Nahrung im Magen → Gastrin von G‐Zellen der Polyrusdrüsen freigesetzt
Gastrin aktiviert (neben Magendrüsen) Azinuszellen und Epithelzellen der
Schaltstücke
intestinale Phase
o beginnt durch Eintritt des Chymus (Nahrungsbrei) in das Duodenum
o in Duodenum und Jejunum zwei Peptidhormone freigesetzt:
Cholecystokinin (CCK)
wirkt vorwiegend auf Azinuszellen
→ Steigerung der intrazellulären Ca2+ ‐Konzentration
→ vermehrte Bildung des enzym‐ und chloridreichen Sekrets
(hemmt auch das Hungergefühl)
Sekretin
aktiviert vorwiegend Epithelzellen der Schaltstücke
→ Anstieg der intrazellulären cAMP‐Konzentration
→ führt zur Zunahme des Pankreassaftes (wenig Chlorid‐Ionen; viel
Bicarbonat)
-5-Sie können auch lesen