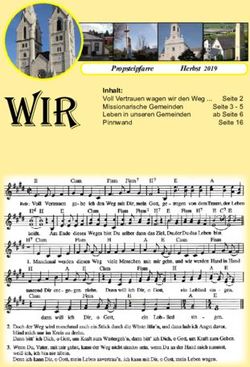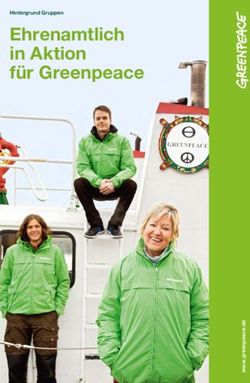UMWELTFÜHRER HERNALS - Die Grünen Hernals
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
VORWORT
Dieser Führer soll Hernalserinnen und
Hernalsern Orientierung bieten, und
Spaß machen. Er soll das Entdecken MAX HARTMUTH PAUL FELDER
und Erleben sowie gleichzeitig das
Schätzen und Respektieren fördern. Er soll die Vielfalt unserer näch-
sten Umwelt nicht nur dokumentieren, sondern erfahrbar machen.
Auch deshalb ist er wie ein Fremdenführer aufgebaut. Denn vieles
des Besprochenen ist uns längst fremd. Auch das versucht dieses
Vademecum zu ändern. Was will es uns aber näherbringen: Land-
schaft, Umwelt, Natur?
Mit „Umwelt“ ist hier vor allem die natürliche Umwelt des Menschen
gemeint. Nicht alles, was von uns behandelt wird, ist „Natur“ im enge-
ren Sinn. Dieser Begriff bezeichnet, in der wohl gängigsten Definition,
einfach das, was nicht vom Menschen geschaffen wurde. Bei Streu-
obstwiesen, Weingärten oder Wirtschaftswäldern handelt es sich aller-
dings um Kulturlandschaften, also Landschaften, die durch mensch-
liche Nutzung geschaffen oder geprägt wurden und werden (Den
Landschaftspark des Grafen Lacy, den wir als Schwarzenbergpark
kennen, könnte man gar als künstliche Landschaft bezeichnen). Das
Gegenteil wäre eine Naturlandschaft oder Wildnis. Eine vom Menschen
gänzlich unbeeinflusste Gegend gibt es aber spätestens in Zeiten der
Klimakrise eigentlich nicht mehr.
Wie wir auf unseren Streifzügen durch drei Gebiete sehen, werden
vom Menschen heute wieder vorsätzlich Wildnisse geschaffen, um
Biodiversität zu fördern. Am Heuberg und am Schafberg werden wir
„ökologische Entwicklungsflächen“ im Sinne von Stadtwildnissen vor-
finden, am Oberlauf des Alsbachs sogar einen „Urwald von morgen“.
2Eine möglichst vom Menschen unbeeinflusste Naturlandschaft soll
dort dadurch entwickelt werden, dass der Mensch seinen Handlungs-
spielraum selbst beschränkt. All das veranschaulicht, dass Kultur und
Natur in einem ständigen Wechselverhältnis stehen, und das nicht
erst seit gestern.
Das UNESCO-Konzept des Biosphärenparks (auch: Biosphärenre-
servat) trägt dieser Erkenntnis Rechnung. Der Mensch wird hier
nicht als Fremdkörper, sondern als Bestandteil der „Biosphäre“ gese-
hen. Damit er seine natürliche Umwelt nicht überfordert, wird sein
Einfluss zwar beschränkt; allerdings nicht überall im selben Ausmaß.
Deshalb werden UNESCO-Biosphärenreservate in drei Zonen
unterteilt.
In der Kernzone dominiert klassischer Naturschutz. Auch die forstliche
Bewirtschaftung wird eingestellt, um den Vorrang der Natur durch-
zusetzen. Zugang bleibt allerdings gestattet. Von den 10 Biosphären-
park-Kernzonen in Wien (27 weitere gibt es in Niederösterreich) befin-
det sich nur eine in Hernals, nämlich die sehr kleine „Waldschafferin“.
Etwas jenseits der Bezirksgrenzen finden sich mit dem Dornbachgra-
ben (Klosterneuburg) und dem Moosgraben (Wien-Ottakring) deutlich
größere Kernzonengebiete.
In der Pflegezone wird Landschaftsschutz betrieben. Sie fungiert
quasi als Pufferzone zur „Wildnis“. Vielfach handelt es sich hierbei um
Offenland, also durch Rodung vom Menschen geschaffene Flächen,
die zumeist landwirtschaftlich genutzt werden oder wurden.
Auch Weinberge und Wiesen verfügen über eine hohe Artenvielfalt.
In Hernals finden sich Pflegezonen vor allem im Schwarzenbergpark
(Wiesenflächen), aber auch die Weingärten am Alsegg und am Heu-
berg sowie die Schafbergwiese zählen zu diesem Bereich.
3Die größte Zone im Biosphärenpark ist die Entwicklungszone. Sie ist
Lebens-,Wirtschafts- und Erholungsraum des Menschen. Zu ihr zählen
die großflächigen Waldbestände am Heuberg und Hameau genauso
wie die Friedhofsareale und Kleingartensiedlungen am Schafberg.
Dort reicht der Biosphärenpark bis zur Vorortelinie und endet somit
in nur 4 Kilometer Distanz zum Stephansplatz. Der Biosphärenpark-
anteil von Hernals darf sich also damit brüsten, dem Zentrum am
nächsten zu kommen.
Spätestens seit dem Biedermeier ist die dem Ballungsraum nächste
„Natur“ Sehnsuchts- und Rückzugsort für viele tausende Wienerinnen
und Wiener. Man entflieht dem engen Korsett der Stadt, kann sich
freier bewegen, durchatmen, das Rundherum beobachten. Kinder kön-
nen herumlaufen, ohne dass ihre Eltern hinter jedem geparkten Auto
ein sich bewegendes befürchten müssen. Die Veränderung, die wir im
Laufe der Jahreszeiten und unterschiedlicher Wetterlagen wahrnehmen
dürfen, erhöht die Erlebbarkeit dieser natürlichen Umwelt.
Weniger erfreulich sind die Einschränkungen unserer Erlebbarkeit
dieses Orts sowie seiner Funktionalität als Lebensraum für andere
Lebewesen. Die sind in den letzten Jahrzehnten angestiegen. Die Stadt
mit ihren massiven Wohnbauten schiebt sich immer weiter in den Wald
hinein. Bebauungslimits werden schamlos ausgenutzt, um möglichst
viel Wohnfläche zu ermöglichen und gleichzeitig Landschaft zu erobern.
Noch invasiver, weil auf so vielen Ebenen nachteilig, ist der Verkehr.
Er durchschneidet Lebensräume und belastet sie mit Lärm und Abga-
sen. Er schränkt auch die Erlebbarkeit und Nutzbarkeit durch andere
ein, die Abwechslung suchen. An einem Sonntag mag man im Schwar-
zenbergpark denken, man befinde sich nahe einem Formel-1-Ring.
Der Verkehr wird völlig ungehemmt in und durch den Wald geschleust.
Die Rahmenbedingungen sind für ihn günstig: Man gesteht ihm eine
4hohe Regelgeschwindigkeit zu und versorgt ihn mit Kreisverkehren,
damit er noch besser „fließt“, und mit Großparkplätzen, damit er sicher
sein kann, mit dem Auto am Ziel auch „ankommen“ zu dürfen. Somit
wird der zentrumsnahe Wienerwald zum Transitraum. „Echte Natur“
wird immer weiter hinausgeschoben und schließlich nur mehr mit
dem privaten Kraftfahrzeug erschließbar.
Diese Verdrängungslogik ist unfair, destruktiv und nicht nachhaltig.
Wir müssen den Individualverkehr im Biosphärenpark massiv verrin-
gern. Etwa indem wir den Wienerwald gleichzeitig besser zu Fuß, mit
dem Rad und mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar machen.
Durch attraktivere Gehverbindungen (Verkehrsberuhigung, angeneh-
me Gehsteigbreiten), sichere Radinfrastruktur (baulich oder zumindest
räumlich vom Restverkehr getrennte Radwege) und dichteren Busli-
nienverkehr, der von hochfrequentierten Verkehrsknotenpunkten aus-
gehend direkt verschiedene Ziele anfährt. Wir müssen auch wieder
Ausflugslokale ermöglichen, die breiteren Zielgruppen zugänglich
sind, nachhaltig und ökologisch wirtschaften, und auch dabei helfen,
den Müll im Wald zu reduzieren.
Fangen wir bei uns in Hernals damit an, zu überlegen, wie wir – in unse-
rem eigenen Hinterhof – das Verhältnis zwischen dem Menschen und
seiner natürlichen Umwelt sinnvoller, nachhaltiger gestalten können.
Es sind ja gar keine Milliardenbeträge vonnöten, um Lärm und Luftver-
schmutzung im Wald zu reduzieren. Es braucht „nur“ politischen Willen,
getragen von einer breiten Unterstützung durch die Bevölkerung.
Wenn auch dir diese Anliegen wichtig sind, dann entdecke mit uns
den Hernalser Biosphärenparkanteil neu, teile diese Handreichung
mit anderen, und hilf uns, sie zu verbessern. Unterstütze uns damit,
Bewusstsein für Probleme – und Potenziale – zu schaffen. Denn unsere
Umwelt braucht mehr Öffentlichkeit!
5Max Hartmuth 20
SCHWARZENBERGPARK, HAMEAU
UND KREUZBÜHEL
WALDWIESEN UND GEWÄSSER
1. Naturwaldreservat Waldschafferin: Die Waldschafferin ist eine der
37 Kernzonen des Biosphärenparks (siehe Seite 3). Hier an der Grenze
zu Penzing mäandriert der Alsbach (siehe Punkt 14) auf natürliche
Weise in einem totholzreichen Schwarz-Erlen-Auwald, der semi-
urwaldartigen Charakter hat und als einer der schönsten Erlenwälder
Wiens gilt. Bitte pflückt in diesem Gebiet keine Blumen, Pilze oder
Beeren, denn sie sind für andere Arten reserviert. Bleibt auf den mar-
kierten Wegen, macht keinen Lärm und habt Hunde an der Leine. Hier
sollen Lebensräume für seltene Pflanzen- oder Tierarten möglichst
ursprünglich erhalten werden und Rückzug ermöglicht. Totholz ver-
bleibt im Wald, bietet Unterschlupf und gibt die gespeicherten Nähr-
stoffe nach seiner Vermoderung wieder in den natürlichen Kreislauf
zurück. Hier soll der „Urwald von morgen“ gedeihen.
2. Naturdenkmal „Kraus-Besitz“ (Amundsenstr. 9): Seit 1976 ist
dieser besondere Gehölzbestand um eine alte Villa (1905) im Tirolerstil
geschützt. Im Anschluss finden sich zwei Teiche, von denen zumindest
der hintere öffentlich zugänglich ist. Erschlossen wird dieses Gebiet
am einfachsten über den Forstweg Waldschafferin.
3. Der Hanslteich ist ein im 19. Jahrhun-
dert künstlich angelegtes stehendes
Gewässer. Zwei weitere künstliche
Gewässer daneben sind fast schon ver-
landet, und auch der Hanslteich muss
immer wieder ausgebaggert werden.
Aus ihm wurden einst Eisblöcke her-
9ausgestochen, die in Kühlhäusern Verwendung fanden. Über eine natür-
liche Ufervegetation verfügt der Hanslteich nicht. Trotzdem ist er ein für
Amphibien wichtiger Lebensraum. Ausschau halten nach: Kröten und
Fröschen.
4. Kreuzbühelwiese: Schmetterlinge fühlen sich auf dieser sehr arten-
reichen, teilweise wechselfeuchten Glatthaferwiese am Jägerbach
besonders wohl. 2009/2014 wurde die Kreuzbühelwiese als Wiesen-
meister-Wiese in der Kategorie Mähwiese prämiert. Wir gratulieren
der Kreuzbühelwiese nachträglich. Der Gipfel des Kreuzbühels (dort
kleinere Stehgewässer) liegt auf 382 Höhenmetern. Ausschau halten
nach: Feldhasen.
5. Lange Wiese: Dieses eingezäunte Gebiet neben dem Forsthaus
der MA49 und unterhalb des Jägerbachs ist mit seinen Tümpeln, einer
Feuchtbrache und dem sogenannten „BOKU-Teich“ ein einzigartiger
Lebensraum. Er gilt gemeinhin als Amphibien-Hotspot. Die amphibi-
schen Bewohner können die angrenzende Exelbergstraße an 8 Stellen
queren.
6. Große Stockwiese und Beindrechslerwiese: Südlich der Exelberg-
siedlung gelegen, ist die Große Stockwiese eine sehr artenreiche Mäh-
wiese in Hanglage (wechselfeuchte Trespenwiese). Im Südosten geht
sie in die Beindrechslerwiese über, eine ältere Ackerbrache, die Feucht-
grünland aufweist. Die Besonderheit dieser artenreichen Magerwiese
ist der saure und nährstoffarme Boden im Ostteil, der Gewächse wie
Ginster, Klee und Vergissmeinnicht begünstigt.
7. Jägerwiese: Eine am Jägerbach gelegene wechselfeuchte Glatt-
haferwiese (v.a. oberer und mittlerer Hangbereich) mit zwei Einzel-
flächen mit Pfeifengras-Streuwiese (Nordost und Süd, in vernässter
Mulde, hervorragender Erhaltungszustand).
108. Jägerbach: Seine Quelle am Exelberg habend, durchfließt der Jäger-
bach die Jägerwiese auf sehr natürliche Art und verläuft auch danach
fast durchwegs oberirdisch, bevor er schließlich in den Eckbach mündet.
9. Waldbestand Hameau-Waldandacht-Dreimarkstein: Bei diesem
geschlossenen, großflächigen Bestand handelt es sich Großteils um Mull-
braunerde-Buchenwald (mesophiler Rotbuchenwald), den häufigsten
Waldtyp in Hernals. Anders als die Waldbestände Schwarzenbergpark
und Kreuzbühel ist der Waldbestand Hameau-Waldandacht-Dreimark-
stein nicht von Wiesengebieten durchbrochen. Ausschau halten nach:
Waldlaubsänger (Phylloscopus sibilatrix), ein Vogel, der geschlossene
Wälder ohne oder mit geringer Strauchschicht besiedelt und in diesem
großflächigen Waldgebiet fast flächendeckend verbreitet ist. Aber auch
Rehe, Wildschweine und Waldohreulen könnte man hier antreffen.
10. Aussichtswiese Hameau: Eine Rodungsinsel am Gipfel des Hame-
aubergs (464 Meter) im geschlossenen Waldbestand. Hier errichtete
im späten 18. Jahrhundert der Graf Lacy ein „Holländerdörfel“ mit 17
Hütten als Teil seines Landschaftsparks. Ein beliebtes Ausflugslokal
etablierte sich später, wurde aber 1956 Opfer eines Brands. Der Erhal-
tungszustand der artenarmen Hochgraswiese ist schlecht, wie auch
zum Teil der Zustand des jüngeren Baumbestands rundherum.
11. Schwarzenbergallee: Eine schnurgerade, asphaltierte Straße durch
den gleichnamigen Landschaftspark. Es schließen vor allem Glattha-
fer-Fettwiesen an. In heißen Sommern dank dem dichten Bewuchs
ein angenehm kühler Ort. Teil des Stadtwanderwegs Nr. 3.
12. Grünbergwiese im Schwarzenbergpark: Diese wechselfeuchte
Glatthaferwiese fungierte einst als Jagdwiese. Im Südteil findet sich
degradiertes Hangflachmoor. Der Wachtelkönig, der vorwiegend in
hochwüchsigen Wiesen brütet, wurde hier gesichtet.
1113. Tiefauwiese im Schwarzenbergpark: Diese blütenreiche wech-
selfeuchte Glatthaferwiese ist Teil des historischen Schwarzenberg-
parks. Bedingt durch unterschiedliche Wasser- und Nährstoffver-
sorgung ist sie teils Fett- und teils Magerwiese. Sie ist eine wichtige
Erholungsfläche und vor allem bei Hundebesitzer*innen beliebt.
Der westlichste Teil ist eine Fuchsschwanz-Frischwiese und (theo-
retisch) hundefrei. Südwestlich findet sich das denkmalgeschützte
Forsthaus, im nördlichen anschließenden Waldstück eine kleine
Kleingartensiedlung (KLG Ried-Tiefau). Auf der anderen Seite des
Kräuterbachs, der durch ein Waldstück (Tiefaumais, hier bedeutet
„Mais“ Jungholz) verläuft, finden sich zwei weniger artenreiche
Glatthafer-Fettwiesen namens Krautäcker (nomen est omen) und
Viehweidacker. An den Böschungen der Waldandacht wurden 2007
Maßnahmen zur „Erhaltung der offenen Lebensräume an den
Böschungen der Höhenstraße für Wiener Schnirkelschnecke und
Schlingnatter“ durchgeführt.
14. Der Alsbach ist mit 10,5 km der nach dem Wienfluss längste
Wienerwaldbach. Er nimmt seinen Ursprung nahe der Moschinger
Wiese an der Einsattlung zwischen der Steinernen Lahn und dem
Schottenwald. In Folge nimmt er die Niederschlagsgewässer von den
Hängen der umliegenden Berge auf: links vom Daha- und Exelberg,
rechts von Heuberg und Schottenwald. Bei der Marswiese mündet
der Eckbach ein (siehe Punkt 15), bevor das Gewässer unter der Erde
verschwindet.
15. Der Eckbach (seltener „Parkbach“) ist ein naturnaher Zubringer
des Alsbachs. Seine drei Quellen liegen bereits jenseits der Stadt-
grenze. An der Schwarzenbergallee, wo er auch einige Teiche speist,
nimmt er zudem den Jägerbach auf. 2013 wurde er in einem Projekt
der MA45 (Gewässerabteilung) und der BOKU auf 200 Metern rena-
turiert. Wo er früher in einer schmalen Betonrinne verlief, wurde er
12(sichtbar auf Höhe der 43A-Haltestelle „Neuwaldegg Linienamt“) vor
dem Einlaufbauwerk verbreitert und mit Uferzonen naturnah umge-
staltet. Durch eine Abflachung wurde der Zugang zum Gewässer
ermöglicht. Im Eckbach (wie auch im Alsbach) finden sich Vorkommen
des stark gefährdeten Steinkrebses. Das weist auf die hohe Qualität
der beiden Bäche hin, denn der Steinkrebs braucht naturbelassene
Gewässer, um seine Höhlen zu graben. 1992 wurden am Eckbach Stein-
krebse von der MA22 ausgesetzt. Auch Feuersalamander gibt es in
den Bächen um den Schwarzenbergpark.
16. Kalkklippe am Eckbach: Eine geologische Besonderheit etwas
unterhalb der Manameierei, weil der nördliche Wienerwald ja eigentlich
aus Flysch besteht. Bedingt durch das härtere Gestein finden sich
Gefällestufen und ein Miniatur-Wasserfall. Selten, und deswegen seit
2003 Naturdenkmal.
17. Der Kräuterbach (17a) plätschert vom Dreimarkstein herab über
den Tiefaumais (siehe Punkt 13). Er nimmt an der Höhenstraße den
Quellengraben (17b) und schließlich den von Pötzleinsdorf herunter-
kommenden Geroldbach (17c) auf, bevor er bei der Kreuzung Neu-
waldegger Straße-Artariastraße unterirdisch in den Alsbach mündet.
Hinter der Residenz des chinesischen Botschafters in der Geroldgasse
(Nr. 7) wird der Kräuterbach überbrückt, bevor er Privatgrund durchläuft.
Bergauf mäandriert der Waldbach zwischen Höhenstraße und Michae-
lerwald, parallel zum Stadtwanderweg 3. Ein bisschen mehr vom Gerold-
bach sieht man bei der Geroldgasse 2A sowie gegenüber Nr. 5.
18. Das Hochwasser-Rückhaltebecken vor der Marswiese ist ein ehe-
maliges Becken zum Durchspülen der Kanalisation, das für Hochwas-
serereignisse umfunktioniert wurde (2018). Hier fließen Alsbach und
Eckbach zusammen und verschwinden dann bis zum Donaukanal unter
dem Asphalt. Ein Wildholzrechen hält angeschwemmtes Totholz zurück.
1320
SCHAFBERG, ALSRÜCKEN UND ALSZEILE
FLEDERMÄUSE UND WEIN
19. Weingarten Alszeile (Riede Alsegg) am „Kleinen Schafberg“:
Hier findet sich der kleine, aber beschauliche Rest eines früher bedeu-
tenden Wirtschaftszweigs an den östlichen Rändern des Wienerwalds
(„Weinbaugürtel“). Auf 8 Hektar werden von der Gutsverwaltung des
Stift St. Peter, das hier seit 1042 Land besitzt, die Sorten Grüner Velt-
liner, Rheinriesling, Weißburgunder und Müller-Thurgau angebaut.
Auf der anderen Straßenseite werden sie im ehemaligen Gutshof in
einer beliebten Buschenschank verabreicht. Wein, Traubensaft und
Liköre sowie „Klosterprodukte“ wie Weihrauch, Kerzen und Honig
werden ab Hof zu festgesetzten Zeiten verkauft (s. www.stiftstpeter.at).
Diese alte Kulturlandschaft ist als „SwwL“ (Schutzgebiet des Wald-
und Wiesengürtels mit landwirtschaftlicher Nutzung) gewidmet. Die
Erhaltung der Weinbaureste, die hier als ortbildprägend gelten dürfen,
wurde als vorrangiges Ziel des Gebietsbereichs Wienerwaldrandzone
definiert.
20. Ökologische Erholungsfläche Stefan-Zweig-Platz/Korngasse:
Ökologische Entwicklungsflächen gibt es seit 1998 als Schutzkategorie
im Wiener Naturschutzgesetz. Ausgegangen wird weniger vom aktu-
ellen naturschutzfachlichen Wert, denn vom Entwicklungspotenzial.
Dieser südexponierten Böschung in Dreiecksform (5687 m2 Wiesen-
brache und Gebüsch) kommt im „Grünzug Alstal“ Bedeutung als Tritt-
steinbiotop zu. Als Ziel für den Ostteil wurde gesetzt, die „Lebens-
bedingungen für trockenheitsliebende und wärmeabhängige Lebens-
gemeinschaften“ zu schaffen oder verbessern. Im Fokus sind dabei
Zauneidechse, Schlingnatter und Wiener Schnirkelschnecke. Blind-
schleiche und Ringelnatter wurden bereits vorher festgestellt. Hier
soll der trockenheiße Biotopcharakter erhalten werden (Entwicklungs-
15ziel Trockenwiese). Verbuschung und Gehölzpflanzung wird nicht
zugelassen; es wird nur alle 1-2 Jahre gemäht. Für den Westteil wurde
als Entwicklungsziel „Stadtwildnis“ definiert. Eine Zuwucherung mit
Waldreben (Clematis), durchsetzt durch einzelne Bäume, wird gedul-
det. Die Fläche wird im Grunde genommen sich selbst überlassen.
Nur die Ränder werden zugunsten der „Verkehrssicherheit“ gepflegt.
21. „Rebenwegwäldchen“: Hinter der Wohnhausanlage „Rebenweg“
befindet sich eine Exklave des Wiener Wald-und Wiesengürtels. Nur
wenige Meter von den Ausläufern der dichtbebauten Stadt und einer
geschäftigen Kreuzung mit Anschluss an gleich drei Straßenbahnlinien
konnte sich also ein Waldstückchen gegen die Bebauung behaupten
und wurde dafür von der Gemeinde mit der Widmung „Sww“ abge-
sichert. Ein öffentlicher Zugang über den Rebenweg sowie ein Fußweg,
der den höher gelegenen Teil des Gebiets mit Braumüllergasse sowie
Czartoriskygasse verbindet, sind laut Flächenwidmungsplan geplant,
aber (Stand 2020) noch nicht umgesetzt.
22. Josef-Kaderka-Park: Dieser nette
Landschaftspark wurde erst 1999
eröffnet. Der nördliche Ast der hier
zweigeteilten Alszeile zeichnet den
Bachverlauf der Als vor ihrer Einwöl-
bung nach. Im Westteil befindet sich
ein schattiger Kleinkinderspielplatz, im Mittelteil ein beliebter natur-
naher Radparcours und ein Sportplatz, westlich davon seit 2011 ein
(ebenfalls äußerst beliebter) Gemeinschaftsgarten.
23. Naturdenkmal Feldahorn bei Josef-Kaderka-Park: Der beein-
druckend mehrstämmige Baum mit einem Kronendurchmesser von
über 15 m und einem Stammumfang von 675 cm, aber unbekannten
Alters, ist das jüngste Naturdenkmal im Bezirk (2020).
1624. Schafbergwiese: Am trockeneren und wärmeren Schafberg gibt
es diese besonders artenreiche Magerwiese vom Typ der trockenen
Glatthaferwiese mit einigen Magerzeigern. Erwähnt wurde sie bereits
1366 als Schafweide. Heute ist diese durch Sträucher und Bäume
reich strukturierte Wiese durch Verbuschung/Verbrachung bedroht.
Sie erfordert laufende Pfle-
ge für die optimale Ent-
wicklung von Fauna und
Flora. Seit der Erstpflege
durch MA22/49 (Entfer-
nung von Gehölzen und
Belassen von einzelnen
Großsträuchern und Bäu-
men) 2013 gibt es jährlich
einen Pflegetermin mit
Freiwilligen, organisiert von Biosphärenpark sowie den erwähnten
Magistratsabteilungen. Gebüschränder und Gehölze werden zurück-
geschnitten und Trockenhaufen angelegt, um Reptilien und Amphi-
bien als Versteck zu dienen. Ausschau halten nach: den auffällig
blauvioletten Blüten der Schopfigen Traubenhyazinthe (Muscari
comosum). Von diesem Spargelgewächs findet sich hier einer der
reichsten Bestände in Wien.
25. Lagerwiese am Schafberg (tw. „Kreuzwiese“): Auf dieser süd-
exponierten Hangwiese vom Typ einer trockenen Glatthaferwiese
finden sich Aufrechttreppe, Wiesenwitwenblume und Wiesensalbei.
Allerdings sind durch den Nutzungsdruck bereits Übergänge zur
Trittrasenvegetation bemerkbar. Die Nutzung als Hundeauslaufwiese
stellt durch den zurückgelassenen Kot ein größeres Problem dar. Da
dieser zu Erkrankungen bei Kühen, Pferden und Schafen führen kann,
ist durch ihn verschmutztes Heu unverkäuflich. Achtung, hier betritt
man bereits Währinger Territorium!
1726. Luftgütemessstelle Schafberg (Josef-Redl-Gasse 2, bei Kreis-
verkehr): Hier werden auf 319 m Seehöhe Schwefeldioxid, Feinstaub
und Stickstoffoxide sowie Windgeschwindigkeit und Windrichtung
gemessen. Eine (grobe) Bewertung der Messstellenwerte nach dem
Wiener Luftgüteindex findet sich auf https://www.wien.gv.at/ma22-
lgb/ luftsl.htm. Etwas mehr Details gibt’s auf https://www.wien.gv.at/
umwelt/luft/messwerte/berichte.html.
27. Weingarten Werfelstraße: Hier hat sich ein kleiner Weingarten
beiderseits der Werfelstraße, die ihn auf Höhe Nr. 11 durchschneidet,
erhalten. Bis zur Schafbergkirche zieht sich eine magere Flachland-
mähwiese (Lebensraum!) den Abhang hinauf.
28. Missionsschwestern-Areal: Um hier der Schlingnatter unter die
(nicht vorhandenen) Arme zu greifen, wurden 2002 im Rahmen des
Wiener Arten- und Lebensraumschutzprogramms Arten- und Bio-
topschutzmaßnahmen im Klosterareal durchgeführt. Trockenböschun-
gen und fugenoffene Trockenmauern wurden erhalten, Lesesteinhau-
fen und Holzhaufen neuangelegt.
29. Waldbestand am Schafberg: Auf den basenreichen Böden des
Schafbergs, der aus kalkreichen Sandsteinen besteht, wachsen am
warm-trockenen Südhang (besonders westlich der Schafbergwiese)
Flaum-Eichen-Hochwälder, wie sie eher für den Mittelmeerraum
typisch sind. In Mitteleuropa findet man Flaumeichen nur in besonders
wärmebegünstigten Lagen, meist auf basischen Böden und auf Kalk-
gestein. Deshalb fühlt sie sich am Südhang des Schafbergs wohl so
wohl. Sonst finden sich am Schafberg vor allem Eichen und Buchen
sowie Nadelhölzer; am Nordhang dominiert Rotbuchenwald.
30. Der Friedhof Hernals ist ein wichtiger Lebensraum für Fleder-
mäuse. Der an alten Bäumen reiche Friedhof beschert ihnen eine
18Vielfalt an Insekten. Baumhöhlen und Rindenspalten dienen ihnen als
Schlafplätze und Quartiere. Für den Fall eines Mangels an natürlichen
Höhlen wurden als Teil des Wiener Arten- und Lebensraumschutz-
programms an Bäumen an der Alszeile (um den Grünbeckweg)
Fledermauskästen als Ersatzquartiere angebracht. Sie sind flach, aus
Holz, und werden von unten angeflogen. 2001/2 wurden am Hernalser
und am benachbarten Dornbacher Friedhof im Rahmen des Wiener
Arten- und Lebensraumschutzprogramms auch Projekte zur Zonierung
von Wiesenflächen, die nur mehr einmal gemäht werden, sowie zur
Extensivierung von Grünflächen, Schaffung von zusätzlichen Biotop-
strukturen, insbesondere für Reptilien durchgeführt. Zudem wurden
Kleingartenbesitzer*innen über Möglichkeiten naturnaher Gestaltung
von Kleingärten informiert.
31. Der Mistplatz Hernals ist mehr als
nur eine Abfallentsorgungsstätte. Am
jährlichen Mistfest werden zehntausen-
de Wiener*innen unterhalten und über
Umweltschutz informiert. Altspeiseöle
und -fette können in (kostenlosen)
WÖLI-Behältern abgegeben werden.
Daraus wird Kohlenstoffdioxid-neutraler Biodiesel produziert. Durch
die mehr als 320.000 Kilogramm in Wien abgegebenen Speiseöle
werden über 880 Tonnen Kohlenstoffdioxid eingespart. Wollte man
dieselbe Menge Diesel aus Rapsöl erzeugen, bräuchte es eine Anbau-
fläche von der Größe von Hernals! Zwischen Februar und Oktober
wird hier um 3 bzw. 5 € auch torffreie Erde in 18- und 40-Liter-Säcken
abgegeben. Die Erde „Guter Grund“ der MA48 wird mit Kompost aus
Wiens 100.000 Biotonnen hergestellt und kann für Topf- und Garten-
pflanzen verwendet werden. Sie entspricht sogar den strengen Vor-
gaben des Österreichischen Umweltzeichens. Kompost aus biogenen
Abfällen wird sogar kostenlos abgegeben.
1920
HEUBERG UND ANDERBACHTAL
WILDNISSE UND EXOTEN
32. Ökologische Erholungsfläche Franz-Glaser-Höhe: Dieser eigent-
lich namenlose Ort setzt sich aus einem steilen Hangwald und einer
ebenen Parkfläche mit Bäumen zusammen. Im Waldbereich wird
durch das Belassen von stehendem und liegendem Totholz ein
Bestand entwickelt, von dem neben Totholzbewohnern insbesondere
Vögel wie der Mittelspecht, die ihre Nester in Höhlungen bauen, pro-
fitieren sollen. Die Anrainer*innen haben meist selbst Gärten und
nutzen die Parkfläche lediglich für den Ausgang mit dem Hund (Rand-
bereich, dort öfter gemäht) und für den Abstieg. Für Verkehrssicher-
heit entlang dieser Flächen ist gesorgt. Die Kombination von Wald
und Wiese simuliert eine Wienerwaldlandschaft, wodurch die Franz-
Glaser-Höhe als Trittsteinbiotop gedacht wird. Die selten gemähte
Wiese soll vor allem Zauneidechsen gefallen. Empfohlene Route:
Aufstieg bei Hst. „Wallishausergasse“ des 44A, danach an Villen, die
stark an ringstraßenzeitliche Bauten auf Rax und Semmering erinnern,
vorbei an der verkehrsarmen Franz-Glaser-Gasse hinab zur 44A-
Haltestelle „Braungasse“.
33. Naturdenkmal Blutbuche Heuberggasse 10 bzw. Trimmelgas-
se: Unterhalb des sog. Terramare-Schlössels beeindruckt diese
rund 200 Jahre alte, aber überaus vitale Blutbuche/Purpurbuche,
eine seltene Spielart der Rotbuche, mit ihrer mächtigen Freistands-
krone und einem Stammumfang von 400 cm. Auf Privatgrund
befindlich, sticht sie höhenmäßig und farblich (purpur!) hervor.
Angeblich gehen alle heute existierenden Blutbuchen auf eine
mutierte Rotbuche im ostdeutschen Possenwald zurück. Von dort
ausgehend eroberte sie als beliebter Parkbaum die Welt. Geschützt
seit 2019.
2134. 7 geschützte Mammutbäume am Heuberg: In Heuberggasse und
Pointengasse finden sich gleich mehrere als Naturdenkmäler aner-
kannte Exemplare dieser in Wien seltenen Zypressengewächse. Die
zwei Mammutbäume im Ernest-Bevin-Hof zeichnen sich durch Größe
und Form aus. Geschützt sind sie bereits seit 1956, als diese skandi-
navisch anmutende Wohnhausanlage, für welche die Gemeinde zuvor
über 20 Grundstücke zusammengekauft hatte, in die Landschaft gebaut
wurde. Öffentlich zugänglich. Etwas weiter oben, in der Heuberggasse
11/11A, befinden sich auf Privatbesitz hinter einer Villa mit Türmchen
vier seltene, mehr als 100 Jahre alte Riesenmammutbäume, und auf
Nr. 13 ein weiterer Mammutbaum. Mammutbäume sind in Kalifornien
weitverbreitet. In unseren Breiten erfuhren sie ab der Mitte des 19.
Jahrhunderts Beliebtheit in Parks und Landschaftsgärten, wenngleich
sie in Wien selten blieben. Der Heuberg ist folglich gewissermaßen ein
Mammutbaum-Hotspot! Ein verwandtes Zypressengewächs in der
Nähe ist die ebenfalls als Naturdenkmal ernannte Kalifornische Fluß-
zeder in der Pointengasse 4-6 (2004) sowie in der Dornbacher Straße
29 (gegenüber Krankenhaus), die bereits seit 1950 unter Schutz steht.
Ein achter geschützter Mammutbaum in Hernals findet sich fern des
Heubergs bei der Rohrerbadwiese an der Exelbergstraße.
35. Feuchtbiotop Plachygasse (gegenüber Nr. 80-95, unweit 44A-
Endstelle „Mitterberg“). Dieses Naturdenkmal in der sogenannten
Waldhüttensiedlung ist seit 1992 geschützt und nicht öffentlich zugäng-
lich. Es stellt einen Übergangsbereich von trockenem zu dauerhaft
feuchtem Ökosystem dar. Ausschau hal-
ten nach: Glühwürmchen.
36. Streuobstwiese am Heuberg: Südlich
des Neuwaldegger Bads (Waldhütten-
weg) findet sich diese stark verwachsene
und verbuschte Hochstamm-Obstwiese.
22Jüngere Obstbäume wurden nachgesetzt. Streuobstwiesen verfügen
über eine hohe Biodiversität. Von Insekten bekrabbelt, genießt man
einen tollen Ausblick. Stadtseitig schließt noch ein Waldstück an.
37. Riede Heuberg: Ein kleinerer
Weingarten mit Buschenschank, die
von der Familie Stippert (www.stip-
pert.at) betrieben wird.
38. Der wasserreiche Anderbach
kommt vom Gallitzinberg herab und
vereinigt sich mit dem vom Heuberg
herabkommenden Dornbach (markiert ungefähr Bezirksgrenze mit
Ottakring) am Ende der Andergasse (44er-Haltestelle „Eselstiege“,
hier auch Anschluss an Stadt-
wanderweg 4a zur Kreuzeichen-
wiese). Dann verschwindet er
unter der Andergasse und ver-
einigt sich nach der Aufnahme
des Pointenbachs (oberirdisch
auf der Pointengasse zwischen
Veletaweg und Rudolf-Bären-
hart-Gasse) in der Als.
39. Geschlossener Waldbestand Heuberg: Wie das Hameau ist der
Heuberg großteils mit Mullbraunerde-Buchenwald bedeckt. Am Ost-
abhang des Heuberges wachsen die streng geschützten Arten Breit-
blatt-Ständelwurz (Epipactis helleborine) und Vogel-Nestwurz
(Neottia nidus-avis). Der Erhaltungszustand gilt hier wegen der natür-
lichen Baumartenzusammensetzung, dem hohen Totholzanteil und
der typischen Waldstruktur als ausgezeichnet (A). Wegen hoher Wild-
stände (Verbiss- und Schälschäden) ist der Erhaltungszustand am
23Westabhang des Heuberges schlechter. Im Wald am Heuberg jagt
übrigens die Mückenfledermaus gerne, und auch der Waldlaubsänger
(siehe Punkt 9) fühlt sich hier wohl.
40. Dem Vogelschutzgebiet des Wiener Tierschutzvereins am
Heuberg wird nachgesagt, es würden sich hier ohnehin dieselben
Vögel wie anderswo finden. Dessen ungeachtet wurde im Rahmen
des Tages der Artenvielfalt 2014 eine eindrucksvolle Liste von gesich-
teten Vögeln erstellt: Stockente, Mauersegler, Mäusebussard, Stieglitz,
Grünfink, Erlenzeisig, Hohltaube, Ringeltaube, Nebelkrähe, Rabenkrähe,
Aaskrähe, Kuckuck, Buntspecht, Schwarzspecht, Rotkelchen, Turmfalke,
Buchfink, Pirol, Blaumeise, Kohlmeise, Hausrotschwanz, Zilpzalp, Grau-
specht, Grünspecht, Sumpfmeise, Kleiber, Star, Mönchsgrasmücke,
Zaunkönig, Amsel und Singdrossel.
41. Der Luchtengraben ist der Name eines Gebiets und eines Gewäs-
sers (mit Zubringer Gausgraben). Er bzw. es befindet sich im Vogel-
schutzgebiet des Wiener Tierschutzvereins (siehe Punkt 40) an den
östlichen Abhängen des Heubergs. Zunächst finden sich unbeeinflusste
Waldbachgräben in Tobeln; ab dem Neuwaldegger Bad ist er einge-
wölbt und mündet schließlich in den Alsbach. Ausschau halten nach:
Schlingnatter. Eine Vorkommenssicherung und Habitatausweitung
wurde 2002 als Teil des Wiener Arten- und Lebensraumschutzpro-
gramms betrieben. Achtung: Wer unweit der 44er-Endstation
„Mitterberg“ zutritt, kommt am unteren Ende des Luchtengrabens
bei der Waldegghofgasse nicht mehr hinaus.
24Quellen und weiterführende Literatur:
Wien Umweltgut - Themenstadtplan. Wien 2020. [https://www.wien.gv.at/umwelt-
schutz/umweltgut]
Biosphärenpark Wienerwald Management GmbH (Hg.), Vielfältige Natur in Hernals.
Wien 2019. [https://www.bpww.at/sites/default/files/download_files/
Wiener_Gemeindebezirksbericht_Hernals.pdf]
Biosphärenpark Wienerwald Management GmbH (Hg.), Natur in Hernals: Ergebnisse
zum Tag der Artenvielfalt 2014. Wien 2015.
[https://www.bpww.at/sites/default/files/download_files/TdA14-Hernals-
Homepage_SMALL.pdf]
MA22 (Hg.), Ottakring/Hernals I: Naturschutz_Ziele/Leitlinien 10. Wien 2007.
[https://www.wien.gv.at/umweltschutz/naturschutz/pdf/ottakring-band.pdf]
D. Becker, Ökologische Entwicklungsflächen: Grundlagen zur Umsetzung. Wien 1999.
[https://www.zobodat.at/pdf/MA22-Wien_33_0001-0056.pdf]
H. Kutzenberger et alii, Netzwerk Natur Hernals: Studien der Wiener Umweltschutzab-
teilung (MA 22). Wien 1999.
[https://www.zobodat.at/publikation_volumes.php?id=32647]
H. Kutzenberger, Vorarbeiten zu einem regionalen Arten- und Lebensraumschutzpro-
gramm Hernals. Wilhering/Wien 1997. [https://www.wien.gv.at/kontakte/ma22/studi-
en/pdf/hernals-97.pdf]
Herausgegeben von der Grünen Alternative Hernals anlässlich des von ihr initiierten
Beitritts des Bezirks zum Klimabündnis Österreich.
Impressum: Klub der Grünen Alternative Hernals, Hernalser Hauptstr. 49, 1170 Wien.
https://hernals.gruene.at. Klubobfrau: Karin Prauhart (karin.prauhart@gruene.at,
0699 111 17465). Inhalt: Max Hartmuth, Layout: Paul Felder. 2020. 1. Auflage.
Feedback gerne an hernals@gruene.at.
25RÜDIGER MARESCH
Grüner Sprecher für Umwelt, Klima-
schutz, Tierschutz, Verkehr, Landwirt-
schaft, Essen/Ernährung, Wiener Linien,
und Märkte
Wien ist eine der grünsten Städte Europas. In Hernals ist dieser
Grünraum jedoch ungleich verteilt. Der Zentralraum des Bezirks ist
an heißen Tagen eine einzige Hitzeinsel und um einige Grad heißer
als der Wienerwald im Westen. Der Klimawandel, der ja nur mehr
von wenigen geleugnet wird, führt uns vor Augen, wie wichtig
gerade Bäume im Straßenraum und in der Stadt überhaupt sind.
Das ist kein Luxus, sondern muss ein Teil der Daseinsvorsorge sein,
wie der öffentliche Verkehr oder Schulen und Spitäler.
Seit vielen Menschen klargeworden ist, dass Klimaschutz und Kli-
maanpassungsmaßnahmen immer wichtiger werden, stellt sich sehr
oft die Frage, ob es mit dem Autoverkehr so weitergehen kann, wie
bisher. So zu tun, als ob der Parkplatz für das Auto unabdingbar
oder gar Menschenrecht ist, führt uns nirgendwo hin.
Der öffentliche Raum darf keine Hitzeinsel sein; wir müssen die
Lebensqualität in der Stadt, im Bezirk in unseren Straßen, Gassen
und Plätzen verbessern. Mehr Bäume, mehr Bänke und mehr Brun-
nen sind dafür notwendig. Dafür brauchen wir Investitionen und
mehr Mut, um Parkplätze in Grünräume zu verwandeln.
Rot-Grün hat da bisher schon einiges weitergebracht, wie ja die
Mariahilfer Straße und einige Begegnungszonen wie die Rotenturm-
26straße zeigen. Auch in Hernals brauchen wir diese Verkehrsberuhi-
gung. Das ist uns aber nicht genug, wenn wir auch in Hernals das
Klima retten wollen. Dafür braucht es weniger Autoverkehr, um die
CO2 Ziele zu erreichen, die sich die Stadt in der Smart-City-Wien
Rahmenstrategie gegeben hat, und mehr Bäume und begrünte
Häuser.
Um die Stadt und auch Hernals zu verändern und den Klimawandel
zu bekämpfen, braucht es die Grünen. Es braucht ihre Ideen, ihren
Mut und ihre Ausdauer.
PÜSCHE WERBUNG
27KARIN PRAUHART
Klubobfrau der Grünen Hernals
Meine Spazierwege durch Hernals haben mich schon immer
hinaus in den Wienerwald geführt, über den Schafberg zum
Hameau, zur Rohrerhütte und zurück durch die Schwarzenberg-
allee nach Neuwaldegg und Dornbach. Der Umweltführer
Hernals wird in Zukunft mein Begleiter sein. Er beschreibt im
Detail, auf welche Wiesen, Wälder und landschaftliche Beson-
derheiten wir auf den vielen Wegen treffen, die den Biosphären-
park erschließen.
„Wir lieben, was wir kennen“ und „wir schützen, was wir lieben“.
In diesem Sinne freue ich mich darauf, das grüne Hernals neu
kennenzulernen. Ich wünsche allen Leser*innen viel Freude beim
Wandern, beim Entdecken und Lesen.
DIE GRÜNEN: Themenführer*innen
im Bereich Umwelt seit 1986
Gratis-Exemplare
dieser Publikation
äft
liegen im Wollgesch
FILO (Hernalser
Hauptstr. 50) auf.
Überblickskarten auf den Seiten 6 und 7.Sie können auch lesen