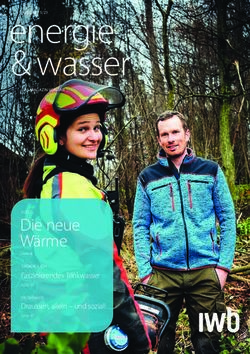Wärmepumpen-Position: "Hohe Gesamteffizienz plus Betrieb mit naturemade star"
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Wärmepumpen-Position: «Hohe Gesamteffizienz plus Betrieb mit naturemade star» Auslegeordnung Autoren Barbara Josephy und Eric Bush Schweizerische Agentur für Energieffizienz S.A.F.E. Schaffhauserstrasse 34 8006 Zürich www.energieeffizienz.ch Begleitung Patrick Hofstetter, WWF Schweiz Elmar Grosse Ruse, WWF Schweiz Marco Pfister, Greenpeace Schweiz Felix Nipkow, Schweizerische Energie-Stiftung SES Jürg Nipkow, Schweizerische Agentur für Energieeffizienz S.A.F.E. Conrad U. Brunner, Schweizerische Agentur für Energieeffizienz S.A.F.E. Finanzierung WWF Schweiz Greenpeace Schweiz Schweizerische Energie-Stiftung SES Zürich, 15. Juli 2014, aktualisiert 28. Oktober 2014 1/39
Inhalt
1 Zusammenfassung .......................................................................................................... 4
2 Grundlagen....................................................................................................................... 6
2.1 Hohe Gesamteffizienz ............................................................................................... 6
2.2 Betrieb der Wärmepumpe mit naturemade star ..................................................... 7
2.3 Ziel: Energiebilanz Wärmepumpe 0 kWh/a ............................................................. 7
2.4 Wärmepumpen-Position: «Hohe Gesamteffizienz plus Betrieb mit naturemade
star» ........................................................................................................................... 7
3 Diskussion Wärmepumpen-Position ........................................................................... 10
4 Vorschläge für das weitere Vorgehen.......................................................................... 11
4.1 Commitment der Umweltorganisationen .............................................................. 11
4.2 Koordination mit den Hauptpartnern .................................................................... 11
4.3 Einbezug weiterer Partner ...................................................................................... 12
4.4 Verschärfung der Anforderungen an Wärmepumpen-Förderprogramme
gemäss Wärmepumpen-Position .......................................................................... 12
4.5 Kommunikation ....................................................................................................... 13
4.6 Untersuchungen Kombination Solaranlagen / Wärmepumpen .......................... 13
4.7 Verbesserung gesetzliche Vorschriften und Standards ..................................... 13
Anhang 1: Wärmebedarf Heizung und Warmwasser ........................................................ 14
1. Definitionen................................................................................................................ 14
2. Erläuterungen ............................................................................................................ 14
Anhang 2: Wärmebedarf MINERGIE-Bauten ..................................................................... 15
Anhang 3: Einflussfaktoren Jahresarbeitszahlen Wärmepumpen .................................. 16
Anhang 4: Abschätzung von Jahresarbeitszahlen nach WPesti..................................... 19
Anhang 5: Berechnung jährlicher elektrischer Energieverbrauch von Wärmepumpen
(kWh/m2 a)............................................................................................................................. 20
Anhang 6: Ziel: Energiebilanz 0 kWh/a .............................................................................. 21
Anhang 7: Komponenten der Wärmepumpen-Position ................................................... 22
1. Hoher Gebäudestandard .......................................................................................... 22
2. Solaranlagen (Solarthermie / Photovoltaik)............................................................ 24
3. Einsatz von Bestgeräten........................................................................................... 25
4. FWS-Systemmodul.................................................................................................... 26
5. Betrieb mit naturemade star-Strom ......................................................................... 27
Anhang 8: Anzahl MINERGIE-Gebäude (Total und 2013) ................................................. 28
Anhang 9: Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich MuKEn ........................ 29
1. Was sind die MuKEn? ............................................................................................... 29
2. Erste Bereinigung der MuKEn 2014 ........................................................................ 29
3. Auszug Eckwerte MuKEn 2014 nach erster Bereinigung (nur Basismodul) ....... 30
Anhang 10: MINERGIE-A-Standard .................................................................................... 31
Anhang 11: Hauptpartner und Gesprächsthemen ............................................................ 33
1. Überblick über die Bereiche, in welchen die Hauptpartner die Wärmepumpen-
Position unterstützen könnten .............................................................................. 33
2. Verein MINERGIE....................................................................................................... 33
3. Schweizerischer Fachverband für Sonnenenergie Swissolar .............................. 34
4. Holzenergie Schweiz ................................................................................................. 34
2/39
5. Topten ........................................................................................................................ 34
6. Fachvereinigung Wärmepumpen Schweiz FWS .................................................... 35
7. Verein für umweltgerechte Energie VUE................................................................. 36
Anhang 12: Weitere Partner und Gesprächsthemen ........................................................ 37
1. Bundesamt für Energie BFE / EnergieSchweiz ...................................................... 37
2. Konferenz Kantonaler Energiedirektoren EnDK / Energiefachstellenkonferenz
EnFK......................................................................................................................... 38
3. Verband schweizerischer Elektrizitätsunternehmen VSE ..................................... 39
4. Schweizer Ingenieur- und Architektenverein SIA .................................................. 39
3/39
1 Zusammenfassung
Sowohl in der Schweiz als auch in Europa steigt der Einsatz von elektrischen Wärmepumpen
als Heiz- und Warmwassersystem kontinuierlich an. In der EU-13 wurden 2012 rund 250’000
Wärmepumpen verkauft (EHPA, Outlook 2012). In der Schweiz sind die jährlichen Verkäufe
bis 2010 angestiegen und stagnieren seither bei rund 20’000 Stück pro Jahr.
Im Jahr 2012 waren in der Schweiz rund 210'000 Elektro-Wärmepumpen in Betrieb. Ihr
Elektrizitätsverbrauch betrug rund 1’550 GWh/a und es wurden rund 4’930 GWh/a Wärme
produziert. Im Jahre 2020 werden voraussichtlich ca. 400’000 Wärmepumpen im Betrieb
stehen, die etwa 4% des elektrischen Energieverbrauchs umsetzen (ecopolitics:
Interpellation bzw. Stellungnahme des Bundesrats dazu).
In einem ersten Schritt hat die Schweizerische Agentur für Energieeffizienz S.A.F.E. die
technischen und fachlichen Grundlagen zu Wärmepumpen aufgearbeitet und ein
Diskussionspapier erarbeitet zu Grundlagen, Optimierungsbedarf, Organisationen,
Instrumenten und Diskussionspunkten. Es wurde WWF, Greenpeace und der
Schweizerischen Energie-Stiftung SES abgeben und Anfang April 2014 mündlich erläutert
und zusammen diskutiert. Zudem hat S.A.F.E. im Dezember 2013 anlässlich des Entwurfs
der revidierten Energieverordnung EnV eine Stellungnahme insbesondere zu den
Wärmepumpen an das Eidgenössische Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und
Kommunikation UVEK eingereicht.
An der Sitzung von Anfang April 2014 wurde beschlossen, eine Wärmepumpen-Position
«Hohe Gesamteffizienz plus Betrieb mit naturemade star» zu entwickeln. Zusammengefasst
bedeutet dies:
• Der elektrische Energieverbrauch der Wärmepumpe ist durch eine hohe Gesamteffizienz
zu minimieren. Die Wege zur Erreichung einer hohen Gesamteffizienz können ganz
verschieden sein, die PlanerInnen haben dabei Freiräume. Alle bestehenden Potentiale
sollen jedoch – abgestimmt auf das jeweilige konkrete Bauvorhaben – immer best
möglichst kombiniert und ausgeschöpft werden.
• Die elektrische Energie, welche die Wärmepumpe im Betrieb benötigt, soll aus
erneuerbaren Quellen stammen und «naturemade star» zertifiziert sein.
• Idealerweise wird übers Jahr mindestens so viel elektrische Energie, wie die
Wärmepumpe verbraucht, mit der eigenen Photovoltaikanlage selber produziert
(Wärmepumpen-Energiebilanz 0 kWh/a).
• Für alle Komponenten, die es zur Umsetzung der Wärmepumpen-Position braucht, gibt
es anerkannte Organisationen bzw. Labels, welche die energetischen Anforderungen
und Standards im Einzelnen definieren und vorgeben. Es sind dies die Fachvereinigung
Wärmepumpen Schweiz FWS, der Verein MINERGIE, der Schweizerische Fachverband
für Sonnenenergie Swissolar, Holzenergie Schweiz, Topten Schweiz und der Verein für
umweltgerechte Energie VUE.
Im nachfolgenden Bericht sind Fakten und Gesprächsgrundlagen aufbereitet, welche die
Umweltorganisationen WWF, Greenpeace und SES bei ihrem Entscheid unterstützen, die
4/39
Wärmepumpen-Position «Hohe Gesamteffizienz plus Betrieb mit naturemade star» zu
vertreten und zu koordinieren. Vorschläge für das weitere Vorgehen sind:
• Koordination mit den Hauptpartnern
• Einbezug weiterer Partner
• Verschärfung der Anforderungen an Wärmepumpen-Förderprogramme gemäss
Wärmepumpen-Position
• Kommunikation
• Untersuchungen Kombination Solaranlagen / Wärmepumpen
• Verbesserung gesetzliche Vorschriften und Standards
An der Schlusssitzung von Mitte Oktober 2014 wurde deutlich, dass der vorliegende Bericht
eine gute Auslegeordnung mit vielen Fakten und Ansatzpunkten bietet, dass das Thema
«Wärmepumpen» und die Situation jedoch komplex sind:
• Mit den im Bericht aufgeführten Organisationen und Labels wird die Problematik
weitgehend abgedeckt. Zwischen ihnen bestehen einerseits viele Berührungspunkte
sowie die gemeinsame Stossrichtung hin zu mehr Effizienz und erneuerbaren Energien.
• Andererseits ist bekannt, aber weniger ausgesprochen, dass die verschiedenen Akteure
teilweise auch unterschiedliche Interessen und Standpunkte vertreten. Die Definition
einer Strategie wird dadurch erschwert.
Dies ist mit ein Grund, weshalb (noch) keine einfachen Lösungen gefunden wurden, wie die
Umweltorganisationen am Besten weiterfahren sollen. Nicht empfohlen wird jedoch eine
reine Substitution zwischen nicht erneuerbaren Energien (elektrische Energie anstelle von Öl
bzw. Gas) ohne gleichzeitige Verbesserung der Effizienz, denn der Winterspitzenstrom, den
die Wärmepumpe während der Heizperiode braucht, wird mehrheitlich aus Kohle und Gas
erzeugt.
5/39
2 Grundlagen 2.1 Hohe Gesamteffizienz Die Effizienz des Gesamtsystem ist dann hoch, wenn der elektrische Energieverbrauch einer Wärmepumpe minimiert ist. Je niedriger der jährliche Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser ist, je besser erneuerbare Energien für die Erwärmung des Wasser bzw. zur Heizungsunterstützung genutzt werden und je höher die Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe ist, desto tiefer ist der elektrische Energieverbrauch einer Wärmepumpe. Tiefer Wärmebedarf Zu einem tiefen Wärmebedarf für Heizung und Warmwasser führen insbesondere gute Gebäudedämmung, kompakte Bauweise, hohe Gebäudedichtigkeit und gute Gebäudeausrichtung (passive Solarnutzung). Der Einsatz einer Komfortlüftung mit Wärmerückgewinnung führt zu weiteren Einsparungen bei der Nutzenergie. Allgemein rückt bei hoch wärmegedämmten Gebäuden der Heizwärmebedarf zunehmend in den Hintergrund und wird der Anteil Warmwasser in Bezug auf Energieverbrauch und Temperaturniveau wichtiger. Weitere Einzelheiten zum Wärmebedarf siehe Anhang 1, zum Wärmebedarf von MINERGIE-Bauten siehe Anhang 2. Best mögliche Nutzung erneuerbarer Energien Wird der Wärmebedarf ganz oder teilweise mit erneuerbaren Energien gedeckt (Solarthermie zur Erwärmung des Warmwassers oder/und zur Heizungsunterstützung und/oder Holz als Alternative zur Wärmepumpe bzw. Einsatz eines Cheminéeofens für die Übergangszeit), so trägt dies ebenfalls zur Reduzierung des elektrischen Energieverbrauchs einer Wärmepumpe bei. Hohe Jahresarbeitszahlen Die Jahresarbeitszahl einer Wärmepumpe stellt das Verhältnis aus benötigter elektrischer Energie (nur Wärmeerzeugung, inkl. Hilfsenergie für Pumpen und Ventilatoren der Wärmequellenseite, aber ohne Pumpenergie für die Wärmeverteilung im Gebäude) und der nutzbaren Wärme für Heizung und Warmwasser dar. Die Jahresarbeitszahl ist hoch, wenn die Temperaturdifferenz zwischen Wärmequelle und Wärmenutzung möglichst gering ist. Sie ergibt sich u.a. aus dem Zusammenspiel von Klima, Wärmequelle, Betriebsweise, Steuerung, Hilfsenergiebedarf, Verlusten im Betrieb und dem Benutzerverhalten. Ebenfalls einen positiven Einfluss auf die Jahresarbeitszahl hat der Einsatz von Bestgeräten sowie deren richtige Dimensionierung, optimierte Auslegung und korrekte Betriebseinstellung (siehe Anhang 3). Generell gilt: Sole-Wasser-Wärmepumpen sind oft effizienter als konventionelle Luft-Wasser- Wärmepumpen, weil sie eine geringere Temperaturdifferenz überwinden müssen. Alle Wärmepumpen profitieren von einer Last-angepassten Regelung der Wärmeerzeugung und der Temperaturhöhe mittels Drehzahlregelung des Kompressors. Luft-Wasser- Wärmepumpen mit Drehzahlregelung können ähnlich effizient sein wie nicht geregelte Erdwärmepumpen, sie sind aber noch wenig verbreitet. Am effizientesten sind Wasser- Wasser-Wärmepumpen. Da sie jedoch höhere Bedingunen an die Verfügbarkeit der Wärmequelle stellen und darum nur selten installiert werden können, sind sie im Folgenden nicht weiter berücksichtigt. 6/39
Bei bestehenden elektrischen Wärmepumpen werden häufig Jahresarbeitszahlen zwischen
2.0 und 2.5 gemessen, was aufzeigt, dass hier ein grosses, ungenutztes energetisches
Verbesserungspotential vorhanden ist. Bei Neubauten und Gesamtsanierungen liegen gute
Jahresarbeitzahlen von Luft-Wasser-Wärmepumpen bei 3.5, von Sole-Wasser-
Wärmepumpen bei 4.5. Werden alle Parameter optimal berechnet und eingesetzt, liegen
10% höhere Jahresarbeitszahlen drin (3.8 bzw. 5). Bei nicht umfassenden Sanierungen sind
die Jahresarbeitszahlen guter Anlagen ca. 10% schlechter als im Neubau bzw. als bei
Gesamtsanierungen (3 bzw. 4). Deutlich tiefere Jahresarbeitzahlen sind bei
Gebäudesanierungen in Kauf zu nehmen, wenn keine Niedertemperaturheizung (z.B.
Fussbodenheizung) eingebaut werden kann (persönliche Kommunkation mit einem FWS-
Mitarbeiter).
Ein anerkanntes Instrument zur Abschätzung der Jahresarbeitszahl für ein konkretes
Bauvorhaben ist das Tool von WPesti (siehe Anhang 4).
2.2 Betrieb der Wärmepumpe mit naturemade star
Oft werden Wärmepumpen als umwelt- und klimafreundliches Heizssystem dargestellt,
obwohl die Elektrizitätsproduktion grosse Umweltbelastungen mit sich bringt (Klima, nukleare
Risiken, Peak Oil).
Damit Wärmepumpen zu umweltfreundlichen Systemen werden, müsen sie einerseits einen
möglichst tiefen elektrischen Energieverbrauch aufweisen, der mittels einer hohen
Gesamteffizienz gewährleistet werden kann (siehe oben). Zum anderen soll diejenige
elektrische Energie, welche die Wärmepumpe bezieht, sauber, d.h. umweltfreundlich
produziert sein. In der Schweiz werden diese höchsten ökologischen Ansprüche von
Stromprodukten erfüllt, die naturemade star zertifiziert sind.
2.3 Ziel: Energiebilanz Wärmepumpe 0 kWh/a
Der Einsatz einer Wärmepumpe führt unvermeidbar zu zusätzlichem elektrischem
Energieverbrauch. Möchte man noch einen Schritt weiter als naturemade star gehen, wird
konsequenterweise dafür gesorgt, dass die zum Heizen und für das Warmwasser benötigte
elektrische Energie mit der eigenen Photovoltaikanlage produziert wird. Eine
Wärmepumpen-Energiebilanz von 0 kWh/a für Heizung und Warmwasser ist machbar und
anzustreben (siehe Anhang 6).
2.4 Wärmepumpen-Position: «Hohe Gesamteffizienz plus Betrieb mit
naturemade star»
Die Wärmepumpen-Postition «Hohe Gesamteffizienz plus Betrieb mit naturemade star»
erfordert:
• Je besser die Gesamteffizienz ist, desto niedriger ist der elektrische Energieverbrauch
der Wärmepumpe. Zu einem niedrigen elektrischen Energieverbrauch der Wärmepumpe
tragen insbesondere eine gute Dämmung der Gebäudehülle bei, eine Komfortlüftung, die
Nutzung von Solarthermie und/oder Holz, der Einsatz von hocheffizienten
Wärmepumpen sowie deren richtige Dimensionierung, Auslegung und
Betriebseinstellung. Es bestehen verschiedene Wege zur Umsetzung, die PlanerInnen
haben eine gewisse Freiheit darin, wie eine hohe Gesamteffizienz erzielen werden soll.
7/39
Alle bestehenden Potentiale sollen – abgestimmt auf das jeweilige konkrete
Bauvorhaben – jedoch best möglichst kombiniert und ausgeschöpft werden.
• Oftmals werden Wärmepumpen-Systeme als umweltfreundlich angepriesen, obwohl sie
dies aufgrund der problematischen elektrischen Energieproduktion nicht a priori sind. Die
Installation jeder weiteren Wärmepumpe führt zu zusätzlichem elektrischem
Energieverbrauch im Wärmemarkt. Da keine billige Substitution von fossilen Energien
mit elektrischer Energie gefördert werden soll, soll diejenige elektrische Energie, welche
die Wärmepumpe verbraucht, sauber, d.h. umweltfreundlich erzeugt sein. Dieses
Kriterium wird von elektrischen Energieprodukten erfüllt, die naturemade star zertifiziert
sind, oder mit der eigenen Photovoltaikanlage selber produziert werden.
• Idealerweise wird mindestens so viel elektrische Energie, wie die Wärmepumpe übers
Jahr verbraucht mit der eigenen Photovoltaikanlage selber produziert. Eine
Wärmepumpen-Energiebilanz von 0 kWh/a für Heizung und Warmwasser ist machbar
und anzustreben.
8/39
Für alle zur Umsetzung der Wärmepumpen-Position bestehenden Potentiale gibt es
anerkannte Organisationen bzw. Labels, welche Mindestanforderungen und Berechnungs-
und Messverfahren (Standards) definieren. «Bildlich» ausgedrückt, kann die Wärmepumpen-
Position durch die bestmögliche Kombination folgendener Komponenten erfüllt werden:
Organisationen bzw. Label Wärmepumpen-Position
Hohe Gesamteffizienz Betrieb mit Wärmepumpen-
(möglichst tiefer naturemade star Energiebilanz 0
elektrischer kWh/a
Energieverbrauch der
Wärmepumpe)
Hoher Gebäudestandard
(hoch wärmegedämmte
Gebäudehülle,
Komfortlüftung):
Mindestens MINERGIE-
Basisstandard(-ECO)
Solarthermie Elektrische
für Warmwasser bzw. Energieproduktion mit
Heizungsunterstützung Photovoltaikanlage
Holz
(generell als Alternative zur
Wärmepumpe oder für die
Übergangszeit)
Einsatz von Bestgeräten
(hoch effiziente
Wärmepumpen,
zertifizierte elektrische
Energie etc.)
FWS-Systemmodul
(richtige Dimensionierung,
Auslegung und
Betriebseinstellung der
Wärmepumpen-
Gesamtanlage,
Leistungsgarantie,
Nachkontrolle)
Bezug von sauberer
elektrischer Energie:
naturemade star
9/39
3 Diskussion Wärmepumpen-Position Gegenwärtig sind verschiedene Bestrebungen in Gange, die Effizienz von Gebäuden, Wärmepumpen und Wärmepumpenanlagen zu verbessern bzw. den Einsatz von erneuerbaren Energien zu fördern. Diese Bestrebungen sind jeweils meist nur partiell: sie sind entweder aufs Bauen ausgerichtet oder auf die Nutzung von Sonnenergie bzw. Holz, auf die Geräte oder den Bezug von sauberer elektrischer Energie. Indem diese Einzelkomponenten gleichsam zu einem Gesamtpaket gebündelt werden, kann eine grosse Wirkung erzielt werden. Das Ziel einer Wärmepumpen-Energiebilanz von 0 kWh/a ist mit MINERGIE-A(-Eco)- Häusern erreichbar. Dieser Standard setzt die Nutzung von Sonnenenergie am Gebäudestandort voraus. Beim Einsatz einer Wärmepumpe ist der Elektrizitätsbedarf vollständig aus erneuerbaren Quellen zu decken und eine Energiebilanz von Null im Betrieb verbindlich (inkl. Hilfsenergie der Wärmequellenseite wie Lüftungsstrom und Umwälzpumpen etc.). Photovoltaische Solarzellen eignen sich dazu besonders. Im Rahmen der MuKEn 2014 (noch in der Vernehmlassung) haben die Kantone angekündigt, dass neue Gebäude ihre Elektrizität zu einem angemessenen Anteil selber produzieren müssen. Die Wärmepumpen-Position trägt zur 2000-Watt-Gesellschaft und zur aktuellen politischen Debatte rund um den Atomausstieg bei. Sie unterstützt sowohl den effizienten Einsatz von Energie als auch die Nutzung erneuerbarer Energiequellen, mit dem Ziel, die CO2- Emissionen zu reduzieren bzw. sich längerfristig von der Abhängigkeit einer fossil-atomaren Energieversorgung zu lösen. Von Seiten der in die Wärmepumpen-Position involvierten Organisationen bzw. Labels ist vermutlich mit einer relativ breiten Akzeptanz des Ansatzes «Hohe Gesamteffizienz plus Betrieb mit naturemade star» zu rechnen. Sie haben zum Teil unterschiedliche Standpunkte und verfolgen unterschiedliche Interessen, gemeinsam ist ihnen jedoch, dass sie im Grundsatz bestrebt sind, die Energieeffizienz zu verbessern – sei dies von Gebäuden, Wärmepumpen oder Wärmepumpenanlagen – und sie sich alle bewusst sind, dass erneuerbare Energien zukünftig noch mehr und besser genutzt werden müssen. Zudem sind sie alle in ihrem Fachbereich sehr engagiert und nehmen darin eine gewisse Vorreiterrolle ein. Die einzelnen Potentiale bzw. Komponenten, welche zur Umsetzung der Wärmepumpen- Position beitragen, werden in Anhang 7 diskutiert. 10/39
4 Vorschläge für das weitere Vorgehen
4.1 Commitment der Umweltorganisationen
Die Umweltorganisationen waren rund ums Thema «Wärmepumpen» bislang wenig präsent.
Die Position «Hohe Gesamteffizienz plus Betrieb mit naturemade star» ist eine Chance, sich
dezidiert zum Thema «Wärmepumpen» zu positionieren und sich aktiv an den (politischen)
Entwicklungen zu beteiligen und die Zukunft nicht nur im Zusammenhang mit
Wärmepumpen, sondern im weiteren Sinne auch mit intelligentem Bauen und bei der
Nutzung von erneuerbaren Energien mit zu gestalten.
Von WWF, Greenpeace und SES sowie evtl. weiteren Umweltorgansiationen braucht es
einerseits den Entscheid, sich hinter die vorgeschlagene Wärmepumpen-Position zu stellen
und andererseits eine Vorstellung davon, in welcher Form sie beitragen wollen und können,
diese Position auch gegen aussen explizit zu vertreten und zu ihrer Umsetzung beizutragen.
Die Rolle der Umweltorganisationen könnte vor allem darin bestehen, die «Kampagne» zu
initiieren und zu koordinieren. Der Zeitpunkt dafür wird als günstig erachtet, denn im Bereich
Bauen und Wärmepumpen ist gegenwärtig Vieles Neu bzw. in Bewegung, wie
beispielsweise die MuKEn 2014, Sortiments-Anpassungen bei MINERGIE und das kürzlich
eingeführte FWS-Systemmodul.
Vorschläge für das weitere Vorgehen der Umweltorganisationen sind:
• Koordination mit den Hauptpartnern
• Einbezug weiterer Partner
• Anforderungen an Förderprogramme für Wärmepumpen verschärfen gemäss
Wärmepumpen-Position «Hohe Gesamteffizienz plus Betrieb mit naturemade star»
• Untersuchungen Kombination Solaranlagen / Wärmepumpen
• Kommunikation
• Verbesserung gesetzliche Vorschriften
4.2 Koordination mit den Hauptpartnern
In einem ersten Schritt wäre es wichtig, Gespräche mit den direkt in die Wärmepumpen-
Position involvierten Organsiationen zu führen, also mit der Fachvereinigung Wärmepumpen
Schweiz FWS, dem Verein MINERGIE, dem Schweizerischen Fachverband für
Sonnenenergie Swissolar, Holzenergie Schweiz, Topten Schweiz und dem Verein für
umweltgerechte Energie VUE.
Die Wärmepumpen-Position kann ihnen vorgestellt und mit ihnen diskutiert werden
(Ergänzungen, Anregungen?). Die Hauptpartner sollen dazu motiviert werden, die
Wärmepumpen-Position dort, wo gemeinsame Interessen bestehen, zu unterstützen.
Mögliche Bereiche gemeinsamer Interessen sind: Aus- und Weiterbildung, Kommunikation /
Information, Beratung, Förderprogramme, Markttransformation, Mitfinanzierung (weitere
Einzelheiten zu den einzelnen Hauptpartnern sowie Gesprächsthemen siehe Anhang 11).
11/39
4.3 Einbezug weiterer Partner
Ist die Unterstützung der Wärmepumpen-Position durch die Hauptpartner gesichert, sind
weitere, im Zusammenhang mit der Wärmepumpen-Position als wichtig erachtete
Institutionen in den Prozess einzubeziehen. Dazu gehören insbesondere:
• Bundesamt für Energie BFE / EnergieSchweiz
• Konferenz Kantonaler Energiedirektoren EnDK / Energiefachstellenkonferenz EnFK
(resp. einzelne führende Kantone und deren Energiefachstellenleiter)
• Verband schweizerischer Elektrizitätsunternehmen VSE (resp. einzelne führende EVU)
• Schweizer Ingenieur- und Architektenverein SIA (Normengeber für elektrische und
theremische Energie)
Nebst ihrer Information zur Wärmepumpen-Position ist der Aufbau weiterer Partnerschaften
anzustreben, dort, wo gemeinsame Interessen bestehen (weitere Einzelheiten zu den
Partnern sowie Gesprächsthemen siehe Anhang 12).
4.4 Verschärfung der Anforderungen an Wärmepumpen-Förderprogramme
gemäss Wärmepumpen-Position
Gegenwärtig laufen viele Förderprogramme parallel zu einander:
• Bauten: Für MINERGIE-zertifizierte Bauten und Modernisierungen gewähren einige
Banken Hypotheken zu Vorzugsbedingungen. (NB: die ZKB ist Leading-Partner von
MINERGIE).
• Wärmepumpen: In den meisten Kantonen wird die Umstellung auf Wärmepumpen
gefördert. Einige Kantone fördern aus Gründen der Energieeffizienz nur Sole-Wasser
oder Wasser-Wasser Wärmepumpen. Es gibt Kantone, die Luft-Wasser-Wärmepumpen
dann fördern, wenn keine Erdwärmesonden abgeteuft werden können oder dürfen.
Einzelne Kantone fördern Luft-Wasser-Wärmepumpen auch dann, wenn damit
Elektroheizungen ersetzt werden. In der Regel werden Wärmepumpen im Neubau nicht
gefördert (siehe auch www.dasgebaeudeprogramm.ch/index.php/de). Zudem gibt es
auch Fördermöglichkeiten durch Gemeinden, Energieanbieter und Banken (siehe auch
www.energieschweiz.ch/de-ch/wohnen/finanzielle-foerderung-subventionen.aspx,
www.energiefranken.ch, baufördergelder.ch).
• Solaranlagen: Alle Kantone und viele Gemeinden fördern den Einsatz von
Sonnenkollektoren zur Wärmegewinnung. Auf Bundesebene werden
Photovoltaikanlagen mit der kostendeckenden Einspeisevergütung KEV gefördert.
Einzelne Kantone und Energieversorger fördern zusätzlich mit Investitionsbeiträgen oder
kantonalen Einspeisevergütungen. Gleich wie bei der Solarwärme sind auch hier
Steuerabzüge möglich (weitere Infos: www.swissolar.ch/de/unsere-themen/foerderung).
• FWS-Systemmodul: Die FWS ist gerade daran, Förderprogramme aufzubauen, welche
ihr Systemmodul voraussetzen (persönliche Kommunkation mit einem FWS-Mitarbeiter).
Hingegen gibt es noch kein Förderprogramm, das nur dann Fördergelder vergibt, wenn die
Strategie «Hohe Gesamteffizienz plus Betrieb mit naturemade star» stimmt.
Die (Haupt)partner sollen motiviert werden, sich vermehrt für die Konzipierung
entsprechender Förderprogramme einzusetzen. Zusätzlich können gezielt auch Partner
12/39
gesucht werden, die gerne Pionierrollen übernehmen und Förderprogramme gemäss
Wärmepumpen-Position anbieten wollen. Mögliche Partner sind insbesondere führende
Elektrizitätsunternehmen wie ewz, EKZ, IWB, BKW und SIG, aber die ZKB als Leading-
Partner von MINERGIE.
4.5 Kommunikation
Zur Bekanntmachung und Verbreitung der Wärmepumpen-Position wird der Kommunkation
bzw. Medienarbeit durch die (Haupt)partner sowie der Umweltorganisationen eine grosse
Bedeutung beigemessen. Mit entsprechend aufbereiteten Informationen können die
verschiedenen Zielgruppen erreicht und für die Wärmepumpen-Position sensibilisiert
werden. Zu den Zielgruppen zählen insbesondere Berufsleute wie ArchitektInnen,
PlanerInnen, HauseigentümerInnen, Bauherrschaften sowie Mitglieder der (Haupt)partner
und Umweltorganisationen.
4.6 Untersuchungen Kombination Solaranlagen / Wärmepumpen
Die Kombination Solaranlage / Wärmepumpen wird kontrovers diskutiert (siehe Anhang 7).
Sie ist jedoch ein wichtiger Schlüssel zur Senkung des elektrischen Energieverbrauchs der
Wärmepumpen (Solarthermie) bzw. zur Deckung des elektrischen Energiebedarfs der
Wärmepumpen (Photovoltaikanlage).
Die Kombination Solaranlagen / Wärmepumpen birgt grosse Sparpotentiale, stellt in der
Praxis aber oft noch grosse Herausforderungen dar. Entsprechende Untersuchungen und
Projekte zu Vor- und Nachteilen, Einsatzmöglichkeiten und Grenzen, Einsparungen und
Kosten etc. sind notwendig.
4.7 Verbesserung gesetzliche Vorschriften und Standards
Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Möglichkeiten bei gesetzlichen Vorschriften im Bereich
Bauen und Wärmepumpen mitzuwirken, begrenzt:
• EU Ökodesign-Richtlinien für Gebäude wurden kürzlich eingeführt bzw. werden für
Wärmepumpen ab September 2015 gelten.
• Die Deklaration gemäss EU Energielabel ist für Wärmepumpen ab September 2015 in
der EU obligatorisch. In der Schweiz besteht keine Pflicht, es darf ab diesem Zeitpunkt
aber nach diesem Label deklariert werden.
• Die im Entwurf der revidierten Schweizer Energieverordnung EnV vorgesehenen
Mindestanforderungen an Wärmepumpen wurden Mitte 2014 abgelehnt.
• Die MuKEn 2014 ist gerade in der Vernehmlassung und wird voraussichtlich 2016 gültig.
Längerfristig betrachtet, ist wichtig, die gesetzlichen Entwicklungen in der Schweiz und EU
im Bereich Bauen und Wärmepumpen weiterhin sorgfältig zu verfolgen und bei den nächsten
Revisionen aktiv mitzuwirken.
Insbesondere sollen die energetischen Anforderungen an die Wärmepumpen verschärft
werden, um damit ihre Effizienz zu steigern. Falls es gelingt, hohe Anforderungen an die
Geräte einzuführen, so hat dies einen flächendeckenden, EU-weiten Einfluss.
13/39
Anhang 1: Wärmebedarf Heizung und Warmwasser
1. Definitionen
• Heizwärmebedarf: Er entspricht derjenigen Wärme, die dem beheizten Raum während
einer Berechnungsperiode (z.B. eines Jahres) zugeführt werden muss, um den Sollwert
der Raumtemperatur einzuhalten, bezogen auf die Energiebezugsfläche. Die
Energiebezugsfläche ist die Summe aller ober- und unterirdischen Geschossflächen, die
innerhalb der thermischen Gebäudehülle liegen und für deren Nutzung ein Beheizen
oder Klimatisieren notwendig ist.
• Wärmebedarf Warmwasser: Er entspricht derjenigen Energie, die dem
Wassererwärmungssystem während einer Berechnungsperiode (z.B. eines Jahres)
zugeführt werden muss, um den Wärmebedarf fürs Warmwasser zu decken, bezogen
auf die Energiebezugsfläche. Darin berücksichtigt sind der Wärmebedarf für
Warmwasser, die Verluste bei der Wärmeerzeugung, -speicherung und -verteilung
(inklusive der Warmhaltung der Verteilleitungen) sowie die Verluste beim Ausstoss.
2. Erläuterungen
• Der Heizwärmebedarf von Mehrfamilien- und Einfamilienhäusern wird gemäss Norm SIA
380/1 Ausgabe 2009 kalkuliert. Er umfasst Transmissionswärmeverluste plus
Lüftungswärmeverluste abzüglich (nutzbare) Wärmegewinne. Zur Berechnung des
Heizwärmebedarfs werden zudem die Gebäudehüllfläche und die Gebäudehüllzahl
benötigt. Norm SIA 416/1 gibt an, wie diese beiden Kenngrössen ermittelt werden.
Ausgangspunkt bei SIA 380/1:2009 ist eine Jahresmitteltemperatur von 8.5°C. Ist sie
tiefer (z.B. im Engadin) darf der Heizwärmebedarf höher sein, ist sie höher (z.B. im
Tessin) muss er tiefer sein. Bei Umbauten darf der Heizwärmebedarf 25% höher sein
(Faktor 1.25). SIA 380/1:2009 wurde kürzlich revidiert (Vernehmlassung Ende 2013).
Vorgesehene Änderungen sind u.a.:
o Erhöhung der Jahresmitteltemperatur von 8.5°C auf 9.4°C bei den
Grenzwerten Heizwärmebedarf (Klimaerwärmung)
o Verschärfung der Grenzwerte bezüglich Heizwärmebedarf (ca. 5%)
o Das Warmwasser wird neu in SIA 385/2 geregelt
• Der Wärmebedarf für Warmwasser ist gegenwärtig noch in SIA 380/1:2009 geregelt,
zukünftig wird er in der SIA 385/2 geregelt sein. Zur Zeit werden für den Wärmebedarf für
Warmwasser noch Konstanten eingesetzt. Im Mehrfamilienhaus sind es 21 kWh/m2 a, im
Einfamilienhaus 14 kWh/m2 a. Zukünftig, d.h. mit SIA 385/2, wird der Wärmebedarf
Warmwasser von der (Standard-) Wohnungsbelegung abhängen. Auch eine
Warmwasser-Verlustzahl wird einberechnet werden. Gemäss Jürg Nipkow, Präsident
Kommission SIA 385 Warmwasseranlagen, kann der Wärmebedarf Warmwasser dann
bei relativ kleinen Wohnungflächen deutlich höher ausfallen als nach alter Norm SIA
380/1:2009. Die Berechnung pro m2 wird aufwendiger sein. SIA 385/2 ist beschlossen,
Sie wird voraussichtlich im Herbst 2014 publiziert und damit ab dann in Kraft treten.
14/39
Anhang 2: Wärmebedarf MINERGIE-Bauten
Die untenstehende Tabelle zeigt den typischen Heizwärmebedarf von MINERGIE-Bauten vor
Abzug der Komfortlüftung (QhStandard) und nach Abzug der Komfortlüftung (QhEffektLuft) sowie
den Wärmebedarf des Warmwassers (kontante Werte gemäss SIA 380/1:2009). Die Daten
zum Heizwärmebedarf beziehen sich auf im 2013 gebaute bzw. sanierte Mehr- und
Einfamilienhäuser im MINERGIE bzw. MINERGIE-P-Standard. Für MINERGIE-A-Bauten
liegen nicht genügend Daten vor. Gemäss Angaben von MINERGIE liegt ihr
Heizwärmebedarf zwischen den Werten von MINERGIE und MINERGIE-P.
Bau- Bauvorhaben Heizwärme- Effektiver Warmwasser Total
2 2 2
standard bedarf kWh/m Heizbedarf kWh/m a kWh/m a
2
a kWh/m a (SIA
(QhStandard, SIA (QhEffektLuft) 380/1:2009)
380/1:2009)
MINERGIE Neubau MFH 34 26 21 47
EFH 34 26 14 40
Sanierung MFH 46 40 21 61
EFH 46 40 14 54
MINERGIE-P Neubau MFH 25 16 21 37
EFH 25 16 14 30
Sanierung MFH 27 18 21 29
EFH 27 18 14 32
(Quelle Heizwärmebedarf: von MINERGIE erhaltene Daten)
• Bei allen MINERGIE-Bauten muss zwar die Anforderungen an den Wärmebedarf
Heizung und Warmwasser erfüllt sein (Basis ist SIA 380/1:2009), ausschlaggebend, ob
der entsprechende MINERGIE-Standard erreicht wird oder nicht, ist jedoch der
gewichtete Energiebedarf (MINERGIE(-Eco)-Neubauten: ≤ 38 kWh/m2 a; MINERGIE-P(-
Eco): ≤ 30 kWh/m2 a; Strom wird gewichtet mit Faktor 2 (nur! Sollte 3 sein). In Regionen
mit einer Jahresmitteltemperatur ≤ 8.5°C (wie z.B. im Engadin) müssen daher zur
Erfüllung dieser Anforderung grössere Anstrengungen unternommen werden (z.B. noch
bessere Dämmung) als in Regionen mit höherer Jahresmitteltemperatur (wie z.B. im
Tessin).
• Alle drei MINERGIE(-Eco)-Standards (Basisstandard, P und A) orientieren sich bezüglich
Heizwärmebedarf und Warmwasser gegenwärtig an SIA 380/1:2009. Ob und wann auf
die zukünftigen SIA-Normen abgestützt wird und zu welchen Änderungen diese
Umstellung gegebenenfalls führen wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt.
15/39
Anhang 3: Einflussfaktoren Jahresarbeitszahlen Wärmepumpen
Die Jahresarbeitszahl einer Wärmepumpe gibt das Verhältnis zwischen produzierter Heiz-
bzw. Warmwasserenergie und aufgenommener elektrischer Energie (inkl. Hilfsenergie) über
ein ganzes Jahr an. Im Gegensatz zum Coefficient of Performance COP, einem im Labor
gemessenen Wert, ist die Jahresarbeitszahl ein Praxiswert, denn erst die durchschnittliche
Leistungszahl der ganzen Anlage über ein Jahr bestimmt den tatsächlichen elektrischen
Energieverbrauch bzw. die effektiven Elektrizitätskosten für die Wärmepumpe.
Beispiel:
Wärmebedarf Total Heizenergie und Jahresarbeitszahl der Total 1’500 kWh/a
Heizung und Energie für Wärmepumpe (Heizung benötigte elektrische
Warmwasser Warmwasser und Warmwasser): 4 Energie (Endenergie)
2
30 kWh/m a
6’000 kWh/a
2 2
Energiebzugsfläche (30 kWh/m * 200 m ) Total 4’500 kWh/a
2
(z.B. 200 m ) benötigte
Umweltenergie (z.B. aus
Luft oder Sole)
Die Jahresarbeitszahl einer Wärmepumpe ergibt sich aus dem Zusammenspiel vieler
Faktoren u.a. von Klima, Wärmequelle (Luft, Sole, Wasser), Betriebsart (monovalent,
bivalent, monoenergetisch), Regelung (Frequenzumrichter zur Drehzahlregelung des
Kompressors, oder nicht), Verlusten im Betrieb und dem Benutzerverhalten.
Je höher die Jahresarbeitszahl einer Wärmepumpe ist, desto effizienter ist sie, d.h. desto
weniger elektrische Energie verbraucht sie. Hohe Jahresarbeitszahlen von Wärmepumpen
werden insbesondere begünstigt durch eine geringe Temperaturdifferenz zwischen
Wärmequelle und Wärmenutzung. Faktoren, die einen Einfluss auf die Jahresarbeitszahl
haben sind u.a.:
• Wärmequelle und Regelung: Sole-Wasser-Wärmepumpen sind im Allgemeinen
effizienter als Luft-Wasser-Wärmepumpen ohne Drehzahlregelung. Wärmepumpen mit
Drehzahlregelung werden auch als «modulierend» oder «Inverter-Wärmepumpen»
bezeichnet. Sie passen die Wärmeleistung besser dem effektiven Bedarf an, haben
weniger Ein-Ausschalt-Zyklen und eine bessere Ausnutzung der Wärmetauscher.
Deshalb ist ihre mittlere Temperaturdifferenz zwischen Quelle und Bedarf geringer.
Daraus resultiert eine höhere Jahresarbeitszahl bei gleichem Coefficient of Performance
COP. Der leicht höhere Preis für die Drehzahlregelung lohnt sich in der Regel. Luft-
Wasser-Wärmepumpen, die drehzahlgeregelt laufen, können ähnlich effizient sein wie
Erdwärmepumpen ohne Drehzahlregelung. Am effizientesten sind geregelte Wasser-
Wasser-Wärmepumpen, welche im Folgenden aber nicht weiter berücksichtigt werden,
da sie höhere Standortkriterien haben und deshalb nur selten installiert werden können.
• Betriebsart:
o Monovalent bedeutet, dass die Wärmepumpenanlage den gesamten
Wärmebedarf auch bei tiefsten Aussentemeperaturen voll decken kann und
die einzige Wärmequelle im Haus ist (also kein zweiter Wärmeerzeuger, kein
16/39
Heizstab). Die Jahresarbeitszahl ist bei tiefen (unter 0°C) und bei sehr tiefen
Aussentemperaturen (-10°C) sehr schlecht, weil (neben der höheren
Temperaturdifferenz zwischen Quelle und Bedarf) die Luftbestrichenen Teile
(Wärmetauscher) vereisen und regelmässig abgetaut werden müssen.
o Bivalent bedeutet, dass die Wärmepumpenanlage mit einer zweiten Heizung
kombiniert wird, die sie in Spitzenzeiten unterstützt (also mit Heizstab oder
Heizkessel). Deshalb kann die Wärmepumpe auf eine geringere
Aussentemperatur ausgelegt werden und ist dadurch auch effizienter.
o Monoenergetisch bedeutet, dass die Wärmepumpe mit einer elektrischen
Zusatzheizung (Heizstab) betrieben wird. Dies muss wegen der zusätzlichen
elektrischen Spitzenlast an kalten und sehr kalten Tagen und der daraus
erhöhten Netzbelastung unbedingt vermieden werden.
• Kombi- oder getrennte Anlagen: Kombianlagen liefern Warmwasser (55°C bis 60°C)
und Heizwärme (häufig nur noch 35°C). Bei kombinierten Anlagen müssen alle
Komponenten auf die höhere erforderliche Warmwassertemeperatur ausgelegt werden.
Die höhere Temperaturdifferenz reduziert die Jahresarbeitszahl. Bei getrennten Anlagen
mit separater Erwärmung des Heizwassers und des Trinkwarmwassers kann dies für den
Heizungsteil vermieden werden.
• Einsatz von Bestgeräten: Je höher der COP des Wärmepumpen-Aggregats ist, desto
effizienter arbeitet es, das heisst desto besser sind die Voraussetzungen, eine hohe
Jahresarbeitszahl zu erreichen. Der COP gibt bei der Wärmepumpe das Verhältnis
zwischen Heizleistung und aufgenommener elektrischer Leistung bei einem bestimmten
Betriebspunkt an. Ein Beispiel: Ein COP von 5 bei B0/W35 (das heisst einer Sole-
Temperatur von 0°C und einer Nutztemperatur von 35°C) steht das 5-fache der
eingesetzten elektrischen Leistung als nutzbare Wärmeleistung zur Verfügung. Der
Zugewinn stammt aus der entzogenen Umgebungswärme. Die Leistungszahlen von
Wärmepumpen werden in Testzentren (z.B. am Wärmepumpen-Testzentrum WPZ in
Buchs/SG) bei verschiedenen standardisierten Betriebspunkten gemessen und sagen
damit aus, wie effizient die Wärmepumpe im jeweiligen Betriebspunkt arbeitet. So
können einzelne Wärmepumpen bezüglich ihrer Effizienz miteinander verglichen werden.
Über den zu erwartenden Energiebedarf hat der COP-Wert jedoch nur begrenzte
Aussagekraft. Denn im praktischen Einsatz arbeiten Wärmepumpen über das ganze Jahr
gesehen nur selten im angegebenen Betriebspunkt, sondern durchlaufen
unterschiedlichste Betriebspunkte. Der COP ist zwar ein Gütekriterium für
Wärmepumpen, erlaubt jedoch keine energetische Bewertung der Gesamtanlage.
Zudem beinhaltet der COP die Hilfsenergien für Pumpen und Ventilatoren nicht.
• Gute Dimensionierung, Auslegung und Betriebseinstellung: Ebenfalls einen
entscheidenend Einfluss auf die Jahresarbeitszahl haben die richtige Dimensionierung
(keine unnötigen Leistungsreserven), optimale Auslegung (Wärmepumpen arbeiten
umso besser, je kleiner die Temperaturdifferenz zwischen Wärmequelle und
Heizwassertemperatur ist) und gute Betriebseinstellungen der Gesamtanlage.
• Tiefe Heizwassertemperatur: Mit möglichst grossen Flächen für die Wärmeabgabe
über Fussboden, Wände oder (grosse) Radiatoren kann die Heizwassertemperatur tief
gehalten werden (z.B. max. 35°C, Radiatoren max. 45°C bis 50°C). Das erhöht die
Jahresarbeitszahl und die Effizienz des Systems. Die Senkung der Heizwasser-
17/39
temperatur um 5°C reduziert den elektrischen Energieverbrauch der Wärmepumpe um
etwa 8 Prozent. Mit Radiatoren resultieren deutlich tiefere COP-Werte.
• Sparsame Umwälzpumpen: Hocheffiziente, drehzahlgeregelte und richtig
dimensionierte Umwälzpumpen auf der Wärmequellenseite (z.B. bei Erdsonden)
benötigen bis zu 80% weniger elektrische Energie als herkömmliche Heizungspumpen.
Ihr Ersatz verbessert die Gesamteffizienz des Heizsystems.
• Sparsame Ventilatoren: Hocheffiziente, drehzahlgeregelte und richtig dimensionierte
Ventilatoren auf der Wärmequellenseite (z.B. bei Luft-Wasser-Wärmepumpen) benötigen
bis zu 80% weniger elektrische Energie als herkömmliche Ventilatoren. Ihr Ersatz
verbessert die Gesamteffizienz des Heizsystems.
• Klima: Das Klima hat ebenfalls einen Einfluss auf die Jahresarbeitszahl. Je höher die
Jahresmitteltemperatur ist, desto besser fällt die Jahresarbeitszahl aus.
• Benutzerverhalten: Auch ein gutes Benutzerverhalten der BewohnerInnen wirkt sich
positiv auf die Jahresarbeitszahl aus (z.B. keine dauergekippten Fenster im Winter).
18/39
Anhang 4: Abschätzung von Jahresarbeitszahlen nach WPesti
Ein in der Praxis häufig angewendetes Instrument zur Abschätzung von Jahresarbeitszahlen
einer Wärmepumpe ist das Excel-Tool von WPesti (Download: www.endk.ch, gültig bis Ende
2015). Bei MINERGIE(-P, -A)-Bauten ist der Nachweis mit diesem Tool Pflicht. Im Tool sind
u.a. folgende Parameter zu hinterlegen:
• Klimastation
• Heizwärmebedarf nach SIA 380/1:2009 und Verluste (Transmission, Lüftung, Verteilung)
• Wärmebedarf Warmwasser nach SIA 380/1:2009 und Verluste (Speicher, Verteilung)
• Name und Typ der Wärmepumpe (Daten vieler in der Schweiz erhältlichen
Wärmepumpen sind bereits hinterlegt)
• Wärmequelle (Luft, Sole, Wasser)
• Einsatz (Heizung, Warmwasser)
• Betriebsweise der Anlage (monovalent, mit elektrischer Zusatzheizung, fossil-bivalent)
• Quelltemperatur
• Heizleistung und COP bei Vorlauftemperatur 35°C und 55°C
• Elektrische Leistungsaufnahme Solepumpe
• Solaranlage (keine Solaranlage, solare Wassererwärmung, Warmwasser und Heizung)
• Verluste im Betrieb (Anfahren, Speicher, etc.)
Der elektrische Zusatz ist nicht berücksichtigt. Abweichungen von den nach WPesti
abgeschätzten Werten treten in der Praxis auf. Gründe dafür können u.a. ungünstige
Betriebseinstellungen der Wärmepumpe sein, aber auch ein besonders kalter bzw. milder
Winter oder ungünstiges Benutzerverhalten.
19/39
Anhang 5: Berechnung jährlicher elektrischer Energieverbrauch
von Wärmepumpen (kWh/m2 a)
Der jährliche elektrische Energieverbrauch einer Wärmepumpe pro m2 Energiebezugsfläche
für Heizung und Warmwasser hängt ursächlich ab vom jährlichen Wärmebedarf dafür
(abzüglich Nutzung erneuerbarer Energien) und der Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe.
Der jährliche elektrische Energieverbrauch kann nach der folgenden Formel berechnet
werden:
Summe jährlicher Wärmebedarf Heizung und Warmwasser
2
(kWh/m a)
______________________________________
=
Jährlicher
Stromverbrauch der
Jahresarbeitszahl der Wärmepumpe Wärmepumpe
2
(kWh/m a)
Beispiel:
(26 kWh/m2 a (Heizwärmebedarf) + 14 kWh/m2 a (Warmwasser)): 4.5 (JAZ) = 8.9 kWh/m2 a
Der Heizwärmebedarf wird bei einer Standardnutzung mit Mittelwerten in Bezug auf
Raumtemperatur, Belegung, Lüftungsverhalten, Aussentemperaturen etc. kalkuliert (gemäss
SIA 380/1: 2009 bzw. zukünftiger Norm). Damit sind die Energiekennzahlen verschiedener
Gebäude vergleichbar.
Beim Warmwasser wird aufgrund der Standardnutzung vorläufig noch ein konstanter Wert
von 21 kWh/m2 a (Mehrfamilienhaus) bzw. 14 kWh/m2 a (Einfamilienhaus) angenommen
(dito SIA 380/1:2009), nach neuer Norm (SIA 385/2) werden es andere Werte sein.
Der am Elektrozähler der Wärmepumpe (d.h. ohne Haushaltstrom) tatsächlich abgelesene
Elektrizitätsverbrauch stimmt in der Praxis mit dem berechneten elektrischen
Energieverbrauch der Wärmepumpen in der Regel nicht überein. Der Heizwärmebedarf kann
je nach Härte des Winters, grösserer Belegung oder je nach Benutzerverhalten (z.B.
dauergekippte Fenster) beträchtlich schwanken. Insbesondere beim Wärmebedarf für
Warmwasser gibt es im Alltag erhebliche Abweichungen vom SIA 380/1:2009-Wert, da der
effektive Verbrauch stark von der Belegung und dem Benutzerverhalten abhängt (z.B. oft
und lang duschen / baden etc.).
Fazit: Je nach Norm, die dem Heizwärmebedarf bzw. dem Wärmebedarf Warmwasser zu
Grunde gelegt wird, resultieren unterschiedliche elektrische Energieverbrauchswerte der
Wärmepumpe. Zudem handelt es sich hierbei um Rechenwerte, die meist nicht mit den
Praxiswerten übereinstimmen.
20/39
Anhang 6: Ziel: Energiebilanz 0 kWh/a
Ursprünglich war vorgesehen, einen ambitionierten, aber realistischen Zielwert für den
jährlichen elektrischen Energieverbrauch einer Wärmepumpe pro m2 Energiebezugsfläche
für Heizung und Warmwasser festzulegen. Damit kann der Grad der anzustrebenden
Gesamteffizienz gut ausgedrückt bzw. festgelegt werden. Von der Vorgabe eines solchen
Zielwertes wird zum jetzigen Zeitpunkt aus folgenden Gründen abgesehen:
• Der errechnete elektrische Energieverbrauch der Wärmepumpen hängt wesentlich von
der jeweiligen Norm ab, die zur Berechnung des Heizwärmebedarfs bzw.
Warmwassersbedarfs verwendet wird:
o Legt man die Norm SIA 380/1:2009 zu Grunde (so wie dies bei MINERGIE
gegenwärtig (noch) der Fall ist), wird im Falle einer effizienten Sole-Wasser-
Wärmepumpe mit einer Jahresarbeitszahl von 4.5 bereits bei allen in Tabelle
Anhang 2 aufgeführten MINERGIE-Bauten ein elektrischer Energieverbrauch
um 10 kWh/m2 oder weniger erreicht (Ausnahme: sanierte Bauten im
MINERGIE-Basistandard: 13.5 kWh/m2).
o Grosse Veränderungen stehen bei den Warmwasser-Werten bevor. Künftig
wird das Warmwasser nach Belegung berechnet, was automatisch zu
anderen elektrischen Energieverbrauchswerten für Wärmepumpen führen
wird. Verlässliche Zahlen, die zeigen, in welchem Bereich der Wärmebedarf
Warmwasser sich gemäss neuer Norm bewegen wird, liegen noch keine vor.
Insbesondere vor diesem Hintergrund ist es wenig sinnvoll, zum jetzigen
Zeitpunkt einen Zielwert für den jährlichen elektrischen Energieverbrauch
einer Wärmepumpe pro m2 zu definieren.
Stattdessen soll die Stromproduktion mit erneuerberen Energien vorangetrieben werden.
Zum bezieht sich dies auf naturemade star-Stromprodukte, zum anderen auf die
Eigenstromerzeugung mit einer Photovoltaikanlage zur Deckung des eigenen Strombedarfs
mit dem Ziel einer Wärmepumpen-Energiebilanz von 0 kWh/a für Heizung und Warmwasser.
21/39
Anhang 7: Komponenten der Wärmepumpen-Position 1. Hoher Gebäudestandard Effizienzpfad SIA Grundlagen und Zielwerte für Wärme, elektrische Energie, Graue Energie und induzierte Mobilität. Einzelne Merkblätter sind zu den Teilwerten vorhanden. Zitat SIA: «Das Merkblatt SIA-Effizienzpfad Energie (SIA 2040) und die zugehörige Dokumentation (SIA D0236) sowie die Rechenhilfe SIA 2040 bilden die Basis für die Umsetzung dieses Etappenziels der 2000-Watt-Gesellschaft im Gebäudebereich. Der SIA-Effizienzpfad Energie zeichnet sich durch eine gesamtenergetische Betrachtung aus: Neben der Betriebsenergie werden auch deren Graue Energie und die standortabhängige Mobilität einbezogen. Als entscheidende Neuerung ist es gelungen, auch Zielwerte für die Treibhausgasemissionen anzugeben. Sie sind wegen der Klimaauswirkungen zentral und bilden neben der nicht erneuerbaren Primärenergie die zweite Beurteilungsgrösse. Der SIA-Effizienzpfad Energie setzt für die drei Gebäudekategorien Wohnen, Büro und Schulen Zielwerte und zwar für Neubauten wie auch für Umbauten und Sanierungen. Damit ist erstmals eine energetische Betrachtung über den ganzen Lebenszyklus von Gebäuden möglich, die mit dem Bereich Mobilität auch das siedlungs- und städtebauliche Umfeld einbezieht. Der SIA-Effizienzpfad Energie gibt dem energieeffizienten Bauen eine neue Dimension.» (siehe auch www.sia.ch/fileadmin/content/download/sia- norm/kommissionen/SIA_Faltblatt_Effizienzpfad_A4.pdf) MuKEn 2014 Bauen nach MINERGIE-Standards ist zum heutigen Zeitpunkt noch nicht Standard (Zahlen MINERGIE-Bauten siehe Anhang 8). Mit Inkrafttreten der angepassten kantonalen Gesetzgebung (Mustervorschriften der Kantone im Energiebereich MuKEn 2014, zur Zeit in der Vernehmlassung, voraussichtlich ca. 2016) ist vorgesehen, dass Neubauten und Gesamtsanierungen von Altbauten künftig in etwa den heutigen MINERGIE-Basisstandard zu erfüllen haben. Die Kantone sind angehalten, die Bestimmungen bis ins Jahr 2020 in ihr kantonales Energierecht zu übernehmen (siehe Anhang 9). Die Energievorschriften der Kantone gehen mit den MuKEn 2014 weniger weit als die Gebäudeanforderungen in der EU (Energiedirektive 2010/31). Begründet wird dies damit, dass in der Schweiz im Gegensatz zu den umliegenden Ländern aufgrund der hohen Erstellungskosten das Kostenoptimum zwischen Investitions- und Betriebskosten bereits bei weniger Dämmung erreicht werde. Investitionen in eine noch bessere Gebäudehülle würden sich entsprechend weniger rentieren als in der EU (Hauseigentümer, Ausgabe Nr. 11, 15. Juni 2014). MINERGIE Bei den MuKEn-Vorschriften handelt es sich um Mindestanforderungen. Selbstverständlich dürfen Bauherrschaften freiwillig energetisch auch besser bauen. Sogenannte Null- Wärmeenergie-Häuser (siehe Anhang 10) verbrauchen in der Jahresbilanz netto keine 22/39
Sie können auch lesen