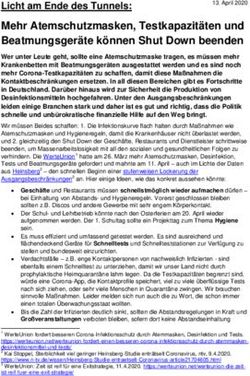Wegfall der Geschäftsgrundlage in Zeiten von Corona - GWriters
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Institut für Rechtswissenschaften
Wegfall der Geschäftsgrundlage in Zeiten
von Corona
Wissenschaftliche Mustervorlage – Disposition zur Jura-Dissertation
Referent (Gutachter): Prof. Dr. Max Mustermann
Betreuer: Alex Mustermann
Erstprüfer: Gerhard Mustermann
Zweitprüfer: Sabine Mustermann
Vorgelegt von: Milena Fischer
Matrikelnummer: 111 111
Adresse: Kurfürstendamm 1, 11719 Berlin
E-Mail: fischer@gwriters.de
Telefon: +49 30 8093323-26
Studienfach: BWL
Wintersemester 2022/2023
Berlin, 24.08.2022Inhaltsverzeichnis I. Einführung und Problemaufriss .......................................................................... 1 II. Deskription des Dissertationsvorhabens und Forschungsfragen ........................ 5 III. Methoden ............................................................................................................ 9 IV. Vorläufige Gliederung ...................................................................................... 10 Vorläufiges Literaturverzeichnis ................................................................................ 11
I. Einführung und Problemaufriss
Das BGB geht im Grundsatz davon aus, dass Verträge einzuhalten sind (pacta sunt
servanda). Dieser Grundsatz gehört zu den unverzichtbaren Elementarstrukturen des
Vertragsrechts1 und soll sicherstellen, dass sich die Vertragspartner auf die Wirksam-
keit des geschlossenen Vertrages als individuelles Planungsinstrument verlassen dür-
fen (Sicherheitsbedürfnis des Rechtsverkehrs). Keine Seite soll sich – ohne Weiteres
– durch einseitige Erklärung von der Bindung an den abgeschlossenen Vertrag lösen
können und zur Aufhebung bedarf es – ebenso wie zum Abschluss des Vertrages –
grundsätzlich einer Willensübereinstimmung der Parteien.2 Das gilt prinzipiell auch
dann, wenn sich das Vertragsumfeld und damit die Verhältnisse, die zum Zeitpunkt
des Vertragsschlusses bestanden hatten, später verändert haben, etwa durch Natur-
/Umweltkatastrophen3, Kriegseinflüsse4 und Terrorgefahren bei Reisezielen,5 Wäh-
rungsverfall oder Geldwertschwund,6 technischen Katastrophen7 sowie Sozialkata-
strophen wie Revolutionen und Attacken im Cyberraum.
1
Vgl. nur BAG, Urt. v. 12.01.2005 – 5 AZR 364/04 unter B. I. 4. a) = BAG NJW 2005 S. 1820.
2
Ellenberger J., in: Grüneberg (81. Auflage 2022) Einf. v. § 145, Rn. 4a.
3
Beispielsweise Erdbeben, Vulkanausbrüche, Tsunamis, Lawinen und Erdrutsche oder extreme Klima-
und Wetterereignisse wie das ‚Jahrhunderthochwasser‘ der Elbe und Donau in Deutschland, Tschechien
und Österreich im August 2002 und vier Jahre später das ‚Elbhochwasser‘ im März/April 2006, das am
schwersten das Bundesland Sachsen traf, oder die Hochwasserkatastrophe aufgrund extremer Unwette-
rereignisse in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Juli 2021.
4
In diesem Zusammenhang wird auf den aktuellen, seit Februar 2022 wütenden Konflikt zwischen der
Ukraine und Russland und die damit einhergehenden Auswirkungen auch auf den Rohstoff- und Ener-
giemarkt hingewiesen.
5
Vgl. zum Beispiel die wiederholten Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes in von Terrororganisa-
tionen wie Al-Qaida und Islamischer Staat attackierten Gebieten.
6
Siehe hierzu beispielsweise BGH, Urt. v. 30.03.1984 – V ZR 119/83 = BGHZ 91 S. 32 (36), Rn. 15
und 17 zur Anpassung (Erhöhung) eines ursprünglich auf 99 Jahre festgelegten Erbbauzinses wegen
Geldwertschwundes um mehr als 3/5 gemäß § 242 BGB; außerdem die aktuellen inflationären Preis-
entwicklungen in Deutschland und Europa von ca. 8 % gegenüber Vormonaten für Energie, Lebensmit-
tel, Kraftstoffe und nahezu alle Güter des Alltags (siehe hierzu Statistisches Bundesamt unter
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/07/PD22_296_611.html – zuletzt aufgeru-
fen am 11.08.2022).
7
Die Liste an Beispielen ist lang: Seeunfälle wie das Querlegen des auf Grund gelaufenen Container-
schiffes Ever Given im Suezkanal im März 2021 und die damit einhergehende tagelange Blockierung
der weltweit bedeutenden Seeverkehrsverbindung; Flugunfälle (z. B. der absichtlich herbeigeführte Ab-
sturz des Airbus A320 in Frankreich im März 2015 oder die wegen Triebwerkausfalls notwendige Not-
landung auf der Bundesautobahn A7 bei Hasloh im September 1971, bei welcher die Maschine mit einer
Brücke kollidierte – siehe Paninternational Flug 112) und Eisenbahnunfälle (z. B. Entgleisung eines
ICE wegen Radbruchs nahe Eschede im Juni 1998), Brücken- und Tunneleinstürze, Chemiekatastro-
phen (z. B. Unfall bei BASF in Ludwigshafen im Oktober 2016 wegen Ansägens einer falschen Rohr-
leitung oder die Explosion von 2.750 Tonnen Ammoniumnitrat im Hafen von Beirut im August 2020),
Öl- und Bergbauunglücke (z. B. Explosion auf der Ölplattform Piper Alpha in der Nordsee im Juli 1988
oder die Ölpest im Golf von Mexiko aufgrund der Zerstörung der Bohrplattform Deepwater Horizon
im April 2010), Stromausfälle (z. B. der großflächige und lang andauernde Stromausfall des gesamten
Stadtgebiets Berlin-Köpenick im Februar 2019 wegen Fehlern bei Bauarbeiten oder der ‚nur‘ zweistün-
dige aber großflächige Stromausfall in Teilen von Deutschland, Frankreich, Belgien, Italien, Österreich
und Spanien im November 2006 wegen Fehlfunktionen bei der Abschaltung von Einrichtungen anläss-
lich der Ausschiffung der Norwegian Pearl, eines Kreuzfahrtschiffs der Meyer Werft in Papenburg).
1Gerade aber in solchen Fällen kann das (unveränderte) Festhalten an vertraglichen Re-
gelungen für eine Partei unzumutbar, mitunter ruinös sein.8
Daher hat die (deutsche) Rechtsprechung – unter Heranziehung der Lehre von der Ge-
schäftsgrundlage9 auf Basis des § 242 BGB – Kriterien aufgestellt, unter denen eine
vertragliche Bindung in derartigen Fällen modifiziert oder sogar aufgehoben wird. Er-
reicht wird damit eine Kompromisslösung zwischen dem Prinzip der Vertragstreue
und der Vermeidung zufälliger extremer Unzumutbarkeitssituationen.
Erste Überlegungen für eine Korrektur aus Billigkeitsgründen (§ 242 BGB) finden
sich bereits bei der gemeinrechtlichen Lehre der clausula rebus sic stantibus.10 Diese
ist die Lehre vom Vorbehalt gleichbleibender Umstände und Vorläufer der Geschäfts-
grundlage. Ihre Ansätze weisen bis in die jüngste Zeit. So ist der Clausula-Gedanke
heute im Völkerrecht durch Art. 62 WKV11 anerkannt und darüber hinaus ein Baustein
des Völkergewohnheitsrechts, der auch die EU-Organe bindet.12
Aber nicht nur im Völkergewohnheitsrecht, sondern auch im Bereich der Privatauto-
nomie entwickelte sich die Lehre – nur weniger klar und häufig divers. Naturrechtliche
Kodifikationen kannten ihn und wendeten zwar den Clausula-Gedanken an.13 Die
Clausula-Einrede hat beispielsweise weder im Jahr 1804 Eingang in den (französi-
schen) Code civile noch in das österreichische Recht des ABGB von 1811 gefunden.
Auch die Wissenschaftler, die sich ausgiebig mit den römisch-rechtlichen Pandek-
ten/Digesten beschäftigten und bekanntlich das BGB besonders beeinflussten, lehnten
sie grundsätzlich ab. Im BGB vom 1. Januar 1900 findet sich ebenfalls keine Regelung.
Dennoch erlebte die Lehre vom Fehlen oder Wegfall der Geschäftsgrundlage in
Deutschland – jedenfalls rechtswissenschaftlich betrachtet – kein Schattendasein; viel-
mehr wurde sie vor allem in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg fortentwickelt, um
die damals bestehenden Vertragsverhältnisse den einschneidenden wirtschaftlichen
Veränderungen der Inflationszeit anpassen zu können.14
8
Schmidt R., SchuldR AT (14. Auflage 2022) Rn. 785.
9
Siehe nur Oertmann P., Die Geschäftsgrundlage: Ein neuer Rechtsbegriff (1921).
10
Allgemeine Auffassung, vgl. etwa Finkenauer: in: MüKo-BGB (9. Auflage 2022) § 313 Rn. 20
m. w. N.; Lorenz, in: Hau/Poseck, BeckOK-BGB (62. Edition, Stand: 01.05.2022) § 313 Rn. 2 m. w. N.
11
Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge vom 23. Mai 1969 (BGBl. II 1985 S. 926).
12
Vgl. nur EuGH, Urt. v. 16.06.1998 – C-162/96 (Racke ./. Hauptzollamt Mainz) = Slg. I 1998, 3655.
13
Siehe z. B. das Bayerische Landrecht (Codex Maximilianeus Bavaricus Civils) von 1756, dort unter
dem 4. Teil (Das Obligationen-Recht), 15. Kapitel (Von anderen Arten der Aufhebung von Obligatio-
nen), § 12 Ziff. 3; Preußisches Allgemeines Landrecht von 1794, dort unter dem 1. Teil, 5. Titel (Von
Verträgen), IX. Abschnitt (Aufhebung der Verträge), Ziff. 3 (wegen veränderter Umstände), § 377.
14
RG, Urt. v. 15.10.1918 – III 104/18 = RGZ 94, S. 45 (47) zum Umgang der durch den Krieg einge-
tretenen völligen Umwälzung der Verhältnisse auf die vor dem Krieg abgeschlossenen Lieferungsver-
träge; RG, Urt. v. 21.09.1920 – III 143/20 = RGZ 100, S. 129 ff.; RG, Urt. v. 06.08.1923 – II 215/23 =
RGZ 106, S. 422 ff. sowie RG, Urt. v. 02.10.1923 – II 165/23 = RGZ 107, S. 21 ff., beide zum Umgang
mit der Geldentwertung in den 1920er-Jahren.
2Unter Berücksichtigung der von der (deutschen) Rechtsprechung entwickelten Krite-
rien und unbenommen der zuvor skizzierten Entwicklungen in anderen Rechtskreisen
hat der deutsche Gesetzgeber das Institut des Wegfalls (oder Störung) der Geschäfts-
grundlage im Rahmen der Schuldrechtsmodernisierung zum 1. Januar 2002 übernom-
men und durch Schaffung des § 313 BGB positivrechtlich geregelt.
An Bedeutung hat dieses Institut in jüngster Vergangenheit im Zusammenhang mit der
Verbreitung des SARS-CoV-2 (Coronavirus) gewonnen, weil die Pandemie15 weite
Teile der Bevölkerung auch über die Grenzen hinweg erfasst und die Gesellschaft als
Ganzes betrifft. Die Geschäftsgrundlage zahlreicher Verträge,16 insbesondere aus den
Bereichen Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten,17 Reisen,18 Gewerberaummiete19
oder Liefer- und Vertriebsbeziehungen,20 war infolge gesetzlicher bzw. behördlich an-
geordneter Schließungen und Untersagungen gestört. Insofern wird auch von einer
‚großen Geschäftsgrundlage‘ gesprochen, weil Umstände wie beispielsweise die
15
Am 11. März 2020 erklärte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die epidemische Verbreitung
des Virus offiziell zu einer weltweiten Pandemie (siehe unter https://www.who.int/emergencies/dise-
ases/novel-coronavirus-2019 – zuletzt aufgerufen am 11.08.2022).
16
Darunter z. B. auch Heimverträge (vgl. hierzu BGH, Beschl. v. 28.04.2022 – III ZR 240/21 = Presse-
mitteilung Nr. 078/2022 v. 01.06.2022 zur Kürzung des Heimentgelts bei coronabedingten Besuchs-
und Ausgangsbeschränkungen).
17
Beispiele: Großmann L. & Deranco D., in COVuR 2021 S. 263, zur Rückabwicklung des Ticketver-
kaufs von pandemiebedingt ausgefallenen Konzertveranstaltungen und Fußballspielen; BGH, Urt. v.
02.03.2022 – XII ZR 36/21 = RA 2022 S. 225–232 zur Rückzahlung des an den Gastwirt geleisteten
Entgelts für eine pandemiebedingt ausgefallene Hochzeitsfeier; Golbs U., in ZAP 2022 S. 185–190 zur
Verlängerung oder Beendigung von Fitnessstudioverträgen nach coronabedingter Schließung; hierzu
auch BGH, Urt. v. 04.05.2022 – XII ZR 64/21 = Pressemitteilung Nr. 056/2022 v. 04.05.2022 = BeckRS
2022, 9338 (Zahlungspflicht bei coronabedingter Schließung eines Fitnessstudios).
18
Vgl. Wolframm A., in RRa 2021 S. 259–266 zum interessengerechten Umgang mit Störungen im
Zusammenhang mit einem Beherbergungsvertrag in der Coronapandemie.
19
Siehe nur BGH, Urt. v. 12.01.2022 – XII ZR 8/21 = JZ 2022 S. 303–309 (mit Anmerkungen Finken-
auer T. & Stahl G., in JZ 2022 S. 309 ff.) = NJW 2022 S. 1370–1377 = Stürner M., in Jura 2022 S. 647
sowie BGH, Urt. v. 16.02.2022 – XII ZR 17.21 = NJW 2022 S. 1378–1381 = JuS 2022 S. 540 f. (mit
Anmerkungen von Arnold S.) sowie KG, Urt. v. 25.04.2022 – 8 U 158/21 = BeckRS 2022, 9023 zur
Anpassung des Mietzinses gewerblich genutzter Räume wegen hoheitlicher Geschäftsschließung zur
Bekämpfung der COVID-19-Pandemie – siehe hierzu auch Börstinghaus U., GmbHR 2022 R68 ff.;
Klein T., in BB 2021 S. 962–972; Kluth P. & Freigang J., in NZM 2006 S. 41–47; Saxinger A., in ZMR
2020 S. 1002–1009; Schmitt Ch., in NZI 2022 S. 159–162; Sittner S., in NJW 2020 S. 1169; ders., in
NJW 2022 S. 1349–1353.
20
Beispiele: Goßler J., in RAW 2021 S. 21–25 zur Anwendung des Instituts bei außergewöhnlich plötz-
lichen, starken und allgemeinen Verknappungen der Verfügbarkeit von bestimmten Produkten in Lie-
ferkettenbeziehungen; Schmidt P., in TranspR 2022 S. 10–16 zu pandemiebedingten Ablieferungshin-
dernissen im nationalen Warentransport; Thume K.-H., in BB 2020 S. 1419–1425 zu Auswirkungen der
COVID-19-Pandemie auf nationale und grenzüberschreitende Vertriebsverträge, insbesondere wenn
Vertragsgüter wegen behördlich angeordneter Schließungen von Geschäftslokalen, Gaststätten usw.
weder abgenommen noch weiter verkauft werden können; BMWK, Hinweise zum Umgang mit Preis-
steigerungen in der öffentlichen Auftragsvergabe (Liefer- und Dienstleistungen) vor dem schicksalhaft
vergleichbaren Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine vom 24. Juni 2022 (Az.: IB6
– 20606-001), Seite 3: „Muss ein Unternehmer wegen coronabedingten Preissteigerungen angesichts
des Pandemiegeschehens und der damit einhergehenden weltweiten Maßnahmen höhere Einkaufspreise
zahlen als mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns im Zeitpunkt des Vertragsschlusses vorher-
zusehen war, […] hat das Unternehmen einen Anspruch auf Anpassung der Preise für die betroffenen
Positionen.“
3Coronapandemie, aber auch Natur-/Umweltkatastrophen, Kriegseinflüsse, Terrorge-
fahren, Geldwertschwund, technische Katastrophen sowie Sozialkatastrophen und At-
tacken im Cyberraum über das Vertragsverhältnis im konkreten Fall hinauswirken und
auch keiner Risikosphäre einer Vertragspartei zugeordnet werden können.21 Demge-
genüber – für die gegenständliche Untersuchung aber nicht von Interesse – wird von
einer ‚kleinen Geschäftsgrundlage‘ in allen übrigen Fällen gesprochen, wenn es also
‚nur‘ um die den jeweiligen Vertrag betreffenden Umstände geht.22
Obwohl in Deutschland das Institut des Wegfalls der Geschäftsgrundlage nunmehr in
§ 313 BGB normiert ist, sind dessen Voraussetzungen im Einzelnen strittig. So ist bei-
spielsweise unter dem Aspekt der Subsidiarität oftmals unklar, ob und inwieweit wel-
che vorrangigen gesetzlichen Sonderregelungen und vertraglichen Vereinbarungen
aufgrund des Pandemiegeschehens zur Anwendung gelangen.
Von einzelnen Problemen innerhalb des geregelten Instituts mit besonderem Blick auf
die Coronapandemie abgesehen liegt gleichwohl die umfassendste Konzeption dem
deutschen Recht zugrunde, das unter Wegfall der Geschäftsgrundlage sowohl die sub-
jektiven Fehlvorstellungen bei Vertragsschluss als auch die nachträglichen Vertrags-
störungen erfasst.23
Zwar hat die historisch interessante und dogmatisch attraktive Lehre von der Ge-
schäftsgrundlage auch im Ausland eine breite wissenschaftliche Beachtung gefunden,
dennoch reicht die Spannweite der gelebten Rechtspraxis vom Extrem der Unbeacht-
lichkeit verändernder Umstände bis hin zur vergleichbar umfassenden Konzeption,
wie sie in Deutschland besteht. Fraglich ist insofern, auf welche Weise andere Staaten,
welche das Institut des Wegfalls der Geschäftsgrundlage nicht (oder nicht so umfas-
send) normiert haben, mit den durch die Verbreitung des SARS-CoV-2 geänderten
Verhältnisse umgehen und wie sie einen Kompromiss zwischen dem Prinzip der Ver-
tragstreue und der Vermeidung pandemiebedingter extremer Unzumutbarkeitssituati-
onen herzustellen versuchen.
21
Siehe beispielsweise Finkenauer: in: MüKo-BGB (9. Auflage 2022) § 313 Rn. 17 ff.; LG Heidelberg,
Urt. v. 30.07.2020 – 5 O 66/20, Rn. 49 m. w. N. = ZMR 2021 S. 44–47.
22
LG Heidelberg, Urt. v. 30.07.2020 – 5 O 66/20, Rn. 49 m. w. N. = ZMR 2021 S. 44–47; Schmidt R.,
SchuldR AT (14. Auflage 2022) Rn. 785 jeweils mit Beispielen.
23
Vgl. nur BT-Drucksache 14 / 4060, S. 174 ff. zu § 313 BGB.
4II. Deskription des Dissertationsvorhabens und Forschungsfragen
Die Thematik rund um die Geschäftsgrundlage reicht weit zurück. Da eine tiefe Aus-
einandersetzung mit dem Wegfall der Geschäftsgrundlage ohne das Begreifen ihres
Ursprungs, der bereits erwähnten clausula rebus sic stantibus, weder zweckmäßig
noch möglich erscheint, wird als Einführung deren historische Entwicklung – von den
Ursprüngen bis hin zur positiven Normsetzung im Zusammenhang mit der Schuld-
rechtsmodernisierung 200124 – dargelegt. Damit soll aufgezeigt werden, wo der Ur-
sprung der Doktrin und der Geschäftsgrundlagenlehre herrührt und wo es bereits in
vergangenen Jahren, auch in der Zeit nach 2001, Kritikpunkte gegeben hat.
Im Kontext der deutschen Normierungsbestrebungen dieses Rechtsinstituts25 werden
sodann dessen einzelne Tatbestandsvoraussetzungen26 mit besonderem Blick auf die
facettenreichen Herausforderungen, welche die COVID-19-Pandemie dem Gemein-
wesen bereitet, zu untersuchen sein. Im Fokus steht hierbei die Frage, ob und inwie-
weit gerade Nutzungs- und Leistungsaustauschverhältnisse betroffen sind und auf wel-
che Weise das Institut des Wegfalls der Geschäftsgrundlage einen Beitrag zur Gerech-
tigkeit leisten kann, wobei es insbesondere eingehender Auseinandersetzungen mit
vorrangigen Regelungen bedarf,27 die unabhängig vom Pandemiegeschehen bestehen,
und auch solchen, die erst anlässlich dieser weltweiten Katastrophe geschaffen und
stetig angepasst werden mussten. Den Abschluss der Betrachtung aus rein nationaler
Perspektive bilden Rechtsfolgen und prozessuale Bezüge.28
Dem Wortlaut nach vermittelt § 313 Abs. 1 BGB – von den diesbezüglich subsidiären
Beendigungsrechten wie Rücktritt (§ 313 Abs. 3 Satz 1 BGB) und Kündigung (§ 313
Abs. 3 Satz 2 BGB) einmal abgesehen29 – lediglich einen Anspruch auf Anpassung
des Vertrages wegen Äquivalenzstörung, während es den Betroffenen aber vornehm-
lich auf Unmittelbarkeit daraus resultierender Leistungen geht, also z. B. auf die Rück-
zahlung überobligatorisch geleisteter Zinsen ankommt. Der BGH hat schon recht früh
entschieden, dass eine lediglich auf Zustimmung zu einer entsprechenden Vertragsän-
derung gerichteten Klage nicht nur nicht erforderlich sei, sondern vielmehr für eine
24
Siehe hierzu auch Feldhahn P., in NJW 2005 S. 3381 ff.; Janda C., in NJ 2013 S. 1–10.
25
Vgl. Janda C., in NJ 2013 S. 1–10; Lejeune M., in ITRB 2020 S. 117–123; Lorenz D., in DVBl 1997
S. 865–893.
26
Vgl. Riesenhuber K. & Domröse R., in JuS 2006 S. 208–213; Rösler H., in JuS 2004 S. 1058 ff.
27
So auch Feldhahn P., in NJW 2005 S. 3381 ff.; Klimesch M. & Walther A., in ZMR 2020 S. 556 ff.
28
Siehe nur Schmidt-Kessel M. & Baldus Ch., in NJW 2002 S. 2076 ff.
29
Siehe hierzu auch Loyal F., in NJW 2013 S. 417–422.
5solche Klage das Rechtsschutzbedürfnis fehle.30 Doch gelte jene Prämisse uneinge-
schränkt für alle Konstellationen, würde dies der Vielgestaltigkeit heutiger Vertrags-
verhältnisse und damit einhergehender Interessen der Vertragsparteien womöglich
nicht gerecht werden, weshalb eine tiefergehende Rechtsfolgenbetrachtung unerläss-
lich ist.
Einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit stellt die rechtsvergleichende Betrachtung
dar.31 Hierbei wird in Vergleich zur deutschen Dogmatik beispielhaft die Jurisprudenz
in den Ländern Frankreich, Italien, Schweiz, England und Österreich untersucht.
Frankreich: Das französische Recht hält nach wie vor strikt an der Bindung des Ver-
trages fest.32 Die Berücksichtigung unvorhergesehener Ereignisse (sog. imprévision)
wird im Bereich des Privatrechts abgelehnt.33 Die in Art. 1103 Code civil (neue Fas-
sung) enthaltende force obligatoire du contrat34 ist damit absolut. Im französischen
Verwaltungsrecht ist das anders, denn die imprévision wird in diesem Rechtsteil
höchstrichterlich anerkannt, und zwar ausgehend von einem Fall, in dem eine Ver-
tragsanpassung die öffentliche Grundversorgung rettete.35
Italien: Das italienische Recht verknüpft mit Art. 1467 Abs. 3 Codice civile von 1942
im Fall ‚übermäßiger‘, insbesondere unvorhersehbarer Leistungserschwerung (sog.
eccessiva onerosità) zum einen die Neuverhandlung und zum anderen die Vertrags-
kontrolle. Dem Vertragspartner ist es danach möglich, das Recht auf Aufhebung des
Vertrages der anderen (benachteiligten) Partei durch Unterbreiten eines Angebotes zur
Änderung der Vertragsbedingungen abzuwenden. Überdies ist das italienische Recht
gegenüber Eingriffen in die Vertragsgestaltung äußerst zurückhaltend, denn außerhalb
von Art. 1467 und Art. 1468 Codice civile gibt es keine Anpassung, sondern nur eine
Auflösung.36
30
BGH, Urt. v. 30.03.1984 – V ZR 119/83 = BGHZ 91 S. 32 (36), Rn. 20 m. w. N.: Bei einer Anpassung
wegen Äquivalenzstörung, also wegen einer Änderung der Geschäftsgrundlage, kann unmittelbar auf
die danach geschuldete Leistung (im gegenständlichen Fall auf Zahlung des erhöhten Erbbauzinses)
geklagt werden. Eine lediglich auf Zustimmung zu einer entsprechenden Vertragsänderung gerichtete
Klage ist daher nicht nur nicht erforderlich, vielmehr fehlt für eine solche Klage das Rechtsschutzbe-
dürfnis; siehe hierzu auch BT-Drs. 14/6040, S. 176.
31
Vgl. nur Schwenzer I., in FS Bucher 2009 S. 723–741.
32
Doralt W., RabelsZ 2012 S. 762 ff.
33
Siehe auch die Entscheidung des französischen Kassationshofes in Zivilsachen vom 6. März 1876 =
Cass. civ., 6.3.1876, D 1876 I, S. 93, wo die Anpassung eines 1576 vereinbarten Entgelts abgelehnt
wurde.
34
Art. 1103 CC (vormals Art. 1134 Abs. 1 CC – deutsche Übersetzung): „Gesetzlich geschlossene Ver-
träge treten an die Stelle des Gesetzes für diejenigen, die sie geschlossen haben.“
35
Vgl. Conseil d’État, 30.3.1916, Gaz de Bordeaux, D. 1916. III. 25.
36
Rösler H., Geschäftsgrundlage, unter 3.b).
6Schweiz: In der Schweiz besteht die traditionelle Lösung über das Richterrecht; neben
dieser sog. clausula rebus sic stantibus findet sich im schweizerischen Privatrecht der
Grundlagenirrtum als gesetzlich geregelter Fall der Geschäftsgrundlagenfrage (Art. 24
Abs. 1 Ziff. 4 OR). Im Gegensatz zur umfassenden Regelung des Instituts des Weg-
falls der Geschäftsgrundlage in Deutschland beschränkt sich die clausula nach schwei-
zerischem Recht aber auf Fälle, in welchen die objektive Vertragsgrundlage nach Ver-
tragsschluss entfallen ist. Subjektive Fehlvorstellungen beim Vertragsschluss führen
nur dann zur Vertragsaufhebung, wenn sie die Voraussetzungen des Grundlagenirr-
tums nach Art. 24 Abs. 1 Ziff. 4 OR erfüllen.37 Übereinstimmung besteht zwischen
dem deutschen und schweizerischen Privatrecht insoweit, als die objektive und die
subjektive Geschäftsgrundlage auch in Deutschland unterschieden werden.
England: Im englischen Recht übernimmt die Frustration-Doktrin zwar ansatzweise
Gedanken der Geschäftsgrundlage, allerdings führt eine Störung oder der Wegfall der
Geschäftsgrundlage prinzipiell zur Vertragsbeendigung. Ausgleichsansprüche folgen
sodann dem restitution Act 1943, nach welchem die Kosten und erlangten Vorteile
nach billigem Ermessen geteilt werden; interessanterweise erfasst die frustration auch
Zweckvereitelungen. Europaweite Bekanntheit hat beispielsweise der Fall Krell vs.
Henry (1903) 2 KB 740 (CA) erlangt.38 Dieser sei foundation of the contract gewor-
den, wodurch der ganze Vertrag gegenstandslos wurde. Das englische Recht kombi-
niert also Fälle der Unmöglichkeit und Zweckvereitelung (frustration of purpose)
gleichermaßen in der Frustration-Doktrin.39 Ansonsten werden Abhilfen bei nachträg-
lichen Umstandsänderungen versagt.40
Österreich: In der Alpenrepublik ist das Rechtsinstitut bislang nicht ausdrücklich ge-
regelt, wird aber verschiedentlich angewandt. So ist beispielsweise der Vorwegver-
zicht zur Geltendmachung des Wegfalls der Geschäftsgrundlage zulasten von Ver-
brauchern gemäß §6 Abs. 1 Ziff. 14 Konsumentenschutzgesetz (KSchG)
37
§ 24 OR lautet auszugsweise: „(1) Der Irrtum ist namentlich in folgenden Fällen ein wesentlicher:
[…] 4. wenn der Irrtum einen bestimmten Sachverhalt betraf, der vom Irrenden nach Treu und Glauben
im Geschäftsverkehr als eine notwendige Grundlage des Vertrages betrachtet wurde.“; Vgl. Kramer,
Obligationenrecht. Allgemeiner Teil, 2009, N 296 mit Angaben zum Streitstand hinsichtlich der Ab-
grenzung.
38
Sog. ‚Krönungszugfall‘: Bei diesem Fall ging es um die Anmietung einer Wohnung in der Pall Mall
in London, um von dort aus die Prozession im Zusammenhang mit der Krönung von Edward VII. am
26. und 27. Juni 1902 mitzuerleben. Da die Prozession jedoch (aufgrund des Gesundheitszustands von
Edward VII.) nicht am ursprünglich geplanten Tag stattfand, stritten die Parteien um die Frage, ob
gleichwohl die Miete geschuldet sei.
39
Vgl. auch Davis Contractors Ltd. vs. Fareham U.D.C. (1956) AC 696 (HL).
40
Rösler H., Geschäftsgrundlage, unter 3.a).
7unwirksam.41 Dem Institut des Wegfalls der Geschäftsgrundlage am Beispiel des ös-
terreichischen Bestandsrechts widmet sich aktuell eine dem gegenständlichen Thema
ähnliche Dissertation an der Universität Wien.42
Die den deutschen richterlichen Kompetenzen zur Vertragsanpassung oder -auflösung
vergleichbaren finden sich auch in anderen europäischen Staaten (z. B. Art. 388 des
griechischen Zivilgesetzbuchs von 1946; niederländische Recht bei onvoorziene om-
standigheden, d. h. bei unvorhergesehenen Umständen, siehe hierzu Art. 6:258 des
niederländischen Bürgerlichen Gesetzbuches BW seit 199243). Ähnlich auch im por-
tugiesischen Recht mit Art. 437 Código civil oder nach § 36 des Nordischen Vertrags-
gesetzes, in welchem die Aufhebung und Abänderung wegen ‚Unfairness‘ ermöglicht
wird. Andere Rechtsordnungen haben diese Möglichkeiten gewohnheitsrechtlich an-
erkannt.
Nachdem die Ausprägungen der Geschäftsgrundlagenlehre in den jeweiligen Ländern
aufgearbeitet wurden, bleibt schlussendlich zu untersuchen, auf welche Weise in die-
sen Ländern mit den durch die Verbreitung des SARS-CoV-2 geänderten Umständen
im Vertragsumfeld umzugehen ist und ob bzw. wie sie einen Kompromiss zwischen
dem Prinzip der Vertragstreue und der Vermeidung pandemiebedingter extremer Un-
zumutbarkeitssituationen herzustellen versuchen.
41
§ 6 KSchG lautet auszugsweise: „(1) Für den Verbraucher sind besonders solche Vertragsbestimmun-
gen im Sinn des § 879 ABGB jedenfalls nicht verbindlich, nach denen […] Ziffer 14. das Recht zur
Geltendmachung eines ihm unterlaufenen Irrtums oder des Fehlens oder Wegfalls der Geschäftsgrund-
lage im Vorhinein ausgeschlossen oder eingeschränkt wird, etwa auch durch eine Vereinbarung, wo-
nach Zusagen des Unternehmers nicht die Hauptsache oder eine wesentliche Beschaffenheit derselben
(§ 871 Abs. 1 ABGB) betreffen.“
42
Pranter A.-K., Exposé zur Dissertation mit dem vorläufigen Arbeitstitel „Der Wegfall der Geschäfts-
grundlage am Beispiel des Bestandsrechts“, 2021, Wien (https://ssc-rechtswissenschaften.uni-
vie.ac.at/doktoratphd/dissertationsthemen-und-expose/zivilrecht/ – zuletzt aufgerufen am 11.08.2022).
43
BW = Burgerlijk Wetboek (vgl. https://www.anwaelte-niederlande.de/niederlaendisches-buergerli-
ches-gesetzbuch/, zuletzt abgerufen am 11.08.2022).
8III. Methoden
Eingangs wird ein Umriss der Entstehung und Entwicklung des Rechtsinstituts des
Wegfalls der Geschäftsgrundlage anhand einer Literatur- und Quellenanalyse darge-
legt. Anhand einer umfangreichen Gesetzesexegese, Literatur- und Rechtsprechungs-
analyse auch unter Rückgriff auf die vor allem vor der Schuldrechtsreform 2001 auf
Grundlage des Grundsatzes von Treu und Glauben (§ 242 BGB) besonders wesentlich
erscheinende Judikatur soll eine Systematisierung der Tatbestandsvoraussetzungen
mit Blick auf das COVID-19-Pandemiegeschehen erarbeitet werden. Gleiches gilt für
die Rechtsfolgen und die prozessuale Behandlung des Instituts. Rechtsvergleiche zwi-
schen der deutschen und ausgewählten ausländischen Rechtslage sowie Unterschiede
im Umgang mit den pandemiebedingten Veränderungen auf nahezu alle Vertragsver-
hältnisse werden anschließend anhand einer umfassenden Literatur- und Rechtspre-
chungsrecherche systematisiert dargestellt.
9IV. Vorläufige Gliederung
A) Einleitung
B) Die Geschäftsgrundlage in ihrer Historie
C) Die Normierung im deutschen Recht
I. Tatbestand
1. Objektive und subjektive Geschäftsgrundlage
2. Unvorhersehbarkeit
3. Sphärenfremdheit
4. Die Typizität
5. Äquivalenzstörungen
6. Subsidiarität
II. Rechtsfolgen
1. Anpassung
2. Beendigung/Aufhebung
III. Prozessuale Behandlung
D) Die Geschäftsgrundlage im Rechtsvergleich
I. Frankreich
II. Italien
III. Schweiz
IV. England
V. Österreich
VI. Andere Staaten
E) Anwendung des Instituts bei aktuellen Themen in der COVID-19-Pande-
mie
I. Gestörte Nutzung
1. Nach deutschem Recht
2. Nach französischem, italienischem, schweizerischem, engli-
schem und österreichischem Recht
II. Äquivalenzstörung bei Austauschverträgen
1. Nach deutschem Recht
2. Nach französischem, italienischem, schweizerischem, engli-
schem und österreichischem Recht
F) Beantwortung der Forschungsfragen und Conclusio
10Vorläufiges Literaturverzeichnis
Anzinger, Heribert & Stahl, Christian, „Landlords will take it easy“ – Auswirkungen
der Corona-Pandemie auf gewerbliche Miet- und Pachtverträge, ZIP 2020 S. 1833
Armbrüster, Christian & Prill, Jonathan, Schuldverträge in Zeiten der Corona-Pande-
mie, JuS 2020 S. 1144
Baier, Klaus-Georg, Die Störung der Geschäftsgrundlage im Recht der Personenge-
sellschaften, NZG 2004 S. 356
Beyer, Yvonne & Hoffmann, Philipp, COVID-19 als Act of God/Force Majeure/Hö-
here Gewalt? – Rechtliche Implikationen der Corona-Krise auf bestehende Verträge,
insbesondere Liefer- und VOB/B-Bauverträge, NJOZ 2020 S. 609
Beyer, Yvonne & Hoffmann, Philipp, Delta, Omikron und weiterhin COVID-19 – Still
(an) Act of God/Force Majeure/Höhere Gewalt, NJOZ 2022 S. 161
BGH, Urt. v. 02.03.2022 – XII ZR 36.21 = NJW 2022 S. 1382–1386 (Die verlegbare
Hochzeitsfeier der schon länger Verheirateten – Pandemiemiete III)
BGH, Urt. v. 04.05.2022 – XII ZR 64/21 = Pressemitteilung Nr. 056/2022 v.
04.05.2022 = BeckRS 2022, 9338 (Zahlungspflicht bei coronabedingter Schließung
eines Fitnessstudios)
BGH, Urt. v. 12.01.2022 – XII ZR 8/21 = NJW 2022 S. 1370–1377 (Pandemiemiete –
Ein Fall der Störung der Geschäftsgrundlage)
BGH, Urt. v. 16.02.2022 – XII ZR 17.21 = NJW 2022 S. 1378–1381 (Grundsätze des
Urkundenprozesses – Pandemiemiete II)
Bork, Daniel, Coronabedingte Geschäftsschließung – Anpassung der Miete wegen
Wegfalls der Geschäftsgrundlage (Anmerkungen zu BGH, Urt. v. 12.01.2022 – XII
ZR 8/21), BB 2022 S. 332
Börstinghaus, Ulf, Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Gewerberaummiet-
verhältnisse, GmbHR 2022 S. R68–R70
Brand, Oliver u. a., Wegfall der Geschäftsgrundlage, in: Philipp Fischinger & Jan F.
Orth, COVID-19 und Sport – Verträge und Regelwerke krisenfest gestalten (1. Auf-
lage 2021)
11Brinkmann, Moritz & Thüsing, Gregor, Pandemiefolgen in der Gewerberaummiete:
Geschäftsgrundlage, Vermutung, Risikozuweisung und Verfahrensbeschleunigung,
NZM 2021 S. 5
Butenberg, Henrike, Drasdo, Michael, Först, Wiebke, Hannemann, Thomas & Heil-
mann, Beate, Anwaltsantworten in der „Corona-Krise“, NZM 2020 S. 493
Deshayes, Béatrice & Barsan, Iris, Das neue französische Vertragsrecht, IWRZ 2017
S. 62
Doralt, Walter, Der Wegfall der Geschäftsgrundlage – Altes und neues zur théorie de
l´imprévision in Frankreich, RabelsZ 2012 S. 762
Draßbach, Christopher & Bayrak, Orhan, Corona-Krise und vertragliche Risikover-
teilung, NJ 2020 S. 185
Drechsler, Jannes & Harenberg, Paul, Stadionbesuch mit Hürden – von Wertpapieren
und Viren, JA 2020 S. 659
Eidenmüller, Horst, Neuverhandlungspflichten bei Wegfall der Geschäftsgrundlage,
ZIP 1995 S. 1063
Ekkenga, Jens & Schirrmacher, Carsten, Auswirkungen der COVID-19-Katastrophe
auf die Zahlungspflichten gewerblicher Mieter und Pächter, NZM 2020 S. 410
Feldhahn, Peer, Die Störung der Geschäftsgrundlage im System des reformierten
Schuldrechts, NJW 2005 S. 3381–3383
Feldhaus, Heiner, Gestaltung von Unternehmenskaufverträgen in Zeiten von Corona,
BB 2020 S. 1546
Golbs, Ulrike, Verlängerung oder Beendigung von Fitnessstudioverträgen nach
coronabedingter Schließung, ZAP 2022 S. 185–190
Goßler, Janik, Auswirkung der Covid-19-Pandemie auf Lieferketten in der Automo-
bilindustrie im Kontext von Force Majeure und höherer Gewalt, RAW 2021 S. 21–25
Großmann, Lars & Deranco, Daniel, I want my money back – Ein Beitrag zur Rück-
abwicklung des Veranstaltungsbesuchs, COVuR 2021 S. 263
12Günther, Dirk-Carsten & Piontek, Sascha, Die Auswirkungen der „Corona-Krise“ auf
das Versicherungsrecht – Eine erste Bestandsaufnahme, r+s 2020 S. 242
Haberland, Annett, Kreikebohm, Ralf & Rauls, Henning, Keine wirtschaftliche Not-
lage in Corona-Zeiten? – Ein Regelungsdefizit in der betrieblichen Altersversorgung,
RdA 2021 S. 16
Häublein, Martin & Müller, Maximilian, Wer trägt das Pandemierisiko in der Ge-
schäftsraummiete?, NZM 2020 S. 481
Heller, Jan, Pacta sunt servanda – gilt dieser Grundsatz auch für die Miete in Zeiten
der COVID-Pandemie?, NJOZ 2020 S. 769
Herlitz, Carsten, Neuregelung der Anwendbarkeit der Regelungen zum Wegfall der
Geschäftsgrundlage bei Gewerbe im Zusammenhang mit Covid-19, NJ 2021 S. 56
Herrlein, Jürgen, Gewerberaummietrecht im Spiegel der NZM-Jahre 1998–2021,
NZM 2022 S. 19
Janda, Constanze, Störung der Geschäftsgrundlage und Anpassung des Vertrages, NJ
2013 S. 1–10
Jung, Stefanie, Coronabedingte Schließungen während des ersten Lockdowns – Be-
währungsprobe für die Störung der großen Geschäftsgrundlage, DStR 2022 S. 560
Klein, Christian, Arbeitsrechtliche Problem- und Fragestellungen der Corona-Pande-
mie, NJ 2020 S. 377
Klein, Thomas, Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Gewerberaummiete
– eine Klarstellung durch den Gesetzgeber, BB 2021 S. 962–972
Klimesch, Martin & Walther, Alexander, Kein Wegfall der Geschäftsgrundlage
(WGG) nach dem COVID-19-Pandemie-Gesetz, ZMR 2020 S. 556–558
Kluth, Peter & Freigang, Jan, Wirtschaftliches Risiko und Äquivalenzstörung – Zum
Wegfall der Geschäftsgrundlage bei langfristigen Gewerberaummietverträgen, NZM
2006 S. 41–47
Krepold, Hans-Michael, Gewerbemietverträge in Zeiten der Corona-Pandemie, WM
2020 S. 726
13Kumkar, Lea Katharina & Voß, Wiebke, COVID-19 und das Institut der Geschäfts-
grundlage, ZIP 2020 S. 893
Lejeune, Mathias, Force Majeure-Klauseln und Leistungsstörungen bedingt durch das
Corona-Virus, ITRB 2020 S. 117–123
Leo, Ulrich & Götz, Emanuel, Fälle und Lösungen zum Schicksal der Mietzahlungs-
pflicht des Gewerberaummieters in COVID-19-Zeiten, NZM 2020 S. 402
Leo, Ulrich, Obergerichtliche Rechtsprechung zur Gewerberaummiete im Jahr 2021,
NZM 2022 S. 65
Leo, Ulrich, Pandemischer Lockdown im Gewerberaummietverhältnis als Störung der
Geschäftsgrundlage: Ein großes Missverständnis?, NZM 2021 S. 249
LG Köln, Urt. v. 22.12.2021 – 15 O 201/21 (Vertragsanpassung nach Wegfall der Ge-
schäftsgrundlage) = NJOZ 2022 S. 432
Lorenz, Dieter, Der Wegfall der Geschäftsgrundlage beim verwaltungsrechtlichen
Vertrag, DVBl 1997 S. 865–893
Lorenz, Stephan, Störung der Geschäftsgrundlage (§ 313 BGB), in: Hubert Schmidt
(Hrsg.), COVID-19 – Rechtsfragen zur Corona-Krise (3. Auflage 2021), § 1 Rn. 29–
32e
Loyal, Florian, Vertragsaufhebung wegen Störung der Geschäftsgrundlage, NJW
2013 S. 417–422
Mann, Marius, Schenn, Ute & Baisch, Benjamin, Störung der Geschäftsgrundlage und
COVID-19, in: Vertrieb von Waren und Dienstleistungen in Zeiten von Corona – Ein
Rechtsleitfaden zu COVID-19-bedingten Vertragsstörungen (1. Auflage 2020)
Mock, Sebastian, Gesellschafterdarlehen in Zeiten von Corona, NZG 2020 S. 505
Oertmann, Paul, Die Geschäftsgrundlage: Ein neuer Rechtsbegriff, Leipzig, 1921
Otte-Gräbener, Sabine, Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf Lieferverträge,
GWR 2020 S. 147
14Prütting, Jens, Wegfall der Geschäftsgrundlage als Antwort des Zivilrechts auf kri-
senbedingte Vertragsstörungen? – Systemerwägungen zu § 313 BGB und sachgerech-
ter Einsatz in der Praxis (2020)
Prütting, Jens, Wegfall der Geschäftsgrundlage als Antwort des Zivilrechts auf kri-
senbedingte Vertragsstörungen – Systemerwägungen zu § 313 BGB und sachgerech-
ter Einsatz in der Praxis (2020)
Quass, Guido, Die Nutzungsstörung – Zur Problematik der Störung des Verwendungs-
zwecks und des Wegfalls der Geschäftsgrundlage, Berlin, 2003
Reinicke, Dietrich & Tiedtke, Klaus, Bürgschaft und Wegfall der Geschäftsgrundlage,
NJW 1995 S. 1449
Riehm, Thomas & Thomas, Quirin, Das Leistungsstörungsrecht und seine Grenzen in
Zeiten von COVID-19, Jura 2020 S. 1046
Riesenhuber, Karl & Domröse, Ronni, Der Tatbestand der Geschäftsgrundlagenstö-
rung in § 313 BGB – Dogmatik und Falllösungstechnik, JuS 2006 S. 208–213
Römermann, Volker, Mietminderung und Wegfall der Geschäftsgrundlage im gewerb-
lichen Mietverhältnis, in: Erste Hilfe für Selbstständige und Unternehmer in Zeiten
von Corona (1. Auflage 2020)
Römermann, Volker, Mietrechtliche „Blitzgesetzgebung“ in Pandemiezeiten, NJW
2021 S. 265
Rösler, Hannes, Die nachträgliche Zuweisung von Vertragsrisiken durch die Lehre
von der Geschäftsgrundlage, JA 2001 S. 215
Rösler, Hannes, Geschäftsgrundlage, unter https://hwb-eup2009.mpipriv.de/in-
dex.php/Gesch%C3%A4ftsgrundlage (zuletzt abgerufen am 11.08.2022)
Rösler, Hannes, Grundfälle zur Störung der Geschäftsgrundlage, JuS 2004 S. 1058 ff.
Rösler, Hannes, Grundfälle zur Störung der Geschäftsgrundlage, JuS 2005 S. 27
Säcker, Franz Jürgen & Schubert, Claudia, Leistungsstörungen bei langfristigen Nut-
zungsverträgen durch hoheitliche Erfüllungshindernisse, BB 2020 S. 2563
15Saxinger, Andreas, Mietminderungen und Vertragsanpassungen im Gewerbemietrecht
in Corona-Zeiten, ZMR 2020 S. 1002–1009
Schall, Alexander, Corona-Krise: Unmöglichkeit und Wegfall der Geschäftsgrundlage
bei gewerblichen Miet- und Pachtverträgen, JZ 2020 S. 388
Schmeisser, Fabian & Fauth, Magdalena, Kurzarbeit in Zeiten der Corona-Krise,
COVuR 2020 S. 363
Schmidt, Andrea, 1. Corona-Krise und Vertragsrecht
2. Corona-Krise und Mietrecht
3. Corona-Krise und Darlehensrecht
4. Corona-Krise und Reiserecht
allesamt in Weber Rechtswörterbuch (27. Edition 2021)
Schmidt, Patrick, Corona, die frachtrechtlichen Risikobereiche und die Geschäfts-
grundlage, TranspR 2022 S. 10–16
Schmidt-Kessel, Martin & Baldus, Christian, Prozessuale Behandlung des Wegfalls
der Geschäftsgrundlage nach neuem Recht, NJW 2002 S. 2076–2078
Schmitt, Christian, Mietreduktion wegen coronabedingter Geschäftsschließung – An-
merkungen aus Sicht eines Insolvenzpraktikers, NZI 2022 S. 159–162
Schmitt, Christian, Mietreduktion wegen coronabedingter Geschäftsschließung – An-
merkungen aus Sicht eines Insolvenzpraktikers, NZI 2022 S. 183
Schwemmer, Sophia, Geschäftsraummiete in Zeiten der Pandemie: Eine Frage des Ein-
zelfalls, ZIP 2022 S. 193
Schwenzer, Ingeborg, Die clausula und das CISG, FS Bucher 2009 S. 723–741
Sittner, Silvio, Mietrecht und Covid-19 - Update des BGH, NJW 2022 S. 1349–1353
Sittner, Silvio, Mietrechtspraxis unter Covid-19, NJW 2020 S. 1169
Spickhoff, Andreas, Die Entwicklung des Arztrechts 2020/2021, NJW 2021 S. 1713
Steinbrück, Ben, Zeyher, Stefan & Liebscher, Thomas, Recht der Leistungsstörungen
im Lichte der COVID-19-Pandemie, ZIP 2020 S. 852
16Strake, Martin, Coronavirus-Krise und Gewerbemietzins, ZfIR 2020 S. 361
Streyl, Elmar, Pandemiebedingte Risikotragung im Mietverhältnis, NZM 2020 S. 817
Thume, Karl-Heinz, Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf nationale und grenz-
überschreitende Vertriebsverträge, BB 2020 S. 1419–1425
Tödtmann, Ulrich & von Bockelmann, Eler, Wegfall der Geschäftsgrundlage – Anpas-
sung des Tarifvertrags nach § 313 Abs. 1 BGB, in: Arbeitsrecht in Not- und Krisen-
zeiten (2. Auflage 2021), Rn. 251–258
Tomic, Alexander, Auswirkungen von Corona – Pandemiebedingte Risikoanalyse und
Neubewertung im privaten Baurecht, ZfBR 2020 S. 419
Tonner, Klaus, COVID-19 und Reisegutscheine, MDR 2020 S. 1032
Tschäpe, Philip, Werkvertraglicher Regelungsbedarf nach Ausbruch der Corona-Pan-
demie, ZfBR 2020 S. 438
Walther, Alexander & Klimesch, Martin, Kein Wegfall der Geschäftsgrundlage
(WGG) nach dem COVID-19-Pandemie-Gesetz, ZMR 2020 S. 556
Warmuth, Cara, § 313 BGB in Zeiten der Corona-Krise – am Beispiel der Gewerbe-
raummiete, COVuR 2020 S. 16
Weiser, Lukas, Das Coronavirus und seine Auswirkungen auf den Bauablauf, NZBau
2020 S. 203
Weller Marc-Philippe & Schwemmer, Sophia, Veranstaltungsabsagen und ihre Folgen
für Besucher und Dienstleister, NJW 2020 S. 2985
Weller, Marc-Philippe, Lieberknecht Markus & Habrich, Victor, Virulente Leistungs-
störungen – Auswirkungen der Corona-Krise auf die Vertragsdurchführung, NJW
2020 S. 1017
Wieling, Hans, Wegfall der Geschäftsgrundlage bei Revolutionen, JuS 1986 S. 272
Woitkewitsch, Christopher, Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf zivilrechtliche
Rechtsverhältnisse, NJW 2022 S. 1134
17Wolf, Christian, Eckert, Rainer, Denz, Christan, Gerking, Lissa, Holze, Alina, Künnen
Simon & Kurth, Niels, Die zivilrechtlichen Auswirkungen des Covid-19-Gesetzes –
ein erster Überblick, JA 2020 S. 401
Wolframm, Alexandra, Das Schicksal des Beherbergungsvertrags in der Corona-Pan-
demie, RRa 2021 S. 259–266
Yushkova, Olga & Stolz, Gerald, Der Wegfall der Geschäftsgrundlage vor und nach
der Schuldrechtsmodernisierung des Jahres 2001, JA 2003 S. 70
Zehelein, Kai, COVID-19 – Miete in Zeiten von Corona (2. Auflage 2021), München
Zehelein, Kai, Infektionsschutzbedingte Schließungsanordnungen in der COVID-19-
Pandemie – Risikoverteilung bei Störung der Geschäftsgrundlage (unter rechtsverglei-
chender Perspektive), NZM 2020 S. 390
Zimmermann, Anton S., Corona-Lockdown bei Gewerbemieten, WM 2021 S. 1781
18Sie können auch lesen