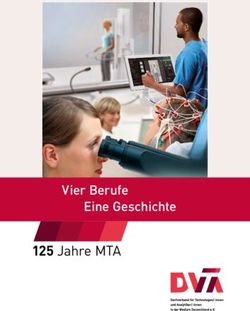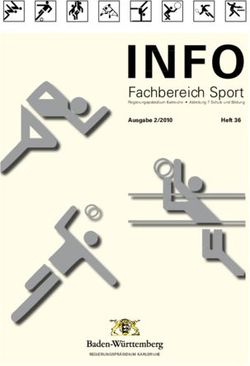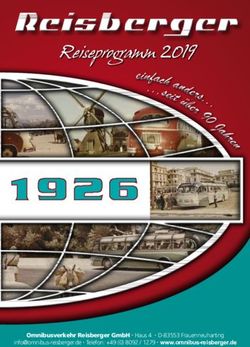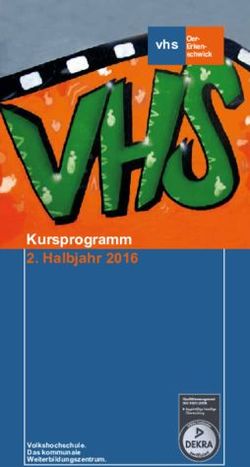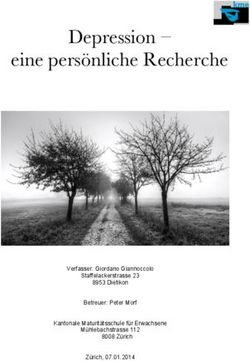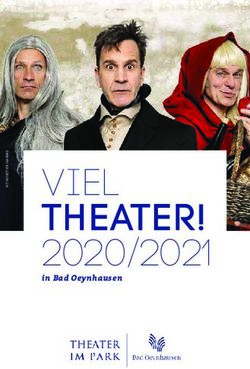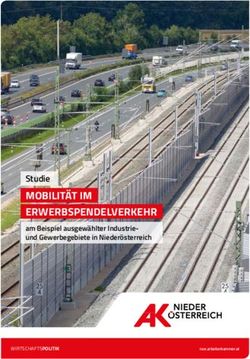Berufsbildende Schulen in Österreich - Eine Informationsbroschüre der Sektion Berufsbildung
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Berufsbildende Schulen in Österreich
Eine Informationsbroschüre der Sektion Berufsbildung
(Berufsbildendes Schulwesen, Erwachsenenbildung und Schulsport)
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
Wien, Jänner 2011Inhaltsverzeichnis
Seite
Vorwort 5
01 Das österreichische Bildungssystem 7
02 Die berufsbildenden Schulen Österreichs 11
03 Berufsschulen 17
04 Technische, gewerbliche und kunstgewerbliche Schulen 21
05 Kaufmännische Schulen 25
06 Humanberufliche Schulen 29
Schulen für wirtschaftliche Berufe
Schulen für Tourismus
Schulen für Mode und Bekleidungstechnik und für künstlerische Gestaltung
Schulen für Sozialberufe
07 Höhere land- und forstwirtschaftliche Schulen 33
08 Abschlüsse und Qualifikationen 35
09 Bildungsstandards in der Berufsbildung 39
Lernergebnis- und kompetenzorientierte Lehrpläne in der Berufsbildung
10 QualitätsInitiative BerufsBildung – QIBB 41
11 Going International 43
12 Informationstechnologien im berufsbildenden Schulwesen 49
13 Entrepreneurship und Übungsfirmen 53
14 Aus-, Fort- und Weiterbildung für Lehrer/innen 57
an berufsbildenden Schulen
15 Erwachsenenbildung 61
16 Bewegung und Sport 65
17 Glossar 69Vorwort
Die Tradition der berufsbildenden Schulen in Österreich reicht bis ins 19. Jahrhundert zurück.
Seither wurde höchst erfolgreich am kontinuierlichen Ausbau und an der Weiterentwicklung
der schulischen beruflichen Bildung gearbeitet.
Das österreichische Schulsystem und die vielfältigen Angebote, speziell im berufsbildenden
Bereich, ermöglichen unseren Schülerinnen und Schülern eine hochwertige, qualitäts-
orientierte und in ganz Europa anerkannte Ausbildung.
Jugendliche legen damit die Basis für einen erfolgreichen Start ins berufliche Leben und ver-
fügen auch international über gute Karrierechancen.
Mehr als 80 Prozent der österreichischen Schülerinnen und Schüler lernen in einer beruflichen
Erstausbildung. Das beweist die Attraktivität der berufsbildenden Schulen und der Lehrlings-
ausbildung in Österreich.
In der vorliegenden Broschüre werden die einzelnen Schultypen innerhalb des berufsbildenden
Schulsystems dargestellt, innovative, zukunftsorientierte Bildungsthemen sowie die berufliche
Weiterentwicklung, das lebenslange Lernen in der Erwachsenenbildung angesprochen.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Sektion Berufsbildung im Bundesministerium für
Unterricht, Kunst und Kultur leisten mit hohem Engagement konsequente Arbeit für die
Weiterentwicklung und Internationalisierung der berufsbildenden Schulen. Sie sind sich der
Verantwortung bewusst, gemeinsam mit allen am Schulprozess Beteiligten die hohe Qualität
der berufsbildenden Schulen sicher zu stellen.
Dr. Claudia Schmied
Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur01 Das österreichische Bildungssystem
(Vereinfachte Darstellung)
Seite 7Bundesministerium für Unterricht,
Kunst und Kultur
BUNDESMINISTERIN
Dr. Claudia Schmied
Büro der Frau Bundesministerin
Generalsekretär
Internationale Angelegenheiten
Stabstelle Südosteuropa
Interne Revision
Bereich Informationstechnologie; Bildungsstatistik; Gender
Präsidialsektion
Organisationsangelegenheiten der Zentralstelle
Budget
Raum
Öffentlichkeitsarbeit
Approbation von Unterrichtsmitteln
Zentrale Förderkoordination
Sektion I
Allgemein bildendes Schulwesen
Qualitätsentwicklung und –sicherung
Pädagogische Hochschulen
Sektion II
Berufsbildendes Schulwesen
Erwachsenenbildung
Schulsport
Sektion III
Personal- und Schulmanagement
Recht und Legistik
Sektion IV
Kultur
Sektion V
Kunstangelegenheiten
Seite 8SEKTION II
Berufsbildendes Schulwesen, Erwachsenenbildung, Schulsport
Sektionschef Mag. Theodor Siegl
● Grundsatzfragen der beruflichen Bildung
● nationale und internationale bildungspolitische Strategien
● Planungs- und Ausstattungsangelegenheiten
● Gender Mainstreaming
● Kosten- und Leistungsrechnung
● Bildungsstandards
● QIBB
● ESF-Koordination
Abteilung 21: Berufsschulen
● Berufsschulen (duale Bildung) – Pädagogische Angelegenheiten
● Berufsreifeprüfung (gemeinsam mit Abteilung 25) [S]
Abteilung 22: Technische und (kunst)-gewerbliche Schulen
● Technische, gewerbliche und kunstgewerbliche mittlere und höhere Lehranstalten
● Technisch-gewerbliche Zentrallehranstalten
● Versuchsanstalten
Abteilung 23: Kaufmännische Schulen und Bildungsberatung
● Kaufmännische mittlere und höhere Schulen
● Wirtschaftspädagogik und Entrepreneurship [S]
● ACT – die Servicestelle österreichischer Übungsfirmen [S]
● Öffentlichkeitsarbeit [S]
● Aus- und Weiterbildung für Bildungsberater/innen und Bildungsberatung [S]
Abteilung 24: Humanberufliche Schulen, Höhere land- und forstwirtschaftliche Schulen
● Mittlere und höhere Schulen für wirtschaftliche Berufe, Tourismus, Mode, Höhere Schulen für
künstlerische Gestaltung
● Höhere land- und forstwirtschaftliche Schulen
● Schulen für Sozialberufe und Sozialbetreuungsberufe
● Allgemeine Sprachausbildung [S]
Abteilung 25: Erwachsenenbildung
● Erwachsenenbildung
● Nachholen von Bildungsabschlüssen
● Berufsreifeprüfung (gemeinsam mit Abteilung 21) [S]
● Bundesinstitut für Erwachsenenbildung
Seite 9Abteilung 26: Lehrer/innenaus-, -fort- und weiterbildung für berufsbildende Schulen,
Daten der Berufsbildung [S]
● Koordination der Fort- und Weiterbildungsprogramme der Pädagogischen Hochschulen
● Lehrer/innenaus-, fort- und –weiterbildung
● Statistik und Datenanalyse
● Schulleiter/innenausbildung
Abteilung 27: Nationale Umsetzung der internationalen Berufsbildungspolitik [S]
● Nationale Umsetzung der Europäischen Berufsbildungspolitik
● Europass, Leonardo Da Vinci, Cedefop
● Bildungsstandards in der Berufsbildung
● Kompetenzorientiertes Unterrichten
● Gewerbeordnung für BMHS, Berufsausbildungsgesetz
● Nationaler Qualifikationsrahmen (NQR)
● ESF Maßnahmen
Abteilung 28: Schulentwicklung, Schulen für Berufstätige, IT-Angelegenheiten [S]
● Informationstechnologien für berufsbildende Schulen
● Schulentwicklung, Schulprogramme und Qualitätssicherung
● Bildungsangebot für Berufstätige
● ARQA-VET
● Naturwissenschaften in der Berufsbildung
● Bildungsplanung, Ökonomie und Systemmonitoring
Abteilung 29: Bewegung und Sport; Schulwettkämpfe, Sportstättenbau, Bundesschullandheime
● Bewegungs- und Sporterziehung
● Schulwettkämpfe
● Sportstättenbau
● Bundessportakademien; Bundesschullandheime
__________________________________
[S] = für den Sektionsbereich, abteilungsübergreifend
Seite 1002 Die berufsbildenden Schulen Österreichs
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur (BMUKK)
Die Sektion Berufsbildendes Schulwesen, Erwachsenenbildung
und Schulsport im BMUKK (Sektion Berufsbildung)
Die Sektion Berufsbildung nimmt für die berufsbildenden Schulen jene Aufgaben
der Schulverwaltung wahr, die aufgrund der gesetzlichen Bestimmungen in die
Zuständigkeit des BMUKK fallen. Die Vollziehung der Gesetze erfolgt in den
Schulbehörden des Bundes auf der Ebene der Bundesländer, in den Landes-
schulräten/Stadtschulrat für Wien.
Die Sektion Berufsbildung ist für folgende Bereiche der schulischen Ausbildung
(Sekundarstufe II) zuständig:
Pädagogische und berufsfachliche Angelegenheiten (z.B. Lehrplanentwicklung),
Lehrerfort- und –weiterbildung, Standortfragen und Ausstattung. Schul-
entwicklung und Bildungsforschung, Internationale Kooperationen u.v.m.
Auch die Erwachsenenbildung und der Schulsport/sportliche Angelegenheiten
für den Bereich des BMUKK sind Teil dieser Sektion.
Die berufsbildenden Schulen
vermitteln neben einer fundierten Allgemeinbildung eine berufliche Erst-
ausbildung mit unterschiedlicher Dauer und unterschiedlichen Niveaus ab der 9.
Schulstufe.
Zu den berufsbildenden Schulen gehören die Eine Vielzahl
● Berufsschulen von Ausbildungs-
● Technischen, gewerblichen und kunstgewerblichen Schulen möglichkeiten
● Kaufmännischen Schulen
● Schulen für wirtschaftliche Berufe
● Tourismusschulen
● Schulen für Mode- und Bekleidungstechnik und für künstlerische Gestaltung
● Schulen für Sozialberufe
● Höheren land- und forstwirtschaftlichen Schulen
● Bundessportakademien
● Bildungsanstalten für Kindergartenpädagogik und für Sozialpädagogik
einschließlich Sonderformen und Schulversuche.
Sie können mit Ausnahme der Berufsschulen (schulischer Ausbildungsteil des
dualen Systems) in verschiedenen Formen mit unterschiedlicher Dauer (1-5
Jahre) geführt werden:
Berufsbildende mittlere Schulen (BMS):
● 3 bzw. 4 Jahre: Vollzeitschule ab der 9. Schulstufe; abgeschlossene berufliche
Erstausbildung
● 1 bzw. 2 Jahre: Vollzeitschule ab der 9. Schulstufe; berufliche Vorbildung
Berufsbildende höhere Schule (BHS):
● 5 Jahre: Vollzeitschule ab der 9. Schulstufe; abgeschlossene berufliche Erst-
ausbildung
Aufbaulehrgang:
● 3 Jahre: Vollzeitschule ab der 9. Schulstufe nach Abschluss einer BMS
Kolleg:
● 4 Semester: Vollzeitschule nach der Reifeprüfung (Bildungsziel der BHS)
Schulen für Berufstätige:
● 4-8 Semester: oben genannten Schularten in Form einer Abendschule
Seite 11Ein Wechsel zwischen einzelnen Arten der berufsbildenden Schulen bei gleichem
Lehrplan ist möglich, bei verschiedenem Lehrplan sind Prüfungen (in bestimmten
Unterrichtsgegenständen) notwendig.
Bildungswege zu den berufsbildenden Schulen
Nach dem Besuch der Volksschule (1.-4. Schulstufe) können die Schüler/innen die
Sekundarstufe I (5.-8. Schulstufe) entweder an der Hauptschule, an einer AHS -
Unterstufe oder in der Neuen Mittelschule absolvieren. Die Aufnahme in die
berufsbildenden Schulen (Sekundarstufe II) ist mit dem positiven Abschluss der 8.
Schulstufe möglich.
Weitere Eingangsvoraussetzungen sind – je nach Vorbildung und angestrebter
Schulart – bisherige schulische Leistungen in bestimmten Unterrichtsgegen-
ständen bzw. eine Aufnahmeprüfung. Mehr als 80 % der österreichischen
Jugendlichen mit 14 Jahren entscheiden sich für eine Ausbildung an den berufs-
bildenden Schulen.
Die berufliche Erstausbildung
Bildung steht neben der Vermittlung von Allgemeinbildung im Mittelpunkt der berufsbil-
für die Zukunft denden Schulen, für deren Absolvent/innen sich – je nach Ausbildungshöhe – der
direkte Berufseinstieg bzw. verschiedene Formen von Weiterbildungsmöglich-
keiten eröffnen.
Chancen Die BMS und BHS verzeichnen seit drei Jahrzehnten einen kontinuierlichen
für das Leben Schüler/innenzuwachs, was nicht zuletzt auf das ausgewogene Bildungsangebot
aus Allgemeinbildung, Fachtheorie und Fachpraxis (mit Praktikum, je nach Schul-
art verpflichtend oder freiwillig) bzw. auf eine Vielzahl an spezifischen Ausbil-
dungsmöglichkeiten und Ausbildungsschwerpunkten mit unterschiedlicher Dauer
zurückzuführen ist.
EU-Anerkennung Besonders gefragt sind seit Beginn der 90er Jahre die BHS mit dem Abschluss der
für BHS Reife- und Diplomprüfung, die mit dem Erwerb von beruflichen Qualifikationen,
dem allgemeinen Hochschulzugang und der Anerkennung dieser Ausbildungs-
gänge auf europäischer Ebene ein hohes Ausbildungsniveau darstellen.
Die Berufsreifeprüfung
Berufsreifeprüfung Mit der Einführung der Berufsreifeprüfung (1997) wurde die Durchlässigkeit des
für Erwachsene Bildungssystems weiter erhöht.
Die Berufsreifeprüfung ermöglicht Absolvent/innen des dualen Systems (Lehr-
abschlussprüfung), von mindestens 3-jährigen berufsbildenden mittleren Schulen,
von Gesundheits- und Krankenpflegeschulen, von Schulen für den medizinisch-
technischen Fachdienst sowie für Personen mit Facharbeiterprüfung gemäß Land-
und forstwirtschaftlichen Berufsausbildungsgesetz, Personen mit Befähigungs-
prüfung gemäß Gewerbeordnung den allgemeinen Hochschulzugang, führt aber
zu keinen Berufsberechtigungen. Die Berufsreifeprüfung ist eine Externistenprü-
fung, d.h. es ist kein Schulbesuch vorgeschrieben.
Berufsmatura: Seit Herbst 2008 wird die Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung parallel zur
Lehre mit Reifeprüfung Lehre angeboten und in dieser Form auch voll gefördert (= Berufsmatura: Lehre
mit Reifeprüfung). Diese wird von allgemeinbildend interessierten Lehrlingen in
Anspruch genommen und kann bereits mit dem 19. Lebensjahr zu einer Hoch-
schulreife und Berufsausbildung führen.
Vorbereitungslehrgänge werden in von BMUKK anerkannten Erwachsenen-
bildungsinstitutionen (z.B. BFI, WIFI, Volkshochschulen) und in manchen berufs-
bildenden Schulen angeboten. In zertifizierten EB-Institutionen können in bis zu 3
Fachbereichen auch Prüfungen abgenommen werden.
Ähnliche Vorbereitungslehrgänge, die an Erwachsenenbildungsinstitutionen oder
von Vereinen organisiert werden, können die Lehrlinge kostenfrei in Anspruch
nehmen.
Externistenprüfung Grundsätzlich können Prüfungen der BMS und BHS bzw. der Schulen für Berufs-
tätige als Externistenprüfungen abgelegt werden. Dies gilt auch für die Reife- und
Diplomprüfung sowie für die Abschlussprüfung an BMS.
Seite 12An den Schulen für Berufstätige – also ca. 80 Standorten in Österreich – wurde Modularisierung an
mit der Novelle zum Schulorganisationsgesetz für Berufstätige im Juli 2010 eine Schulen für Berufstätige
konsequente Einteilung der Unterrichtsgegenstände in Module umgesetzt. Als
„Modul“ wird der Lehrstoff eines Gegenstandes in einem Semester bezeichnet;
dies erleichtert den berufstätigen Studierenden das Weiterkommen an den
Schulen und ermöglicht erwachsenengerechte Bildungswege. Auch bei der
Anerkennung von nicht formal erworbenem Wissen und der andragogischen
Betreuung wurden Fortschritte durch das neue Gesetz erzielt. Damit wird es auch
möglich, Berufstätigenformen, Aufbaulehrgänge und Kollegs für Berufstätige zu
einer modularisierten Form zusammen zu nehmen.
Rechtliche Rahmenbedingungen
Die grundlegenden Schulgesetze umfassen das Schulorganisationsgesetz
(SchOG) und das Schulunterrichtsgesetz (SchUG) und können nach einem Begut-
achtungsverfahren mit einfacher Mehrheit im Parlament geändert werden. Die
Lehrpläne der verschiedenen Schularten werden durch Verordnung des BMUKK
festgelegt.
Kosten – Finanzierung
Der Besuch von berufsbildenden Schulen ist – mit Ausnahme von Privatschulen –
kostenlos. Dies gilt auch für Kollegs und für die Schulen für Berufstätige. Kosten-
beiträge sind für Schulbücher und Schulfahrt sowie Arbeitsmittel zu leisten.
Weitere Kosten können durch die Teilnahme an Schulveranstaltungen oder die
Unterbringung in einem Internat entstehen (Beihilfen sind möglich).
Die Kosten für die Schulausstattung und –erhaltung trägt bei öffentlichen BMS
und BHS der Bund, bei Berufsschulen und land- und forstwirtschaftlichen Fach-
schulen (zuständig für diese Fachschulen sind die Länder) das Land. Die Kosten
für Lehrer/innen an Bundesschulen als auch für jene an Privatschulen mit
Öffentlichkeitsrecht werden vom Bund getragen; bei Berufsschullehrer/innen
sowie Lehrer/innen an land- und forstwirtschaftlichen Fachschulen erfolgt eine
Kostenteilung zwischen Bund und Land.
Die Schulaufsicht
In der Sekundarstufe II liegt die Schulaufsicht in der Zuständigkeit des Landes- Koordination, Beratung
schulrates/Stadtschulrates für Wien, wo sie von Landesschulinspektor/innen und Konfliktlösung
ausgeübt wird, die jeweils für eine bestimmte Schulart zuständig sind. Die
Höheren land- und forstwirtschaftlichen Lehranstalten und einige Schulen im
technisch-gewerblichen Bereich unterstehen direkt dem BMUKK (Zentral-
lehranstalten).
Mitwirkung anderer Ministerien
Bestimmte Ausbildungsbereiche fallen in die Kompetenz von anderen
Ministerien, wie dem Bundesministerium für Wirtschaft, Familie und Jugend (u.a.
Ausbildung im Lehrbetrieb, Akkreditierung von beruflichen Qualifikationen), dem
Bundesministerium für Gesundheit (u.a. Schulen für Gesundheits- und
Krankenpflege) und dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft.
Die Sozialpartner
Das System der österreichischen Wirtschafts- und Soziapartner beruht auf der
freiwilligen Zusammenarbeit der gesetzlichen Interessenverbände der Arbeit-
geber (Wirtschaftskammer Österreich), der Arbeitnehmer (Bundesarbeiter-
kammer) und der Landwirtschaft (Präsidentenkonferenz der Landwirtschafts-
kammern) und der freiwilligen Interessenverbände (Vereinigung Österreichischer
Industrieller und der Österreichische Gewerkschaftsbund) sowohl untereinander
als auch mit Vertretern der Regierung.
Seite 13Im schulischen Bereich erfolgt die Mitwirkung der Sozialpartner bei Gesetzen und
Verordnungen (z.B. bei neuen Lehrplänen).
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft
Praxisrelevante Für alle Beteiligten im Bereich der berufsbildenden Schulen spielt die Wirtschaft
Ausbildung als Partner eine große Rolle. So werden Lehrpläne oder Ausbildungsschwerpunkte
den Anforderungen der Wirtschaft angepasst, in Betrieben Lehrlinge fachgemäß
ausgebildet oder Praktika absolviert. In gemeinsamen Projekten zwischen Schulen
und Wirtschaft, z.B. Diplomprojekte oder Projekte im Rahmen der Übungsfirmen-
arbeit, werden Ergebnisse von Forschung und Entwicklung praxisrelevant umge-
setzt. Fast alle Lehrer/innen der fachbezogenen und praxisrelevanten Unterrichts-
gegenstände verfügen über praktische Erfahrung in der Wirtschaft.
Bildungsberatung
Beratung und an BMS und BHS erfolgt durch speziell ausgebildete Lehrer/innen, die für
Orientierung Informationen, Orientierung, Entscheidungsvorbereitung, Vermittlung von Hilfe
und individuelle Beratung den Schüler/innen zur Verfügung stehen. Je nach
Schüler/innenzahl sind pro Schule dafür ein bis drei Lehrkräfte vorgesehen.
Die Bildungsberater/innen arbeiten mit den Zubringerschulen, den Schüler-
berater/innen der Hauptschule und AHS-Unterstufe und Neuen Mittelschule sowie
anderen Beratungsinstitutionen für die Abschlussklassen (Arbeitsmarktservice,
Hochschülerschaft der Universitäten etc.) zusammen.
Gutes Zeugnis für Österreichs Schulen
Jährliches Das jährliche Bildungsmonitoring ist eine breit angelegte Studie, in der 2.000
Bildungsmonitoring Personen aus ganz Österreich zum Schul- und Bildungswesen befragt werden (seit
1993). Die Bewertung erfolgt nach dem österreichischen Schulnotensystem: Sehr
Gut (1) = beste Note; Nicht genügend (5) = schlechteste Note, negativ. (IFES
Schulmonitoring 2009. Repräsentative Bevölkerungsbefragung)
Die Imagewerte der einzelnen Schulformen haben sich in den letzten Jahren
tendenziell verbessert bzw. kaum verändert, knapp 60 % der befragten Personen
beurteilen das gesamtösterreichische Bildungssystem mit Sehr Gut (1) oder Gut
(2).
Berufsbildende Im Gesamtvergleich der Einschätzung der einzelnen Schularten schneiden die BHS,
Höhere Schulen gemeinsam mit Fachhochschulen, mit der Benotung (Mittelwert) 2,1 am besten
ab. In der Mittelwert-Skala – 2,0 bis 2,8 – liegen auch die Berufsschulen und die
BMS in der Bewertung der Bevölkerung mit jeweils 2,3 sehr gut.
Seite 14Eckdaten:
● Entwicklung der Schüler/innenzahlen:
160.000
150.000
149.806 132.613 140.256
140.000
130.000 137.534
120.000
123.676
110.000
100.000
BS
99.057 BMS
90.000 BHS
77.788 AHS
80.000
65.481
70.000
54.863 59.571
60.000
58.802
50.000
51.712
40.000
30.000
1990/1991 2000/2001 2009/2010
● Verteilung aller Schüler/innen in der 10. Schulstufe:
AHS AHS
20% 20%
BS
38%
BHS
26%
BMS BBS
16% 80%
● Verteilung der Reifeprüfungen:
AHS BHS
40% 60%
Abkürzungen:
AHS = AHS-Oberstufe
BS = Berufsschule
BMS = Berufsbildende mittlere Schule
BHS = Berufsbildende höhere Schule
BBS = Berufsbildende Schulen
Seite 15● Standorte der berufsbildenden Schulen (2010):
Berufsschulen: 160
Berufsbildende mittlere Schulen: 500
Berufsbildende höhere Schulen: 300
Lehrpläne: 490
Lehrer/innen: 27.000
● Bildungsstand der Jugendlichen (2009):
Anteil der Personen im Alter von 20 bis 24 Jahren mit weiterführendem Bildungsabschluss (Sekundarab-
schluss II, ISCED 3A/B oder höher), bezogen auf die Gesamtbevölkerung derselben Altersgruppe:
Österreich: 86 %
EU 27: 79 %
● Frühzeitige Schulabgänger/innen (2009):
Haben keinen Schulabschluss der Sekundarstufe II erreicht und befinden sich aktuell nicht in Ausbildung:
Österreich: 8,7 %
EU 27: 14,9%
● Jugendarbeitslosenquote (15-24 Jahre; 2009):
Österreich: 10,0 %
EU 27: 19,6%
● Teilnahme Erwachsener am lebenslangen Lernen (2008):
Österreich: 13,2 %
EU 27: 9,5%
● Anzahl der Veranstaltungen und Teilnahmen der KEBÖ (2009):
Kurzveranstaltungen (1 - 4 UE) Kurse Gesamt Sonderveranstaltungen
Veranstaltungen 75.716 131.406 207.122 19.337
Teilnahmen 1.213.922 1.691.966 2.905.888 1.449.172
● Österreichisches Notensystem:
Sehr Gut (1) – beste Note
Gut (2)
Befriedigend (3)
Genügend (4)
Nicht Genügend (5) – negative Note
● Unterricht Dauer:
eines Schuljahres: September bis Juni (ca. 40 Wochen)
einer Unterrichtsstunde: 45 / 50 Minuten
Unterricht in der Woche (BMS und BHS): 30-38 Stunden
Unterricht in der Woche (BS, lehrgangsmäßig): 42-45 Stunden
Abkürzungen: Quellen:
BS = Berufsschule Statistik Austria, Europäische
BMS = Berufsbildende mittlere Schule Kommission, WKÖ, AMS
BHS = Berufsbildende höhere Schule Forschungsnetzwerk, BMUKK
KEBÖ = Konferenz der Erwachsenenbildung Österreich
Seite 1603 Berufsschulen
Jugendliche, die einen Lehrvertrag mit einem Lehrberechtigten (Betrieb) ab- Duales System
geschlossen haben, sind verpflichtet, die Berufsschule zu besuchen. Diese Art der
Berufsausbildung wird als duales Berufsausbildungssystem (duales System)
bezeichnet, da die Bildungsaufgaben auf zwei Träger verteilt sind: Betrieb und
Berufsschule.
Für die Ausbildungsordnung im Betrieb ist das Bundesministerium für
Wirtschaft, Familie und Jugend zuständig, für pädagogische Belange der Berufs-
schule das Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur.
Die Finanzierung der betrieblichen Ausbildung erfolgt durch das ausbildende
Unternehmen, für die Kosten der Berufsschule kommt die öffentliche Hand auf.
Hier gibt es eine Kostenteilung zwischen dem Bund und den Ländern. Für die
Errichtung und Ausstattung von Berufsschulen sind die Länder zuständig. Die
Finanzierung der Lehrenden an Berufsschulen wird zu 50% vom Bund und zu 50%
von den Ländern getragen.
Berufsbereiche
Die Berufsschulen umfassen so viele Schuljahre, wie es der Dauer des Lehr- Über 220 Lehrberufe
verhältnisses entspricht. Je nach Lehrberuf beträgt die Zeit der Ausbildung 2 bis 4
Jahre, in der Regel jedoch 3 Jahre. Zurzeit gibt es über 220 anerkannte Lehr-
berufe, die folgende Lehrberufsgruppen umfassen:
● Bauwesen
● Büro, Verwaltung, Organisation
● Chemie
● Druck, Foto, Grafik, Papierverarbeitung
● Elektrotechnik, Elektronik
● Gastronomie
● Gesundheit und Körperpflege
● Handel
● Holz, Glas, Ton
● Informations- und Kommunikationstechnologien
● Lebens- und Genussmittel
● Metalltechnik und Maschinenbau
● Textil, Mode, Leder
● Tiere und Pflanzen
● Transport und Lager
Bedingt durch anhaltende Strukturveränderungen von Wirtschaft und
Gesellschaft sind auch Lehrberufe einem ständigen Wandel unterworfen. Vor
allem auf dem Dienstleistungssektor ist eine dynamische Entwicklung von neuen
Lehrberufen feststellbar.
Nach Beendigung der Lehrzeit kann die Lehrabschlussprüfung abgelegt werden. Lehrabschlussprüfung
Hierbei wird festgestellt, ob sich der Lehrling die im Lehrberuf erforderlichen
Fertigkeiten und Kenntnisse angeeignet hat und in der Lage ist, die dem Lehr-
beruf eigentümlichen Tätigkeiten selbst fachgerecht auszuführen. Die Lehr-
abschlussprüfung gliedert sich in eine praktische und eine theoretische Prüfung
und besteht aus einem schriftlichen und einem mündlichen Teil.
Hat der Jugendliche das Unterrichtsziel der letzten Klasse der Berufsschule
erreicht, so besteht die Prüfung nur aus dem Praxisteil.
Im Zuge der Lehrabschlussprüfung eines vierjährigen Lehrberufes besteht die
Möglichkeit, eine freiwillige, zusätzliche Fachprüfung abzulegen. Für Lehrlinge,
die diese freiwillige Fachprüfung positiv ablegen bedeutet dies, dass die Teil-
prüfung Fachbereich im Rahmen der Berufsreifeprüfung entfällt.
Seite 17Weiterbildungs- Nach erfolgreich abgelegter Lehrabschlussprüfung ergeben sich für die
möglichkeiten Absolvent/innen u.a. folgende Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung: Ablegung
der Meisterprüfung für ein Handwerk, wobei Prüfungsteile entfallen; Ablegung
einer – bzw. Zulassung, falls als Zugangsvoraussetzung eine einschlägige
berufliche Erstausbildung verlangt wird, zu einer – Befähigungsnachweisprüfung
für ein sonstiges reglementiertes Gewerbe; Zugang zur weiterführenden Bildung
über Berufsreifeprüfung bzw. Studienberechtigungsprüfung als Voraussetzung für
ein Studium an Universitäten, Fachhochschulen, Kollegs und Pädagogischen Hoch-
schulen.
Ein Lehrplan mit Rahmencharakter
Allgemeine Der Lehrplan der Berufsschule ist ein Lehrplan mit Rahmencharakter, der Unter-
Bestimmungen richtsziele, Inhalte und Verfahren für die Planung und Realisierung von Lern-
prozessen angibt. Er ermöglicht die eigenständige und verantwortliche Unter-
richtsarbeit der Lehrer/innen innerhalb des vorgegebenen Umfangs.
Die Landesschulräte bzw. der Stadtschulrat für Wien haben im vorgesehenen
Rahmen durch zusätzliche Lehrplanbestimmungen das Stundenausmaß und den
Lehrstoff der einzelnen Unterrichtsgegenstände auf die einzelnen Schulstufen
aufzuteilen, soweit dies nicht bereits durch die Lehrpläne erfolgt.
Der Lehrplan jedes Unterrichtsgegenstandes umfasst:
● Bildungs- und Lehraufgabe, welche angibt, zu welchen Lernergebnissen, zu
welchen Kompetenzen und Fertigkeiten die Schüler/innen geführt und über
welches Wissen sie verfügen sollen.
● Lehrstoff, welcher den Umfang der Unterrichtsinhalte festlegt.
● Didaktische Grundsätze als Handlungsanweisungen für die Lehrer/innen.
Bildungsziele
Förderung der Die Berufsschule hat die Aufgabe, in einem berufsbegleitenden fachlich ein-
Allgemeinbildung schlägigen Unterricht die grundlegenden theoretischen Kenntnisse zu vermitteln,
und der betrieblichen die betriebliche Ausbildung zu fördern und zu ergänzen sowie die Allgemein-
Ausbildung bildung zu erweitern.
Die Bildungsarbeit in der Berufsschule berücksichtigt die durch die betriebliche
Lehre bewirkte enge Verbindung mit der Berufswelt. Ausgehend von der Erleb-
niswelt werden Berufsschüler/innen zur selbstständigen Aneignung von
Kenntnissen, Fertigkeiten und Einstellungen befähigt und zur Weiterbildung
angeregt.
Unterrichtsziele Damit die Schüler/innen die Kenntnisse und Fertigkeiten in verschiedenen
Situationen anwenden können, wird eine fächerübergreifende Aufbereitung des
Lehrstoffes forciert. Insbesondere in den höheren Klassen werden durch Projekt-
unterricht die Zusammenhänge der einzelnen Stoffgebiete und Unterrichtsgegen-
stände verständlich gemacht.
Im Sinne einer ganzheitlichen Bildung wird im Berufsschulunterricht großer Wert
auf die Persönlichkeitsbildung gelegt, wobei der Vertiefung und Zunahme der
Sozialkompetenzen wie Offenheit, Teamfähigkeit und Konfliktfähigkeit, der
Förderung der Kommunikationsfähigkeit sowie der Stärkung der Selbstkompe-
tenzen wie Selbsteinschätzung, Selbstvertrauen und Belastbarkeit eine besondere
Bedeutung zukommt. Zur Zielerreichung kommen problem- und prozessorientier-
te Lehrverfahren, Gruppenunterricht, Partnerarbeit und andere Sozialformen des
Unterrichts sowie Präsentationen, Diskussionen etc. zum Einsatz.
Bildungsinhalte
Im Sinne dieser Aufgabe hat der Lehrplan als Pflichtgegenstände Deutsch und
Kommunikation, Berufsbezogene Fremdsprache, Politische Bildung, betriebs-
wirtschaftliche und die für den betreffenden Lehrberuf erforderlichen theoreti-
schen und praktischen Unterrichtsgegenstände (sowie Religion in den Bundes-
ländern Tirol und Vorarlberg) vorzusehen.
Seite 18Als Freigegenstände sind Lebende Fremdsprache, Deutsch sowie Religion
(ausgenommen in Tirol und Vorarlberg), als unverbindliche Übungen Bewegung
und Sport möglich.
Der Unterricht in der Berufsschule kann in folgenden Organisationsformen Organisation der
geführt werden: Unterrichtszeit
● ganzjährig:
d.h. mindestens an einem vollen Schultag oder mindestens zwei halben
Schultagen in der Woche
● lehrgangsmäßig:
d.h. mindestens 8 Wochen hindurch
● saisonmäßig:
d.h. auf eine bestimmte Jahreszeit geblockt
Die Vielfalt der Organisationsformen geht auf die Abstimmung zwischen
Wirtschaft und Schulverantwortlichen zurück und berücksichtigt den Bedarf der
einzelnen Branchen bzw. Regionen.
Lehrer/innen an Berufsschulen
In der Berufsschule unterscheidet man Lehrer/innen der Fachgruppe (FG) I, II und Wie wird man Lehrer/in
III. Lehrer/innen der FG I und II haben eine Lehrverpflichtung von 23 Wochen- an einer Berufsschule?
stunden und halten den allgemein bildenden und betriebswirtschaftlichen
Unterricht (FG I) bzw. den fachtheoretischen Unterricht (FG II) ab. Die Ausbildung
für Berufsschullehrer/innen erfolgt seit Oktober 2007 an Pädagogischen Hoch-
schulen, folgende Zugangvoraussetzungen sind zu erfüllen:
a) für die Fachgruppe I und die Fachgruppe II die erfolgreiche Ablegung der
Reife- und Diplomprüfung einer einschlägigen berufsbildenden höheren
Schule oder die erfolgreiche Ablegung einer Reifeprüfung oder einer Berufs-
reifeprüfung und eine einschlägige Ausbildung;
b) für die Fachgruppe III (fachpraktische Unterrichtsgegenstände) die
erfolgreiche Ablegung einer einschlägigen Meisterprüfung oder eine gleich-
wertige einschlägige Befähigung sowie die allgemeine Universitätsreife und
c) in allen Fällen die Zurücklegung einer mindestens dreijährigen einschlägigen
Berufspraxis.
Die allgemeine Universitätsreife (d.h. z.B. Reifeprüfung, Berufsreifeprüfung oder
Studienberechtigungsprüfung) ist für ordentliche Studierende bis zum Erlangen
von 120 ECTS-Credits nachzuweisen.
Das 1. und 2. Semester sowie das 5. und 6. Semester sind berufsbegleitend, das 3.
und 4. Semester als Vollstudium zu absolvieren. Die Ausbildung wird mit dem
akademischen Grad „Bachelor of Education“ (BEd) abgeschlossen.
Die Diensthoheit der Lehrer/innen an Berufsschulen haben die Länder, die die
angehenden Pädagog/innen vorerst als Vertragslehrer/innen einstellen.
Charakteristik der Dualen Ausbildung
Das System der österreichischen Lehrlingsausbildung ist ein besonders praxis- Ausbildung an
orientiertes Ausbildungsmodell, dem in Österreich durchgehend ein bedeutender zwei Lernorten
Stellenwert beigemessen wird.
Durch die große Bandbreite an Qualifikationsmöglichkeiten – von der Teil-
qualifizierung bis hin zu High-Tech-Berufen und Berufsreifeprüfung eröffnet die
Lehrlingsausbildung alle Qualifikationschancen, die der österreichische Ausbil-
dungsmarkt bietet. Ob mit oder ohne Reifeprüfung, die duale Ausbildung ist
flexibel an die unterschiedlichen Begabungen und Bedürfnisse angepasst.
Seite 19Jugendliche, die mit einer Reifeprüfung eine Lehre beginnen, erhalten eine
Verkürzung der Lehrzeit und haben nach erfolgreichem Abschluss der Lehr-
abschlussprüfung gute Jobchancen. Jugendliche, die eine Lehre erfolgreich
abschließen, sind von der Wirtschaft nachgefragte Fachkräfte und nehmen einen
beachtlich hohen Anteil an Selbstständigen in der Gründerstatistik ein. Zudem
wurde der Weg in die Selbstständigkeit durch die Validierung der während der
Ausbildung erworbenen fachlichen Qualifikationen, die den Entfall von Prüfungs-
teilen im Rahmen der Meisterprüfung bewirkt, erleichtert.
Die Lehrlingsausbildung bietet aber auch Jugendlichen mit sozialen, begabungs-
mäßigen oder körperlichen Benachteiligungen eine geeignete Ausbildungsschiene
zur Ausschöpfung ihres Potentials an beruflichen Fähigkeiten, da ganz gezielt auf
die individuellen Bedürfnisse eingegangen wird und dadurch ein wesentlicher
Impuls für die Integration dieses Personenkreises in das Berufsleben gesetzt
werden kann.
Integrative Berufsausbildung
Chancen für alle Ziel der integrativen Berufsausbildung ist es, für Jugendliche mit sozialen,
begabungsmäßigen oder körperlichen Benachteiligungen eine geeignete Ausbil-
dungsschiene auf der Ebene der Lehrlingsausbildung zur Ausschöpfung ihres
Potentials an beruflichen Fähigkeiten zu schaffen. Die integrative Berufsausbil-
dung wird sowohl als eine Lehrausbildung mit einer verlängerten Lehrzeit als auch
als eine Berufsausbildung, die Teilqualifikation vermitteln angeboten, um jenen
Personen einen Eintritt in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen, bei denen die
Erreichung eines Lehrabschlusses nicht möglich ist. Durch die Möglichkeit einer
maßgeschneiderten Ausbildung kann sowohl im Betrieb, in besonderen selbst-
ständigen Ausbildungseinrichtungen als auch an Berufsschulen ganz gezielt auf
die individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten, auf die individuellen Bedürfnisse
eingegangen werden.
Kooperation Berufsschule / Wirtschaft
Best practice Die lernortübergreifende und partnerschaftliche Zusammenarbeit aller an der
Berufsausbildung Beteiligten ist einer der wesentlichen Faktoren für den Erfolg des
dualen Systems. Eine moderne Berufsausbildung erfordert eine enge Verbindung
von Theorie und Praxis, von schulischem Unterricht und betrieblicher Praxis.
Große Handelsketten aber auch Industriebetriebe nutzen zunehmend die
Potentiale, die in der Lehrlingsausbildung stecken, und entwickeln in Kooperation
mit den Berufsschulen komplementäre Bildungsmodelle, die auf ihren Fachkräfte-
nachwuchs zugeschnitten sind. Diese vertieften Kontakte und Kooperationen
zwischen Wirtschaft und Berufsschule sind wichtige Impulsgeber zur Weiteren-
twicklung und Qualitätssicherung der Lehre.
Förderprogramm: Berufsmatura – Lehre und Reifeprüfung
Perspektiven eröffnen, Mit dem Förderprogramm „Berufsmatura: Lehre mit Reifeprüfung“, das im Herbst
Potenziale nutzen 2008 gestartet wurde, sollen Perspektiven eröffnet und Potenziale genutzt
durch Verbesserung werden. Lehrlinge mit einem Lehr- oder Ausbildungsvertrag erhalten die Möglich-
der Durchlässigkeit keit, sich bereits während der Lehrzeit in entgeltfreien Kursangeboten auf die
Berufsreifeprüfung vorzubereiten, wobei bereits 3 Teilprüfungen vor der Lehr-
abschlussprüfung absolviert werden können. Die Kosten für die Vorbereitungs-
maßnahmen werden seitens des Bundes getragen. Die Organisation der Maß-
nahme erfolgt über Trägerorganisationen in den Bundesländern.
Seite 2004 Technische, gewerbliche und kunstgewerbliche Schulen
Bildungsangebote
Die technischen, gewerblichen und kunstgewerblichen mittleren und höheren Berufliche
Schulen sehen primär Bildungsangebote für die berufliche Erstausbildung vor. Zu Erstausbildung
diesen gehören:
• die 5-jährigen höheren Lehranstalten (HTL), die die 9. bis 13. Schulstufe
umfassen, vom Beginn weg in die Theorie und Praxis des jeweiligen Fach-
gebiets einführen und im letzten Jahr postsekundäre Lehr- und Lernformen
aufweisen; die höheren Lehranstalten werden mit einer Reife- und
Diplomprüfung abgeschlossen;
• die 4-jährigen Fachschulen (9. bis 12. Schulstufe), die mit einer Abschluss-
prüfung abgeschlossen werden und über Aufbaulehrgänge, die Studien-
berechtigungsprüfung oder die Berufsreifeprüfung an den postsekundären
Sektor angeschlossen sind;
• die 2-jährigen Aufbaulehrgänge, die die Absolventen/innen aus fach-
einschlägigen Fachschulen zum Bildungsziel der entsprechenden 5-jährigen
höheren Lehranstalten führen; bei 3-jährigen Fachschulen ist vor Eintritt in
den Aufbaulehrgang ein so genannter Vorbereitungslehrgang zu ab-
solvieren;
• die (postsekundären) 4-semestrigen Kollegs (13. bis 14. Schulstufe), die die
Universitäts-/ Hochschulreife voraussetzen und mit einer Diplomprüfung
abgeschlossen werden.
Neben der beruflichen Erstausbildung gibt es auch ein differenziertes Weiter- Weiterbildungs-
bildungsangebot für Berufstätige. Dazu gehören: angebote
• die 8-semestrigen höheren Lehranstalten für Berufstätige, die zum selben
Bildungsziel führen wie die entsprechenden 5-jährigen höheren Lehr-
anstalten und in modularer Form aufgebaut sind. Personen mit ab-
geschlossener Lehre beginnen im 1. Semester, Absolventen/innen von Fach-
schulen oder Werkmeisterschulen steigen in das dritte Semester ein;
• die 6-semestrigen Kollegs für Berufstätige („Abendkollegs“), die in den
letzten vier Semestern mit den entsprechenden Semestern der höheren
Lehranstalt für Berufstätige übereinstimmen, wie die 4-semestrigen Kollegs
eine Universitäts-/Hochschulreife voraussetzen und mit einer Diplomprü-
fung abgeschlossen werden;
• die 7-semestrigen Fachschulen für Berufstätige, die mit einer Abschluss-
prüfung abgeschlossen werden und über Aufbaulehrgänge, die Studien-
berechtigungsprüfung oder die Berufsreifeprüfung an den postsekundären
Sektor angeschlossen sind;
• die Werkmeister-, Bauhandwerker- und Meisterschulen, die mit einer Ab-
schlussprüfung abgeschlossen werden und der beruflichen Höher-
qualifizierung dienen.
Autonome Gestaltungsfreiräume
Die Schulautonomie ermöglicht durch Dezentralisierung die Schaffung von
Gestaltungsspielräumen - auf Schulebene vor allem bei der Bildungsvermittlung,
auf Landesebene vor allem bei der Ressourcenbewirtschaftung. Bei der
Bildungsvermittlung erlaubt die Schulautonomie das Eingehen auf regionale
Bedürfnisse und die Schärfung des Schulprofils (Lehrplanautonomie).
Die Lehrplanautonomie ermöglicht sowohl die Wahl zwischen den lehrplan- Lehrplanautonomie
mäßig vorgesehenen Ausbildungsschwerpunkten als auch die Entwicklung schul-
autonomer Schwerpunktsetzungen. Darüber hinaus können die Schulen alterna-
tive Pflichtgegenstandsbereiche entwickeln, die es den Schüler/innen ermöglicht,
ihre Schullaufbahn nach individuellen Begabungen und Interessen zu gestalten.
Zusätzlich können schulautonom freiwillige Bildungsangebote (z.B. Freigegen-
stände) festgelegt werden, um z.B. für die Praxis wichtige Zusatzqualifikationen
zu erwerben.
Seite 21Fachrichtungen
Differenziertes Die technischen, gewerblichen und kunstgewerblichen Schulen umfassen in ihrem
Bildungsangebot Bildungsangebot mehr als 20 Fachrichtungen, die die Spezialisierungen in den
verschiedenen Technologiefeldern ermöglichen.
Alle wesentlichen Sektoren von Industrie und Gewerbe sind durch entsprechende
aktuelle Bildungsangebote abgedeckt. Diese umfassen u.a. die folgenden
Fachrichtungen:
Bautechnik, Innenraumgestaltung und Holztechnik, Elektrotechnik, Elektronik und
Technische Informatik, Biomedizin- und Gesundheitstechnik, Informatik, Informa-
tionstechnologie, Gebäudetechnik Maschinenbau, Mechatronik, Kunststofftechnik,
Werkstofftechnik, Medientechnik und Medienmanagement, Chemie & Chemie-
ingenieurwesen, Lebensmitteltechnologie, Wirtschaftsingenieurwesen, Betriebs-
management, Kunst und Design.
Spezialisierungen innerhalb einer Fachrichtung sind durch Ausbildungsschwer-
punkte oder schulautonome Schwerpunktsetzungen möglich.
Bildungsziele
Fachtheoretische und Die technischen, gewerblichen und kunstgewerblichen Schulen vermitteln
fachpraktische Bildung hochwertige Fach- und Methodenkompetenz für weiterführende Studien und das
für die eigenständige Weiterbildung erforderliche vertiefte allgemeine und
konzeptuelle Wissen sowie spezialisierte, zur Berufsausübung erforderliche
Kenntnisse und Fertigkeiten.
Allgemeine und soziale Neben der fachlichen Bildung findet auch die Weiterentwicklung jener allge-
Qualifikationen meinen, personalen und sozialen Qualifikationen starke Beachtung, welche die
Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen/innen sicherstellt und diese befähigen,
durch Selbststudium oder Studium an weiterführenden Bildungsinstitutionen
erfolgreich am Prozess des lebenslangen Lernens teilzunehmen.
Entrepreneurship Die technischen, gewerblichen und kunstgewerblichen Schulen betrachten es als
ein zentrales Ziel, unternehmerisches, innovatives Denken und Handeln auf der
Grundlage von fundierten betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Kompetenzen
zu vermitteln.
Im Besonderen dienen
• die technischen, gewerblichen und kunstgewerblichen Fachschulen dem
Erwerb jenes fachlichen grundlegenden Wissens und Könnens, das
unmittelbar zur Ausübung eines Berufs auf gewerblichem, technischem oder
kunstgewerblichem Gebiet befähigt und der Erweiterung und Vertiefung der
erworbenen Allgemeinbildung.
● die höheren technischen, gewerblichen und kunstgewerblichen Lehranstalten
dem Erwerb höherer allgemeiner und fachlicher Bildung, die zur Ausübung
eines höheren Berufs auf technischem, gewerblichem oder kunstgewerb-
lichem Gebiet in der industriellen oder gewerblichen Wirtschaft befähigt und
zur Universitäts-/ Hochschulreife führt.
Bildungsinhalte
Gemeinsame Um den allgemeinen Bildungszielen entsprechen zu können, gibt es in allen Lehr-
Lehrplanarchitektur plänen eine – der Art des Bildungsangebots und der Fachrichtung angepasste –
gemeinsame Lehrplanarchitektur. Diese umfasst die Bereiche der allgemeinen
Bildung, der fachtheoretischen Bildung und der fachpraktischen Bildung.
Naturwissenschaftliche Kenntnisse und IT-Kompetenzen werden grundlegend und
auch berufsorientiert entsprechend den Erfordernissen des Fachgebietes ver-
mittelt. Unter Bedachtnahme auf die mit den Lehrplänen verbundenen gewerbli-
chen Berechtigungen werden die rechtlichen, betriebswirtschaftlichen und unter-
nehmerischen Kompetenzen in adäquatem Umfang vermittelt.
Praxisnähe und Praxisnähe und Aktualität sind für alle Unterrichtsgegenstände geltende Grund-
Aktualität sätze. Neben den Werkstätten, den Konstruktionsübungen und den Übungen in
den verschiedenen Laboratorien sind Pflichtpraktika und die mit Unternehmen
durchgeführten Projekte und Diplomarbeiten weitere Elemente der fachlichen
Ausbildung.
Seite 22Pflichtpraktika sind in den 5-jährigen höheren Lehranstalten im Ausmaß von Pflichtpraktika
8 Wochen vorgesehen; die Pflichtpraktika in den Fachschulen umfassen im
Allgemeinen 4 Wochen; in den Fachschulen mit Betriebspraktikum ist zusätzlich
im letzten Schuljahr ein Praktikum im Ausmaß von 12 Wochen vorgesehen.
Abschlüsse
Abschlussprüfung
Die technischen, gewerblichen und kunstgewerblichen Fachschulen und die
Fachschulen für Berufstätige schließen mit einer Abschlussprüfung ab und
führen zu beruflichen Qualifikationen, die zur unmittelbaren Ausübung von
einschlägigen beruflichen Tätigkeiten befähigen und den Zugang zu
reglementierten Berufen eröffnen. Die Abschlussprüfung berechtigt ferner – bei
den 3-jährigen Fachschulen nach Absolvierung eines Vorbereitungslehrganges –
zum Eintritt in einen fachverwandten Aufbaulehrgang oder in das dritte
Semester der höhern Lehranstalt für Berufstätige.
Abschlussprüfungen sind auch an den Meister-, Werkmeister- und Bauhand-
werkerschulen vorgesehen.
Reife- und Diplomprüfung
Die höheren Lehranstalten und die höheren Lehranstalten für Berufstätige
schließen mit einer Doppelqualifikation ab: Die Reife- und Diplomprüfung eröff-
net den Zugang zum Universitäts-/Hochschulbereich sowie zur unmittelbaren
Ausübung von gehobenen Berufen auf technischem, gewerblichem oder kunst-
gewerblichem Gebiet in der industriellen und gewerblichen Wirtschaft.
Ein zentraler Teil der Reife- und Diplomprüfung ist die Diplomarbeit, in der ein
Thema aus dem Fachbereich umfassend und eigenständig zu bearbeiten ist. Diplomarbeit:
Diese werden im letzten Jahrgang unter Betreuung erfahrener Lehrkräfte durch- Zusammenarbeit mit
geführt. Viele davon werden in Kooperation mit der Wirtschaft durchgeführt. der Wirtschaft
Dabei werden nicht nur wichtige fachliche Erfahrungen an realen Projekten
gesammelt, sondern vielfach bereits die ersten Brückenschläge für spätere
Berufseinstiege gelegt.
Diplomprüfung
Die Kollegs schließen mit der Diplomprüfung ab. Da die Studierenden an den
Kollegs bereits die Universitäts-/Hochschulreife erworben haben, umfasst die
Diplomprüfung die fachlichen Teilprüfungen der Reife- und Diplomprüfung, im
Besonderen die Diplomarbeit.
Zertifikate
Der praxisorientierte, kompetenzbasierte Unterricht führt durch den Erwerb Zertifikat
berufsrelevanter Zertifikate auch zu Zusatzqualifikationen für Schüler/innen. Qualitätssicherung
Zertifikatskurse werden im Bereich der Fremdsprachen (z.B. First Certificate of
English oder Business English Certificate), im Bereich der Informatik (z.B. ECDL;
CISCO- bzw. Microsoft-Netzwerktechnik), im Bereich der Wirtschaft (z.B. SAP,
EBCL) und der Qualitätssicherung angeboten.
Anerkennung facheinschlägiger Kenntnisse
Für ein Studium an Fachhochschulen und Universitäten können die fachein- Anerkennung im
schlägigen Kompetenzen der Absolventen und Absolventinnen technischer, Tertiärsektor
gewerblicher und kunstgewerblicher höherer Schulen individuell angerechnet
werden. Dies kann zu einer Verkürzung der Studiendauer führen.
Auf EU-Ebene wird dem hohen Bildungsniveau der HTL wie schon in den
bisherigen Diplomanerkennungsrichtlinien nunmehr auch in der mit 20. Oktober
2005 in Kraft getretenen Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung von
Berufsqualifikationen Rechnung getragen.
Seite 23Standesbezeichnung „Ingenieur/Ingenieurin“
Mit Fachpraxis zum Die Absolventen und Absolventinnen der höheren technischen Lehranstalten
Ingenieurtitel können nach einer mindestens dreijährigen fachbezogenen Praxis die Verleihung
der Standesbezeichnung „Ingenieur/Ingenieurin“ beim Bundesministerium für
Wirtschaft, Familie und Jugend beantragen.
Voraussetzung für die Verleihung der Standesbezeichnung „Ingenieur/
Ingenieurin“ ist, dass die höhere technische Lehranstalt bzw. die jeweilige Fach-
richtung in der Ingenieurverordnung (gemäß § 3 des Ingenieurgesetzes 2006)
angeführt und die Fachbezogenheit der Praxis gegeben ist.
Qualität
In Verantwortung gegenüber den Stakeholdern haben die technischen,
gewerblichen und kunstgewerblichen Lehranstalten das Qualitätsmanagement-
system QIBB implementiert, welches auf modernen und anerkannten Grundsätzen
des Qualitätsmanagements aufbaut und sich am europäischen Qualitätsrahmen
CQAF (Common Quality Assurance Framework) orientiert (QIBB, www.qibb.at).
Eckpunkte von QIBB sind mittel- und kurzfristige Planungen auf der Grundlage von
Schul- und Arbeitsprogrammen, Evaluierungen, Qualitätsberichte sowie die
Vereinbarung von Entwicklungs- und Umsetzungszielen im Rahmen von
Management- und Performance Reviews. QIBB ist nicht nur auf die Schulebene
beschränkt, sondern schließt auch die Landesebene (Schulaufsicht) und die
Bundesebene (Sektion Berufsbildung im BMUKK) ein. Damit wird sichergestellt,
dass auch Prozesse, die mehrere organisatorische Ebenen betreffen, im Qualitäts-
management erfasst sind.
Leitbild
QIBB des technischen, gewerblichen und kunstgewerblichen Schulbereichs baut
auf dem gemeinsamen, österreichweit gültigen HTL-Leitbild auf, das an den
Schulen standortspezifisch ergänzt werden kann. Das Leitbild enthält die Kern-
botschaften zu den laufenden Bildungsprozessen, die in den sieben Qualitäts-
feldern „Bildungsauftrag“, „Innovative Bildungsangebote“, „Praxisbezug“,
„Qualität“, „Lern- und Arbeitsumgebung“, „Personal“ und „Internationalität“ dar-
gestellt werden. Die Kernbotschaften lauten in Kurzform:
Die technischen, gewerblichen und kunstgewerblichen Schulen Österreichs ...
• bieten ihren Schülerinnen und Schülern eine fundierte technische oder
gewerbliche Berufsausbildung und eine umfassende Allgemein- und Persön-
lichkeitsbildung;
• sehen ihre Kernkompetenz in der Entwicklung von innovativen Bildungsange-
boten auf allen Gebieten der Technik;
• sichern ihr Markenzeichen „Praxisbezug der Ausbildung“ durch die Ver-
bindung von theoretischer und fachpraktischer Ausbildung, durch die Praxis-
erfahrung der Lehrenden und durch intensive Kooperation mit der Wirtschaft;
• fühlen sich in ihrer Bildungsarbeit höchsten Ansprüchen an Qualität und ihrer
ständigen Weiterentwicklung verpflichtet;
• bieten ihren Schülerinnen und Schülern Unterstützung und Förderung in einer
motivierenden Lern- und Arbeitsumgebung;
• betrachten die Fähigkeiten, die Erfahrung und das Engagement der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter als wesentliche Grundlagen für die erfolgreiche Um-
setzung ihres Bildungsauftrages;
● leisten ihre Bildungsarbeit mit einem starken internationalen Bezug und
führen zu Mobilität, Weltoffenheit und interkulturellem Verständnis.
Seite 2405 Kaufmännische Schulen
Handelsakademien, Handelsschulen, Kollegs, Aufbaulehrgänge,
Schulen für Berufstätige
Struktur der kaufmännischen Ausbildung in der Sekundarstufe II
Die kaufmännischen mittleren und höheren Schulen werden in Österreich Kaufmännische
insgesamt an 121 Standorten geführt und sind durch eine relativ starke Ein- Berufsausbildung
heitlichkeit im Kernbereich der Ausbildung gekennzeichnet. Sie verstehen sich als
Kompetenzzentren der Wirtschaft mit den Ausbildungssäulen Betriebswirt- Kompetenzorientierung
schaft, Fremdsprachen, Allgemeinbildung, Informations- und Kommunikations- Entrepreneurship
technologien sowie Schlüsselqualifikationen und schließen praxisnahe Unter- Education
richtsformen und die Vermittlung von Werthaltungen und Verantwortungsbe-
wusstsein ein. Diese Kompetenzen sind für alle Lebensbereiche (privat wie
beruflich) nützlich.
Die Handelsakademie (HAK), die mit einer Reife- und Diplomprüfung nach 5- Handelsakademie
jährigem Schulbesuch abschließt, vermittelt in integrierter Form umfassende
Allgemeinbildung und höhere kaufmännische Bildung. Eine betriebswirt-
schaftlich berufsbezogene Differenzierung erfolgt durch verschiedene Ausbil-
dungsschwerpunkte und Fachrichtungen ab dem 3. Jahrgang, welche eine
vertiefende Spezialisierung anbieten (Ausbildungsschwerpunkt 6-8 Jahres-
wochenstunden, Fachrichtung 9-16 Jahreswochenstunden). In diesen Ausbil-
dungsschwerpunkten und Fachrichtungen wird entsprechend den regionalen
Erfordernissen und beruflichen Interessen der Schüler/innen eine kaufmännische
Spezialausbildung angeboten.
Die Handelsschule (HAS) vermittelt ebenso wie die Handelsakademie in Handelsschule
integrierter Form Allgemeinbildung und kaufmännische Bildung. Sie wird nach 3-
jährigem Schulbesuch mit einer Abschlussprüfung beendet.
Für Absolvent/innen der Handelsschule wird ein Aufbaulehrgang angeboten, der Sonderformen der
zur Reife- und Diplomprüfung führt. kaufmännischen Schulen
Für Absolvent/innen einer Reifeprüfung an einer allgemein bildenden höheren
Schule bzw. einer Reife- und Diplomprüfung einer nicht kaufmännischen
berufsbildenden Schule ist im Sinne einer postsekundären Zusatzausbildung die
Absolvierung eines kaufmännischen Kollegs mit dem Abschluss einer Diplom-
prüfung möglich.
Das Kolleg und die Handelsakademie werden auch als Schulformen für
Berufstätige geführt; einige Standorte bieten diese Schulform auch als Fern-
schulen für Berufstätige an, wobei der Unterricht teilweise an der Schule (Sozial-
phase) angeboten und ein Teil des Lehrstoffes von den Studierenden eigen-
ständig (Fernphase) erarbeitet wird.
Spezialformen der Handelsakademie sind die Handelsakademie und das Kolleg Schulversuche
für Wirtschaftsinformatik (Digital Business), in diesem wird eine sehr tief-
greifende Spezialisierung im IKT-Bereich kombiniert mit der anerkannten
wirtschaftlichen Ausbildung der Handelsakademie angeboten.
Ausbildungsschwerpunkte, Fachrichtungen und Fachbereiche
Im Rahmen der Ausbildung an Handelsakademien bzw. an deren Sonderformen Ausbildungsschwer-
werden vertiefende Spezialausbildungen in Form von Ausbildungsschwer- punkte
punkten und Fachrichtungen angeboten, die von den Schulen autonom ausge-
wählt bzw. selbst geschaffen werden können, z.B. Fachrichtungen
● Informationsmanagement und Informationstechnologie
● Internationale Wirtschaft mit Fremdsprache(n) und Kultur
● Entrepreneurship und Management
● Logistikmanagement und Speditionswirtschaft
● Controlling und Accounting
Seite 25Sie können auch lesen