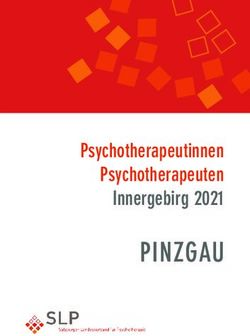Burnout bei Ärzten - Sozialkapital im Krankenhaus als mögliche Ressource?
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Oliver Ommen, Elke Driller, Christian Janßen,
Peter Richter und Holger Pfaff
Burnout bei Ärzten – Sozialkapital im Krankenhaus
als mögliche Ressource?
Burnout ist ein weit verbreitetes Phänomen unter Ärzten: Grassi und Mag-
nani (2000) gehen davon aus, dass ca. 25–30 % der stationär und ambulant
tätigen Ärzte im Laufe ihrer beruflichen Tätigkeit ein Burnout-Syndrom
entwickeln. Burnout kann hierbei charakterisiert werden durch emotionale
Erschöpfung, Depersonalisierung und reduzierte persönliche Leistungsfä-
higkeit (Maslach u. Jackson, 1984). Die Vermeidung von Burnout stellt die
Verantwortlichen im Gesundheitssystem vor eine große Herausforderung.
Für Krankenhäuser ist Burnout zudem mit hohen Kosten verbunden, weil
neben der Minderung der Qualität und Quantität der Patientenversorgung
(Maslach u. Jackson, 1984) auch erhöhter Absentismus (Firth u. Britton,
1989) und hohe Fluktuation (Jackson, Schwab u. Schuler, 1986) mit Burn-
out einhergehen. Vor allem jedoch kann Burnout zu ärztlichem Fehlver-
halten führen. Somit ist die Vermeidung von Burnout auch ein wichtiger
Aspekt im Rahmen des Risikomanagements im Krankenhaus (Shanafelt,
Bradley, Wipf u. Back, 2002; Freeborn, 2001). Eine rationale Burnout-
Prävention setzt Wissen über die Determinanten von Burnout voraus. Es
wurden bereits eine Reihe von Faktoren wie z. B. Selbstwirksamkeit und
Sinnhaftigkeit als persönlichkeitsassoziierte Faktoren identifiziert (Pierce u.
Molloy, 1990; Enzmann, 1996; Glass u. McKnight, 1996), weitestgehend
ungeklärt ist bisher allerdings die Frage, welchen Einfluss das Sozialkapital
eines Krankenhauses auf Burnout bei den dort tätigen Ärzten haben kann.
Der vorliegende Beitrag umfasst einen theoretischen sowie einen empiri-
schen Teil. Zunächst wird die berufliche Situation der in deutschen Kran-
kenhäusern tätigen Ärzte beschrieben, der darauf folgende Abschnitt wid-
met sich dem Konzept »Burnout«, Gegenstand ist hierbei die Definition und
Ätiologie. Dabei wird auf begriffliche Grundlagen und zentrale theoretische
Ansätze in der Burnout-Forschung eingegangen. Um die spezifische Bedeu-
tung sozialer Beziehungen in der Arbeit hinreichend berücksichtigen zu
können, wird im darauf folgenden Abschnitt das Konzept des Sozialkapitals
mit dem Fokus auf Werte- und Vertrauenskapital skizziert.190 O. Ommen, E. Driller, C. Janßen, P. Richter und H. Pfaff
Hierauf folgt ein Abschnitt mit den Ergebnissen einer eigenen Untersu-
chung. Abschließend werden die dargestellten Ergebnisse vor dem Hinter-
grund wissenschaftlicher und praxisrelevanter Aspekte diskutiert.
1 Arbeitsbedingungen der Ärzte im Krankenhaus
Die Arbeitsbedingungen der Krankenhausärzte in Deutschland haben sich
in den vergangenen Jahren erheblich verändert. So erhöhte sich die Fallzahl
in deutschen Krankenhäusern von rund 14 Mio. Fällen im Jahr 1990 auf
rund 17 Mio. Fälle im Jahre 2004, im gleichen Zeitraum nahm die durch-
schnittliche Verweildauer jedoch von 14,7 Tage auf 8,7 Tage ab (Deutsche
Krankenhausgesellschaft, 2006). Die zunehmende Bürokratisierung sowie
Technisierung im ärztlichen Klinikalltag, insbesondere die erhöhten Anfor-
derungen im Rahmen von Dokumentation, spielen neben der oben be-
schriebenen Verdichtung ebenfalls eine nicht unerhebliche Rolle im Rah-
men der somit immer patientenferner werdenden ärztlichen Tätigkeit (Blum
u. Müller, 2003).
In angloamerikanischen (Spickard, Gabbe u. Christensen, 2002; Linzer et
al., 2002; Ramirez, Graham, Richards, Cull u. Gregory, 1996), europäi-
schen (Bovier u. Perneger, 2003; McManus, Winder u. Gordon, 2002) und
zunehmend auch in deutschen Studien (Bergner, 2004; Rottenfußer, 1999;
Bestmann, 2004) wird über eine deutliche Zunahme der Arbeitsbelastung
und damit verbunden des Burnout-Syndroms bei Ärzten berichtet. Häufige
und nicht selten zu kurze Interaktionsepisoden zwischen Ärzten und Patien-
ten mit zum Teil hohen emotionalen Belastungen und emotionaler Disso-
nanz sind maßgeblich für emotionale Erschöpfung verantwortlich (Büssing
u. Glaser, 2003; Glaser, 2004).
Kritisch muss zum bisherigen Stand der Forschung zu den Arbeitsbedin-
gungen der Ärzte vermerkt werden, dass der Fokus der Forschung zu den
Determinanten von Burnout bisher auf den Belastungen als Risikofaktoren
lag. Der Aspekt der möglichen Verhinderung von Burnout durch Ressour-
cen – z. B. durch soziale Unterstützung – wurde bisher jedoch in der For-
schung vernachlässigt. Insbesondere wurde die Frage, welche Auswirkun-
gen das subjektiv wahrgenommene Sozialkapital – und hier insbesondere
das Werte- und Vertrauenskapital im Krankenhaus – auf das emotionale
Burnout der Ärzte hat, bisher kaum untersucht.Burnout bei Ärzten 191
2 Burnout – mehr als nur »Erschöpfung«?
Burnout (engl. »to burn out«: ausbrennen) wurde 1974 von dem deutsch-
stämmigen Psychoanalytiker Herbert J. Freudenberger in die Fachliteratur
eingeführt, als er seinen ersten Artikel über das Ausbrennen von ehrenamt-
lich tätigen Personen in »alternativen« helfenden Einrichtungen im »Journal
of Social Issues« veröffentlichte. Seitdem ist Burnout in der über 30-jähri-
gen Forschungsgeschichte aus Sicht unterschiedlicher Forschungstraditio-
nen und -disziplinen beschrieben und erforscht worden. Vor allem mit der
Entwicklung eines Messinstruments durch Maslach u. Jackson und damit
der Möglichkeit, Burnout empirisch zu erfassen, wuchs das Forschungsinte-
resse immens (Schaufeli u. Enzmann, 1998; Maslach, 1982; Paine, 1982;
Perlman u. Hartman, 1982; Farber, 1983/1991; Schaufeli, Maslach u. Ma-
rek, 1993; Enzmann u. Kleiber, 1989/1990; Burisch, 1994; Wagner, 1993).
Burnout tritt vor allem bei Menschen in helfenden Berufen auf, die in ih-
ren Beziehungen (zu Klienten und Patienten) die Gebenden sind (Aronson,
Kafry u. Pines, 1983). Freudenberger benutzt den Begriff Burnout zur Be-
schreibung eines Zustandes, der bei Helfern eintritt, wenn diese nach »an-
fänglichem großen Engagement für ihre Arbeit oder Aufgabe physisch und/
oder psychisch zusammenbrechen« (Freudenberger, 1974).
Freudenberger definiert Burnout als »…Energieverschleiß, eine Erschöp-
fung aufgrund von Überforderungen, die von innen oder von außen (...)
kommen kann und einer Person Energie, Bewältigungsmechanismen und
innere Kraft raubt. Burnout ist ein Gefühlszustand, der begleitet ist von
übermäßigem Stress, und der schließlich persönliche Motivationen, Einstel-
lungen und Verhalten beeinträchtigt« (Freudenberger, 1974, S. 27).
Maslach und Jackson (1984) erweitern Freudenbergers Definition und
unterteilen den Prozess Burnout in drei Dimensionen. Demnach seien die
Krankheitszeichen von Burnout zunächst emotionale Erschöpfung, dann De-
personalisierung und schließlich reduzierte persönliche Leistungsfähigkeit.
Emotionale Erschöpfung bezieht sich dabei auf das Gefühl, durch den
Kontakt mit anderen Menschen emotional überanstrengt und ausgelaugt zu
sein. Depersonalisierung äußert sich durch eine gefühllose und abgestumpf-
te Reaktion gegenüber den Menschen, die gewöhnlich die Empfänger von
sozialen Dienstleistungen oder Fürsorge sind. Reduzierte persönliche Leis-
tungsfähigkeit zeigt sich durch ein verringertes Kompetenzgefühl bei der
Ausführung der eigenen Arbeit mit Menschen (Maslach u. Jackson, 1984,
S. 134). Nach Maslach tritt Burnout vor allem bei Personen auf, die »bis an
die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit mit Menschen arbeiten« (Maslach,
1985, S. 250).192 O. Ommen, E. Driller, C. Janßen, P. Richter und H. Pfaff
2.1 Ursachen und Auswirkungen
Wie Burnout entsteht und welche persönlichen bzw. arbeitsorganisatori-
schen Bedingungen zum Entstehen beitragen, sind zentrale Fragestellungen
der Forschung über Burnout.
Zur Frage nach den ursächlichen Bedingungen von Burnout besteht bis-
her kein konsentiertes Meinungsbild. Einige Burnout-Forscher betonen die
Persönlichkeitsstruktur der Helfenden – hier insbesondere Idealismus und
motiviertes Engagement zur Veränderung sozialer Probleme – als Ursache
für Burnout (Freudenberger, 1974; Edelwich u. Brodsky, 1984), andere
dagegen beziehen stärker die Bedeutung arbeitsbezogener Faktoren wie
z. B. soziale Unterstützung am Arbeitsplatz in ihre Konzepte und Analysen
ein (Cherniss, 1980; Aronson et al., 1983; Maslach u. Jackson, 1984). Trotz
vieler ungeklärter Fragen zeigt die Forschung, dass Burnout als arbeitsbe-
zogenes Phänomen mit einer Verschlechterung der psychischen sowie phy-
sischen Gesundheit einhergeht. Zu den psychischen Korrelaten zählen vor
allem vermindertes Selbstwertgefühl und Depression (Glass u. McKnight,
1996), Angst und Hilflosigkeit (Maslach u. Jackson, 1982). Die physischen
Beschwerden äußern sich vor allem in Form von Müdigkeit, Schlaflosig-
keit, Kopfschmerzen und Magenbeschwerden (Schaufeli u. Enzmann,
1998).
Ebenso wie Freudenberger geht auch Maslach davon aus, dass belastete
Helfer gewisse Merkmale in der Persönlichkeit aufweisen, die dazu führen,
dass der eine Helfer an einer belastenden Situation zerbricht, während ande-
re die gleiche Situation scheinbar belastungsfrei überstehen (Buchka u.
Hackenberg, 1987, S. 69).
2.1.1 Personenmerkmale als Determinanten von Burnout
Als verursachend in der Person des Helfenden werden von Maslach und
Kollegen primär Verzerrungen in der Selbst- und Fremdbeobachtung ange-
führt, welche bei der Entstehung von emotionaler Erschöpfung, Depersona-
lisierung und reduzierter persönlicher Leistungsfähigkeit entscheidend sind.
Nach Ansicht von Maslach et al. attribuieren ausgebrannte Helfer eher
internal. Internal attribuierende Helfer erkennen zwar die Belastungssitua-
tionen der Arbeit, suchen jedoch den Fehler bei sich selbst, wodurch sich
Versagensgefühle, Selbstwertverlust und depressive Zustände entwickeln.
Daraufhin beginnen die Helfenden noch härter zu arbeiten, was den Burn-
outprozess weiter beschleunigt.
Die Ergebnisse zum Zusammenhang von Kontrollüberzeugung bzw.
Selbstwirksamkeit (Erwartung eines Menschen, eine schwierige Herausfor-
derung meistern zu können) und Burnout zeigen einen eindeutigen negati-
ven Effekt (Jeannau u. Armelius, 2000; Pfennig u. Hüsch, 1994; Janssen,Burnout bei Ärzten 193
Schaufeli u. Houkes, 1999; Masclet u. Mineure, 1999), allerdings bleibt die
Richtung des Effekts unklar. Nämlich die Frage, ob eine geringe Selbst-
wirksamkeit Burnout erzeugt, die Kausalität in umgekehrter Richtung ver-
läuft oder ob beide Variablen durch einen dritten Faktor gemeinsam beein-
flusst werden.
Als weitere potentielle Determinanten sind vor allem demographische
Variablen wie Alter, Geschlecht, Familienstatus, Bildung und Dauer der
beruflichen Tätigkeit in zahlreichen empirischen Studien untersucht wor-
den. Maslach (1985) identifizierte in ihren empirischen Untersuchungen
bestimmte sozio-demographische Variablen, die das Eintreten von Burnout
begünstigen können. Es stellte sich etwa heraus, dass
– das Ausbrennen Männer wie Frauen betrifft
– Männer eher zu Entpersönlichung (»Dehumanisierung«) neigen
– jüngere Helfer signifikant häufiger betroffen sind (besonders in den
ersten fünf Berufsjahren)
– unverheiratete Helfer häufiger vom Ausbrennen betroffen sind
– das Ausbrennen bei jüngeren, unverheirateten Helfern dramatischer
verläuft als bei älteren, verheirateten (vgl. Maslach, 1985, S. 261).
Schaufeli und Enzmann (1998) zeigen in ihrer Übersichtsarbeit, dass vor
allem Alter deutlich mit Burnout korreliert. Ältere Arbeitnehmer neigen
seltener unter Burnout. Dennoch ist dieser in vielen Studien gezeigte nega-
tive Zusammenhang von Lebensalter und Burnout vorsichtig zu interpretie-
ren. Cherniss konnte aufgrund einer Langzeituntersuchung an Berufsanfän-
gern (1989) zeigen, dass ein subjektiv empfundenes Burnout ein signifikan-
ter Prädiktor für das frühzeitige Aussteigen aus dem Beruf darstellt. In der
Wiederholungsbefragung nach 12 Jahren arbeiteten vor allem jene Helfer
weiterhin in ihrem Beruf, die keine oder nur sehr geringe Ausprägungen
von Burnout aufwiesen.
Hinsichtlich der Frage, ob Männer oder Frauen unterschiedlich stark von
Burnout betroffen sind, zeigen Studien widersprüchliche Ergebnisse. Wäh-
rend einige Ergebnisse zeigen, dass vor allem Männer hohe Werte im Be-
reich der Depersonalisierung aufweisen (u. a. Vredenburgh, Carlozzi u.
Stein, 1999; Morgan, VanHaveren u. Pearson, 2002; Gursel, Murat Sunbul
u. Sari, 2002), zeigen die Ergebnisse anderer Studien, dass Frauen stärker
betroffen sind (u. a. Agust Nieto, Grau u. Beas, 2001, Van Emmerick u.
Euwema, 2001). Aufgrund dieser Datenlage kommt Rösing zum Schluss,
dass die Forschung in dieser Frage keine Klarheit liefert (Rösing, 2003,
S. 95).194 O. Ommen, E. Driller, C. Janßen, P. Richter und H. Pfaff 2.1.2 Arbeitsbezogene Korrelate Neben diesen auf die Persönlichkeit des Helfers fokussierten Analysen über die Entstehung von Burnout thematisieren die nachfolgend dargestellten Arbeiten schwerpunktmäßig die Arbeitsbedingungen als Auslöser für Burn- out. Zu den arbeitsorganisatorischen Faktoren, welche das Entstehen von Burnout begünstigen, zählen Maslach (1982), Büssing u. Schmitt (1998), Schaufeli u. Enzmann (1998), Demerouti (2000) sowie Cheuk, Swearse, Wong u. Rosen (1998) folgende Faktoren: – Mangel an positivem Feedback – Hierarchieprobleme – administrative Zwänge – eine schlechte Teamarbeit – Druck von Vorgesetzten – schlechte Arbeitsorganisation – mangelnde Personal- und Finanz-Ressourcen – hohe Arbeitbelastung – hoher Zeitdruck – geringe Autonomie In dem arbeits- und organisationspsychologisch geprägten Ansatz von Cherniss (1980) stellt Stress die zentrale Determinante zur Entstehung von Burnout dar. Cherniss hat daher einen stresstheoretischen Ansatz im Sinne des transaktionalen Stresskonzeptes von Lazarus und Folkman (1984) in die Forschung zum Burnout-Konzept eingeführt. Burnout wird dabei als ein Prozess definiert, in welchem sich ein ursprünglich engagierter Professio- neller als Reaktion auf in der Arbeit erfahrenen Stress von seiner Arbeit zurückzieht. Cherniss (1980) begründet Burnout aus dem Zusammenwirken von arbeitsbezogenem Stress und defensiven Copingstrategien. Nach dieser These sind die Helfenden nicht mehr in der Lage, dem erlebten Stress durch aktive Bewältigung zu begegnen. In einer Schutzreaktion bzw. einer defen- sive Bewältigungsstrategie ziehen sich die Helfenden zurück und wenden sich schließlich ganz von der Arbeit bzw. den Klienten ab. Als potentielle Stressquellen identifizierte Cherniss (1980, S. 210f.) vor allem folgende Faktoren: – Kompetenzkrise – schwierige Klienten – bürokratische Hindernisse – Monotonie sowie – mangelnde Kollegialität
Burnout bei Ärzten 195 In weiteren Studien über arbeitsorganisatorische Korrelate zu Burnout konnten Cherniss und Krantz (1983) zeigen, dass Stressoren im beruflichen Alltag nur dann zu Burnout führen, wenn die Bedeutsamkeit der eigenen Arbeit nicht mehr empfunden wird bzw. ein ursprünglich gemeinsam getra- genes Wertesystem in Frage gestellt wird. Ideologien wie Religion oder eine gemeinsame Werte- und Vertrauenskultur vermitteln dagegen den einzelnen, beschäftigten Personen einen Sinn- und Bedeutungsrahmen (vgl. Rook, 1998, S. 50). Die Richtigkeit und Sinnhaftigkeit des beruflichen Handelns steht innerhalb einer wertekonsistenten Gemeinschaft nicht zur Disposition (vgl. Cherniss u. Krantz, 1983, S. 201). Menschen, die einen Sinn in ihrer Arbeit sehen und sich sozial eingebunden fühlen, sind nach den Ergebnissen von Cherniss und Krantz deutlich stress- und burnout- resistenter (Cherniss u. Krantz, 1983). 3 Sozialkapital am Arbeitsplatz – ein potentieller Schutzfaktor?! Vom Sach- und Humankapital wird das Sozialkapital unterschieden. Dieses findet seinen Ausdruck unter anderem in gemeinsamen Überzeugungen und Werten sowie in den sozialen Beziehungen zwischen den Mitgliedern einer Organisation (Badura u. Hehlmann, 2003). Die Bedeutung des Sozialkapi- tals einer Organisation konnte schon in eigenen Studien über das Sozialka- pital in Arbeitsgruppen in Form von Gruppenkohäsion dargestellt werden (Pfaff, 1989; Pfaff, Badura, Pühlhofer u. Siewerts, 2005). Der Sozialkapital- Ansatz gewinnt bei gesundheitswissenschaftlichen Untersuchungen zuneh- mend an Bedeutung, da diese Betrachtungsweise nicht nur zur Prognose des wirtschaftlichen Erfolges (Sabatini, 2006), sondern auch zur Prognose von Wohlbefinden und Gesundheit der Mitarbeiter geeignet erscheint. Das Sozialkapital kann als soziale Ressource, welche die Bewältigung von Be- lastungen unterstützt und salutogenetisches Potential besitzt, erachtet wer- den. Der Begriff Sozialkapital wurde von dem französischen Soziologen Bourdieu definiert als »Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von Beziehungen verbunden sind« (Bourdieu, 1983). Der amerika- nische Soziologe Coleman beschreibt Sozialkapital folgendermaßen: »Im Unterschied zu anderen Kapitalformen besteht Sozialkapital aus der Struk- tur der Beziehungen zwischen Personen. Es ist weder in Menschen noch in den physischen Produktionsmitteln verkörpert.« (Coleman, 1990). So konn- te die sozialepidemielogische Forschung der letzten 20 Jahre zeigen, dass als hilfreich und positiv erachtete soziale Beziehungen das Allgemeinbefin- den fördern und vor psychischen und körperlichen Schäden schützen kön- nen und möglicherweise sogar eine lebensverlängernde Wirkung haben
196 O. Ommen, E. Driller, C. Janßen, P. Richter und H. Pfaff
(Badura et al., 1987; Berkman u. Kawachi, 2000). Des Weiteren ist davon
auszugehen, dass nicht nur Individuen sondern auch komplexe Organisatio-
nen, wie zum Beispiel Krankenhäuser oder Arztpraxen, über Sozialkapital
verfügen. Wichtige Bestandteile des Sozialkapitals sind insbesondere das
Vorhandensein kollektiver Werte und Überzeugungen sowie eine gemein-
same Vertrauensbasis zwischen den Mitgliedern einer Organisation (Badura
u. Hehlmann, 2003). Somit kann – ausgehend von wirtschaftswissenschaft-
lichen, soziologischen und gesundheitswissenschaftlichen Konzepten und
Erkenntnissen – das Sozialkapital als Merkmal sozialer Systeme definiert
werden, das die Leistungsfähigkeit und Gesundheit ihrer Mitglieder fördern
bzw. verbessern kann (Janssen u. Pfaff, 2005). Aus der Unterstützungs- und
Netzwerkforschung ist zudem bekannt, dass die soziale Vernetzung des
Menschen maßgeblichen Einfluss auf seine Leistungsfähigkeit, Gesundheit
sowie sein emotionales Gleichgewicht haben kann. Stabilität, Umfang und
Funktionalität der sozialen Netze haben hierbei einen modulierenden Ein-
fluss auf Kognitionen, Motivation und Emotionen (Henderson, 1980;
Hammer, 1981; Badura u. Waltz, 1984; Cohen, 1988; Schwarzer u. Leppin,
1989; Röhrle, 1994). Ein erfolgreich etabliertes Klima des Vertrauens sowie
die Teilhabe an gemeinsamen Werten und Überzeugungen könnten aus
dieser Forschungsperspektive betrachtet dazu beitragen, die Zusammenar-
beit zu erleichtern und die Arbeitswelt berechenbarer zu machen. Unsicher-
heit, Ungewissheit und Desorientierung können auf diese Weise vermindert
werden. Die zentrale Grundannahme dieser Arbeit, die sich unmittelbar aus
den dargestellten Studienergebnissen ableiten lässt, lautet demgemäß: »Es
besteht ein Zusammenhang zwischen dem Sozialkapital einer Organisation,
z. B. eines Krankenhauses, und dem potentiellen Burnout-Risiko der Mitar-
beiter.«
4 Eigene Untersuchung
4.1 Fragestellung
Der Einfluss des Selbstwirksamkeitserlebens und die subjektiv eingeschätz-
te Sinnhaftigkeit am Arbeitsplatz konnte in zahlreichen Studien nachgewie-
sen werden (Cherniss, 1989; Brouwers u. Tomic, 1998 u. a.). Insgesamt ist
jedoch der Forschungsstand zum Zusammenhang zwischen Sozialkapital im
Krankenhaus und der Entstehung bzw. dem Ausmaß von Burnout bei Ärz-
ten als eher rudimentär einzuschätzen. Diese Forschungslücke beabsichtigt
der vorliegende Beitrag zu schließen. Das Ziel der Untersuchung besteht
darin, neben dem Einfluss persönlicher Faktoren (Soziodemographie,Burnout bei Ärzten 197
Selbstwirksamkeitserleben, Sinnhaftigkeit der beruflichen Tätigkeit) den
Einfluss des Sozialkapitals am Arbeitplatz auf Burnout zu untersuchen. Der
Fokus dieser Studie soll hierbei auf emotionalem Burnout liegen. Nach
Definition von Maslach und Jackson (1984) handelt es sich hierbei um die
erste Stufe des Burnouts (siehe oben).
Welchen Einfluss haben persönliche Faktoren sowie das
Sozialkapital im Krankenhaus auf emotionales Burnout?
Persönliche Faktoren:
Alter, Geschlecht, Familienstand,
Berufserfahrung, Selbstwirksam-
keit, Sinnhaftigkeit emotionales
Burnout
Sozialkapital
im Krankenhaus
Abbildung 1: Untersuchungsmodell der vorliegenden Studie
4.2 Daten und Methode
Die nachfolgenden Analysen basieren auf Daten des BMBF-Forschungs-
projektes »Unternehmensführung mit biopsychosozialen Kennzahlen«
(U-BIKE-Studie). Im Rahmen dieser Studie wurde der hier eingesetzte Fra-
gebogen MIKE (Mitarbeiterkennzahlenbogen) eingesetzt. Hierbei handelt
es sich um ein modular aufgebautes Befragungsinstrumentarium, mit dem
valide Kennzahlen zum Thema »Krankenhaus aus der Sicht der Mitarbei-
ter« erhoben werden können (vgl. auch Pühlhofer u. Stoll, 2004). Die Er-
gebnisse der Befragung lassen Rückschlüsse auf subjektiv erlebte Arbeits-
bedingungen zu.
In die U-BIKE-Studie wurden neben ärztlichem und pflegerischem Per-
sonal auch Verwaltungskräfte sowie Mitarbeiter der technischen Dienste
einbezogen. Es wurden insgesamt 2.644 Mitarbeiter aus vier Krankenhäu-
sern angeschrieben. Dabei wurden zwei Häuser in Ost- und zwei in West-
deutschland einbezogen, von denen zwei Maximal- und zwei Grundversor-
gung anbieten. 1.645 Krankenhausmitarbeiter beteiligten sich an der Erhe-
bung, was einer Rücklaufquote von 62,2 Prozent entspricht. Davon waren
277 der Befragten Ärzte, welche die Stichprobe der vorliegenden Untersu-
chung bilden.198 O. Ommen, E. Driller, C. Janßen, P. Richter und H. Pfaff 4.2.1 Messinstrumente Die Operationalisierung der abhängigen Variable erfolgte durch die Kenn- zahl »Burnout – emotionale Erschöpfung« nach Schaufeli et al. (1996). Dieses international etablierte Messinstrument (Cronbach´s Alpha: 0.85) wird durch folgende fünf Items gebildet: »Ich fühle mich emotional leer in meiner Arbeit«, »Ich fühle mich am Ende des Arbeitstages verbraucht.«, »Ich fühle mich müde, wenn ich morgens aufstehe und an meine Arbeit denke.«, »Jeden Tag zu arbeiten, ist wirklich eine Belastung für mich.«, »Ich fühle mich durch meine Arbeit ausgebrannt.«. Der Befragte hat die Möglichkeit zwischen sieben vorgegebenen Antwortkategorien auszuwählen. Jeder Antwortkategorie wird hierbei ein Punktwert zwischen 1 und 7 zuge- ordnet: (1) nie, (2) einige Male pro Jahr oder weniger, (3) einmal im Monat oder weniger, (4) mehrmals im Monat, (5) einmal in der Woche, (6) mehr- mals in der Woche und (7) täglich. Die Addition der Punktwerte der fünf Items führt schließlich zu einem Summenscore der Kennzahl »Burnout – emotionale Erschöpfung«. Somit können bei der Beantwortung dieser Kenn- zahl minimal 5 und maximal 35 Punkte erreicht werden. Die Angaben zu Alter, Geschlecht, Familienstand und Berufserfahrung erfolgten durch Selbstangabe in dem verwendeten Erhebungsinstrument. Die Variable »Selbstwirksamkeit« ist ein Maß für das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. Operationalisiert wird diese Variable (Cronbach´s Alpha: 0.87) durch die gleichnamige 10 Items umfassende Kennzahl von Jerusalem u. Schwarzer aus dem Jahre 1981 (z. B. »Wenn sich Widerstände auftun, finde ich Mittel und Wege, mich durchzusetzen«, »Die Lösung schwieriger Probleme gelingt mir immer, wenn ich mich darum bemühe«, »Wenn eine neue Sache auf mich zukommt, weiß ich, wie ich damit umge- hen kann« und »Wenn ein Problem auftaucht, kann ich es aus eigener Kraft meistern«). Der Befragte hat die Möglichkeit, zwischen vier vorgegebenen Antwortkategorien auszuwählen. Jeder Antwortkategorie wird hierbei ein Punktwert zwischen 1 und 4 zugeordnet: (1) stimmt nicht, (2) stimmt kaum, (3) stimmt eher und (4) stimmt genau. Somit können bei der Beantwortung dieser Kennzahl mindestens 10 und maximal 40 Punkte erreicht werden. Die Variable »Sinnhaftigkeit« ist ein Einzelitem, das aus der Skala »Innere Kündigung« (McKee, Markham u. Scott, 1992) entnommen wurde und lautet: »Ich sehe einen Sinn in meiner Arbeit«. Der Befragte hat die Möglichkeit, zwischen vier vorgegebenen Antwortkategorien auszuwählen. Jeder Antwortkategorie wird hierbei ein Punktwert zwischen 1 und 4 zuge- ordnet: (1) trifft nicht zu, (2) trifft weniger zu, (3) trifft eher zu und (4) trifft völlig zu. Somit können bei der Beantwortung dieser Kennzahl mindestens einer und maximal vier Punkte erreicht werden. Die Variable »Sozialkapital im Krankenhaus« (Cronbach´s Alpha: 0.91) stellt ein Maß für das werte- und vertrauensbasierte Betriebsklima dar
Burnout bei Ärzten 199
(Pfaff, Lütticke, Badura, Piekarski u. Richter, 2004) und besteht aus insge-
samt 9 Items (z. B. »In unserem Haus herrschen Einigkeit und Einverständ-
nis vor«, »In unserem Haus haben wir Vertrauen zueinander«, »In unserem
Haus vertreten wir viele Werte gemeinsam« oder »In unserem Haus verfol-
gen die Menschen ganz unterschiedliche Ziele«). Der Befragte hat die Mög-
lichkeit, zwischen vier vorgegebenen Antwortkategorien auszuwählen. Jeder
Antwortkategorie wird hierbei ein Punktwert zwischen 1 und 4 zugeordnet:
(1) stimme überhaupt nicht zu, (2) stimme eher nicht zu, (3) stimme eher zu
und (4) stimme voll und ganz zu. Bei der Beantwortung dieser Kennzahl
können mindestens 9 und maximal 36 Punkte erreicht werden.
Die nachfolgenden Ergebnisse beruhen auf der Durchführung einer mul-
tivariaten linearen Regression mit »emotionalem Burnout« als abhängige
Variable.
4.3 Ergebnisse
In der Tabelle 1 sowie in der Tabelle 2 sind die deskriptiven Ergebnisse der
abhängigen sowie der unabhängigen Variablen dargestellt. 163 der in der
vorliegenden Studie befragten Krankenhausärzte sind männlich (58,8 %),
114 weiblich (41,2 %). Das Alter der Befragten lag zum Zeitpunkt der
Datenerhebung bei durchschnittlich 40 Jahren, dabei war der jüngste be-
fragte Arzt 26 und der älteste 64 Jahre alt (Standardabweichung: 9,9 Jahre).
167 Ärzte gaben an, verheiratet zu sein (60,3 %). 89 Ärzte (32.1 %) hatten
zum Zeitpunkt der Befragung eine 1- bis 5-jährige Berufserfahrung vor-
zuweisen, 111 Ärzte (40,1 %) eine 6- bis 16-jährige Berufserfahrung und
77 Ärzte (27,8 %) gaben »17 Jahre und mehr« Berufserfahrung an. Tabelle 2
zeigt die Verteilung der befragten Ärzte/innen auf die jeweilige Fachabtei-
lung.
Tabelle 1: Deskriptive Ergebnisse der soziodemographischen Analyse-Variablen
Variable Operationalisierung, Wert & Verteilung bzw. n & Prozentwert
Alter bei Erhebung in Jahren (MW=40; SD=9.9)
Geschlecht 1 = Mann (n=163; ≙ 58,8%);
2 = Frau (n=114; ≙ 41,2%)
Familienstand 1 = verheiratet (n= 167; ≙ 60,3%);
2 = ledig (n= 110; ≙ 39,7%)
Berufserfahrung 1 = 1-5 Jahre (n=89; ≙ 32,1%)
2 = 6-16 Jahre (n=111; ≙ 40,1%)
3 = 17 Jahre und mehr (n=77; ≙ 27,8%)200 O. Ommen, E. Driller, C. Janßen, P. Richter und H. Pfaff
Tabelle 2: Verteilung der befragten Ärzte/innen auf die jeweilige Fachabteilung
Fachabteilung Häufigkeit Prozent
Innere Medizin (z. B. Kardiologie, Hämatologie-Onkologie) 82 29,6
Visceral- und Gefäßchirurgie 57 20,8
Psychiatrie 24 8,6
Frauenklinik 23 8,3
Neurologie 14 5
Kinderklinik 4 1,4
Anästhesie 2 0,7
Psychosomatik 1 0,3
Neurochirurgie 1 0,3
keine Angabe 69 25
Gesamt 277 100
Die deskriptiven Ergebnisse der stetigen Analyse-Variablen sowie der Ziel-
variable »emotionale Erschöpfung« können der nachfolgenden Tabelle 3
entnommen werden:
Tabelle 3: Deskriptive Ergebnisse der stetigen Analyse-Variablen
Variable Operationalisierung MW SD Min Max
Sozialkapital im Summenscore der Kennzahl
Krankenhaus »Werte- und Vertrauenskapital« 21.6 5.2 10 36
nach Pfaff et al. (2004)
Selbstwirksamkeit Summenscore der Kennzahl
»Selbstwirksamkeit« nach 30.2 3.6 14 40
Jerusalem u. Schwarzer (1981)
Sinnhaftigkeit Einzelitem der Kennzahl
»Innere Kündigung« nach 3.48 0.6 1 4
McKee et al. (1992)
Burnout – Summenscore der Kennzahl
emotionale Erschöpfung »emotionales Burnout« nach 16.9 6.3 5 34
Schaufeli et al. (1996)
Die abhängige Variable »emotionale Erschöpfung« ist nach Testung durch
den Kolmogorov-Smirnov-Test normalverteilt. In der nachfolgenden Tabel-
le 4 sind nur die signifikanten Variablen der durchgeführten Linearen Reg-
ression dargestellt. Keine Signifikanz zeigten in dem durchgeführten linea-
ren Modell die soziodemographischen Variablen Alter, Familienstand und
Berufserfahrung. Neben den im Untersuchungsmodell dargestellten persön-Burnout bei Ärzten 201
lichen Faktoren Geschlecht, Selbstwirksamkeit und Sinnhaftigkeit zeigte
sich das subjektiv beurteilte Sozialkapital des Krankenhauses als hochsigni-
fikanter Einflussfaktor (siehe Tabelle 4). Je höher die befragten Ärzte das
Sozialkapital des Krankenhauses einschätzen, desto geringer ist die Wahr-
scheinlichkeit für das Auftreten von emotionaler Erschöpfung. Das vorlie-
gende Modell hat eine Varianzaufklärung von 32 %.
Tabelle 4: Signifikante Ergebnisse der linearen Regression
Standardisierter Standardfehler p-Wert
Koeffizient
Geschlecht -.157 .653 .002**
Selbstwirksamkeit -.384 .093 .000***
Sinnhaftigkeit -.137 .553 .013*
Sozialkapital im Krankenhaus -.192 .064 .000***
Korrigiertes R2 .320
*Abhängige Variable: Burnout – emotionale Erschöpfung;
* p ≤ 0.05; ** p ≤ 0.01; *** p ≤ 0.001
5 Diskussion und Fazit
Der vorliegende Beitrag untersucht den Zusammenhang zwischen dem
Sozialkapital am Arbeitplatz und der Ausprägung emotionaler Erschöpfung
bei Krankenhausärzten. Neben der interessierenden Variable, dem subjektiv
wahrgenommenen Sozialkapital des Krankenhauses, wurde das gewählte
Untersuchungsmodell der Vollständigkeit halber ergänzt durch bereits em-
pirisch gesicherte Determinanten emotionaler Erschöpfung wie z. B. demo-
graphische und berufliche Faktoren sowie dem Vorhandensein personeller
Ressourcen. Die Operationalisierung der abhängigen Variable erfolgt durch
das international etablierte Instrument »Burnout – emotionale Erschöpfung«
nach Schaufeli et al. (1996).
Die vorliegenden Untersuchungsergebnisse zeigen deutlich erhöhte Mit-
telwerte der abhängigen Variable »Burnout – emotionale Erschöpfung« und
liefern somit einen ernstzunehmenden Hinweis auf ein stark erhöhtes
Burnout-Risiko innerhalb der befragten Population (Kalimo, Pahkin, Muta-
nen u. Toppinen-Tanner, 2003). Darüber hinaus kann ein negativer Zusam-
menhang zwischen dem männlichen Geschlecht, der Sinnhaftigkeit der ärzt-
lichen Tätigkeit, dem Selbstwirksamkeitserleben sowie dem Sozialkapital
innerhalb des Krankenhauses nachgewiesen werden. Insbesondere die bei-202 O. Ommen, E. Driller, C. Janßen, P. Richter und H. Pfaff den letztgenannten Faktoren zeigen hierbei einen hochsignifikanten Ein- fluss. Konkret bedeutet dies, dass insbesondere ein schwach ausgeprägtes Selbstwirksamkeitserleben sowie ein gering eingeschätztes Sozialkapital innerhalb des Krankenhauses erhöhte Risikofaktoren für das Auftreten emotionaler Erschöpfung bei den befragten Klinikärzten darstellen. Die stressreduzierende, präventive und gesundheitsförderliche Bedeutung personaler Ressourcen, wie z. B. Kontrollüberzeugung, positiver Selbstwert oder positive Selbstwirksamkeitserwartung konnte bereits in anderen Stu- dien nachgewiesen werden (siehe Kapitel 2.1.1). Das männliche Geschlecht als potentieller Risikofaktor für emotionale Erschöpfung bei Ärzten steht hingegen in einem gewissen Widerspruch zu den Ergebnissen anderer Untersuchungen. Hier zeigte insbesondere das weibliche Geschlecht ein erhöhtes Risiko für die Entwicklung von emotionalem Burnout (Maslach, Schaufeli u. Leiter, 2001, S. 410). Keinen signifikanten Zusammenhang wiesen in dieser Untersuchung das Alter zum Zeitpunkt der Befragung, der Familienstand und die Berufserfahrung auf. Das nichtsignifikante Ergebnis der Dauer der Berufstätigkeit könnte unter anderem damit erklärt werden, dass Ärzte, welche ein Burn-Out-Syndrom entwickeln, eher aus dem Be- rufsleben ausscheiden, sodass langfristig nur noch diejenigen im Berufs- leben verbleiben, die ein solches Syndrom nicht entwickeln (sogen. healthy worker effect; Haisch, Weitkunat u. Wildner, 1999). Dieser Effekt kann je- doch nur mit Langzeit-Studien kontrolliert werden. Eine mögliche protektive Funktion durch einen Ehepartner – im Sinne der sozialen Unterstützung – konnte in der vorliegenden Studie nicht gezeigt werden, dass heißt, die Tatsache, ob der Befragte verheiratet ist oder nicht, hat bei diesen Daten keine Auswirkung auf die Höhe der emotionalen Erschöpfung. Die aufgeklärte Varianz des vorliegenden Untersuchungsmodells beträgt 32 %, was im Kontext sozialwissenschaftlicher Untersuchungen durchaus als gutes bis befriedigendes Ergebnis gewertet werden kann. Daneben je- doch sind die dargestellten Ergebnisse vor dem Hintergrund verschiedener methodischer Begrenzungen zu sehen. Da es sich bei der vorliegenden Arbeit nicht um ein reines Experiment mit kontrollierten Versuchsbedin- gungen handelt, sondern um eine Felduntersuchung, die mehr Erklärungs- alternativen bietet, ist die interne Validität begrenzt. Eine methodische Einschränkung der Aussagekraft der gewonnenen Er- gebnisse ergibt sich dadurch, dass es sich aufgrund der Verwendung der ausgewählten Stichprobe um ein selektives Befragtengut handelt und die externe Validität daher eingeschränkt ist. Die Ergebnisse können demzufol- ge nicht vorbehaltlos auf die Mitarbeiter deutscher Krankenhäusern über- tragen werden. Allerdings wurde durch die gezielte Auswahl von Kranken- häusern in Ost- und West-Deutschland, und zwar sowohl der Grund- als auch der Maximalversorgung versucht, wirklich typische Krankenhaus-
Burnout bei Ärzten 203
konstellationen in den Daten zu berücksichtigen. Positiv ist anzumerken,
dass eine Ausschöpfungsquote von 62 % erreicht wurde. Dieses Ergebnis
ist bei sozialwissenschaftlichen Befragungen als sehr zufrieden stellend zu
bewerten (Borg, 2003).
Trotz aller methodischen Einschränkungen deutet das Ergebnis dieser
Untersuchung darauf hin, dass das Bemühen um ein gutes Betriebsklima,
die Bereitschaft sich gegenseitig zu unterstützen und die Verfolgung ge-
meinsamer Werte und Ziele innerhalb eines Krankenhauses das Risiko
eines emotionalen Burnouts bei Ärzten vermindern kann.
Um das Sozialkapital im Krankenhaus zu stärken und somit eine Kultur
des Vertrauens, der Kooperation und der Veränderungsbereitschaft zu för-
dern, kann die Etablierung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements
hilfreich sein. Hierbei können mittels regelmäßig durchgeführter Mitar-
beiterbefragungen frühzeitig Problemlagen im Krankenhaus als auch bei
den Betroffenen selbst identifiziert werden. Darüber hinaus sind regel-
mäßige Teambesprechungen und/oder Supervisions-Sitzungen geeignete
Maßnahmen zur Stärkung des Sozialklimas im Krankenhaus sowie zur Ver-
besserung der Kommunikationsstrukturen. Zudem sollten im Rahmen regel-
mäßiger betriebsärztlicher Untersuchungen neben den körperlichen Befun-
den auch die psychischen Determinanten für Burnout der klinisch tätigen
Ärzte mittels standardisierter Instrumente in Kombination mit einer geziel-
ten Anamnese erfasst werden.
Neben diesen berufsbegleitenden Ansätzen zur Verminderung und Ver-
meidung von Burnout sollten junge, angehende Mediziner auch schon wäh-
rend des Studiums hinsichtlich dieses Berufsrisikos sensibilisiert werden.
Entsprechende Inhalte wie etwa der Umgang mit belastenden Situationen
sowie Schulungen zur Selbstwahrnehmung von Stressreaktionen des eige-
nen Körpers – mit dem Ziel frühzeitig professionelle Hilfe in Anspruch zu
nehmen – sind dabei unseres Erachtens unbedingt in das Curriculum zu
implementieren.
Literatur
Agust Nieto, S., Grau, R., Beas, M. (2001). Burnout en mujeres: Un estudio comparativo entre
contextos de trabajo y no trabajo. A nsiedad y Estrés 7(1), 79–88.
Aronson, E., Kafry, D., Pines, A. M. (1983). Ausgebrannt: vom Überdruss zur Selbstentfaltung.
Stuttgart: Klett-Cotta.
Badura, B., Hehlmann, T. (2003). Betriebliche Gesundheitspolitik. Berlin: Springer.
Badura, B., Kaufhold, G., Lehmann, H., Pfaff, H., Schott, T., Waltz, M. (1987). Leben mit dem
Herzinfarkt. Eine sozialepidemiologische Studie. Berlin u. a.: Springer.
Badura, B., Waltz, E. M. (1984). Social Support and Quality of Life Following Myocar-dial
Infarction. Social Indicators Research 14, 295–311.204 O. Ommen, E. Driller, C. Janßen, P. Richter und H. Pfaff Bergner, T. (2004). Burn-out bei Ärzten – Lebensaufgabe statt Lebens-Aufgabe. Deutsches Ärzte- blatt, 101(33), A 2232–2234. Berkman, L. F., Kawachi, I. (2000). Social Epidemiology. New York: Oxford University Press. Bestmann, B. (2004). Berufsreport 2003: Geschlechterunterschiede im Beruf. Deutsches Ärzteblatt 101(12), A 776–779. Blum, K., Müller, U. (2003). Dokumentationsaufwand im Ärztlichen Dienst der Krankenhäuser. Das Krankenhaus, 7, 545–548 Borg, I. (2003). Führungsinstrument Mitarbeiterbefragung. Theorien, Tools und Praxiserfahrun- gen. Reihe: Wirtschaftspsychologie – Band 3, 3., überarbeitete und erweiterte Aufl. Göttingen: Hogrefe. Bourdieu, P. (1983). Ökonomisches Kapital, kulturelles Kapital, soziales Kapital. In R. Kreckel (Hrsg.), Soziale Ungleichheiten (S. 183–199). Soziale Welt, Sonderband 2. Göttingen: Otto Schwartz. Bovier, P. A., Perneger, T. V. (2003). Health behaviour – Predictors of work satisfaction among physicians. The European Journal of Public Health, 13(4), 299–305. Brouwers, A., Tomic, W. (1998). A longitudinal study of teacher burnout and perceived self- efficacy in classroom management. Teaching and Teacher Education, 16(2), 239–253. Buchka, M., Hackenberg, J. (1987). Das Burnout-Syndrom bei Mitarbeitern in der Behindertenhil- fe. Ursachen, Formen und Hilfen. Dortmund: Modernes Lernen. Burisch, M. (1994). Das Burnout-Syndrom: Theorie der inneren Erschöpfung. Berlin: Springer Verlag. Büssing, A., Glaser, J. (2003). Arbeitsbelastungen, Burnout und Interaktionsstress im Zuge der Reorganisation des Pflegesystems. In A. Büssing, J. Glaser (Hrsg.), Dienstleistungsqualität und Qualität des Arbeitslebens im Krankenhaus (S. 101–130). Göttingen: Hogrefe. Büssing, A., Schmitt, S. (1998). Arbeitsbelastungen als Bedingungen von emotionaler Erschöp- fung und Depersonalisation im Burnoutprozeß. Zeitschrift für Arbeits- und Organisationspsy- chologie, 42, 76–88. Cherniss, C. (1980). Staff Burnout: Job Stress in the Human Services. London: Sage Publications. Cherniss, C. (1989). Burnout in new professionals: A long-term follow-up study. Journal of Health u. Human Ressources Administration, 12, 11–24. Cherniss, C., Krantz, D. L. (1983). The Ideological Community as an Antidote to Burnout in the Human Services. In B. A. Farber (Ed.), Stress and Burnout in the Human Service Professions (pp. 198–212). New York: Pergamon Press. Cheuk, W. H., Swearse, B., Wong, K. S., Rosen, S. (1998). The linkage between spurned help and burnout among practising nurses. Current Psychology, 17, 188–196. Cohen, S. (1988). Psychosocial models of the role of social support in the etiology of physical disease. Health Psychology, 7(3), 269–297. Coleman, J. S. (1990). Foundations of social Theory. Cambridge: Harvard University Press. Demerouti, E. (2000). Die Arbeit, nicht den Menschen verändern. Ein Burnout-Modell. Psychos- cope, 21(10), 11–13. Deutsche Krankenhausgesellschaft (2006). Zahlen, Daten, Fakten 2005/2006. Düsseldorf: Deut- sche Krankenhaus Verlagsgesellschaft. Edelwich, J., Brodsky, A. (1984). Ausgebrannt sein – Das Burn-out-Syndrom in den Sozialberu- fen. Salzburg: AVM Verlag. Enzmann, D. (1996). Gestresst, erschöpft oder ausgebrannt? Einflüsse von Arbeitssituation, Em- pathie und Coping auf den Burnoutprozess. München: Profil. Enzmann, D., Kleiber, D. (1989). Helfer-Leiden. Stress und Burnout in psychosozialen Berufen. Heidelberg: Asanger Verlag. Enzmann, D., Kleiber, D. (1990). Burnout: eine internationale Bibliographie. Göttingen: Hogrefe. Farber, B. A. (1983). Stress and burnout in the human services professions. New York: Pergamon Press. Farber, B. A. (1991). Burnout bei Lehrern: Annahmen, Mythen, Probleme. In E. Terhart (Hrsg.), Unterrichten als Beruf (S. 217–230). Köln: Böhlau.
Burnout bei Ärzten 205
Firth, H., Britton, P. (1989). Burnout, absence and turnover amongst British nursing staff. Journal
of Occupational Psychology, 62, 55–59.
Freeborn, D. K. (2001). Satisfaction, commitment, and psychological well-being among HMO
physicians. Western Journal of Medicine, 174, 13–18.
Freudenberger, H. J. (1974). Staff burnout. Journal of Social Issues, 30, 159–165.
Glaser, J. (2004). Humanisierung der Humandienstleistung. Wirtschaftspsychologie aktuell, 11(4),
18–22.
Glass, D. C., McKnight, J. D. (1996). Perceived control, depressive symptomatology and profes-
sional burnout: A review of the evidence. Psychology and Health, 11, 23–48.
Grassi, L., Magnani, K. (2000). Psychiatric Morbidity and Burnout in the Medical Profession. An
Italian Study of General Practitioners and Hospital Physicians. Psychotherapy and Psychoso-
matics, 69(6), 329–334.
Gursel, M., Murat Sunbul, A., Sari, H. (2002). An analysis of burnout and job satisfaction between
Turkish headteachers and teachers. European journal of psychology of education, 17, 35–45.
Haisch, J., Weitkunat, R., Wildner, M. (1999). Wörterbuch Public Health. Göttingen: Hans Huber.
Hammer, M. (1981). Social Support, Social Networks and Schizophrenia. Schizophrenia. Bulletin,
7(1), 45–57.
Henderson, S. A. (1980). A Developement in Social Psychiatry: The Systematic Study of Social
Bonds. Journal of Nervous and Mental Disease, 168, 63–69.
Jackson, S. E., Schwab, R. L., Schuler, R. S. (1986). Toward an understanding of the burnout
Phenomenon. Journal of Applied Psychology, 71, 630–640.
Janssen, C., Pfaff, H. (2005). Psycho-social environments. In J. Kerr, R. Weitkunat, M. Moretti
(Eds.), ABC of Behavior Change. A guide to successful disease prevention and health promo-
tion. London: Elsevier.
Janssen, P. P., Schaufeli, W. B., Houkes, I. (1999). Work-related and individual determinants of
the three burnout dimensions. Work u. Stress, 13(1), 74–86.
Jeanneau, M., Armelius, K. (2000). Self-image and burn-out in psychiatric staff. Journal of Psy-
chiatric and Mental Health Nursing, 7, 399–406.
Jerusalem, R., Schwarzer, M. (1981). Fragebogen zur Erfassung der Selbstwirksamkeit. In R.
Schwarzer (Hrsg.), Skalen zur Befindlichkeit und Persönlichkeit (Forschungsbericht 5). Berlin:
Freie Universität, Institut für Psychologie.
Kalimo, R., Pahkin, K., Mutanen, P., Toppinen-Tanner, S. (2003). Staying well or burning out at
work: work characteristics and personal resources as long-term predictors. Work u. Stress,
17(2), 109–122.
Lazarus, R. S., Folkman, S. (1984). Stress, appraisal, and coping. New York: Springer Verlag.
Linzer, M., Gerrity, M., Douglas, J. A., McMurray, J. E., Williams, E. S., Konrad, T. R. (2002).
Physician Stress: Results from the physician worklife study. Stress and Health: Journal of the
International Society for the Investigation of Stress, 18(1), 37–42.
Masclet, G., Mineure, S. (1999). The relationship between the burnout and self esteem among
prison wardens. L´Encephale, 25(5), 450–460.
Maslach, C. (1982). Understanding Burnout: Definitional issues in analysing a complex phenome-
non. In W. S. Paine (Ed.), Job stress and Burnout (pp. 29–40). Beverly Hills CA: Sage.
Maslach, C. (1985). Das Problem des »Ausbrennens« bei professionellen Helfern. In E. Wacker,
J. Neumann (Hrsg.), Geistige Behinderung und soziales Leben (S. 249–265). Frankfurt: Cam-
pus Forschung, Bd. 439.
Maslach, C., Jackson, S. E. (1982). Burnout in Health Professions: A social psychological analy-
sis. In G. Sanders, J. Suls (Eds.), Social Psychology of Health and Illness (pp. 227–251). Hills-
dale: Erlbaum.
Maslach, C., Jackson, S. E. (1984). Burnout in organizational settings. In S. Oskamp (Hrsg.),
Applied social Psychology Annual (pp. 133–153). Beverly Hills: Sage.
Maslach, C., Schaufeli, W. B., Leiter, M. P. (2001). »Job burnout«. Annual Review of Psycho-
logy, 52, 397–422.206 O. Ommen, E. Driller, C. Janßen, P. Richter und H. Pfaff McKee, G. H., Markham, S. E., Scott, K. D. (1992). Job stress and employee withdrawal form work. In J. C. Quick, L. R. Murphy, J. J. Hurrell (Eds.), Stress u. well-being at work: Assess- ments and interventions for occupational mental health (pp. 153–163). Washington, DC: American Psychological Association. McManus, I. C., Winder, B. C., Gordon, D. (2002). The causal links between stress and burnout in a longi-tudinal study of UK doctors. Lancet, 359(9323), 2089–2090. Morgan, R. D., VanHaveren, R. A., Pearson, C. A. (2002). Correctional Officer Burnout: Further Analyse. Criminal Justice and Behavior, 29(2), 144. Paine, W. S. (1982). Job stress and Burnout. Beverly Hills CA: Sage. Perlman, B., Hartman, E. A. (1982). Burnout: Summary and Future Research. Human Relations, 35(4), 283–305. Pfaff, H. (1989). Streßbewältigung und soziale Unterstützung. Zur sozialen Regulierung individu- ellen Wohlbefindens. Weinheim: Deutscher Studien Verlag. Pfaff, H., Badura, B., Pühlhofer, F., Siewerts, D. (2005). Das Sozialkapital der Krankenhäuser – wie es gemessen und gestärkt werden kann. In B. Badura, H. Schellschmidt, C. Vetter (Hrsg.), Fehlzeiten-Report 2004. Gesundheitsmanagement in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen (S. 81–109). Berlin u. a.: Springer Verlag. Pfaff, H., Lütticke, J., Badura, B., Piekarski, C., Richter, P. (2004). »Weiche« Kennzahlen für das strategische Krankenhausmanagement. Stakeholderinteressen zielgerichtet erkennen und ein- beziehen. Bern u. a.: Verlag Hans Huber. Pfennig, B., Hüsch, M. (1994). Determinanten und Korrelate des Burnout-Syndroms: Eine meta- analytische Betrachtung (Determinants and correlates of the burnout syndrome: A meta- analytic approach). Berlin: Freie Universität, Psychologisches Institut. Pierce, C. M., Molloy, G. N. (1990). Psychological an biographical differences between secondary school teachers experiencing high and low levels of burnout. British Journal of Educational Psychology, 60, 37–51. Pühlhofer, F., Stoll, A. (2004). Mitarbeiterkennzahlen als strategisches Führungsintrument im Krankenhaus. In H. Pfaff, J. Lüttike, B. Badura, C. Piekarski, P. Richter (Hrsg.), »Weiche« Kennzahlen für das strategische Krankenhausmanagement. Stakeholderinteressen zielgerichtet erkennen und einbeziehen (S. 31–50). Bern u. a.: Verlag Hans Huber. Ramirez, A. J., Graham, J., Richards, M. A., Cull, A., Gregory, W. M. (1996). Mental health of hospital consultants: the effects of stress and satisfaction at work. Lancet, 16(347), 724–728. Rook, M. (1998). Theorie und Empirie in der Burnout-Forschung. Eine wissenschaftstheoretische und inhaltliche Standortbestimmung. Studienreihe Psychologische Forschungsergebnisse, Bd. 29. Hamburg: Dr. Kovaĉ Verlag. Röhrle, B. (1994). Soziale Netzwerke und soziale Unterstützung. Weinheim: Beltz. Rösing, I. (2003). Ist die Burnout-Forschung ausgebrannt? Analyse und Kritik der internationalen Burnout-Forschung. Heidelberg: Asanger Verlag. Rottenfußer, R. (1999). Studie zur Arbeitszufriedenheit der Vertragsärzte: Viele Kassenärzte füh- len sich ausgebrannt. Deutsches Ärzteblatt, 96, A 610–613. Sabatini, F. (2006). Does Social Capital Improve Labour Productivity in Small and Medium Enterprises? In Working Paper No. 92, University of Rome La Sapienza, Department of Public Economics. Schaufeli, W. B., Enzmann, D. (1998). The burnout companion to study and research: A critical analysis. London: Taylor u. Francis. Schaufeli, W. B., Leiter, M., Maslach, C., Jackson, S. E. (1996). MBI – General Survey. In C. Mas- lach, S. E. Jackson, M. P. Leiter (Eds.), Maslach Burnout Inventory Manual, 3rd. ed. (pp. 19– 26). Palo Alto, CA.: Consulting Psychologists Press. Schaufeli, W. B., Maslach, C., Marek, T. (1993). Professional burnout: recent developments in theory and research. London: Taylor u. Francis. Schwarzer, R., Leppin, A. (1989). Sozialer Rückhalt und Gesundheit: Eine Metaanalyse. Göttin- gen: Hogrefe.
Burnout bei Ärzten 207 Shanafelt, T. D., Bradley, K. A., Wipf, J. E., Back, A. C. (2002). Burnout and self-reported patient care in international medicine programs. Annals of Internal Medicine, 136, 358–367. Spickard, A. Jr., Gabbe, S. G., Christensen, J. F. (2002). Mid-career burnout in generalist and specialist physicians. JAMA, 288(12), 1447–1450. Van Emmerick, H., Euwema, M. (2001). At risk of burnout: Geneder and faculty differences within academia. In J. De Jonge, P. Vlerick, A. Büssing, W. B. Schaufeli (Eds.), Organizatio- nal Psychology and Health Care at the Start of a New Millenium (pp. 123–138). München u. a: Rainer Kampp Verlag. Vredenburgh, L. D., Carlozzi, A. F., Stein, L. B. (1999). Burnout in counseling psychologists: type of practice setting and pertinent demographics. Counselling psychology quarterly, 12(3), 293– 302. Wagner, P. (1993). Ausgebrannt: Zum Burnout Syndrom in helfenden Berufen. Bielefeld: KT Verlag.
Sie können auch lesen