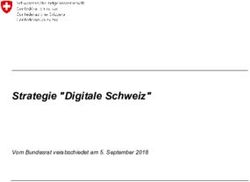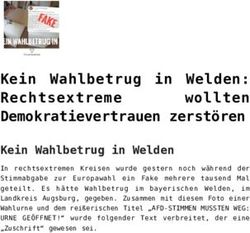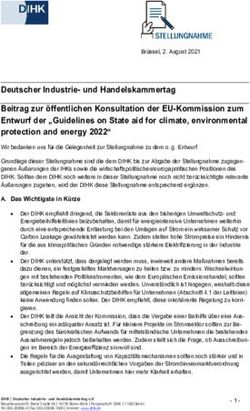DIE ÖSTERREICHISCHE FAHRZEUGINDUSTRIE - innovativ, technologieoffen & nachhaltig
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Executive Summary _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2
Intro, begriffliche Abgrenzung & Terminologie _ _ _ _ _ _ _ _ 6
Quo Vadis – Automobilwirtschaft _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 8
Was leistet die Branche für Österreich? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 9
Wie tickt die Branche? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _10
Wie nehmen Politik und Öffentlichkeit die Branche wahr? _ _ _11
Wettbewerbsfähigkeit und Technologieoffenheit _ _ _ _ _ _12
Antriebstechnologien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _13
Digitalisierung _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _15
Chance Werkstoffe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _15
Herausforderung Fachkräfte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16
Steuern und Abgaben _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _16
Notwendige Infrastruktur _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _17
Maßnahmenempfehlungen für einen
wettbewerbsfähigen Mobilitätsstandort Österreich _ _ _ _ 18
Antriebstechnologien _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _20
Digitalisierung _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _20
Werkstoffe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _21
Fachkräfte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _21
Steuerpolitischer Rahmen _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22
Infrastruktur _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _22
3DIE FAHRZEUG- DIE BRANCHE LEISTET VIEL FÜR DIE MENSCHEN
INDUSTRIE IST EINE Kaum eine andere Branche hat so viel für Innovation, Digitalisierung und
LEITBRANCHE Ökologisierung geleistet wie die Fahrzeugindustrie. Der daraus resultie-
Die Fahrzeugindustrie ist rende Mehrwert für die Menschen muss anerkannt und kommunikativ
eine Leitbranche mit enormer besser genutzt werden. Das Auto der Zukunft und die damit einherge-
Bedeutung für Innovation, hende Mobilität sind höchst attraktiv für die Nutzer und Nutzerinnen,
Arbeitsplätze und Wohlstand sicher, komfortabel und gleichzeitig umweltfreundlich und nachhaltig.
in Österreich. Änderungen
der Rahmenbedingungen
haben gravierende Auswir- BELASTUNGSSTOPP FÜR DIE INDIVIDUALMOBILITÄT
kungen auf das Land und die Verbotsmäßige Beschränkungen der individuellen Freiheit oder fal-
Menschen, die hier leben. sche Anreize, die den Mobilitätsbedürfnissen gerade der erwerbstä-
tigen Bevölkerung widersprechen, sind nicht Teil einer zukunfts- und
lösungsorientierten Mobilitätspolitik. Für eine wirksame Förderung
nachhaltiger Mobilität braucht es eine ausschließlich nutzungsbezo-
DEN WETTBEWERB gene, verursachergerechte und faire Besteuerung bei gleichzeitiger
DER TECHNOLOGIEN Streichung aller besitzbezogenen Abgaben.
ZULASSEN
Technologieoffenheit und eine
Life-Cycle-Betrachtung müs-
WETTBEWERBSFÄHIGKEIT DES STANDORTES
sen Grundpfeiler für politische
Entscheidungen sein – das gilt ENTSCHEIDET ÜBER DEN WOHLSTAND
vor allem bei der Mobilitäts-, Neben steuerlichen Maßnahmen bilden grundlegende Punkte wie
Industrie-, Energie-, Umwelt- Offenheit einer Volkswirtschaft, Bekenntnis zu gut gemachtem Frei-
und Förderpolitik. handel, wettbewerbsfähigen Lohnkosten oder Innovationsfreude und
Technologievernetzung sowie ein entsprechendes Angebot an direkter
und indirekter F&E-Förderung das Fundament für eine wettbewerbs-
fähige Fahrzeugindustrie in Österreich.
DIE MOBILITÄTS-TRANSFORMATION FÜR
KONSUMENTEN UND PRODUZENTEN ERMÖGLICHEN
Die Transformation der Individualmobilität zu nachhaltigen Technologien
muss mit Hilfe steuerlicher Anreize beschleunigt werden – sowohl bei
Konsumenten und Konsumentinnen als auch bei der Produktion. Anreize
für die Anschaffung neuer emissionsarmer Fahrzeuge sowie zur Quali-
fizierung von Bestandspersonal und für die Forschung, Entwicklung und
Erprobung neuer Technologien würden eine solche Beschleunigung be-
wirken. Ebenso wie eine der Investitionsprämie nachempfundene Incen-
tivierung zur Ausweitung der Produktionskapazitäten für die Fertigung
alternativer Antriebe, aufbauend auf digitalen Produktionsprozessen.
5Österreichs Fahrzeugindustrie ist mit zahlreichen Sektoren der hei-
mischen Volkswirtschaft eng verbunden. Die Kernbranchen (Auto-
mobilwirtschaft im engeren Sinn) umfassen die Entwicklung und
Herstellung von Fahrzeugen – dazu zählen sowohl Nutzfahrzeuge,
PKW als auch Krafträder – und Fahrzeugteilen (Mechanik, Elektronik,
Software), den Handel mit Fahrzeugen und Fahrzeugteilen sowie die
Wartung und Reparatur.
Die definitorische Abgrenzung1 der Fahrzeugindustrie im weiteren
Sinn berücksichtigt über die Kernbranchen hinaus auch alle Vorleis-
tungen, sofern diese nicht bereits in die Herstellung von Fahrzeugen
eingeflossen sind. Ohne diese Vorleistungen ließen sich Fahrzeuge
nicht betreiben. Beispielsweise zählen hierzu die Produktion und
Distribution von Treibstoffen oder die Herstellung von Werkstoffen.
Hinzu kommen alle nachgelagerten wirtschaftlichen Aktivitäten, die es
ohne Fahrzeuge nicht oder in dieser Form nicht gäbe. Damit gemeint
sind beispielsweise Fahrschulen, Taxibetriebe, Autovermieter und
-versicherungen sowie der Straßenbau.
7QUO VADIS –
FAHRZEUGINDUSTRIE
8WAS LEISTET DIE BRANCHE FÜR ÖSTERREICH?
Die Fahrzeugindustrie steht für… ²/³ Der Vollzeitanteil der mit diesem Sektor zusammen-
Die Unternehmen der österreichischen Automobil- und hängenden Arbeitsplätze beträgt somit gut 88 Pro-
Motorradwirtschaft leisten einen substanziellen Bei- zent. Damit liegt die Fahrzeugindustrie deutlich über
trag für den Wohlstand in Österreich: Im Geschäftsjahr dem österreichischen Durchschnitt von 76 Prozent.
2018 erwirtschafteten sie einen Bruttoproduktions- Gemessen an der Zahl der Erwerbstätigen in Öster-
wert von 48,3 Mrd. Euro. Insgesamt steht dieser Wirt- reich beläuft sich der Anteil der Automobil- und Motor-
schaftsbereich für einen Bruttoproduktionswert von radwirtschaft auf 4,5 Prozent (direkt) bzw. 7,9 Prozent
mehr als 74 Mrd. Euro – wenn direkte und indirekte (total). Der Beschäftigungsmultiplikator erreicht 1,76
Effekte entlang der vorgelagerten Wertschöpfungs- und liegt damit noch etwas höher als der Wertschöp-
kette und induzierte Effekte aus der Einkommensver- fungsmultiplikator. Das zeigt: Die österreichische
wendung mitberücksichtigt werden. Die heimische Automobil- und Motorradwirtschaft beschäftigt einen
Fahrzeugindustrie schafft damit 6,7 Prozent (direkt) großen Anteil höher- und hochqualifizierter Erwerbs-
bzw. 10,3 Prozent (insgesamt) des Bruttoproduktions- tätiger bei überdurchschnittlicher Bezahlung.
wertes der gesamten heimischen Volkswirtschaft.
…Erfolge auf den internationalen Märkten
…jeden 12. Euro, der in Österreich Die Exportquote der Mobilitätsindustrie (Automo-
erwirtschaftet wird, und… bilwirtschaft und sonstiger Fahrzeugbau einschließ-
Ausgehend vom Bruttoproduktionswert lässt sich lich Motorradwirtschaft) beträgt mehr als 86 Pro-
für die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit einer gan- zent. Daher hängt für die Branche sehr viel von der
zen Branche eine weitere aussagekräftige Kennzahl heimischen Wettbewerbsfähigkeit und vom Zugang
berechnen: die Bruttowertschöpfung (BWS). Zieht zu internationalen Märkten ab – in positiver wie
man vom Bruttoproduktionswert die heimischen und negativer Hinsicht.
importierten Vorleistungen ab, dann steht die Automo-
bil- und Motorradwirtschaft für eine direkte BWS von Mehr als jeder siebte Euro im Industriegüterexport
17,8 Mrd. Euro. Dies entspricht einem Anteil von 5,1 kommt aus der Mobilitätsindustrie. Diese herausragen-
Prozent an der heimischen Wirtschaftsleistung. Ein- de Position auf den Exportmärkten wäre ohne perma-
schließlich indirekter und induzierter Effekte erhöhen nente Anstrengungen zum Erhalt und Ausbau ihrer
sich die Werte auf einen Betrag von 29,1 Mrd. Euro Technologieführerschaft nicht möglich. Der Anteil der
oder 8,5 Prozent der österreichischen BWS. Das be- Mobilitätsindustrie an den gesamten unternehmens-
deutet: Jeder zwölfte Euro, der österreichweit erwirt- internen Ausgaben für Forschung und Entwicklung in
schaftet wird, lässt sich unmittelbar oder mittelbar auf Österreich beträgt 10,3 Prozent und liegt damit dop-
die Fahrzeugindustrie zurückführen. pelt so hoch wie der Anteil der Automobil- und Motor-
radwirtschaft an der Bruttowertschöpfung.
Direkt und indirekt generiert jeder Euro, der in der
Fahrzeugindustrie erwirtschaftet wird, weitere Die besondere Sensibilität der Branche für Veränderun-
0,64 Euro an Wertschöpfung in anderen Branchen. gen der Produktions- und Wettbewerbsbedingungen
in Österreich bestätigt eine weitere Kennzahl: Mit einem
…für 355.000 hochwertige Arbeitsplätze sowie… Anteil von 18,5 Prozent am Bestand aller ausländischen
Die Mobilitätswirtschaft ist ein wichtiger Motor für Direktinvestitionen in der österreichischen Industrie
hochwertige Arbeitsplätze in Österreich: 2018 waren ist die Mobilitätsindustrie dem harten internationalen
insgesamt mehr als 184.000 Menschen direkt in der Standortwettbewerb besonders stark ausgesetzt. In
Automobil- und Motorradwirtschaft im engen Sinn be- ausländischen Unternehmenszentralen wahrgenommene
schäftigt. Dies entspricht knapp 170.000 Vollzeitäqui- Veränderungen in der Standortattraktivität Österreichs
valenten (VZÄ). Der Gesamteffekt beläuft sich auf über können weitreichende Konsequenzen für Wertschöpfung
355.000 Beschäftigte, entsprechend 313.000 VZÄ. und Beschäftigung hierzulande nach sich ziehen.
9WIE TICKT DIE BRANCHE?
Die Fahrzeugindustrie ist (mehr als andere Branchen der Planbarkeit und stabile Rahmenbedingungen
österreichischen Wirtschaft) gekennzeichnet durch: Die Fahrzeugindustrie ist eine „Asset Heavy Industry“ –
bezogen auf Technologie- und Produktentwicklung, aber
Hohe Wettbewerbsintensität und Internationalität auch auf die Produktion selbst. Das ermöglicht einerseits
Die Fahrzeugindustrie ist weltweit tätig und trifft Inves- eine gewisse Stabilität an bestehenden Standorten, darf
titions- und Standortentscheidungen zutiefst rational. aber andererseits nicht als Selbstverständlichkeit oder
Hohe Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des Wirt- Standortgarantie missverstanden werden. Planbarkeit
schaftsstandortes sowie eine Politik, die als „mobilitäts- und Stabilität der Rahmenbedingungen (z.B. Steuerpoli-
freundlich und technologieoffen“ betrachtet wird, tik) spielen eine überdimensional große Rolle.
sind essenziell für Volkswirtschaften, die auf Wert
schöpfung und Beschäftigung durch die Automobil Zentrale Rolle einzelner Unternehmen
branche bauen wollen. außerhalb Österreichs
Die aktuelle Diskussion in Europa ist stark geprägt
In den vergangenen Jahren sind die Renditen auf den von den Positionen einzelner Fahrzeughersteller
Heimmärkten europäischer Unternehmen gefallen. (Original Equipment Manufacturer – OEM), die ihren
Kompensiert werden konnte dies nur durch Wachstum Sitz außerhalb Österreichs haben. Österreichische
auf internationalen Märkten außerhalb Europas (insbe- Betriebe sind Nischenplayer. Nicht alle europäischen
sondere in Asien und Nordamerika). Die österreichische Richtungsentscheidungen im Sinne der europäischen,
Fahrzeugindustrie profitiert von gut gemachten Handels- sind automatisch auch im Sinne der österreichischen
abkommen, es benötigt offene Märkte und fairem Wett- Fahrzeugindustrie.
bewerbsbedingungen. Denn je stabiler und planbarer
dieser Handel ist, desto besser kann sich die Fahrzeug- Laufende Effizienzsteigerungen
industrie in Österreich entwickeln. Das ist auch deshalb als „Überlebensgrundlage“
bedeutend, da sie für eine internationale Sichtbarkeit In der Branche ist es üblich, im Kunden-Lieferanten-
Österreichs sorgen kann. Verhältnis laufend Effizienzpotenziale in Form von
sogenannten „Give Backs“ über eine degressive Preis-
Veränderung und hoher Investitions- und gestaltung einzukalkulieren. Die Unternehmen sind mit
Innovationsbedarf stetig sinkenden Margen und gleichzeitig (u.a. KV-Ab-
Die Fahrzeugbranche befindet sich in einem umfassen- schluss-bedingt) stetig steigenden (Personal-)Kosten
den Wandel. Das Auto und die Mobilität der Zukunft zur Effizienzsteigerung verdammt.
bauen auf neuen herausfordernden Technologie-Stacks
auf – Software, neue Antriebe, neue Materialien, künstli-
che Intelligenz sowie ein geändertes Mobilitätsverhalten
und die damit verbundenen Bedürfnisse der Kunden. Das
alles erfordert derzeit außergewöhnlich hohe Investi-
tionen in Forschung & Entwicklung und bedingt auch
signifikante Abschreibungen bei Technologie-Verboten.
Dafür ist wiederum eine entsprechende Kapitalstärke
notwendig, um das Erforschen und Umsetzen neuer
Formen der Mobilität zu finanzieren.
Mit den Veränderungen bei der Mobilität ergeben sich
neue Anforderungen und Möglichkeiten in der branchen-
und technologieübergreifenden Forschung und Koope-
ration. Entscheidend für die Fahrzeugindustrie ist die
Vernetzung mit anderen wirtschaftlichen Sektoren, zum
Beispiel mit 5G-Netzbetreiber(n), Werkstoffspezialisten
oder der Elektronikindustrie. Das sollte in Forschungs-
förderprogrammen abgebildet sein.
10WIE NEHMEN POLITIK UND ÖFFENTLICHKEIT DIE BRANCHE WAHR?
Geht es um Konzerne oder die Fahrzeugindustrie, ie Leistungen der Unternehmen für Wohlstand,
d
scheint (nicht nur) die österreichische Politik in einem Lebensqualität und Arbeitsmarkt, ihre Bereitschaft
„inneren Konflikt“ gefangen zu sein: Große Unter- in den Standort, in F&E und damit die Zukunft des
nehmensgruppen werden hochgeschätzt als wichtige Landes zu investieren, wird vielfach ausgeblendet,
Arbeitgeber, Investoren und Innovatoren sowie als weil das nicht ins Narrativ mancher Lobbys etc. passt.
Steuerzahler in Österreich. Dies ist beispielsweise bei
Neuinvestitionen und „Spatenstich“ sichtbar. Gleichzeitig Dies (be-)trifft alle Menschen, die in diesen Unterneh-
wird der Begriff „Konzern“ in der öffentlichen Diskussion men tätig sind. Und auch deren Eigentümer sowie die
völlig zu Unrecht als Synonym für vermeintlich negative Entscheidungen, die sie treffen. Für alle Arbeitsplätze
Entwicklungen missbraucht – ob bei Arbeitsbedingun- in der Automotive-Industrie gilt: Über den Fortbestand
gen, Steuerleistungen oder entscheiden zwei wesentliche Kriterien.
im Umweltbereich.
1. Die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes
Die Sensibilität für Klimaschutz und Nachhaltigkeit in der 2. Die wahrgenommene „Automotive-Freundlichkeit“
österreichischen Bevölkerung ist hoch. Deutlich geringer am Standort
ist die Wahrnehmung der Leistung der Industrie in diesem
wichtigen Zukunftsbereich. Das betrifft vor allem die Fahr-
zeugindustrie, die in der öffentlichen Einschätzung häufig
mit Mythen und Unwahrheiten konfrontiert ist.
Mythen, Unwahrheiten und negatives „Framing“
Begriffe wie „SUV“ oder „Diesel“ wurden von einzel-
nen Interessengruppen zu Sündenböcken abgestem-
pelt sowie politisch und medial ungleich schwerer
gewichtet als die Beiträge der österreichischen
Fahrzeugindustrie zur Verbesserung der Nachhal-
tigkeit und Sicherheit. Dabei wird die öffentliche
Diskussion weitgehend an den Fakten vorbeigeführt –
11WETTBEWERBS-
FÄHIGKEIT UND
TECHNOLOGIE-
OFFENHEIT
12ANTRIEBSTECHNOLOGIEN
Die Industrie lebt permanente Innovation, nicht den Er-
halt des technologischen Status quo. Entscheidend ist
die ökologisch richtige Ausrichtung – und dabei Wert-
schöpfung und Beschäftigung in Österreich zu halten,
besser noch auszubauen.
Wann und ob sich eine Antriebstechnologie durchsetzen
wird, ist aus heutiger Sicht noch offen. Untersuchungen
zeigen: Österreich verliert Bruttowertschöpfung bei
einer überhasteten und nicht technologieoffenen Um-
stellung auf alternative Antriebsarten. Die nationale
Wertschöpfungstiefe verringert sich, die Abhängigkeit
von Importen steigt. Beschäftigung und Wohlstand
gehen in Österreich unweigerlich zurück. Und: Der
ökologische Effekt bleibt darüber hinaus in einer
Gesamtbetrachtung aus.
Eine Frage der Primärenergieträger
Steigerung der Effizienz, Die Rahmenbedingungen für Antriebstechnologien
Reduktion der Schadstoff-Emission von Fahrzeugen werden derzeit auf europäischer und
Die vergangenen 50 Jahre in der europäischen Fahr- nationaler Ebene neu gestaltet. Ein wesentlicher Mei-
zeugindustrie waren geprägt von der laufenden lenstein ist dabei die geplante Euro-7-Abgasnorm, die
Steigerung der Effizienz der Antriebstechnik und derzeit in Ausarbeitung und für den zukünftigen Einsatz
damit einhergehend der Reduktion von emittierten von Verbrennungsmotoren entscheidend ist. Generell
Schadstoffen. Insbesondere in den jüngsten 25 Jahren ist bei der Beurteilung von Antriebstechnologien die
(Kyoto-Protokoll, Klimaabkommen von Paris) ist die gesamte Wirkungskette des Energie- und Rohstoffein-
CO2-Effizienz von Antriebssystemen in den Mittelpunkt satzes zu berücksichtigen. Ausgeblendet wird etwa die
der Diskussion und auch der technischen Entwicklung begrenzte Verfügbarkeit von Energie aus erneuerbaren
gerückt. Mit dem „Flottenziel“ der EU (CO2-Emissionen Energieträgern. Eine ADAC-Studie4 zeigt, dass Elektro-
der Neufahrzeuge) kam es 2009 zu einer überaus am- fahrzeuge erst mit Nutzung von regenerativem Strom
bitionierten und strengen Vorgabe der Europäischen eine deutlich bessere Treibhausgas-Bilanz aufweisen
Union. Abgedeckt werden damit allerdings nur die als alle anderen Antriebsarten. Bei einem Strom-Mix hat
Emissionen des Antriebs (tank-to-wheel), aber nicht das Erdgas-Auto die beste Treibhausgas-Bilanz.
jene der Produktion und vorgelagerter Wertschöp-
fungsschritte oder der Entsorgung. Diese verkürzte Das Beispiel Steiermark belegt, wie hoch (und un-
Sichtweise resultiert aus einem regionalen Fokus, realistisch) der Investitionsbedarf für eine CO2-neu-
vernachlässigt jedoch die erforderlichen weltweiten trale Stromerzeugung ist. Bis 2030 bräuchte es neun
Handlungsnotwendigkeiten. weitere Kraftwerke am Verlauf der Mur, 125 weitere
Windkraftanlagen zu je 4 MW und alle 25 Minuten eine
Die europäische Gesetzgebung schließt durch die ge- weitere PV-Anlage. Die damit verbundenen behörd-
wählte tank-to-wheel-Logik und die dadurch ausgelös- lichen Genehmigungsverfahren und ihre Dauer zeigen
ten Systemgrenzen die Entwicklung und den Einsatz die niedrige Realisierungschance dieses Szenarios auf.
synthetischer Kraftstoffe de facto aus. Die auf Produk-
tion und Kraftstoff reduzierte Betrachtung suggeriert, Für eine weitsichtige Bewertung von Antriebstechno-
dass bestimmte Formen der Mobilität keine CO2-Emis- logien braucht es Konzepte, die (unter Berücksichti-
sionen verursachen. gung von Energie-Mix, Lebensdauer, Verwertung von
13Altfahrzeugen, Speicherfähigkeit und -kapazität der Welcher Antrieb? – Im Idealfall ein
Energie …) eine Life-Cycle-Betrachtung ermöglichen. Wettbewerb der Technologien
Das wäre die Grundlage, um Antriebstechnologien und Neben der Bewertung der Stärken und Schwächen sowie
ihre CO2-Footprints verantwortungsvoll einschätzen und der physikalischen Grenzen der einzelnen Technologien
bewerten zu können. Unbestritten ist, dass alle heute müssen auch die ökonomischen und strukturellen
bekannten Technologien Effizienzpotenziale bei CO2- Effekte berücksichtigt werden. Inwieweit kann Europa
Emissionen besitzen. An welchen Stellhebeln diese (bei gegebener Kostenstruktur) in der Batterietechnolo-
Potenziale angesiedelt sind, wie große diese Potenziale gie überhaupt wettbewerbsfähig sein? Werden durch das
eingeschätzt werden und wie sie zu nutzen sind, ist hin- Forcieren einzelner Technologien auch Abhängigkeiten
gegen äußerst unterschiedlich. Europas und Österreichs verstärkt? Die exportorientier-
te österreichische Fahrzeugindustrie sieht jedenfalls eine
„You’re not betting the shop on one technology” steigende Nachfrage nach allen Arten von CO2-reduzie-
Schwerpunkte und Vorgaben deuten aktuell darauf hin, renden und nachhaltigkeitsfördernden Technologien aus
dass die Politik einen elektrischen Antrieb (vorwiegend Regionen außerhalb Europas.
auf Basis von Batterietechnologie) als Zukunftstechnologie
bevorzugt. Das ist aus volkswirtschaftlichen (Verlust an Sinnvoll ist zweifellos ein ausgewogener Mix und ein
Wertschöpfung in Europa und Österreich), aber auch aus Pfad in Richtung Klimaziele, der sich die Stärken der
ökologischen (keine Life-Cycle-Betrachtung) und techno- verschiedenen Antriebssysteme zunutze macht. Wett-
logischen (kein Wettbewerb der Technologien als Innova- bewerb (gerade jener der Technologien) fördert Inno-
tionstreiber) Gesichtspunkten nicht nachvollziehbar. vation, versetzt Unternehmen in die Lage, ihre Stärken
einzusetzen und auszubauen, und ermöglicht es ihnen,
Bevorzugt die Politik eine bestimmte Technologie und ihre Klimaziele rascher zu erreichen. Wegen der unter-
damit die Ausrichtung einer ganzen (noch dazu derart schiedlichen Einsatzgebiete wäre es zudem sinnvoller, die
relevanten) Branche, wäre das volkswirtschaftlich über- Antriebstechnologien als sich ergänzende Konzepte zu
aus risikoreich und innovationshemmend. Ein betriebs- verstehen – nicht als Widerspruch.
wirtschaftliches Risk-Management würde eine derart un-
sichere Strategie unter Einsatz derart hoher Ressourcen Die Frage der CO2-Bilanz von Fahrzeugen mit verschie-
jedenfalls verhindern – für Unternehmen ist es gerade denen Antriebstechnologien kann ohne die Frage nach
in Zeiten des Wandels die unattraktivste Variante, alles der CO2-Bilanz der Primärenergie und der Produktion
auf nur eine Technologie zu setzen. Das „Unternehmen (insbesondere von Batterien) nicht beantwortet werden.
Fahrzeugindustrie“ beschäftigt in Österreich 355.000
Mitarbeiter und ist dabei, all seine Ressourcen auf eine
politisch vorgegebene Technologie setzen zu müssen.
Hinzu kommt, dass es sich um eine Technologie handelt, in
der die bestehenden europäischen und österreichischen
Stärken nicht ausreichend zu Geltung kommen können
und deren ökologischer Gesamteffekt ungewiss ist.
14DIGITALISIERUNG
Nicht nur die Fahrzeugindustrie verändert sich, sondern
auch das Fahrzeug selbst. Grund dafür ist der verstärkte
Einsatz von Automatisierung und Digitalisierung in der
Produktion und im Vertrieb. Die Nutzung von künst-
licher Intelligenz wird in Zukunft zunehmend an Be-
deutung gewinnen. Zugleich erfährt auch die technische
Architektur des Produktes an sich grundlegende Neue-
rungen. Vor zwanzig Jahren waren die Eigenschaften des
Fahrwerks, der Lenkung und des Motors im Blickpunkt.
Heute stehen digitale Funktionen immer stärker im Vor-
dergrund: Assistenzsysteme (Adaptive Cruise Control,
Nachtsichtassistent), digitale Anzeigesysteme (Head-
Up-Display, digitales Cockpit, Infotainmentsystem) oder
auch elektronisch gesteuerte Antriebssysteme (Allrad-
antrieb, Automatikgetriebe) führen einerseits zu einer
zunehmenden Vielfalt kundenspezifischer Fahrzeugkon-
figurationen, andererseits zu einer steigenden Komplexi-
tät der Fahrzeuge. Am Ende des Prozesses könnte eine
Fahrzeugproduktion der Losgröße 1 – nämlich das gänz-
lich kundenindividuelle Fahrzeug – stehen. Dafür sind
volldigitalisierte, cyberphysische Produktionsbedingun-
gen notwendig. Im Ergebnis werden hierbei moderne
Produktionshallen im Tandem mit einer Vielzahl neuer,
hochqualifizierter Berufsbilder in deren Wertschöp-
fungsnetzwerk auftreten.
CHANCE WERKSTOFFE
Um die Gewichtszunahme durch veränderte Antriebe Struktur alleine nicht aus. Erfolgreiche Leichtbaukon-
auszugleichen, hat Leichtbau massiv an Bedeutung ge- zepte beruhen auf spezifischem Know-how in vielen
wonnen. Schon die kraftstoffeffiziente Optimierung von Bereichen der Werkstoff- und Ingenieurwissenschaften
Motoren macht das Fahrzeug um durchschnittlich 50 und auf „systemischem“ Denken.
kg schwerer. Die Batterie in Hybrid- oder Range-Exten-
der-Fahrzeugen wiegt bis zu 150 kg mehr. Rein batte- Leichtbau umfasst daher das Gesamtpaket mit unter-
rieelektrisch betriebene Fahrzeuge haben ein Mehrge- schiedlichen Kompetenz-Schwerpunkten wie:
wicht von 250 kg und mehr, da sehr große und schwere Werkstoffe von hochfestem Stahl, Aluminium, Magne-
Batterieeinheiten aufgrund der geforderten Reichweite sium über Kunststoff bis zu Faserverbundmaterialien
notwendig sind. Das stellt wiederum besondere Heraus-
Produktentwicklung und -gestaltung: Bauweisen und
forderungen an den Werkstoff. Verschiedene Leicht-
Konstruktion
baumaterialien werden in diversen Fahrzeugklassen mit
unterschiedlichen Antriebsarten eingesetzt. Fertigungsverfahren, Fügetechnik und Additive Ferti-
gung/3D-Druck
Ein Schlüssel zum Leichtbau ist die Multi-Material- Simulation: Materialmodellierung, Struktur- und Pro-
Bauweise. Dabei wird für jedes einzelne Element des zesssimulation, Optimierung
Fahrzeugaufbaus jener Werkstoff ausgewählt, der An den vielfältigen, für den Leichtbau notwendigen Kom-
die gestellten Anforderungen bei minimalem Gewicht petenzen hängt in der Wertschöpfungskette eine Vielzahl
erfüllt. Da die Karosserie nur etwa 35 Prozent des Ge- an Unternehmen aus den Sektoren der Werkstoffindust-
samtfahrzeuggewichts ausmacht, reicht für effizienten rie, des Maschinen- und Anlagenbaus, der Fahrzeugpro-
Leichtbau eine Reduktion des Gewichts der tragenden duzenten und -zulieferer sowie der F&E-Dienstleister.
15HERAUSFORDERUNG FACHKRÄFTE
Mit dem Wandel der Branche geht seit Jahren auch ein Ausbildung eines Lehrlings nimmt ein Industrieunter-
Wandel der benötigten Qualifikationen und Kompeten- nehmen im Schnitt rund 100.000 Euro in die Hand.
zen in der Fahrzeugindustrie einher. Die „klassischen Auch sind Automotive-Unternehmen enger Koopera-
Fähigkeiten“ für fachliche Kompetenzen in der Kfz-, der tionspartner des Arbeitsmarktservice, wenn es darum
Metall- und der Elektrotechnik (und deren Schnittmen- geht, arbeitsuchende Personen durch Umschulung
gen) sowie persönliche und soziale Kompetenzen reichen oder Weiterqualifizierung wieder in den Arbeitsmarkt
heute nicht mehr. Gefragt sind vor allem „digital skills“ zu integrieren.
und damit verbundene Kompetenzen im Bereich Data
Science, Cyber Security, Cloud Computing, Software Der Mangel an Fachkräften betrifft die Branche auf
Engineering, Robotik sowie Elektronik und Mecha- allen Ebenen. Ein regelrechter „War for Talents” er-
tronik. Die Chancen der digitalen Transformation gilt es schwert den Betrieben mittel- und langfristige Planun-
somit auch konsequent im Bereich der dualen Ausbildung gen. Gleichzeitig besteht die Sorge, dass die öffentliche
fortwährend zu implementieren. Diffamierung des „Automobils“ junge Menschen von
klassischen Studienrichtungen der Fahrzeugbranche
Eine Branche investiert in ihre Fachkräfte zusehends fernhält. Durch den steigenden Stellenwert
Die Unternehmen der Branche kooperieren eng mit von Informations- und Kommunikationstechnologien in
Höheren Technischen Lehranstalten, Fachhochschulen nahezu allen produzierenden Branchen, ganz besonders
und Universitäten. Nach wie vor hat die Lehrausbil- auch in der Fahrzeugbranche, ist der Mangel an Absol-
dung einen hohen Stellenwert in der österreichischen ventinnen und Absolventen IKT-naher Ausbildungen
Industrie. Junge Menschen bekommen hier eine erst- eine der zentralen Herausforderungen des Wirt-
klassige Ausbildung mit besten Karrierechancen. Für die schaftsstandortes Österreich.
STEUERN UND ABGABEN
Die Autoindustrie ist seit Jahren mit neuen regulato- Motorbezogene Versicherungssteuer:
rischen Belastungen und ständig steigenden Abgaben 2.533 Mio. Euro
konfrontiert. Österreich befindet sich, was die gesamte Wurde ebenfalls mit 1. Jänner 2021 erhöht.
automotive Steuerbelastung betrifft, im EU-Spitzenfeld, Ist eine reine Besitzsteuer, unabhängig von der
tatsächlichen Nutzung.
insbesondere bei der Besitz-Besteuerung. Der Besitz
eines Kfz, also bevor man auch nur einen Kilometer ge- Kraftfahrzeugsteuer: 56 Mio. Euro
fahren ist oder CO2 ausgestoßen hat, ist in Österreich im Betrifft Kraftfahrzeuge und Anhänger über 3,5 Ton-
Vergleich zu den anderen EU-Ländern am zweithöchsten nen. Fehleranfällige Bagatellsteuer mit hoher büro-
besteuert. Zusätzlich ist der Großteil der Steuern ver- kratischer Belastung für Unternehmen, da sie für jedes
brauchsunabhängig, wodurch es auch umweltpolitisch zu Fahrzeug getrennt ermittelt werden muss. Ist wie die
motorbezogene Versicherungssteuer unabhängig von
falschen Anreizen kommt.
der tatsächlichen Nutzung.
Enorme Belastung der Mobilität Mineralölsteuer: 4.480 Mio. Euro
Alleine die bestehenden Abgaben im Bereich der Kraft- Die einzige verbrauchsabhängige Kfz-Abgabe, die zu-
fahrzeuge betragen mehr als 10 Mrd. Euro (exklusive letzt 2011 erhöht wurde. Diesel wird mit 39,7 Cent/
Umsatzsteuer, da nicht abgrenzbar) und machen damit Liter und Benzin mit 48,2 Cent/Liter unabhängig vom
tatsächlichen Verkaufspreis besteuert.
rund 10 Prozent des gesamten Steueraufkommens aus.
Umsatzsteuer
Beim Kauf des Kfz, bei Reparaturen und für die Be-
Normverbrauchsabgabe (NoVa): 555 Mio. Euro
tankung zu bezahlen. Die Mineralölsteuer fließt in die
Wurde in den letzten Jahren mehrmals erhöht. Ab Juli
Bemessungsgrundlage für die Umsatzsteuer mit ein,
2021 erfolgt eine Ausweitung auf Nutzfahrzeuge bis
weswegen die Umsatzsteuer quasi eine Besteuerung
3,5 Tonnen (z.B. Lieferwägen von Handwerkern) sowie
der Steuer darstellt.
bis 2024 eine stufenweise massive Erhöhung (Spitzen-
steuersatz steigt von 32 auf 80 Prozent).
16 Vignette: 524 Mio. Euro Streckenmaut: 200 Mio. Euro
Die Vignette stellt eine verbrauchsunabhängige Für bestimmte Streckenabschnitte müssen Kfz bis
Streckenbenützungsgebühr dar und beträgt für PKW 3,5 Tonnen eine Streckenmaut entrichten.
derzeit 92,50 Euro/Jahr.
Parkgebühren: 204,5 Mio. Euro (nur Wien, Parkgebüh-
LKW-Maut: 1.515 Mio. Euro ren und Verkehrsstrafen. Für Rest-Österreich liegen
Der Tarif der LKW-Maut ist sowohl verbrauchs- keine Zahlen vor)
abhängig als auch nach Emissionsklassen gestaffelt.
Nachdem LKW allerdings zur Beförderung für
jegliche Art von Gütern benötigt werden, bedeutet
eine Maut-Erhöhung immer auch eine Verteuerung
sämtlicher Güter und damit eine zusätzliche Belas-
tung für Konsumenten.
NOTWENDIGE INFRASTRUKTUR
Nur eine entsprechend ausgebaute Verkehrsinfra- im Bedarfsfall rasch und unbürokratisch für Infrastruk-
struktur (Schiene, Straße oder Luftfahrt) sichert den turprojekte genehmigt werden können. Gerade bei
Transport lebensnotwendiger Güter. Ebenso führen die Innovationen sind rechtliche Adaptierungen (z. B. beim
steigende Vernetzung durch die Digitalisierung und der autonomen Fahren) notwendig, um neuen Entwicklun-
technologische Wandel zu neuen Anforderungen an die gen und Innovationen den Weg zu ebnen. Außerdem
Infrastruktur und zu einem Anpassungsbedarf bei den eröffnet die Digitalisierung auch im Bereich der Infra-
rechtlichen Rahmenbedingungen. struktur Chancen: Durch die Integration modernster
Informations- und Kommunikationstechnologie für den
Innovationen den Weg ebnen Verkehrssektor („Smart and Seamless Mobility“) ergeben
Vorausschauendes Handeln und eine frühzeitige sich Effizienzpotenziale im Bereich Energie- und Ver-
Weichenstellung ist im gesamten Themenkomplex der kehrsmanagement.
Infrastruktur essenziell. Eine moderne, gesamtheitliche
Betrachtung und pro-aktive Gestaltung – unter Einbezug
aller Faktoren des Gesamtverkehrs – sind unumgänglich.
Dazu gehören einerseits sozioökonomische Themen-
felder sowie Investitionen im Bereich der klassischen
Infrastruktur, wie beispielsweise der Ausbau von Tank-
stellen bzw. Ladestationen für alternative Antriebe.
Daneben ist es wichtig, sich im Rahmen der übergeordne-
ten Raumplanung geeignete Standorte, Trassen, Flächen
und Korridore für zukünftige Vorhaben zu sichern, die
17MASSNAHMEN-
EMPFEHLUNGEN
FÜR EINEN WETT-
BEWERBSFÄHIGEN
MOBILITÄTSSTANDORT
ÖSTERREICH
18„ÖSTERREICH IST MOBILITÄT DER ZUKUNFT:
DIE ÖSTERREICHISCHE FAHRZEUGINDUSTRIE
SCHAFFT WERTE FÜR ÖSTERREICHS WIRTSCHAFT
UND GESELLSCHAFT – INDUSTRIELEISTUNG &
ARBEITSPLÄTZE, TECHNOLOGIE & WISSEN“
Es braucht ein klares Bekenntnis und eine positive Gerade jene Produktsegmente, auf die viele österrei-
Kommunikationsstrategie der österreichischen chische Unternehmen ihren Fokus gelegt haben, sind
Bundespolitik und Landesregierungen, die den vielfach Innovationstreiber für andere Bereiche – bei-
Stellenwert der Fahrzeugindustrie, die hohe Innova- spielsweise beim autonomen Fahren. Der Schwerpunkt
tionskraft der Branche und die erzielten ökologischen auf Premium-Fahrzeuge ist primär den kostentechni-
Effekte würdigt. schen und steuerlichen Rahmenbedingungen in Öster-
Idealerweise bildet sich der Stellenwert der Fahr- reich geschuldet. Sie pauschal zu verdammen wäre auch
zeugindustrie für Beschäftigung und Wohlstand in der in technologischer Hinsicht überaus kurzsichtig.
Kommunikation mit vielen Stakeholdern ab. Gerade in Bekenntnis zu fairem internationalen Handel und
Zeiten eines dynamischen und umfassenden Wandels Umsetzung von fairen Freihandelsabkommen:
einer Branche braucht es ein investitionsfreundliches Österreich als massiv exportorientierte Volkswirt-
Klima. Nur dann kann eine Volkswirtschaft von diesem schaft profitiert ganz besonders vom Abbau von Han-
Wandel profitieren. Dabei geht es auch um kom- delsbarrieren. Nicht zuletzt durch die Erschließung
munikative Signale an bestehende und potenzielle weltweiter Märkte durch die heimische Fahrzeug-
Investoren. Hinzu kommen attraktive und planbare industrie. Es gilt immer zu berücksichtigen: Wachstum
Rahmenbedingungen bei Kosten, qualifiziertem Perso- findet zunehmend außerhalb Europas statt.
nal, Infrastruktur, Steuern sowie F&E.
Die Innovationsleistungen der Branche sind auch
und insbesondere im Bereich der Umwelt- und
Klimaverträglichkeit von Fahrzeugen anzuerken-
nen.3 Kaum einem anderen Wirtschaftsbereich ist es
in den vergangenen zehn Jahren gelungen, den öko-
logischen Impact seiner Produkte derart zu optimie-
ren. Die Branche als „Öko-Sünder“ abzustempeln, ist
nicht nur faktisch falsch, es ist auch volkswirtschaft-
lich verantwortungslos.
Mobilitätspolitik muss als zentrales Element der
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik gestaltet
werden, deren Zielsetzungen gleichzeitig die Leitlinien
für die Weiterentwicklung der österreichischen Fahr-
zeugindustrie bilden sollen.
Eine aktive Verkehrs- und Mobilitätspolitik ist eine
Chance für technologische und wirtschaftliche Im-
pulse in der gesamten österreichischen Wirtschaft.
Daran sind auch FTI-Schwerpunkte festzumachen.
Forschungsförderung muss Vernetzungen mit anderen
Sektoren (bspw. mit 5G-Netzbetreibern) unterstützen.
Ebenso im Fokus stehen müssen wichtige Enabling
Technologies, Digitalisierung der Entwicklungsprozes-
se sowie der Einsatz von künstlicher Intelligenz und
autonomes Fahren.
19ANTRIEBSTECHNOLOGIEN
Technologieoffene Ausgestaltung von Standort-, Um- Fahrzeugindustrie zu wahren, muss sich die österreichi-
welt- und Forschungspolitik: Die Umstellung der Primär- sche Politik für eine solche technologisch und wirt-
energie von fossilen auf regenerative Quellen kann nur schaftlich sinnvolle technologieoffene Ausgestaltung
schrittweise erfolgen. Während der Umstellungsphase stark machen. Jedenfalls benötigen Unternehmen eine
müssen daher alle Wege technologieoffen bzw. tech- bestmögliche Begleitung bei den resultierenden Über-
nologieneutral beschritten werden. Eine kurzsichtige gangsprozessen – sowohl in der Produktion, Forschung
Bevorzugung einzelner Technologien ist ein volkswirt- und Entwicklung sowie auch im Ausbau von Infrastruk-
schaftliches Risiko und verringert die Innovationskraft tur und Anlagen.
durch Wettbewerb.
Life-Cycle-Betrachtung muss die Basis einer ökolo-
gisch verantwortungsvollen Bewertung verschiedener
Die Ausgestaltung der Euro-7-Abgasnorm ist ein wich-
Antriebskonzepte sein.
tiger Meilenstein, um das Potenzial des hybridisierten
Verbrennungsmotors für die nachhaltige Mobilität zu Der Fokus muss auf bestehende Stärken der Unter-
sichern und zu maximieren. Der gegenwärtige Schritt in nehmen gerichtet werden, damit Optimierungs-
der Findung von herausfordernden Abgaszielen in der potenziale für einzelne Antriebstechnologien genutzt
Advisory Group on Vehicle Emission Standards (AG- werden können.
VES), die zu praktisch emissionsfreien Verbrennungs- Wasserstoff-Technologie muss als Chance erkannt
motoren im realen Betrieb führen wird, zeigt einen für und genutzt werden. Hier hat Österreich die Chance,
Umwelt und Wirtschaft ambitionierten europäischen zum Innovations-Führer zu wachsen. Dafür notwendig
Weg auf. Um die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen ist die rasche Umsetzung der „Wasserstoff-Milliarde“.
DIGITALISIERUNG
Die europäischen Autohersteller und ihre Zulieferer und der zu ihrer Herstellung erforderlichen Kompe-
stehen im weltweiten Wettbewerb. Um dort bestehen tenzen scheitern. Nach Maßgabe der „Trilokations-
zu können, bedarf es ausgefeilter Differenzierungsstrate- Hypothese“ stellt sich ein dauerhafter Wettbewerbs-
gien. Die Digitalisierung des Fahrzeuges ist eine Chance, vorsprung dort ein, wo Forschung & Entwicklung,
um Alleinstellungsmerkmale zu definieren und damit Produktion und Markteinführung räumlich zusammen-
ein unverwechselbares europäisches Produktangebot fallen. Die Standortpolitik ist gefordert, sich gezielt
zu schaffen. Einerseits verspricht digitale Exzellenz um die Ansiedlung von Produktionsstätten für solche
Intermediärgüter mit komplementären Eigenschaften
viele positive Wirkungen für den Kundennutzen und die
zu bemühen. Dabei sind gezielt kompetitive Konzepte
Verkehrssicherheit. Eine weitere zentrale Bedeutung
wie digitale Fabrikhallen in Verbindung mit einer stabi-
kommt dem Thema Datensicherheit zu, und zwar sowohl
len Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen und
im Hinblick auf die Verkehrssicherheit als auch auf den einem hohen Schutzniveau für immaterielle Assets zu
Schutz der Privatsphäre der Fahrzeugnutzer. Für beide verfolgen. Zusätzliche Beschäftigungsperspektiven
Aspekte braucht es standort- und verkehrspolitische entstehen vor allem im wissens- und logistikintensiven
Rahmenbedingungen, welche die Herausbildung solcher Wertschöpfungsnetzwerk solcher Produktionsstätten,
Alleinstellungsmerkmale unterstützen: Angefangen von aber kaum in der physischen Produktion an sich.
der Bereitstellung von „regulatory sandboxes“ und
Die Komplexität und damit die Reparaturintensi-
„innovation test beds“ über die Förderung digitaler
tät von Fahrzeugen unterliegt zwei gegenläufigen
Services (vgl. Kartendienste) bis zu einer raschen, wider-
Entwicklungen: Alternative Antriebskonzepte ver-
spruchsfreien und anreizkompatiblen Regulierung der
ringern, die Digitalisierung erhöht sie. Es ist daher
Datensammlung und -nutzung ist die Politik gefordert,
besonderes Augenmerk darauf zu legen, dass sich der
optimale Rahmenbedingungen für die Weiterentwick- ohnedies schon bestehende, gravierende Rückstand
lung der europäischen und österreichischen Fahrzeug- in der Produktivitätsentwicklung bei Werkstattleis-
industrie zu schaffen. tungen nicht noch weiter vergrößert. Hierzu bedarf es
Die Herausbildung europäischer Alleinstellungsmerk- einer raschen Weiterentwicklung des Berufsbildes
male darf nicht an einer mangelnden Verfügbarkeit des Kraftfahrzeugelektrikers und weiterer Lehrberu-
entsprechender Intermediärgüter (z.B. Prozessoren) fe im Bereich der Kraftfahrzeugtechnik.
20WERKSTOFFE
Der Industriestandort Österreich weist aufgrund seiner schungsförderungsprogrammen und Forschungs-
ausgeprägten Werkstoffkompetenz eine international infrastrukturen im universitären und außeruniver-
herausragende Position im Leichtbau auf. Zahlreiche sitären Bereich in Österreich notwendig.
Leitbetriebe sind global führend in den Bereichen Stahl, Die werkstoffübergreifende Zusammenarbeit ist
Aluminium, Kunststoff und Faserverbundwerkstoff. ein Schlüsselthema. Die Innovationskraft im Wert-
Diese Betriebe der Grundstoffindustrie sind die Basis schöpfungsnetzwerk Leichtbau soll durch Koope-
der intensiv verflochtenen Wertschöpfungsketten der rationsprojekte im Rahmen der relevanten Clus-
Fahrzeugindustrie und von den Rahmenbedingungen der terstrukturen insbesondere in den Bundesländern
Energie- und Umweltpolitik stark abhängig. Die Bedeu- Oberösterreich und Steiermark entsprechend
tung dieser Leitbetriebe auch für den Fahrzeugindustrie- weiter ausgebaut und gestärkt werden. Die Platt-
Standort Österreich muss besonders betont werden. form “Austrian Advanced Lightweight Technology”
Zur Sicherung dieser Position ist die Weiterent- (A2LT) bündelt die Kompetenzen der österreichi-
schen Unternehmen und Forschungseinrichtungen
wicklung der Ausbildungsstrukturen im Schul- und
im Themenbereich Leichtbau.
Hochschulbereich sowie von spezifischen For-
FACHKRÄFTE
In Politik und Medien braucht es eine positiv besetzte Betriebe müssen ganzheitlich unterstützt werden,
Kommunikation über die österreichische Fahrzeugindus- wenn sie ihren Beschäftigten Weiterbildung in den
trie und ihre Technologien. Als wichtiger Teil der Lösung Bereichen ermöglichen, die für die Fahrzeugindustrie
für moderne und klimaverträgliche Mobilität. Dieses an Bedeutung gewinnen.
Wissen muss sich auch bei der Bildungs- und Berufswahl Die Lehrausbildung gerade auch für technikaffi-
junger Menschen wiederfinden. ne und leistungsorientierte Jugendliche attraktiv
Notwendig ist eine enge und strukturell verankerte machen, z.B. durch eine qualitätsvolle Einstiegsphase
oder durch Lehre mit oder nach Matura.
Abstimmung zwischen Schulen (insbesondere HTL)
bzw. Hochschulen und der Fahrzeugindustrie, um
Aktualität und Zukunftsrelevanz der vermittelten
Bildungsinhalte sicherzustellen.
Österreich braucht eine MINT-Offensive, die
bereits in der Elementarstufe startet, um die Zahl der
Absolventinnen und Absolventen in den technisch-
naturwissenschaftlichen Ausbildungsrichtungen zu
steigern. Gestärkt werden müssen zudem die Bereiche
Data Intelligence, Data Security, Software.
21STEUERPOLITISCHER RAHMEN
Eine Überarbeitung des steuerpolitischen Rahmens, hin Letztlich müssen aber auch die vielen österreichischen
zu einer deutlich nutzungsabhängigeren Besteuerung Arbeitsplätze in der Fahrzeugindustrie und den mit
schafft faire Rahmenbedingungen und bringt Verur ihr verbundenen Sektoren durch eine Anpassung des
sachergerechtigkeit. steuerpolitischen Rahmens erhalten bleiben. Insbe-
sondere darf keine Verschlechterung beim Sachbezug
Damit verbunden ist unter anderem auch die und Pendlerpauschale geschaffen werden und darüber
Forderung nach einer deutlichen Reduktion bzw. hinaus ist eine Anpassung des seit 2008 nicht angeho-
Abschaffung der NoVa. benen Kilometergeldes notwendig. Da die Anschaffung
von Hybrid-Modellen und Elektrofahrzeugen oftmals
Um die moderne Autoindustrie 4.0 in Österreich zu mit hohen Kosten verbunden ist, wird auch eine Anpas-
fördern, ist die Einführung einer Investitionsprämie sung der seit 2005 gleichbleibenden Luxustangente in
für die Autoindustrie für die Bereiche Digitalisierung der Höhe von 40.000 Euro empfohlen.
und Ökologisierung zielführend und kann zusätzlich
durch eine Ökologisierungsprämie für Käufer flankiert
werden. Diese kann beispielsweise so ausgestaltet
werden, dass Konsumenten, die ihr altes Auto gegen ein
deutlich umweltfreundlicheres eintauschen (Senkung
des CO2-Ausstoßes um mindestens 30 Prozent), eine
Ökologisierungsprämie von 3.000 Euro erhalten.
INFRASTRUKTUR
Der Ausbau von zukunftsfester Infrastruktur und Durch Vernetzung den Fortschritt stärken
flächendeckender Multimodalität ist unumgänglich Die Digitalisierung birgt im Bereich der Infrastruktur
für eine erfolgreiche Fahrzeugindustrie. Im Bereich der großes Effizienzpotenzial. Dabei sollten vor allem
Technologie ist die Technologieneutralität, Transpa- modernste Informations- und Kommunikationstech-
renz und die Effizienz von Kostenwahrheit ausschlag- nologien für den Verkehrssektor („Smart and Seamless
gebend. Eine moderne Raumordnung soll dabei als Mobility“) zum Einsatz kommen, um die Optimierung
unterstützendes (Lenkungs-)Instrument für intelligente bei Energie- und Verkehrsmanagement voranzutrei-
Verkehrs- und Siedlungspolitik dienen. Schließlich sind ben. Dazu gehören vor allem auch der lückenlose Aus-
auch Investitionen in Forschung und Entwicklung eine bau der digitalen Infrastruktur (5G-Mobilfunknetz,
Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Fahrzeug- schnellere Datenleitungen) und ein großflächiger
industrie in Österreich. Ausbau für Ladeinfrastruktur alternativer Antriebs-
technologien. Ebenso kann vorhandene Infrastruktur
Konkret gilt es hierbei zwei strategische Handlungs mit innovativen Nutzungsmustern gekoppelt werden.
Zum Beispiel durch die Integration von Wasserstoff
felder zu beachten:
in den Energiesektor, die Nutzung der Power-to-Gas-
Verantwortung für die Zukunft übernehmen Technologie oder auch für Ansätze der CO2-Abschei-
Schon heute müssen die Weichen für morgen gestellt dung und -Verwendung (Carbon Capture and Utili-
werden: Eine Überarbeitung des Gesamtverkehrs- zation, CCU). Im Sinne des europäischen Gedankens
plans von 2012, der Ziele und Leitlinien wiedergibt ist auch die Vereinheitlichung technischer Standards
und proaktiv gestaltet ist, ist daher unumgänglich. EU-weit anzuraten, neben den Fahrzeugklassen etwa
Ebenso müssen die rechtlichen Rahmenbedingungen auch Mautsysteme.
für Innovationen, wie autonomes Fahren, die viel-
fältiges Potenzial für die Optimierung des Verkehrs-
systems bringen, geschaffen werden. Im gesamten
Prozess gilt es dabei Bürokratiehürden abzubauen
und Initiativen zur Beschleunigung von Genehmi-
gungsverfahren (u.a. Umweltverträglichkeitsprüfungs-
verfahren) zu setzen.
22QUELLVERZEICHNIS:
1. Economica (2013): Leitbranche Automobilwirtschaft – Volkswirtschaftliche Leistung, fiskalischer Beitrag und innovative Dynamik, Studie
im Auftrag des Arbeitskreises der Automobilimporteure Österreichs in Zusammenarbeit mit dem Fachverband der Fahrzeugindustrie
Österreichs und dem Bundesgremium des Fahrzeughandels, Wien.
2. Council 4 (2019): Auf der Siegerstraße bleiben. Automotive Cluster der Zukunft bauen, Studie im Auftrag des BMVIT, Wien. sowie
Economica (2018): Der ökonomische Fußabdruck der Motorradwirtschaft in Österreich. Update. Studie im Auftrag der arge2Rad Austrian
Motorcycle Association, Wien.
3. Economica (2016): Leitbranche Automobilwirtschaft – Innovative Leistungen im Bereich der Umwelttechnologien, Studie im Auftrag des
Arbeitskreises der Automobilimporteure in der Industriellenvereinigung in Zusammenarbeit mit dem Fachverband der Fahrzeugindustrie
Österreichs, dem Bundesgremium des Fahrzeughandels und der Bundesinnung der Kraftfahrzeugtechniker, Wien.
4. Klima-Studie: Elektroautos brauchen die Energiewende [26.08.2019]
Dieses Aktionspapier wurde von der IV-Task Force „Fahrzeugindustrie“ erarbeitet.
WIR DANKEN DEN MITGLIEDERN FÜR IHRE WERTVOLLEN IMPULSE
DI Günther Apfalter, MAGNA International Europe GmbH
DI Herbert Eibensteiner, voestalpine AG
Georg Knill, Präsident Industriellenvereinigung (IV), Rosendahl Nextrom GmbH
Prof. Dr. DI Helmut List, AVL List Gmbh
DI Georg List, MBA, AVL List Gmbh
DI F. Peter Mitterbauer, MBA, Vizepräsident Industriellenvereinigung (IV), Miba AG
DI Stefan Pierer, PIERER Mobility AG
23www.iv.at IMPRESSUM Vereinigung der Österreichischen Industrie (Industriellenvereinigung) Schwarzenbergplatz 4, 1031 Wien Tel.: +43 1 711 35 - 0 newsroom@iv.at, www.iv.at zvr.: 806801248, livr-n.: 00160, EU-Transparenzregister Nr.: 89093924456-06 Vereinszweck gemäß § 2 Statuten: Die Industriellenvereinigung (IV) bezweckt, in Österreich tätige industrielle und im Zusammenhang mit der Industrie stehende Unternehmen sowie deren Eigen- tümer und Führungskräfte in freier und demokratischer Form zusammenzufassen, ihre Interessen besonders in beruflicher, betrieblicher und wirtschaftlicher Hinsicht auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene zu vertreten und wahrzunehmen, industrielle Entwicklungen zu fördern, Rahmenbedingungen für Bestand und Entscheidungsfreiheit des Unternehmertums zu sichern und Verständnis für Fragen der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung zu verbreiten. Die verwendeten Bezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter gleichermaßen. Für den Inhalt verantwortlich: Industriellenvereinigung Kontakt & Koordination: Patrick Grabher, Gernot Pagger, Christian Helmenstein, Joachim Haindl-Grutsch, Dominik Futschik Grafikdesign: Petra Matovic, Nina Mayrberger, designundzwanzig OG Fotocredits: AdobeStock Wien, im Mai 2021
Sie können auch lesen