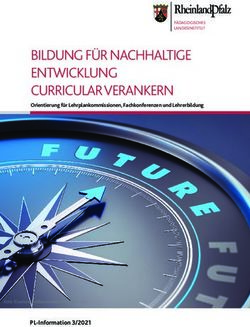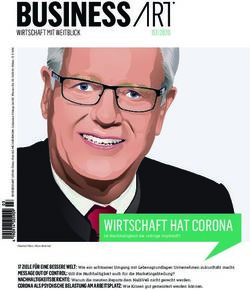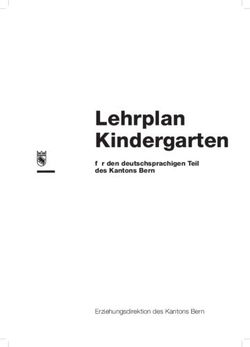Duale Ausbildung: Schule und Fußball - unipub
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Duale Ausbildung: Schule und Fußball
Vor- und Nachteile dieses Bildungsweges
Diplomarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades eines Magisters der
Naturwissenschaften
an der Karl-Franzens-Universität Graz
vorgelegt von
David Mayer
am Institut für Sportwissenschaften
Begutachter: Mag. Dr. Phil. Gerald Payer
Graz, Juni 2021Eidesstattliche Erklärung
Ich erkläre hiermit Eides statt, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig
und ohne fremde Hilfe verfasst habe, andere als die angegebenen Quellen
nicht verwendet habe und die den benutzten Quellen wörtlich oder
inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe.
29.06.2021 Mayer David
Graz, am Unterschrift
3Danksagung
Sehr großer Dank geht an meine Eltern, die mich mein ganzes Leben
immer voll unterstützen und die mir alles in meinem Leben ermöglicht
haben. Ohne sie hätte ich nicht die Möglichkeiten für mein jetziges Leben
gehabt und auch wäre meine Liebe zu dem Fußball nicht so entflammt,
wenn von zuhause nicht dieses Verständnis und dieser Enthusiasmus
geherrscht hätte.
Weiters möchte ich mich bei meinem Betreuer Mag. Dr. Phil. Gerald Payer
bedanken. Er steht mit Rat und Tat zur Seite und nimmt sich für seine
Studenten immer Zeit. Er brachte mich bei der Umsetzung der Arbeit
immer wieder auf gute Ideen und wie man diese auch umsetzen könnte.
Auch ein Dank geht an alle meine ehemaligen Spielerkollegen, Trainer,
Funktionäre und weitere Personen, die mich in meinem Fußballleben
begleitet haben. Ohne dieses Umfeld wäre ich nie zum großartigsten Sport
der Welt gekommen und wäre so lange darin verblieben.
Danke an die Steiermark Sturm Graz Akademie unter der Leitung von
Herrn Dipl. Päd. Dietmar Pegam, dem Administrativen Leiter Mag. David
Tauschmann und dem U18 Akademie Trainer Arnold Wetl für die
kooperative Zusammenarbeit und der Ermöglichung der Durchführung der
Interviews. Natürlich auch ein Dank an die interviewten Spieler, welche
sich unentgeltlich an ihren freien Tag der Woche zur Verfügung gestellt
haben.
4Vorwort
Mein ganzes Leben begleitet mich schon der Fußball in den
verschiedensten Funktionen, wie zum Beispiel als aktiver Spieler,
Funktionär oder Trainer. Mich hat schon immer die Komplexität dieses
Sports fasziniert, wo man auf so viele Fähigkeiten und Fertigkeiten achten
muss, um diesen Sport erfolgreich ausüben zu können.
In meiner zwanzigjährigen Laufbahn in diesem sogenannten
Fußballgeschäft sind mir im Laufe der Zeit einige Veränderungen
aufgefallen. Der Sport wurde immer athletischer, taktischer und auch
kognitiv fordernder. Reichten in früheren Zeiten wenige Trainings, um ein
sehr gutes Niveau zu erreichen, so muss man in der Gegenwart schon sehr
viel mehr an Zeit und Opferbereitschaft aufbringen, um sich an der Spitze
des Sports etablieren zu können.
Durch dieses Bewusstwerden dieser Veränderungen kam in mir der
Gedanke auf, sich die Leistungsschmieden des Fußballs genauer
anzuschauen und über dieses Zusammenspiel von Fußball und der
verbundenen schulischen Ausbildung der Akademien eine Arbeit zu
verfassen.
Wichtig war es mir in meiner Arbeit auch wichtige Bausteine und
Zusammenhänge für eine erfolgreiche Ausbildung aufzuzeigen.
5Inhaltsverzeichnis
Einleitung ........................................................................................................... 7
Theoretischer Teil ............................................................................................ 11
1. Die Entwicklung des österreichischen Fußballs .................................... 12
2. Ist-Zustand im österreichischen Fußball ................................................ 18
3. Ergebnisse des österreichischen Fußballs ............................................ 24
4. Kinderfußball ......................................................................................... 27
5. Duale Ausbildung in der Bildungswissenschaft ..................................... 29
6. Die Fußballakademien (AKA) ................................................................ 30
7. Gesetzliche Grundlage für die Kooperation zwischen
Akademie und Schule ........................................................................... 35
7.1 Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben in den Akademien .... 40
7.2 Konzeption und Umsetzung in der Akademie Steiermark Sturm Graz
...................................................................................................... 49
7.3 Die sportliche Ausbildung .............................................................. 54
7.4 Das Spiel ....................................................................................... 57
8. Die Vor- und Nachteile der dualen Ausbildung ...................................... 61
Empirischer Teil ............................................................................................... 64
1. Empirische Erhebung ............................................................................ 64
2. Begründung der Forschungsmethode ................................................... 65
3. Qualitative Interviews als Forschungsmethode ..................................... 65
4. Interviewpartnerinnen/Interviewpartner ................................................. 66
5. Methodik der Datenerhebung & -erfassung ........................................... 66
6. Methodik der Auswertung ...................................................................... 67
6.1 Gegenstand der Analyse ............................................................... 68
6.2 Kategoriebildung/Kategoriedefinition ............................................. 68
6.3 Einzelanalyse ................................................................................ 69
7. Auswertung der Leitfadeninterviews ...................................................... 70
7.1 Gründe für den Besuch einer Fußballakademie ............................ 70
7.2 Chancen für professionelle Karriere .............................................. 71
7.3 Vorteile einer Fußballakademie..................................................... 72
7.4 Nachteile einer Fußballakademie .................................................. 73
7.5 Resümee über Schulauswahl........................................................ 74
7.6 Schwerpunkt der Ausbildung......................................................... 75
7.7 Veränderungswünsche ................................................................. 76
8. Resümee der Ergebnisse ...................................................................... 76
9. Quellenverzeichnis ................................................................................ 79
6Einleitung
Einleitung
Diese Arbeit beschäftigt sich mit der dualen Ausbildung am Beispiel einer
Fußballakademie in Österreich. Sie geht auf die Entwicklung der
österreichischen Fußballakademien, den Ist-Zustand im österreichischen
Fußball, Kinderfußball, die gesetzlichen Grundlagen und vor allem auf die
Vor- und Nachteile des dualen Ausbildungssystems „Fußballakademie“
näher ein. Als Hauptforschungsfrage wird beleuchtet
„Welche Vor- und Nachteile sehen Schülerinnen und Schüler einer
Fußballakademie in ihrem Ausbildungsweg gegenüber Schülerinnen und
Schülern, die in ihrer Freizeit ins Fußballtraining gehen?“
Um diese Fragestellung zu klären, wird der Autor Schülerinnen und
Schüler einer österreichischen Fußballakademie befragen und die
Antworten dann mit adäquater Literatur analysieren.
Gunnar Prokop (o.J.), ein bekannter österreichischer Sporttrainer, hat
folgende Meinung über den österreichischen Fußball:
„Die Leute wollen den österreichischen Fußball offenbar gar nicht sehen, sonst wäre
ja zum Beispiel die Austria jedes Mal ausverkauft. Bei Real Madrid oder in Deutschland
kommen die Zuschauer, Woche für Woche. 80.000 Leute in Dortmund zum Beispiel. Und
da soll mir dann bitte keiner erklären, dass es nur daran liegt, dass Deutschland so viel
größer ist als Österreich. Denn wo ist der große Unterschied zwischen den Städten Wien
und Dortmund?“
Genau diesem Trend - der fehlenden Sportdisziplin entgegenzuwirken -
hat sich der Fußball in Österreich verschrieben und unterstützt dies mit
einer „Spitzensportausbildung“ (vgl. Fußballakademie Burgenland GmbH,
o.J., o.S.).
Die Spielerinnen und Spieler, welche einen Platz an einer österreichischen
Fußballakademie finden, werden in ihrem Können im Bereich Fußball
gefördert und optimiert, so dass sie im Laufe ihrer Entwicklung einen Platz
im Profisport erlangen können. Trotz dieser einmaligen Gelegenheit der
Ausbildung ist ein Abschluss an einer der Akademien noch keine Garantie
für eine Karriere im Profifußball.
7Einleitung
Deshalb setzt die österreichische Nachwuchsförderung auf eine parallele
Ausbildung, die ebenfalls die Allgemeinbildung einbezieht, für den Fall,
dass eine Spielerin/ein Spieler keine Chance erhält.
Vielfach haben junge Spielerinnen und Spieler in der Vergangenheit die
Chance auf eine Profikarriere vor eine fundierte Ausbildung gesetzt und für
ihren Traum alles riskiert. Wirtschaft und Fußball sind sich jedoch heute
einig darüber, dass dies nicht sein muss. Um Enttäuschungen und
verfehlten Lebensträumen vorzubeugen, riefen Entscheiderinnen und
Entscheider die duale Ausbildung auf den Plan. In Deutschland spricht sich
ein Politiker und Jurist, der gleichfalls als Sportfunktionär agiert, für die
Verbindung zwischen Sport und Bildung aus. Theo Zwanziger betont dabei
die Ganzheitlichkeit in der Ausbildung (vgl. Weisbarth & Henkel, 2011, S.
9). Neben einer sportlich-taktischen Ausbildung nennt er die
Persönlichkeitsbildung als entscheidenden Bestandteil der
Nachwuchsförderung der Zentren in Kooperation mit ihren Partnerschulen
in Deutschland.
In der Sportwissenschaft ist die Beschäftigung mit der Thematik Fußball
und Fußballakademien nicht ausgereift. Dies gilt nicht nur für Österreich,
sondern für nahezu alle europäischen Staaten (vgl. Lewentz, o.J., o.S.).
In der Forschung wurde die Thematik noch im Jahr 1980 nicht als
ernsthafter Untersuchungsgegenstand anerkannt. Damals sollte er im
Rahmen der Sozialwissenschaften in Form einer Magisterarbeit untersucht
werden (vgl. Elias & Dunning, 2003, S. 42)
Eine quantitative Forschung liegt deshalb kaum vor und auch qualitativ
befinden sich diese Untersuchungen nicht auf einem wissenschaftlichen
Niveau. Dies ist beispielsweise daran zu erkennen, dass das Budget der
Bundesliga nicht veröffentlicht wird. Im Falle einer seltenen
Veröffentlichung sind die Zahlen eher zweifelhaft (vgl. Huber, 2015, o.S.)
8Einleitung
In der Regel zählen die Grunddaten zu den Zahlen, die erhoben und
veröffentlicht werden. Darunter verstehen sich Fernsehzeiten,
Einsatzminuten der einzelnen Spielerinnen und Spieler sowie
Wettbewerbe (vgl. Österreichische Fußball-Bundesliga, o.J., o.S.). Jedoch
gilt dies nicht für den Amateurbereich, denn dort ist eine nachvollziehbare
Erhebung der Daten nicht gegeben.
Erst zur Jahrhundertwende beauftragte der Oberösterreichische
Fußballverband (OÖFV) ein webbasierendes System, das Daten im
Amateurbereich regional übergreifend erfasste. Kontinuierlich wurde
dieses System in ganz Österreich etabliert (vgl. Österreichischer Fußball-
Bund, o.J., o.S.).
Zusätzlich liefen sowohl im professionellen Bereich als auch im
Amateursegment zwei Neuerungen ab: Einerseits untersuchte das Institut
für Höhere Studien (IHS) zwischen 2005 und 2009 den „Fußball in
Österreich“ (vgl. Ritzinger, 2005, S. 30) und anderseits analysierte das
Institut für Sportökonomie (SPEA) Daten zum „Wirtschaftsfaktor Fußball“
(vgl. Österreichischer Fußballverbund, 2020, o.S.)
Die Untersuchungen fanden mithilfe quantitativer Forschungsmethoden
(Fragebogen, statistische Auswertung) statt. Die
Untersuchungsgegenstände teilten sich in Fußballvereine und Fanklubs in
Österreich auf. Die Zielsetzung lag auf der Untersuchung der
wirtschaftlichen Effekte des Fußballs. Zum ersten Mal generierten die
Forscherinnen und Forscher nicht nur Zahlen, sondern interpretierten sie
auch. Dies erwies sich als schwierig, da die Daten weder eine hohe
Qualität noch Quantität aufwiesen.
Als Ergebnis bildete sich heraus, dass grundlegende Entscheidungen im
Fußball in Österreich auf zwei Faktoren beruhen: die „Expertinnen und
Experten“-Meinung und die informelle Gruppe.
9Einleitung
Es stellte sich weiterhin heraus, dass Maßnahmen, die einer präzisen
Analyse der wirtschaftlichen Gegebenheiten entbehrten, kaum erfolgreich
waren. Dies rief eine Umstrukturierung auf den Plan, der sich die „ÖFB
Zukunftswerkstatt“ annahm (vgl. Ritzinger, 2005, S. 42).
Als Grundlage für diese Arbeit sind aus den angeführten Gründen nur
wenige Quellen vorhanden, denn wissenschaftliche Arbeiten und Theorien
sind selten zum Thema Fußball in Österreich. Zudem sind relevante Daten
nur lückenhaft vorhanden und die zur Thematik vorliegenden Meinungen
sind aufgrund ihrer hohen Anzahl schwer strukturierbar.
Auf dieser Ausgangsbasis soll im Folgenden das genutzte
Untersuchungsdesign dargelegt werden. Um sich einer wissenschaftlichen
Untersuchung anzunähern, sind zunächst Vermutungen zu den nicht
vorhandenen Untersuchungsgründen anzustellen. Die geringen Qualitäten
österreichischen Fußballs werden vielfach mit unlauteren Methoden in
Verbindung gebracht. Dazu werden Schwarzgeldzahlungen im
österreichischen Fußball und eine Ausnutzung des Ehrenamtes genannt
(vgl. Irndorfer, 2013, S. 102). Da beide Vermutungen auf Gesetzesbrüche
zurückzuführen sind, sind Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in
diesem Bereich kaum zu erwarten. Die zweite Vermutung scheint schwer
untersuchbar, da das Ehrenamt in Österreich einen angesehenen Status
hat, der die österreichische Gesellschaft ausmacht. Eine Kritik an diesem
würde einer Gesellschaftskritik gleichkommen.
Als Forschungsmethode entschied sich der Autor aufgrund dieser
mangelnden Zahlen und Studien für qualitative Interviews. Eine genauere
Erläuterung zu seinen Forschungsmethoden und den gewonnenen
Erkenntnissen ist im empirischen Teil zu finden.
10Theoretischer Teil
Theoretischer Teil
Die vorliegende Arbeit soll das Thema Fußballakademien so erläutern,
dass die Notwendigkeit ihrer Entstehung aus der Geschichte des
österreichischen Fußballs deutlich wird. Bereits die
Entstehungsgeschichte zeigt einen Zusammenhang des Sports mit der
schulischen Ausbildung auf. Die Weiterentwicklung in Form von
Akademien brachte die Möglichkeit, den Sport und die Ausbildung in dieser
Disziplin zu professionalisieren. Die Meilensteine, die zu einer geförderten
Profikarriere führten, sollen dargestellt werden, so dass der heutige Ist-
Zustand der österreichischen Fußballakademien entstand.
Im Rahmen der bildungswissenschaftlichen Untersuchung liegt der Fokus
auf den gesellschaftlichen Veränderungen in der Anerkennung des
Fußballs als Beruf in Österreich. Dies wird anhand der Kooperation
Akademie / Schule dargelegt und mit den österreichischen Lehrplänen
legitimiert. Danach beschreibt diese Arbeit die Umsetzung in den Schulen,
um den Übergang zwischen Theorie und Praxis zu verdeutlichen. Anhand
dessen sollen unterschiedliche Formen der Umsetzung erörtert und
miteinander verglichen werden.
Exemplarisch soll dies am Beispiel der Kooperation Sturm Graz mit den
Partnerschulen in Graz weitergeführt werden. Dabei werden die Vor- und
Nachteile der dualen Ausbildung weiter erörtert. Dies soll auch den
Schwerpunkt der Arbeit bilden, um schlussendlich eine klare Aussage
darüber treffen zu können, welcher Ausbildungsweg für Profisportlerinnen
und Profisportler zu präferieren ist. Letztendlich soll aufgezeigt werden, wie
die Verbindung zwischen Bildung und Fußball zu einer erfolgreichen
Karriere mit einem Plan B führt. Damit fasst diese Arbeit die
Zukunftsperspektiven für junge Spielerinnen und Spieler an
Fußballakademien zusammen.
11Theoretischer Teil
1. Die Entwicklung des österreichischen Fußballs
Fußball ist nicht nur eine Sportart, die sich einer großen Beliebtheit in der
Öffentlichkeit erfreut; Fußball hat eine Geschichte. Der Wissenschaft ist bis
heute keine eindeutige zeitliche Einordnung des Beginns des Fußballs
möglich. Zu bestimmen ist allerdings die Erfolgsgeschichte desselben,
denn dadurch wurde die Festlegung von Regeln notwendig. Es entstand
ein einheitliches Regelwerk. Erste Aufzeichnungen darüber belegen, dass
ein erster Entwurf im Jahr 1863 in England entstand. Im Kreise einer
Gruppe von Studentinnen und Studenten der Universität Cambridge
entwarf ein Beratungsteam ein Minimum an Regeln. Dahinter stand die
Motivation die unterschiedlichen Fußballclubs zusammen zu fassen und
damit einen gewissen Standard zu kreieren. Es brauchte ganze sechs
Sitzungen des Teams, um eine einstimmige Entscheidung herbeizuführen.
Dies brachte den Startschuss als Voraussetzung des Eintritts vom Fußball
in die Wettbewerbsfähigkeit (vgl. Bausenwein, 2006, S. 252f.)
Darauf aufbauend gründete man im selben Jahr die Football Association
(FA). Sie entstand am 26. Oktober 1863 in London. Die Beratungen
wurden sogar in Form von Dokumentationen der Treffen veröffentlicht.
Dazu diente die damals populäre Sportzeitschrift „Bell´s Life“. In diesem
Stadium wurde jedoch noch nicht definiert, wie viele Spielerinnen und
Spieler in einer Mannschaft sein sollen oder wie lange ein Spiel dauern
soll. Auch die Form des Balles wurde noch nicht festgelegt. Die
Notwendigkeit einer Schiedsrichterin/eines Schiedsrichters wurde im Jahr
1891 für gültig erklärt.
Sehr früh allerdings wurde klargestellt, dass Fußball kein Sport der Gewalt
ist und es in jedem Fall um „Fair Play“ gehen muss.
Anhand dieser Kriterien lassen sich heute noch Schlussfolgerungen auf die
Charaktere der Beteiligten ziehen. Es gab zu diesem Zeitpunkt klare
Vorstellungen über die Werte, welcher dieser Sport vermitteln soll.
12Theoretischer Teil
Noch im selben Jahr führte dies dazu, dass die öffentliche Schule in
England den Fußball als Spiel in seine Curricula aufnahm, um „zur
Ausbildung im Sinne der britischen Herrschaft“ (vgl. Zeyringer, 2014, S. 30)
beizutragen. Drei Jahre später veranstaltete man den ersten Wettbewerb
als FA-Cup. Ausgetragen wurde dieser von der Football Association.
Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren fünfzehn Mannschaften, die aus
hohen Schulen stammten. Die Siegerinnen und Sieger belohnte die
Association mit einem Gewinn in Höhe von zwanzig Pfund. Außerdem
verlieh sie einen Silberpokal sowie ein Endspiel mit zweitausend
Zuschauerinnen und Zuschauern im Stadion. Der FA-Cup fand bis ins Jahr
2011 mit insgesamt 763 Teams statt. Damit entwickelte er sich zum
größten Pokalbewerb im englischen Fußball. Im Jahr 2016 stellte die
Association ein Preisgeld in Höhe von 1,8 Millionen Pfund zur Verfügung
(vgl. ebd., 2014, S. 31).
Im Zuge der Industrialisierung kam es zu vermehrten Handelsbeziehungen
zwischen England und den restlichen europäischen Ländern. Damit
verbreitete sich der Trend des „football“ auch im Ausland durch
Mundpropaganda. Dadurch kann auch Österreich auf die ursprünglichen
englischen Wurzeln im Fußball zurückblicken (vgl. Bausenwein, 2014, S.
304f.).
Mit der Entwicklung des Fußballs einher ging parallel die Entwicklung der
Akademien im Bereich des Fußballs. Da der Fußball nun im öffentlichen
Interesse stand und als professioneller Sport galt, musste der Nachwuchs
entsprechend professionell ausgebildet werden.
Bis dahin erlangten zahlreiche Spielerinnen und Spieler ihre Fähigkeiten in
Parks, wo eingezäunte Vierecke aufgestellt waren. Darin konnte Fußball
gespielt werden, so dass viele Schülerinnen und Schüler diese
sogenannten „Käfige“ für sich nutzten.
So verbreitete sich der Fußball einerseits im Rahmen des Stundenplans
als auch durch die aktive Freizeitgestaltung.
13Theoretischer Teil
Da der Fußball immer mehr zum Mittelpunkt im Sport wurde, rückte dieser
immer mehr von der Freizeit in einen professionellen Rahmen. Innerhalb
der Sportklubs gründete man deshalb vermehrt U10 und U8 Teams.
Dadurch konnten auch jüngere Kinder an den Sportereignissen teilhaben
(vgl. Skocek, Weeisgram & Mauhart, 2004, S. 318f.).
Die Entwicklung der Ausbildung im Fußball übernahm der wirtschaftlich
denkende Unternehmer Frank Stronach in den Jahren um 2000. So
repräsentierte er in den Jahren 2000 bis 2005 den Bundesliga-Präsidenten
(vgl. News (apa/red), o.J., o.S.). Im Herbst 2000 entstand die „Fachschule
für Computer- und Kommunikationstechnik mit integrierter Ausbildung
zur/zum Leistungssportlerin/Leistungssportler“. Zunächst wurden dort 22
motivierte Fußballspielerinnen und Fußballspieler in die Akademie von
Hollabrunn aufgenommen und kostenlos zu Profispielerinnen und
Profispielern ausgebildet. Somit konnten die ersten Spielerinnen und
Spieler ihren Traum verwirklichen. Diese erste österreichische
Fußballakademie setzte den ersten Meilenstein für eine nachfolgende
fundierte Aus- und Weiterbildung des Fußballs. Die Unterrichtsform nannte
sich damals „geschützte Werkstatt“. Diese strebte stets nach dem
Optimum in der Ausbildung. Um der Akademie einen Schwerpunkt zu
verleihen, wurde sie dreifach gegliedert. Die drei Säulen gestalten eine
Zusammenarbeit zwischen Schule, Sport und individueller Förderung (vgl.
Wiener Zeitung o.A., 2000, o.S.).
Die Ausarbeitung der Curricula vollzog sich zusammen mit den
zuständigen politischen Abteilungen. Dabei bestimmten diese Abteilungen
nun auch die Dauer der Ausbildung auf fünf Jahre. Daneben wurden
Fächer für den Lehrplan ergänzt, die auf den Sport bezogen waren.
Damit hoben sich die Akademien eindeutig von den regulären Schulen ab,
denn dort herrschte eine strikte Trennung zwischen Regelunterricht am
Vormittag und Sportunterricht am Nachmittag (vgl. APA OTS, 2000, o.S.).
Dies wiederum beeinflusste den Fußballbund in Österreich, der Schlüsse
14Theoretischer Teil
aus diesem Umbruch in der Ausbildung zog. So begann dieser im Jahr
2000 die Arbeit für den Nachwuchs zu erweitern und zu optimieren. Daraus
resultierte die Gründung von Landesverbandsausbildungszentren (LAZ).
Sie basieren auf einer Kooperation aus „den Stammvereinen, den Schulen
und den Eltern“. Es galt die Talente der Jungen außerschulisch in den
Ausbildungszentren zu fördern. Dies ging so weit, dass sie auch an den
Wochenenden zu Wettbewerben antraten. So konnte eine zusätzliche
individuelle Förderung neben der Schule erzielt werden (vgl.
Österreichischer Fußballbund, 2000, o.S.). Die Schule war dabei jederzeit
im Bilde, so dass von einer Zusammenarbeit gesprochen werden kann.
Den Landesverbandsausbildungszentren nachgelagert waren die
Bundesliga-Nachwuchszentren, die BNZ. Wenn eine BNZ gewisse
Kriterien erfüllt, die „Personal, Infrastruktur, Betreuung (und)
Schulkooperationen“ betreffen, besteht die Möglichkeit einer Bildung einer
Fußballakademie. Allerdings bleibt dabei zu beachten, dass in ganz
Österreich lediglich 12 solcher Akademien existieren dürfen, welche durch
den Österreichischen Fußballverband legitimiert werden (vgl. ebd.).
Das Alleinstellungsmerkmal der Fußballakademien ist durch die
Kooperation zwischen Schule und Sport gegeben. Die Auflage dazu lautet:
Es muss „mindestens eine Schulkooperation mit einer berufsbildenden
mittleren Schule“ und zumindest zwei „Schulkooperation(en) mit (...)
maturaführenden Schule(n)“ vorhanden sein (vgl. Österreichischer
Fußballbund, 2000, S. 13).
15Theoretischer Teil
Dadurch wird gleichzeitig das Mindesteintrittsalter bei 14 Jahren
vorausgesetzt. Damit soll sichergestellt sein, dass die Jugendlichen sich
sowohl auf ihre Schullaufbahn als auch auf den Profisport konzentrieren
können. Eine/Ein Schulkoordinatorin/Schulkoordinator stimmt die Termine
ab und kann verfügen, dass in Einzelfällen ein Training während der
regulären Schulzeit stattfindet (vgl. Österreichischer Fußballbund, 2000, S.
13).
Da der Anstoß der Gründung der Fußballakademien aus der Wirtschaft
stammt, muss die Motivation der verantwortlichen Persönlichkeiten
betrachtet werden. Dazu wird das Fußballländerspiel zwischen Österreich
und den USA vom 22. April 1998 im Ernst Happel Stadion in Wien
beleuchtet. Dieses Spiel verlor Österreich mit 0 Toren zu 3 Toren der
Amerikaner. Frank Stronach war damals im Publikum und konnte die
Niederlage nicht begreifen. Danach wuchs in ihm die Idee, dass Österreich
ein Land ist, das zu den Besten gehören sollte. Daran wollte er mit
Optimierungen arbeiten (vgl. Kurier o.A., 2013, o.S.).
Als Geschäftsmann unterstütze er den nationalen Fußball einerseits mit
finanziellen Mitteln, forderte gleichzeitig aber auch Änderungen in der
Struktur. Zu dieser Strukturveränderung gehörte auch die Entstehung der
Fußballakademien. Erfolgsorientiert erklärte Stronach den Weltmeistertitel
zum Ziel. Dies sollte bei der WM im Jahr 2006 in Deutschland verwirklicht
werden. Zusätzlich lautete der Plan, dass die Vereine aus Österreich sich
in Europa wieder etablierten. Wenn diese hohen Ziele auch nicht erreicht
wurden, so sollten die Akademien für den Fußball doch bleiben. Und mit
ihnen überlebte auch das allgemeine Bedürfnis nach einem verbesserten
Fußball in Österreich (vgl. ebd).
Der Stand einer Fußballakademie wird vom Fußballbund in Österreich
bestimmt. Dazu sind vier Ziele notwendig. Zu diesen gehört auch, dass
jedes Bundesland eine Fußballakademie beherbergt (vgl. ebd.).
16Theoretischer Teil
Somit soll ein Rahmen für die Bestimmungen gesetzt werden. Damit ist die
Suche nach Talenten nicht regionalabhängig. Zusätzlich sollten alle
Schülerinnen und Schüler „sportlich(e), schulisch(e) bzw. beruflich(e)“
Ausbildung ermöglichen zu können“ (Stronach, zitiert in: Kurier o.A., 2013,
o.S.).
Die verschiedenen Vereine sind zudem zu einer engen Zusammenarbeit
aufgerufen, denn nur so kann ein passender Einstieg des Nachwuchses in
den Profifußball gewährleistet werden. Die Modelle für das Training setzen
das Ziel in eine Profikarriere sowohl national als auch international. Die
Spielerinnen und Spieler sollen in die Nationalmannschaften eingegliedert
werden und dadurch die sportliche Zukunft ihres Landes mitbestimmen
(vgl. Österreichischer Fußballbund, 2000, S. 4).
In Zahlen meint dies, dass ein Spieltag in der Bundesliga in Österreich in
sechs Spielen höchstens 168 Spielerinnen und Spieler braucht. In
Kombination mit der darunter gelegenen Liga sind es höchstens 392
Spielerinnen und Spieler, welche spielen müssen. Reduziert wird diese
Anzahl durch internationale Spielerinnen und Spieler, welche in
österreichischen Teams spielen. Aus den Absolventinnen- und
Absolventenzahlen der österreichischen Nachwuchsakademien ergeben
sich 348 Nachwuchsspielerinnen und -spieler, die pro Jahr auf den Markt
kommen. Anhand der Zahlen wird deutlich, dass das optimistische Ziel,
dass alle Absolventinnen und Absolventen in den Profisport gehen, nicht
realisierbar ist und bleibt. Zwar kann ein gewisser Teil auch auf dem
internationalen Markt einen Platz finden, jedoch sind die Chancen aufgrund
der hohen Konkurrenz eher gering (vgl. ebd.).
Im nächsten Kapitel folgt eine Aufstellung des Ist-Zustandes des
österreichischen Fußballs.
17Theoretischer Teil
2. Ist-Zustand im österreichischen Fußball
Bei einer Betrachtung des heutigen österreichischen Fußballs gilt der
Dachverband als übergeordnete Organisation, worunter die neun
Landesverbände sowie die Österreichische Fußball-Bundesliga (BL)
zusammengefasst sind (vgl. Zeyringer, 2014, S. 41).
Zusätzlich gestaltet er die Toto-Jugendliga mit. In Kooperation mit den
verschiedenen Vereinen repräsentiert er zudem den Berufsfußball des
Landes, die im Jahr 2012 in der Österreichischen Fußball-Bundesliga zu
finden war. Abbildung 1 zeigt eine Auflistung aller österreichischen
Fußballvereine.
Aus der Feder des Wiener Fußball-Verbandes stammt die Definition der
Aufgaben für die Landesverbände. Es treten jedoch trotzdem immer wieder
Unterschiede zwischen den Regionen auf. Dies hängt mit der
Zweckbindung der Landesverbände zusammen, der in der Förderung des
Sportes innerhalb des jeweiligen Bundeslandes besteht. Er übernimmt die
Vertretung der Interessen aller Mitglieder. Zudem werden Verbandspiele
und Wettbewerbe organisiert. Die Unterstützung vereint sportliche als auch
finanzielle Maßnahmen.
Im Gesamten obliegt ihm ebenfalls die Ausbildung der Schiedsrichterinnen
und Schiedsrichter und der Trainerinnen und Trainer, so dass ein
ganzheitliches Konzept entstehen kann. Im Mittelpunkt bleibt
selbstverständlich die Förderung des Nachwuchses in den
Landesverbandsausbildungszentren (vgl. Wiener Fußballverband, o.J.,
o.S.).
18Theoretischer Teil
Abbildung 1: Liste der Fußballvereine in Österreich (Fandom, o.J., o.S.)
Dieses Konzept wird in Interessenkreisen auch “Der österreichische Weg“
genannt. Spielerinnen und Spieler sowie Trainerinnen und Trainer werden
vom ÖFB parallel ausgebildet. Die Konzentration dieser Konzeption sieht
eine Stärkung des Breitensports als auch des Frauenfußballs vor.
Daneben bildet die Talentförderung ein weiteres Standbein und auch die
elitäre individuelle Förderung von Nationalspielerinnen und
Nationalspielern gehören in den Mittelpunkt dieses Konzeptes. Im Jahr
2008 fand die Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz statt. Im
Hinblick darauf wurde bereits ab dem Jahr der Vergabe 2003 ein Projekt
des ÖFB gestartet. Die Challenge 2008 forderte Höchstleistungen von
allen Beteiligten und baute den “Österreichischen Weg“ zusätzlich aus (vgl.
OEFB, o.J., S. 41).
19Theoretischer Teil
Im Laufe dieser intensiven Vorbereitung wurde 2005 ein
Individualtrainerinnen-/Individualtrainermodell integriert. Dies geschah im
Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen dem ÖFB und den
verschiedenen Bundesligavereinen. Um die Zukunft des österreichischen
Fußballs zusätzlich zu stärken, wurde in der Zukunftsklausur 2007 “Der
österreichische Weg - Challenge 2012“ beschlossen. Darin beschlossen
die Mitglieder die Kriterien zur Optimierung des österreichischen Fußballs.
Eingeschlossen sind darin einerseits ein Bekenntnis zum
Nachwuchsfußball auf allen Ebenen sowie der Grundsatz: Ohne Breite
keine Spitze. Die Spielerinnen und Spieler verbleiben im Mittelpunkt der
Ausbildung, so dass ebenfalls die Struktur der österreichischen
Talentförderung erhalten wird. Betont wurden abermals die elitäre
individuelle Förderung der talentiertesten Spielerinnen und Spieler sowie
die Herausarbeitung von Chancen für die österreichischen Talente. Die
Dreifachgliederung Fußball – Schule – Beruf soll im Gleichgewicht liegen
und die geeignetsten Trainerinnen und Trainer sollten zum Nachwuchs
gehören (vgl. OEFB, o.J., S. 23).
Unter dem Punkt “Ohne Breite keine Spitze“ ist zu verstehen, dass der
Kinderfußball die Grundlage für die Sicherung des Nachwuchses in
Österreich geworden ist. „Durch einen breiten Unterbau im Kinderfußball
sollen sich Talente sowohl über Vereine als auch über
Talentförderungseinrichtungen systematisch entwickeln und ihre
individuellen Leistungsmaxima erreichen können“ (OEFB, o.J., S. 32).
Abbildung 2 soll verdeutlichen, wie der ÖFB den Weg vom Kinderfußball
zum Profisport sieht:
20Theoretischer Teil
Abbildung 2: Der österreichische Weg – Ohne Breite keine Spitze (OEFB,
o.J., S. 51)
Im Jahr 2017 wurden wiederum neue Richtlinien zur Gründung von
Fußballakademien verfasst. Der Österreichische Fußballbund tat dies mit
der Zielsetzung, die Ausbildung von Profispielerinnen und Profispielern zu
optimieren und damit den Nachwuchs nachhaltig zu fördern. Sehr populär
ist die sogenannte Red Bull-Akademie. Sie wurde im Jahr 2014 in Betrieb
genommen. Weitere Akademien entstanden auf Landesebene. Dazu
gehörte die Fußballakademie Burgenland.
Zuvor hatte der Österreichische Fußballbund (ÖFB) ein Programm für
Schulungen der 12 Akademien in Österreich gestartet, das im April 2016
verwirklicht wurde.
21Theoretischer Teil
Zusätzlich entstand eine Kooperation mit dem Nationalen Zentrum für
Frauenfußball. Sie dient dazu, dass der Informationsfluss zu den
Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspielern transparent und
nachhaltig vollzogen wird.
Speziell lag der Schwerpunkt dieses Programms in einer Anti-Doping-
Kampagne, in der die Grundlage für einen sauberen, gesunden und fairen
Sport in der Zukunft geschaffen wurde.
Die Schulungen waren altersgerecht konzipiert und wurden interaktiv
durchgeführt, um die Inhalte in ein eigenverantwortliches Verhalten
umzuwandeln. Insgesamt dauerte das Akademieprogramm zwei
aufeinanderfolgende Jahre. Das erste Jahr wurde für die Einführung in der
U15, der U16 und U18 genutzt. Weiterführende Module führten die
Nachwuchsspielerinnen und Nachwuchsspieler durch das zweite Jahr, um
das Engagement der Spielerinnen und Spieler zu stärken. Nach der
gesamten Schulung wurde die jeweilige Akademie für die Teilnahme durch
eine Urkunde der ÖFB, BMLVS und NADA Austria geehrt (vgl. NADA
Austria, o.J., o.S.).
Im Jahr 2019 wollte das U21 Nationalteam an die Siege ihrer
Vorgängerinnen und Vorgänger aus dem Jahr 1996 anknüpfen. Eine
Teilnahme an der UEFA U21 Euro 2021 war das nächste Ziel und wurde
leider mit dem Abschneiden auf den zweiten Tabellenplatz hinter England
in der Qualifikationsgruppe verpasst. Man hätte sich auch mit einer
Platzierung unter den fünf Zweitbesten der Qualifikationsgruppe
qualifizieren können, aber auch dieses Ziel wurde nicht erreicht. Die
Europameisterschaft findet in Ungarn und Slowenien statt (vgl. OEFB, o.J.,
o.S.).
Dem A-Nationalteam ist 2020 ein Prestigeerfolg in der seit 2018/19 neu
gegründeten Uefa Nations League gelungen, indem man in der Gruppe B
den ersten Platz erreichen konnte.
22Theoretischer Teil
Somit wird man in der nächsten Nations League in die Gruppe A aufsteigen
und sich mit den besten Mannschaften Europas messen dürfen.
Ebenso hat sich das A-Nationalteam für die Fußball Europameisterschaft
2021 über die Qualifikation 2019 mit einem zweiten Platz hinter Polen
qualifiziert. Die Europameisterschaft wird heuer erstmalig in zwölf Ländern
ausgetragen. Die Austragungsländer sind England, Italien, Aserbaidschan,
Deutschland, Russland, Ungarn, Rumänien, Niederlande, Schottland,
Irland, Spanien und Norwegen. Dies stellt in der Geschichte der
Europameisterschaft ein Novum dar, da zumeist die Großveranstaltungen
in einem Land ausgetragen wurden oder in letzter Zeit in maximal zwei.
Einen kleinen Einblick darüber, wie die Hierarchie der österreichischen
Ligen gestaltet ist, zeigt Abbildung 3 am Beispiel der Steiermark.
Abbildung 3: Hierarchie der Österreichischen Ligen am Beispiel Steiermark
(Fandom, o.J., o.S.)
23Theoretischer Teil
Im nächsten Kapitel sind die wichtigsten Ergebnisse des österreichischen
Fußballs zu finden. Die Leistungsaufstellung ist wichtig, um die
Entscheidungen, wer an den Akademien aufgenommen wird, zu
verstehen.
3. Ergebnisse des österreichischen Fußballs
Im Jahr 2012 konnte das österreichische Fußballnationalteam sich für die
EM qualifizieren. Zudem waren Siege im Rahmen der Europa League zu
verzeichnen. Deshalb kann dieses Jahr als positiver Umschwung für den
österreichischen Fußball gewertet werden. Angebahnt hatten diese Erfolge
sich jedoch bereits in der Zeit für 2008 bis 2010 durch eine Verbesserung
des österreichischen Fußballs auf der FIFA-Coca-Cola-Weltrangliste.
Neben der neutralen Bewertung gewann der Sport durch die Medien den
nötigen Aufwind. Aus dem Marketing war durch Constantini (2009, zit. in
Irndorfer, 2013, S. 43.) zu hören: „Ich glaube, ich habe gezeigt, dass ich
mehr bin als ein Feuerwehrmann. Wir haben in der Weltrangliste über 30
Plätze gutgemacht – das hat eine Aussagekraft.“
Deshalb lohnt es sich, das Bewertungskriterium der FIFA-Coca-Cola-
Weltrangliste in diese Arbeit einzubeziehen. Dazu soll diese Verbesserung
der Leistungsfähigkeit exemplarisch dargelegt werden: Herangezogen
wurden die Spiele der österreichischen Mannschaft vom 17. November
2009 bis zum 16. Dezember 2010. Es wurde nur ein Spiel absolviert, indem
Österreich gegen Spanien 1:5 verlor. Dennoch stieg die Mannschaft auf
der Coca-Cola-Weltrangliste von Platz 62 mit 520 Punkten auf Platz 61 mit
523 Punkten. Dies scheint zunächst widersprüchlich zu sein. Der
wirtschaftliche Aufschwung gelang Österreich im Jahr 2011, als Österreich
eines der 53 Länder waren, die Gewinne brachten (vgl. Weinreich, 2011,
o.S.).
24Theoretischer Teil
Allerdings bleibt zu bemerken, dass die Zweit- und Drittligisten, von dieser
positiven Entwicklung ausgeschlossen waren.
Um die Erfolge des österreichischen Fußballs zu messen und damit die
Auswirkungen der Gründung der Fußballakademien zu verfolgen, sollen
im Folgenden die der FIFA-Coca-Cola-Weltrangliste und der UEFA-5-
Jahreswertung als Leistungsindizes herangezogen werden. Damit wird ein
internationaler Vergleich angestrebt. Dabei werden zwei Zusammenhänge
untersucht: die qualitativ-sportliche Auswirkung und die wirtschaftliche
Auswirkung. Die FIFA-Coca-Cola-Weltrangliste kann als wissenschaftlich
relevant angesehen werden, da der Österreichischen Fußballbund (ÖFB)
und die Österreichischen Bundesliga (BL) diese respektieren (vgl. OEFB,
o.J., o.S.).
Die Aussage des Leistungsindex beschreibt das Leistungsniveau der
Nationalmannschaft. Dabei ist irrelevant, ob die Fußballspielerinnen und
Fußballspieler im In- oder Ausland spielen.
Damit der Herleitung der Punktezahl nachvollziehbar ist, soll das Vorgehen
nun erläutert werden (vgl. Transfermarkt GmbH & Co. KG, o.J., o.S.):
- Sieg oder Unentschieden? (M)
- Wichtigkeit des Spiels (Freundschaftsspiel bis FIFA-Fußball-
Weltmeisterschaft) (I)
- Stärke der Gegnerin/des Gegners (Position auf der Rangliste) (T und
C)
Aufgrund dieser Merkmale berechnet man die Gesamtpunktezahl (P):
P = M * I * T * C * 100
M: Punkte für Sieg (3 Punkte), Unentschieden (1 Punkt) oder Niederlage
(0 Punkte). Sobald die Entscheidung auf einem Elfmeter beruht, bekommt
das Siegerinnenteam/Siegerteam 2 Punkte, das
Verliererinnenteam/Verliererteam 1 Punkt.
I: Wichtigkeit des Spiels mit unterschiedlichen Gewichtungen
25Theoretischer Teil
T: Stärke des Gegenteams, T = (200 – Ranglistenposition des
Gegners)/100
Das Team, das auf Rang 1 liegt, werden 2,00 Punkte ergeben, ab Position
150 sind lediglich 0,50 vergeben.
C: Der Faktor der Stärke, der durch die Zahl der Siege in den letzten drei
Weltmeisterschaften ermittelt wird.
Zuletzt wird der Durchschnitt der Punkte sämtlicher Spiele eines Jahres
berechnet. Voraussetzung für die Ermittlung ist eine Mindestzahl von fünf
Spielen. Wenn diese Voraussetzung nicht erfüllt wurde, muss die
Gesamtpunktezahl durch fünf dividiert werden. Insgesamt werden vier
Jahre betrachtet. Diese vier Jahre werden unterschiedlich schwer
gewichtet. Das letzte Jahr fällt mit 100 % ins Gewicht, das vorletzte Jahr
mit 50% und die davor liegenden drei Jahre mit 30 % sowie die davor
liegenden vier Jahre mit 20 %. Entscheidend für die Position auf der
Rangliste ist die Position der anderen Nationen. Daher ergibt sich ein
Unterschied der Chancen, zusätzliche Punkte zu bekommen. Dadurch
haben schlechter bewertete Nationen eine erhöhte Chance, sich zu
verbessern. So verlieren Nationen auf einer guten Position bei einer
Niederlage eine geringe Punktzahl, jedoch sinkt der Abstand zu anderen
Nationen übermäßig. Die unteren Ränge separieren sich lediglich durch
geringe Punktabstände, weshalb eine hohe Schwankungsbreite in diesem
Bereich vorliegt. Damit sind punktuelle Verbesserungen sehr schnell zu
erzielen. Zwar unterliegen auch die ersten Ränge einer hohen
Schwankung, jedoch sind diese nicht so stark ausgeprägt. Ab einem Platz
von 30 oder mehr ist unbedingt eine Teilnahme an allen welt- und
Europameisterschaften nötig, um auf die vorderen Ränge zu gelangen (vgl.
Transfermarkt GmbH & Co. KG, o.J., o.S.).
Da Profikarrieren fast immer schon in den Kinderschuhen beginnen, muss,
um diese Arbeit abzurunden, auch erläutert werden, welchen Stellenwert
Kinderfußball in Österreich hat. Damit beschäftigt sich das nächste Kapitel.
26Theoretischer Teil
4. Kinderfußball
Um Kinder für den Sport zu begeistern, soll im Kinderfußball vor allem
Spaß und Freude am Spiel vermittelt werden. Dies soll den Rahmen bilden,
um Technik- und Koordination zu schulen und für zahlreiche Ballkontakte
sorgen. Zentrales Element ist zudem die Beidbeinigkeit und ihr Einsatz auf
allen Positionen (vgl. OEFB, o.J., o.S.).
Als detailliertes Ziel wurde 2009 festgelegt, dass die Kinder im Alter von
sechs bis zwölf Jahren spielerisch an das Spiel mit dem Fußball
herangeführt werden. Auf dem Kleinfeld werden die Kinder auf Spiele auf
dem Großfeld vorbereitet. Die grundsätzliche Motivation der Kinder soll
stets die Freude am Fußballspielen sein. Deshalb sollte der Spieldrang
auch nicht unterbrochen werden, sondern explizit gefördert werden. Um
die individuelle Zukunft nicht zu früh festzulegen, sollen möglichst viele
technisch-taktische Übungen erlernt werden und auch die spätere Position
in der Mannschaft der Kinder wird erst an dem Nachwuchsfußball
festgelegt.
Im Bereich der Talentförderung kommen gesonderte Einrichtungen zum
Tragen.
„Die Talentförderungseinrichtungen (LAZ, AKA) des ÖFB werden als
elitäre Ausbildungsstätten für zukünftige Profispieler definiert“ (OEFB, o.J.,
S. 53). Diese Landesverbandsausbildungszentren (LAZ) fanden ab der
Saison 2000/2001 Einsatz in der Talentförderung. Die Ausbildungszentren
arbeiten eng mit den Stammvereinen zusammen und fördern 12-14jährige
exzellente Fußballspielerinnen und Fußballspieler. Außerdem wurde vom
ÖFB noch eine LAZ Vorstufe für die 10-12jährigen Kinder eingeführt (vgl.
ebd.).
27Theoretischer Teil
Im Detail bedeutet die duale Ausbildung der Spielerinnen und Spieler durch
das LAZ, dass sie innerhalb der Woche dort trainieren, die Meisterschaft
allerdings bei ihren Vereinen austragen. Weiterhin ist vorgesehen, dass die
Arbeit im Verein sich auf ein Individual- bzw. Gruppentraining konzentriert
(vgl. ebd., S. 23).
Auch im Bereich der LAZ sieht Österreich eine Regelung vor, so dürfen
lediglich 5 LAZ in einem Bundesland vorhanden sein. Somit bestanden im
Jahr 2020 insgesamt 28 LAZs, die eine Lizenz besitzen. Abbildung 4 zeigt
die Standorte der LAZs in Österreich:
Abbildung 4: Die Standorte der Leistungsausbildungszentren (LAZ)
(OEFB, o.J., o.S.)
Die letzten vier Kapitel des Theorieteils sind essentiell für die Fragestellung
dieser Arbeit. Zuerst wird der Autor näher auf den dualen Ausbildungsweg
eingehen. Anschließend wird er kurz die wichtigsten Erkenntnisse zu den
Fußballakademien zusammenfassen und deren gesetzliche Grundlage
28Theoretischer Teil
analysieren. Im letzten Kapitel wird er die Vor- und Nachteile des dualen
Systems näher beleuchten.
5. Duale Ausbildung in der Bildungswissenschaft
Anfang des 19. Jahrhunderts legte das „preußische Bildungssystem“
seinen Schwerpunkt auf höhere Schulen. Es schien also so, als würde die
Bildung der Beamtinnen und Beamten wichtiger sein als die
Allgemeinbildung des Bürgertums.
Erst 1919 wurden sich Entscheiderinnen und Entscheider darüber einig,
die ersten vier Jahre der schulischen Laufbahn der kollektiven
Allgemeinbildung aller Schülerinnen und Schüler gleichermaßen zu
widmen (vgl. Van Ackeren & Block, 2009, S. 209).
1920 legte die „Reichsschulkonferenz“ die Grundsteine für das
österreichische Schulsystem. Hierbei wurde unter anderem auch das
„Organisationsprinzip der Vertikalität“ beschlossen, welches bedeutet,
dass alle Schülerinnen und Schüler unterschiedliche Schultypen besuchen
dürfen. Natürlich musste hierbei bei den Abschlüssen, Berechtigungen, …
differenziert werden. Zusätzlich bildete sich in eine Angleichung von
berufsbildenden und allgemeinbildenden Schulen heraus, das „duale
System“ war somit geboren (vgl. Blankertz, 1982, S. 234ff.).
Nach dem zweiten Weltkrieg war eine „Bildungsexpansion“ zu
verzeichnen. In dieser Zeit waren Bürgerinnen und Bürger aus der
Mittelschicht besonders darum bemüht, ihren Kindern eine „bessere
Schulbildung“ zu ermöglichen. Hieraus rührt die Verlängerung der
Schulpflicht von vier auf neun Jahre (vgl. ebd.).
1964 ist das duale System mit einem „System der gleichzeitigen
Ausbildung in Betrieb und Berufsschule“ gleichzusetzen bzw. stellt es in
29Theoretischer Teil
seinem Prinzip „Schule und Betrieb als gleichberechtigte Partner“ dar.
Duales Ausbildungssystem heißt also, dass die gesetzten Pflichten
gleichermaßen zwischen den Bereichen Schule und Profession aufgeteilt
sind.
Eine Schülerin/Ein Schüler des dualen Systems muss also neben
ihrer/seiner praktischen Tätigkeit eine Schule besuchen (vgl. Schermaier,
1981, S. 131ff.).
6. Die Fußballakademien (AKA)
„Fußballakademien (AKA) sind jene Kaderschmieden der
Bundesligavereine bzw. der Landesverbände für Nachwuchstalente, die im
Anschluss an die erste Ausbildungsschiene
(Landesverbandsausbildungszentren – LAZ) stehen“ (OEFB, o.J., S. 76).
Erst seit der Jahrhundertwende ist der Begriff „Akademie“ bekannt und
geläufig. Diese Begrifflichkeit wurde durch die Einhaltung strengerer
Kriterien erzielt seitens der Bundesnachwuchszentren. Erstmals wurden
diese Kriterien im Jahr 2001 erfüllt. Damals bekamen drei
Fußballakademien den Titel Akademie verliehen. Die entsprechende
Lizenz wurde vom ÖFB verliehen. Sie wird ohne Befristung vergeben,
solange die Einrichtung die entsprechenden Kriterien erfüllt.
Die Saison 2012/13 brachte dann zwölf Vereine hervor, die den Status
„Akademie“ erhielten. Damit konnten sie an der Toto Jugendliga
teilnehmen. Insgesamt wurden in diesem Dutzend Akademien 751
Spielerinnen und Spieler ausgebildet. Die Aufteilung zeigte die
Unterbringung von 734 Spielerinnen und Spieler in 42 Kooperationen von
Schulen sowie 17 Spielerinnen und Spieler, die sich in einer Lehre
befanden. Weiterhin wohnten 304 der Spielerinnen und Spieler in einem
Internat, während 140 Spielerinnen und Spieler bei ihren Eltern lebten (vgl.
OEFB, o.J., o.S.).
30Theoretischer Teil
In der Saison 2020/21 sind es schon insgesamt 863 Spielerinnen und
Spieler, die in den jeweiligen U15, U16 und U18 Akademien von Österreich
ausgebildet werden (vgl. ebd.).
Die Vereine der Österreichischen Bundesliga führen sieben Akademien,
genauso wie die Landesverbände drei Akademien führen. Die Akademie
Steiermark Sturm Graz bildet hierbei eine Ausnahme, da sie von
Trägerverein Sturm Graz, aber auch gemeinsam gleichberechtigt von dem
Landesverband Steiermark geführt wird. In der Saison 2020/21 gehörten
zu diesen Vereinen und Landesverbänden:
AKA FK Austria Wien
FK Austria Wien
AKA Admira Wacker
FC Trenkwalder Admira
AKA SK Rapid
SK Rapid Wien
AKA Steiermark-Sturm Graz
SK Puntigamer Sturm Graz
AKA Red Bull Salzburg
Red Bull Salzburg
AKA SV Ried
SV Josko Fenster Ried
AKA LASK Juniors OÖ
LASK Linz
AKA RZ Pellets Wac
RZ Pellets Wac
AKA Burgenland
Burgenländischer Fußball-Verband
AKA Tirol
Tiroler Fußball-Verband
31Theoretischer Teil
AKA St. Pölten NÖ
Niederösterreichischer Fußball-Verband
AKA Vorarlberg
Vorarlberger Fußball-Verband (vgl. OEFB, o.J., o.S.).
Abbildung 5 zeigt, wo die österreichischen Akademien angesiedelt sind:
Abbildung 5: Die österreichischen Akademien (Direktion Sport, 2016, S.
36)
Die Existenz der Fußballzentren seit dem Jahr 1999 ist durch die Regelung
einer Akademie pro Bundesland geregelt. Eine Ausnahme dazu bilden
dabei jedoch die vier „flächen- bzw. einwohnermäßig größte(n)“
Bundesländer. In den Bundesländern Steiermark und Wien sowie Nieder-
und Oberösterreich ist die Verwaltung von zwei Akademien gleichzeitig
erlaubt. Herausgebildet hat sich diese Regelung aus dem Grund, dass den
32Theoretischer Teil
Spielerinnen und Spielern ein kurzer Weg zur Akademie zustehen soll (vgl.
OEFB, 2020, S. 6).
Die Voraussetzungen für eine Bewerbung eines Vereins für den Status der
Akademie haben unter Umständen ein Landesverband oder ein Verein in
der Bundesliga, um eine gewisse Leistung zu gewährleisten. Zudem sind
die vom ÖFB weitere Voraussetzungen als sogenanntes Regulativ für
Fußballakademien zu erfüllen. Neben der Erfüllung der bereits erwähnten
wirtschaftlichen, strukturellen, organisatorischen und personellen Kriterien
muss ein sportliches Nachwuchskonzept erstellt werden. Durch diese
hochgesteckten Kriterien ist die Ausbildung an den Fußballakademien die
Beste in Österreich (vgl. OEFB, 2020, S. 6).
Im Anschluss an die Gründung der Fußballakademien als Institution
betonte der Fußball in Österreich in den nachfolgenden Jahren die
besondere Stellung der Akademien als Grundlage für die Zukunft. Dies
legte der Fußball im Jahr 2005 in einem Projektbericht „Fußball in
Österreich“ nieder. In diesem Jahr arbeiteten acht Fußballakademien mit
fünf Bundesnachwuchsausbildungszentren zusammen.
Weitere Kennzeichen der Ausbildung sind durch eine intensive Betreuung
geprägt, welche wissenschaftliche Hinweise mit einbeziehen. Die
Umstrukturierung der Schulen sorgte zusätzlich für eine öffentliche
Anerkennung des Berufes im Fußball. Somit bekamen alle Absolventinnen
und Absolventen der Fußballakademien ein zusätzliches berufliches
Standbein. So gingen die Spielerinnen und Spieler mit vielseitigen
Perspektiven für die Karriere in die Zukunft (vgl. Felderer et al., 2005, S.
82f.).
Im Jahr 2016 konnte festgestellt werden, dass die Fußballakademien die
Ziele des österreichischen Fußballs durchaus erfüllt haben, denn die
Mehrheit der Absolventinnen und Absolventen konnte sich in einer
Fußballliga etablieren. Insgesamt konnte von einer optimierten Qualität
33Theoretischer Teil
des österreichischen Fußballs gesprochen werden. Problematiken
entstanden durch die Reisewilligkeit einiger Spielerinnen und Spieler,
welche die Region um ihren Verein verlassen wollten.
Gerade junge Spielerinnen und Spieler strebten eine Karriere im Ausland
an und verließen die heimischen Akademien frühzeitig. Dabei wird die
Infrastruktur durch Wettbewerbe mit anderen Akademien ständig
verbessert (vgl. Fenz, 2016, o.S.). Auch der ökonomische Hintergrund
macht die Akademien attraktiv, denn die Schülerinnen und Schüler zahlen
kein Schulgeld. Die Finanzierung erfolgt durch Sponsorinnen und
Sponsoren sowie Verkäufe der Absolventinnen und Absolventen an
Vereine, so dass ein zusätzlicher Leistungsanreiz gegeben ist.
Unverkennbar bleibt deshalb die enge Bindung zwischen der qualitativen
Steigerung der Akademien und der finanziellen Grundlage (vgl. Felderer et
al., 2005, S. 84).
Um den Verbesserungsprozess zu unterstützen, wurden Studien rund um
österreichischen Fußball durchgeführt und ausgewertet. So entstand im
Jahr 2014 eine Studie, die Themen wie das Berufsbild, die Ausbildung und
die Verdienstchancen in den oberen österreichischen Ligen untersuchte.
Es ergab sich, dass ohne Schulbildung lediglich 23,85 % der Spielerinnen
und Spieler in diese Ligen gelangt waren. Die Mehrheit mit 66,2 % hatte
bereits die Reifeprüfung erfolgreich absolviert oder haben eine Lehre
beendet. Akademikerinnen und Akademiker mit einem abgeschlossenen
Studium machten 3,25 % der Spielerinnen und Spieler aus und 9,72 %
durchlaufen parallel zur Ausbildung eine Ausbildung in der Wirtschaft. Die
Befragten teilten sich in Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer
Fußballakademie (52,32 %) und Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus
einem Bundesnachwuchsleistungszentrum (23,47 %) auf. Die Kenntnisse
aus einem Verein erlangten 24,21 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
(vgl. Vereinigung der Fußballer, o.J., o.S.).
34Sie können auch lesen