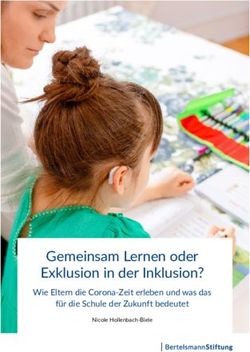Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg - Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken - Rechte und Pflichten ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Erfahrungsaustausch Betrieb
von Hochwasserrückhaltebecken
in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung - Berichtsband
Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken –
Rechte und Pflichten
Bürgerhaus Neuer Markt Bühl, 30. November 2016Erfahrungsaustausch Betrieb
von Hochwasserrückhaltebecken
in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung - Berichtsband
Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken –
Rechte und Pflichten
Bürgerhaus Neuer Markt Bühl, 30. November 2016Impressum Berichtsband zur 23. Jahrestagung 20. Jahrgang, November 2017 ISSN 1438-3586 Herausgeber: WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH Karlstraße 91 76137 Karlsruhe Telefon **49 (0) 721 824 489 20 Telefax **49 (0) 721 824 489 29 info@wbw-fortbildung.de www.wbw-fortbildung.de Redaktion: Stefan Albinger / Thorsten Kowalke WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH Gestaltung und Druck: Bechtel Druck GmbH & Co. KG, Ebersbach/Fils Umschlagbild: WBW Fortbildungsgesellschaft für Gewässerentwicklung mbH & Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg (LUBW) Papier: Diese Broschüre ist auf 100% Altpapier gedruckt. Das verwendete Papier ist mit dem Blauen Engel zertifiziert. Nachdruck – auch auszugsweise – nur unter Quellenangabe und Überlassung von Belegexemplaren gestattet. Karlsruhe, im November 2017
Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 3
Inhaltsverzeichnis
Programmübersicht |4
Bericht über die Starkregenereignisse im Mai/Juni 2016 und daraus |6
resultierende Folgen von noch nicht realisierten HRB im Einzugsgebiet des
AHW auf unterliegende HRB
Josef Zöllner
Verantwortlichkeiten beim Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken | 10
Ralf Zimmermann
Organisation des Arbeitsschutzes als Führungsaufgabe | 26
Stefan Tampe
Praktischer Arbeitsschutz – Der Weg zur Gefährdungsbeurteilung | 30
Dietmar Klopfer
Vielfachnutzungen und Aufgaben am Speicher- und | 38
Hochwasserrückhaltebecken Buch
Josef Gentner
Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken – | 52
Verantwortung der Betreiber und Zuständigkeiten der Wasserbehörden
Armin Stelzer
Erdbebensicherheit von Hochwasserrückhaltebecken und Talsperren – | 54
Kompendium für Betreiber und Wasserbehörden
Bernd Karolus
Verzeichnis der Veröffentlichungen | 56
3Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 4–-5
Programm
Moderation: Georg Ruf
Wasserverband Kocher-Lein
09.30 Uhr Eröffnung und Begrüßung
Hubert, Schnurr, Oberbürgermeister der Stadt Bühl, Verbandsvorsitzender Zweckverband Hoch-
wasserschutz Raum Baden-Baden/Bühl
Armin Stelzer, Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
Prof. Dr.-Ing. Franz Nestmann, Präsident des Wasserwirtschaftsverbands Baden-Württemberg e.V.
Einführungsvortrag
10.00 Uhr Bericht über die Starkregenereignisse im Mai 2016 und daraus resultierende Folgen von noch
nicht realisierten HRB im Einzugsgebiet des AHW auf unterliegende HRB
Josef Zöllner, Abwasser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch (AHW)
Verantwortung der Betreiber
10.30 Uhr Verantwortlichkeiten beim Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken
Ralf Zimmermann, Bürgermeister der Stadt Großbottwar,
Verbandsvorsitzender Zweckverband Hochwasserschutz Bottwartal
11.00 Uhr Diskussion
11.15 Uhr Pause
11.45 Uhr Organisation des Arbeitsschutzes als Führungsaufgabe
Stefan Tampe, Unfallkasse Baden-Württemberg
12.15 Uhr Praktischer Arbeitsschutz – Der Weg zur Gefährdungsbeurteilung
Dietmar Klopfer, Regierungspräsidium Tübingen
12.45 Uhr Diskussion
13.00 Uhr Mittagspause
14.10 Uhr Vielfachnutzungen und Aufgaben am Speicher- und Hochwasserrückhaltebecken Buch
Josef Gentner, Wasserverband Obere Jagst
14.30 Uhr Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken – Verantwortung der Betreiber und Zuständigkeiten
der Wasserbehörden“
Armin Stelzer, Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg
4Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 4–5
14.45 Uhr Erdbebensicherheit von Hochwasserrückhaltebecken und Talsperren – Kompendium für
Betreiber und Wasserbehörden
Bernd Karolus, Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-Württemberg
Workshops zu aktuellen Themen
15.00 Uhr Parallele Workshops
Organisation des Betriebs von Stauanlagen
Andrea Bär, RP Tübingen
Carsten Scholz, LRA Ludwigsburg
Zuständigkeiten und Kooperation der Akteure
Bernd Karolus, LUBW
Dieter Schuster, UM
HRB und HWGK: Abbildung der Wirkung von HRB und Herauslesen der Informationen
Christoph Sommer, RP Stuttgart
Rebecca Stadelmann, RP Stuttgart
Hochwasseralarm- und Einsatzplanung / FLIWAS 3.0
Markus Moser, RP Stuttgar
Dr. Sandra Röck, WBWF
Michael Sartorius, KIVBF
Fernwirktechnik bei HRB – Möglichkeiten und Grenzen
Jörg Ebhart, GBI Gackstatter Beratende Ingenieure GmbH
Melchior Rettenmeier, RP Stuttgart
Arbeitsschutz / Gefährdungsbeurteilung
Uta Felsen, RP Stuttgart
Dietmar Klopfer, RP Tübingen
Stefan Tampe, UKBW
16.00 Uhr Vorstellung der Workshop-Ergebnisse und Diskussion
ca. 17.00 Uhr Ende der Veranstaltung
5Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 6–9
Bericht über die Starkregenereignisse im Mai/Juni 2016 und
daraus resultierende Folgen von noch nicht realisierten HRB
im Einzugsgebiet des AHW auf unterliegende HRB
Josef Zöllner
Wassergeschichte des „Abwasserverbandes Leim-
bach-Angelbach“ in Wiesloch, der 2004 in den „Ab-
wasser- und Hochwasserschutzverband Wiesloch
(AHW)“ umbenannt wird.
1961 wurde der Abwasserverband Leimbach-Angelbach
gegründet, dem sich bis 1964 die meisten Gemeinden
der drei Bachtäler Leimbach, Waldangelbach und Gau-
angelbach angeschlossen hatten. Geführt wird er wie
eine Firma. Die Verbandsversammlung und der Betrieb-
sausschuss beschließen und entscheiden, als Verbands-
vorsitzender fungiert der Oberbürgermeister der Stadt
Wiesloch und ums operative Geschäft kümmert sich die
AHW-Geschäftsleitung.
Heute hat die Kläranlage 110.000 Einwohnergleichwerte
(EWG). Ca. 45 km Zubringerkanäle leiten das Abwasser aus
den angeschlossenen Gemeinden zur Verbandskläranlage
in Wiesloch. Der AHW beschäftigt derzeit 27 Mitarbeiter.
Hochwasserschutz seit 2004
Schwere Unwetterkatastrophen, die das AHW-Ver-
bandsgebiet 1969, 1993, 1994 und 2003 heimsuchten,
sensibilisierten die Region. Seit 2004 übernahm der Ab-
wasserverband Leimbach-Angelbach, zusätzlich zur
Abwasserbehandlung, die Aufgaben des Hochwasser-
schutzes und wurde in AHW (Abwasser- und Hochwas-
serschutzverband Wiesloch) umbenannt. Ihm gehören
fünf Gemeinden an: Stadt Wiesloch, Gemeinde Dielheim,
Ortsteile der Stadt Leimen: Gauangelloch und Ochsen-
bach, Stadt Rauenberg, Gemeinde Mühlhausen.
Eine Flussgebietsuntersuchung der Universität Karlsruhe Abb. 1: Maßnahmenübersicht AHW Wiesloch
wurde 2004 in Auftrag gegeben, um das Einzugsgebiet
des AHW zu prüfen und um ein Hochwasserschutzpro-
gramm aufstellen zu können. Es wurde aufgrund der Von diesen zehn HRB sind bis heute sechs realisiert wor-
Berechnungen festgelegt, wo und in welcher Größe den. Bis zum Jahr 2021 sollen alle zehn in Betrieb sein und
Hochwasserrückhalte- und Regenüberlaufbecken ge- einen flächendeckenden Hochwasserschutz vor einem
baut werden müssen, um das Verbandsgebiet vor einem 100-jährlich wiederkehrenden Ereignis mit Klimafaktor
100-jährigen Ereignis inkl. Klimafaktor zu schützen. gewährleisten (siehe Abb. 1). Abhängig ist die endgültige
Fertigstellung des Gesamtausbaus von Genehmigungen,
Die Untersuchung ergab, dass für das Verbandsgebiet mit Wasserrechten, Grundstücksverhandlungen und Beihilfe-
den genannten fünf Gemeinden insgesamt zehn Hochwas- zusagen.
serrückhaltebecken (HRB) sowie sieben Bachausbauten not-
wendig sind. Das Gesamtvolumen beträgt über 1 Mio. Ku- Die sechs HRB waren seit deren Inbetriebnahmen schon
bikmeter in einem Gesamteinzugsgebiet von rund 110 km². mehrfach in die Regelbetriebe gegangen. Die Regener-
6Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 6–9
eignisse sind immer abgeklungen, sodass die Becken-
strukturen die bisherigen Regenwassermengen immer
verkraften konnten.
Starkregenereignisse Ende Mai bis Anfang Juni 2016
Starkregenereignisse im Frühjahr dieses Jahres haben
das Einzugsgebiet des AHW teilweise massiv getroffen.
Ein Gebiet wurde besonders hart getroffen, nämlich mit
Starkregen über mehrere Tage. Niederschläge von bis zu
80 Litern pro m² waren hier zu messen. Langanhaltende
und immer wiederkehrende Wassermengen traten in den
Bachtälern des Waldangelbaches und des Gauangelba-
ches auf. Das Bachtal des Leimbachs, unmittelbar angren-
zend, blieb verschont. Dort gab es kaum Niederschlag. Abb. 3: HRB Hohenhardter Hof, Erreichen der
Leistungsgrenze
Abb. 2: Gewässerausbau Leimbach, Schwetzinger
Straße, Wiesloch Abb. 4: HRB Hohenhardter Hof, technischer Überlauf
Massive regionale Regenzellen haben tagelang auf die
gleichen Gebiete eingewirkt. Gemäß Ausbauplan sind
für dieses, Ende Mai von Starkregen betroffene Einzugs-
gebiet, fünf HRB notwendig, um einem 100-jährlichen
Hochwasser plus Klimafaktor zu trotzen. Allerdings feh-
len dem Verband oberhalb noch zwei Becken mit einem
Gesamtvolumen von rund 100.000 m³ Fassungsvolumen,
die bisher noch nicht realisiert sind. Das heißt über den
langen Regenzeitraum wurde eines der bestehenden
HRB so massiv mit einem zusätzlichen Einzugsgebiet von
11,5 km² beaufschlagt, sodass es seine Leistungsgrenze
erreicht hatte und der technische Überlauf angesprungen
ist.
Damit wurde unterhalb eine so große Wassermenge in die
Ortschaft geleitet, dass eine Überflutung gemäß Hoch- Abb. 5 HRB Hohenhardter Hof nach dem Stark-
wassergefahrenkarte leider nicht mehr zu verhindern war. regenereignis
Der Katastrophenalarm wurde durch die Feuerwehr und
die Stadtverwaltung ausgelöst. Sofortmaßnahmen wur-
den zum Schutz des Ortes eingeleitet und viele Keller so-
fort ausgepumpt. Ein Großteil des Ortes war vom Hoch-
wasser mit entsprechendem Sachschaden betroffen.
7Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 6–9
Abb. 6 Gauangelbach vor dem Überlauf in den Ort Abb. 9 Räumgutentsorgung
Baiertal
Durch Nachlassen des Regens wurde auch der weitere
Überlauf des Beckens gestoppt. Es konnte somit der Re-
gelbetrieb wiederhergestellt und die Situation im betrof-
fenen Ort wieder relativ schnell beruhigt werden.
Abb. 10 Räumgutentsorgung
Die Aufräumarbeiten, Reinigung von Straßen, Auspum-
pen von Kellern und Abräumen des Treibgutes durch
Verklausungen von Brücken waren natürlich notwendig
Abb. 7 Räumung des Vorrechens am HRB Hohen- geworden und beanspruchten tagelang die Einsatzkräfte.
hardter Hof
Die Regenereignisse Ende Mai, Anfang Juni 2016 zeigten
im AHW-Verbandsgebiet die Notwendigkeit des Hoch-
wasserschutzprogramms mit insgesamt zehn geplanten
Becken und sieben Bachausbauten. Nicht nur hier bei
uns, auch in vielen anderen Gebieten, auch weit über
die deutschen Grenzen hinaus wurde die Dringlichkeit
des Ausbaus deutlich. Die Personen- und Sachschäden
waren teils immens hoch, immer verbunden mit großem
menschlichem Leid.
Bis zum Jahre 2021 sollen alle zehn Hochwasserrückhal-
tebecken und sieben Bachausbauten in Betrieb sein und
einen flächendeckenden Hochwasserschutz vor einem
100-jährlich wiederkehrenden Ereignis plus Klimafaktor
gewährleisten. Erst dann können wir Mensch, Tier und
Abb. 8 Räumgut des Vorrechens HRB Hohenhardter Umwelt ausreichend schützen.
Hof
8Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
22. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 6–9
Verfasser
Josef Zöllner
Abwasser- und Hochwasserschutzverband
Wiesloch (AHW)
Bruchwiesen 1
69168 Wiesloch
www.ahw-wiesloch.de
j.zoellner@ahw-wiesloch.de
9Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 10–25
Verantwortlichkeiten beim Betrieb von Hochwasserrück-
haltebecken
Ralf Zimmermann
10Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 10–25
11Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 10–25
12Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 10–25
13Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 10–25
14Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 10–25
15Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 10–25
16Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 10–25
17Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 10–25
18Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 10–25
19Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 10–25
20Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 10–25
21Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 10–25
22Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 10–25
23Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 10–25
24Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 10–25
Verfasser
Ralf Zimmermann
Bürgermeister der Stadt Großbottwar
Marktplatz 1
71723 Großbottwar
r.zimmermann@grossbottwar.de
25Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 26–29
Organisation des Arbeitsschutzes als Führungsaufgabe
Stefan Tampe
1. Rechtsgrundlagen Aufgeführt werden als Aufgabe für den Unternehmer in
DGUV Vorschrift 1 unter anderem folgende Pflichten:
Zur Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit gibt es eine
Fülle von Vorschriften mit Vorgaben zur Gestaltung von • Organisation des Arbeitsschutzes
Arbeitsplätzen, zu Arbeitsverfahren oder zum Bedienen • Erstellung der Gefährdungsbeurteilung
von Maschinen und Geräten. Dabei ist als erstes das • Unterweisung der Versicherten
Arbeitsschutzgesetz mit seinen nachgeordneten Ver- • Vergabe von Aufträgen unter sicherheitsgerechter
ordnungen wie der Betriebssicherheitsverordnung (Betr- Auftragsgestaltung
SichV), der Biostoffverordnung (BioStoffV) oder der Ar- • Befähigung für Tätigkeiten der Mitarbeiter sicherstel-
beitsstättenverordnung (ArbStättV) zu nennen. Aus dem len
autonomen Recht der Unfallversicherungsträger (UVT) • Auswahl geeigneter Mitarbeiter
kommen die Unfallverhütungsvorschriften (UVV) hinzu, • Besonderen Schutz bei gefährlichen Arbeiten be-
konkretisiert in den Regeln zu Sicherheit und Gesundheit rücksichtigen
bei der Arbeit. In einer Pyramide lässt sich die Systematik • Zugang zu Vorschriften und Regeln gewährleisten
der Normen im Arbeitsschutz gut darstellen: • Bestellung von Fachkraft für Arbeitssicherheit (Sifa)
und Betriebsarzt (BA)
• Bestellung von Sicherheitsbeauftragten
• Notfallmaßnahmen und Erste Hilfe organisieren
• Bereitstellung von Persönlicher Schutzausrüstung
Aus dem ArbSchG, der BetrSichV, der BioStoffV oder der
ArbStättV ließen sich hier ebenfalls etliche weitere Vorga-
ben zitieren.
Wer ist nun der Normadressat der oben aufgeführten
Vorschriften beim Betrieb von Hochwasserrückhaltebe-
cken der oben aufgeführten Vorschriften? In erster Linie
ist dies der Betreiber. Dies kann der Bürgermeister beim
Betrieb von kommunalen Becken sein, der Verbandsvor-
sitzende eines Zweckverbandes oder der Landrat mit sei-
Abb. 1: Gesetzespyramide nem Referatsleiter beim Betrieb von landeseigenen Be-
cken. Wirft man nochmals einen Blick auf die Aufgaben,
wird schnell klar, dass diese nicht allein von den Adres-
saten, der Amtsspitze, geleistet werden können. Daher
Alle Gesetze und Vorschriften haben eines gemeinsam: kommt eine weitere Forderung aus dem ArbSchG ins
Sie richten sich in erster Linie an den Arbeitgeber und den Spiel: Der Arbeitgeber hat für eine geeignete Organisa-
Unternehmer. Nach der UVV „Grundsätze der Prävention“ tion zu sorgen, die erforderlichen Mittel bereit zu stellen,
(DGUV Vorschrift 1) hat der Unternehmer die erforderlichen sowie Vorkehrungen zu treffen, dass die Maßnahmen des
Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufs- Arbeitsschutzes bei allen Tätigkeiten beachtet und in die
krankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren betrieblichen Führungsstrukturen eingebunden werden.
sowie für eine wirksame Erste Hilfe zu treffen. Das Arb-
SchG gibt dem Arbeitgeber vor, die Arbeit so zu gestalten, Die Antwort, wie dies zu lösen ist, liefert § 13 DGUV Vor-
dass eine Gefährdung für das Leben sowie die physische schrift 1 gleich mit: „Der Unternehmer kann zuverlässige
und die psychische Gesundheit möglichst vermieden und und fachkundige Personen schriftlich damit beauftragen,
die verbleibende Gefährdung möglichst gering gehalten ihm nach Unfallverhütungsvorschriften obliegende Auf-
wird. Dabei hat er eine Verbesserung von Sicherheit und gaben in eigener Verantwortung wahrzunehmen“, der
Gesundheitsschutz der Beschäftigten anzustreben. Begriff hierzu ist die Pflichtenübertragung.
26Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 26–29
2. Pflichtenübertragung • Übergeordnete Regelungen für Brand- und Notfälle
• Steuerung der arbeitsmedizinischen Vorsorge
„Die Pflichtenübertragung ist ein Instrument des Unter- • Sammlung, Aktualisierung und Bereitstellung von
nehmers zur Organisation des betrieblichen Arbeits- Vorschriften und Regeln
schutzes. Durch sie werden Aufgaben, Pflichten und
Verantwortlichkeiten des Arbeitsschutzes auf Personen Je nach zu übertragener Verantwortung und Aufgaben
übertragen. Mit der Pflichtenübertragung kann der Unter- müssen demnach die entsprechenden Personen ausge-
nehmer einen wesentlichen Teil seiner ihm obliegenden wählt werden. Vor der Pflichtenübertragung hat der Un-
Organisationspflichten erfüllen“, heißt es in den Erläute- ternehmer jedoch zu prüfen, ob die Person, die er damit
rungen zur Pflichtenübertragung in der Regel zur Sicher- beauftragen möchte, zuverlässig und in dem zu übertra-
heit und Gesundheit „Grundsätze der Prävention“ (DGUV genden Bereich über das einschlägige Fachwissen und
Regel 100-001). die praktische Erfahrung verfügt. Wie sollte sie auch
Die Übertragung der Unternehmerpflicht ist an bestimm- sonst ihren Aufgaben verantwortungsbewusst nachge-
te Voraussetzungen gekoppelt und bedarf zweier grund- hen können? Möglicherweise muss die vorgesehene Per-
sätzlicher Überlegungen: son daher vor der Beauftragung entsprechend qualifiziert
werden.
1. Was sind die konkreten Aufgaben und Pflichten?
2. Welche Personen können mit diesen Aufgaben be- Als Beispiel für mögliche Adressaten der Pflichtenüber-
traut werden? tragung beim Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken
dient folgendes Schaubild:
Aufgabenfelder
Bei der Übertragung der Pflichten lassen sich zwei Auf-
gabenfelder unterscheiden: Zum einen die Aufgaben, die
sich an alle Führungskräfte richten, zum anderen speziel-
le Pflichten für einen bestimmten Personenkreis.
Zu den allgemeinen Pflichten für jede Führungskraft im
eigenen Zuständigkeitsbereich zählen z. B. die Auswahl
von geeigneten Mitarbeitern für die jeweiligen Tätigkei-
ten, die Unterweisung der Mitarbeiter, die Erstellung der
Gefährdungsbeurteilung, die Auswahl und Bereitstellung
geeigneter Arbeitsmittel, die Einbindung von Sifa und BA
in das Arbeitsfeld, die Organisation einer funktionieren-
den Rettungskette und die Bereitstellung geeigneter per-
sönlicher Schutzausrüstung. Abb. 2: Organigramm Pflichtenübertragung
Spezielle Pflichten richten sich an Personen, die für be-
sondere, meist mehrere Organisationseinheiten übergrei-
fende Aufgaben im Arbeitsschutz verantwortlich sind. Legt man oben aufgeführte Themenfelder zugrunde, kön-
Denn einige Abläufe lassen sich zentral effizienter steu- nen auf unterschiedliche Personengruppen entsprechend
ern, besonders dann, wenn Spezialwissen oder eine enge ihres Einsatz- und Zuständigkeitsbereichs verschiedene
Koordinierung erforderlich ist. Dies ist beispielsweise bei Aufgaben übertragen werden.
folgenden Aufgaben der Fall:
Zuständigkeiten und Befugnisse
• Bestellung und Koordination der Leistungen von Sifa
und BA Damit keine Unklarheiten und Missverständnisse bei der
• Teilnahme an Sitzungen des Arbeitsausschusses Übertragung der Aufgaben entstehen, müssen die Zu-
(ASA) ständigkeiten und Befugnisse eindeutig festgelegt wer-
• Organisation der Prüfungen von Anlagen und Ar- den.
beitsmitteln
• Bestellung von Sicherheitsbeauftragten Der Klarheit dienen dabei alle Festlegungen über inhalt-
• Benennung von Ersthelfern liche, räumliche und zeitliche Zuständigkeiten, die in der
• Steuerung der Qualifizierung und Fortbildung der Mit- DGUV Vorschrift 1 mit dem Begriff „Verantwortungsbe-
arbeiter reich“ gemeint sind. Damit es keine Diskrepanz zwischen
• Erfassung der Gefahrstoffe in einem Verzeichnis Aufgaben und Befugnissen gibt, müssen auch die Wei-
27Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2015 – Berichtsband, S. 26–29
sungsrechte, Beschaffungs- und Organisationsbefugnis- nem Verantwortungsbereich klar und eindeutig geregelt
se sowie der Zugriff auf finanzielle Mittel für die beauf- hat. Hätte er keine Festlegungen getroffen, stünden im
tragte Person definiert werden. Haftungsfall alle Funktionsträger mit relevanten Befugnis-
sen in der Verantwortung. Im Rahmen ihrer Fürsorgepflicht
Auf die Festlegung der Schnittstellen zu benachbarten nach § 618 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) können alle
Verantwortungsbereichen ist dabei besonderer Wert zu Führungskräfte im Falle eines Gesundheitsschadens zur
legen, da an dieser Stelle erfahrungsgemäß oft keine ein- Verantwortung gezogen werden, auch wenn die obers-
deutigen Regelungen zu den Abläufen vorhanden sind. te Leitung eine klare Pflichtenzuweisung versäumt hat.
Denn jede Führungskraft, die ihren Beschäftigten Arbeit
Form der Übertragung zuweist, muss auf Grund ihrer Position für Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit sorgen. Deshalb gewinnen mit
Die Pflichtenübertragung ist schriftlich zu vereinbaren. einer transparenten Organisation letztlich alle.
Hierbei gibt es mehrere Möglichkeiten: Die Führungsauf-
gaben im Arbeitsschutz können formell im Arbeitsvertrag, Bei allen Haftungsfragen darf das eigentliche Ziel nicht
in einer Stellenbeschreibung, in einem Organisations- aus den Augen verloren werden: Es geht darum, dass
handbuch, im Rahmen einer Dienstvereinbarung oder in Arbeitsplätze sicher und gesundheitsgerecht gestaltet
einer besonderen Pflichtenübertragung definiert werden. sind, dass Führungskräfte und Mitarbeiter die eigenen
Zum Ausdruck der Verbindlichkeit ist die Pflichtenüber- Zuständigkeits- und Aufgabenbereiche bestens kennen
tragung vom Beauftragten zu unterzeichnen und ihm und beherrschen, damit am Ende eines Arbeitstages alle
auszuhändigen, bei Bedarf ermöglicht dies den erforder- Beschäftigten gesund und wohlbehalten nach Hause zu-
lichen Nachweis. rückkehren.
Prädestiniert zur Darlegung der Arbeitsschutzpflichten ist
das Betriebshandbuch. Es bietet die Möglichkeit, die Auf-
gaben im Sinne des Arbeitsschutzes festzulegen und in-
dividuell im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung auf die
jeweilige Anlage abzustimmen. Literatur
Selbstverständlich muss das Vorhaben der Pflichten- [1] Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der
übertragung im Vorfeld mit den zu beauftragenden Per- Prävention“, DGUV Vorschrift 1 (11/2013)
sonen kommuniziert und erläutert werden. Dabei ist es [2] Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen
wichtig, den Grundgedanken und den Hintergrund der des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der
Übertragung darzulegen, um etwaige Ängste oder Vor- Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der
behalte auszuschließen. Per E-Mail ohne Kommentar an Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutz-
das elektronische Postfach gesandt – wie schon beob- gesetz – ArbSchG)
achtet – wäre eindeutig der falsche Weg. [3] Regel „Grundsätze der Prävention“, DGUV Regel
100-001 (5/2014)
Der Personalrat ist in diesen Prozess mit einzubinden.
Was bleibt beim Unternehmer?
Die Pflichten sind übertragen, der Unternehmer hat sich
„befreit“ und besitzt nun eine Aufgabe weniger? Dies
ist nur zum Teil richtig: „Er bleibt verantwortlich für die
Aufsicht und Kontrolle und hat dafür zu sorgen, dass
die übertragenen unternehmerischen Pflichten auch
tatsächlich umgesetzt werden. Der Unternehmer hat
zumindest stichprobenartig zu prüfen oder prüfen zu
lassen, ob die übertragenen Aufgaben ordnungsgemäß Verfasser
erfüllt werden. Die oberste Auswahl-, Aufsichts- und
Kontrollverpflichtung des Unternehmers ist nicht über- Stefan Tampe
tragbar“, heißt es abschließend in der DGUV Regel 100- Unfallkasse Baden-Württemberg
001. Abteilung Prävention
Waldhornplatz 1
Er kann sich aber sicher sein – dass er bei Wahrnehmung 76131 Karlsruhe
seiner verbleibenden Pflichten – den Arbeitsschutz in sei- stefan.tampe@ukbw.de
28Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 26–29
29Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 30–37
Praktischer Arbeitsschutz –
Der Weg zur Gefährdungsbeurteilung
Dietmar Klopfer
Vorab: Die folgenden Erläuterungen stellen dar, wie das Insgesamt besteht ein stark erhöhtes Risiko der Verlet-
oft abschreckende Thema der Gefährdungsbeurteilung zung und Erkrankung der Kollegen Wasserbauarbeiter.
im Landesbetrieb Gewässer in Tübingen bearbeitet wor-
den ist. Es handelt sich um einen Praxisbericht und ist Welche Tätigkeiten risikobehaftet sind, wie groß dieses
sicherlich nicht die einzig richtige Herangehensweise und Risiko ist und was der Arbeitgeber aber auch die ausfüh-
auch nicht die Ideallösung für alle Bereiche. renden Wasserbauarbeiter tun können, um das Risiko so
gering wie möglich zu halten, wird im Rahmen der Ge-
1. Vorstellung des Landesbetriebs Gewässer Tübingen fährdungsbeurteilung systematisch bewertet und geklärt.
Der Landesbetrieb Gewässer in Tübingen ist sogenann- 2. Erarbeitung der Gefährdungsbeurteilung im Lan-
ter Träger der Ausbau- und Unterhaltungslast an Ge- desbetrieb Gewässer Tübingen mit Auditor plus
wässern erster Ordnung. Er ist, aufgeteilt auf zwei Re-
ferate, mit 33 Mitarbeitenden von den drei Dienstsitzen EDV gestütztes Arbeitsschutzmanagementsystem
Tübingen, Riedlingen und Ravensburg aus für ca. 785 Auditor plus
Flusskilometer Gewässer zuständig. Die Gewässerun-
terhaltung wird von neun Betriebshöfen aus durch 42 Das Regierungspräsidium Tübingen – zu diesem gehört
Mitarbeiter durchgeführt. Daneben ist der Landesbe- der Landesbetrieb Gewässer Tübingen – hat sich 2010
trieb Gewässer Tübingen Betreiberin der Schlichemtal- dazu entschlossen, ein EDV gestütztes Arbeitsschutz-
sperre bei Schömberg und des Hochwasserrückhal- managementsystem einzuführen. Diese Entscheidung
tebeckens Urlau, zweier großer Rückhalteräume nach beruht darauf, dass u. a. der § 3 Arbeitsschutzgesetz
DIN 19700. (ArbSchG) die Forderung beinhaltet, dass der Arbeitge-
ber für eine geeignete Organisation des Arbeitsschutzes
Aufgaben des Landesbetriebs Gewässer Tübingen zu sorgen hat. Mit einem solchen System wird dies erfüllt.
Ebenfalls entscheidend war, dass mit der Verwaltungs-
Zu den Aufgaben des Landesbetriebs Gewässer gehören reform die Zahl der Mitarbeitenden, die Anzahl und das
im Wesentlichen die folgenden vier Schwerpunkte: Spektrum der Tätigkeiten sowie der Anteil technisch ge-
prägter Arbeitsplätze in den Regierungspräsidien erheb-
• die Gewässerunterhaltung, lich zugenommen haben.
• der Hochwasserschutz und die Hochwasservorsorge,
• die naturnahe Gewässerentwicklung, Nach der Sondierung mehrerer Softwarelösungen fiel
• der Gewässerkundliche Dienst (Betrieb der Oberflä- die Wahl auf das Produkt „Auditor plus“ der HNC Daten-
chengewässerpegel) technik GmbH, Rheinberg. Die Entscheidung für dieses
System basierte hauptsächlich darauf, dass es unter an-
Die noch folgenden Ausführungen beziehen sich haupt- derem den Vorteil bietet, monatlich aktiv mit einer Mail an
sächlich auf die Tätigkeiten der Kollegen in der Gewäs- noch ausstehende Arbeitsschutztermine, wie z. B. Unter-
serunterhaltung und die damit verbundenen Tätigkeiten, weisungen, Prüfintervalle, Maßnahmen, arbeitsmedizini-
Gefährdungen und Schutzmaßnahmen. sche Untersuchungen und andere Termine zu erinnern,
die Aktivitäten rechtssicher dokumentiert und über eine
Zur Gewässerunterhaltung gehören alle Arbeiten, die detaillierte Benutzerverwaltung verfügt. Auch bietet es
dem Erhalt von Wasserbaulichen Anlagen, der Ufersi- den Vorteil, dass es durch viele optionale Module ergänzt
cherung, der Grünpflege, der Gehölzpflege wie auch werden kann. Eine Übersicht über diese Module und ei-
dem Betrieb und der Unterhaltung der beiden oben nen Eindruck der Oberfläche, die 2017 überarbeitet wird,
genannten großen Rückhalteräume dienen. Dabei kom- findet sich in Abbildung 1. Seit Frühjahr 2011 ist dieses
men in der Regel Maschinen und Geräte unterschied- nun im Regierungspräsidium Tübingen im Einsatz.
lichster Art zum Einsatz. Diese Tätigkeiten erfordern
zudem oft schwere körperliche Arbeit unter widrigen
Umweltbedingungen (Unwetter, Arbeit am Hang, etc.).
30Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 30–37
Der dritte Schritt weist jeder dieser Tätigkeiten eine oder
mehrere Gefährdungen zu. Hier erfolgt auch eine Risiko-
bewertung.
Im vierten Schritt werden jeder Gefährdung adäquate
Maßnahmen nach dem STOP-Prinzip (vgl. später) zuge-
wiesen.
Zwar ist es sinnvoll die einzelnen Ebenen nacheinander
abzuarbeiten, allerdings sollte dieser kaskadenartige Auf-
bau verinnerlicht werden. Im Zweifelsfall, ob beispiels-
weise eine Tätigkeit aufgenommen werden sollte, ist es
hilfreich zu überlegen, welche Gefährdung aus dieser re-
Abb. 1: Modulübersicht des Arbeitsschutzmanage- sultiert und wie hoch das Risiko dieser überhaupt ist.
mentsystems „Auditor plus“ der HNC Daten-
technik GmbH [5] Anhand der Arbeitsbereiche werden Personen – und so
letztendlich eine Reihe von Maßnahmen - zugeordnet. Oft
ergeben sich allerdings Überschneidungen der in einem
Systematischer Aufbau der Gefährdungsbeurteilung Arbeitsbereich tätigen Personengruppen. Um dennoch
keine wesentlichen Tätigkeiten und Gefahren bei einzel-
Die Erarbeitung der Gefährdungsbeurteilung erfolgte im nen Personen zu vergessen und auch, um andere Per-
Groben für beiden Referate gemeinsam. Die Eigenheiten sonen nicht mit unnötigen Maßnahmen zu belasten, er-
der jeweiligen Referate wurden dann zu einem späteren folgte ein Zwischenschritt über die Identifikation von vier
Zeitpunkt von den einzelnen Referaten in Eigenverant- Arbeitsprofilen. Die Unterscheidung erfolgt aufgrund der
wortung nachgeführt. typischen Zuständigkeiten und der daraus resultierenden
Arbeiten. Anhand von Tabelle 1 unterscheidet der Lan-
Bei der Erarbeitung ist es von entscheidender Bedeu- desbetrieb in Tübingen die vier folgenden Arbeitsprofile:
tung, die ausführenden Personen einzubinden. Dies er-
folgte über die regelmäßige Einbindung der Leiter der Arbeitsprofil dortige Tätigkeiten
Betriebshöfe. Nur so kann die Gefährdungsbeurteilung (reine) Büroarbeit typische Vorzimmer-
vollständig die tatsächliche Situation abbilden. tätigkeiten
Büroarbeit und typische SachbearbeiterIn
Es erwies sich zudem als sinnvoll das vorhandene Exper- Außendienste
tenwissen des Betriebsarztes, der Fachkraft für Arbeits-
sicherheit (FaSi), der (RPT eigenen) Koordinierungsstelle Flussmeister und Flussmeister und
für Arbeitssicherheit (KoRA), sowie bei Bedarf der Unfall- Pegelwesen Pegelwesen
kasse Baden-Württemberg (UKBW) zu Rate zu ziehen. Wasserbauarbeiter Wasserbauarbeiter
Mit dem Arbeitsschutzmanagementsystem Auditor plus Tab. 1: Zusammenfassung von typischen Arbeiten zu
wird eine Gefährdungsbeurteilung in vier Ebenen geglie- Arbeitsprofilen
dert erstellt:
Erste Ebene: Arbeitsbereich Mit Hilfe einer Zuordnungsmatrix (vergleiche Tabelle 2)
Zweite Ebene: Tätigkeiten wurden dann die Arbeitsprofile mit den zugehörigen Ar-
Dritte Ebene: Gefährdungen beitsbereichen verknüpft. So wurde eine zielgerichtete
Vierte Ebene: Maßnahmen Zuweisung möglich. Auch wird so gewährleistet, dass
beispielsweise alle Wasserbauarbeiter den gleichen Ar-
Im ersten Schritt wurden Arbeitsbereiche, also Bereiche beitsbereichen zugeordnet werden und nicht einzelne
gleicher bzw. ähnlicher Arbeit, identifiziert. Dabei kann es vergessen werden – was zur Folge hätte, dass auch spe-
sich sowohl um einen speziellen Ort oder auch um eine zifische Maßnahmen vergessen werden. Dies ist insbe-
Ansammlung ähnlicher Tätigkeiten handeln. Anhand der sondere auch bei Neueinstellungen hilfreich.
Arbeitsbereiche erfolgt auch die Zuweisung der Personen.
Die Tabelle 2 zeigt die Zuweisungsmatrix. Hier wird jedem
Im zweiten Schritt werden für jeden Arbeitsbereich die der vier Arbeitsprofile ein Paket von Arbeitsbereichen zu-
dort anfallenden Tätigkeiten identifiziert. gewiesen, in denen diese Gruppe von Mitarbeitenden
tätig wird. In der Matrix kann diese Zuweisung anhand
31Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 30–37
Zuordnungsmatrix (Arbeitsbereiche zu Arbeitsprofile)
Nr. Arbeitsbereich Büro Büro und AD Flussmeister/ Wasserbau-
Pegler arbeiter
1 Büro x x x
2 Nichttechnischer Außendienst x x x
3 Bauaufsicht/Baukontrolle x x
4 Betriebshof allgemein x x
5 Betriebshof Werkstatt / Fahrzeughalle x x
6 Betrieb und Unterhalt: Allgemeines x x
7 Gewässerunterhaltung x
8 Mäharbeiten x
9 Gehölzpflege x
10 Arbeiten auf Booten x
11 Pegelwesen x x
12 Wasserbauliche Anlagen x x x
13 Hochwassereinsatz x x x
Tab. 2: Zuordnungsmatrix von Arbeitsbereichen zu Arbeitsprofilen
der gesetzten Kreuze („x“) erkannt werden. Diese Matrix Erarbeitung der Gefährdungsbeurteilung
ist auch im späteren Verlauf der Erarbeitung und ggf. auch
Modifikation der Gefährdungsbeurteilung hilfreich, wenn es Es ist sinnvoll die oben genannten Ebenen nacheinander
darum geht, konkrete Tätigkeiten/Gefährdungen und Maß- abzuarbeiten, um so vom Groben immer feiner zu werden.
nahmen einem Arbeitsbereich zuzuordnen. Alleine anhand
der Wahl der Zuweisung können Dopplungen vermieden Auch geht es bei der Bearbeitung darum, keine der we-
werden. Als Beispiel soll die folgende Überlegung dienen: sentlichen Arbeiten oder schweren Gefährdungen zu ver-
gessen. Die Gefährdungsbeurteilung muss immer wieder
Es sollte offensichtlich sein, dass in vielen Arbeitsberei- angepasst werden, weil beispielsweise neue Geräte oder
chen S3-Sicherheitsschuhe getragen werden müssen. Maschinen zum Einsatz kommen, sich neue rechtliche
Das gilt sowohl für Sachbearbeiter, für Flussmeister und Rahmenbedingungen ergeben oder auch weil Unfälle
Pegelsachbearbeiter und insbesondere selbstverständ- oder Beinahe-Unfälle passieren, die dazu führen, die ge-
lich auch für die Wasserbauarbeiter. Es wäre also mög- troffenen Schutzmechanismen zu überdenken.
lich, die Beschaffung der S3-Sicherheitsschuhe jedem
einzelnen dieser Arbeitsbereiche, in dem dieser notwen- Nach Festlegung der Arbeitsbereiche, im Landesbetrieb
dig ist, als Maßnahme vorzusehen (Arbeitsbereiche: Bau- Gewässer Tübingen wurden zwölf1 verschiedene identi-
aufsicht, Betriebshof, Werkstatt …). fiziert (vgl. Tabelle 2), erfolgte die Auflistung der dort je-
weils stattfindenden Tätigkeiten.
Wenn die Beschaffung der S3-Sicherheitsschuhe andershe-
rum aber einmalig einem Arbeitsbereich zugewiesen wird, in Für das Beispiel in Abbildung 2 wurden die handwerkli-
dem diese drei Personengruppen (mit den oben genannten chen Tätigkeiten des Arbeitsbereichs „Betrieb- und Un-
Tätigkeitsprofilen) gemeinsam arbeiten, erspart dies unnöti- terhaltung: Allgemeines“ stark zusammengefasst. Obwohl
gen Aufwand und ist zudem noch übersichtlicher. es sicherlich ein deutlicher Unterschied ist, ob eine Verlet-
zung von einer Bohrmaschine oder einem Hobel ausgeht,
Aus diesen Erwägungen wurden zwei Sammelposten
(„Betriebshof allgemein“ und „Betrieb und Unterhaltung: 1 Zunächst waren es 13. Der Arbeitsbereich Nr. zwei wurde im
Verlauf der Bearbeitung ersatzlos gestrichen und die Inhalte auf andere
Allgemeines“) erstellt, um möglichst viele Tätigkeiten, Ge-
Bereiche verteilt. Die Nummerierung wurde aber nicht geändert, da
fährdungen und Maßnahmen sozusagen „vor die Klam- sonst viele Verweise auf andere Arbeitsbereiche hätten händisch
mer“ zu ziehen. angepasst werden müssen. Dies ist auch eine der Schwachpunkte des
Systems.
32Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 30–37
so sind die daraus resultierenden Maßnahmen letztendlich
ganz ähnlich. Das ergibt sich mit ein wenig Übung und Hin-
eindenken in die Systematik und die Möglichkeiten der Ge-
fährdungsbeurteilung sehr schnell im Erstellungsprozess2.
Abb. 2: Übersicht der für den Arbeitsbereich „Betrieb- Abb. 3: Den Arbeitsbereichen zugeordnete Gefähr-
und Unterhaltung: Allgemeines“ identifizierten dungen [5].
Tätigkeiten [5].
Bei der Betrachtung der einzelnen Tätigkeiten ist im Fol-
genden entscheidend, welche Gefahren aus diesen resul-
tieren und wie groß das Risiko für diese ist.
Auch hier wurden möglichst viele Tätigkeiten bzw. die da-
raus resultierenden Gefährdungen, denen die Kollegen auf
den Betriebshöfen ausgesetzt sind, zusammengefasst und
in diesem Arbeitsbereich an exponierter Stelle einmalig
aufgeführt („vor die Klammer gezogen“). Bei diesen, in Ab-
bildung 3 aufgeführten Gefährdungen, handelt es sich um
Stürzen bzw. Umknicken durch Arbeiten an Böschungen,
Ertrinken durch die Arbeit direkt am Gewässer, belastende
Witterungseinflüsse durch Arbeit im Freien bei Wind und
Wetter, Umgang mit Ölen und Schmierstoffen durch das
Hantieren, Nachfüllen und Betanken von Maschinen und
Geräten sowie die Belastung durch UV-Strahlung.
Für die oben bereits genannten zusammengefassten hand-
werklichen Tätigkeiten bestehen bei näherer Betrachtung
noch weitere Gefahren, beispielsweise durch das Einatmen
von Gasen und Dämpfen (bei Lackierarbeiten) oder auch
durch Funkenflug (bei Metallarbeiten). Diese werden dann
jeweils bei den entsprechenden Tätigkeiten aufgelistet.
Diese Gefahren sollten im Freitext ruhig konkret be-
nannt werden („Verbrennung durch Funkenflug beim
Schweißen, Schleifen“). „Eine Kategorisierung erfolgt
über die Zuordnung eines sog. Gefährdungsfaktors. Ge-
fährdungsfaktoren sind Gruppen von Gefährdungen, die
durch gleichartige Gefahrenquellen oder Wirkungsquali-
täten gekennzeichnet sind.“3 [2].
2 Beim ersten Herantasten und Erstellen der Gefährdungsbe-
urteilung ist es durchaus legitim, alle noch so banalen Tätigkeiten zu-
nächst zu sammeln und aufzulisten. Bei der Bewertung des Risikos der Abb. 4: Auswahlliste der Gefährdungsfaktoren [5].
daraus entstehenden Gefahren wird recht schnell klar, wo die „echten“
Risiken liegen.
3 Entnommen [2] Ratgeber zur Gefährdungsbeurteilung Hand-
buch für Arbeitsschutzfachleute, baua: 11/2016.
33Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 30–37
Diese Gefährdungsfaktoren sind in Auditor plus hin- schwer sind die Folgen im Falle des Unfalls/ der Erkran-
terlegt und basieren auf der Kategorisierung der Deut- kung?“. Die Beantwortung erfolgt in Kategorien. Als Ant-
schen Gesetzlichen Unfallversicherung (BGI/GUV-I wort für die Eintrittswahrscheinlichkeit E stehen zur Aus-
8700 [3]). In Abbildung 4 ist ein Ausschnitt der wähl- wahl „Sehr gering (1)“, „Gering (2)“, „Mittel (3)“, „Hoch
baren Gefährdungsfaktoren enthalten. Für jede, der (4)“. Als Antwort für die Schadensschwere S stehen zur
konkret ermittelten Gefahren, wird die Gefahrenquelle Auswahl „Leicht (1)“, „Mittel (2)“, „Schwer (3)“, „Tod/Ka-
anhand des Gefährdungsfaktors zugeordnet. Das be- tastrophe (4)“.
deutet beispielsweise, dass die Arbeit an Böschungen,
die mit der Gefahr des Umknickens verbunden ist, den Aus dem Produkt der beiden Antworten resultiert eine Ri-
Gefährdungsfaktor „Sturz auf der Ebene, Ausrutschen, sikozahl, die auch das Risiko bewertet (R = E x S).
Stolpern, Umknicken“ mit der Ordnungsnummer 01.05
erhält. Diese Abschätzung wird anhand der dort hinterlegten
Matrix (Abbildung 6) durchgeführt.
Nach der Eintragung der konkreten benannten Gefahr
(Freitext) und der Zuweisung der Gefahrenquelle (Gefähr-
dungsfaktor als Auswahlliste) ist als nächstes die Beurtei-
lung dieser Gefahr notwendig: Die Risikobewertung.
Abb. 5: Abschätzung der Gefährdung und Zuordnung
des Gefährdungsfaktors [5].
Dies ist ein Kernpunkt der Gefährdungsbeurteilung und,
um diese korrekt durchführen zu können, ist es zunächst
wichtig zu wissen, dass das Risiko das Produkt aus Ein-
trittswahrscheinlichkeit und Schadensschwere (Vulnera-
bilität) ist.
Abb. 6: Abschätzen des Risikos [5].
Zur Verdeutlichung dient das Beispiel von einem Ruder-
boot und einem Schiff, die beide auf einem See in einen
Sturm geraten. Die Wahrscheinlichkeit in einen Sturm zu Für das Beispiel der Arbeiten an der Böschung, bei der
geraten (Eintrittswahrscheinlichkeit) ist für beide Was- die Gefahr besteht umzuknicken bzw. auszurutschen,
serfahrzeuge gleich groß. Allerdings sind die drohenden wurde im Landesbetrieb Gewässer Tübingen eine gerin-
Folgen für das Ruderboot (Kentern) verheerend. Sprich, ge Eintrittswahrscheinlichkeit (Wertung E = 2) und eine
die Vulnerabilität des Ruderbootes ist deutlich höher und Mittlere Schadensschwere (Wertung S = 2) angenom-
dadurch ist das Risiko ebenfalls deutlich höher. men. Die sich ergebende Risikozahl R (Risiko ist Produkt
aus Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensschwere. R
Durch die Betrachtung des Risikos – und eben nicht nur = E x S) beträgt also R = 2 x 2 = 4.
der Gefahr (Vulnerabilität) – ergibt sich auch recht schnell,
welche Tätigkeiten tatsächlich in die Gefährdungsbeur- Anhand der mitgelieferten Bewertungsmatrix und der
teilung aufgenommen werden müssen und welche viel- dort enthaltenen Farbgebung wird ein mittleres Risiko
leicht entfallen können. ausgewiesen.
Bei jeder identifizierten Gefährdung muss man sich also Bei der Erarbeitung im Landesbetrieb wurde vereinbart,
die beiden Fragen stellen „Wie wahrscheinlich ist es, dass Handlungsbedarf erst dann besteht, wenn ein Risiko
dass dieser Unfall/ diese Erkrankung auftritt?“ und „Wie der Zahl 3 oder höher besteht (also ab mittlerem Risiko).
34Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 30–37
Im folgenden Schritt werden dann für diejenigen Gefähr-
dungen, mit mittlerem oder höherem Risiko, adäquate
Maßnahmen zur Reduktion des Risikos ausgewählt. Die
Auswahl erfolgt systematisch nach dem STOP-Prinzip
[4]. Dieses gibt eine Hierarchie vor, nach der man bei der
Maßnahmenauswahl vorgeht:
S ubstitution
T echnische Maßnahme
O rganisatorische Maßnahme Abb. 8: Ausformulierung der Maßnahmen und Zu-
P ersönliche Schutzausrüstung weisung von Terminen [5].
Das bedeutet, dass erst geprüft werden sollte, ob eine
Substitution (beispielsweise eines Betriebsstoffes oder Wie eingangs beschrieben, ist einer der Vorteile von Au-
eines Gerätes) möglich ist, um eine Gefahr komplett zu ditor plus, dass Terminverfolgungen hinterlegt werden
umgehen. Wenn dies nicht der Fall ist, ob es eine tech- können, an die das Programm erinnert. Dies wurde bei-
nische Möglichkeit gibt das Risiko zu vermindern (bei- spielsweise in der Abbildung 8 für die Beschaffung von
spielsweise Einhausung eines Maschinenteils). Ist auch P2-Masken, die als eine Maßnahme zum Umgang mit Ei-
dies nicht möglich, wird geprüft, ob organisatorische chenprozessionsspinnern identifiziert worden ist, getan.
Maßnahmen wirkungsvoll sind (beispielsweise regelmä- Als Verantwortliche wurden hier die Flussmeister, also die
ßige Unterweisungen). Ist dies alles nicht möglich oder Leiter der Betriebshöfe, eingetragen und mit einem Ter-
nicht ausreichend, bleibt die persönliche Schutzausrüs- min zur Erledigung versehen.
tung (PSA). Diese sollte das letzte Mittel der Wahl sein,
wenn sie auch oft recht einfach bereit zu stellen wäre, da Expertenwissen in der Erarbeitung
jede persönliche Schutzausrüstung eine körperliche Be-
lastung für den Arbeitenden darstellt. Wie eingangs beschrieben, wurde während der Bear-
beitung immer wieder auf die vorhandenen Experten zu-
rückgegriffen. Die Leiter der Betriebshöfe verfügen über
das Wissen über die betrieblichen Abläufe, die notwendig
sind, um eine realitätsnahe Darstellung der Tätigkeiten in
der Gefährdungsbeurteilung zu gewährleisten. Die Fach-
kraft für Arbeitssicherheit und der Betriebsarzt verfügen
darüber hinaus auch über das Expertenwissen zur Be-
wertung von Risiken und geben Hilfe bei der Auswahl von
Maßnahmen.
Ohne die Beteiligung dieser Gruppen, ist es nicht möglich
eine adäquate Gefährdungsbeurteilung zu erstellen.
Abb. 7: Zuweisung von Maßnahmen zu den jeweiligen Aus diesem Grund wurden diese Experten, zu unter-
Gefährdungen [5]. schiedlichen Bearbeitungsständen, immer wieder in die
Erarbeitung eingebunden.
In Abbildung 7 wurde dies exemplarisch für den Arbeits- Bei der Erarbeitung der Arbeitsbereiche und der Tätigkei-
bereich Nr. 3 „Baukontrolle, Bauaufsicht“ durchgeführt. ten wurden diese auf Vollständigkeit durch die Leiter der
Dabei wurde bei den Freitexten darauf geachtet, dass Betriebshöfe verifiziert.
eine halbwegs einheitliche Beschriftung erfolgte. So ist
bereits an der Art der Beschriftung erkennbar, ob es sich Sowohl die Gefährdungen, als auch die Bewertung der
beispielsweise um eine Organisatorische Maßnahme Gefährdung (Risiko) sowie die daraus resultierenden
handelt – diese verwendet das Schlagwort „Sicherstellen“ Maßnahmen wurden zur Überprüfung zunächst an die
gefolgt von der Art der konkreten Maßnahme „regelmä- Fachkraft für Arbeitssicherheit und danach an den Be-
ßige Unterweisung“. „Beschaffung“ wiederum weist auf triebsarzt zur Korrektur gesendet und die jeweiligen Rück-
eine PSA hin. Diese Art der Beschreibung ist sicherlich meldungen in die Gefährdungsbeurteilung eingearbeitet.
nicht zwingend notwendig, wurde aber im Landesbetrieb
Gewässer verwendet, um den Überblick über die Vielzahl Insgesamt waren, über einen Zeitraum von mehreren Mo-
an Maßnahmen zu behalten. naten, einige interne Besprechungen sowie schriftliche
35Erfahrungsaustausch Betrieb von Hochwasserrückhaltebecken in Baden-Württemberg
23. Jahrestagung 2016 – Berichtsband, S. 30–37
Beteiligungsrunden im Prozess notwendig, um die Ge- wenn sich Abläufe ändern, neue Maschinen oder Geräte
fährdungsbeurteilung auf den aktuellen Stand zu bringen. zum Einsatz kommen oder Unfälle bzw. Beinahe-Unfälle
auftreten. Ein EDV gestütztes Arbeitsschutzmanagement-
Gefährdungsbeurteilung abgeschlossen? system kann dabei helfen, die Gefährdungsbeurteilung zu
einem lebendigen Dokument werden zu lassen, das auch
Mit dem Abschluss der Gefährdungsbeurteilung ist klar, im Alltag genutzt werden kann.
bei welchen Tätigkeiten, welche Personengruppen, wel-
chen Risiken ausgesetzt sind und welche Maßnahmen Letztendlich dient die Gefährdungsbeurteilung der (kör-
dazu notwendig sind, diese Risiken zu reduzieren. perlichen) Sicherheit der Mitarbeiter und auch der (recht-
lichen) Sicherheit der Führungskräfte.
Im Landesbetrieb Gewässer Tübingen ergab diese Ana-
lyse einen regelrechten Berg von Aufgaben, die nun suk-
zessive und systematisch abgearbeitet werden. Viele der
identifizierten Maßnahmen, insbesondere organisatori- Literatur
sche Maßnahmen wie Unterweisungen, müssen jedoch
immer wieder – beispielsweise im jährlichen Rhythmus – [1] Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen
aufgefrischt werden. des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der
Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der
Hinzu kommen neuere Themen, wie beispielsweise die Beschäftigten bei der Arbeit (Arbeitsschutz-
desinfizierende Reinigung von Schutzkleidung, die im gesetz – ArbSchG), August 1996
Moment noch am Anfang steht.
[2] Ratgeber zur Gefährdungsbeurteilung Handbuch
Das Thema Arbeitsschutz ist mit dem Abschluss der für Arbeitsschutzfachleute,
Gefährdungsbeurteilung also keinesfalls beendet. Es ist baua: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-
dennoch wichtig und bietet auch konkrete Vorteile für beitsmedizin, November 2016
den Ersteller.
[3] Gefährdungs- und Belastungs-Katalog. Beurtei-
Dadurch, dass sich die Bearbeitenden mit den eigenen lung von Gefährdungen und Belastungen am Ar-
Abläufen beschäftigen, und diese auch kritisch hinter- beitsplatz (BGI/GUV-I 8700). Deutsche Gesetz-
fragen müssen, können bislang unerkannte Risiken ent- liche Unfallversicherung, Dezember 2009
deckt werden. Das dient nicht nur den ausführenden Mit-
arbeitern sondern auch den Führungskräften. [4] Erläuterung des STOP-Prinzips der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung am Beispiel von
Das EDV gestützte Arbeitsschutzmanagementsystem un- Nanomaterialien
terstützt bei der Verteilung von Aufgaben, dokumentiert http://nano.dguv.de/praevention/stop-prinzip/,
diese und erinnert an die Erledigung der Aufgabe. abgerufen am 29.05.2017.
Letztendlich dient eine sauber erstellte Gefährdungsbe- Quellen
urteilung auch dazu, das vorhandene Wissen zu erhalten
und kann auch zum Wissenstransfer genutzt werden. [5] Alle enthaltenen Abbildungen (1 bis 8) wurden
dem Arbeitsschutzmanagementsystem „Auditor
3. Fazit plus“ der HNC Datentechnik GmbH entnommen.
Um eine Gefährdungsbeurteilung für eine technische Ein-
heit wie den Landesbetrieb Gewässer aufzustellen, erfor-
dert es einiges an Arbeit und auch Abstimmung mit den
betroffenen Personengruppen sowie mit den Experten-
kreisen, wie der Fachkraft für Arbeitssicherheit und dem
Betriebsarzt. Es ist daher nicht möglich, eine solche Ge-
fährdungsbeurteilung komplett extern zu vergeben und Verfasser
keine Arbeit mit dieser zu haben. Sicherlich ist es mög-
lich, Expertenwissen extern hinzuzuziehen. Ein Hauptteil Dietmar Klopfer
der Arbeit verbleibt jedoch in der eigenen Einheit. Regierungspräsidium Tübingen – Abteilung 5, Ref. 53.2
Konrad-Adenauer-Str. 20
Die Gefährdungsbeurteilung wird immer wieder ange- 72072 Tübingen
passt werden müssen. Das ist insbesondere der Fall, dietmar.klopfer@rpt.bwl.de
36Sie können auch lesen