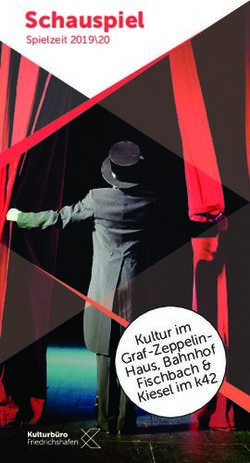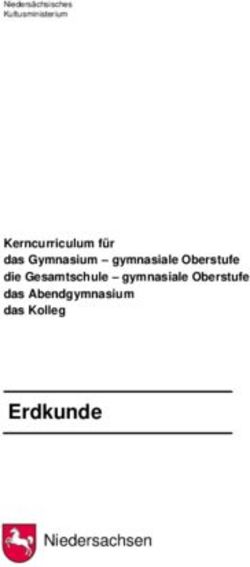Ernährungslehre Hüffertgymnasium Warburg - Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe - Hüffertgymnasium
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Hüffertgymnasium Warburg
Schulinterner Lehrplan
zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe
Ernährungslehre
In der Erprobung: EF ab Schuljahr 2014/2015
QI ab Schuljahr 2015/2016
Fassung: August 2015Inhalt
Seite
1. Rahmenbedingungen der fachlichen Arbeit ............................................................. 3
2. Entscheidungen zum Unterricht ............................................................................... 4
2.1 Unterrichtsvorhaben ............................................................................................ 5
2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben ........................................................ 6
2.1.2 Mögliche konkretisierte Unterrichtsvorhaben............................................. 13
2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit........................ 50
2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung ...................... 51
2.4 Lehr- und Lernmittel …………………………………………………..………… 53
3. Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden Fragen……………………. 54
4. Qualitätssicherung und Evaluation........................................................................... 551. Rahmenbedingungen für die fachliche Arbeit
Das Hüffertgymnasium ist in der Oberstufe ein fünfzügiges Gymnasium. Als städtische Schule liegt sie in zentraler Lage und bietet eine gute
Anbindung sowohl an den Wochen- und verschiedene Supermärkte, unterschiedliche Erzeugerbetriebe als auch an städtische Institutionen.
• Die Schule hat einen Ernährungslehrefachraum, der mit der Schulküche verbunden ist. Zudem werden die Biologiefachräume genutzt
werden.
• Dem Profil der Schule entsprechend besteht eine Koch-AG im Rahmen des Übermittagsbetreuung für die Erprobungsstufe.
Im Wahlpflichtbereich der Mittelstufe wird die Fächerkombination „Ernährungslehre mit Chemie“ angeboten. Dabei erfolgt die
Schwerpunktsetzung im Bereich der Ernährung mit 75% igem Stundenanteil. Dieses Angebot wird mit seiner besonderen Schwerpunktsetzung
zweistündig (zu 60 Minuten) in den Jahrgangsstufen 8 und 9 unterrichtet.
In der Oberstufe wird Ernährungslehre als neu einsetzendes Fach in Kombination mit einem anderen naturwissenschaftlichen Fach (Biologie,
Chemie, Physik) im mathematisch-naturwissenschaftlichen Aufgabenfeld gewählt. In der Einführungsphase sowie in den beiden
Qualifikationsphasen gibt es in der Regel in jeder Stufe 2 – 3 Kurse, wobei insbesondere Seiteneinsteiger aus Real- und Hauptschulen, dieses Fach
gerne belegen. Der Ernährungslehreunterricht findet in Einzelstunden (60 Minuten) statt.
Jg Fachunterricht Sekundarstufe I Zeitrahmen
5/6 Koch- und Back-AG im Rahmen der 2 x 60 Minuten
Übermittagsbetreuung
8/9 Ernährungslehre mit Chemie 2 x 60 Minuten
Fachunterricht Sekundarstufe II
EF 2,5 x 60 Minuten
Q1 2,5 x 60 Minuten
Q2 2,5 x 60 Minuten
Für alle Inhaltsfelder stehen Materialien für Experimente in etwa 7-facher Ausführung (4-er Gruppen) zur Verfügung. Kleinere Experimente mit
Lebensmitteln und lebensmitteltechnologische Verfahren werden im Fachraum oder in der Schulküche, entsprechend den aktuellen Sicherheits- und
Hygienebestimmungen, durchgeführt. Darüber hinaus steht die Schulküche mit ihren fünf Küchenzeilen (Kojen) für exemplarische
Mahlzeitenzubereitungen zur Verfügung. Für komplexere Experimente wird in Absprache der Biologie- oder Chemieraum genutzt.In dem Fachraum steht ein Computer mit Beamer zur Verfügung, der alleine oder in Ergänzung mit dem Computerraum u.a. für Nährwertberechnungen genutzt werden kann. Für individuelle anthropometrische Messungen der Schülerinnen und Schüler wird mindestens ein weiterer Unterrichtsraum / Schulküche zusätzlich genutzt. Zur Erreichung der in den vier Kompetenzbereichen aufgeführten Teilkompetenzen werden den Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten für individualisiertes und kooperatives Lernen gegeben, indem unterschiedliche Fach- und Unterrichtsmethoden zum Einsatz kommen. Das allgemeine Unterrichtskonzept ermöglicht Projektunterricht und Formen selbstgesteuerten Lernens in Kleingruppen unter Einbeziehung des Computers. Darüber hinaus sind fachlich fundierte Kenntnisse die Voraussetzung für verantwortliches Handeln in einer globalisierten Welt. Hervorzuheben sind hierbei die Aspekte der Eigen- und Mitverantwortung gegenüber dem eigenen Körper und gegenüber der Gesellschaft im Sinne eines nachhaltigen Handelns. Ein Leitgedanke des Schulprogramms ist ein ganzheitliches Verständnis von Gesundheit, das physische, psychische und soziale Faktoren mit einbezieht unter besonderer Berücksichtigung der Nachhaltigkeit. Dieser Leitgedanke soll im Fachunterricht deutlich werden. Der Besuch der Zuckerfabrik als einem regionalen Betrieb aus dem Lebensmittelbereich vermittelt Lehrkräften sowie Schülerinnen und Schülern des Gymnasiums einen Einblick in die unternehmerische Praxis und in Möglichkeiten und Grenzen eines Unternehmens aus dem Lebensmittelbereich bei der Realisierung der Ziele einer nachhaltigen Entwicklung. Berufsorientierung spielt im Fach Ernährungslehre eine bedeutende Rolle. Durch Einladungen von Fachkräften aus verschiedensten Bereichen wie Hebamme, Diätberaterin, Gesundheitsberater, Apotheker erhalten die Schüler konkrete Vorstellungen von deren Berufswelt, aber auch eine andere Sichtweise auf die unterrichtlichen Themenfelder.
2. Entscheidungen zum Unterricht Hinweis: Die nachfolgend dargestellte Umsetzung der verbindlichen Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans findet auf zwei Ebenen statt. Das Übersichtsraster gibt einen raschen Überblick über die laut Fachkonferenz verbindlichen Unterrichtsvorhaben und deren Reihenfolge in der Einführungsphase und in der Qualifikationsphase. In dem Raster sind außer den Themen für das jeweilige Vorhaben und den dazugehörigen Kontexten die damit verknüpften Inhaltsfelder und inhaltlichen Schwerpunkte des Vorhabens sowie die Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung ausgewiesen. Die Konkretisierung von Unterrichtsvorhaben führt die konkretisierten Kompetenzerwartungen des gültigen Kernlehrplans auf, stellt eine mögliche Unterrichtsreihe sowie dazu empfohlene Lehrmittel, Materialien und Methoden dar und verdeutlicht neben diesen Empfehlungen auch vorhabenbezogene verbindliche Absprachen der Fachkonferenz, z.B. zur Durchführung eines für alle Fachkolleginnen und Fachkollegen verbindlichen Experiments oder auch die Festlegung bestimmter Diagnoseinstrumente und Leistungsüberprüfungsformen. 2.1. Unterrichtsvorhaben Hinweis: Thema, Inhaltsfelder, inhaltliche Schwerpunkte und Kompetenzen hat die Fachkonferenz verbindlich vereinbart. In allen anderen Bereichen sind Abweichungen von den vorgeschlagenen Vorgehensweisen bei der Konkretisierung der Unterrichtsvorhaben möglich. Darüber hinaus enthält dieser schulinterne Lehrplan in den Kapiteln 2.2 bis 2.4 übergreifende sowie z.T. auch jahrgangsbezogene Absprachen zur fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit, zur Leistungsbewertung und zur Leistungsrückmeldung. Je nach internem Steuerungsbedarf können solche Absprachen auch vorhabenbezogen vorgenommen werden. Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan besitzt den Anspruch, sämtliche im Kernlehrplan angeführten Kompetenzen auszuweisen. Dies entspricht der Verpflichtung jeder Lehrkraft, den Lernenden Gelegenheit zu geben, alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans auszubilden und zu entwickeln. Die entsprechende Umsetzung erfolgt auf zwei Ebenen: der Übersichts- und der Konkretisierungsebene.
Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.1.1) werden die für alle Lehrerinnen und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindlichen Kontexte sowie Verteilung und Reihenfolge der Unterrichtsvorhaben dargestellt. Das Übersichtsraster dient dazu, den Kolleginnen und Kollegen einen schnellen Überblick über die Zuordnung der Unterrichtsvorhaben zu den einzelnen Jahrgangsstufen sowie den im Kernlehrplan genannten Kompetenzerwartungen, Inhaltsfeldern und inhaltlichen Schwerpunkten zu verschaffen. Um Klarheit für die Lehrkräfte herzustellen und die Übersichtlichkeit zu gewährleisten, werden in der Kategorie „Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung“ an dieser Stelle nur die übergeordneten Kompetenzerwartungen ausgewiesen, während die konkretisierten Kompetenzerwartungen erst auf der Ebene der möglichen konkretisierten Unterrichtsvorhaben Berücksichtigung finden. Der ausgewiesene Zeitbedarf versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die nach Bedarf über- oder unterschritten werden kann. Um Spielraum für Vertiefungen, besondere Schülerinteressen, aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse anderer besonderer Ereignisse (z.B. Praktika, Kursfahrten o.ä.) zu erhalten, wurden im Rahmen dieses schulinternen Lehrplans nur ca. 75 Prozent der Bruttounterrichtszeit verplant. Während der Fachkonferenzbeschluss zum „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ zur Gewährleistung vergleichbarer Standards sowie zur Absicherung von Lerngruppen- und Lehrkraftwechseln für alle Mitglieder der Fachkonferenz Bindekraft entfalten soll, besitzt die exemplarische Ausgestaltung „möglicher konkretisierter Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.1.2) abgesehen von den in der vierten Spalte im Fettdruck hervorgehobenen verbindlichen Fachkonferenzbeschlüssen nur empfehlenden Charakter. Referendarinnen und Referendaren sowie neuen Kolleginnen und Kollegen dienen diese vor allem zur standardbezogenen Orientierung in der neuen Schule, aber auch zur Verdeutlichung von unterrichtsbezogenen fachgruppeninternen Absprachen zu didaktisch-methodischen Zugängen, fächerübergreifenden Kooperationen, Lernmitteln und -orten sowie vorgesehenen Leistungsüberprüfungen, die im Einzelnen auch den Kapiteln 2.2 bis 2.4 zu entnehmen sind. Abweichungen von den vorgeschlagenen Vorgehensweisen bezüglich der konkretisierten Unterrichtsvorhaben sind im Rahmen der pädagogischen Freiheit und eigenen Verantwortung der Lehrkräfte jederzeit möglich. Sicherzustellen bleibt allerdings auch hier, dass im Rahmen der Umsetzung der Unterrichtsvorhaben insgesamt alle Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans Berücksichtigung finden.
2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben
Einführungsphase (EF)
Unterrichtsvorhaben I: Unterrichtsvorhaben II:
Thema/Kontext: Der Energie- und Nährstoffbedarf von Menschen variiert Thema/Kontext: Kohlenhydrate sind nicht gleich Kohlenhydrate – Wie viel
– Wie kann ich meinen individuellen Bedarf adäquat decken? Zucker darf es sein?
Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung:
• UF1 Wiedergabe • UF3 Systematisierung
• UF2 Auswahl • E2 Wahrnehmung und Messung
• UF4 Vernetzung • E4 Untersuchungen und Experimente
• E5 Auswertung • E6 Modelle
Inhaltsfeld: Bedarfsgerechte Ernährung • K1 Dokumentation
Inhaltliche Schwerpunkte: Inhaltsfeld: Bedarfsgerechte Ernährung
• Hauptnährstoffe und ihre Funktion Inhaltliche Schwerpunkte:
• Energie- und Nährstoffbedarf • Hauptnährstoffe und ihre Funktion
Zeitbedarf: ca. 16 Std. à 60 Minuten • Verdauung, Resorption und Speicherung der Hauptnährstoffe
Zeitbedarf: ca. 18 Std. à 60 Minuten
Unterrichtsvorhaben III: Unterrichtsvorhaben IV:Thema/Kontext: Ohne Fette geht es nicht – Sind Fette besser als ihr Thema/Kontext: Auf die Qualität der Proteine kommt es an – Welche
Ruf? Proteinlieferanten sind für mich geeignet?
Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung:
• E3 Hypothesen • E1 Probleme und Fragestellungen
• K2 Recherche • K3 Präsentation
• K3 Präsentation • K4 Argumentation
• B1 Kriterien • B1 Kriterien
• B2 Entscheidungen
• B3 Werte und Normen
Inhaltsfeld: Bedarfsgerechte Ernährung Inhaltsfeld: Bedarfsgerechte Ernährung
Inhaltliche Schwerpunkte: Inhaltliche Schwerpunkte:
• Hauptnährstoffe und ihre Funktion • Hauptnährstoffe und ihre Funktion
• Verdauung, Resorption und Speicherung der Hauptnährstoffe • Hauptnährstofflieferanten und ihre Herstellung
Zeitbedarf: ca. 15 Std. à60 Minuten Zeitbedarf: ca. 18 Std. à 60 Minuten
Summe der Unterrichtsstunden in der Einführungsphase: ca. 67 Stunden
Qualifikationsphase (Q1) – GrundkursQualifikationsphase (Q1) – Grundkurs
Unterrichtsvorhaben I: Unterrichtsvorhaben II:
Thema/Kontext: Bedeutung von Wasser, Mineralstoffen und Thema/Kontext: B-Vitamine – Welche Rolle spielen sie im Stoffwechsel
Vitaminen im Stoffwechsel des Menschen – Welche Folgen hat eine des Menschen?
Unter- und Überversorgung an ausgewählten Mineralstoffen, Vitamin
D und C sowie Wasser?
Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung:
Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung:
• K1 Dokumentation
• UF1 Wiedergabe
• UF4 Vernetzung
• UF3 Systematisierung
• E5 Auswertung
• UF4 Vernetzung
• E6 Modelle
• E1 Probleme und Fragestellungen
• E5 Auswertung
• K3 Präsentation
Inhaltsfeld: Physiologie der Ernährung
Inhaltsfelder: Physiologie der Ernährung / Pathophysiologie der
Ernährung
Inhaltliche Schwerpunkte: Inhaltliche Schwerpunkte:
• Bedeutung des Wassers • Stoffwechsel der Hauptnährstoffe
• Vitamine und Mineralstoffe • Vitamine [und Mineralstoffe]
• Nährstoffträger • Nährstoffträger
• Hormonelle Regulation
• Lebensmittelunverträglichkeiten
Zeitbedarf: ca. 27 Std. à 60 Minuten Zeitbedarf: ca. 15 Std. a 60 MinutenUnterrichtsvorhaben III: Unterrichtsvorhaben IV:
Thema/Kontext: Ernährung und Sport – Bessere Leistung durch Thema/Kontext: Fit im Alter – Besser leben durch eine bedarfsadäquate
bedarfsadäquate Ernährung? Ernährung?
Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung:
• UF4 Vernetzung • K1 Dokumentation
• E5 Auswertung • K2 Recherche
• K4 Argumentation • K3 Präsentation
• B2 Entscheidungen • K4 Argumentation
• B1 Kriterien
Inhaltsfeld: Ernährung in verschiedenen Lebensphasen und Inhaltsfeld: Ernährung in verschiedenen Lebensphasen und
Lebenssituationen Lebenssituationen
Inhaltliche Schwerpunkte: Inhaltliche Schwerpunkte:
• Physiologische und stoffwechselphysiologische • Physiologische und stoffwechselphysiologische Zusammenhänge
Zusammenhänge und Lebensbedingungen und Lebensbedingungen
• Nährstoff- und Energiebedarf • Nährstoff- und Energiebedarf
• Prinzipien für die Zusammenstellung einer bedarfsgerechten • Prinzipien für die Zusammenstellung einer bedarfsgerechten Kost
Kost Zeitbedarf: ca. 9 Std. à 60 Minuten
Zeitbedarf: ca. 16 Std. à 60 Minuten
Summe Qualifikationsphase (Q1): ca. 68 StundenQualifikationsphase (Q2) – Grundkurs
Unterrichtsvorhaben I: Unterrichtsvorhaben II:
Thema/Kontext: Gewicht im Griff – Krank durch Diät? Thema/Kontext:Leben mit Diabetes mellitus – Was ist zu
beachten?
Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung: Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung:
• UF1 Wiedergabe • UF1 Wiedergabe
• UF2 Auswahl
• E2 Wahrnehmung und Messung
• E5 Auswertung
• E5 Auswertung
• E7 Arbeits- und Denkweisen • K4 Argumentation
• B1 Kriterien
• K4 Argumentation
• B1 Kriterien
Inhaltsfeld: Pathophysiologie der Ernährung Inhaltsfeld: Pathophysiologie der Ernährung
Inhaltliche Schwerpunkte: Inhaltliche Schwerpunkte:
• Stoffwechselprozesse und Stoffwechselstörungen
• Regulation der Nährstoffaufnahme
• Stoffwechselprozesse und Stoffwechselstörungen • Formen der Fehlernährung
• Krankheitsbilder, Therapie und Prophylaxe
• Formen der Fehlernährung
• Krankheitsbilder, Therapie und Prophylaxe
Zeitbedarf: ca. 12 Std. à 60 Minuten Zeitbedarf: ca. 15 Std. à 60 MinutenUnterrichtsvorhaben III:
Thema/Kontext: Zukunftsfähige Ernährung – Wie ernähre ich mich
in einer globalisierten Welt „richtig“?
Schwerpunkte der Kompetenzentwicklung:
• E4 Untersuchungen und Experimente
• B1 Kriterien
• B2 Entscheidungen
• B3 Werte und Normen
Inhaltsfeld: Ernährungsökologie
Inhaltliche Schwerpunkte:
• Ernährung als mehrdimensionales Phänomen
• Vollwerternährung und alternative Ernährungsformen
• Strategien der Wirtschaft
• Ernährungssituation der Bevölkerung unter verschiedenen regionalen
und globalen Bedingungen
Zeitbedarf: ca. 22 Std. à 60 Minuten
Summe Qualifikationsphase 2 (Q 2) : 49 Stunden
2.1.2 Mögliche Konkretisierung der einzelnen Unterrichtsvorhaben- Einführungsphase
Unterrichtsvorhaben I: Der Energie-und Nährstoffbedarf von Menschen variiert –
Wie kann ich meinen individuellen Bedarf adäquat decken?
Kontext: Energie-und Nährstoffbedarf des Menschen
Inhaltsfeld: Bedarfsgerechte Ernährung
Inhaltliche Schwerpunkte: Schwerpunkte übergeordneter Kompetenzerwartungen:
• Hauptnährstoffe und ihre Funktion Schülerinnen und Schüler können...
• Energie-und Nährstoffbedarf • UF 1 grundlegende ernährungswissenschaftliche Phänomene und
• Zusammenhänge erläutern und dabei Bezüge zu übergeordneten
Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten herstellen.
Zeitbedarf: ca. 15 Std. zu 60 Minuten • UF 2 zur Lösung von Problemen in eingegrenzten Bereichen lösungs-
relevante ernährungswissenschaftliche Konzepte und Definitionen
angemessen auswählen und anwenden.
• UF 4 neue ernährungswissenschaftliche Erfahrungen und Erkenntnisse mit
bestehendem Wissen verknüpfen und modifizieren.
• E5 Daten/Messwerte bezüglich einer Fragestellung interpretieren, daraus
qualitative und quantitative Zusammenhänge ableiten und diese formal
korrekt beschreiben.
Mögliche didaktische Leitfragen / Konkretisierte Empfohlene Lehrmittel, Didaktisch-methodische
Kompetenzerwartungen aus dem Materialien und Anmerkungen und EmpfehlungenSequenzierung inhaltlicher Aspekte Kernlehrplan Unterrichtsmethoden sowie Darstellung der
verbindlichen Absprachen der
Die Schülerinnen und Schüler … Fachkonferenz
Nährstoffe in unseren Lebensmitteln • ordnen die Hauptnährstoffe nach Liste mit Auswahl von Systematisierung von Lebensmitteln
– Warum essen wir? ihren Funktionen im menschlichen Lebensmitteln
Organismus in verschiedene Einbezug von Vorwissen:
• Hauptnährstoffe und ihre Funktion Kategorien ein. (UF 3) Liste mit Kategorien zur
Einordnung von Lebensmitteln SuS als Experten z.B. mit
Vorkenntnissen aus
Lernen durch Lehren Wahlpflichtbereich.
Verbindlicher Beschluss der
Fachkonferenz:
Einbezug von Expertenwissen des
Wahlpflichtbereichs und
Absicherung, dass dieses Wissen
der gesamten Lerngruppe zur
Verfügung steht.
Grund- und Leistungsumsatz – • erläutern die Größen Materialquelle Schulbuch zum GU Auswertung und Berechnung
Kilojoule/Kilokalorie und ihre
Wodurch wird mein Bedeutung im Zusammenhang mit Vergleichende Bewertung
Gesamtenergiebedarf beeinflusst? dem physiologischen Brennwert verschiedener Berechnungsmethoden
der Hauptnährstoffe. (UF1) Tabellen, Texte, Abbildungen zu
• Energieeinheiten • beschreiben Einflussfaktoren auf beeinflussenden Faktoren wie Alter,• Grundumsatz den Grund- und Leistungsumsatz Geschlecht, Körperoberfläche,
• Leistungsumsatz • und ziehen Rückschlüsse auf den Körpermasse
• Gesamtenergiebedarf Energie- und Nährstoffbedarf.
• PAL-Wert (UF1, UF4) Informationsblatt mit:
• berechnen den täglichen
Energiebedarf (u. a. mit Hilfe des - Definition der Größen
physical activity levels (PAL- Kilojoule/Kilokalorie
Wert)). (E2, E6)
- Nomogramme und Formeln zur
Grundumsatzbestimmung
Anleitung zum Umgang mit
graphischen Darstellungen
Ergänzendes Material zu weiteren
beeinflussenden Faktoren
Fallbeispiel(e) zum Leistungsumsatz
und zum täglichen
Gesamtenergiebedarf
Gesamtenergiebedarf – Wie kann • berechnen mit Hilfe von Nährwerttabellen Ermittlung der Energie-und
ich meinen Bedarf adäquat Nährwerttabellen den Energie- Nährstoffbilanz
decken? und Nährstoffgehalt von Anleitung zur Berechnung der
Lebensmitteln und bewerten auf täglichen Energiezufuhr und Auswertung der
• Energie- und Nährstoffgehalt von dieser Grundlage ihre Qualität (u. Nährstoffrelation Tagesleistungskurven mit kritischer
Lebensmitteln a. ihren Beitrag zur Berücksichtigung der
• Energie- und Nährstoffdichte Bedarfsdeckung). (E2, E5, E6) Übersicht zum physiologischen beeinflussenden Faktoren (u.a.
• Nährstoffrelation • argumentieren und beziehen Brennwert der Grundnährstoffe Mahlzeitenfrequenz)
Position zu unterschiedlichen• Mahlzeitenfrequenz Ernährungsweisen mit Blick auf Matrix zur Einschätzung der eigenen
Energie- und Nährstoffbilanzen Tagesleistungsfähigkeit
• Ernährungspyramide (positive, negative
unausgeglichene). (B2) Tageskostpläne am Beispiel von
Jugendlichen und exemplarische Ernährungsberater
Leistungskurven
Ernähungspyramide und
Richtlinien der DGE
Diagnose von Schülerkonzepten: Kartenabfrage von Schülerinnen konzipiert
Leistungsbewertung: Schriftliche Übung, ggf. Klausur zum Energie-und NährstoffbedarfUnterrichtsvorhaben II: Kohlenhydrate sind nicht gleich Kohlenhydrate –
Wie viel Zucker darf es sein?
Kontext: Kohlenhydrate in der Ernährung des Menschen
Inhaltsfeld: Bedarfsgerechte Ernährung
Inhaltliche Schwerpunkte: Schwerpunkte übergeordneter Kompetenzerwartungen:
• Hauptnährstoffe und ihre Funktion Schülerinnen und Schüler können...
• Hauptnährstofflieferanten und ihre Herstellung • UF 3 Sachverhalte und Erkenntnisse in gegebene fachliche Strukturen
und funktionale Beziehungen einordnen.
• Verdauung, Resorption und Speicherung
• E 2 Beobachtungen und Messungen Kriterien geleitet vornehmen,
der Hauptnährstoffe Ergebnisse neutral und objektiv beschreiben und eigene Deutungen
als solche kenntlich machen.
Zeitbedarf: ca. 19 Std. zu 60 Minuten • E 4 einfache Experimente sachgerecht nach dem Prinzip der Variablen-
kontrolle unter Beachtung von Sicherheits- und Hygieneaspekten
planen, durchführen und dabei systematische und zufällige Fehler
reflektieren.
• E 6 Modelle zur Beschreibung, Erklärung und Vorhersage
ernährungsphysiologischer und lebensmitteltechnologischer
Vorgänge verwenden und begründet auswählen.
• K3 Fragestellungen, Untersuchungen, Experimente und Daten unter
Verwendung fachüblicher Darstellungsweisen nach gegebenen
Strukturen dokumentieren und stimmig rekonstruieren.Mögliche didaktische Leitfragen / Konkretisierte Empfohlene Lehrmittel/ Didaktisch-methodische Anmerkungen
Sequenzierung inhaltlicher Kompetenzerwartungen des Materialien/ Methoden und Darstellung der verbindlichen
Aspekte Kernlehrplans Absprachen der Fachkonferenz
Die Schülerinnen und Schüler …
Bedeutung der Kohlenhydrate in • verdeutlichen den komplexen Einzel- und Partnerarbeit Selbstgesteuertes und kooperatives
der Ernährung Molekülaufbau der Lernen
Hauptnährstoffe mit
Funktionsmodellen. (E6, UF 3) Selbstlerneinheit zum Aufbau von SuS als Experten:
• Chemie der Kohlenhydrate • veranschaulichen mit Kohlenhydraten Molekülbaukasten Einbezug von chemischen und
• Kohlenhydratverdauung Strukturmodellen den Bau der biologischen Kenntnissen aus der
Sekundarstufe I bzw. parallel belegten
• Aufgaben der Kohlenhydrate im Hauptnährstoffe und erklären mit Süßkraft, Karamellisieren
ihrer Hilfe besondere Kursen
menschlichen Körper
Eigenschaften. (K3, E 2)
• Kohlenhydratlieferant und seine
Herstellung • weisen Hauptnährstoffe und ihre Sus führen selbstständig das Experiment
Eigenschaften durch Experimente nach Anleitung durch, beobachten und
nach und werten diese aus. (E4, dokumentieren die Ergebnisse und
E5, K 1) werten diese aus.
z. B. Gruppenarbeit:
• recherchieren den Zuckergewinnung
Herstellungsweg eines Besuch der Zuckerfabrik
Kriterienorientierte Recherche zur
Hauptnährstofflieferanten, Berufe in Lebensmittelverarbeitenden
Herstellung eines/ausgewählter
beschreiben den Betrieben
Kohlenhydratlieferanten
lebensmitteltechnologischen Lebensmittelkennzeichnung
Prozess und ziehen Rückschlüsse
auf die Qualität des Endproduktes. Die Art/Form der Präsentation der
(K2, K3) Ergebnisse wird freigestellt,
z. B. Power-Point-Präsentation,
Einzel- und Partnerarbeit: Kurzvortrag, Lernplakat etc.
• erläutern die Vorgänge der Lernaufgabe zur Kohlenhydrat-
Verdauung und Resorption der verdauung
Hauptnährstoffe unter korrekter selbstgesteuertes Lernen mit Schulbuch
ev. Diagnosebogen
Verwendung der Fachbegriffe.
(UF1)Wie viel Zucker darf es sein? • analysieren die Qualität von Fallbeispiel: Bankangestellte – Nährstoffberechnungen
energieliefernden Nährstoffen ballaststoffarme und Anleitung durch die Lehrkraft zu
• Kohlenhydratbedarfsdeckung mithilfe polysaccharidarme Kost im Verbesserungsempfehlungen
ernährungsphysiologischer Vergleich zu vollwertiger Kost
Bewertungskriterien (u. a.
einfache und komplexe Nährwerttabellen
Kohlenhydrate). (E1, E2)
• argumentieren und beziehen
• Ballaststoffe Position zu unterschiedlichen
Ernährungsweisen mit Blick
auf Energie- und
Nährstoffbilanzen (positive,
negative und ausgeglichene).
(B2)
• begründen sach- und
adressatengerecht den
Gesundheitswert von
Ballaststoffträgern (K4) Werbeaussagen und selbstgesteuertes Lernen ev. mit
und beziehen begründet einen Nährwertangaben zu Anleitung durch die Lehrkraft
eigenen Standpunkt zur Ballaststoffpräparaten
Auswahl von Lebensmitteln.
(B1)
• bewerten Informationsgehalt
von Nährwertangaben Gesundheitsberater,
Werbeaussagen und Food design, Food-Werbung
(Kohlenhydrate) auf Nährwertangaben zu
Verpackungen und zeigen an zuckerhaltigen Lebensmitteln
Beispielen Konflikte
(versteckte Zucker) zwischen
wirtschaftlichem Interesse und
tatsächlichem Gesundheitswert
auf. (B3)Diagnose von Schülerkompetenzen/Leistungsbewertung: Diagnosebogen mit Ich-Kompetenzen, SÜ z.B. Optimierungsaufgabe; Klausur
Unterrichtsvorhaben III: Ohne Fette geht es nicht – Sind Fette besser als ihr Ruf?
Kontext: Fett in der Ernährung des Menschen
Inhaltsfeld: Bedarfsgerechte Ernährung
Inhaltliche Schwerpunkte: Schwerpunkte übergeordneter Kompetenzerwartungen:
• Hauptnährstoffe und ihre Funktion Schülerinnen und Schüler können...
• Verdauung, Resorption und Speicherung • E 3 zur Klärung ernährungswissenschaftlicher Fragestellungen begründete
Hypothesen formulieren und Möglichkeiten zu ihrer Überprüfung
der Hauptnährstoffe
Angeben.
• K 2 ernährungswissenschaftliche Fragestellungen in vorgegebenen
Zeitbedarf: ca. 16 Std. zu 60 Minuten Zusammenhängen Kriterien geleitet mithilfe von Fachbüchern und
anderen Quellen bearbeiten.
• K 3 Sachverhalte, Arbeitsergebnisse und Erkenntnisse adressatengerecht
sowie formal und fachlich korrekt schriftlich und mündlich
präsentieren.
• B1 bei Entscheidungen in ernährungswissenschaftlichen
Zusammenhängen Bewertungskriterien angeben und begründet
gewichtenMögliche didaktische Leitfragen / Konkretisierte Empfohlene Lehrmittel, Didaktisch-methodische
Sequenzierung inhaltlicher Kompetenzerwartungen aus dem Materialien und Anmerkungen und Empfehlungen
Aspekte Kernlehrplan Unterrichtsmethoden sowie Darstellung der
verbindlichen Absprachen der
Die Schülerinnen und Schüler … Fachkonferenz
Fett gleich Fett ? • veranschaulichen mit Einzel- und Partnerarbeit Aktivierung von Vorwissen
Strukturmodellen den Bau der Schmelzpunkt, Iod-Zahl, Transparenz schaffen
Chemie der Fette Hauptnährstoffe und erklären mit ihrer Fetthärtung Selbstgesteuertes und kooperatives
• Fettverdauung Hilfe besondere Eigenschaften. (K3) Lernen
• Aufgaben der Fette im Verbindlicher Beschluss der
menschlichen Körper Fachkonferenz:
Sch.-Referat „Trans-Fettsäuren“
• dokumentieren Gruppenarbeit: Sus führen selbstständig das
Untersuchungsergebnisse (u.a. aus Experiment zur Emulsion Experiment nach Anleitung durch,
Experimenten mit Lebensmitteln) in beobachten und dokumentieren die
präziser Sprache und mit ge-eigneten Ergebnisse und werten diese aus.
Darstellungsformen (K1)
• erläutern die Vorgänge der Einzel- und Partnerarbeit: Selbstgesteuertes Lernen mit Buch
Verdauung und Resorption der Lernaufgabe zur Fettverdauung und Film
Hauptnährstoffe unter korrekter
Verwendung der Fachbegriffe. (UF1)
• erläutern die anatomischen und
cytologischen Strukturen innerhalb
des Verdauungssystems (u.a.
Darmmukosazelle, Micellen und
Chylomikronen) (UF1) Informationsmaterial Selbstgesteuertes Lernen
• ordnen die Hauptnährstoffe nach
Funktionen im menschl. Organismusin versch. Kategorien ein (UF3)
Ohne Fette geht es nicht ? • analysieren die Qualität von Kriterien orientierte Recherche Die Art/Form der Präsentation der
energieliefernden Nährstoffen zur Herstellung Ergebnisse wird freigestellt,
mithilfe ernährungsphysiologischer eines/ausgewählter z. B. Power-Point-Präsentation,
Bewertungskriterien (u. a. Fettlieferanten Kurzvortrag, Lernplakat etc.
biologische Wertigkeit der Proteine,
Fettsäuremuster, einfache und Verbindlicher Beschluss der
komplexe Kohlenhydrate). (E1, E2) Fachkonferenz:
• begründen sach- und Werbeaussagen und Orientierung an den vom Fach
adressatengerecht den Nährwertangaben zu Deutsch erstellten Kriterien als
Gesundheitswert eines Fischölkapseln Grundlage
Hauptnährstoffträgers. (K4) Berufe in der
• bewerten Kriterien orientiert Lebensmittelindustrie
Hauptnährstoffträger und Mahlzeiten
(u. a. Genuss- und Gesundheitswert, Ernährungsberatung
ökonomischer Wert sowie Hilfekarten
Nachhaltigkeit) und beziehen - Argumentationsstruktur Verbindlicher Beschluss der
begründet einen eigenen Standpunkt (These, Argument, Beispiel) Fachkonferenz:
zur Auswahl von Lebensmitteln. mit Anwendungsbezug Simulation einer
(B1) - Gütekriterien (Schlüssigkeit, Ernährungsberatungssituation einer
Vollständigkeit, sachliche Jugendlichen/ eines Jugendlichen
Richtigkeit) (Wie kann man bei der
- Aufbau einer Pro- und Lebensmittelauswahl und
Kontraargumentation -zubereitung Fett einsparen?)Unterrichtsvorhaben IV: Auf die Qualität kommt es an –
Welche Proteinlieferanten sind für mich geeignet?
Kontext: Proteine in der Ernährung des Menschen
Inhaltsfeld: Bedarfsgerechte Ernährung
Inhaltliche Schwerpunkte: Schwerpunkte übergeordneter Kompetenzerwartungen:
• Hauptnährstoffe und ihre Funktion Schülerinnen und Schüler können...
• E 1 in vorgegebenen Situationen ernährungswissenschaftliche Probleme in
Teilprobleme zerlegen und dazu fachadäquate Fragestellungen
formulieren.
Zeitbedarf: ca. 18 Std. zu 60 Minuten • K 3 Sachverhalte, Arbeitsergebnisse und Erkenntnisse adressatengerecht
sowie formal und fachlich korrekt schriftlich und mündlich präsentieren.
• K 4 ernährungswissenschaftliche Aussagen und Behauptungen mit sachlich
fundierten und überzeugenden Argumenten begründen bzw. kritisieren.
• B 1 bei Entscheidungen in ernährungswissenschaftlichen Zusammenhängen
Bewertungskriterien angeben und begründet gewichten.
• B 2 für Entscheidungen in ernährungswissenschaftlichen Zusammenhängen
Kriterien geleitet Argumente abwägen und einen begründeten
Standpunkt beziehen.
• B3 Konflikte sowie mögliche Konfliktlösungen bei ernährungswissenschaft-
lichen Entscheidungen darstellen und dabei u.a. ethische Maßstäbe
berücksichtigen.Mögliche didaktische Konkretisierte Empfohlene Lehrmittel, Didaktisch-methodische
Leitfragen / Sequenzierung Kompetenzerwartungen aus dem Materialien und Anmerkungen und Empfehlungen
inhaltlicher Aspekte Kernlehrplan Unterrichtsmethoden sowie Darstellung der
verbindlichen Absprachen der
Die Schülerinnen und Schüler … Fachkonferenz
Bedeutung der Proteine in • verdeutlichen den komplexen Agenda Aktivierung von Vorwissen
der menschlichen Ernährung Molekülaufbau der Hauptnährstoffe Transparenz schaffen
- Kann ich auf Proteine in mit Strukturmodellen E6
meiner Ernährung • veranschaulichen mit Einzel- und Partnerarbeit Selbstgesteuertes und kooperatives
verzichten? Strukturmodellen den Bau der Lernen
Hauptnährstoffe und erklären mit
• Chemie der Proteine ihrer Hilfe besondere Eigenschaften. Selbstlerneinheit zum Aufbau SuS als Experten:
• Denaturierung der Proteine (K3) und zu Aufgaben von Proteinen Einbezug von chemischen und
• Proteinverdauung Frage- und Antwortkarten biologischen Kenntnissen aus der
• Aufgaben der Proteine im • weisen Hauptnährstoffe und ihre Sekundarstufe I bzw. parallel
menschlichen Körper Eigenschaften durch Experimente belegten Kursen
• Proteinlieferant und seine nach und werten diese aus. (E4, E5) Gruppenarbeit:
Herstellung • erläutern die Vorgänge der Experiment zur Denaturierung Sus führen selbstständig das
Verdauung und Resorption der von ausgewählten Proteinen Experiment nach Anleitung durch,
Hauptnährstoffe unter korrekter beobachten und dokumentieren die
Verwendung der Fachbegriffe. Einzel- und Partnerarbeit: Ergebnisse und werten diese aus.
(UF1) Lernaufgabe zur
Proteinverdauung Die Art/Form der Präsentation der
Ergebnisse wird freigestellt,
z. B. Power-Point-Präsentation,
Kurzvortrag, Lernplakat etc.
Selbstgesteuertes Lernen mit
Hilfekarten• analysieren die Qualität von Fallbeispiele Konflikt- und
• Biologische Wertigkeit und energieliefernden Nährstoffen zweier Jugendlicher – Entscheidungssituation:
Ergänzungswirkung mithilfe ernährungsphysiologischer vegetarische Mahlzeit im Vegetarische kontra fleischhaltige
• Proteinbedarfsdeckung Bewertungskriterien (u. a. Vergleich zur Mischkost Mahlzeit für eine Jugendliche/einen
biologische Wertigkeit der Jugendlichen
Proteine). (E1, E2) Informationsmaterial zum
• argumentieren und beziehen Proteinbedarf und zum Anleitung durch die Lehrkraft zur
Position zu unterschiedlichen prozentualen Gehalt essenzieller Ermittlung der biologischen
Ernährungsweisen mit Blick auf Aminosäuren in verschiedenen Wertigkeit und des
Energie- und Nährstoffbilanzen Lebensmitteln Ergänzungswertes mit
(positive, negative und Kriterien Arbeitsaufgabe
ausgeglichene). (B2) • Argumentationsstruktur
• begründen sach- und (These, Argument, Verbindlicher Beschluss der
adressatengerecht den Beispiel) mit Fachkonferenz:
Gesundheitswert eines Anwendungsbezug Orientierung an den vom Fach
Hauptnährstoffträgers. (K4) - Gütekriterien Deutsch erstellten Kriterien als
• bewerten Kriterien orientiert (Schlüssigkeit, Grundlage
Hauptnährstoffträger und Vollständigkeit,
Mahlzeiten (u. a. Genuss- und sachliche Richtigkeit)
Gesundheitswert, ökonomischer - Aufbau einer Pro- und Verbindlicher Beschluss der
Wert sowie Nachhaltigkeit) und Kontraargumentation Fachkonferenz:
beziehen begründet einen eigenen Simulation einer
Standpunkt zur Auswahl von Werbeaussagen und Ernährungsberatungssituation
Lebensmitteln. (B1) Nährwertangaben zu einem einer Jugendlichen/ eines
• bewerten Werbeaussagen zu Muskelaufbaupräparat Jugendlichen
Hauptnährstoffträgern und zeigen an
Beispielen Konflikte zwischen Gesprächsleitfaden Die Art/Form der Präsentation der
wirtschaftlichem Interesse und Kriterien orientierter Ergebnisse wird freigestellt,
tatsächlichem Gesundheitswert auf. Beobachtungsbogen für z. B. Power-Point-Präsentation,
(B3) Beratungssituationen Kurzvortrag, Lernplakat etc.- Qualifikationsphase 1
Unterrichtsvorhaben I:
Thema/Kontext: Bedeutung von Wasser, Mineralstoffen und Vitaminen im Stoffwechsel des Menschen – Welche Folgen hat eine Unter- und Überversorgung
an ausgewählten Mineralstoffen, Vitamin D und C sowie Wasser?
Inhaltsfeld: Physiologie der Ernährung
Inhaltliche Schwerpunkte: Schwerpunkte übergeordneter Kompetenzerwartungen:
• Bedeutung des Wassers Die Schülerinnen und Schüler können …
• Vitamine und Mineralstoffe • UF1 Wiedergabe: ernährungswissenschaftliche Phänomene und
• Nährstoffträger Zusammenhänge unter Verwendung von Theorien, übergeordneten
• Hormonelle Regulation Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten beschreiben und erläutern.
• Lebensmittelunverträglichkeiten • UF3 Systematisierung: Sachverhalte und Erkenntnisse in gegebene
fachliche Strukturen und funktionale Beziehungen einordnen.
• UF4 Vernetzung: Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen
Zeitbedarf: 27 Stunden a 60 Minuten physiologischen und technischen Vorgängen auf der Grundlage eines
vernetzten ernährungswissenschaftlichen Wissens erschließen und
aufzeigen.
• E1 Probleme und Fragestellungen: in vorgegebenen Situationen
ernährungswissenschaftliche Probleme in Teilprobleme zerlegen und
dazu fachadäquate Fragestellungen formulieren.
• E5 Auswertung: Daten/Messwerte bezüglich einer Fragestellung
interpretieren, daraus qualitative und quantitative Zusammenhänge
ableiten und diese formal korrekt beschreiben.
• K3 Präsentation: Sachverhalte, Arbeitsergebnisse und Erkenntnisse
adressatengerecht sowie formal und fachlich korrekt schriftlich und
mündlich präsentieren.Mögliche didaktische Konkretisierte Kompetenzerwartungen aus dem Empfohlene Lehrmittel, Didaktisch-methodische
Leitfragen / Sequenzierung Kernlehrplan Materialien und Anmerkungen und Empfehlungen
inhaltlicher Aspekte Unterrichtsmethoden sowie Darstellung der verbindlichen
Die Schülerinnen und Schüler … Absprachen der Fachkonferenz
Ohne Wasser kein Leben? • erläutern die Bedeutung von Wasser im Fallbeispiele für Schülerzentrierte Erarbeitung des
menschlichen Körper Wasservergiftung und – Wasserhaushalts anhand von
(u. a. bei osmotischen Prozessen), mangel Materialien
Probleme der Dehydrierung und
Hyperhydratation (UF 1) Partnerarbeit
• beschreiben Einflussfaktoren auf den
Wasserbedarf und leiten Empfehlungen für die
Höhe der Zufuhr ab (E 1)
Welche Getränke/Lebensmittel • systematisieren Lebensmittel nach ihrem Gehalt Marktanalyse Getränke im Trend
löschen Durst optimal? an Wasser sowie resorptionsfördernde und
hemmende Lebensmittel-inhaltsstoffen ( u. a. Marktforschung
isotone Getränke (UF 3)
• erläutern die Reglerfunktion der Vitamine und
Starke Knochen durch Calcium Mineralstoffe im menschlichen Organismus (UF SuS recherchieren nach den folgenden
und Vitamin D 1) Aspekten: Funktion, Vorkommen,
• systematisieren Lebensmittel nach ihrem Gehalt Bedarf und Bedarfsdeckung,
an ausgewählten Mineralstoffen und Vitaminen Resorption und Stoffwechsel,
sowie resorptionsfördernde und hemmende Versorgung, Antivitamine, Hypo-,
Fruchtzwerge – so wertvoll wie Lebensmittelinhaltsstoffen (UF3) Hyper- und Avitaminose,
ein kleines Steak? Vitaminverluste bei der Verarbeitung.
• erläutern in Grundzügen die spezifischen
Aufgaben der am Stoffwechsel beteiligten
Organsysteme und das funktionelle
Zusammenwirken dieser Organsysteme (UF 1,4)
• werten statistische Daten zur aktuellen Vitamin-
und Mineralstoffversorgung im Vergleich zu den
D-A-CH Referenzwerten aus. (E 5)
Die Art/Form der Präsentation kann• führen gesundheitliche Probleme auf Vitamin- z.B. über eine Power-Point-
Eisen und Vit C – gemeinsam und Mineralstoffmangel als Folge negativer Präsentation, einen Flyer, etc. erfolgen.
ein starkes Team Nährstoffbilanzen zurück und werten
entsprechende Untersuchungsdaten aus. (E 1,E 5)
• planen und bewerten Mahlzeiten unter dem
Aspekt der Bioverfüg-barkeit von ausgewählten
Mineralstoffen und Vitaminen (E 4)
• recherchieren selbständig begriffliche
Zusammenhänge in ausgewählter Fachliteratur
und werten kriterienorientiert ihre Ergebnisse
aus. (u. A zur Genese und Häufigkeit von Hypo-, Steckbrief
Folsäure - kleine Menge große Hyper- und Avitaminose) (K 2)
Wirkung • beschreiben unterschiedliche Perspektiven zum
Konsum von Nahrungs-ergänzungsmitteln,
bewerten deren Effektivität und Risiken aus
fachwissenschaftlicher Sicht und beziehen eine Flyer zur Notwendigkeit von Folsäure
eigene Position dazu (B 1, B 2) in verschiedenen Lebenssituationen,
• beschreiben und präsentieren Resorption und wie Schwangerschaft, Alter, Wachstum
Stoffwechsel ausgewählter Mineralstoffe und
Vitamine in unterschiedlichen fachspezifischen
Darstellungsformen (K 3)
Diagnose von Schülerkompetenzen: kriteriengestützter Vortrag zu Arbeitsergebnissen als Präsentationsaufgabe
Leistungsbewertung: Auswertung eines Fallbeispiels/Präparates als Bewertungsaufgabe oder ggf. Klausur
Unterrichtsvorhaben II:
Thema/Kontext: B-Vitamine – Welche Rolle spielen sie im Stoffwechsel des Menschen?
Inhaltsfeld: Physiologie der Ernährung
Inhaltliche Schwerpunkte: Schwerpunkte übergeordneter Kompetenzerwartungen:
• Stoffwechsel der Hauptnährstoffe und Vitamine Die Schülerinnen und Schüler können …• Vitamine, Antivitamine und Mineralstoffe • K1 Untersuchungen, Experimente und theoretische
• Nährstoffträger Überlegungen selbstständig dokumentieren und dabei
fachübliche Darstellungen verwenden.
Zeitbedarf: 15 Stunden a 60 Minuten • UF4 Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen
physiologischen und technischen Vorgängen auf der Grundlage
eines vernetzten ernährungswissenschaftlichen Wissens
erschließen und aufzeigen.
• E5 Daten/Messwerte qualitativ und quantitative im Hinblick auf
Zusammenhänge, Regeln oder auch zu formulierende
Gesetzmäßigkeiten analysieren und Ergebnisse
verallgemeinern.
• E6 Modelle entwickeln sowie theoretische Modelle
situationsgerecht anwenden, um ernährungswissenschaftlich-
technische und physiologische Prozesse zu erklären oder
vorherzusagen (u. a. über Simulationen, Modellierungen).
Mögliche didaktische Konkretisierte Kompetenz-erwartungen aus Empfohlene Lehrmittel, Didaktisch-methodische An-
Leitfragen/ Sequenzierung dem KLP Materialien und merkungen und Empfehlungen
inhaltlicher Aspekte Die Schülerinnen und Schüler ….. Unterrichtsmethoden sowie Darstellung der
verbindlichen Absprachen der
Fachkonferenz
Coenzyme im • dokumentieren nachvollziehbar Versuch oder Film mit Reaktion unter enormer
Kohlenhydratstoffwechsel Untersuchungsergebnisse zur Enzymatik Gummibärchen in (sichtbarer) Energiefreisetzung
– Fit durch B-Vitamine? z. B. Abbau von Stärke, Amylase in Kaliumchlorat (siehe Skript mit Hilfe chemischer
Waschmitteln aus Lehrerfortbildung Katalysatoren.
• B-Vitamine als • erläutern die Reglerfunktion der „Methodische Zugänge zumBestandteil von Vitamine und Mineralstoffe im Stoffwechselgeschehen“) Ableitbare Fragestellungen:
Coenzymen im menschlichen Organismus. (UF1) • Wie geschieht die
Stoffwechsel: • beschreiben die anabolen und katabolen Einzel-/Partner- und Energiefreisetzung im
− Funktion Stoffwechselwege der Hauptnährstoffe Kleingruppenarbeit Körper? (schrittweise?)
− Vorkommen im Hinblick auf die zentrale Stellung
• Wie wird die Energie
− Bedarf und des Citratzyklus im intermediären Skript aus
Stoffwechsel. (UF 4) Lehrerfortbildung umgewandelt?
Bedarfsdeckung
− Resorption und • führen gesundheitliche Probleme auf „Methodische Zugänge zum • Wofür wird die Energie
Stoffwechsel Vitamin- [und Mineralstoff]mangel als Stoffwechselgeschehen“ genutzt?
Folge negativer Nährstoffbilanzen Film und AB: Dissimilation
Schülerzentrierte Erarbeitung des
zurück und werten entsprechende Stoffwechsels anhand von
Untersuchungsdaten dazu aus. (E1, E5) Übersicht zu B-Vitaminen als
Materialien:
• Antivitamine • beschreiben und präsentieren Resorption Coenzyme im Stoffwechsel
- Abschnittsweise Erarbeitung
und Stoffwechsel [der Hauptnährstoffe des Kohlenhydrat-
sowie] ausgewählter Vitamine [und Recherche in Einzel-
stoffwechsels
Mineralstoffe] in unterschiedlichen /Partner- oder
- Zuordnung der
fachspezifischen Darstellungsformen. Kleingruppenarbeit
Coenzymfunktionen zu
(K3) bestimmten Schritten im
Kohlenhydratstoffwechsel
• Hypo-, Hyper- und • werten Untersuchungsdaten zum SuS recherchieren nach den
Avitaminose [unterschiedlichen] Energiegewinn aus folgenden Aspekten: Funktion,
[anaeroben und] aeroben Prozessen Vorkommen, Bedarf und
unter Einbeziehung der Rolle der Bedarfsdeckung, Resorption und
Energie- und Reduktionsäquivalente Stoffwechsel, Versorgung,
• Vitaminverluste aus. (E5) Antivitamine, Hypo-, Hyper- und
• recherchieren selbstständig begriffliche Avitaminose, Vitaminverluste bei
Zusammenhänge in ausgewählter der Verarbeitung.
Fachliteratur und werten Fachjournalismus
kriterienorientiert ihre Ergebnisse aus Die Art/Form der Präsentation
(u.a. zur Genese und Häufigkeit von kann z.B. über eine Power-Point-Hypo-, Hyper- und Avitaminosen.(K2) Präsentation, einen Flyer, etc.
erfolgen.
Diagnose von Schülerkompetenzen: Erstellung eines Partnerinterviews durch die Schülerinnen und Schüler, Kartenabfrage, Kriterien geleitete
Bewertung der Versuchsplanung
Leistungsbewertung: Schriftliche Übung, ggf. Klausur
Unterrichtsvorhaben III:
Thema/Kontext: Ernährung und Sport – Bessere Leistung durch bedarfsadäquate Ernährung?
Inhaltsfeld: Ernährung in verschiedenen Lebensphasen und Lebenssituationen
Inhaltliche Schwerpunkte: Schwerpunkte übergeordneter Kompetenzerwartungen:
Die Schülerinnen und Schüler können …
• Physiologische und stoffwechselphysiologische Zusammenhänge und • UF4 Vernetzung: neue ernährungswissenschaftlicheLebensbedingungen Erfahrungen und Erkenntnisse mit bestehendem Wissen
• Nährstoff- und Energiebedarf verknüpfen und modifizieren.
• Prinzipien für die Zusammenstellung einer bedarfsgerechten Kost • E5 Auswertung: Daten/Messwerte bezüglich einer
Fragestellung interpretieren, daraus qualitative und
Zeitbedarf: ca. 16 Std a 60 Minuten quantitative Zusammenhänge ableiten und diese formal
korrekt beschreiben.
• K4 Argumentation: Daten/Messwerte bezüglich einer
Fragestellung interpretieren, daraus qualitative und
quantitative Zusammenhänge ableiten und diese formal
korrekt beschreiben.
• B2 Entscheidungen: für Entscheidungen in ernährungswissen-
schaftlichen Zusammenhängen kriteriengeleitet Argumente
abwägen und einen begründeten Standpunkt beziehen.
Mögliche didaktische Leitfragen/ Konkretisierte Kompetenz-erwartungen aus Empfohlene Lehrmittel, Didaktisch-methodische An-
Sequenzierung inhaltlicher dem KLP Materialien und merkungen und Empfehlungen
Aspekte Die Schülerinnen und Schüler ….. Unterrichtsmethoden sowie Darstellung der verbindlichen
Absprachen der Fachkonferenz
• erklären Unterschiede im Gesamtenergie- Bezug zum Sportunterricht:
Bessere Leistung durch und -nährstoffbedarf von verschiedenen
Ernährung ? Altersstufen und Berufsgruppen sowie in Gesundheitliche Auswirkungen
speziellen Lebenssituationen unter von Ausdauersport
Einteilung der Sportarten nach Einbeziehung der D-A-CH-Referenzwerte
Belastung und Dauer und der Besonderheiten im Stoffwechsel(UF1, UF2),
• benennen Kriterien zur Beurteilung von Der Mann mit dem
Tageskostplänen im Hinblick auf die Hammer
Bedarfsdeckung (UF1, UF4).
Hungerrast und RQ • analysieren den Lebensmittelverzehr mit Auswertung von Laktat-
epidemiologischen Methoden und werten messungen
die Ergebnisse im Hinblick auf den
Ernährungsstatus aus, auch mit digitalen
ATP-Gewinnung bei Werkzeugen (E4, E5), Fitnesstrainier als
aerobe und anaerober Be- • bestimmen den täglichen Energiebedarf Ernährungscoach
lastung mit Hilfe des physical activity levels
(PAL-Wert) und werten den täglichen
Kraftsportler Energieumsatz bei unterschiedlichen Anknüpfung an eigene
Masse- Definitionsphase Berufs- und Freizeittätigkeiten von Erfahrungen im Fitnessstudio
Referenzpersonen aus (E2, E5),
Säure-Basen-Haushalt • werten Menüpläne nach Qualitätskriterien AB: Ernährung und
aus und ziehen Rückschlüsse auf die Säure-Basen-Haushalt
Bedarfsdeckung ausgewählter
Probandinnen und Probanden (E5).
• bewerten Konfliktsituationen u.a .von
Freizeit- oder Leistungssportlerinnen und
-sportlernbei der Optimierung der
Leistungsfähigkeit durch sportartgerechte
Kostformen sowie leistungssteigernde
Substanzen und beziehen Berufe aus dem Bereich Food-
kriterienorientiert eine fachlich fundierte Design, neuartige Lebensmittel
Position (B1, B2, B3), und Werbung für diese Produkte
• bewerten, argumentieren und beziehen
Mögliche Beispiele: Position im Hinblick auf den Lebensmittelkennzeichnung als
NEM wie Carnitin, gesundheitlichen Wert von Werbeaussagen und VerbraucherinformationProteinpräparate, Sport- Nahrungsergänzungsmitteln und Nährwertangaben zu
Getränke funktionellen Lebensmitteln in der einem Fachjournalismus in Primär- und
Ernährung verschiedener Altersstufen und Muskelaufbaupräparat Sekundärliteratur
Berufsgruppen (B1, B2), und
• verwenden Fallbeispiele zur Sportlergetränken
Verdeutlichung
ernährungsphysiologischer schülerzentrierte Analysen und
Zusammenhänge (u.a. zum Einfluss der Vorträge zu einzelnen Präparaten
verschiedenen energieliefernden Substrate oder Produkten
auf die Leistung und zur Begründung
einer sinnvollen Nährstoffrelation) (K3),
• recherchieren für eine ausgewählte
Personengruppe bezogen auf z.B. Alter,
Beruf oder spezielle Lebenssituation den
Energie- und Nährstoffbedarf und nutzen
die Ergebnisse für Problemlösungen (K2,
K4),
Diagnose: Referate zu “Sportler-Produkten“, Ernährungsberatungen in Fitness-Studios
Leistungsbewertung: Schriftliche Übung, ggf. Klausur
Unterrichtsvorhaben IV:
Thema/Kontext: Fit im Alter – Besser leben durch eine bedarfsadäquate Ernährung?
Inhaltsfeld: Ernährung in verschiedenen Lebensphasen und Lebenssituationen
Inhaltliche Schwerpunkte: Schwerpunkte übergeordneter Kompetenzerwartungen:
• Physiologische und stoffwechselphysiologische Die Schülerinnen und Schüler können …
Zusammenhänge und Lebensbedingungen • K1 Untersuchungen, Experimente und theoretische Überlegungen
• Nährstoff- und Energiebedarf selbstständig dokumentieren und dabei fachübliche Darstellungen
• Prinzipien für die Zusammenstellung einer bedarfsgerechten verwenden.Kost • K2 zu ernährungswissenschaftlichen Fragestellungen relevante
Informationen in verschiedenen Quellen, auch in ausgewählten
Zeitbedarf: Ca 9 Stunden zu 60 Min. wissenschaftlichen Publikationen, recherchieren, auswerten und für
Problemlösungen nutzen.
• K3 ernährungswissenschaftliche Sachverhalte, eigene und fremde
Arbeitsergebnisse und Überlegungen unter Verwendung
angemessener Medien und Darstellungsformen adressatengerecht
präsentieren.
• K4 sich über ernährungswissenschaftliche Aussagen, Sachverhalte
und Erkenntnisse kritisch-konstruktiv austauschen und dabei
Behauptungen oder Beurteilungen durch Argumente belegen bzw.
widerlegen.
• B1 fachliche, wirtschaftlich-politische und ethische Maßstäbe bei
Bewertungen von ernährungswissenschaftlichen Sachverhalten
anhand von Beispielen unterscheiden und angeben.
Mögliche didaktische Konkretisierte Kompetenz- Empfohlene Lehrmittel, Didaktisch-methodische An-
Leitfragen/ Sequenzierung erwartungen aus dem KLP Materialien und merkungen und Empfehlungen
inhaltlicher Aspekte Die Schülerinnen und Schüler ….. Unterrichtsmethoden sowie Darstellung der
verbindlichen Absprachen der
Fachkonferenz
Gesund älter werden – Wie • erklären Unterschiede im Kollage, Film oder Recherche zur Ernährung im
können sich ältere Menschen Gesamtenergie- und Zeitungsausschnitte als Alter:
bedarfsadäquat ernähren? Nährstoffbedarf von Einstieg zu unterschiedlichen • Ist- und Soll-Situation im
• Altersbegriff verschiedenen Altersstufen und Lebensphasen eines Menschen Vergleich
• Energie- und Berufsgruppen sowie in • Stellungnahme
Nährstoffbedarf speziellen Lebenssituationen Gruppenarbeit (arbeitsteilig):Sie können auch lesen