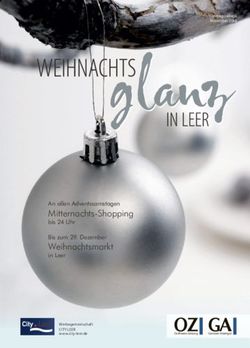Europäische Forschungsreisen um die Welt oder die Ausweitung des Wissens - De Gruyter
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Europäische Forschungsreisen um die Welt oder
die Ausweitung des Wissens
Das europäische 18. Jahrhundert strahlt gleichwohl auch im Glanze seiner zahl-
reichen Forschungsreisen und damit der empirischen Annäherung an die au-
ßereuropäische Welt in dem Sinne, in welchem Jean-Jacques Rousseau vom
„philosophe voyageur“ sprach. Die europäische Expansion des Aufklärungs-
zeitalters schreitet im Rhythmus dieser Forschungsreisen voran, die vor allem
von Briten und Franzosen, den Hauptakteuren der zweiten Phase beschleunig-
ter Globalisierung, unternommen wurden. Lassen Sie mich jedoch mit einem
Nachzügler in dieser Mächtekonstellation beginnen, mit Russland, an dessen wis-
senschaftlichen wie militärischen Expeditionen auch zahlreiche deutschsprachige
Wissenschaftler, Künstler und Kapitäne beteiligt waren.
Die reiseliterarische Schilderung der ersten Annäherung von Georg Hein-
rich Freiherr von Langsdorff an die Küsten Brasiliens steht von Beginn an im
Zeichen der tropischen Fülle. So lesen wir im ersten Band seiner erstmals im
Jahr 1812 in Frankfurt am Main erschienenen Bemerkungen auf einer Reise um
die Welt in den Jahren 1803 bis 18071 zunächst von einem am 18. Dezember 1803
durchgeführten Versuch, sich der „Insel St. Catharina“2 und damit auf den Spu-
ren von Bougainville und Pernety der brasilianischen Küste zu nähern: „und
schon bewillkommnten [sic] uns, in einer Entfernung von 60 bis 80 Seemeilen,
mehrere Schmetterlinge, die wahrscheinlich durch einen starken Wind dem
Lande entrissen waren.“3 Doch diese erste Begegnung mit ungeheuer großen
und bunten, vielfarbigen Bewohnern der Neuen Welt muss aufgrund eines auf-
ziehenden schweren Sturms – der gleichsam für die andere, gefährliche Seite
der Tropen, also die Falle der Tropenwelt, steht – zunächst abgebrochen wer-
den, bevor dann am 21. Dezember endlich die erste Berührung mit Brasilien
erfolgt:
Kaum konnte ich, belebt von so manchen schönen Bildern meiner Einbildungskraft, die
wiederkehrende Sonne erwarten, um die nahe paradiesische Gegend zu besuchen. Meine
Ideen waren, ich gestehe es, groß und gespannt, dem ungeachtet übertraf nun, je mehr
ich mich dem Lande näherte, die Wirklichkeit meine Erwartung.
1 Bemerkungen auf einer Reise um die Welt in den Jahren 1803 bis 1807 von G.H. von
Langsdorff, Kaiserlich-Rissischer Hofrath, Ritter des St. Annen-Ordens zweiter Classe, Mitglied
mehrerer Akademien und gelehrten Gesellschaften. Mit acht und zwanzig Kupfern und einem
Musikblatt. 2 Bde. Frankfurt am Main: Im Verlag bey Friedrich Eilmans 1812.
2 Ebda., S. 27.
3 Ebda.
Open Access. © 2021 Ottmar Ette, publiziert von De Gruyter. Dieses Werk ist lizenziert unter
einer Creative Commons Namensnennung - Nicht-kommerziell - Keine Bearbeitung 4.0 International Lizenz.
https://doi.org/10.1515/9783110703467-014466 Europäische Forschungsreisen um die Welt oder die Ausweitung des Wissens
Die an Farben, Größe, Bau und Verschiedenheit mannichfaltigen Blüthen, hauchten in die
Atmosphäre eine Mischung von Wohlgeruch, die mit jedem Athemzug den Körper stärkte
und das Gemüth erheiterte.
Große Schmetterlinge, die ich bisher nur als Seltenheiten in unsern europäischen Ca-
binetten sah, umflatterten viele, noch nie oder in unseren Gewächshäusern nur als Krüppel
gesehene und hier in üppigem Wuchs blühende Prachtpflanzen.– Die goldblitzenden Colib-
ri’s umschwirrten die honigreichen Blumen der Bananenwälder und wiederhallender Ge-
sang noch nie gehörter Vögel ertönte in den wasserreichen Thälern, und entzückte Herz
und Ohr.– Dunkele, überschattete Wege schlängelten sich von einer friedlichen Hütte zur
andern, und übertrafen an Schönheit und Anmuth, an Abwechslung und Einfalt jede noch
so gekünstelte Anlage unserer europäischen Gärten.– Alles was ich um mich her sah, setzte
mich durch seine Neuheit in Erstaunen und machte einen Eindruck, der sich nur fühlen
aber nicht beschreiben läßt.–4
Sagte ich gerade, dass diese europäischen Forschungsreisen die empirisch ba-
sierte Annäherung an das ‚Andere‘ darstellten, an die Gestade der Neuen Welt?
Haben wir es hier aber nicht mit der Beschreibung einer tropischen Idylle,
eines locus amoenus zu tun, für dessen Darlegung es wohl kaum der Mühe wert
gewesen wäre, eine so weite und beschwerliche Reise zu unternehmen? Denn
steht die erste physische Annäherung dieses Europäers an die Wunder eines
tropischen Amerika nicht im Zeichen all dessen, was er zuvor über diese ameri-
kanischen Tropen gelesen hatte?
In dieser kurzen, aber ästhetisch wie kulturtheoretisch wohldurchdachten
Passage sind all jene Gemeinplätze und Topoi versammelt, die seit der ersten
Annäherung des Christoph Kolumbus an die Inselwelt der Antillen die Wahr-
nehmungs- und Darstellungsmuster von Europäern prägen, welche die unter-
schiedlichsten Phänomene der für sie ‚neuen‘ Welt im Zeichen des Reichtums
und der Überfülle erstmals wahrnehmen. In einer Art der Überbietungsstrategie
setzt sich der amerikanische locus amoenus an die Stelle des weitaus kargeren
europäischen ‚Originals‘, ohne freilich im Geringsten die Darstellungsmodi der
abendländischen Antike zu verlassen.
Die Fülle der Tropenwelt übersteigt alles, was die europäischen Gärten zu
bieten vermögen: Die tropische Natur erweist sich jeder künstlichen Nachahmung
in den Botanischen Gärten und Orangerien Europas als überlegen. Reichtum und
Exuberanz prägen alles, was sich dem ankommenden Europäer darbietet. Alle
Sinne des Reisenden sind überwältigt, befindet er sich doch nun in einem Reich
der Sinne, in welchem er aufpassen muss, nicht von Sinnen zu kommen. Wir wer-
den später noch ein weiteres Beispiel für diese Überwältigung aller Sinne kennen-
lernen …
4 Ebda., S. 29.Europäische Forschungsreisen um die Welt oder die Ausweitung des Wissens 467
Zugleich handelt es sich um einen Diskurs der amerikanischen Fülle, aber
auch einer freilich nur kurz angedeuteten tropischen Falle, deutlich nach jenem
anderen, insbesondere das letzte Drittel des 18. Jahrhunderts dominierenden eu-
ropäischen Diskurs angesiedelt, der unter Rückgriff auf Buffon oder de Pauw
Amerika im Zeichen der Unterlegenheit und der Schwäche sah. In diesen Passa-
gen entfaltet sich vielmehr die Kraft und Stärke der amerikanischen Vegetation,
die sich als weitaus stärker erweist als alles, was die Natur in den gemäßigten
Zonen Europas aufzubieten hat.
Als Teilnehmer der ersten russischen Weltumsegelung, die unter dem Befehl
von Adam Johann von Krusenstern durchgeführt wurde, hatte sich Langsdorff –
wie er in seinem auf St. Petersburg, den 12. Juni 1811 datierten Vorwort zu seinen
Bemerkungen auf einer Reise um die Welt ausführte – „als Arzt und Naturfor-
scher“5 erstmals der amerikanischen Hemisphäre zugewandt. Er partizipierte
damit an einer Unternehmung, wie sie charakteristisch war für die zweite Phase
beschleunigter Globalisierung: Weltumsegelungen also, wie sie auf französischer
Seite Bougainville und „der unsterbliche“6 Lapérouse oder auf britischer Seite
James Cook durchgeführt hatten. Im deutschsprachigen Raum ist zweifellos die
Weltumsegelung des Adelbert von Chamisso auf der russischen Brik Rurik noch
berühmter geworden; eine ausgedehnte Weltumrundung, auf welcher der große
französische Dichter der deutschen Romantik seine Offenheit nicht nur gegen-
über der Natur in den verschiedensten Breiten, sondern auch gegenüber der
Vielfalt menschlicher Kulturen auf unserem Planeten demonstrieren konnte.7
Chamissos Reisebericht hat sicherlich den Glanz des Langsdorff’schen Bandes
übertroffen, gehört jedoch fraglos dem 19. Jahrhundert zu und steht ganz im
Zeichen einer Romantik, die der französisch-deutsche Poet vertrat.
Doch jene Expedition, an der Freiherr von Langsdorff teilnahm, eröffnete
den Reigen russischer Forschungsreisen und wurde noch ganz im Geist des
18. Jahrhunderts konzipiert. Das Russische Reich war auf diesem Gebiet ein
Nachzügler; und so verwundert es nicht, dass lange Jahrzehnte die paradigma-
tischen Weltumsegelungen der Franzosen und Engländer von jenen der Russen
trennten, die ihrerseits ein ausgeprägtes Interesse insbesondere an der Erfor-
schung der Küsten des Pazifiks und des russischen Amerika besaßen. Das Rus-
5 Ebda., S. xix.
6 Ebda., S. 26.
7 Vgl. hierzu auch Ette, Ottmar: Welterleben / Weiterleben. Zur Vektopie bei Georg Forster, Alex-
ander von Humboldt und Adelbert von Chamisso. In: Drews, Julian / Ette, Ottmar / Kraft, Tobias /
Schneider-Kempf, Barbara / Weber, Jutta (Hg.): Forster – Humboldt – Chamisso. Weltreisende im
Spannungsfeld der Kulturen. Mit 44 Abbildungen. Göttingen: V&R unipress 2017, S. 383–427.468 Europäische Forschungsreisen um die Welt oder die Ausweitung des Wissens
Abb. 36: Georg Heinrich von Langsdorff (1774–1852).
sische Reich versuchte, erfolgreich in die Fußstapfen der westeuropäischen
Mächte zu treten.
Und doch ergab sich auch eine bedeutungsvolle Um-Akzentuierung euro-
päischer Reisepläne. Denn aus dieser Perspektive ist es aufschlussreich zu kon-
statieren, dass in der Figur von Georg Heinrich Freiherr von Langsdorff ein
grundlegender Paradigmenwechsel aufscheint, der sich noch im Verlauf dieser
zweiten, im Zeichen der Führungsmächte England und Frankreich stehenden
Beschleunigungsphase der europäischen Globalisierung vollzog. Es handelt
sich dabei um den Wechsel von der Entdeckungsreise (sei es in Form von See-
reisen zu bestimmten Küstenstrichen, sei es in Form spektakulärer Weltumse-
gelungen) zur Forschungsreise, wobei die erstere stets nur die Küstenbereiche
berührte, die zweite hingegen auf eine Erforschung gerade auch der Binnen-
räume der Kontinente abzielte. Noch ein Alexander von Humboldt hatte in den
ausgehenden neunziger Jahren des 18. Jahrhunderts darauf gehofft, sich einer
weiteren französischen Weltumsegelung unter Kapitän Baudin anzuschließen,
bevor er sich – durchaus mit hohem Risiko und auf eigene Kosten – im Juni
1799 zusammen mit Aimé Bonpland auf seine eigene Forschungsreise in die
amerikanischen Tropen begab. Und seine gleichsam das Jahrhundert der Auf-
klärung abschließende und das 19. Jahrhundert eröffnende Forschungsreise
zielte weniger auf die Küstensäume der amerikanischen Tropen, als auf deren
weite und teilweise noch unbekannte Binnenräume.
Zwei Jahrzehnte nach der Krusenstern‘schen Weltumsegelung erfüllte die
von 1824 bis 1828 durchgeführte Langsdorff‘sche Expedition – wiederum in rus-
sischem Auftrag – alle Kriterien jener nun vermehrt angestrebten Erforschung
des Landesinneren, die nunmehr im Zentrum der europäischen Expansionsbe-
mühungen stand, seien sie vorwiegend wissenschaftlicher oder politischer be-
ziehungsweise ökonomischer Ausrichtung. Da auch diese Expedition eindeutig
dem 19. Jahrhundert zugehört, wollen wir uns nur kurz mit ihr beschäftigen.
Langsdorff selbst hatte die wissenschaftliche Notwendigkeit eines langfristigen
Aufenthalts in Brasilien bereits in seinem Reisebericht bezüglich der Insel
Santa Catarina festgehalten; in einer Art Vorwegnahme seines späteren Lebens
merkte er im Angesicht der Überfülle von Naturphänomenen in einer epistemo-Europäische Forschungsreisen um die Welt oder die Ausweitung des Wissens 469
logisch wie autobiographisch nicht unwichtigen Fußnote an, dass man hier
eines Botanikers bedürfe, „der sich nicht Tage und Wochen, sondern Jahre lang
hier aufhalten muß“, könne dieser Forscher doch nur so „durch die Entdeckung
einer Menge neuer genera und species an Pflanzen belohnt werden“.8 Die
Dringlichkeit längerer Forschungsaufenthalte, wie sie fast zeitgleich etwa auch
ein Christian Gottfried Ehrenberg, der spätere Begleiter Humboldts auf dessen
1829 durchgeführter Russisch-Sibirischen Forschungsreise, von 1820 bis 1825
im Nahen Osten und in Afrika durchführte, war damit zum Ausdruck gebracht.
Georg Heinrich Freiherr von Langsdorff verkörpert als Teilnehmer wie als
der spätere Leiter einer Entdeckungs- wie einer Forschungsreise damit einen
paradigmatischen Wechsel, der in seinem Falle gerade auch angesichts der
Schwierigkeiten, auf die seine Expedition stieß – zahlreiche Dokumente bele-
gen die internen Spannungen zwischen den einzelnen Mitgliedern9 –, auch das
Oszillieren zwischen Fülle und Falle miteinschloss. Denn das, was sich zu-
nächst den Sinnen des europäischen Reisenden als Fülle darbot, konnte sich
schon rasch und jederzeit in eine gefährliche Falle verwandeln.10 Dass sich der
noch junge Reisemaler Johann Moritz Rugendas seinerseits der Falle, welche
für ihn die Langsdorff-Expedition darstellte, zu entziehen vermochte, wirft ein
bezeichnendes Licht auf die große Bedeutung, welche dem Zusammenleben,
der Konvivenz, für das Überleben und den wissenschaftlichen wie künstleri-
schen Ertrag jedweder Forschungsreise zukommt.11 Der autoritäre Führungsstil
Langsdorffs war offenkundig den wissenschaftlichen Ergebnissen nicht immer
zuträglich.
Der Paradigmenwechsel von der Entdeckungs- zur Forschungsreise lässt
sich auf einen noch umfassenderen Wandel beziehen, den ein Zeitgenosse
Langsdorffs, der bereits erwähnt wurde und uns noch am Ende unseres Par-
cours beschäftigen soll, als eine „révolution heureuse“, als eine glückliche Re-
volution bezeichnete. Dabei ging es bei dieser Formulierung weder um die
industrielle Revolution in England noch um die politische Revolution in Frank-
8 Langsdorff, Georg Heinrich Freiherr von: Bemerkungen auf einer Reise um die Welt, S. 49.
9 Vgl. hierzu die wichtige Zusammenstellung von Costa, Maria de Fátima / Diener, Pablo
(Hg.): Viajando nos Bastidores: Documentos de Viagem da Expediçao Langsdorff. Cuiabá: Mi-
nistério da Educaçao e do Desporto 1995.
10 Zur historischen Dimension des Wechselspiels von Fülle und Falle vgl. insbes. Kapitel III
in Ette, Ottmar: Konvivenz. Literatur und Leben nach dem Paradies. Berlin: Kulturverlag Kad-
mos 2012, S. 102–146.
11 Zu den Dokumenten der Zerrüttung zwischen Langsdorff und Rugendas in Brasilien
vgl. Costa, Maria de Fátima / Diener, Pablo: Entorno dos documentos. In (dies., Hg.): Viajando
nos Bastidores: Documentos de Viagem da Expediçao Langsdorff, S. 20–25.470 Europäische Forschungsreisen um die Welt oder die Ausweitung des Wissens
reich, weder um die antikoloniale Revolution in den Vereinigten Staaten noch
um die gegen Sklaverei und Kolonialismus gerichtete Haitianische Revolution.
Es ging vielmehr um eine neue Zirkulation des Wissens, um eine veränderte dis-
kursive Konfiguration, welche die vielfältigen und asymmetrischen Beziehungen
zwischen Europa und der außereuropäischen Welt betraf. Um die Langsdorff‘-
sche Expedition vor dem Hintergrund dieser „révolution heureuse“ einschätzen
zu können, bedarf es jedoch einer kritischen Rekonstruktion dieser asymmetri-
schen Wissenszirkulation in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts.
Denn denken wir noch einmal zurück an die Schilderung der spannungsvol-
len Beziehung zwischen dem Gelehrten („savant“) und dem Mäzen („homme
riche“), wie sie Denis Diderot in einem obigen Zitat entwickelte. Auf welche Weise
man auch immer die Beziehung zwischen dem Monarchen und dem großen Ge-
lehrten im Falle Langsdorffs deuten mag, der ‚seinem‘ Zaren eine ebenso starke
wie zugleich auch formelhafte Widmung seines Reiseberichtes zukommen ließ:12
Die Krusenstern’sche Weltumsegelung gehorchte noch dem alten Paradigma und
damit dem Gebot des europäischen Schreibtischs, der über weite Strecken des
18. Jahrhunderts zum eigentlichen Ort des Wissens über die außereuropäische
Welt geworden war. Nun, für die spätere Langsdorff’sche Expedition galt dies
nicht länger! Sie schreibt sich unverkennbar in einen Paradigmenwechsel ein, den
die erwähnte Fußnote Langsdorffs freilich schon ankündigt. Bestimmte Sitten und
Gebräuche auf europäischen Schiffen waren gleichwohl beibehalten worden, wie
die „Rites de passage“ bei der Überquerung der Äquatoriallinie durch das russi-
sche Schiff zeigen. Sehr einfach wäre es, Antoine-Joseph Pernetys Schilderung der
Querung der Linie mit jener reiseliterarischen Darstellung in Verbindung zu brin-
gen, die Langsdorff als Teilnehmer der ersten russischen Expedition, die je die
Grenze zwischen Nord- und Südhalbkugel passierte, von einer nicht weniger lust-
vollen Taufe an Bord von Kapitän Krusensterns Schiffen vorlegte.13 Auch die russi-
sche Expedition machte an diesem Ort ihrer Reise keine Ausnahme: Alle Länder,
alle Schiffsbesatzungen Europas partizipierten an diesem kollektiven Imaginären
einer radikal anderen tropischen Welt.14
12 Vgl. Langsdorff, Georg Heinrich von: Bemerkungen auf einer Reise um die Welt in den Jahren
1803 bis 1807 von G.H. von Langsdorff, Kaiserlich-Russischer Hofrath, Ritter des St. Annen-Or-
dens zweiter Classe, Mitglied mehrerer Akademien und gelehrten Gesellschaften. Mit acht und
zwanzig Kupfern und einem Musikblatt, Bd. 1, S. vf.
13 Vgl. hierzu Langsdorffs Darstellung in seinen Bemerkungen auf einer Reise um die Welt in
den Jahren 1803 bis 1807, Bd. 1, S. 22 f.
14 Vgl. hierzu Ette, Ottmar: Diskurse der Tropen – Tropen der Diskurse: Transarealer Raum
und literarische Bewegungen zwischen den Wendekreisen. In: Hallet, Wolfgang / Neumann,
Birgit (Hg.): Raum und Bewegung in der Literatur. Die Literaturwissenschaften und der Spatial
Turn. Bielefeld: transcript Verlag 2009, S. 139–165.Europäische Forschungsreisen um die Welt oder die Ausweitung des Wissens 471
Und noch an einer anderen Stelle können wir in Langsdorffs Reisebericht
ohne jeden Zweifel die tropische Bilderwelt des 18. Jahrhunderts konstatieren.
Denn er hatte zweifellos auch das Journal historique von Dom Pernety gelesen
und auf diesen Reisebericht zurückgegriffen. Nicht umsonst prägt letzterer, der
auf seiner Reise unter Kapitän Bougainville Brasilien berührt und entzückt die
Insel Santa Catarina in Augenschein genommen hatte, noch die Darstellungs-
weisen des Langsdorff‘schen Brasilienberichts, die uns diesen Teil des amerika-
nischen Kontinents – wie wir sahen – wie einen tropikalisierten locus amoenus
mit nicht wenigen paradiesartigen Zügen zeigen, besingt Langsdorff doch nicht
selten in bewegten Worten und mit einigen Anleihen bei Pernety diese „paradiesi-
sche Gegend“ als ein neues Eden.15
Seit dem Beginn der zweiten Phase beschleunigter Globalisierung waren in
Europa unzählige Expeditionen ausgerüstet worden, die als Entdeckungsreisen
direkten kolonialen Zielen gehorchten und von Beginn an wissenschaftliche
Forschungsprogramme integrierten, welche später – dies klang bereits an – das
Paradigma kolonialer Reiseunternehmungen Europas grundlegend verändern
sollten. Diese gewaltige Bewegung wurde selbstverständlich auch außerhalb
der beteiligten europäischen Mächte – wie etwa im deutschsprachigen Raum –
wahrgenommen. So hat im Jahre 1774 kein Geringerer als Johann Gottfried
Herder in seiner Schrift Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der
Menschheit sehr pointiert diese ungeheure Welle an Reisen beschrieben, die
eine sich von Europa aus über die gesamte Welt ausbreitende Dynamik globa-
len Ausmaßes erreichte. Dieser beeindruckenden Welle stand die Philosophie
selbst im weltpolitisch marginalen deutschsprachigen Raum keineswegs fremd
gegenüber. Denn sie wurde ihrerseits von der Wucht einer Dynamik erfasst, die
sie schnell – Jahrzehnte vor Hegel – in weltgeschichtliche Fragestellungen trieb.
Sahen sich nicht die Wissenschaften und viele Wissenschaftler in einen Bewe-
gungstaumel versetzt, der rasch die tableauförmige Anordnungsmöglichkeit des
Wissens überforderte und am Ausgang des 18. Jahrhunderts das Ende der Natur-
geschichte16 heraufführen sollte?
Diese sich in der zweiten Hälfte des Siècle des Lumières – und hier bildeten
die siebziger und achtziger Jahre einen deutlichen Höhepunkt aus – stetig
beschleunigende Dynamik, diese Vektorisierung aller Dinge und aller Sinne
machte zweifellos das entscheidende Epochenmerkmal aus. Es handelt sich
15 Vgl. hierzu Langsdorff, Georg Heinrich von: Bemerkungen auf einer Reise um die Welt in
den Jahren 1803 bis 1807, S. 29.
16 Vgl. Lepenies, Wolf: Das Ende der Naturgeschichte. Wandel kultureller Selbstverständlichkei-
ten in den Wissenschaften des 18. und 19. Jahrhunderts. Frankfurt am Main: Suhrkamp 1978.472 Europäische Forschungsreisen um die Welt oder die Ausweitung des Wissens
dabei um ein zentrales Element der Aufklärung zwischen zwei Welten. Folg-
lich konnte Johann Gottfried Herder mit gutem Grund und mit bewegten, biswei-
len aufgewühlten Worten gerade auf die damalige Leitgattung der Reiseberichte
und die in ihnen zutage geförderte Fülle an Materialien nicht ohne ein Augen-
zwinkern verweisen:
Unsre Reisebeschreibungen mehren und bessern sich; alles läuft, was in Europa nichts zu
tun hat, mit einer Art philosophischer Wut über die Erde – wir sammeln „Materialien aus
aller Welt Ende“ und werden in ihnen einst finden, was wir am wenigsten suchten, Erör-
terungen der Geschichte der wichtigsten menschlichen Welt.17
Herders Aussage war zweifellos auf viele europäische Reisende gemünzt. Aber
sie passte besonders gut auf einen jungen Mann, dem das Glück zuteilwurde, mit
seinem Vater an der zweiten Weltumsegelung des Briten James Cook teilnehmen
zu können und so bereits in jungen Jahren einmal die Erde zu umrunden. Der
junge Georg Forster war zweifellos einer jener hochgradig vektorisierten Pro-
tagonisten, die in dieser Expansionsgeschichte des Wissens – und nicht ohne
„philosophische Wut“ – das aussagekräftigste Material in Umlauf zu setzen
verstanden.
Doch stand er den von Herder ironisch auf den Punkt gebrachten Entwick-
lungen keineswegs unkritisch gegenüber. Vielmehr versuchte er, in seinem
schriftstellerisch-philosophischen Schaffen grundlegende Einsichten zur Epis-
temologie des Wissens über die außereuropäische Welt zu entwickeln, um
damit sein Erleben der Welt – und nicht allein „der wichtigsten menschlichen
Welt“18 – so zu erweitern, dass daraus ein neues, grundlegend erweitertes Welt-
verstehen, Welterleben und Weltbewusstsein sich herausbilden konnten. Nicht
ohne Grund verwende ich dabei den von Alexander von Humboldt später ge-
prägten Begriff des Weltbewusstseins.19 Und nicht umsonst heftete sich der
junge Alexander von Humboldt an Forsters Spuren, während Adelbert von Cha-
misso letzterem noch in den Titelformulierungen seines Reisewerkes eine sicht-
bare Hommage erwies. Georg Forster wurde im deutschsprachigen Raum zu
einem literarischen Vorbild, das mit seinem ästhetischen Stilwillen und seiner
ethnographischen Offenheit eine lange Traditionslinie von Reisenden aus den
deutschsprachigen Ländern begründete.
17 Herder, Johann Gottfried: Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung der Menschheit.
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1967, S. 89.
18 Ebda.
19 Vgl. hierzu Ette, Ottmar: Weltbewusstsein. Alexander von Humboldt und das unvollendete
Projekt einer anderen Moderne. Mit einem Vorwort zur zweiten Auflage. Weilerswist: Velbrück
Wissenschaft 2020.Europäische Forschungsreisen um die Welt oder die Ausweitung des Wissens 473
In seiner auf London, den 24. März 1777 datierten „Vorrede“ zu seiner Reise
um die Welt hat der junge Georg Forster die epistemologische Positionierung
seines Reiseberichts vorgestellt und damit zugleich Eckdaten für einen ebenso
reisetheoretischen wie reiseliterarischen Paradigmenwechsel am Ausgang des
18. Jahrhunderts festgehalten. Dabei nahm er von Beginn an eine Position ein,
welche die zeitgenössische Aufklärungsphilosophie im Auge hatte:
Die Philosophen dieses Jahrhunderts, denen die anscheinenden Widersprüche verschie-
dener Reisenden sehr misfielen, wählten sich gewisse Schriftsteller, welche sie den übri-
gen vorzogen, ihnen allen Glauben beymaßen, hingegen alle andere für fabelhaft
ansahen. Ohne hinreichende Kenntniß warfen sie sich zu Richtern auf, nahmen gewisse
Sätze für wahr an, (die sie noch dazu nach eigenem Gutdünken verstellten,) und bauten
sich auf diese Art Systeme, die von fern ins Auge fallen, aber, bey näherer Untersuchung,
uns wie ein Traum mit falschen Erscheinungen betrügen. Endlich wurden es die Gelehr-
ten müde, durch Declamation und sophistische Gründe hingerissen zu werden, und ver-
langten überlaut, dass man doch nur Thatsachen sammeln sollte. Ihr Wunsch ward
erfüllt; in allen Welttheilen trieb man Thatsachen auf, und bey dem Allem stand es um
ihre Wissenschaft nichts besser. Sie bekamen einen vermischten Haufen loser einzelner
Glieder, woraus sich durch keine Kunst ein Ganzes hervorbringen ließ; und indem sie bis
zum Unsinn nach Factis jagten, verloren sie jedes andre Augenmerk, und wurden unfä-
hig, auch nur einen einzigen Satz zu bestimmen und zu abstrahiren; so wie jene Mikrolo-
gen, die ihr ganzes Leben auf die Anatomie einer Mücke verwenden, aus der sich doch
für Menschen und Vieh nicht die geringste Folge ziehen läßt.20
Mit der ihm eigenen kritischen Klarsichtigkeit wendet sich Georg Forster hier
im Grunde gegen zwei einander konträr gegenüberliegende Positionen der Wis-
senschaftsgeschichte nicht allein des 18. Jahrhunderts. Zum einen lehnt er ve-
hement die Werke jener „philosophes“ der europäischen Aufklärung ab, die
sich – wie etwa der Holländer Cornelius de Pauw in seinen Recherches philo-
sophiques sur les Américains oder der Franzose Guillaume-Thomas Raynal in
seiner Histoire des deux Indes – zu Richtern über den Wahrheitsgehalt von Rei-
seberichten und anderen Texten aufschwangen, ohne doch jemals selbst den
Fuß auf außereuropäischen Boden gesetzt oder Reisen unternommen zu haben.
Keinesfalls konnten sie so die von ihnen für zutreffend oder falsch gehaltenen
Schriften aus einer empirisch fundierten Kenntnis vor Ort kritisch beurteilen.
Ihnen fehlte ein sinnliches, körperliches, hautnahes Erleben einer Welt, die sie –
gleichsam als Philologen avant la lettre21 – allein durch die Lektüre von Texten
20 Forster, Georg: Reise um die Welt. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Gerhard
Steiner. Frankfurt am Main: Insel Verlag 1983, S. 16 f.
21 Vgl. hierzu Ette, Ottmar: Wörter – Mächte – Stämme. Cornelius de Pauw und der Disput um
eine neue Welt. In: Messling, Markus / Ette, Ottmar (Hg.): Wort Macht Stamm. Rassismus und474 Europäische Forschungsreisen um die Welt oder die Ausweitung des Wissens
Abb. 37: Johann Heinrich Wilhelm Tischbein: Georg Forster (1754–1794).
doch bestens zu kennen glaubten. Wir haben diesen Ansatz in der Philosophie
des europäischen Aufklärungszeitalters ausführlich bearbeitet.
Weit über die Berliner Debatte um die Neue Welt hinaus war die grundle-
gende Problematik der „Armchair Travellers“ einer auch außereuropäischen Le-
serschaft immer deutlicher vor Augen getreten. Aber wie war dieser Problematik
zu begegnen? Einfach durch Reisen in außereuropäische Weltgegenden? Georg
Forster war auf der Höhe der Debatten seiner bewegten Zeit und wusste zweifels-
frei, dass gerade die neuweltlichen Leser der beiden europäischen „philosophes“
diese Unkenntnis der Verhältnisse vor Ort vehement angeprangert und eine em-
pirische Vertrautheit auch und gerade der europäischen gelehrten mit ihren au-
ßereuropäischen Gegenständen eingefordert hatten.
Es galt daher, eine deutlich an die jeweiligen arealen und lokalen Verhält-
nisse angepasstere und produktivere Lösung zu finden. Allein auf eine philolo-
gische Textkenntnis war ein Wissen von der Welt nicht länger zu stützen –
auch wenn die „géographes de cabinet“, die besten Kartographen ihrer Zeit wie
etwa ein D’Anville, der sich niemals weiter als vierzig Meilen von Paris ent-
fernte, auch weiterhin die Erdoberfläche kartierten, ohne sie jemals außerhalb
eines kleinen Kreises gesehen zu haben.22 Doch dies war, folgen wir Georg Fors-
ter, nur die eine Hälfte des Problems.
Denn auf der anderen Seite distanzierte sich Forster auch von einer empi-
risch ausgerichteten Faktensammelei, die ohne Sinn und Verstand vonstatten-
ging und gleichsam ‚mikrologisch‘ sich in den unwichtigsten Details verirrte,
eine – wie Forster nahelegt – Fliegenbeinzählerei betrieb und dabei jene Ge-
samtheit aus den Augen verlor: jene Welt, die in ihren inneren Zusammenhän-
gen dem Verfasser der Reise um die Welt doch so sehr am Herzen lag. Man darf
aus der heutigen Rückschau mit Sicherheit behaupten, dass das Sammeln un-
Determinismus in der Philologie (18. / 19. Jh.). Unter Mitarbeit von Philipp Krämer und Markus
A. Lenz. München: Wilhelm Fink Verlag 2013, S. 107–135.
22 Vgl. hierzu Broc, Numa: La Géographie des Philosophes. Géographes et voyageurs français
au XVIIIe siècle. Paris: Editions Ophrys 1975, S. 34.Europäische Forschungsreisen um die Welt oder die Ausweitung des Wissens 475
terschiedlicher Massen von ‚Tatsachen‘ durchaus epistemologische Konsequen-
zen hatte, insofern die traditionelle Naturgeschichte des 18. Jahrhunderts auf
Grund der Vielzahl an gesammelten Fakten buchstäblich gesprengt und die Di-
mension der Zeit in die vorhandenen Tableaus eingefügt werden musste.23 Aber
dies allein konnte nicht genügen, um eine Gesamtsicht zu erzeugen und in
diese umfassendere Weltsicht auch die von Rousseau schon geforderte Perspek-
tive auf die Vielheit des Menschengeschlechts zu integrieren. Nicht umsonst
wird der Begriff „Welt“ bei Georg Forster stets in seiner etymologisch „mensch-
haltigen“ Bedeutung als Totalität verstanden, die nur als Ganzes zu erfassen ist
und den Menschen an zentraler Stelle einschließt. Auf ein Erleben dieser Tota-
lität zielte sein Welterleben, wie es reiseliterarisch in seinen Schriften zum
Ausdruck kommt.
Forster selbst war es auf und nach der Weltumsegelung mit James Cook kei-
neswegs darum gegangen, möglichst viele isolierte ‚Fakten‘ aneinanderzureihen,
sondern tunlichst die vor Ort gemachten Beobachtungen in größere Zusammen-
hänge einzuordnen, ohne dabei auf jene chimärischen ‚Systeme‘ zu verfallen, die
ohne empirische Grundlage eine nur auf Bezügen zu anderen Texten aufbauende
Textwissenschaft betrieben – eine Art Philologie im negativen Sinne. Georg Fors-
ter ging es weder um Systeme noch um Fliegenbeine: Es ging ihm in seinen For-
schungen und in seinem Denken – wie nach ihm und in seinen Fußstapfen auch
Alexander von Humboldt – schlicht ums Ganze.24 Er zielte folglich auf eine empi-
rische Grundlage aller erhobenen Fakten, zugleich aber auf deren Zusammen-
schau in einem wissenschaftlich-philosophischen Gesamtverständnis. Und in
dieser Ausrichtung entsprach Forster durchaus Herders stiller Hoffnung, über
den Menschen in seiner planetarischen Verteilung und in seinen verschiedenarti-
gen Kulturen wesentlich mehr und Genaueres zu erfahren.
Georg Forster hatte zusammen mit seinem Vater Reinhold James Cook auf
dessen zweiter Reise um die Welt begleitet. Er war, da ihm dies anders als sei-
nem Vater vertraglich nicht untersagt blieb, zum Verfasser des im Jahre 1777
zunächst in englischer Sprache und von 1778 bis 1780 dann in deutscher Bear-
23 Vgl. hierzu nochmals Lepenies, Wolf: Das Ende der Naturgeschichte, a.a.O.
24 Vgl. hierzu auch den Aufsatz von Schmitter, Peter: Zur Wissenschaftskonzeption Georg
Forsters und dessen biographischen Bezügen zu den Brüdern Humboldt. Eine Vorstudie zum
Verhältnis von „allgemeiner Naturgeschichte“, „physischer Weltbeschreibung“ und „allgemei-
ner Sprachkunde“. In: Naumann, Bernd / Plank, Frans / Hofbauer, Gottfried / Hooykaas, Rei-
jer (Hg.): Language and Earth: Elective Affinities between the emerging Sciences of Linguistics
and Geology. Amsterdam: Benjamins 1992, S. 91–124.476 Europäische Forschungsreisen um die Welt oder die Ausweitung des Wissens
beitung erschienenen Berichts seiner Reise um die Welt25 geworden, die von
Alexander von Humboldt so geschätzt wurde. Der junge Forster schuf damit ein
reiseliterarisches Monument – nicht nur für den deutschsprachigen Raum. Die
enorme Resonanz dieses ebenso umfangreichen wie ästhetisch ausgefeilten
Reiseberichts verwandelte Georg Forster zumindest in Deutschland, wo es aus
naheliegenden Gründen an Weltumseglern mangelte, rasch in die emblemati-
sche Figur des Weltreisenden schlechthin. Doch er setzte über seinen Bekannt-
heitsgrad hinaus auch im wissenschaftlichen Bereich neue epistemologische
Akzente und begründete eine höchst fruchtbare Tradition deutschsprachiger
Weltreisender und deren Reiseberichte.
Und Forster blieb, auch im globalen Maßstab, auf der Höhe des Zeitgesche-
hens im letzten Viertel des 18. Jahrhunderts. In seiner im Jahre 1791 – also nach
der Französischen Revolution – veröffentlichten Schrift über Die Nordwestküste
von Amerika nahm er den scheinbar marginalen Handel im Norden des ameri-
kanischen Kontinents zum Anlass, sich grundlegenderen Überlegungen zu stel-
len. Seine Reflexionen zogen bereits in gewisser Weise eine Bilanz der zweiten
Phase beschleunigter Globalisierung. Er griff dabei auf den Handel mit Biberfel-
len im Norden des amerikanischen Doppelkontinents zurück und wählte dabei
just jenes Beispiel, dessen sich Cornelius de Pauw bedient hatte, um die welt-
weit geführten Auseinandersetzungen europäischer Mächte um Handelspro-
dukte und die damit verbundene Gefahr eines „Weltbrandes“ zu benennen:
Der Zeitpunkt nähert sich mit schnellen Schritten, wo der ganze Erdboden dem Europäi-
schen Forschungsgeiste offenbar werden und jede Lücke in unseren Erfahrungswissen-
schaften sich, wo nicht ganz ausfüllen, doch in so weit ergänzen muß, dass wir den
Zusammenhang der Dinge, wenigstens auf dem Punkt im Äther den wir bewohnen, voll-
ständiger übersehen können. Bald ist es Nationaleitelkeit, bald politisches Interesse, Spe-
kulation des Kaufmanns oder Enthusiasmus für Wahrheit, was auf jenes Ziel hinarbeitet
und dem wichtigen Endzwecke mit oder ohne Bewußtseyn dienen muß. Wie greifen als-
dann die Räder des großen kosmischen Mechanismus so wunderbar in einander! […]
Hier beginnt eine neue Epoche in der so merkwürdigen Geschichte des Europäischen
Handels, dieses Handels, in welchen sich allmählig die ganze Weltgeschichte aufzulösen
scheint. Hier drängen sich dem Forscher so viele Ideen und Thatsachen auf, dass es die
Pflicht des Herausgebers der neuen Schifffahrten und Landreisen in jener Gegend mit
sich zu bringen scheint, alles, was auf die Kenntniß derselben Beziehung hat, in einen
Brennpunkt zu sammeln und zumal einem Publikum, wie das unsrige, welches nur einen
litterarischen, mittelbaren Antheil an den Entdeckungen der Seemächte nehmen kann,
25 Vgl. hierzu Steiner, Gerhard: Georg Forsters „Reise um die Welt“. In: Forster, Georg: Reise
um die Welt. Herausgegeben und mit einem Nachwort von Gerhard Steiner. Frankfurt am Main:
Insel Verlag 1983, S. 1015.Europäische Forschungsreisen um die Welt oder die Ausweitung des Wissens 477
die Übersicht dessen, was bisher unternommen worden ist, und das Urtheil über die
Wichtigkeit dieser ganzen Sache zu erleichtern.26
Kein Zweifel: Der Verfasser der Reise um die Welt war ein Protagonist jener Vor-
gänge, die der Reisende und Revolutionär in diesen Zeilen beschrieb. Denn am
Ineinandergreifen der „Räder des großen kosmischen Mechanismus“ hatte
Georg Forster durch seine Teilnahme an der zweiten Weltumsegelung von
James Cook zweifellos seinen Anteil gehabt. Die französischen und britischen
Weltumsegelungen setzten den Maßstab jener Erforschung und Erkundung,
aber auch Vermessung und Verteilung der Welt, an denen das deutschspra-
chige Publikum – wie Forster sehr bewusst betont – keinen direkten Anteil hat.
Noch war die Kolonialpolitik in den deutschen Landen nur rudimentär und
bruchstückhaft, so dass das Publikum vor allem einen intellektuellen Anteil am
Ausgreifen wie am Ausgriff Europas in dieser Phase der Weltgeschichte hatte.
Aber auch dieser Anteil war – zusätzlich zu jenem deutscher Kaufleute und
Händler im großen kosmischen Mechanismus der Globalisierung – keineswegs
gering. Und Georg Forster wusste dies besser als jeder andere, ging es ihm doch
darum, die Mechanismen des Welthandels dieser Globalisierungsphase ge-
nauer zu verstehen.
Sein zeitgenössischer Kommentar zur europäischen Expansion der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts, die wir im Kontext unserer Vorlesung wie auch der
transarealen Studien insgesamt als Beschleunigungsphase identifiziert haben,
macht deutlich, wie endlich der planetarische Raum und wie absehbar seine
detaillierte Erkundung geworden zu sein schien. Es ist die Literatur – und ganz
besonders auch die Reiseliteratur – dieser Zeit, die uns den lebendigsten und
zugleich präzisesten Eindruck davon vermittelt, wie die Zeitgenossen die damalige
Akzeleration erlebten. Bald also wurden die weißen Flecken auf den Landkarten
und Globen der europäischen Herrscher, der wissenschaftlichen Gesellschaften
und der großen Handelshäuser und Kaufleute kleiner und kleiner. Die Metaphorik
der schnellen Schritte, mehr aber noch jener „Räder des großen kosmischen Me-
chanismus“, die sich immer schneller drehten und für den Menschen immer er-
kennbarer ineinandergriffen, verdeutlicht den Glauben an eine auf Fortschritt,
Beherrschbarkeit und (Erfahrungs-) Wissenschaften setzende Vernunft, die jene
des „Europäischen Forschungsgeiste[s]“ ist. Georg Forster stand mit beiden Beinen
fest auf dem Fortschrittsglauben der europäischen Aufklärung: Er war ein beispiel-
26 Forster, Georg: Die Nordwestküste von Amerika, und der dortige Pelzhandel. In (ders.):
Werke. Sämtliche Schriften, Tagebücher, Briefe. Bd. 5: Kleine Schriften zur Völker- und Länder-
kunde. Herausgegeben von Horst Fiedler, Klaus Georg Popp, Annerose Schneider und Christian
Suckow. Berlin: Akademie-Verlag 1985, S. 390 u. 395.478 Europäische Forschungsreisen um die Welt oder die Ausweitung des Wissens
hafter Vertreter jener Lumières, die Besitz von ihrer eigenen Geschichte ergriffen
und sie in Zukunft selbst bestimmen wollten.
Georg Forster gehört in Deutschland zweifellos zu jenen Autoren, die am
meisten für die Entwicklung dieser im wahrsten Sinne des Wortes auf Erfah-
rungswissen beruhenden Kenntnisse einer sich verändernden und an Bedeutung
noch zunehmenden Reiseliteratur am Ausgang des 18. Jahrhunderts beitrugen.27
Damit öffneten sie ihren Zeitgenossen die Augen für die ihnen nun gegebenen
Gestaltungsmöglichkeiten. Forster war zweifellos einer der Protagonisten und
wichtigsten Verkünder der europäischen Expansion, ohne freilich bezüglich die-
ser kolonialen Ausbreitung Europas Schuld auf sich geladen zu haben. Im
Gegenteil: Er machte seine Zeitgenossen auf die Risiken dieser gewaltigen
Beschleunigung von globaler Geschichte aufmerksam.
Doch die Räder dieser kosmischen Maschinerie drehten sich so schnell, so
dass sie – wie wir in kinematographischer Metaphorik hinzufügen könnten – bis-
weilen ‚stillzustehen‘ schienen. Die letzten verbliebenen Lücken des Erdraumes28
waren bald schon ausgefüllt: War es dann nicht bald auch die Zeit als Zeit-Raum
wie als Raum-Zeit? Georg Forster, den Alexander von Humboldt mehrfach zu
Recht nicht nur als seinen Freund, sondern als seinen Lehrmeister bezeichnete,
hielt mit Blick auf die Erforschung der Nordwestküste des amerikanischen Dop-
pelkontinents fest, wie sehr sich all dies in eine allgemeine Geschichte der
Menschheit einfügte. Diese aber begann sich in den Augen Forsters grundlegend
zu verändern. War es da nicht die Pflicht des Weltreisenden, an diesem Geschäft
der Veränderung teilzuhaben?
Die zentrale Beobachtung Georg Forsters war erhellend und provokativ zu-
gleich: Löste sich also die gesamte Weltgeschichte in den Welthandel auf? Kam
die allgemeine Geschichte der Menschheit vielleicht dadurch zu einem Still-
stand, dass sie durch Vervielfältigung von Kommunikation ersetzt wurde?
Diese Darstellung einer Epoche der Nachzeitlichkeit will uns aus heutiger Sicht
27 Vgl. hierzu Wuthenow, Ralph-Rainer: Die erfahrene Welt. Europäische Reiseliteratur. im
Zeitalter der Aufklärung. Mit zeitgenössischen Illustrationen. Frankfurt am Main: Insel Verlag
1980; sowie Wolfzettel, Friedrich: „Ce désir de vagabondage cosmopolite.“ Wege und Entwick-
lung des französischen Reiseberichts im 19. Jahrhundert. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1986.
28 Forster, Georg: Die Nordwestküste von Amerika, und der dortige Pelzhandel, S. 393: „So ist
nicht nur unsere jetzige physische und statistische Kenntniß von Europa zur Vollkommenheit
gediehen, sondern auch die entferntesten Welttheile gehen allmählig aus dem Schatten her-
vor, in welchem sie noch vor kurzem begraben lagen.“ Auch hier kommt das Licht aus Europa,
die Kenntnisse und Selbstkenntnisse außereuropäischer Völker liegen noch im Schatten euro-
päischer Interessen. Forster war zweifellos ein privilegierter Beobachter dieser gesamten
Entwicklung.Europäische Forschungsreisen um die Welt oder die Ausweitung des Wissens 479
als nach-modern erscheinen. Konstatierte Forster in diesen Zeilen ein Ende der
Geschichte und den Beginn einer Nachzeitlichkeit?
Die zitierte Passage bringt aber nur ein verändertes, beschleunigtes Zeit-
empfinden zum Ausdruck, das nicht bloß den Verfasser der Reise um die Welt
am Ausgang des 18. Jahrhunderts – und keineswegs allein auf Grund der Erfah-
rung der Französischen Revolution – ergriffen hatte. Eine neue Zeit und ein
neues Verständnis von Zeit waren zugleich entstanden! Georg Forster war aller-
dings kein Jules Michelet: Der französische Historiker hatte in seiner Sichtweise
der Geschichte die Epochenerfahrung der Französischen Revolution als Orien-
tierungspunkt gesetzt, für den alles, was danach kommen sollte, nur eine Zeit
nach dem Ende der Geschichte war – schaler Abklatsch eines Ereignisses von
menschheitsgeschichtlichem Rang, das ein für alle Male den Lauf der Geschichte
im Weltmaßstab verändert hatte.
Nicht so Forster, obwohl auch für ihn die Französische Revolution ein ein-
schneidendes Epochenereignis und Epochenerlebnis war. Die prägnante Cha-
rakterisierung dieser weltgeschichtlichen Ära der europäischen Expansion,
ihrer weltweiten Handelsverflechtungen und ihrer wissenschaftlichen wie „lite-
rarischen“ Aufarbeitung ließ keinen Zweifel daran aufkommen, dass es sich im
Sinne Georg Forsters um einen unaufhaltsamen, unabänderlichen Prozess han-
delte, der von den unterschiedlichsten Interessen und Spekulationen „mit oder
ohne Bewußtseyn“ dieser Entwicklungen vorangetrieben werde. Georg Forster
besaß folglich ein klares Epochenbewusstsein seiner Zeit; zweifellos eine Frucht
seiner Reisen, die immer wieder seinen Beobachterstandpunkt veränderten und
ihm andere Perspektiven auf seine Zeit ermöglichten. Es waren diese Bewegun-
gen und ihre ständigen Reflexionen, die ihn von seinen Zeitgenossen nicht nur
in Deutschland unterschieden.
Lassen Sie uns noch ein letztes Mal auf den Beginn des obigen Zitats zurück-
kommen! Mit dem Ausfüllen aller ,Lücken‘ sind die Spielräume für jene Utopien,
die im Zeichen von Thomas Morus’ Utopia aus dem Jahr 1516 im Kontext der ers-
ten Phase beschleunigter Globalisierung entstanden, längst deutlich kleiner ge-
worden und zunehmend geschwunden. Forsters Bemerkungen machen nebenbei
darauf aufmerksam, dass der schwindende Raum für den „u-topos“ am Ausgang
des 18. Jahrhunderts eine Situation entstehen lässt, in welcher nun nicht mehr
der Raum, sondern die Zeit zur Projektionsfläche des Ersehnten, zumindest aber
zum Erprobungsmittel des Erdachten wird: Die Uchronie29 entsteht und findet in
29 Vgl. hierzu Krauß, Henning: Der Ursprung des geschichtlichen Weltbildes, die Herausbil-
dung der „opinion publique“ und die literarischen Uchronien. In: Romanistische Zeitschrift für480 Europäische Forschungsreisen um die Welt oder die Ausweitung des Wissens
Louis-Sébastien Merciers L’an 244030 ihren epochemachenden und bis in George
Orwells vergangene Zukunftswelten fortwirkenden literarischen Ausdruck.
Der Hinweis auf den veränderten Kenntnisstand insbesondere der europäi-
schen Wissenschaft als Resultat jenes Expansionsprozesses, der durch die ver-
stärkte Zirkulation und Aufhäufung der unterschiedlichsten Wissensbereiche
zum Ende des naturgeschichtlichen Tableaus beigetragen hatte, verändert nicht
allein wissenschaftliche Epistemologien, sondern auch das Leben und Erleben
einer Welt, die für die Zeitgenossen wesentlich weiter geworden ist. Nicht nur sei
„unsere jetzige physische und statistische Kenntniß von Europa zur Vollkom-
menheit gediehen, sondern auch die entferntesten Welttheile“ aus dem Schatten
hervorgetreten, „in welchem sie noch vor kurzem begraben lagen“.31 Kein Zwei-
fel: Das Weltbewusstsein hatte sich im Kontext der zweiten Phase beschleunigter
Globalisierung längst zu verändern begonnen!
Die Lichtmetaphorik der Aufklärung wirft ein deutliches Licht auf Forsters
eigenen Standpunkt: Die Fahrten von James Cook an die Nordwestküste Ameri-
kas hätten viele neue Erkenntnisse gebracht, so dass „ohne ihn wohl schwer-
lich der Pelzhandel zwischen China und dieser neuentdeckten Küste zu Stande
gekommen und zwischen den Höfen von Madrid und London eine Kollision
desfalls entstanden wäre“.32 Noch hatte die erst 1799 gegründete Russisch-Ame-
rikanische Handelskompagnie, ohne deren Existenz es nicht zu den Weltreisen
des Freiherrn von Langsdorff und von Adelbert von Chamisso gekommen wäre,
nicht in diese Verhältnisse eingegriffen. Seit dem Ende des Siebenjährigen Krie-
ges war in ganz Europa aber das Bewusstsein dafür gewachsen, dass sich lokale
Auseinandersetzungen rasch in regionale, ja in globale Konflikte verwandeln
konnten, die gerade auch im außereuropäischen Raum – wie der langanhal-
tende Prozess der „Independencia“ nur wenige Jahrzehnte später in der ameri-
kanischen Hemisphäre zeigen sollte – zu fundamentalen Umwälzungen führen
Literaturgeschichte (Heidelberg) XI, 3–4 (1987), S. 337–352; und (ders.): La „Querelle des Anci-
ens et des Modernes“ et le début de l’uchronie littéraire. In: Hudde, Hinrich / Kuon, Peter
(Hg.): De l’utopie à l’uchronie. Actes du colloque d’Erlangen, 16–18 octobre 1986. Tübingen:
Narr 1988, S. 89–98.
30 Vgl. Jurt, Joseph: Louis-Sébastien Mercier et le problème de l’esclavage et des colonies. In:
Anales del Caribe (Santiago de Cuba) 7–8 (1987 / 1988), S. 94–107; sowie (ders.): Stadtreform
und utopischer Entwurf: von Alberti bis L.-S. Mercier. In: Hahn, Kurt / Hausmann, Matthias
(Hg.): Visionen des Urbanen. (Anti-) utopische Stadtentwürfe in der französischen Wort- und
Bildkunst. Heidelberg: Winter 2012, S. 21–31.
31 Forster, Georg: Die Nordwestküste von Amerika, und der dortige Pelzhandel, S. 393.
32 Ebda., S. 395.Europäische Forschungsreisen um die Welt oder die Ausweitung des Wissens 481
oder zumindest beitragen konnten. Selbstverständlich zählt auch die Haitiani-
sche Revolution zu jenen historischen Ereignissen, welche die Macht und Gewalt
der in Gang gesetzten unerhörten Möglichkeiten gesellschaftlicher Umwälzungen
allen denkenden Zeitgenossen vor Augen führten.
Die Problematik globaler Konvivenz hatte längst aufgehört, eine abstrakte
philosophische Frage zu sein: Im Sinne selbst eines Cornelius de Pauw war die
Auslöschung des Planeten durch den Menschen selbst zu einer realen Möglich-
keit geworden. Auch jene, die in der Berliner Debatte beziehungsweise im „Dis-
put um die Neue Welt“ auf der anderen Seite standen, vermochten dies nicht
anders zu sehen. Gerade deshalb blieb diese Frage eine brennende philosophi-
sche Herausforderung: Die Menschheit war in die Moderne eingetreten und
damit in eine Epoche, in welcher die Selbstzerstörung des Menschen durch den
Menschen zu einer realen Möglichkeit wurde.
Diese globale Bedrohung ist in unserer Epoche nur noch größer geworden.
Zudem könnte man die These wagen, dass es gerade Phasen des Zerfalls einer
beschleunigten Globalisierung sind, die als eine rasante Vervielfachung der un-
terschiedlichsten lokalen und regionalen Konfliktentwicklungen erlebt werden.
Diese regional überall aufflammenden Konflikte vermögen freilich immer welt-
weite Veränderungen hervorzurufen, die für den gesamten Globus bedrohlich
werden können. Anders als bei Georg Forster finden wir uns heute, Jahre nach
dem Ausgang der vierten Phase beschleunigter Globalisierung, in einer Situa-
tion, in der eine Geschichte nach der Geschichte, gleichsam ein „Posthistoire
Now!“33 nicht mehr erlebt werden kann. Die Entschleunigung von Globalisie-
rung, wie sie uns derzeit etwa in einer Welle neuer Nationalismen und Funda-
mentalismen, aber auch Aufrüstungen aller Art entgegentritt, ist mithin gerade
nicht mit einem Erleben politischer, geschichtlicher oder gesellschaftlicher
Ruhe und Stabilität gleichzusetzen. Und wie nach dem Ende der zweiten und
der dritten Phase verfügt die Menschheit auch nach der vierten Phase beschleu-
nigter Globalisierung nicht über wirksame internationale Mechanismen einer
Konfliktregelung. So fällt es auch im Vergleich mit dem 18. Jahrhundert schwer,
in der Menschheitsgeschichte einen ethischen Fortschritt oder Verbesserungen
zumindest auf der Ebene internationaler Konfliktlösungsstrategien zu erkennen.
Der ‚Ausweg‘ von der mangels unbekannter Räume von der Utopie in die
Uchronie umspringenden Projektion ist sicherlich nicht die einzige Möglichkeit,
mit einer Raum-Zeit-Problematik ‚fertig‘ zu werden, die sich als Folge westli-
33 Vgl. Gumbrecht, Hans Ulrich: Posthistoire now. In (ders. / Link-Heer, Ursula, Hg.): Epo-
chenschwellen und Epochenstrukturen in der Literatur- und Sprachhistorie. Frankfurt am Main:
Suhrkamp 1985, S. 34–50.482 Europäische Forschungsreisen um die Welt oder die Ausweitung des Wissens
cher Expansion und wissenschaftlicher Welt-Ausdehnung ergab. Denn ebenso
Georg Forster, Freiherr von Langsdorff oder Alexander von Humboldt wählten
auf ihr eigenes Leben bezogene und damit lebbare Reaktionsweisen, die sich
nicht alleine auf den Raum oder alleine auf die Zeit, sondern auf eine spezifi-
sche Verbindung der Dimensionen von Raum und Zeit bezogen. Sie wählten,
mit anderen Worten, die Reise als spezifische Seinsweise und entwickelten und
lebten das, was an dieser Stelle als – zugegebenermaßen gräcolatinisierter –
Neologismus begrifflich eingeführt sei: die Vektopie. Was ist neben Utopie und
Uchronie unter einer Vektopie zu verstehen?
Der Begriff der Vektopie steht für eine Verknüpfung der Projektionsflächen
von Utopie und Uchronie in Raum und Zeit auf eine Weise, welche die kineti-
sche34 Dimension, die Erfahrung und das Erleben von Bewegung und mehr
noch von Vektorizität, zum eigentlichen Erprobungs- und Erlebensmittel von
Welt macht. Die ständige Bewegung in Raum und Zeit wird zum Lebens-Mittel
des reisenden Subjekts. Dieses weltweit ausgedehnte Welterleben beinhaltet
zugleich ein Weiter-Leben, das an dieser Stelle unserer Argumentation zu-
nächst in einem räumlichen Sinne verstanden sei und folglich in erster Linie
den Radius des von Forster so genannten „Erfahrungswissens“ betrifft. Es ist
das Erleben einer weiter gespannten Welt, das sehr wohl mit einem epistemolo-
gisch bedeutungsvollen Weiter-Denken verbunden ist.35
Anders als Utopie und Uchronie ist in der Vektopie eine materielle, auf Kör-
per und Leib bezogene Dimension und damit ein Leben und Erleben von Welt
miteinbezogen, das ohne die ständige Ortsveränderung, ohne ein immer wieder
aufgenommenes Reisen nicht auskommt. Wissen wird aus der Bewegung er-
zeugt: Welt wird aus der Bewegung angeeignet: Weltwissen ist ohne Reisen
nicht zu haben. Die Vektopie entfaltet die Projektionen eines Lebens nicht aus
dem Raum, nicht aus der Zeit allein, sondern dank deren Kombinatorik aus
einer Vektorizität, in der alle früheren Bewegungen gespeichert und alle nach-
folgenden Bewegungen bereits angelegt sind. Die Vektopie ist mehr als eine
Denkfigur: Sie ist vital mit dem Leben verknüpft und damit eine Lebensfigur,
welche wir bei den Reisenden des ausgehenden 18. Jahrhunderts gehäuft an-
treffen können.
34 Das sich anbietende griechische Kompositum einer „Kinetopie“ besäße den Nachteil, zu
stark mit vorwiegend kinematographischen, aber auch kinesiologischen Belegungen konfron-
tiert zu sein und entsprechend zu Missverständnissen führen zu müssen.
35 Vgl. zum Begriff des Weiter-Denkens Ette, Ottmar: Weiter denken. Viellogisches denken /
viellogisches Denken und die Wege zu einer Epistemologie der Erweiterung. In: Romanistische
Zeitschrift für Literaturgeschichte / Cahiers d’Histoire des Littératures Romanes (Heidelberg) XL,
1–4 (2016), S. 331–355.Sie können auch lesen