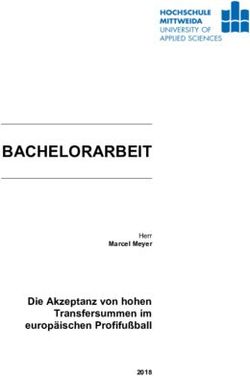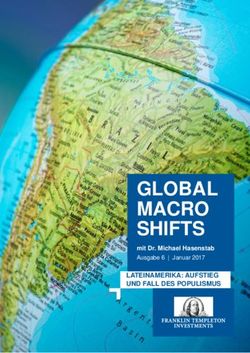Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes - Stadt Gladbeck - In Zusammenarbeit mit
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Bearbeitung durch: Gertec GmbH Ingenieurgesellschaft Martin-Kremmer-Str. 12 45327 Essen Telefon: +49 [0]201 24 564-0 Auftraggeber: Stadt Gladbeck Willy-Brandt-Platz 2 45964 Gladbeck
5 Inhaltsverzeichnis Abbildungsverzeichnis 7 Tabellenverzeichnis 9 Abkürzungsverzeichnis 11 Vorwort 12 1 Ausgangssituation 13 2 Validierung der bisherigen Maßnahmen 16 2.1 Bisherige Aktivitäten der Stadt 16 2.2 Öffentlichkeitsarbeit 25 2.3 Fazit 27 3 Ermittlung eines Zielkorridors 28 3.1 Entwicklung von Klimaschutzszenarien und Leitlinien 32 3.2 Entwicklung eines Fahrplans zur klimaneutralen Energieversorgung 39 3.3 Zwischenfazit 44 4 Handlungsfelder und Leitprojekte 45 4.1 Handlungsfeld 1 – Gebäude und Quartiere 45 4.2 Handlungsfeld 2 – Industrie und GHD 47 4.3 Handlungsfeld 3 – Energieversorgung und erneuerbare Energien 49 4.4 Handlungsfeld 4 – Kommune als Vorbild 49 4.5 Handlungsfeld 5 – Klimaschonende Mobilität 51 4.6 Handlungsfeld 6 – Klimaschonender Lebensstil 51 4.7 Themenspeicher 53
7
Abbildungsverzeichnis
Abbildung 1 RVR THG-Bilanz und Fortschreibung bis 2019 der Stadt Gladbeck .................................. 14
Abbildung 2 sektorale Aufteilung der RVR THG-Bilanz und Fortschreibung bis 2019 der Stadt
Gladbeck ........................................................................................................................... 15
Abbildung 3 Bisherige und geplante Klimaschutzmaßnahmen in Gladbeck zum Thema Mobilität...... 17
Abbildung 4 Bisherige und geplante Klimaschutzmaßnahmen in Gladbeck zum Thema
Quartierskonzepte ............................................................................................................ 21
Abbildung 5 prozentuale Einsparung der CO2-Emissionen durch Umsetzung der geförderten
Sanierungsmaßnahmen in den Quartieren Stadtmitte und Rentfort-Nord....................... 22
Abbildung 6 Bisher durchgeführte Klimaschutzmaßnahmen in Gladbeck im Bereich kommunale
Liegenschaften ................................................................................................................. 24
Abbildung 7 Logo der Dachmarke „Gladbeck. 78.000 Klimaretter! Wenn du mitmachst“ ................. 25
Abbildung 8 Paris-konformer Zielkorridor zur Senkung der CO2-Emissionen zwischen 2030 und 2036
.......................................................................................................................................... 30
Abbildung 9 Die THG-Emissionen in den Sektoren (Quelle: Klimaschutzplaner 2019) ........................ 31
Abbildung 10 Endenergiebedarf in den Anwendungssektoren .............................................................. 34
Abbildung 11 Treibhausgasentwicklung in den Anwendungssektoren .................................................. 35
Abbildung 12 Endenergie nach Verbrauchssektoren .............................................................................. 36
Abbildung 13 Treibhausgasemissionen nach Verbrauchssektoren ........................................................ 37
Abbildung 14 Budgetbetrachtung des Szenarios anhand des 1,5 Grad- und 1,75 Grad-Ziels ................ 38
Abbildung 15 Strombedarfsentwicklung nach Anwendungssektor ....................................................... 40
Abbildung 16 Energieträger im Wärmemix ............................................................................................ 40
Abbildung 17 Anteile der Energieträger im Wärmemix .......................................................................... 41
Abbildung 18 Energieträger im Fernwärmemix ...................................................................................... 42
Abbildung 19 Entwicklung des Fernwärmeabsatzes und der Kundenanzahl ......................................... 42
Abbildung 20 Ausbaupfad der erneuerbaren Stromerzeugung .............................................................. 43
Abbildung 21 Strombedarf nach Quelle (regional / importiert) ............................................................... 43
Abbildung 22 Fortschritt der Sektorenkopplung über den gesamten Endenergiebedarf Gladbecks ..... 449 Tabellenverzeichnis Tabelle 1 Endenergiebedarf nach Anwendungssektoren 34 Tabelle 2 Treibhausgasentwicklung in den Anwendungssektoren 35 Tabelle 3 Endenergiebedarf nach Verbrauchssektoren 36 Tabelle 4 Treibhausgasemissionen nach Verbrauchssektor 37 Tabelle 5 Leitlinien des Transformationsprozesses 38 Tabelle 6 Themenspeicher 56
11 Abkürzungsverzeichnis a Jahr BHKW Blockheizkraftwerk BISKO Bilanzierungs-Systematik Kommunal ca. circa CO2 Kohlenstoffdioxid d.h. das heißt EnEV Energie-Einsparverordnung EW Einwohner ggf. gegebenenfalls GHD Gewerbe/Handel/Dienstleistung GWh Gigawattstunde ha Hektar inkl. inklusive IPCC Intergouvernemental Panel on Climate Change IT.NRW Information und Technik Nordrhein-Westfalen IWU Institut Wohnen und Umwelt KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau KMU kleine und mittlere Unternehmen kWel Kilowatt elektrisch kWh Kilowattstunde KWK Kraft-Wärme-Kopplung LANUV Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz NRW LED Light Emitting Diode MIV Motorisierter Individualverkehr MWh Megawattstunde PV Photovoltaik rd. Rund RVR Regionalverband Ruhr SRU Sachverständigenrats für Umweltfragen t Tonne THG Treibhausgas Tsd. Tausend u.a. unter anderem WKA Windkraftanlage z.B. zum Beispiel z.T. zum Teil
12 Vorwort Die Folgen des Klimawandels und die damit verbundenen Veränderungen unseres Lebensraumes zählen zu den großen Herausforderungen unserer Zeit. Trockene und heiße Sommer, niederschlagsreiche Winter und Extremwetterereignisse werden das Klima auch hier in Gladbeck deutlich verändern. Klimaschutz ist nunmehr ein Thema, das uns alle angeht. Das Bewusstsein hierfür wächst in globalen Dimensionen, gehandelt werden muss aber insbesondere auch vor Ort im Rahmen unseres kommunalen Handlungsspielraums. Dabei kommt den Kommunen eine wichtige Vorbild- und Leitfunktion zu, denn Entscheidungen auf höherer Ebene sind ohne engagierte Basis nicht umsetzbar. Daher hat Gladbeck bereits im Jahr 2010 ein integriertes, kommunales Klimaschutzkonzept erstellt und seitdem eine Vielzahl an Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt. Die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes wurde im Rahmen des Beschlusses zum Klimanotstand beschlossen, um den Notwendigkeiten bzw. Anforderungen der letztjährigen und gegenwärtigen klimatischen Veränderungen sowie den Anforderungen des Klimanotstand-Beschlusses Rechnung zu tragen. Mit dem vorliegenden Bericht und der Ausweitung des Instrumentes „Klimaschutzkonzept“ ist eine gute Basis erarbeitet worden, um in Gladbeck die internationalen und nationalen Klimaschutzziele zu erreichen! Mit dem Konzept liegt nun ein Bericht zum Klimaschutz der Stadt Gladbeck vor. Er dokumentiert und bewertet den bisherigen Einsatz der vielen kommunalen Akteurinnen und Akteure und bringt sie zusammen. Für das Erreichen der Klimaneutralität bis zum Jahr 2042 unter Einhaltung des 1,75-Grad- Ziels wurden ein Zielszenario und daraus ableitend Leitprojekte entwickelt, um den Energieverbrauch und den CO2- Ausstoß der Stadt Gladbeck weiter zu reduzieren. Klimaschutz ist aber keine Aufgabe, die Politik und Verwaltung alleine bewältigen können. Die erfolgreiche Umsetzung ist eine Gemeinschaftsaufgabe vor Ort und kann nur im Einklang mit der Stärkung des Klimabewusstseins und einem Umdenken in der persönlichen Alltagsgestaltung jedes Einzelnen gelingen. Wir sind deshalb alle gefordert, sorgsam und ressourcenschonend mit unserer Umwelt umzugehen. Mit dem hier vorliegenden Klimaschutzkonzept haben wir eine Basis geschaffen, diese Ziele gemeinsam zu erreichen. Gemeinsam können wir im Verbund mit Bürgerinnen und Bürgern, der Wirtschaft, Vereinen und Verbänden den Klimaschutzgedanken weiter verbreiten, effektive Maßnahmen initiieren und umsetzen, um unseren Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Bettina Weist Dr. Volker Kreuzer Bürgermeisterin Stadtbaurat
13
1 Ausgangssituation
Der anthropogene Klimawandel stellt eine Herausforderung für Kommunen dar. Der Handlungsbedarf
hat vor allem im letzten Jahrhundert zugenommen, sodass die Umsetzung entsprechender
Maßnahmen auf globaler und lokaler Ebene erforderlich ist. Dies wird auch durch die Einführung neuer
Gesetze und Abkommen auf allen Ebenen deutlich. Dazu gehört das Pariser Klimaabkommen der
Vereinten Nationen von 2015, in dem 195 Staaten vereinbart haben, den globalen Temperaturanstieg
auf unter 2,0 Grad, besser noch 1,5 Grad, bis zum Ende des Jahrhunderts zu begrenzen, sowie
zusätzliche kontinentale (europäische), nationale und landesspezifische Ziele einzuhalten.
Die globalen Durchschnittstemperaturen haben sich seit der industriellen Revolution stetig erhöht. Der
Temperaturanstieg wird durch einen großen Ressourcenverbrauch und damit einhergehende
Treibhausgasemissionen, für die die industrialisierten Staaten in besonderem Maße verantwortlich sind,
verursacht.1 Die Auswirkungen bzw. die Folgen des Klimawandels sind heute auch schon in der Stadt
Gladbeck zu spüren. Hierzu zählen bereits häufigere und längere Hitzeperioden, Starkregenereignisse
und Stürme, vor allem in den Jahren 2017 und 2018. Global ist kurz- bis mittelfristig auch mit einer
Zunahme von Dürreereignissen sowie einer grundsätzlichen Destabilisierung der Wettersituation zu
rechnen.
Die Stadt Gladbeck ist sich ihrer Rolle im Spannungsfeld zwischen lokaler und globaler Verantwortung
bewusst. Daher hat Gladbeck bereits im Jahr 2010 ein integriertes, kommunales Klimaschutzkonzept
erstellt. Die Fortschreibung des Klimaschutz-Konzeptes wurde im Rahmen des Beschlusses zum
Klimanotstand beschlossen, um den Notwendigkeiten bzw. Anforderungen der letztjährigen und
gegenwärtigen klimatischen Veränderungen sowie den Anforderungen des Klimanotstand-Beschlusses
Rechnung zu tragen. Mit der Erarbeitung des vorliegenden Konzeptes wurde im August 2020
begonnen. Dabei kann die Stadt auf ihrem bisherigen Engagement aufbauen, etwa die energetische
Quartierssanierung durch beispielsweise die Erstellung des energetischen Quartierskonzepts Brauck-
West / Butendorf und die Etablierung eines Sanierungsmanagement sowie der Teilnahme am
„Innovation City roll out“. Bereits 1978 wurde ein städtisches Energiemanagement eingeführt, welches
durch Energiecontrolling und Sanierungsmaßnahmen den Energieverbrauch kontinuierlich senkt. Die
Stadt Gladbeck hat zudem bereits auf 20 kommunalen Gebäuden Photovoltaikanlagen installiert. Dies
soll in Zukunft weiter ausgebaut werden. Die im letzten Jahr beschlossene Gründachstrategie schafft
zum einen Anreize über Förderung, sein Dach in ein Gründach umzuwandeln, zum anderen soll die
Dachbegrünung bei geeigneten Dächern in zukünftigen Bebauungsplänen festgesetzt werden. Darüber
hinaus ist Gladbeck Mitglied im Zukunftsnetz Mobilität NRW und verfügt über einen separaten
Arbeitskreis „Nachhaltige Mobilität“. Die Kampagne STADTRADELN wird seit langem in der Stadt
Gladbeck jährlich erfolgreich durchgeführt und motiviert spielerisch die Bevölkerung ihre Alltagswege,
wenn möglich, umweltfreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen.
Mit dem Instrument Klimaschutzkonzept ist die Stadt Gladbeck in der Lage, Klimaschutz-,
Energieeffizienz- und Nachhaltigkeitsaktivitäten anzustoßen, die auf kommunaler Ebene flächenhaft
Wirkung entfalten können. Drei wesentliche Ziele verfolgt das Konzept:
Als strategische Entscheidungsgrundlage und Planungshilfe dienen,
Akzeptanz und Umsetzung durch Partizipation vorbereiten,
durch Umsetzung des Konzepts auf lokaler Ebene einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.
1
Siehe auch http://report.ipcc.ch/sr15/pdf/sr15_spm_final.pdf14 Aus dem Inhalt ergeben sich weitreichende Zukunftsaufgaben. Die Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes bietet für die Stadt Gladbeck eine weitere Möglichkeit, das Thema Klimaschutz in der Stadtgesellschaft zu verankern, die Bevölkerung diesbezüglich zu sensibilisieren und anknüpfend an bisherige Aktivitäten weitere Leitprojekte zu ergreifen. Das partizipativ erarbeitete Programm der Leitprojekte dieses Klimaschutzkonzeptes, welches die spezifische Ausgangssituation der Stadt Gladbeck ihre Möglichkeiten und Beschränkungen berücksichtigt, soll zum einen die Einwohnerschaft erreichen und motivieren und somit eine breite Flächenwirkung erzielen. Zum anderen sind Projekte enthalten, die in enger Abstimmung mit der Stadtverwaltung entwickelt wurden. Diese überzeugen die Fachbereichsleitenden und können von der Mitarbeiterschaft verstanden, gutgeheißen und möglichst selbstständig umgesetzt werden, um somit einen starken Rückhalt in der Verwaltung zu erreichen. Für das im Jahr 2010 für die Stadt erstellte integrierte Klimaschutzkonzept wurde ein Maßnahmenprogramm entwickelt, mit welchem eine Gesamtminderung der CO 2-Emissionen von ca. 85.500 t ermittelt wurde. Viele der vorgeschlagenen Maßnahmen wurden teilweise in abgeänderter Form umgesetzt (siehe Kapitel 2). Die Bilanz mit dem Bilanzierungsjahr 2007 wurde nicht kontinuierlich weitergeführt. Daher wurde auf die Bilanz des Regionalverband Ruhr (RVR) für Gladbeck zurückgegriffen ( Fehler! Verweisquelle konnte icht gefunden werden.). Dabei ist gegenüber der Bilanz im vorherigen Klimaschutzkonzept im Wirtschaftssektor eine methodische Änderung durchgeführt worden, da die Betriebe, welche am Emissionshandel teilnehmen, nicht herausgerechnet wurden. Ebenso ist die Datenqualität für den Wirtschaftssektor ausbaufähig und der Anteil des Sektors höher einzuschätzen. An der Grundaussage, dass zur Erreichung der Klimaschutzziele auch weiterhin große Anstrengungen unternommen werden müssen, ändert sich nichts. Die RVR-Bilanz wurde zudem bis zum Jahr 2012 zurückgeschrieben und wird zukünftig weiter fortgeschrieben, sodass die Bilanz als Monitoring-Instrument genutzt werden kann. Abbildung 1 RVR THG-Bilanz und Fortschreibung bis 2019 der Stadt Gladbeck
15
Aus der Bilanz wird deutlich, dass insgesamt bislang nur geringe Einsparerfolge (ca. 5.710 t, entspricht
ca. 1 %) gegenüber 2012 erreicht wurden. Dabei ist jedoch in Abbildung 2 zu beachten, dass der
Wirtschaftssektor, welcher in Gladbeck einen großen Anteil (50 %) ausmacht, massiv konjunkturell
geprägt ist und über einen längeren Zeitraum betrachtet werden muss. Jedoch können die
Einsparungen im Sektor der privaten Haushalte genutzt werden, um den Erfolg zu messen. In diesem
Fall ist die Unsicherheit der konjunkturellen Schwankung nicht vorhanden. Es wird ersichtlich, dass in
dem Sektor Einsparungen von 41,2 Tsd. t CO 2eq/a erreicht wurden, was ca. 21 % entspricht und
hinsichtlich des Bevölkerungswachstums der Stadt Gladbeck positiv zu bewerten ist.
Abbildung 2 sektorale Aufteilung der RVR THG-Bilanz und Fortschreibung bis 2019 der Stadt
Gladbeck
Die Anforderungen an die Klimaschutzziele haben sich seit 2010 deutlich erhöht und somit auch der
Druck, wirksame Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen. Die Leitprojekte sollen der Stadt Gladbeck
einen möglichst großen Handlungsspielraum einräumen, die aktuellen Klimaschutzziele zu erreichen.16
2 Validierung der bisherigen Maßnahmen
2.1 Bisherige Aktivitäten der Stadt
Die Stadt Gladbeck hat bereits mit großem Engagement Klimaschutzmaßnahmen erfolgreich
angestoßen und umgesetzt. Grundlage der zahlreichen Klimaschutzmaßnahmen waren unter anderem
die im kommunalen Klimaschutzkonzept von 2010 vorgeschlagenen Maßnahmen. Viele der dort
aufgeführten Maßnahmen befinden sich bereits in Umsetzung und wurden im Laufe der Zeit verstetigt
und den aktuellen Bedürfnissen angepasst.
Um eine Übersicht dieser Klimaschutzmaßnahmen zu erhalten, wurden sie im Vorfeld erfasst und
anschließend in themenbezogenen Gesprächsrunden vervollständigt und diskutiert.
Aufgrund der anhaltenden Kontaktbeschränkungen während der Corona-Pandemie wurde überwiegend
auf die Durchführung von Workshops in Präsenz verzichtet. Stattdessen wurden die Besprechungen
per Videokonferenz durchgeführt.
Die nachfolgenden Mind-Maps zeigen die bisherigen und geplanten Klimaschutzmaßnahmen der Stadt
Gladbeck der folgenden Themengebiete:
Mobilität
Quartierskonzepte
Kommunale Liegenschaften17 Abbildung 3 Bisherige und geplante Klimaschutzmaßnahmen in Gladbeck zum Thema Mobilität
Mobilität Die Stadt Gladbeck hat bereits sehr viele Klimaschutzmaßnahmen im Bereich Mobilität ergriffen und plant mit dem Forschungsprojekt „Gladbecker Mobilität für alle (GlaMoBi)“ nachhaltige individuelle Mobilität auf gerechte Weise zu schaffen und zu fördern. Grundsätzlich ist vor dem Hintergrund des Klimaschutzes der Modal Split2 entscheidend. Alle Maßnahmen mit Bezug zum Bereich der Mobilität haben somit immer eine Verschiebung des Modal Split hin zu den Verkehrsträgern des Umweltverbundes, Fahrrad- und Fußverkehr und ÖPNV als Ziel. So zielt zum Beispiel der Ausbau von Mobilstation insbesondere an den Haltepunkten des SPNV (Schienengebundener Personennahverkehr) auf eine komfortable Verknüpfung umweltfreundlicher Verkehrsmittel als Alternative zum privaten Kfz ab. Die Einheimischen sollen durch zahlreiche Aktionen rund um das Rad zum Fahrradfahren motiviert werden. So wird die jährliche Teilnahme der Stadt Gladbeck am STADTRADELN beispielsweise durch Aktionstage, eine Fahrradwaschstraße und weitere Aktionen flankiert. Der Radverkehr wird durch die Planung und den Bau von Rad- und Schnellradwegen verstärkt berücksichtigt. So genannte „Runde Tische“ zum Thema Radverkehr und Nahverkehr bringen neue Ideen und Transparenz in das Thema. Mit dem Runden Tisch „Nachhaltige Mobilität“ hat die Stadt Gladbeck eine Dialogplattform für alle Akteure aus dem Bereich der Mobilität geschaffen. Hier treffen regelmäßig Vertreter:innen aus Zivilgesellschaft, Politik, Sicherheitsbehörden, Nahverkehrsunternehmen und Verwaltung zusammen, um Projekte und Planungen frühzeitig zu besprechen. Mit dem Beschluss des Radverkehrskonzeptes 2025 im September 2019 ist ein wichtiger Grundstein für die systematische Förderung des Radverkehrs in den Bereichen Infrastruktur, Kommunikation, Service und Öffentlichkeitsarbeit gelegt worden. Daraus hat sich zwischenzeitlich zudem ein eigenes Fahrradstraßenkonzept entwickelt. Die Berücksichtigung des Radverkehrs bei allen städtischen Planungen ist damit fest verankert Daneben konnten auch zahlreiche Maßnahmen erarbeitet werden, die ausschließlich auf einen höheren Radverkehrsanteil zielen. Die Erfahrungen der Stadt Gladbeck im Bereich Mobilität zeigen, dass die Projekte und Aktionen auf großen Zuspruch bei der Bürgerschaft stoßen und Aktionen wie das STADTRADELN ein fester Termin im Kalender der Gladbecker Bevölkerung sind. Auch die Förderung von Lastenrädern und die Schaffung von Fahrradabstellmöglichkeiten, auch für Lastenräder, sorgen dafür, dass das Fahrrad als umweltschonendes Transportmittel in Gladbeck immer mehr an Attraktivität gewinnt. Ende 2020 wurde für die Stadt Gladbeck ein städtisches Elektromobilitätskonzept erstellt, welches sich aktuell in der Umsetzung befindet. Schwerpunkt des Konzeptes ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur für die Bürger:innen und Besucher:innen der Stadt Gladbeck. So soll beispielsweise auch eine Ladeinfrastruktur für die Einwohnerschaft ohne eigenes Grundstück zur Verfügung gestellt werden. Die Schaffung von Lademöglichkeiten, unabhängig vom eigenen Grundstück, ist eine Grundvoraussetzung, um den Anteil elektrisch betriebener Fahrzeuge zu erhöhen. Auch die Beratung von Wohnungsbaugenossenschaften bezüglich der Bereitstellung von Ladeinfrastruktur ist eine gute Möglichkeit, die Entscheidung der Bevölkerung auf ein elektrisch betriebenes Fahrzeug umzusteigen, zu erleichtern. Die Stadt Gladbeck hat beim Thema Mobilität nicht nur die Erwachsenen im Blick. Im kontinuierlichen Austausch mit den Schulen sollen Schulwege sicherer und umweltfreundlicher gestaltet werden. Auch die Einrichtung temporärer Spielstraßen soll zeigen, dass mit einer Reduktion des Autoverkehrs nicht nur Umwelt- und Klimaschutz betrieben werden kann, sondern auch die Lebensqualität aller 2 Als Modal Split wird die Verteilung des Verkehrsaufkommens auf verschiedene Verkehrsmittel bezeichnet. Er beschreibt das Mobilitätsverhalten, also die Wahl des jeweiligen Verkehrsmittels durch die Bürger:innen für die Wege zur Arbeit, Ausbildung, zum Einkaufen und in der Freizeit.
19 Bürger:innen gesteigert werden kann. Wenn diese Kampagnen dauerhaft betrieben werden und Schulen und Kitas auf diesem Weg Elterntaxis weitestgehend abschaffen können, gewinnen alle, indem Emissionen reduziert werden, Unfälle beim Bringen und Abholen vermieden werden und den Kindern eine nachhaltige und eigenständige Mobilität möglich gemacht wird. Auch im Rahmen von InnovationCity ist die Förderung nachhaltiger Mobilität ein wichtiger Aspekt. Schwerpunkte sind hier die Förderung von Lastenrädern und ebenfalls die Beratung zum Thema Elektromobilität.
Quartierskonzepte Im Rahmen des InnovationCity roll out werden die Quartiere Stadtmitte und Rentfort-Nord in Gladbeck verstärkt in den Fokus genommen. Nachfolgende Mindmap zeigt einen Ausschnitt der umgesetzten Maßnahmen der Quartierskonzepte. Die Stadt Gladbeck unterstützt die energetische Quartierssanierung. innerhalb des InnovationCity roll out über das Förderprogramm „InnovationCity Sanierungszuschuss“ unter anderem Sanierungsmaßnahmen von privaten Wohngebäuden in den Quartieren Rentfort-Nord und Stadtmitte. Die kommunale Förderrichtlinie soll Hauseigentümerschaft durch einen nicht rückzahlbaren Zuschuss einen Anreiz bieten, energetische Sanierungsmaßnahmen umzusetzen oder den Einbau effizienter Heizungsanlagen vorzunehmen. Aktuell ist geplant, auch im Quartier Brauck-West/Butendorf ein Sanierungsmanagement und entsprechende Fördermittel zu etablieren, im Frühjahr 2022 soll das Quartiersmanagement starten.
21 Abbildung 4 Bisherige und geplante Klimaschutzmaßnahmen in Gladbeck zum Thema Quartierskonzepte
Im Rahmen der Konzepterstellung hat die InnovationCity Management GmbH ein Excel basiertes
Berechnungstool entwickelt, welches die eingereichten Förder- bzw. Modernisierungsanträge der
Antragstellenden für den Wohngebäudebereich hinsichtlich einer CO2-Einsparung und Energieeffizienz
bewertet.
Für folgende Maßnahmen(-kategorien) werden die CO 2-Einsparungen in Kilogramm pro Jahr berechnet:
Dämmung der Außenwände
Austausch der Fenster
Dämmung der Dach- oder Geschossdecke
Dämmung der Kellerdecke
Austausch der Heizungsanlage
Hydraulischer Abgleich
Errichtung einer Photovoltaikanlage
Errichtung einer Solarthermieanlage
Bis zum Zeitpunkt der Berichterstellung konnten insgesamt 415,8 t CO 2-Emissionen durch die
Umsetzung der geförderten Sanierungsmaßnahmen in den Stadtteilen Rentfort-Nord und Stadtmitte
eingespart werden, wobei davon etwa 32 % auf die Dachdämmung (Stadtmitte), etwa 24 % auf die
Heizungserneuerung (Stadtmitte) und 12 % auf die Außenwanddämmung (Stadtmitte) fallen. Etwa
18,5 % fallen auf die gesamten Sanierungsmaßnahmen im Quartier Rentford-Nord.
Abbildung 5 prozentuale Einsparung der CO2-Emissionen durch Umsetzung der geförderten
Sanierungsmaßnahmen in den Quartieren Stadtmitte und Rentfort-Nord23 Kommunale Liegenschaften Die Stadt Gladbeck erstellt seit 1978 jährlich einen Energiebericht, welcher die Verbrauchswerte und Kosten für Heizung, Strom und Wasser der städtischen Gebäude dokumentiert und bezüglich der CO 2- Emissionen bewertet sowie einen Überblick über die durchgeführten energetischen Sanierungsmaßnahmen an den städtischen Liegenschaften schafft. Nachfolgende Mindmap zeigt eine Übersicht der bisher durchgeführten Sanierungsmaßnahmen der kommunalen Liegenschaften.
Abbildung 6 Bisher durchgeführte Klimaschutzmaßnahmen in Gladbeck im Bereich kommunale Liegenschaften
Validierung der bisherigen Maßnahmen 25
Die langjährige Dokumentation der Energieverbräuche der Stadt Gladbeck zeigt eine
(witterungsbereinigte) Reduktion des Heizenergieverbrauchs von fast 57 % innerhalb der letzten
42 Jahre. Auch die CO2-Emissionen konnten durch Umstellung der Strom-Nachtspeicherheizungen und
den Verzicht auf Koks- und Kohleheizungen um fast 64 % innerhalb der letzten 42 Jahre reduziert
werden. Die zahlreichen energetischen Sanierungsmaßnahmen sorgen in Kombination mit der
Umstellung auf effiziente und erneuerbare Wärmeerzeugung für eine kontinuierliche CO 2-Minderung im
Bereich der kommunalen Liegenschaften.
Der Bezug von Ökostrom seit 2015 für die Gladbecker Liegenschaften hat nicht nur Vorbildcharakter,
sondern sorgt auch dafür, dass der Anteil erneuerbarer Energien im Strommix gesteigert wird.
Mit Erstellung des Energieberichts inklusive der Darstellung der durchgeführten
Sanierungsmaßnahmen zeigt die Stadt Gladbeck, wie wichtig ihr der effiziente und nachhaltige
Unterhalt ihrer Immobilien ist. Potenzial besteht in diesem Sektor noch in der Priorisierung und Planung
der Sanierungsmaßnahmen. Laut Aussage der Stadt werden die Sanierungsmaßnahmen nach
Dringlichkeit durchgeführt und es besteht keine Möglichkeit zur langfristigen Planung, sodass die
anfallenden Sanierungsmaßnahmen meist gemäß den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt wurden, um
die Anforderungen der EnEV (Energieeinsparverordnung), bzw. des GEG (Gebäudeenergiegesetzes) zu
erfüllen. Wirtschaftliche Gründe verhinderten oftmals eine über den gesetzlich vorgeschriebenen
Standard hinausgehende Umsetzung der Sanierungsmaßnahmen.
2.2 Öffentlichkeitsarbeit
Die Stadt Gladbeck hat bereits ein großes Portfolio aus Klimaschutzprojekten und
Motivationskampagnen für die Einwohnerschaft ihrer Stadt. Die Dachmarke „Gladbeck. 78.000
Klimaretter! Wenn du mitmachst“3 bündelt die Klimaschutzaktivitäten der Stadt Gladbeck. Die
Internetseite der Stadt informiert über aktuelle Meldungen, Projekte und Veranstaltungen. Unter
verschiedenen Themenschwerpunkten bietet die Stadt Gladbeck regelmäßig Veranstaltungen (unter
anderem in Kooperation mit der VHS Gladbeck) an. Bei diesen Veranstaltungen können Interessierte
mit Expert:innen ins Gespräch kommen.
Abbildung 7 Logo der Dachmarke „Gladbeck. 78.000 Klimaretter! Wenn du mitmachst“
Die Stadt Gladbeck bietet neben einer Sanierungsberatung auch Fördermittel für alle Bürger:innen
Gladbecks an. Kommunale Zuschüsse gibt es für Sanierungsvorhaben nicht nur für
energieeffizienzsteigernde Maßnahmen und den Einsatz erneuerbarer Energien, sondern auch für
Klimafolgenanpassung. Das Programm zur umfassenden Verbesserung des Stadtgrüns heißt
„Gladbeck goes green“ und beinhaltet finanzielle Förderung für eine naturnahe Gestaltung von
Vorgärten. Ein Teilprojekt von „Gladbeck goes green“ ist „Wunschgrün“. Hierbei werden von der Stadt
3
Quelle: https://www.gladbeck.de/Leben_Wohnen/Klima_in_Gladbeck/ (Stand Dezember 2021)26 Gladbeck mobile Bäume zur Verfügung gestellt, die auf Wunsch von Anwohner:innen platziert werden. Bei entsprechender Akzeptanz wird eine dauerhafte Realisierung geprüft. Die Stadt Gladbeck bezuschusst außerdem Dach- und Fassadenbegrünung in Gladbeck. Weitere finanzielle Zuschüsse hält die Stadt Gladbeck außerdem für klimafreundliche Mobilität bereit, wie z.B. die Bezuschussung von Lastenrädern. Die Vorschläge zur Kommunikation und Information, welche im Elektromobilitätskonzept und im Radverkehrskonzept enthalten sind, werden derzeit im Rahmen der Umsetzung der Konzepte ebenfalls berücksichtigt. Die Stadt Gladbeck beteiligt sich seit mehreren Jahren als Pilotkommune an der Ausbau-Initiative „Solarmetropole Ruhr“ des Regionalverbandes Ruhr. Ziel der Kampagne ist, das Solarpotenzial von Dächern und Fassaden auszuschöpfen. Im Rahmen der Kampagne wird die Installation von PV-Anlagen gefördert. Um Umweltschutz bei den Bürger:innen der Stadt Gladbeck möglichst früh zu verankern und den Multiplikatoreffekt durch die Kinder und Jugendlichen zu nutzen, unterstützt die Stadt Gladbeck mit vielfältigen Angeboten Umweltbildung, wie beispielsweise durch die finanzierten Umweltstunden der Deutschen Umwelt-Aktion oder durch die Leihmöglichkeit von Energiesparkisten an Schulen und Kitas.
Validierung der bisherigen Maßnahmen 27 2.3 Fazit Das Kapitel 2 zeigt, dass die Stadt Gladbeck bereits seit Jahren zahlreiche Maßnahmen zum Thema Klimaschutz und Klimaanpassung durchführt, verstetigt und kontinuierlich weiter ausbaut. Um CO 2- Emissionen zu reduzieren und das Stadtbild „grüner“ zu gestalten, nutzt die Stadt Gladbeck hauptsächlich Motivationskampagnen im Rahmen von Sensibilisierungskampagnen, Information über verschiedene Kanäle und finanzielle Anreize und Förderung. Auf kommunale Vorgaben, welche über die gesetzlichen hinausgehen (beispielsweise eine Effizienzvorgabe bezüglich Neubauten), wird bis dato noch nicht zurückgegriffen.
28 3 Ermittlung eines Zielkorridors Mit der Ratifizierung des Klimaabkommens von Paris hat sich die Bundesrepublik Deutschland völker- rechtlich bindend zu den darin festgelegten Klimazielen bekannt. Danach soll die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Niveau deutlich unter 2,0 Grad begrenzt werden. Die Empfehlung lautet, den Anstieg möglichst nicht über 1,5 Grad steigen zu lassen. Aus Sicht des Sachverständigenrats für Umweltfragen (SRU) sollte die Grenze des 1,75 Grad-Ziels als Paris konform nicht überschritten werden. Auch wenn es für Deutschland und demzufolge für die kommunale Ebene keinen verbindlichen und kompatiblen Transformationspfad gibt, wird es deutlich, dass die Frage der Klimaschutzziele neu verhandelt und ausgerichtet werden muss. Das Bundesverfassungsgericht hat am 24. März 2021 sinn- gemäß klargestellt: Entscheidungen, die Auswirkungen auf die Entstehung von CO 2 haben, sind so auszugestalten, dass so wenig wie möglich CO 2 entsteht. Dies kann einer gerichtlichen Überprüfung zugeführt werden. Für die Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts für die Stadt Gladbeck wird daher das Restbudget definiert, dessen Einhaltung im Rahmen des Controllings zukünftig zu überwachen ist. Folgende Aspekte sollten dabei berücksichtigt werden: Die Grundlagen der CO 2-Budgetierung Während das globale CO2-Budget im Bericht des IPCC (Intergouvernemental Panel on Climate Change) im Jahr 2018 für unterschiedliche Temperaturanstiege und Wahrscheinlichkeiten vorgelegt wurde, ist die nationale Budgetverteilung zwischen den Ländern bislang nicht verbindlich geklärt. Die Länder haben demnach freie Hand bei der Interpretation. Diskutiert werden unterschiedliche Ansätze, wie mit der Budgetbetrachtung in Bezug auf die eigene Zielformulierung umzugehen ist, bei der es vor allem um die Frage der gerechten Verteilung des verbleibenden Budgets geht. Der Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU) empfiehlt für Deutschland ab 2020 ein Budget in Höhe von rd. 6,7 Gigatonnen CO2 nach dem Einwohnerprinzip. Dem Prinzip liegen die Annahmen zugrunde, dass die zurückliegenden Emissionen nicht berücksichtigt werden, jedoch ein möglichst ambitioniertes Budget angenommen wird. Weiterhin wird ein gleiches Pro-Kopf-Emissionsrecht für jede Person der Erde angenommen. Bei einer Zunahme der Bevölkerung würde sich das Budget entsprechend erhöhen, bei einem Schrumpfungsprozess abnehmen. Für Kommunen gibt es noch keine verbindlichen methodischen Vorgaben zur Behandlung des CO 2- Budgets. Das SRU berechnet Paris-konforme Pro-Kopf Emissionsbudgets für das 1,75 Grad-Ziel und das 1,5 Grad-Ziel. Wird das oben beschriebene Prinzip der Verteilung innerhalb Deutschlands auf Gladbeck übertragen, ergibt sich ein Paris-konformer Korridor des Restbudgets zwischen dem 1,5 Grad und dem 1,75 Grad-Ziel. Die fachliche Diskussion ist damit jedoch noch nicht abgeschlossen. Sofern in Zukunft einheitlichere Regeln zur Methodik der Budgetberechnung für Kommunen festgelegt werden, wird empfohlen, die vorliegende Betrachtung dementsprechend zu überprüfen und ggf. anzupassen. Ein CO2-Budget für Gladbeck beschreiben Das vom SRU beschriebene Budget bezieht sich auf die energetischen und die nicht energetischen CO₂-Emissionen. Das CO2-Budget berücksichtigt zudem nur CO2 als Treibhausgas. Methan und Distickstoffoxid/Lachgas werden nicht berücksichtigt.
Ermittlung eines Zielkorridors 29
Der in Gladbeck eingesetzte BISKO-Standard4 bezieht sich ausschließlich auf die energetischen
Emissionen und die nicht energetischen Emissionen, berücksichtigt dabei jedoch zusätzlich
treibhausrelevante Gase (Methan und Distickstoffoxid/Lachgas) als CO2-Äquivalente.
Zur Übertragung des CO 2-Budgets auf die Bilanzgrenzen von Gladbeck sollen daher folgende
Annahmen getroffen werden:
Aus dem Nationalen Inventarbericht zum Deutschen Treibhausgasinventar geht hervor, dass
ca. 93 % der Emissionen (CO2, Methan und Lachgas) energiebedingt sind.
Als Grundlage für die Budgetbetrachtung werden von den oben genannten Budgets 93 % als
energetische angenommen. Der nicht energetische Anteil wird mit 7 % angenommen.
Zur Prüfung der Einhaltung des Restbudgets werden im Sinne einer Restbudgetbilanz die
jährlichen Emissionen der Stadt Gladbeck vom Budget abgezogen.
Sobald die Summe negativ wird, ist das Budget der Stadt Gladbeck verbraucht und das jeweilige
Temperaturbegrenzungsziel aus kommunaler Perspektive verfehlt.
Da in der BISKO Bilanz jedoch nicht nur CO2, sondern CO2-Äquvalente enthalten sind, handelt es
sich hier um eine konservative Betrachtung, indem mehr Emissionen vom Budget abgezogen
werden als laut Budgetdefinition erforderlich.
Auf bundesdeutscher Ebene liegt das CO2-Restbudget nach dem Personenprinzip bei:
51,0 Tonnen CO₂ pro Person für das 1,5 Grad-Ziel bei 50 % Wahrscheinlichkeit der
Zielerreichung5
79,5 Tonnen CO₂ pro Person für das 1,75 Grad-Ziel bei 50 % Wahrscheinlichkeit der
Zielerreichung
Das Budget für Gladbeck liegt demnach bei:
51 Tonnen CO₂ pro Person x 75.610 Personen = 3,9 Mio. Tonnen CO₂
Davon können ca. 93 % des obigen CO 2-Budgets für energiebedingte Emissionen angerechnet
werden
3,9 Mio. Tonnen CO2 x 93 % = 3,6 Mio. Tonnen (1,5 Grad-Ziel, 50 % Wahrscheinlichkeit)
Emissionsbudget für das 1,75 Grad-Ziel: 5,6 Mio. Tonnen CO2
Unter Berücksichtigung eines vereinfachten linearen Entwicklungspfades ergeben sich die in Abbildung
8 folgenden Verläufe für die Einschätzung eines mit dem Pariser Klimaschutzabkommen konformen
Reduktionspfads. Diese entsprechen nicht den entwickelten Szenarien, bieten aber einen ersten
Einblick über den Zeithorizont, der zur Erfüllung des Abkommens übrig bleibt. Da die im Folgenden
berechneten Szenarien ein realistischeres Bild zeichnen und Effekte auf unterschiedlichen Zeitskalen
betrachten, bleibt für die Erfüllung des 1,75 Grad-Ziels mehr Zeit.
4
Bilanzierungs-Systematik Kommunal: „Für eine Vereinheitlichung der Bilanzierungsmethoden entwickelte das ifeu 2014 im Auftrag des
Bundesumweltministeriums zusammen mit dem Klima-Bündnis und dem Institut für dezentrale Energiesysteme im Projekt „Klimaschutz-Planer -
Die Gestaltung der Energiewende in Kommunen: Entwicklung eines standardisierten Instrumentenansatzes zu Bilanzierung, Potenzialermittlung und
Szenarienentwicklung“ eine Empfehlung. Auf diese Weise konnten die recht allgemein gehaltenen Vorgaben auf internationale Ebene (z. B.
Greenhouse Gas Protocol [GPC]) konkret für deutsche Belange zugeschnitten werden. So entstand auf Basis von mehreren Workshops mit
Expert*innen, Wissenschaftler*innen, kommunalen Anwender*innen sowie einem Review durch fünf wissenschaftliche Institute die
Bilanzierungssystematik Kommunal (BISKO)“ (Quelle: Gugel, Hertle, Dünnebeil, Herhoffer (2020) Weiterentwicklung des kommunalen
Bilanzierungsstandards für THG-Emissionen. Bilanzierungssystematik kommunal – BISKO Abschlussbericht. Dessau-Roßlau: Institut für Energie-
und Umweltforschung Heidelberg gGmbH. Hrsg.: Umweltbundesamt)
5
Vgl. Sachverständigenrat für Umweltfragen (Hrsg.): „Pariser Klimaziele erreichen mit dem CO2-Budget“ S. 45 – Punkt 17
https://www.umweltrat.de/SharedDocs/Downloads/DE/01_Umweltgutachten/2016_2020/2020_Umweltgutachten_Kap_02_Pariser_Klimaziele.pdf?_
_blob=publicationFile&v=31,30 Abbildung 8 Paris-konformer Zielkorridor zur Senkung der CO2-Emissionen zwischen 2030 und 2036 Die Berechnung macht deutlich, dass die Stadt Gladbeck erhebliche Anstrengungen unternehmen muss, um die Anforderung des Pariser Klimaabkommens zu erfüllen. Weiterhin wird die Annahme getroffen, dass unvermeidbare Emissionen durch Kompensationsmaßnahmen aufgefangen werden müssen. Als Höhe der Kompensation werden 0,36 t CO2 Kompensation angenommen. Das entspricht dem von der Bundesregierung avisierten Ziel die Treibhausgase auf 95 % im Vergleich zum Jahr 1990 zu reduzieren. Die in Abbildung 9 dargestellte Bilanz der Stadt Gladbeck verdeutlicht, welche Sektoren dabei besonders wichtig sind:
Ermittlung eines Zielkorridors 31 Abbildung 9 Die THG-Emissionen in den Sektoren (Quelle: Klimaschutzplaner 2019) Aus der Abbildung geht hervor, dass die privaten Haushalte für rund 23 % der Treibhausgasemissionen verantwortlich sind. Der Mobilitätssektor hat mit ca. 26 % ebenfalls einen großen Anteil an den gesamten Treibhausgasemissionen. Dennoch wird durch den Wirtschaftssektor (GHD und Industrie) im Jahr 2019 mit rund 50 % der Gesamtemissionen der Großteil der Treibhausgase emittiert. Im Sektor Wirtschaft ist anzumerken, dass sich gegenüber der Bilanz für das Jahr 2007 die Datengüte wesentlich verbessert und sich ebenfalls die Bilanz-Methodik geändert hat. So sind in den Daten des Netzbetreibers auch Daten von Unternehmen die am Emissionshandel teilnehmen enthalten. Zur Zielerreichung bedarf es hier somit besonderer Anstrengungen, wobei dabei im Bereich des kommunalen Klimaschutzes jene Unternehmen anzusprechen sind, die nicht am Emissionshandel teilnehmen, da der Einflussbereich der Kommune in den Fällen wesentlich höher ist. Zusammengefasst sind die Treibhausgasemissionen der Sektoren „Private Haushalte“ und „Mobilität“ höher als die Treibhausgasemissionen verursacht durch die Wirtschaft. Dies zeigt, dass auch in diesen beiden Sektoren ein hohes Einsparpotenzial bezüglich Treibhausgasemissionen besteht.
32 Wie ein möglicher Weg zur Klimaneutralität aussehen kann, beschreibt das folgende Kapitel am Beispiel eines Zielszenarios. Dabei wird die Einhaltung des 1,75 Grad-Ziels bis zum Jahr 2042 angestrebt. Möglich wird diese Verzögerung im Vergleich zu den vorgestellten linearen Pfaden in Abbildung 8 durch effektive Maßnahmen, die schon deutlich vor 2042 eingeführt werden könnten. Die zwei Maßnahmen, die diese Verlängerung ermöglichen, sind zum einen die bereits vorgestellte Kompensation der nicht vermeidbaren Emissionen in Höhe von 0,36 t pro Einwohner:in und Jahr ab 2030 und zum anderen die Umstellung des gesamten Strombedarfs auf Ökostrom bis 2030. Dabei soll jeglicher Strombedarf in sämtlichen Sektoren, der nicht aus lokalen Quellen stammt, aus Ökostrom gedeckt werden. Diese Annahme erfordert in der Umsetzung ein großes gesamtgesellschaftliches Engagement, dem die Kommune nur über Verpflichtungen der lokalen Energieversorger Nachdruck verleihen kann. Der Ökostrombedarf kann auch aus überregionalen Quellen gedeckt werden. 3.1 Entwicklung von Klimaschutzszenarien und Leitlinien Das folgende Szenario stellt einen möglichen Pfad zum Erreichen der Klimaneutralität bis zum Jahr 2042 unter Einhaltung des 1,75 Grad-Ziels dar. Wichtig ist: Das Szenario ist keine Prognose, es beschreibt vielmehr eine mögliche Entwicklung unter Berücksichtigung spezifischer Annahmen. Die Szenariomethodik ist daher insofern gut geeignet, um daraus Leitlinien für die Klimaschutzarbeit in Gladbeck abzuleiten. Die daraus abgeleiteten Leitplanken geben Hinweise darauf, was in den einzelnen Bereichen passieren müsste, um das Ziel der Klimaneutralität zu erreichen. Das Szenario geht von folgenden Annahmen aus: Endenergieverbrauch im Gebäudebestand Für die Stadt Gladbeck ist die energetische Erneuerung des Gebäudebestandes eine der großen Herausforderungen der Energiewende und ein wesentlicher Baustein, um die gesteckten Klimaschutzziele zu erreichen. Das Szenario geht davon aus, dass der Endenergieverbrauch im Gebäudebestand bis 2042 um 64 % sinkt. Hierfür wäre es erforderlich, dass 80 % der Gebäude ihren Wärmeverbrauch um 80 % reduzieren. Die Betrachtung richtet sich dabei nicht allein auf einzelne Gebäude, sondern vielmehr auf den energetischen Sanierungsprozess von ganzen Quartieren (Beispiel InnovationCity roll out). Das klimaneutrale Quartier im Bestand ist eine besondere Herausforderung und bietet noch erhebliches Potenzial für Forschungsfragen und die Entwicklung Gladbecks. Endenergieverbrauch durch klimaschonendes Verhalten reduzieren Da auf den Sektor der privaten Haushalte und die Wirtschaftssektoren in der Stadt Gladbeck insgesamt fast 3/4 der gesamtstädtischen Energieverbräuche entfallen, ist die Entwicklung von Leitlinien, welche die Sensibilisierung und Mitwirkung der Zivilgesellschaft sowie die Umweltbildung umfassen, für eine wirkungsvolle kommunale Klimaschutzpolitik von hoher Bedeutung. Die Bevölkerung kann durch private Konsum- und Verhaltensentscheidungen einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Darüber hinaus unterstützt das Bewusstsein über die eigenen Handlungsmöglichkeiten die Akzeptanz für die Umsetzung der Maßnahmen auf gesamtstädtischer Ebene. Die Verantwortung liegt aber nicht allein bei den Bürger:innen als Konsument:innen. Für die Akzeptanz in der Gesamtgesellschaft ist die „Gerechtigkeitsfrage“ von großer Bedeutung. Hier besteht ein erhebliches Akzeptanzrisiko. Die breite Verankerung klimaschonender Lebensstile ist daher auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe: Anbietende und Unternehmen müssen ihren Beitrag durch nutzenbringende und erschwingliche Angebote und Dienstleistungen leisten, die Stadt hat die Verantwortung, gute Rahmenbedingungen
Ermittlung eines Zielkorridors 33 auch für Menschen mit geringem Einkommen zu schaffen. In der Szenarienbetrachtung wird ein Suffizienzpotenzial von 10 % bei den Energieverbräuchen im Bereich der privaten Haushalte im Sektor Wärme sowie Licht und Kraft unterstellt. Endenergieverbrauch im Wirtschaftssektor reduzieren Ein bedeutsamer Teil der Treibhausgasemissionen wird durch produzierende Betriebe (Produktionsprozesse), aber auch durch Büro- und Verwaltungsgebäude erzeugt. Dazu gehören neben Gebäuden aus dem Dienstleistungsbereich auch Gebäude aus dem öffentlichen Sektor. Strategisch bedeutend sind neben der Förderung der Energieeinsparung im Prozess- und Gebäudebereich auch effiziente, branchenspezifische Energieversorgungsangebote. Klimaschonendes Arbeiten und Wirtschaften ist in Gladbeck daher nicht allein eine technisch zu lösende Aufgabe. Es gilt Klimaneutralität als Ziel der Wirtschaft zusammen mit der Sicherung von Arbeitsplätzen zu verankern. Hierzu bedarf es Strategien, die Transformationsprozesse in den Unternehmen hin zur Klimaneutralität zu beschleunigen, Anreize für die Ansiedlung klimaneutraler Unternehmen zu schaffen und eine Steigerung der Innovationskraft für die Entwicklung klimaschonender und nachhaltiger Produkte und Dienstleistungen zu unterstützen. In den Wirtschaftssektoren wird im Bereich Licht und Kraft sowie der Prozesswärme eine Einsparung bis zum Zieljahr von 48 % unterstellt. Diese Annahme setzt sich aus einer Sanierungsquote von 80 % (wie im Raumwärmebereich) sowie einer Endenergiereduzierung von 60 % je saniertem Verbraucher. Klimaschonende Mobilität ausbauen Zur Erreichung der Klimaneutralität muss der Endenergieverbrauch im Verkehrssektor möglichst ohne große Einschränkung der Mobilität sinken. Zentrale Fragestellungen stellen sich hierbei sowohl in Bezug auf die Fortführung bzw. Erweiterung technologischer Entwicklungen sowie die Erleichterung eines multimodalen Verkehrsverhaltens. In Hinblick auf das Verkehrsverhalten sollte sich der Modal Split in Richtung Rad- und Fußverkehr sowie ÖPNV verschieben. Durch die Förderung von Home Office und der Digitalisierung ist es möglich, Verkehrswege einzusparen und damit den gesamten Personenverkehr zu reduzieren. Die drei Grundsäulen der Dekarbonisierung des Mobilitätssektors sind die Verlagerung des Individualverkehrs auf den öffentlichen Nahverkehr, die Umrüstung der Antriebstechnologie auf klimaschonendere Antriebe sowie die generelle Einsparung von Endenergie bspw. durch Effizienz- und Suffizienz-Maßnahmen. Im Vergleich zum Elektromobilitätskonzept der Stadt Gladbeck setzt das Zielszenario auf eine 100 % Umrüstung aller PKW auf Elektromobilität. Unter diesen Annahmen müssten bis 2030 nicht rund 5.700 ePKW auf Gladbecker Straßen unterwegs sein, sondern eher rund 20.000 ePKW. Weiterhin unterstellen die Szenarien einen Ausbau der Fahrzeugkilometer des öffentlichen Personennahverkehrs um 20 %, sowie die vollständige Umrüstung der Fahrzeugflotte des öffentlichen Personennahverkehrs auf elektrische und wasserstoffbetriebene Antriebe. Aus der Detailbetrachtung ergeben sich aus dem vorgestellten Szenario Leitplanken, die im Folgenden herausgearbeitet werden. Um den Gesamtüberblick herzustellen, ist in Abbildung 10 der gesamte Endenergiebedarf bis 2050 dargestellt.
34
2.500.000
Endenergie [MWh/a]
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2021 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Licht und Kraft Wärme Mobilität
Abbildung 10 Endenergiebedarf in den Anwendungssektoren
Die Abbildung macht deutlich, dass die Endenergie bis 2042 stetig sinkt. Nach 2042 stagniert die
Reduktion und es ist ein leichter Aufwärtstrend durch das Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum
erkennbar. Die meiste Endenergie wird im Wärmesektor eingespart. Aus der folgenden Tabelle geht
hervor, dass im Mobilitätssektor jedoch prozentual noch mehr Endenergie eingespart werden müsste.
Licht und Kraft Wärme Mobilität gesamt
absolut absolut absolut absolut
in % in % in % in %
[GWh/a] [GWh/a] [GWh/a] [GWh/a]
2019 336 100 1.293 100 546 100 2.174 100
2030 274 81 916 71 288 53 1.478 68
2040 215 64 620 48 160 29 995 46
2050 215 64 602 47 145 27 962 44
Tabelle 1 Endenergiebedarf nach Anwendungssektoren
Aus der Tabelle ergibt sich zudem, dass im Sektor Licht und Kraft bis 2050 ca. 125 GWh/a reduziert
werden müssten. Im Wärmesektor beträgt die Einsparung rund 691 GWh/a. Für den Mobilitätsbereich
wird der Endenergiebedarf um 73 % reduziert, was einer Einsparung von 401 GWh/a entspricht.
Insgesamt verringert sich der Gladbecker Endenergiebedarf um 54 % bis 2050.
Die Treibhausgasemissionsminderung kann in Abbildung 11 abgelesen werden.Ermittlung eines Zielkorridors 35
700.000
600.000
500.000
t CO2 eq/a
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2021 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Licht und Kraft Wärme Mobilität
Abbildung 11 Treibhausgasentwicklung in den Anwendungssektoren
Im Kurvenverlauf „Licht und Kraft“ ist der Effekt des Ökostrombezugs bis 2030 deutlich zu sehen.
Insgesamt reduzieren sich die Treibhausgasemissionen bis 2050 von 661 Tt CO 2 eq/a um 95 % auf
34 Tt CO2 eq/a. Die weiteren Reduktionspfade sind in Tabelle 2 aufgeführt.
Licht und Kraft Wärme Mobilität gesamt
absolut absolut absolut absolut
in % in % in % in %
[Tt/a] [Tt/a] [Tt/a] [Tt/a]
2019 161 100 333 100 172 100 665 100
2030 9 6 145 43 54 32 208 31
2040 7 4 36 11 11 6 54 8
2050 7 4 20 6 7 4 34 5
Tabelle 2 Treibhausgasentwicklung in den Anwendungssektoren
Die Aufschlüsselung der Verbrauchssektoren ist in der folgenden Abbildung 12 dargestellt und
ermöglicht eine detailliertere Betrachtung der Anstrengungen, welche die lokalen Beteiligten
unternehmen müssten.36
2.500.000
Endenergie [MWh/a]
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2021 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Private Haushalte GHD + Industrie Kommunale Einrichtungen Mobilität
Abbildung 12 Endenergie nach Verbrauchssektoren
Aus der Abbildung geht hervor, dass selbst nach dem Heben sämtlicher Potenziale der Wirtschafts-
sektor für den größten Teil des Endenergiebedarfs verantwortlich ist. Er macht mit 619 GWh/a rund
64 % des gesamten Endenergiebedarfs im Jahr 2050 aus. Eine detailliertere Darstellung bietet Tabelle
3.
Private Kommunale
GHD + Industrie Mobilität gesamt
Haushalte Einrichtungen
absolut absolut absolut absolut absolut
in % in % in % in % in %
[GWh/a] [GWh/a] [GWh/a] [GWh/a] [GWh/a]
2019 495 100 1.102 100 31 100 546 100 2.174 100
2030 335 68 835 76 20 66 288 53 1.478 68
2040 206 42 617 56 12 40 160 29 995 46
2050 186 38 619 56 11 36 145 27 962 44
Tabelle 3 Endenergiebedarf nach Verbrauchssektoren
Die Treibhausgasemissionen nach Verbrauchssektoren sind in Abbildung 13 abgebildet.Ermittlung eines Zielkorridors 37
800.000
600.000
t CO2 eq/a
400.000
200.000
0
2021 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Private Haushalte GHD + Industrie Kommunale Einrichtungen Mobilität
Abbildung 13 Treibhausgasemissionen nach Verbrauchssektoren
Es wird erkennbar, dass die Treibhausgase bis 2030 schnell sinken und im Anschluss langsamer bis
2042 absinken. Auch aus Sicht der Treibhausgasemissionen wird die große Verantwortung des
regionalen Wirtschaftssektors am Erreichen der Klimaneutralität deutlich, da rund 2/3 der Emissionen
auf den Wirtschaftssektor zurückzuführen sind. Tabelle 4 schlüsselt die
Treibhausgasemissionsentwicklung im Szenario genauer auf.
Private Kommunale
GHD + Industrie Mobilität gesamt
Haushalte Einrichtungen
absolut absolut absolut absolut absolut
in % in % in % in % in %
[Tt/a] [Tt/a] [Tt/a] [Tt/a] [Tt/a]
2019 149 100 335 100 9 100 172 100 665 100
2030 43 29 108 32 3 32 54 32 208 31
2040 11 7 32 10 1 7 11 6 54 8
2050 6 4 21 6 0,4 4 7 4 34 5
Tabelle 4 Treibhausgasemissionen nach Verbrauchssektor
Die Frage, ob das entwickelte Szenario mit dem Pariser-Klimaschutzabkommen konform ist,
beantwortet Abbildung 14. Zu beachten ist, dass die nachfolgende Berechnung der jährlichen
Emissionen nicht BISKO-konform ist, da die lokalen erneuerbaren Energiepotenziale sowie der
Ökostrombezug mit einberechnet wurden. Außerdem ist in der Abbildung der Kompensationsanteil ab
2030 inkludiert.38
Jährl. Emissionen – lokaler
Strommix [Tt CO2 eq/a] Restbudget [Tt CO2]
800 8.000
700 7.000
600 6.000
500 5.000
400 4.000
300 3.000
200 2.000
100 1.000
0 0
-100 -1.000
-200 -2.000
2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Jährliche Emissionen - lokaler Strommix abzgl. Kompensation ab 2030 Restbudget 1,75° Restbudget 1,5°
Abbildung 14 Budgetbetrachtung des Szenarios anhand des 1,5 Grad- und 1,75 Grad-Ziels
Unter den gegebenen Rahmenbedingungen ist das vorgestellte Szenario mit dem Pariser-
Klimaschutzabkommen konform. Zwar würde das 1,5 Grad-Ziel bereits 2027 verfehlt werden, aber
unter der Prämisse, dass die Klimaerwärmung nicht mehr als 2 Grad betragen darf, reicht das
1,75 Grad-Ziel aus. Das Szenario erfordert jedoch trotzdem ein immenses gesamtgesellschaftliches
Engagement. Die Kennziffern des Prozesses hin zur Klimaneutralität sind in der folgenden Tabelle 5
festgehalten.
Rahmenbedingungen von jetzt bis 2042, bezogen auf Endenergie
Private Haushalte - Wärme 3,8 %/a der Wohngebäude mit 80 % Reduktion bis 2042
Private Haushalte - Licht und Kraft 1,4 %/a Endenergieeinsparung bis 2042
Wirtschaft - Raumwärme 3,8 %/a der Gebäude mit 80 % Reduktion
Wirtschaft - Prozesswärme 2,3 %/a Einsparung Prozesswärme bis 2042
Wirtschaft - Licht und Kraft 2,3 %/a Einsparung Licht + Kraft bis 2042
Ausbau E-Mobilität MIV 4,8 %/a bis 2042
2,4 %/a Ausbau Wasserstoff Linienbusse und
Mobilität Lastverkehr bis 2042
Fahrleistungsverringerung MIV 2,6 %/a bis 2042
5 % des Emissionsniveaus von 1990 werden ab 2030
Kompensation
kompensiert, 27 Tt/a
Tabelle 5 Leitlinien des Transformationsprozesses
Aus der Tabelle geht der Umfang der Transformation hervor. Beispielsweise beträgt die
Gebäudesanierungsrate in Deutschland in den letzten Jahren rund 1 %. Um das Klimaziel zu erreichen
wäre somit knapp eine Vervierfachung notwendig. Auch die Fahrleistung des Motorisierten-Individual-
Verkehrs (MIV) ist in Deutschland tendenziell steigend, wohingegen im Szenario eine Reduktion von
2,6 % pro Jahr bis 2042 hinterlegt ist.Sie können auch lesen