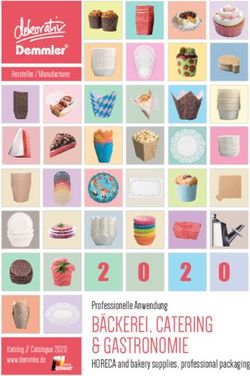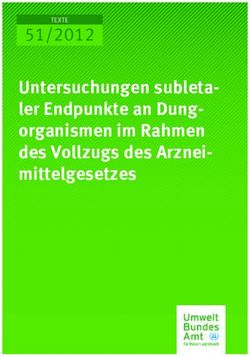Generatives Kopftheater mit demokratischem Design? - Theater der Zeit
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Generatives Kopftheater mit demokratischem Design? Ein Erklärungsversuch von Christoph Maurer und Peter Zizka Das „Crossing Lines Project“ verfügt über eine Vielzahl inhaltlicher und geografischer Positionen, an deren Schnittpunkten eine ebenso diverse Bühnenaktion stattfindet. Der Nukleus der Aktion, PAN.OPTIKUM, ist zudem eine bedeutungsschwangere Wortkonstruktion: Laut Thesaurus rangeln hier Begriffe wie Synthese, Zusammenschau, Zusammenfügung und Vermittlung um die Wette. Für Gestalter, die schon früh den Satz „Design ist nicht demokratisch“ als DNA mit auf den Weg bekommen, ist die Suche nach einer passenden Strategie zur kollektiven Erstellung eines Aktionsreliktes folgerichtig nicht gerade einfach. Ich verstehe deshalb den einen oder anderen, der sich fragt, was denn eine egomane Position von Designern oder bildenden Künstlern im Rahmen eines gemeinschaftlich ausgerichteten europäischen Jugend-Tanz-Theater-Projektes zu suchen hat. Anders als noch in den 1970er Jahren sind gegenwärtig synergetische Innovationen zwischen Bühne und intentionaler Grafik Mangelware. Im Universum der darstellenden Kunst fallen Kommunikationsaufgaben heutzutage in der Regel sehr zweckgerichtet und funktional aus: Die Zeiten, in denen das Grafikdesign von Opern- oder Schauspielhäusern mit experimenteller Typografie und mutigen Bildwelten um die Gunst der Zuschauer warben, scheinen im celebrity- und bildergläubigen Medienzeitalter keine Rolle zu spielen. Doch die visuelle Krise ist auch eine hausgemachte Designsuppe, die durch den Gebrauch von zu viel geschmäcklerischer Gestaltungswürze entstanden ist. Bei vielen ernst gemeinten kulturellen Projekten sieht man die Anfälligkeit der visuellen Kommunikation für umfänglichen Opportunismus äußerst kritisch. In unserer Arbeit für das „Crossing Lines Project“ wollten wir deshalb dem verzweifelten Mantra zur Sinnfälligkeit des Grafikdesigns als tradierter geniebetonter Strategie kein neues Futter geben. Vielmehr war es uns wichtig, in einer Zeit, in der populistische Konzepte das Kollektive missbrauchen, ein Experiment zu wagen und im Kosmos des Darstellenden ein Kommunikationskonzept anzugehen, das weitab schnell gelernten Branding-BlaBlas oder deskriptiver Abbildungswelten funktioniert. Es galt außerdem, die gegenwärtige Melange aus elitärer Positionierung und immer stärkerer Verkaufsorientierung des Kommunikations- und Kunstmarktes außen vor zu lassen, denn die riecht an jeder Ecke nach schnöder Ökonomisierung. Was könnte also eine Form sein, die den Moment des Darstellens dokumentiert und gleichzeitig assoziativ bereichert? Nach gemeinsamem Gestaltungs-Headbanging, mit der oben erwähnten Geniealtlast im Gepäck, machten wir uns auf, am Anfang der Ideenfindung auf einen bildnerischen Gedankenkreuzweg, in dessen Verlauf wir das Genie zeitweise in einen kollektiven Dornröschenschlaf versetzen und unseren selbstreferentiellen Bedürfnissen einen Haken schlagen wollten. Als neutraler Instanz und virtuellem Spiritus Rector bedienten wir uns, wie könnte es in Zeiten von Bits und Bytes anders sein, einer Maschine, die als sogenannter Computer seit Jahrzehnten unser Leben mitbestimmt. Der Einsatz von Rechnern im kreativen Bereich ist freilich nichts Neues. Es gibt sogar einen naheliegenden Begriff dafür: Computerkunst. Die wiederum ist beeinflusst von Concept Art, kybernetischer Kunst, Bauhaus, Op-Art, Konkreter Kunst, Neuer Tendenz sowie Konzeptkunst. Dazu kommt die neue Disziplin der Informationstheorie sowie die von Max Bense daraus abgeleitete Informationsästhetik, die mit dem Verhältnis von Ordnung/Unordnung arbeitet. Die von Frieder Nake daraus weiterentwickelte Vorstellung der generativen Ästhetik beschreibt die Werke der Computerkunst als Klassen von Kunstwerken, als operationale Beschreibung von Unendlichkeit, als „Unvollendung“ (Lunenfeld). „In der traditionellen Kunst steht das einzelne Kunstwerk im Zentrum. Über die ästhetische Bedeutung der modernen Massen-Reproduktion von Kunst ist viel geschrieben worden, ebenso über die Idee von Kunst, die bloß als unausgeführtes Konzept von einzelnen Kunstobjekten existiert. Der eigentümliche Kerngedanke der Computerkunst ist hingegen der eines Einzelobjektes, das sich nur dadurch als Kunstobjekt qualifiziert, dass es Element einer Klasse möglicher verschiedener, aber auf bestimmte Weise gleichartiger Objekte ist.“ (Nake in: Klutsch, Computer Grafik, 2007, S. 16) „Die Unvollendung ist das radikal neue ästhetische Prinzip. In ihm zeigt sich die Abkehr vom festen einzelnen Werk, ohne dass das Werk, wie man meinte, verschwindet.“ (Klutsch, Computer Grafik, 2007, S. 10)
Starker Tobak für das kreativitätswillige Hirn. Die Theorie zur Informationsästhetik lässt den Frontlappen glühen: Operationale Beschreibung von Unvollendung? Arbeiten mit dem Verhältnis von Ordnung und Unordnung? Das klingt ja fast so, wie der gekachelte Boden im Maleratelier aussieht, aber überhaupt nicht nach dem akademisch-stringenten Bild von Kunstvermittlung. Wenn man aber die Hebelkraft einer darstellenden Dimension wie bei „Power of Diversity“ richtig ansetzt, eröffnet sich die Möglichkeit, die Grenze zwischen aktiver und passiver Rolle, ganz wie auf der Bühne, auch in einem Tafelbild aufzulösen. Dem Genie bricht an der Stelle der Angstschweiß aus: Ist dieser demokratische Gestaltungsprozess, der über Zahlen gefiltert zum Bild wird, eine ernstzunehmende Konkurrenz im kulturellen Diskurs? Der gemeine Selbstdarsteller hingegen fragt sich ganz profan: Wo bleibe ich mit meinem Ego? In der Tat knirscht es an dieser Stelle gewaltig, denn wir erleben gegenwärtig, dass der Ersatz des Egomanen durch die unbestechliche Brutalität des Algorithmus unsere Lebensrealitäten immer unüberschaubarer macht und zum Beispiel entscheidende wirtschaftliche Prozesse zu einer menschenfernen, mikrozeitbasierten Maschinenekstase geraten lässt. Im Falle generativer Gestaltung geht es aber nicht um die Beschleunigung von Wachstum und Serie, sondern um eine metaästhetische Konzeption, die Produktion und Rezeption nahezu gleichsetzt. Damit sind wir wieder beim Theater, das im Moment der Produktion rezipiert wird. Zugegeben wird das Theater höchst analog aufgeführt und ist glücklicherweise frei von inhaltsamputierten Avataren. Aber im Falle unseres angestrebten Reliktes in Form eines Tafelbilds wird der Algorithmus, der den Kern der generativen Ästhetik ausmacht, zum Regisseur eines Schauspiels, dessen Hauptdarsteller explizites und implizites Wissen heißen. Der Computer ist der Arbeiter am Band, der einen gesteuerten, nach einer strikten Handlungsvorschrift ablaufenden Arbeitsprozess ausführt und die Schritte in der Folge dramaturgisch endlich abarbeitet. Damit ist der Rechner eine durchaus ernstzunehmende Alternative zur Ausbeutung von Menschen und in unserem Fall ein Schutzschild dagegen, den Rest unseres Lebens mit langweiligen Rechenoperationen zu verbringen, denn wir reden hier über das Visualisieren von Daten mit Methoden, die unsere grauen Zellen überfordern würden. Das der Rechenoperation vorgelagerte kreative Rezept besteht in der Verbindung einer gestalterischen Idee mit der Meinung eines Kollektivs. Für diese Überlegung braucht es keine nerdige Informatikerpersönlichkeit, denn das Rezeptewissen ist für jeden eine alltägliche Erfahrung und macht einen erheblichen Teil der menschlichen Kultur aus. Zum Beispiel beim Kochen: Ohne tradierte Rezeptgrundlagen würde unser Verdauungssystem täglich u. a. mit giftigen Pilzen, zerkochten Zutaten und verbranntem Allerlei belastet – die geschmacklichen Aussichten wären katastrophal. Aber selbst in dieser niederkomplexen Dimension ist reines Rezeptewissen extrem unkreativ und schnell langweilig. Die Speise wird mehr oder weniger immer gleich schmecken und im besten Falle eine der schon erwähnten geschmäcklerischen Designsuppen werden. Erst die Abweichung von der Regel führt zu überraschenden, anderen Ergebnissen, die einen positiv-irritierenden dreifachen Inhalts-Toeloop schlagen. Informationstheoretisch gesprochen, benennt das den Unterschied, der einen weiteren Unterschied macht (Gregory Bateson). Die Abweichung von der Regel kann im Computer aber nur durch den Zufall erreicht werden, bei Menschen würde man von Intuition sprechen. Da der Computer aber eine deterministische Maschine ist, der doppelseitig zufallsamputiert daherkommt, kann sie ihn nur simulieren. Wer jetzt glaubt, der Mensch wäre der Archetyp des freien Radikals und in jeder Richtung reaktionsfreudig, der irrt gewaltig, denn gerade unsereiner kann, anders als es die Idee des Genies verspricht, mitunter als vorhersagbar angesehen werden. Der Mensch hat es in Zeiten perfekt errechneter Userprofile ausgesprochen schwer, Zufall in die eigene Leistungsbilanz einzubringen. Ganz im Gegensatz zu unserem Selbstverständnis sind wir in der Regel vorgeprägt: Möchten wir zum Beispiel eine zufällige Reihe von Zahlen bilden, lässt sich darin statistisch sehr schnell ein Muster erkennen. Der Computer lässt dagegen, wie einst Caesar, die Würfel fallen und überschreitet den Prägungsrubikon mit Aleatorik und durch schiere Geschwindigkeit (Mikrozeitlichkeit), indem astronomische Mengen an Bits verarbeitet werden. Sein intelligentes Verhalten ist ein komplexes und schnell operierendes Regelwerk, das für unseren Rezeptionsapparat nicht mehr überschaubar ist. Auch im Falle der generativen Arbeiten des „Crossing Lines Projects“ geht es also um die automatisierte (Re-)Kombination von Regeln, Konzepten und Formen, die zu einem Ergebnis führt, das nur zu einem gewissen Grad vorhersehbar ist, da die Eingabe- und Zufallswerte sowie Programmanweisungen zu komplex sind, als dass sie in ihren exakten Konsequenzen vom Menschen erfasst werden könnten. Wir gehen hier den Weg einer demokratischen generierten Emergenz. Emergente Eigenschaften zeichnen sich dadurch aus, dass sie aus Elementen hervorgehen, die diese Eigenschaft einzeln nicht aufweisen. Das Paradebeispiel dafür ist Wasser: Kein Wassermolekül weist die Eigenschaft nass auf, viele von diesen Molekülen zusammen aber schon. Irgendwie kommt an dieser Stelle Magie ins Spiel, denn in jedem generativen Bild erzeugen Daten eine völlig neue kollektive Abbildung. Der umgekehrte Weg dagegen führt zu Problemen: Wenn das Bild in seine Einzelteile (Pigmente, Bits, Energie) zerlegt wird, wo bleibt dann die erhabene ästhetische Dimension? Das Emergente ist übrigens keine Erfindung des Digitalzeitalters, sondern essentieller Bestandteil vieler philosophischer Überlegungen. Kant zum Beispiel definiert das Erhabene als den Moment, in dem die beiden Handlungen der Einbildungskraft, die Auffassung (apprehensio) und die
Zusammenfassung (comprehensio aesthetica), nicht mehr deckungsgleich sind. Anhand einer ägyptischen Pyramide verdeutlicht er die Problematik: „Daraus läßt sich erklären, was Savary in seinen Nachrichten von Ägypten anmerkt, daß man den Pyramiden nicht sehr nahe kommen, ebensowenig als zu weit davon entfernt sein müsse, um die ganze Rührung von ihrer Größe zu bekommen. Denn ist das letztere, so sind die Teile, die aufgefaßt werden (die Steine derselben übereinander) nur dunkel vorgestellt, und ihre Vorstellung tut keine Wirkung auf das ästhetische Urteil des Subjektes. Ist aber das erstere, so bedarf das Auge einige Zeit, um die Auffassung von der Grundfläche bis zur Spitze zu vollenden; in dieser aber erlöschen immer zum Teil die ersteren, ehe die Einbildungskraft die letzteren aufgenommen hat, und die Zusammenfassung ist nie vollständig. […] Denn es ist hier ein Gefühl der Unangemessenheit seiner Einbildungskraft für die Idee eines Ganzen, um sie darzustellen, worin die Einbildungskraft ihr Maximum erreicht, und, bei der Bestrebung, es zu erweitern, in sich selbst zurücksinkt, dadurch aber in ein rührendes Wohlgefallen versetzt wird.“ (Kant, Kritik der Urteilskraft, Zweites Buch. Analytik des Erhabenen, § 26) An der Stelle denke ich an die literarische Figur des Scheinriesen aus „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“, welche die Idee des Erhabenen ironisch aufgreift und Herrn Tur Tur nur durch Abstand zur mythischen Figur eines Riesen geraten lässt. Ein treffendes Beispiel für eine medial generierte Erhabenheit, die wir sicher in der Diskussion nicht auslassen sollten. Bei Kant liegt die Sache freilich anders: Der Betrachter kann nur in einem bestimmten Abstand zur Pyramide, nicht zu nahe und nicht zu weit entfernt, sowohl die einzelnen Steine als auch die gesamte Form erkennen. Das Erhabene im kant’schen Sinne verweist deshalb auf die Kategorien des unermesslichen Großen, des Unendlichen, desjenigen, was jenseits aller Vergleiche liegt. „Aber eben darum, daß in unserer Einbildungskraft ein Bestreben zum Fortschritte ins Unendliche, in unserer Vernunft aber ein Anspruch auf absolute Totalität als auf eine reelle Idee liegt: ist selbst jene Unangemessenheit unseres Vermögens der Größenschätzung der Dinge der Sinnenwelt für diese Idee, die Erweckung des Gefühls eines Übersinnlichen Vermögens in uns […].“ (Kant, Kritik der Urteilskraft, Zweites Buch. Analytik des Erhabenen, § 25) Kants Idee der Erhabenheit erzeugt in uns ein Gefühl, das nicht das interesselose, aus sich selbst heraus schöpfende Kunstschöne als „allgemeines Wohlgefallen“ (Kant) bezeichnet. Das Genie ist bei ihm vielmehr ein naturgegebenes Talent, das Regeln aufstellt. Auf generative Werke übertragen, könnte das Erhabene gefunden werden, indem das Staunen/Ergriffen-Sein bei der Rezeption des Werks darauf zurückgeführt wird, dass die Komplexität und die Details von der Imagination wegen der naturgegebenen Neutralität des Algorithmus nicht mehr verhandelt werden können. Es ist für den Rezipienten nicht mehr möglich rückzuschließen, wie das Werk entstanden ist, da der Nachvollzug der Millionen von Iterationen und Rekursionen der Programmroutinen jenseits des menschlichen Vermögens liegt. Bei den generativen Arbeiten für „Power of Diversity“ geht es uns um diese algorithmisch-neutrale Erhabenheit und eben nicht um die Ego-Positionierung im Kontext des traditionellen Gestaltungs- oder Kunstbegriffs. Natürlich gibt es in der Kunstgeschichte Werke, die eine hochgradige Komplexität aus der Vielfältigkeit persönlicher Interpretation ziehen, aber kollektive Produktionsmodelle sind in der bildenden Kunst weiße Elefanten. Generative Strategien dagegen könnten als neue Möglichkeiten zur Implementierung kollektiver Daten gesehen werden, die vor der Einführung des Computers mithilfe der menschlichen Intelligenz so nicht realisierbar waren. Die computerbasierte Visualisierung der Mandelbrotmenge in den 1980er Jahren war zum Beispiel aufgrund der gigantischen Regelsysteme manuell nicht visualisier- und errechenbar. Vor der Visualisierung mittels Computer war die Form (Apfelmännchen) nicht bekannt. Was aber haben wir genau bei „Crossing Lines“ gemacht, um ein kollektives Bild zu erzeugen, welches war unsere generative Strategie? Stufe 1: Wir teilen im Publikum und unter den Teilnehmern anonyme Fragebögen aus, die es ermöglichen, die eigene Lebenssituation und Erfahrungen mit Hilfe einer Werteskala zu beurteilen. Diese Fragebögen werden dann für jeden Aufführungsort getrennt evaluiert. Stufe 2: Von einer für die jeweilige Aufführung charakteristischen Bewegung werden drei Einzelbilder aus einem Video
gemeinsam ausgewählt. In diesen drei Stills werden mittels eines Kantenerkennungsalgorithmus sowie des Blob-Detection-Verfahrens Konturen ermittelt. Stufe 3: Die drei Konturen werden in einer speziellen dafür entwickelten App räumlich gestaffelt. Daraufhin werden die Punkte mit einer errechneten Kurvenform verbunden. Entlang dieser Form werden in einem weiteren Schritt die Buchstaben der Fragen aus der Evaluierung in der jeweiligen Landessprache aufgereiht. Stufe 4: Die Farbgebung wird implementiert. Sie ist sowohl von der Nationalflagge des Landes motiviert als auch durch die Mittelwerte, die sich aus der Evaluierung des Fragebogens ergeben haben. Je nach dem, ob eine Frage eher positiv oder negativ bewertet wurde, werden die Buchstabenstränge unterschiedlich eingefärbt. Dafür werden die Farben der Nationalflagge unterschiedlich gewichtet, bei dem Beispiel Deutschland sind positive Fragen eher gelb als rot. In der Mischung aller dieser Elemente ergibt sich für jeden Aufführungsort eine formal verwandte, aber trotzdem eigenständige kollektiv erzeugte Abbildung, die vielschichtig lesbar und ästhetisch erfahrbar ist. Die Ergebnisse geben uns recht, ist doch eine Reihe von Tafelbildern entstanden, die, entsprechend der Projektkonzeption, viele Individuen in einen gemeinschaftlich darstellenden und bildenden Prozess einbauen. „Crossing Lines“ schlägt damit vernetzte Pässe auf dem europäischen Spielfeld und füllt es mit gemeinschaftlichem Leben im Sinne des Bundestrainers: „Das Kollektiv ist wichtiger als jeder einzelne Spieler.“ Generative theatre of the mind with democratic design? An interpretative attempt Christoph Maurer & Peter Zizka The “Crossing Lines Project” involves a great number of positions, geographically and in terms of content, with equally diverse stage action performed at their intersections. PAN.OPTIKUM, the nucleus of these activities, carries a title gravid with meaning: a glance at a thesaurus offers terms such as synthesis, synopsis, conflation and communication all of which equally jostle for attention. Designers, who are indoctrinated with the precept that “design is not democratic” from the very start of their studies, may consequently find the quest for a fitting strategy with which to collectively forge an action relic rather challenging. I can therefore relate to those wondering what place there is for the egomaniacal position of a designer or visual artist in the context of a European youth dance-theatre project with a collaborative focus. Unlike in the 1970s, synergistic innovations between stage and intentional graphics are few and far between today. Communication tasks dished out in the realm of the performative arts tend to be rather goal-orientated and functional nowadays: the age when opera houses and theatres courted their customer’s attention with graphic design devoted to experimental typography and bold visual worlds seems well and truly over in our celebrity-adoring, image-obsessed media age. Yet this visual crisis is a design broth spoiled by the performance world itself, which has chosen to season the product with too much faddish design dressing. Many cultural projects claiming to do serious work have an extremely critical view of visual design’s susceptibility to pervasive opportunism. In our endeavours for the “Crossing Lines Project” we therefore did not want to nourish the desperate mantra of graphic design’s perceptibility, with its conventional emphasis on genius. On the contrary, in a time when populist concepts abuse the notion of the collective, we found it crucial to dare to experiment and tackle a communication concept in the performative cosmos that functions very differently to any approach of hastily acquiring trite branding or illustrative description. The goal was to leave the current concoction of elitist positioning and the communication and art market’s ever stronger propensity towards sales at any cost (which incidentally reeks of vulgar economization) out in the cold. But what could be a form that both documented and at the same time associatively reinforced the performative moment? Following a joint design brainstorming/head banging session (still weighed down by the aforementioned “genius legacy”) we struck out on a visual-conceptual way of the cross at the very start of the reconnaissance of ideas, along the path of which we were hoping to transitively lull our inner design whizz-kid into a deep collective sleep and outmanoeuvre our self-referential needs. In step with our present era of bits and bytes, we employed a machine as a neutral entity and virtual guiding spirit which has had a determining influence on all of our lives for the past decades: a so-called computer. Admittedly, employing computers in the creative field is hardly new. There is even a fitting term for this: computer art. This, in turn, is influenced by concept art, cybernetic art, Bauhaus, op-art, concrete art and New Tendency. It is joined by a new discipline called information theory, as well as by the notion of information aesthetics, derived from the former by Max Bense, which taps into the relationship between order and chaos. The concept of generative aesthetics, developed from these positions by Frieder Nake, describes works of computer art as categories of art works, as an operative description of infinity, as “incompletion” [Lunenfeld]. “Traditionally, art is centred on the single art work. Much has been written about the aesthetic meaning of Modern mass reproductions of art, as well as on the idea of art that exists merely as an
unexecuted concept for individual art objects. By contrast, the odd central idea of computer art is that of an individual object, which qualifies itself as an art work solely through its being an element of a category of possible disparate objects which are nevertheless kindred in a particular way.” [Nake in: Klutsch, Computer Grafik, 2007, p. 16] “Incompletion is the radical new aesthetic principle. In it, we see the turn away from the concrete individual work, without the work disappearing – as was previously assumed it would.” [Klutsch, Computer Grafik, 2007, p. 10] This is strong stuff for minds inclined to engage in creative production. The theory of information aesthetics can make one’s frontal lobe boil: operational description of incompletion? Working with the relationship between order and chaos? It almost sounds the way a tiled floor in a painter’s studio looks, and nothing like the academically rigorous stance we would expect visual arts education to take. If we apply the leverage of a descriptive dimension properly, as is done in “Power of Diversity”, we broach the possibility of dissolving the boundaries between active and passive roles in a panel painting, too – just as we are able to do on stage. At this point, the genius will be breaking out in a cold sweat: is this democratic creative process, which becomes an image via the filter of numbers, a serious rival in cultural discourse? Meanwhile, the common attention-seeker is irreverently asking himself a different question: what about me and my ego? And indeed, we have reached a rather tender point in our evolution as a creative species, given that we are currently finding the egomaniac superseded by the incorruptible brutality of the algorithm – a development that is making our lived realities ever harder to comprehend, for example by turning economic processes into a micro-time-based technological frenzy far-removed from people’s actual lives. Generative design however is not about the acceleration of growth and series output, but rather about a meta-aesthetic conception that essentially equates production and reception. Which brings us back to theatre, received as it is in the moment of its production. Granted, theatre is performed in a very analogue fashion and is fortunately free of content-amputated avatars. However, in the case of our proposed relic in the form of a panel painting, the algorithm at the heart of our generative aesthetics assumes the role of a director staging a play with two leads, named explicit and implicit knowledge. The computer is the assembly line worker carrying out work processes according to a strictly defined action protocol, then executing the work steps dramaturgically and conclusively. The computer thus becomes a genuine alternative to the exploitation of humans, as well as in our case a defence against having to spend the rest of our lives doing boring calculations – because what we are talking about here is the visualization of data through methods that would certainly over-exert our grey matter. The creative recipe, according to which the calculations are carried out, is composed of a fusion between a design idea and the view of a collective. No nerdy computer-cum-scientific mindset is needed to follow this train of thought: we all have personal experience of recipe knowledge in our day-to-day lives. In fact, it makes up a considerable part of human culture. Take cooking, for example: without the handed-down groundwork that went into compiling our recipes, our digestive system would be regularly burdened with poisonous mushrooms, overcooked ingredients and a burnt potpourri of inedible matter– disastrous prospects as regards taste. Yet even in this less complex dimension, pure knowledge of recipes is highly uncreative and quickly becomes boring. The dishes produced accordingly will always taste more or less the same – and may at best turn into one of those previously mentioned faddy design chowders. It is not until we deviate from the rule that we arrive at surprising and different results which are able to pull off positively irritating triple-content toe loops. Speaking in the language of information theory, this constitutes the difference that makes the difference to quote Gregory Bateson. However, when a computer is used, a deviation from the rule can only be achieved by introducing the element of chance – in humans, we would call this intuition. But because the computer is a deterministic and coincidence-amputated in all respects, it is only able to simulate this. Those now prone to seeing humans as the archetype of the free radical and highly responsive in all directions are nevertheless seriously mistaken. Because, contrary to the notion of genius, human behaviour is particularly easy to predict – at least in certain cases. In our age of perfectly calibrated user profiles, humans have an exceptionally hard time introducing chance into their own balance of activities. Though we may fancy ourselves otherwise, we generally tend to be subconsciously predetermined: If, for example, we want to generate a random numerical series, statistically speaking this will soon exhibit patterns. The computer, by contrast, casts the dice, as Caesar once did, crossing the Rubicon of predefinitions by relying on aleatory computations and sheer pace (microtemporality), by processing astronomic amounts of bits. The computer’s intelligent behaviour is a complex and rapidly operating set of rules which we are no longer able to keep track of with our own, much slower, sensory and cognitive apparatus. The generative works by the “Crossing Lines Project” are also about the automatic (re-)combination of rules,
concepts and forms leading to a result that is predictable only to a certain degree – seeing as the input and chance values, as well as the programme instructions, are too complex to be comprehended in their exact consequences by human beings. What we are pursuing here is the path of democratically generated emergence. Emergent traits are characterized by the fact that they arise from elements that do not individually carry said traits. The textbook example would be water: no single water molecule has the property of ‘wetness’ but many of these molecules together do. Somehow magic comes into play at this point, as different data sets give rise to a completely new collective picture in every generative image. The reverse path, on the other hand, leads to problems: when an image is split up into its individual components (pigments, bits, energy), where does that leave the sublime aesthetic dimension? Incidentally, emergence is not a concept invented in the digital era, but an essential part of many philosophical deliberations. Kant, for example, defined the sublime as the moment in which the two actions of the faculty of imagination, namely apprehension (apprehensio) and comprehension (comprehensio aesthetica) are no longer congruent. He illustrates the problem by referring to an Egyptian pyramid: “This explains Savary’s observations in his account of Egypt, that in order to get the full emotional effect of the size of the Pyramids we must avoid coming too near just as much as remaining too far away. for in the latter case the representation of the apprehended parts (the tiers of stones) is but obscure, and produces no effect upon the aesthetic judgement of the Subject. In the former, however, it takes the eye some time to complete the apprehension from the base to the summit; but in this interval the first tiers always in part disappear before the imagination has taken in the last, and so the comprehension is never complete. […] for here a feeling comes home to him of the inadequacy of his imagination for presenting the idea of a whole within which that imagination attains its maximum, and, in its fruitless efforts to extend this limit, recoils upon itself, but in so doing succumbs to an emotional delight.” (Kant, Critique of Judgement, Second Book. Analytic of the Sublime, §26, in the translation by James Creed Meredith) At this point, the literary figure of the illusionary giant in Michael Ende’s “Jim Button and Luke the Engine Driver” comes to mind. In an ironic twist on the notion of the sublime, Mr Tur Tur only appears as the mythical figure of a giant when seen from a distance. This seems like an apt example of media-generated sublimity, which certainly should not be omitted from this discussion. Yet things are somewhat different with Kant: The viewer is only able to make out both the individual stones and the overall shape of the pyramid when positioned at the right distance to the structure – not too close and not too far away. The sublime in the Kantian sense hence refers to the categories of the immeasurably large, the infinite, to that which is beyond all comparison. “But precisely because there is a striving in our imagination towards progress ad infinitum, while reason demands absolute totality, as a real idea, that same inability on the part of our faculty for the estimation of the magnitude of things of the world of sense to attain to this idea, is the awakening of a feeling of a supersensible faculty within us […]” (Kant, Critique of Judgement, Second Book. Analytic of the Sublime, §25, in the translation by James Creed Meredith) Kant’s notion of the sublime generates a feeling in us that does not identify the beautiful in art, created disinterestedly from within itself, as what Kant terms “general pleasure”. He instead sees genius as a natural talent that establishes rules. In the context of generative works, this could mean finding the sublime in the fact that the awe/reverence felt when contemplating the work may be traced back to the inability of imaginatively negotiating its complexity and details due to the natural neutrality of the algorithm. The recipient is no longer able to infer how the work was made, as mentally re-enacting the millions of iterations and recursions of the programme routines is beyond the abilities of the human mind. In the case of the generative work for “Power of Diversity”, we are interested in this algorithmic, neutral form of the sublime – and precisely not in ego-positioning in the context of the traditional concept of art or design. Of course, art history includes works that draw a high degree of complexity from the diversity of personal interpretation, but collective modes of production are scarce in the visual arts. Generative strategies may, by contrast, be seen as new opportunities for implementing collective data that could not have been realized before the introduction of the computer, with human cognitive powers only. For example, in the 1980s, it would not have been possible to visualize or calculate the computer-based visualization of the Mandelbrot set manually, due to the gigantic regulatory systems. Before it was visualized using computers the shape (also known as the “apple man”), was unknown. What exactly did we do for “Crossing Lines” in order to create a collective image, what was our generative
strategy? Step 1: We hand out anonymous questionnaires to the audience and participants which enable them to assess their own life situation and experiences using a scale of values. These questionnaires are then evaluated separately for each performance venue. Step 2: Three individual images of a movement characteristic of the performance in question are chosen by the group from a video. The contours in these three stills are then determined using a blob detection procedure and an edge detection algorithm. Step 3: The three contours are three-dimensionally staggered using an app developed especially for this purpose. The dots are then connected using a computed curve shape. In a further step, the letters forming the questions in the evaluation are lined up along this shape in the local language in question. Step 4: The colour scheme is implemented. It is prompted both by the national flag of the respective country as well as by the median values gleaned from the evaluation of the questionnaire. The strings of letters are coloured in different hues, depending on whether a question tended to be answered positively or negatively. In order to achieve this, the colours of the respective national flag are each attached to different values: for example in the case of Germany, positive questions are yellow rather than red. By combining all of these elements, a figure is generated for each place of performance. The ensuing collectively generated and formally related, yet discrete figures may be read and aesthetically experienced on a multitude of levels. The results prove us right – seeing as, corresponding with the project conception, a range of panels has been produced through a collaborative descriptive and formative process that involves many individuals. And so the “Crossing Lines Project” kicks some interlinked passes across the European playing field, filling it with communal life – in keeping with German national coach Jogi Löw’s mantra: “The collective is more important than any individual player.” Quelle: http://www.theaterderzeit.de/buch/power_of_diversity/36365/komplett/ Abgerufen am: 07.10.2018
Sie können auch lesen