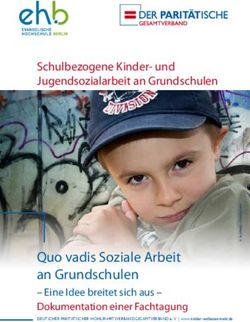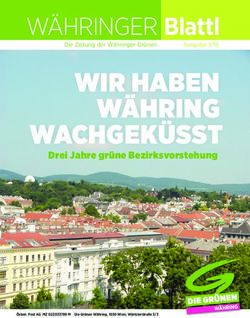Gerechtigkeit und Fairness im Sport im Kontext von Doping Masterarbeit
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Gerechtigkeit und Fairness im Sport im Kontext von Doping
Masterarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
„Master of Arts“ (MA)
eingereicht von
Reinhold Kurzweil
bei
Univ.-Prof. Mag. Dr. theol. Leopold Neuhold
Institut für Ethik und Gesellschaftslehre
Katholisch- Theologische Fakultät
Karl-Franzens-Universität Graz
Oktober 2021Ehrenwörtliche Erklärung Ich, Reinhold Kurzweil, erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen inländischen oder ausländischen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht. Die vorliegende Fassung entspricht der eingereichten elektronischen Version. Graz, _____________ Reinhold Kurzweil
Kurzfassung Doping ist ein globales Problem und hat nahezu alle Bereiche des Sports erfasst. Diese Masterarbeit zeigt die negativen Konsequenzen des Dopings auf das Sportethos im Allgemeinen und auf die Prinzipien Fairness und Gerechtigkeit im Besonderen. Im ersten Teil wird Sport in seinen verschiedenen Dimensionen beschrieben und versucht, das Wesen des Sports freizulegen, um ein klares Bild zu bekommen, warum Menschen aktiv Sport betreiben oder passiv konsumieren wollen. Im nächsten Schritt werden die Werte und Normen, auf die sich Sport beruft, in den Blick genommen. Dabei zeigt sich, dass der Fairness eine zentrale Rolle im Sport zukommt, um der Anerkennung der Regeln und der Gerechtigkeit im Sinne der Chancengleichheit aller zum Durchbruch zu verhelfen. Danach wird Doping und die derzeit gültige, problematische Definition kritisch beleuchtet, welche Dopingpraktiken auf ein rechtliches Problem reduziert, das von der Moral losgelöst ist. Der ethische Blick auf das Thema zeigt aber, dass das Sportethos grob verletzt und die Fairness und Gerechtigkeit außer Acht gelassen werden, wenn gedopt wird. Darüber hinaus wird deutlich, dass die negativen Folgen des Dopings über die Verletzungen des Sportethos hinausgehen, weil der Sport dadurch seinen Sinn verliert und somit seine Glaubwürdigkeit ernsthaft gefährdet wird.
Abstract Doping is a global problem and occurs in nearly all sports. This master thesis shows the negative impact doping has on sports ethics in general and on the principles of fairness and justice. In the first part the thesis describes sports in its different dimensions. In particular, the question why people want to do sports and watch sports events is investigated. Then the thesis focuses on sports ethics to detect the values and norms, which affect the behavior of athletes within the sporting sphere most. It reveals that fairness plays the crucial role in sports in order to ensure both the acknowledgement of sports rules and the equality of opportunities for all contenders. The next part analyzes doping and its current problematic definition, which reduces doping to a strictly legal issue while eliminating moral aspects. From the ethical perspective it shows that doping seriously violates sports ethics and neglects the principles of fairness and justice. Furthermore, it reveals that the damage caused by doping exceeds its violation of ethics because it leads to a loss of meaning of sports, thereby severely putting its credibility at risk.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung ..................................................................................................... 7
1.1 Mediale Berichterstattung und Relevanz des Themas ............................................... 8
1.2 Eingrenzung des Themas.......................................................................................... 10
1.3 Methodik und Aufbau der Arbeit ............................................................................. 11
2 Das Phänomen Sport ................................................................................. 13
2.1 Herkunft des Begriffes „Sport“ und erste allgemeine Definition............................. 13
2.2 Sport als Bewegung .................................................................................................. 13
2.3 Bewegung als Leibphänomen .................................................................................. 15
2.4 Sport als Bestandteil der Kultur ............................................................................... 16
2.5 Sport als Kunstwerk ................................................................................................. 18
2.6 Sport als Regelsystem .............................................................................................. 19
2.6.1 Willkürlichkeit der Ziele, Irrelevanz in anderen Sphären ................................ 20
2.6.2 Ritualcharakter der Regeln ............................................................................... 21
2.6.3 Neutralität gegenüber den Gegnern .................................................................. 21
2.6.4 Eigenweltcharakter ........................................................................................... 22
2.6.5 Zwang zur Legitimation ................................................................................... 22
2.7 Sport als Sinnsystem ................................................................................................ 23
2.8 Sport als ästhetische Inszenierung ............................................................................ 24
2.9 Sport als Institution .................................................................................................. 27
2.10 Sport als Spiel........................................................................................................... 29
2.11 Sport als Religionsersatz .......................................................................................... 30
3 Das Ethos des Sports ................................................................................. 32
3.1 Der Begriff Sportethos ............................................................................................. 32
3.2 Die Olympische Idee ................................................................................................ 34
3.2.1 Olympische Spiele der Antike.......................................................................... 35
3.2.2 Olympische Spiele der Neuzeit ........................................................................ 35
3.2.3 Fünf Olympische Prinzipien............................................................................. 36
3.3 Fairness, die zentrale Tugend des Sports ................................................................. 37
3.3.1 Der Begriff Fairness ......................................................................................... 37
3.3.2 Der Begriff Fair play ........................................................................................ 41
3.4 Achtung im Sport ..................................................................................................... 43
3.4.1 Vor den Gegner*innen: .................................................................................... 43
3.4.2 Der Sportpartner*innen und Mannschaftsmitglieder: ...................................... 44
3.4.3 Der Schiedsrichter*innen ................................................................................. 44
3.4.4 Zwischen Trainer*innen und Athlet*innen ...................................................... 45
3.4.5 Vor der Sportart und dem Wettbewerb ............................................................ 46
53.5 Gerechtigkeit im Sport ............................................................................................. 47
3.5.1 Was versteht man unter Gerechtigkeit?............................................................ 47
3.5.2 Wie gerecht ist Sport? ...................................................................................... 50
4 Das Problem Doping ................................................................................. 53
4.1 Grundsätzliches ........................................................................................................ 53
4.2 Problem der Begriffsdefinition................................................................................. 55
4.2.1 Herkunft des Wortes......................................................................................... 55
4.2.2 Definition des Deutschen Sportbundes ............................................................ 55
4.2.3 Definition des Europarates ............................................................................... 56
4.2.4 Definition des Internationalen Olympischen Komitees ................................... 57
4.3 Der World-Anti-Doping-Code der WADA .............................................................. 58
4.3.1 Die WADA-Liste ............................................................................................. 59
4.3.2 Problem der Verbotslisten-Logik ..................................................................... 60
4.3.3 Problem der Verrechtlichung ........................................................................... 60
4.4 Motive für Doping .................................................................................................... 61
4.4.1 Ein Kalkül ........................................................................................................ 62
4.4.2 Die Formel “The winner takes it all” ............................................................... 63
4.5 Doping als moralisches Problem .............................................................................. 64
4.5.1 Drei Grundpositionen zu Doping ..................................................................... 64
4.5.2 Unnatürliche Leistung und Gesundheitsrisiko ................................................. 65
4.5.3 Die negativen Folgen von Doping aus der ethischen Perspektive ................... 66
4.5.3.1 Missachtung des impliziten Sozialvertrages................................................. 66
4.5.3.2 Betrug am Sport, an der eigenen Person, an Konkurrent*innen ................. 68
4.5.3.3 Zerstörung der Glaubwürdigkeit des Sports ................................................ 69
4.5.3.4 Zerstörung des Sportsinns ............................................................................ 70
4.5.3.5 Entwertung des Sports .................................................................................. 71
4.5.3.6 Sport wird zu Nicht-Sport ............................................................................. 71
4.6 Gerechtigkeit und Fairness? ..................................................................................... 72
4.6.1 Verletzung der Fairness .................................................................................... 73
4.6.2 Verletzung der Gerechtigkeit ........................................................................... 74
5 Zusammenfassung ..................................................................................... 76
6 Literaturverzeichnis .................................................................................. 81
7 Internetquellen........................................................................................... 84
8 Abbildungsverzeichnis .............................................................................. 85
61 Einleitung
Bewegung, Spiel und Spaß zählen in einer Welt, in der alles sehr hektisch und schnell geworden
ist, in welcher der Beruf oftmals hohe Anforderungen an den Menschen stellt und ganz
allgemein der Druck groß geworden ist, ein ausgefülltes, erfolgreiches und selbstbestimmtes
Leben zu führen, oft zu jenen Bestandteilen im Leben eines Menschen, die für Ausgleich sorgen
sollen. Kinder finden dazu einen natürlichen Zugang, indem sie dem Drang nach Bewegung
ganz einfach nachgeben. Sie beginnen zu krabbeln, später zu gehen und irgendwann gelingt es,
sogar schnell zu laufen. Nach und nach wird der natürliche Bewegungsdrang durch eine
spielerische Komponente ergänzt und spätestens in der Schule messen sich Schüler*innen im
Turnunterricht in ihren sportlichen Fähigkeiten. Was zuerst nur Bewegung war, bekommt somit
eine sportliche Komponente. Aber was genau ist Sport, was unterscheidet Bewegung allgemein
von sportlicher Betätigung? Im Rahmen dieser Arbeit wird dieser Frage nachgegangen werden.
Neben den physischen und psychischen Aspekten, denen beim Sport zentrale Bedeutung
zukommt und die für Sporttreibende unmittelbar erfahrbar werden und den Grund für sportliche
Betätigung darstellen, ist auch der sportliche Vergleich mit anderen im Zuge eines Wettkampfes
ein wichtiges Motiv. Dies gilt sowohl für den Leistungssport als auch für den Freizeit- und
Hobbysport.
Sport ist also eine an sich äußerst wünschenswerte Betätigung, weil sie die Gesundheit in
vielerlei Hinsicht fördert, aber er hat auch Schattenseiten. Vor allem im Leistungssport, wo
Höchstleistungen erbracht werden, stellt Doping eines der größten Probleme dar. Doping
begrenzt sich allerdings nicht auf den Bereich des Leistungssportes, wo es oftmals um viel
Preisgeld und Werbeeinnahmen geht. Vielmehr hat Doping auch schon im Breiten- und
Hobbysport Einzug gehalten. Auch in diesem Segment werden unerlaubte Hilfsmittel
verwendet, um eine Leistungssteigerung zu erzielen. In einer globalisierten und vernetzten Welt
kann praktisch jeder über das Internet die entsprechenden leistungssteigernden Substanzen
erwerben, wenn man das möchte, seien es legale oder aber auch illegale.
71.1 Mediale Berichterstattung und Relevanz des Themas
Als sportinteressierter Mensch kann man in den Medien regelmäßig Berichte über sogenannte
Doping-Vergehen im Bereich des Leistungssportes oder Entwicklungen im Bereich des
Dopings mitverfolgen. Der Standard schreibt beispielsweise in einem Artikel vom 6. Februar
2021 über Szenarien der Zukunft des Dopings. So sei laut dem Bericht das Gen-Doping jene
Variante, welcher in der Wissenschaft und Sportgemeinschaft die höchste Aufmerksamkeit
zukomme. Mittels der Genschere CRISPR ist es möglich, in die DNA des Menschen
einzugreifen und jene Gene, die für die sportliche Leistung entscheidend sind, zu verändern
oder zu optimieren. Bislang konnten mehr als 200 Varianten davon identifiziert werden. Eine
genetische Manipulation könnte theoretisch schon vor der Geburt stattfinden, um ein Baby mit
besonderen sportlichen Talenten zu designen.1
Den wahrscheinlich spektakulärsten Dopingfall der jüngeren österreichischen Sportgeschichte
zeichnete Lukas Matzinger im Falter 11/19 unter dem Titel „Johannes der Täuscher“ nach. Die
tragische Figur des Skandals ist Johannes Dürr, ein nach Einschätzung der Fachwelt des
Wintersportes überaus talentierter Langläufer. Dürr besuchte das Schigymnasium in Stams und
kam früh mit Medikamenten und schließlich mit Dopingpraktiken in Kontakt. Während der
Olympischen Winterspiele in Sotschi 2014 wurde er positiv auf das Wachstumshormon EPO
getestet. Ein Strafverfahren wegen Sportbetrugs wurde durch eine Diversion erledigt, Preis-
und Sponsor-Gelder musste Dürr zurückzahlen.2
Doch Dürr startete nach seiner Sperre einen Comeback-Versuch und gerierte sich als geläuterter
und nun sauberer Athlet, und der Autor Martin Prinz schrieb ein Buch über dieses Sport-
Comeback mit dem Titel „Der Weg zurück“. Mittels Crowdfunding sammelte Dürr knapp €
39.000, - an Spenden für dieses Projekt. Doch das Ende der Geschichte ist ernüchternd und
genau genommen erschütternd: Dürr, dem durch dieses Projekt auch mediale Aufmerksamkeit
zuteil wurde, sprach im deutschen Fernsehen über seine Dopingvergangenheit und löste damit
Nachforschungen deutscher Behörden aus. Es folgte eine groß angelegte Razzia namens
1
Vgl. Pallinger, Jakob: Höher, schneller, weiter: Spitzensport an der Grenze der Leistung, in:
https://www.derstandard.at/story/2000123823982/hoeher-schneller-weiter-spitzensport-an-den-grenzen-der-
leistung [abgerufen am 17.4.2021].
2
Vgl. Matzinger, Lukas: Johannes der Täuscher, in: Falter 11/19, 2019, 20-21.
8„Operation Aderlass“, die schlussendlich auch das neuerliche Vergehen Dürrs mittels
Eigenblutdoping ans Licht brachte und ihn als Wiederholungstäter auswies.3
Die grundsätzliche Problematik des Sports thematisiert Johann Skocek in einem Kommentar
im Falter 13/19 anlässlich der Ermittlungen deutscher Strafermittlungsbehörden gegen den
deutschen Arzt Mark S. in München. Diese kamen aufgrund der getätigten Aussagen von Dürr
ins Rollen und förderten zutage, dass 21 Sportler aus 8 Nationen Kunden von Mark S. waren
und mit ihm Blutdoping und weitere verbotene leistungssteigernde Maßnahmen durchgeführt
hatten. Das Grundproblem des Sports sei laut Skocek, dass der Respekt vor der Menschenwürde
abhandengekommen ist. Die Zufriedenheit im moralischen Sinn fehle, vielmehr zählen nur
mehr Medaillen und Titel. Auch Politik und Sportfunktionäre würden den ehrlichen Diskurs
verweigern und stattdessen lieber ein Einzeltäter-Narrativ zeichnen.4
Die internationale bzw. globale Dimension des Dopings im Sport zeigt eine im Standard
publizierte APA-Meldung vom 8.7.2019, wonach bei der internationalen „Operation Viribus“,
die in 23 EU- und zehn anderen Ländern durchgeführt wurde, 234 Personen verhaftet und 3,8
Millionen Dopingpräparate und Arzneimittel beschlagnahmt wurden. In dieser bisher weltweit
größten Operation gegen Doping wurden siebzehn kriminelle Gruppen zerschlagen, neun
Untergrundlabore entdeckt und vierundzwanzig Tonnen an Roh-Steroid-Pulver sichergestellt.5
Über einen aktuellen Fall wurde am 12.1.2021 auf tirol.orf.at berichtet: Stefan Denifl, ein
ehemaliger österreichischer Radprofi, der 2017 die Österreich-Rundfahrt gewonnen hatte,
wurde vom Landesgericht Innsbruck wegen gewerbsmäßigen, schweren Sportbetrugs zu zwei
Jahren Haft verurteilt. Denifl hatte gestanden, zwischen den Jahren 2014 bis 2018 Blutdoping
in Zusammenarbeit mit deutschen Arzt Mark S. betrieben zu haben. Im Zuge der „Operation
Aderlass“ war man auch auf den Namen Denifls gestoßen.6
3
Vgl. ebd.
4
Vgl. Skocek, Johann: Die Moralmaschine hat einen Schaden, in: Falter 13/19, 2019, 6.
5
Vgl. APA: Doping: 234 Personen bei „Operation Viribus“ verhaftet, in:
https://www.derstandard.at/story/2000106064674/doping-234-personen-bei-operation-viribus-verhaftet
[abgerufen am 17.4.2021]
6
Vgl. red, tirol.orf.at/Agenturen: Stefan Denifl zu zwei Jahren Haft verurteilt, in:
https://tirol.orf.at/stories/3084538/ [abgerufen am 17.4.2021]
9Wie die Beispiele zeigen, wirkt sich Doping auf mehreren Ebenen für den Sport negativ aus.
Auf individueller Ebene führt dies dazu, dass Siege wertlos werden, wenn man überführt wird.
Preisgelder und sonstige erzielte Einkünfte aus Sponsor-Verträgen müssen oft zurückgezahlt
werden, und auch strafrechtliche Verurteilungen sind Konsequenzen, die dopende
Sportler*innen unmittelbar zu tragen haben. Die Frage nach gesundheitlichen Konsequenzen
stellt sich für viele erst nach dem Ende der Sportkarriere, ist deswegen aber nicht minder
bedeutsam.
Der Sport an sich wird aber ebenso beschädigt, wie die jedes Jahr wiederkehrende und
exemplarische Diskussion über die Frage zeigt, ob es möglich ist, bei der Tour de France, einer
dreiwöchigen Radrundfahrt durch Frankreich, die über zahlreiche steile Berge führt, die
Herausforderung mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit jenseits der 40 km/h ohne
Doping zu bewältigen. In diversen Internet-Foren wird dies von Sportinteressierten vielfach
bezweifelt, und von der Annahme, dass „alle dopen“ und von der Tour de France als
„internationale Leistungsschau der Pharmakonzerne“ ist häufig zu lesen. Doping beschädigt
somit die Reputation der Sportler*innen und der Sportart und stellt implizit, wenn man es
weiterdenkt, die grundsätzliche Sinnhaftigkeit von Sport infrage.
1.2 Eingrenzung des Themas
Doping im Sport hat viele Facetten, wie den exemplarisch angeführten Medienberichten zu
entnehmen ist. Dies ist aber nur eine kleine Auswahl, von der jede einzelne eine nähere
Betrachtung verdienen würde, aber dies würde den Rahmen dieser Arbeit sprengen.
In dieser Masterarbeit soll versucht werden, das Problem des Dopings im Sport näher aus einer
ethischen Perspektive zu betrachten, und innerhalb dieses Rahmens soll auf die Auswirkungen
auf die Werte Gerechtigkeit und Fairness eingegangen werden. Dabei stellen sich folgende
Fragen: Welchen Stellenwert haben Gerechtigkeit und Fairness im Sport und welche
Auswirkungen hat das Faktum, dass gedopt wird, auf diese Werte? Wie kann in einer
Gemengelage, in der Doping eine immer bedeutendere und größere Rolle zuzukommen scheint,
eine Chancengerechtigkeit im Sport erreicht werden? Worin besteht die Grundproblematik bei
der Bekämpfung des Dopings? Inwiefern ist denkbar, Doping gänzlich freizugeben mit dem
Ziel, den Sport gerechter zu machen?
10Das Thema der Arbeit wird in erster Linie bezugnehmend auf Sport als Wettkampfsport
behandelt, weil gerade im Spitzen- und Hochleistungssport Doping ein großes Problem darstellt
und durch die mediale Berichterstattung und die globale Medienpräsenz der negative Einfluss
des Dopings auf die Glaubwürdigkeit des Sports generell enorme Auswirkungen haben kann.
Nicht eingegangen werden kann auf den Hobby- und Freizeitsport, obwohl auch dieser nicht
frei von Doping betrieben wird, wenn man Medienberichten Glauben schenken kann.
1.3 Methodik und Aufbau der Arbeit
Methodisch wurde für diese Arbeit die Vorgangsweise gewählt zu versuchen, Sport auf das
Wesentlichste zu reduzieren, in gewisser Hinsicht alles, was den Sport sonst noch begleitet und
umhüllt, wegzulassen. Das Ziel, das mit diesem Zugang erreicht werden soll, ist es, mit dieser
„Skelettierung“ zum Kern der Sache und somit zum Wesen des Sports vorzudringen. Erst wenn
verständlich geworden ist, was Sport überhaupt ist und weshalb er eine Relevanz im Leben von
Menschen hat, macht es Sinn zu fragen, welche formellen und informellen Regeln und Normen
darin Gültigkeit haben. Auch bei dieser Frage, also der Frage nach dem Ethos des Sports und
dem Ethos der Sportler*innen, soll diese Art der „Skelettierung“ angewandt werden, um einen
klaren Blick auf das Wesentliche zu bekommen. Erst wenn das Fundament des Sports und
seines Ethos freigelegt ist, wird Doping behandelt und seine moralisch problematischen
Implikationen auf den Sport aufgegriffen.
Zusammenfassend soll also zunächst die Sphäre des Sports in seinen verschiedenen
Dimensionen beschrieben werden, um ein Bild darüber zu bekommen, was Sport ausmacht und
welche Merkmale als essenziell erachtet werden. Wesentlich dabei ist, herauszuarbeiten,
warum Menschen Sport betreiben, warum sich jemand in sportlicher Art und Weise bewegen
möchte und welchen Sinn und welche Funktionen Sport im Leben der Menschen erfüllen kann.
Im nächsten Schritt soll die moralische Dimension im Sport beleuchtet und der Frage
nachgegangen werden, nach welchem Ethos Sportler*innen Sport betreiben und welche
Bedeutung und Verbindlichkeit dieses Ethos für die Sportler*innen hat. In diesem Teil soll
bereits eine Antwort auf die Frage gegeben werden können, inwieweit Sport überhaupt gerecht
sein kann und welchen Stellenwert der Fairness/dem Fair play im Sport zukommt.
11Im letzten Schritt wird versucht, das Doping-Problem in seinen Dimensionen zu skizzieren.
Dabei wird auf die Frage eingegangen, wie Doping definiert wird und welche Konsequenzen
sich aus der gegenwärtig anerkannten Definition ergeben. Schließlich werden die moralischen
Bezugspunkte des Dopings in den Blick genommen, um die Auswirkungen auf den Sport und
seine zentralen Werte zu analysieren und eine Antwort auf die Frage zu bekommen, inwieweit
Doping im Widerspruch zu Gerechtigkeit und Fairness steht.
122 Das Phänomen Sport
Das Interesse an Sport scheint weltweit enorm zu sein, denn in allen Medien, also in klassischen
Printmedien, im Fernsehen und im Internet nimmt Sport einen beträchtlichen Teil der
Berichterstattung ein und ist darüber hinaus ein riesiger Wirtschaftsfaktor geworden.
In diesem Kapitel soll versucht werden, Sport als Phänomen näher zu betrachten, um ein
Verständnis dafür zu bekommen, warum Menschen sich für die aktive Ausübung oder die
passive Betrachtung von Sport (oder beides) überhaupt interessieren. Es scheint deshalb
nützlich, sich zuallererst der Frage zu widmen, was genau unter dem Begriff Sport zu verstehen
ist und nach welchen Gesetzmäßigkeiten er funktioniert.
2.1 Herkunft des Begriffes „Sport“ und erste allgemeine Definition
Der Begriff leitet sich vom lateinischen Wort „disportare“ oder „deportare“ her und hatte die
Bedeutung von Vergnügen, Belustigung und Unterhaltung. In den romanischen Sprachen
wurde dieser Gehalt übernommen und im Frankreich des Mittelalters wurde der Ausdruck
„desport“, „se deporter“ mit der Bedeutung Entspannung, Ergötzung verwendet. Von
Frankreich kam der Begriff nach England und wurde als Lehnwort ins Englische übernommen.
Die Vorsilbe von „disport“ und „desport“ verschwand über die Zeit, übrig blieb die Kurzform
„sport“. Mit dem Wandel von Arbeit und Lebensweise im Laufe der Verstädterung und
Industrialisierung wandelte sich der Begriff von Sport zum heutigen Verständnis.7 Carl Diem
formuliert eine Beschreibung von Sport wie folgt: „Sport als Leibesübung ist im Lebensbereich
zweckfreien Tuns ein von Wertgefühl und Festlichkeit erfülltes, natur- und kampffrohes,
verfeinert und typisiert geregeltes Vervollkommnungsstreben.“8
2.2 Sport als Bewegung
Die Frage, was Sport „eigentlich“ ist, mag auf den ersten Blick recht banal klingen, aber sie ist
nicht leicht zu beantworten. Sicher ist jedenfalls, dass Sport eine Form von Bewegung darstellt.
7
Vgl. Diem, Carl: Wesen und Lehre des Sports, Berlin: Weidmann 1949, 9-10.
8
Vgl. ebd., 20.
13Bewegung ist aber vieles, daher dröselt Stygermeer zuallererst den Begriff Bewegung zwischen
lebendiger und unlebendiger, zwischen menschlicher und nicht menschlicher sowie zwischen
sportlicher und unsportlicher Bewegung auf.9 Lebendige Bewegung wird aber auch von Tieren
und Pflanzen ausgeführt, dennoch handelt es sich hierbei nicht um Sport. Stygermeer sieht in
der menschlichen Fähigkeit zur Differenzierung die Voraussetzung dafür, Bewegung als
Selbstzweck auszuführen.10 Dadurch ist der Mensch in der Lage, zwischen sich und dem Rest
der Wirklichkeit zu unterscheiden. Er kann sich dadurch als Einheit von der restlichen Welt
differenzieren und seine leibliche Individualität als unteilbare Einheit erfahren.11
Wenn man von Bewegung spricht, ist immer davon die Rede, dass eine Masse durch Raum und
Zeit bewegt wird. Im Kontext von Sport ist aber essenziell, dass diese Bewegung im
physikalischen Sinne durch eine bestimmte Person ausgeführt wird. Sport kann nicht
vertretungsweise getrieben werden, die Individualität als Unteilbarkeit des Leibes ist für den
Sport konstitutiv. Sport wäre demnach undenkbar, wenn es gleichgültig wäre, wer die
körperliche Leistung vollführt. Eine erste Definition von Sport lautet nach Stygermeer daher
wie folgt: „Sport ist die Repräsentation der leiblichen Individualität (als Unteil- und
Unaustauschbarkeit) in der Ableistung von Arbeit im physikalischen Sinne.“12
Dies allein wäre allerdings zu wenig, sondern verweist nur darauf, dass eine sportliche Leistung
nicht delegierbar ist. Dem Wesen des Sports fehlt in dieser Definition aber noch die
Komponente der Leistungssteigerung. Sport im Sinne der ersten Definition wäre ohne den
Aspekt der Leistungssteigerung äußerst langweilig und würde auch Wettbewerbe zulassen, wo
es beispielsweise das sportliche Ziel sein könnte, möglichst langsam zu sein. Die Realität zeigt
aber, dass gerade im Leistungssport die Leistungssteigerung eines Athleten mithilfe eines
Teams, das sich aus verschiedensten Professionen zusammensetzt, mit großer Konsequenz
verfolgt wird. Stygermeer definiert daher in einer zweiten Definition Sport in folgender Weise:
„Sport ist die Repräsentation der leiblichen Individualität (als Unteil- und Unaustauschbarkeit)
9
Vgl. Stygermeer, Moth: Der Sport und seine Ethik. Zur Grundlegung einer Dogmatik des Sports, Berlin: Tenea
Verlag 1999, 9.
10
Vgl. ebd., 58-61.
11
Vgl. ebd., 61.
12
Vgl. ebd., 77-81.
14in der Ableistung von Arbeit im physikalischen Sinne bei klarer Differenzierung von
individueller Verursachung und multifunktionaler Mitwirkung.“13
Sport kann also nur vom Sporttreibenden selbst betrieben werden, klar definierte Hilfeleistung
von außen durch Unterstützungspersonen ist vor allem heutzutage im hochprofessionellen
Sport üblich und nicht mehr wegzudenken.
2.3 Bewegung als Leibphänomen
Der Ursprung des Sports wird in der Jagd und im Kampf zur Sicherung der Existenz vermutet,
als Vorformen, aus denen aus Kult oder agonalen Antrieben Sport entstanden ist.14
Nach Liedke gibt es anthropologisch fünf endogene Faktoren, die in der Verhaltensforschung
beschrieben und als biologisch determiniert gesehen werden, die dafür ausschlaggebend sind,
dass sich Menschen sportlich betätigen:
v Bewegungsdrang
v Bedürfnis nach Leistungssteigerung
v Wettbewerb
v Zielgebundene Jagd (über den Nahrungserwerb hinaus)
v Bedürfnis nach Selbstdarstellung und Beachtung.15
Aus anthropologischer Sicht ist der Mensch gekennzeichnet durch seine Weltoffenheit. Die
Position des Menschen ist exzentrisch zu seiner Umwelt im Gegensatz zu jener eines Tieres.
Darüber hinaus wird der Mensch als Mängelwesen und als Handlungswesen gesehen, das seine
Mittellosigkeit und Hilflosigkeit durch Schaffung einer Kultur, mittels Sprache und durch
intelligentes Handeln, überwinden kann und zur Herstellung von Distanz zu seiner Umwelt
fähig ist. 16 Auch Bewegung wird dabei nach Grupe als Handlung verstanden, die den
13
Vgl. ebd., 84-86.
14
Vgl. Lotz, Klaus: Anthropologie und Sport. Beiträge zu einer philosophischen Fundierung des Sports aus
anthropologischer Sicht, Hanau: Cocon 2010, 100-101.
15
Vgl. Liedke, M.: Schulsportanthropologische Funktion und pädagogische Bedeutung, in: Baumann-Heimerl,
Schulsport-wozu, Aachen 1995, 13-23, [zit. n. Lotz, Klaus: Anthropologie und Sport. Beiträge zu einer
philosophischen Fundierung des Sports aus anthropologischer Sicht, Hanau: Cocon 2010, 100].
16
Vgl. Haag, Herbert: Bewegungskultur und Freizeit. Vom Grundbedürfnis nach Sport und Spiel, Osnabrück:
Fromm 1986, 19-20.
15weltoffenen Menschen in die Lage versetzt, auf die Welt zuzugehen und die Welt zu sich zu
holen. Dadurch, dass der Mensch nicht nur Leib ist, sondern auch einen Leib hat, kann er durch
Bewegung eine Beziehung zur Welt herstellen, kann sich ihr mitteilen und sie erfahren.17
2.4 Sport als Bestandteil der Kultur
Die Frage, ob Sport ein Teil der Kultur sein soll, scheint vordergründig eher eigenartig
anzumuten, da der Begriff Kultur im Alltagsverständnis oft mit Hochkultur wie klassischer
Musik, bildender und darstellender Kunst oder gehobener Literatur synonym verwendet wurde
und teilweise noch immer in diesem normativen Sinn verstanden wird. Innerhalb dieses
Kulturverständnisses ist Sport daher nicht zu verorten.
Allerdings hat sich Sport weltweit in allen Kulturen verbreitet, und die Mechanismen des Sports
mit den Regel-, Normen- und Wertesystemen werden annähernd gleich verstanden und ebenso
betrieben. Dies betrifft sowohl die für den jeweiligen Sport typischen Bewegungsformen und
Bewegungsmuster als auch für die Prinzipien der Leistung und des geregelten Ablaufs, die für
den Sport bestimmend sind. 18 Grupe weist darauf hin, dass Sport tief in der Gesellschaft
verankert ist und viele Berufe sich in diesem Feld betätigen. Darüber hinaus besteht ein
beträchtliches mediales Interesse an Sport, wie die Übertragungen der Olympischen Spiele oder
Fußballweltmeisterschaften zeigen. Der ehemalige Präsident des Internationalen Olympischen
Komitees Avery Brundage rückte Sport sogar in die Sphäre einer Religion mit universellem
Anspruch.19
Der Soziologe Friedhelm Neidhardt fasste den Begriff Kultur in einer übergreifenden und
allgemeinen Formel zusammen: „[...] sie sei das System kollektiver Sinnkonstruktionen, mit
denen Menschen die Wirklichkeit definieren – jener Komplex von allgemeinen Vorstellungen,
mit denen sie zwischen wichtig und unwichtig, wahr und falsch, gut und böse sowie schön und
hässlich unterscheiden.“ 20Nach dieser Definition ist Kultur ein System, das sich eher durch
17
Vgl. Grupe, Ommo: Grundlagen der Sportpädagogik. 2. Aufl., Schorndorf: Hoffmann 1975 [zit. n. Haag,
Herbert: Bewegungskultur und Freizeit. Vom Grundbedürfnis nach Sport und Spiel, Osnabrück: Fromm 1986, 20-
21.]
18
Vgl. Grupe, Ommo: Sport als Kultur, Osnabrück: Fromm 1987, 24-25.
19
Vgl. ebd., 25-26.
20
Vgl. ebd., 27.
16Verschwommenheit auszeichnet als durch genaue Erkennbarkeit von Strukturen, Funktionen,
Merkmalen.21 Durch den Wandel des Kulturverständnisses - von einem normativen zu einem
deskriptiven Verständnis - ist letztlich alles Kultur und der Begriff wurde zu einer diffusen
Beschreibungskategorie bzw. zu einer wenig strukturierten, allgemeinen Hintergrundgröße.
Kultur konnte nun nicht mehr einer normativen Auslegung eines elitären Kulturbegriffes
folgend als Kriterium des Anspruchs, des Vorrechtes und der Abgrenzung für bestimmte
Gesellschaftsschichten herangezogen werden, sondern musste einem egalitären Verständnis
Platz machen.22
Sport hat sich zu einen Kulturphänomen entwickelt und Begriffe wie „Sportkultur“ oder
„Freizeitkultur“ sind in unserer Sprache mittlerweile fest verankert. Diese Begriffe sind aber
wieder nur Überbegriffe, die weiter differenziert werden, beispielsweise in Freizeitsportkultur
oder Leistungssportkultur oder Vereinskultur oder Fußballkultur. Von den Sport-
wissenschaftlern Gunter Gebauer und Eugen König wird Sport als klassischer Bereich der
Alltagskultur gesehen, da im Sport, abgesehen von eigenen Werten und Normen, allgemeine
kulturelle Grundmuster und Wertorientierungen wie Leistung, geregelter Wettbewerb und
Gleichheit gelten.23
Innerhalb der Alltagskultur unterliegt der Sport einer weiteren Entwicklung und
Ausdifferenzierung. Auf der einen Seite gibt es immer mehr Sportangebote, denen kaum
Grenzen gesetzt sind, wenn man Extremsportarten auf der einen Seite mit der Suche nach
Spannung oder fernöstliche Entspannungstechniken auf der anderen Seite mit der Suche nach
Entspannung und Erholung als Beispiele heranzieht. Die Vielfalt an Sportangeboten und
Sportarten befriedigt auch das Individualisierungsbedürfnis vieler Menschen in einer
pluralistischen Welt, auch wenn dies oft nur durch die unterschiedliche Sportkleidung zum
Ausdruck kommt. 24 Über Medien findet Sport seine globale Inszenierung und mit der
Berichterstattung über Sportereignisse füllen unzählige Fernsehsender ihre Sendezeiten und
machen einen wesentlichen Teil der Unterhaltungskultur aus - kombiniert mit Werbe-
botschaften. Sportler*innen werden dabei mit Bildern kunstvoll in Szene gesetzt, Sportbilder
21
Vgl. ebd.
22
Vgl. ebd., 26-28.
23
Vgl. ebd., 29-30.
24
Vgl. Grupe, Ommo: Vom Sinn des Sports. Kulturelle, pädagogische und ethische Aspekte, Schorndorf:
Hoffmann 2000, 30-32.
17werden zu eigenen Kunstbildern und Motiven, die auch im Design und der Werbegraphik ihren
Niederschlag finden.25
2.5 Sport als Kunstwerk
Die Frage nach der Zuordnung des Sports in eine bestimmte Sphäre des menschlichen Tuns
beantwortet Güldenpfennig damit, dass es durchaus Sinn macht, Sport als Kunst bzw. als eine
der Künste zu verstehen. 26 Zwischen den anderen Künsten und dem Sport bestehen nach
Güldenpfennig sowohl Parallelen als auch Unterschiede, durch die jede Kunstgattung eben ihre
spezifischen Eigenschaften aufweist. Einem möglichen Einwand gegen eine Zuordnung des
Sports zu den Künsten aufgrund der fehlenden Kreativität bei Sportereignissen begegnet er mit
dem Verweis, dass auch viele Künste an bestimmte Vorgaben gebunden sind, die der Kreativität
nur wenig Raum lassen, beispielweise beim Ballett aufgrund der Beschränkung durch die
Gebundenheit an den menschlichen Körper. Überdies ist auch im Sport Kreativität in
vielfältigen Formen erkennbar, wenn man genauer hinsieht.27
Güldenpfennig führt sieben Kriterien an, die Sport als Kunst ausweisen, da diese Kriterien für
alle Künste gelten:
1. Sport gehört der Sphäre des Spiels an, ist selbstzweckhaftes Handeln.
2. Wichtige Teile von Regeln konstituieren erst den gesamten Sinn-Raum.
3. Es wird eine eigene, fiktive Welt erschaffen.
4. In dieser fiktiven Welt sind auch außerästhetische Welten vorhanden, aber den Gesetzen
dieser Spielwelt folgend.
5. In dieser Welt regiert das Primat der ästhetischen Formgestaltung.
6. Durch das Zusammenwirken der Akteur*innen entsteht eine besondere Gattung eines
künstlerischen Werkes: ein „Sport-Werk“.
25
Vgl. ebd.
26
Vgl. Güldenpfennig, Sven: Sport: Kritik und Eigensinn. Der Sport der Gesellschaft, 1. Aufl., Sankt Augustin:
Academia, 2000, 140.
27
Vgl. ebd., 141.
187. Sportwerke haben eine doppelte interne Verweisungsstruktur und verweisen erstens von
sportlichen Einzelaktionen auf den Vordergrundsinn des Einzelereignisses und zweitens von
sportlichen Einzelereignissen auf den Hintergrundsinn des Gesamtsports.28
Der Sport erzählt in seiner fiktiven Welt frei erfundene Geschichten und ist darin nur so weit
mit der realen Welt verwoben, wie es für die Konstruktion der Erzählung notwendig ist. Die
(Sport-)Erzählung der fiktiven Welt bestimmt über den Kontext, der mit einbezogen wird. Die
Sinnstruktur der Sportgeschichten besteht nur innerhalb dieser selbst, Sport ist also
selbstzweckhaft.29
2.6 Sport als Regelsystem
Sport ist ein Feld menschlichen Handelns, das von einer Vielzahl von Regeln und Normen
bestimmt wird, damit er laienhaft formuliert „funktionieren kann“.
Grieswelle spricht hier davon, Sport als eine Menge von Regelsystemen zu begreifen, mittels
welchen das soziale Handeln der Akteure in den jeweiligen Sportarten normiert wird. Die
Charakteristik des Sports liegt in ausgeformten, spezialisierten und wiederholungsfähigen
Aktivitäten, in Mustern, die zwar veränderbar sind, aber ein starkes Beharrungsvermögen
aufweisen. Es werden auf Leistung gerichtete Leibesübungen nach Kulturmustern
reglementiert und festgelegte Normen regeln in objektiver Weise das sportliche Handeln.30
Heinemann unterscheidet dabei drei Typen von Regeln: Regeln auf dem Sportplatz, Regeln und
Normen am Rande des Spielfelds und Regeln außerhalb des Sportplatzes.31 Zu den Regeln auf
dem Sportplatz zählen:
v Konstitutive Regeln, durch die der Rahmen der Sportart durch die Festlegung von Zeit,
Raum und Ziel definiert wird.
28
Vgl. ebd., 141-142.
29
Vgl. Güldenpfennig, Sven: Sport: Kritik und Eigensinn. Der Sport der Gesellschaft, 1. Aufl., Sankt Augustin:
Academia, 2000, 55.
30
Vgl. Grieswelle, Detlef: Sportsoziologie.-1. Aufl., Stuttgart, Berlin, Köln, Mainz: Kohlhammer, 1978, 32-33.
31
Vgl. Heinemann, Klaus: Einführung in die Soziologie des Sports. 4., völlig neu bearbeitete Auflage, Schorndorf:
Hoffmann 1998, 54-55.
19v Prozessregeln, durch die die Verhaltensweisen der Mitwirkenden, Gebote und Verbote
einer Sportart definiert werden.
v Fertigkeitsregeln, durch die besondere Fähigkeiten, Techniken und Kenntnisse, die für eine
Sportart erforderlich sind, definiert werden.
v Strategische Regeln fördern die optimale Ausführung der Sportart.
v Ethische Regeln sollen die positiven Werthaltungen gegenüber dem Sport, den Regeln und
Normen zu Ausdruck zu bringen.32
Zu den Regeln und Normen am Rande des Spielfeldes zählen jene, die für die Sportart zwar
nicht konstitutiv sind, die Ausübung des Sports aber entscheidend mitbestimmen wie Verkehrs-
und Vorfahrtsregeln, Bau- und Sicherheitsvorschriften, Qualifikationsanforderungen und
Umweltschutzbestimmungen. Unter Regeln und Normen außerhalb des Sportplatzes führt
Heinemann insbesondere Rechtsvorschriften an, welche Rahmenbedingungen für den Sport
darstellen.33
Die Regeln, die den Sport in seiner Eigenart konstituieren, weisen aber Besonderheiten auf.
2.6.1 Willkürlichkeit der Ziele, Irrelevanz in anderen Sphären
Im Sport sind Regeln und Normen allgegenwärtig. Das Besondere am Regelwerk im Sport ist,
dass es völlig willkürlich konstruiert wird und bei entsprechendem Willen auch völlig anders
aussehen könnte. Heinemann spricht hier von einem Eigenweltcharakter des Regelwerkes im
Sport. Durch die willkürliche Festlegung von Regeln sind auch die Ziele von Sport willkürlich,
da sie auch anders festgelegt werden könnten. Der Autor führt als Beispiel an, dass man anstatt
eines 100m-Laufes auch einen 85,36m-Lauf veranstalten könnte, oder dass nicht jene(r)
Sportler*in gewonnen hat, die oder der am höchsten gesprungen ist, sondern jene(r), die oder
der sowohl am höchsten als auch am weitesten gesprungen ist. Das Ergebnis eines Wettkampfes
ist somit nur innerhalb des Wettkampfes von Relevanz, außerhalb dieser Sphäre ist es
bedeutungslos und irrelevant.34
32
Vgl. ebd.
33
Vgl. ebd., 56.
34
Vgl. ebd.
202.6.2 Ritualcharakter der Regeln
Regeln im Sport werden also beliebig definiert und sind nicht immer rational begründbar, sie
haben nach Heinemann den Charakter von Ritualen. Es wird zum Beispiel nicht festgelegt, wie
viele Tore eine Fußballmannschaft zu schießen hat, um ein Spiel zu gewinnen, sondern
geregelt, wie das Ziel, ein Tor zu schießen, erreicht werden darf. Diese willkürlichen Regeln
sind nicht rational begründet und könnten auch ganz anderes formuliert werden. Sportregeln
sind beliebig festgelegte Verknappungen von Zeit, Geräten, Techniken etc., um jenen zum Sieg
zu verhelfen, die mit diesen knappen Mitteln am besten umgehen können. 35 Heinemann
formuliert hier: „Die Instrumentalisierung bzw. Ökonomisierung des Körpers wird zum
Selbstzweck: Körperliche Fähigkeiten und Fertigkeiten, Motorik, Kraft, Schnelligkeit und
Ausdauer sind so zu optimieren, dass ein willkürlich festgelegtes Ziel nach willkürlich
festgelegten Regeln möglichst gut und besser als von anderen erreicht wird.“36
2.6.3 Neutralität gegenüber den Gegnern
Im Sport wirken soziale Normen und Regeln, die für alle Konkurrent*innen gleiche
Wettbewerbsbedingungen herstellen, die Regeln sind also neutral. Dies bedeutet, dass durch
das Regelwerk im Sport ein Rahmen sozialer Gleichheit geschaffen wird. Anders als unter
Alltagsbedingungen, wo trotz des Gleichheitsprinzips in entwickelten Demokratien soziale
Ungleichheit besteht, werden im Sport diese Unterschiede ausgeschaltet, und es treten sich
Menschen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Schichtzuge-hörigkeit,
unterschiedlicher ökonomischer Ressourcen und Bildungsgrade im sportlichen Wettkampf
gegenüber. Von Krockow formulierte, dass Sport „fast wie der Entwurf einer Utopie: also ein
Versprechen dessen, was allgemein sein sollte, aber nicht ist“, erscheint.37
Neben dem Schaffen sozialer Gleichheit sorgt das Regelwerk im Sport auch dafür, dass der
Ausgang eines Wettkampfes offen und ungewiss ist. Durch verschiedenste Regulative wie
durch die Einteilung in Leistungsklassen wird eine weitgehende Chancengleichheit hergestellt,
35
Vgl. ebd., 57-58.
36
Vgl. ebd., 58.
37
Krockow, 1972, 102 [zit. n.: Heinemann, Klaus: Einführung in die Soziologie des Sports. 4., völlig neu
bearbeitete Auflage, Schorndorf: Hoffmann 1998, 59].
21die dafür sorgt, dass die Chancen auf Erfolg oder Misserfolg für alle Teilnehmer*innen gleich
sind. Diese Chancengleichheit sorgt für eine Stimulation der Leistungsmotivation.38
2.6.4 Eigenweltcharakter
Die Welt des Sports kennt klare Regeln, mit denen festgelegt ist, innerhalb welchen räumlichen
und zeitlichen Grenzen sich ein Wettbewerb abspielt. Im Wettkampf wird nach klaren und
objektiven Regeln ein Sieger ermittelt, was von den Teilnehmern mithilfe ihrer eigenen
Fähigkeiten und ihres Einsatzes angestrebt wird. Im Alltag finden Menschen allerdings völlig
andere Bedingungen vor. Ziele, Absichten sind oft unklar, Regeln interpretationsbedürftig und
oft ist Kooperation nötig, um ein Ziel zu erreichen. Die besonderen Bedingungen des Sportes
mit seinen klaren Regeln mögen auch ein Grund für seine Attraktivität sein.39
2.6.5 Zwang zur Legitimation
Aufgrund des beschriebenen Aspekts der Irrelevanz einer sportlichen Leistung außerhalb der
sportlichen Sphäre stellt sich die Frage nach Sinn und Zweck. Abgesehen vom Zweck des
Geldverdienens, der für einige Sportler*innen gelten mag und der ökonomischen
Verwertbarkeit des Sports, bedarf es für die große Masse derer, die kein Geld mit Sport
verdienen können, nach einer anderen Legitimation. Heinemann führt hier drei Typen an:
rationalistische Legitimationen, die dem Sport einen sozialen, gesundheitlichen oder
psychischen Nutzen zuschreiben oder ihn als Ausgleich zum Alltag sehen. Strukturalistische
Legitimationen verweisen auf den Wert des Sports durch die Verwirklichung idealer kultureller
Grundprinzipien wie Chancengleichheit und Leistungsgerechtigkeit und des damit
einhergehenden Verstehens von gesellschaftlichen Mechanismen. A-rationale Legitimationen
sehen den Wert des Sports genau darin, dass er nichts mit der normalen Alltagswelt zu tun hat
und so zu einem Rückzugsort für Spiel, Spaß und Freude wird und die normale Wirklichkeit
ausblendet, was den Eigenweltcharakter betont.40
38
Vgl. Heinemann, Klaus: Einführung in die Soziologie des Sports. 4., völlig neu bearbeitete Auflage, Schorndorf:
Hoffmann 1998, 59.
39
Vgl. ebd., 60.
40
Vgl. ebd., 60-61.
222.7 Sport als Sinnsystem
Wenn man davon ausgeht, dass menschliches Handeln immer mit einem Sinn verbunden ist,
dann muss man auch sportlicher Betätigung Sinn zuschreiben. Der Sport hat als Institution
selbst einen eigenen Sinn. Dieser eigene Sinn bietet den aktiven und passiven
Sportteilnehmer*innen Sinnmuster an, und gleichzeitig richtet der Sport sein Selbstverständnis
danach aus.41
Dieses Selbstverständnis ist aber keineswegs einheitlich, sondern unterliegt einer heterogenen
Sinnzuschreibung. Sporttreibende können Leistung und Wettbewerb in den Mittelpunkt von
Sport stellen, andere sehen wiederum den gesundheitlichen Aspekt und soziale Aspekte im
Vordergrund, wieder andere haben einen wirtschaftlichen Erfolg als ihr vorrangigstes
Sinnmuster. Sinnmuster sind vielfältig und unterliegen auch in homogenen Gruppen keinen
einheitlichen Sinngebungen. So wirken soziokulturelle Faktoren wie Alter, Beruf, Einkommen
oder Bildungsgrad auf die Sinnmuster ebenso wie die Darstellung von Sport in den Medien.
Durch die Selektion bestimmter Sportarten durch die Medien und die entsprechenden medialen
Inszenierungen kommt ihnen eine eigene Deutungsmacht zu.42 Grupe spricht hier sogar von
einem Sinndeutungsmonopol43 der Medien.
Dietrich Kurz definiert sechs Sinn-Bereiche, die für Menschen im Sport ausschlaggebend sind:
1. Menschen suchen im Sport besondere Körpererfahrung, den körperlichen Ausgleich, die –
möglichst umfassende – körperliche Beanspruchung und das daraus hervorgehende
Wohlbefinden. Sie erwarten vom Sport auch positive Wirkungen für ihre Fitness, ihre
Gesundheit und ihre Figur.
2. Menschen suchen im Sport den Reiz, die Sensation, die Lust, die mit der
Bewegungshandlung selbst verbunden sein können. Sie erschließen sich durch die
Bewegungen des Sports Erfahrungen besonderer Art, nicht zuletzt auch in der und über die
Natur.
3. Menschen suchen die sportliche Bewegung als eine Botschaft über sich selbst zu gestalten;
sie wollen durch Bewegung etwas ausdrücken; sie möchten, dass ihre Bewegungen gekonnt,
kunstvoll, beeindruckend, schön, ästhetisch erscheinen.
4. Menschen suchen den Sport als Handlungsfeld auf, in dem man sich etwas vornehmen,
etwas abverlangen, sich an Aufgaben messen und mit anderen vergleichen, seine
41
Vgl. Grupe, Ommo: Vom Sinn des Sports. Kulturelle, pädagogische und ethische Aspekte, Schorndorf:
Hoffmann 2000, 49.
42
Vgl. ebd., 50-53.
43
Ebd., 53.
23Möglichkeiten und Grenzen erkennen, die Anerkennung anderer erfahren und den eigenen
Wert erleben kann.
5. Menschen suchen im Sport Situationen mit einem offenen Ausgang, der sie zwar in
Spannung versetzt, aber nicht unbedingt bedroht. Sie suchen Erlebnisse von Risiko und
Abenteuer, die Lust des Ungewissen und das befreite Gefühl danach.
6. Menschen suchen im Sport das Beisammensein mit anderen, die besondere, oft leichtere
Kommunikation, die Erfahrungen von menschlicher Nähe, Geselligkeit und
Gemeinschaft.44
Der Autor sieht in jedem dieser Sinnbereiche eine mögliche Antwort, die der Sport auf Defizite
des Alltags geben kann. 45 Bereiche, für die Sport eine Kompensation sein könnte sind der
Mangel
- an körperlichen Beanspruchungen in einer Welt der Maschinen und Fahrzeuge;
- an Unmittelbarkeit und Spontanität in einer Welt der Medien und Automaten;
- an Leistungen, die wir uns persönlich zurechnen können, in einer Welt immer komplexerer
und unübersichtlicher Arbeitsvorgänge;
- an Spannung und Dramatik in einer Welt der Versicherungen und Routine;
- an überschaubaren Kontakten in einer Welt der Einsamkeit und der Massen.46
Für Grupe lässt sich der Sinn von Sport auch auf eine allgemeine Formel bringen. Für aktive
und passive Sportteilnehmer*innen liegt der allgemeine Sinn abgesehen von den besonderen
Sinnmustern im 1:0 des Sports. Mit diesem Bild wird auf die Unmittelbarkeit des Sports
hingewiesen, mit all seinen Facetten des Gewinnens und Verlierens, der Konkurrenz und
Kooperation, des Leidens und Könnens, des Hochmutes und Falles, der Dramatik und Ästhetik,
um nur einige wenige hier zu nennen. Diese Unmittelbarkeit des Sports kann selbst erlebt oder
miterlebt werden, ist authentisch und ein Teil des Lebens, der für viele eine hohe Attraktivität
aufweist.47
2.8 Sport als ästhetische Inszenierung
Martin Seel rückt den Blick auf Aspekte der Ästhetik des Sports in den Mittelpunkt und versteht
diesen als Schauspiel. Dabei werden sportliche Betätigungen wie Waldlaufen oder Radtouren
44
Kurz, Dietrich: Was suchen Menschen im Sport? Erwartungen und Bedürfnisse der Zukunft, in: Gieseler,
Karlheinz (Hg.): Menschen im Sport 2000. Dokumentation des Kongresses „Menschen im Sport 2000“, Berlin
5.7.11.1987, Schorndorf: Hoffmann 1998, 128.
45
Vgl. ebd., 129.
46
Vgl. ebd.
47
Vgl. Grupe, Ommo: Sport als Kultur, Osnabrück: Fromm 1987, 59-60.
24ausgeklammert, der Autor fokussiert auf den sportlichen Wettkampf, wie er im professionellen
Sport ausgeübt wird. 48 Folgende Definition kommt hier zur Anwendung: „Sport ist das
öffentliche Schauspiel eines durch anschauliche körperliche Handlungen vollzogenen und nach
objektiven Kriterien entschiedenen Wettkampfs im Rahmen bestimmter Regeln, die den
Handlungsspielraum der Ausführenden begrenzen.“49
In diesem Schauspiel spielt der Körper des Sportlers die entscheidende Rolle, denn er muss in
räumlicher und zeitlicher Begrenzung Bewegungen ausführen. Raum und Zeit sind als
begrenzende Elemente für den Sports konstitutiv, erst dadurch erhält eine sportliche Tätigkeit
den Charakter eines Spiels. Durch diese Begrenzung mit einem Beginn und einem sicheren
Ende erhält der Wettkampf seinen Reiz, an dem Zuschauer teilhaben wollen. Dabei spielen
nicht nur die sportlichen Handlungen an sich, sondern auch alle anderen zur Schau gestellten
Verhaltensweisen der Sportler*innen eine ästhetische Rolle und gehören zur Dramaturgie.50
Die Faszination des Sports geht von der Unvorhersehbarkeit des Höhepunktes aus, die
Dramaturgie folgt laut dem Autor einem Gesetz der verzögerten Kulmination. Keiner der
Akteure weiß, ob der Höhepunkt des Wettkampfes schon war oder noch kommen wird oder ob
es deren mehrere geben wird. Die Zuseher*innen möchten im Geschehen dieser sportlichen
Höhepunkte dabei sein, bei der Entscheidung des Wettkampfes, die durch das Können und
Wollen der Beteiligten nicht gänzlich beeinflussbar ist. Die Ungewissheit und die
Unkalkulierbarkeit des Wettkampfes sind nicht nur für Zuseher*innen, sondern auch für die
aktiv Ausübenden interessant. Beide Seiten warten darauf, dass etwas nicht Voraussehbares
passiert.51
Der Autor unterscheidet das Gelingen einer sportlichen Leistung von der sportlichen Leistung:
Der Gewinn eines Wettbewerbes ist von der Leistung, die physisch und psychisch erbracht
wird, nicht planbar. Der Sieg ist für Seel ein Gelingen, für das die körperliche und geistige
Verfassung der Sportler*innen die Grundlage ist, die dieses Gelingen an einem bestimmten
Punkt zulassen kann, aber der Sieg oder die Niederlage fällt den Wettkämpfenden zu. Seel
spricht von einer Verselbstständigung des Leibes, die Sportler*innen eins werden lässt mit dem
48
Vgl. Seel, Martin: Ethisch-ästhetische Studien, 1. Aufl., Frankfurt am Main: Suhrkamp 1996, 188-190.
49
Ebd., 191.
50
Vgl. ebd., 192-193.
51
Vgl. ebd., 194.
25Geschehen, um etwas zu erreichen, was nicht mehr trainierbar ist. Sport ist für den Autor der
Versuch von Sportler*innen, im Rahmen begrenzter Zeit und begrenzten Raums, mittels
körperlicher Tätigkeiten in aller Öffentlichkeit etwas auf virtuose Weise zu tun, was sie nicht
können, denn der Sieg ist immer ungewiss. Es ist eine riskante Zurschaustellung, in der das
Unvermögen zelebriert wird. Die Ungewissheit des Eintretens des Gelingens oder Nicht-
Gelingens ist aber der Grund für die Faszination sowohl auf der Seite der Zuschauer*innen als
auch auf jener der Sportler*innen.52 Sport ist für den Autor die ästhetische Inszenierung der
physischen Natur des Menschen. Im Sport wird die Grenze dieser physischen Natur erfahrbar,
und Sportler*innen feiern in dieser Inszenierung die Grenze ihrer physischen und psychischen
Fähigkeiten.53
Auch für Güldenpfennig ist ein Sportereignis „die Aufführung eines Dramas, das Erzählen einer
Fabel oder eines Epos, in welchen es in unendlich vielen Akten, Kapiteln oder Strophen um
Variationen auf ein Thema“54 geht. Folgende Erzählelemente sind dafür konstitutiv:
- Die Betonung auf den Wett-Kampf, als Wette von Sportler*innen, etwas vollbringen
zu können, das für kaum möglich gehalten wird, mit dem gleichzeitigen
Versprechen, mit allen erlaubten Mitteln im Rahmen der Regeln um den Erfolg zu
kämpfen,
- dem Streben nach Exzellenz, mit dem Ziel des Ausreizens der Leistungsgrenzen zur
Selbstvervollkommnung unter Einhaltung der Regeln innerhalb des künstlich
errichteten Rahmens der Sportart, also dem bewussten Verzicht auf unerlaubte
Hilfsmittel,
- die Verabredung einer künstlich herbeigeführten Fehde, bei der es außer um den
Austrag um nichts geht, aber trotzdem so getan wird, als ob es ganz im Gegenteil
um alles ginge,
- dem Errichten eines ästhetischen Werkes, eine Sport-Werkes,
- der Frage, ob und wie das Sportwerk gelingt, was letztlich die Faszination des
Ereignisses ausmacht.55
52
Vgl. ebd., 195-197.
53
Vgl. Seel, Martin: Ethisch-ästhetische Studien, 1. Aufl., Frankfurt am Main: Suhrkamp 1996, 199.
54
Güldenpfennig, Sven: Sport verstehen und verantworten. Sportsinn als Herausforderung für Wissenshaft und
Politik, 1. Auflage, Sankt Augustin: Academia 2007, 269.
55
Vgl. ebd., 269-270.
26Sie können auch lesen