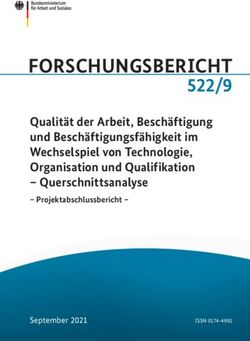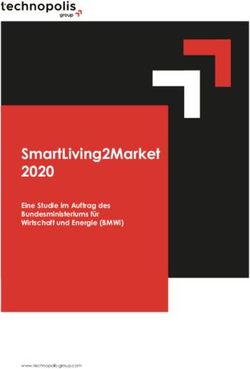Heller schneller stärker - Fraunhofer IAF
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
ISBN 978-3-8167-7403-7
GaAs - AlGaAs - GaSb - AlGaSb - InP - GaInAs - InAs - GaN - AlN - GaInN - CdHgTe
1957 – 2007
heller JAHRE
stärker
schnellerDie schnellsten MMICs der Welt kommen aus dem Fraunhofer IAF: InAlAs/InGaAs-Transistor mit 50 nm Gatelänge und 380 GHz Grenzfrequenz.
Günter Weimann
Institutsleiter Fraunhofer IAF
heller – schneller – stärker
Unser Jubiläumsmotto beschreibt, chronologisch
zwar etwas ungenau, die folgenreichen Erfin-
dungen und Entwicklungen, die unsere Welt
noch immer verändern.
Als der Transistor 1947 erfunden wurde, er-
reichte er das hohe C und verstärkte Wechsel-
stromsignale bis zu einigen Kilohertz. Unsere
heutigen Transistoren am IAF haben Grenzfre-
quenzen von einigen hundert Gigahertz:
100 000-mal schneller. Die ersten – und sehr
dunklen – Leuchtdioden hatten eine Lichtaus-
beute von 0,1 Lumen/Watt, heute erreichen
LEDs 100 Lumen/Watt: 1 000-mal heller. Unsere
GaN-Transistoren haben heute Leistungsdichten
von 10 Watt/mm Gateweite: 10-mal stärker als
die auf GaAs basierenden Vorgänger.
Als das IAF 1957 gegründet wurde, waren die
III/V-Verbindungshalbleiter gerade fünf Jahre alt,
der Halbleiterlaser sollte erst fünf Jahre später
erfunden werden. Das damals gegründete Insti-
tut für Elektrowerkstoffe hatte den Auftrag,
Materialentwicklung für wehrtechnische Anwen-
dungen zu betreiben. Das zuständige Verteidi-
gungsministerium erwies sich übrigens als viel
weitsichtiger, als die amerikanischen Militärs
seinerzeit: nach der Erfindung des Transistors
hielten sie diesen weder für geheimhaltungs-
noch förderungswürdig – letzteres sicherlich
50 Jahre Fraunhofer IAFÜberall verfügbar und sauber – netzunabhängige
Stromversorgung mit erneuerbaren Energien
noch enttäuschender für die Erfinder. Das Insti- Einige Beispiele seien hier genannt: Im wehrtech-
tut für Elektrowerkstoffe wurde jedoch bald an- nischen Bereich setzten Infrarotdetektoren mit
gehalten, sich mit den modernen Halbleitern zu höchster thermischer Auflösung und bispektrale
beschäftigen, damit war sein Weg vorgezeichnet. Detektoren neue internationale Maßstäbe, eben-
so wie Millimeterwellenschaltungen mit höch-
Diese Ausrichtung wurde erfolgreich fortgesetzt sten Frequenzen. Im zivilen Sektor gehören GaN-
mit den vom Bundesministerium für Bildung und Leistungsverstärker für die Mobilkommunikation,
Forschung (damals noch BMFT – Forschung und Quantenkaskadenlaser und Leistungslaser zu den
Technologie) geförderten Verbundprogrammen herausragenden Ergebnissen.
auf dem Gebiet der III/V-Halbleiter, mit Vernet-
zung der Forschungslandschaft und ausgepräg- Das IAF war und ist erfolgreich, gestützt durch
ten Industriekooperationen. Das IAF konnte da- die Finanzierung und Förderung von BMVg und
mit seine zivile Vertragsforschung ausbauen und BMBF – aber auch durch das Vertrauen unserer
wurde zu einem führenden Forschungsinstitut in- und ausländischen Industriepartner. Dafür
für Mikro- und Optoelektronik auf der Basis von danken wir.
Galliumarsenid und seinen Verwandten.
Messlatte für unsere Erfolge sind auch wissen-
Es war ein erfolgreicher Weg mit den III/V-Halb- schaftliche Preise und erfolgreiche Ausgründun-
leitern und der gesamten Kette von Materialent- gen. Entscheidend für Erfolg und Innovationen –
wicklung, Prozesstechnologie, Bauelementen in fünfzig Jahren immer wieder erreicht – sind
und integrierten Schaltungen. Das IAF hat die aber Wissen, Können und Fleiss der Mitarbeiter-
bahnbrechenden Fortschritte in der Halbleiter- innen und Mitarbeiter des IAF. Dafür bedanke
technologie mitgemacht, oft vorangetrieben. ich mich und wünsche dem IAF, für das ich
Entwicklungen wie die Molekularstrahlepitaxie zwölf Jahre arbeiten durfte, weiterhin Erfolg
für das atomlagengenaue Kristallwachstum von und gute Ideen.
Halbleiterstrukturen und die Lateralstrukturie-
rung im Nanometerbereich haben neue Bau- Ihr
elemente – auch Quanteneffektbauelemente –
ermöglicht, diese gehören schon seit vielen
Jahren zum Portfolio des Fraunhofer IAF. Prof. Günter Weimann
50 Jahre Fraunhofer IAF50 Jahre Fraunhofer IAF
Inhaltsverzeichnis
Grußworte 2
Ein halbes Jahrhundert Halbleiter
50 Jahre Fraunhofer IAF 8
Das Fraunhofer-Institut für
Angewandte Festkörperphysik
im Kontext der bundesdeutschen
Forschungs- und Innovationsgeschichte:
Ein zeithistorischer Essay
Helmuth Trischler 29
Kundenlösungen 68
Menschen am Fraunhofer IAF 75
Die Zukunft ist hell 89
50 Jahre Fraunhofer IAF –1Hans-Jörg Bullinger
Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft
Öffnung – der Schlüssel zu Innovationen
Grundlegende technologische Durchbrüche bil-
den die Voraussetzung für neue Schlüsseltech-
nologien, deren Beherrschung für eine Volks-
wirtschaft erfolgskritisch ist, weil sie viele Tech-
nologiegebiete und Wirtschaftsbranchen radikal
verändern. Die meisten Innovationen sind aber
»inkrementelle« Verbesserungen; Produkte oder
Verfahren werden entlang bestimmter »techno-
logischer Pfade« schrittweise verbessert. Früher
ging man davon aus, dass Innovationen in einer
linearen Abfolge entstehen: Grundlagenfor-
schung – Angewandte Forschung – Experimen-
telle Entwicklung – Markteinführung – Markt-
durchdringung. Heute wissen wir, dass einzelne
Phasen vielfach miteinander rückgekoppelt sind.
Und so stellt sich auch das Zusammenwirken von
verteidigungsbezogener Forschung und ziviler
Anwendung heute in einem anderen Bild dar.
Die Geschichte des IAF zeigt die ganze Band-
breite der großen technologischen Fortschritte,
der kleinen Sprünge und der mühsamen Schritte
»Die Wissenschaft braucht Zusammenarbeit, in die Anwendung. Die Flüssigkristalle, eines der
in der sich das Wissen des einen durch die frühen Forschungsgebiete des IAF, haben Jahr-
Entdeckung des anderen bereichert.« zehnte gebraucht, bis sie sich aus der Nische
Ortega y Gasset befreien konnten und in die Massenanwendung
überführt wurden. Heute haben die flachen
Nach der anfänglichen Euphorie gehen neue LCD-Bildschirme nicht nur die Büros, sondern
Forschungsansätze durch ein langes Tal der Er- auch die Haushalte erobert. Doch in Zeiten des
nüchterung und brauchen oft mehr als ein Jahr- Booms kündigt sich bereits der Technologie-
zehnt, bis sie sich am Markt durchsetzen und wechsel auf OLEDs oder andere noch neuere
bewähren können. Zunächst eröffnen neue Displaytechnologien an. Das unerbittliche Gesetz
Technologien ein unüberschaubares Potenzial an der Innovation demonstriert auch hier, dass auf
Möglichkeiten. Die Leistung von Innovatoren dem Höhepunkt bereits der Abstieg beginnt.
besteht darin, diese Vielfalt auf die erfolgsver-
sprechenden Anwendungsfelder zu reduzieren. Den III/V-Halbleitern mit ihrem überragenden
So gehören Durchhaltevermögen, Anpassungs- Potenzial für Hochgeschwindigkeitsschaltungen
fähigkeit und Orientierung am Kunden zu den und Optoelektronik blieb bisher der Durchbruch
entscheidenden Erfolgsfaktoren. Ohne langfristi- in den Massenmarkt versagt. Im Jahr 1989 kün-
ge Strategie und kapitalkräftige Partner sind digte Hans S. Rupprecht, Leiter des IAF, gemein-
viele Inventionen nicht umsetzbar. sam mit Roland Diehl in der Titelgeschichte von
2–50 Jahre Fraunhofer IAFBild der Wissenschaft an: »Gallium-Arsenid: Auch für die Entwicklung des »blauen Lasers«
Das Zeitalter der Superchips«. Doch noch immer lieferte das IAF wichtige Grundlagen.
schlagen in den Herzen der Computer Chips aus
Silizium den Takt der digitalen Revolution. So Zur langfristig größten Erfolgsgeschichte könnte
wurde mit Siliziumchips die Taktfrequenz seit sich die Erfindung der weißen Leuchtdiode ent-
1989 um den Faktor 50 beschleunigt, die Zahl wickeln. LEDs haben inzwischen die Nischen-
der Transistoren pro Chip stieg sogar auf das bereiche der kleinen Anzeigen verlassen und
500fache. Allerdings: In Mobiltelefonen, An- erobern Schritt für Schritt alle Domänen der
lagen der Nachrichtenübertragung und im Ab- Beleuchtung. Schon heute sind sie in Ampeln
standradar von Oberklassefahrzeugen haben und Autobremslichtern zur alltäglichen Erschei-
sich Chips aus Galliumarsenid durchgesetzt. nung geworden. In wenigen Jahren werden sie
Und die Verbindungshalbleiter werden noch die Glühbirnen und Halogenlampen in unseren
weitere innovative Lösungen hervorbringen. So Büros und Wohnungen verdrängen. Und auch
hat die Forschung zur Gallium-Nitrid-Leistungs- diese Innovationsgeschichte lohnt sich genauer
elektronik am IAF zu einem großen Industrie- zu untersuchen. Denn wieder einmal zeigt sich,
projekt geführt, in dem Leistungsverstärker für dass auch eine überlegene Technologie Zeit,
energieeffiziente Mobilfunk-Basisstationen ent- Durchhaltevermögen und finanzstarke Partner
wickelt werden. Günter Weimann, der seit 1995 braucht, um sich durchzusetzen. Fraunhofer-
Institutsleiter ist, hat das Institut noch stärker an Forscher entwickeln Ideen und liefern die tech-
den Bedürfnissen der Industrie ausgerichtet. nologische Basis für neue Produkte und Dienst-
leistungen, doch zur Innovation werden sie erst,
Ähnliche Erfolge im »dual use« zum zivilen wenn sie von einem Unternehmen erfolgreich in
Markt konnte das IAF in der Infrarotsensorik, bei den Markt eingeführt und durchgesetzt werden.
Halbleiterlasern und in der Herstellung von Dia- Deshalb sind langfristige Partnerschaften und
mantschichten erreichen. IAF-Forschern gelang strategische Kooperationen, wie sie das IAF mit
es weltweit erstmalig, einen zweifarbigen Detek- zahlreichen Unternehmen pflegt, so wichtig für
torchip zu entwickeln, der in der Lage ist, gleich- die Stärkung der Innovationsfähigkeit der deut-
zeitig Strahlung in verschiedenen Wellenlängen schen Wirtschaft.
wahrzunehmen. Für die bildgebende Infrarot-
technologie stellt die Entwicklung dieser neuen Zum Jubiläum würdigen wir die Leistungen des
Wärmebildgeräte einen entscheidenden Quali- IAF der vergangenen 50 Jahre. Wir wünschen
tätssprung dar: So können die extrem empfind- den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch in
lichen Detektoren nicht nur bei Frühwarnsys- Zukunft genügend gute Ideen und vor allem
temen der Luftfahrt eingesetzt werden, sondern Mut, Ausdauer und Entschlossenheit zur Erobe-
auch im Klimaschutz, der Überwachung von rung von technologischem Neuland.
Industrieanlagen und Raffinerien und zur besse-
ren Diagnostik in der Medizintechnik. Für diese Ihr
Arbeiten wurde kürzlich der Landesforschungs-
preis Baden-Württemberg verliehen. Bereits im
Jahr 2002 ging diese hohe Auszeichnung an das Prof. Hans-Jörg Bullinger
IAF für die Entwicklung neuer Halbleiterlaser. Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft
50 Jahre Fraunhofer IAF –3Peter Eickenboom
Staatssekretär im Bundesministerium
der Verteidigung
Grußwort
Die Bundeswehr gratuliert dem Fraunhofer-
Institut für Angewandte Festkörperphysik IAF zu
seinem 50-jährigen Bestehen. Wir möchten da-
durch auch unsere Verbundenheit mit einem der
ältesten Fraunhofer-Institute ausdrücken, die sich
der angewandten Forschung verschrieben haben.
Das Fraunhofer IAF geht auf das »Institut für
Elektrowerkstoffe IEW«, damals das vierte
Forschungsinstitut der Fraunhofer-Gesellschaft,
zurück. Gegründet aus dem Institut für physikali-
sche Chemie der Universität Freiburg, lagen die
Forschungsschwerpunkte des damaligen Fraun-
hofer IEW in der Infrarot-, Mikrowellen- sowie
Halbleiter- und Lumineszenzphysik. 1970 erfolg-
te die Umbenennung in das heutige »Institut für
Angewandte Festkörperphysik«.
Heute sind in der Fraunhofer-Gesellschaft über
56 Institute integriert. Die Fraunhofer-Gesell-
schaft im Allgemeinen und das Fraunhofer IAF
im Besonderen stellen ein sichtbares Zeichen er-
folgreicher, international etablierter Forschungs-
tätigkeit und deutscher Forschungsförderungs-
politik dar. Mit seinen fast 200 Mitarbeitern ist
das Fraunhofer IAF auch eine feste Größe für
die Zusammenarbeit mit der Bundeswehr. Das
Fraunhofer IAF gehört zu den Gründungsmit-
gliedern des Fraunhofer-Verbundes »Verteidi-
gungs- und Sicherheitsforschung VVS«. Die mitt-
lerweile sechs Fraunhofer-Institute des VVS sind
mit besonderem Erfolg auch auf dem Gebiet der
wehrtechnischen Forschung tätig. Der VVS liefert
wertvolle, anwendungsnahe Forschungsergeb-
nisse, um zur inneren und äußeren Sicherheit
der Bundesrepublik Deutschland beizutragen.
In den zurückliegenden 50 Jahren ist das
Fraunhofer IAF zu einem in Deutschland und
Europa führenden Forschungsinstitut im Bereich
der Halbleitertechnologien geworden. Das
Bundesministerium der Verteidigung und das
4–50 Jahre Fraunhofer IAFBundesministerium für Bildung und Forschung Dem Fraunhofer IAF ist es in den zurückliegen-
hatten hierfür mittel- bis langfristige Förderungs- den 50 Jahren gelungen, mit einem außeror-
programme aufgelegt. Die IAF-Forschungsarbei- dentlich hohen Maß an Dynamik, Innovation,
ten befassen sich mit der Material-, Bauele- Engagement und Eigeninitiative den Prozess der
mente- und Schaltungsentwicklung und decken technologischen Weiterentwicklung entschei-
alle Prozesse vom Entwurf bis hin zur Fertigung dend mitzuprägen und voranzutreiben. Für die
von kleinen und mittleren Serien ab. Die Ver- Bundeswehr und insbesondere für den Bereich
bindungshalbleiter des Fraunhofer IAF finden der Rüstung haben die IAF-Mitarbeiterinnen und
Anwendung in der Nano-, Mikro- und Opto- -Mitarbeiter entscheidend zum Erhalt einer um-
elektronik. Der Rüstungsbereich des Bundes- fassenden Urteils- und Beratungsfähigkeit auf
ministeriums der Verteidigung kann davon dem Gebiet der Hochfrequenzschaltungen und
unmittelbar profitieren. der optoelektronischen Bauelemente beigetra-
gen. Die Leistungsfähigkeit des Fraunhofer IAF
Im Bereich der militärischen Forschung & Tech- hat über 50 Jahre das Motto ihres Jubiläums ein-
nologie wurden in den 80-er Jahren im Bereich drucksvoll hinterlegt: heller, schneller, stärker.
von Gallium-Arsenid (GaAs) Forschungsarbeiten
auf den Gebieten der Technologieentwicklung, In einem übergeordneten Zusammenhang lassen
der Hochfrequenzelektronik und bei Infrarot- sich auch weiterhin neue Herausforderungen
detektoren durchgeführt. Aufgrund ihres hohen identifizieren. Die bisherige strikte Trennung zwi-
Dual-Use-Potenzials war die GaAs-Technologie schen wehrtechnischer und ziviler Forschung ist
für viele Anwendungen attraktiv. In den letzten nicht mehr zeitgemäß, der politische Paradig-
Jahren wurde darüber hinaus eine im europäi- menwechsel fordert einen verstärkten »Dual-
schen Vergleich herausragende Stellung in der Use« in der Sicherheitsforschung. Das Fraun-
Gallium-Nitrid (GaN)-Technologie für Leistungs- hofer IAF ist für den neuen Ansatz bestens auf-
elektronik erzielt, die für den Einsatz in den gestellt. Zusammen mit den anderen Instituten
Bereichen Mobilfunk und luftgestützte Radar- hat das Fraunhofer-Modell sogar Wissenschaft,
systeme vorgesehen ist. Politik und Verwaltung überzeugt, die Bundes-
wehr-eigenen Forschungsinstitute der FGAN zu-
In der Infrarottechnik wurden immer hochleis- künftig unter das Dach der Fraunhofer-Gesell-
tungsfähigere Infrarotdetektoren entwickelt. schaft in den Verbund VVS zu integrieren.
Mitarbeiter des Fraunhofer IAF wurden dieses
Jahr zum zweiten Mal in der Geschichte der Im Namen der Leitung des Bundesministeriums
Fraunhofer-Gesellschaft mit dem »Landesfor- der Verteidigung und des Ministers gratuliere ich
schungspreis Baden-Württemberg« ausgezeich- dem IAF besonders herzlich zum Geburtstag!
net. Ihre weltweite Erstentwicklung einer »bi-
spektralen Infrarot-Kamera« liefert hochauflö-
sende Farbbilder bei Nacht. Die IR-Kamera findet
Anwendungen in Flugzeugen als Detektor von
Flugkörperwarnsystemen, als Sensor in Sicher- Dr. Peter Eickenboom
heitssystemen, in der Medizintechnik und bei Staatssekretär im Bundesministerium
der Klimaforschung. der Verteidigung
50 Jahre Fraunhofer IAF –5Frieder Meyer-Krahmer
Staatssekretär im Bundesministerium
für Bildung und Forschung
Grußwort
Das Fraunhofer-Institut für Angewandte Fest-
körperphysik hat in seinem 50-jährigen Wirken
viele Erfolgsgeschichten von Innovationen
»made in Germany« geprägt. Die Welterfolge
von Halbleiterdioden aus Deutschland für Be-
leuchtungsanwendungen sowie Laserdioden
für Materialbearbeitung und Informations- und
Kommunikationstechnologien wären ohne das
IAF nicht denkbar gewesen. Das IAF hat die wis-
senschaftlichen Grundlagen für energiesparende
Leistungselektronik gelegt und damit den Weg
zu erheblicher CO2-Einsparung gewiesen. Das
zeigt, wie durch das Fraunhofer-Modell Brücken
zwischen Wissenschaft und Wirtschaft geschla-
gen werden und sogar Aufholjagden im interna-
tionalen Wettbewerb durch exzellente Forschung
entschieden werden können.
Die Exzellenz der Forschung am IAF ist mit den
Namen vieler Wissenschaftler verbunden, aber
besonders auch mit Herrn Professor Weimann
als langjährigem Leiter. Mit dem Jubiläum in
diesem Jahr wird Herr Professor Weimann seinen
Ruhestand antreten. Ich bedanke mich für gute
Zusammenarbeit und wünsche seinem Nach-
folger ein ebenso innovationsförderndes Wirken.
6–50 Jahre Fraunhofer IAFÜberall verfügbar und sauber – netzunabhängige
Stromversorgung mit erneuerbaren Energien
Auch für die Zukunft sehen wir das IAF gut auf- Logistik, die sichere Mobilität und die Gesund-
gestellt. Die Forschungspolitik in den nächsten heit und Medizintechnik. Zusätzlich wird durch
Jahren wird durch die Umsetzung der Hightech- Technologieverbünde branchenübergreifend die
Strategie geprägt sein. In die Hightech-Strategie Technologieführerschaft in ausgewählten Tech-
wird die Bundesregierung in den Jahren 2006 bis nologien ausgebaut.
2009 rund 14,7 Mrd € investieren. Das Signal
ist klar: Vorfahrt für Innovation durch Forschung! Ich bin sicher: Das IAF wird zur erfolgreichen
Ein zentrales Ziel ist, dass Forschungsergebnisse Umsetzung der Hightech-Strategie und insbe-
schnell in die Anwendung gebracht werden. Der sondere des Programms IKT 2020 seinen Beitrag
Fokus liegt auf 17 prioritären Innovationsfeldern. leisten. Ich wünsche dem IAF dabei weiterhin die
Aus dem IAF sind Beiträge zu mindestens vier kreativen Ideen und deren konsequente anwen-
dieser Prioritäten zu erwarten, nämlich zu den dungsorientierte Verfolgung, die wir für den
Sicherheitstechnologien, den Informations- und Erfolg der Hightech-Strategie brauchen.
Kommunikationstechnologien, der Nanotech-
nologie und den Optischen Technologien.
Die Informations- und Kommunikationstechno- Ihr
logien sind mit rund 50 Mio € Projektförderung
seit 1990 der gewichtigste Schwerpunkt am IAF
aus Sicht des BMBF. Das BMBF hat die Förder-
strategie in diesem Bereich mit dem Programm
IKT 2020 neu ausgerichtet und auf die Ziele der
Hightech-Strategie fokussiert. Durch Leitinnova-
tionen werden ausgewählte Anwendungsfelder Prof. Frieder Meyer-Krahmer
technologieübergreifend erschlossen. Dazu zäh- Staatssekretär im Bundesministerium
len insbesondere die Automobilelektronik, die für Bildung und Forschung
50 Jahre Fraunhofer IAF –7Ein halbes Jahrhundert Halbleiter
50 Jahre Fraunhofer IAF
26. März 1949:
Gründung der Fraunhofer-Gesellschaft
(FhG) in München.
1950
»Amt Blank« wird eingerichtet als
Dienststelle des »Beauftragten für
die mit der Vermehrung der alliierten
Truppen zusammenhängenden
Fragen«.
1955
Gründung der Bundeswehr.
»Amt Blank« wird zum Bundes-
verteidigungsministerium (BMVg).
27. Mai:
In einer Sitzung im Geologischen
Institut der Universität Freiburg wird
zwischen Universität, Landesgewerbe-
amt Stuttgart, »Amt Blank« und
Bundeswirtschaftsministerium die
Gründung des Instituts für Elektro-
werkstoffe IEW als Institut der
Fraunhofer-Gesellschaft beschlossen.
1956
FhG übernimmt Verwaltungshilfe für
Forschungsprojekte des BMVg.
vor 1957
1952
erste Ge-Einkristalle 1954
erste Si-Einkristalle
1947 III/V-Halbleiter: 1953
erster Transistor 1948 Ge ist nicht rein genug, Prinzip der optischen Rechner mit
(transfer-resistor) Feldeffekttransistor Si ist nicht billig genug Verstärkung 1000 Transistoren
8–50 Jahre Fraunhofer IAFEine Erfolgsgeschichte
nimmt ihren Anfang
1. Juli: Institutsgründung als Institut
für Elektrowerkstoffe IEW, unterge-
bracht im Institut für physikalische
Chemie der Universität Freiburg.
Reinhard Mecke ist Institutsleiter.
1. November: Beginn der Forschungs-
arbeiten am IEW, erstes Projekt:
»Entwicklung einer paramagnetischen
Resonanzapparatur«.
5 Mitarbeiter/innen
Einweihung des Institutsneubaus am 25. März 1959.
24. März: Grundsteinlegung für Drei Abteilungen für
gemeinsamen Neubau von IEW und - Infrarot-Technik
Ernst-Mach-Institut in der Eckerstraße - Mikrowellen
in Freiburg, geplante Baukosten - Elektrolumineszenz
630 TDM.
Betriebshaushalt: 400 TDM
Investitionen: 300 TDM
20 Mitarbeiter/innen
1957 1958 1959
erster integrierter Schaltkreis
Prinzip des Heterobipolar-Transistors Si-Solarzelle
50 Jahre Fraunhofer IAF –9Projektfinanzierung des IEW wird
durch BMVg-Grundfinanzierung
abgelöst:
Wirtschafts- und Stellenplan über
2,12 Mio DM und 61 Stellen.
Forschungsthemen:
- Festkörperphysik einschl. Kristall-
- und Halbleiterphysik
- Lumineszenz-, Infrarot- und
- Mikrowelleneigenschaften
- Analytik
Reinhard Mecke scheidet als
Fackelzug zum 70. Geburtstag von Reinhard Mecke.
Institutsleiter aus.
Forschungsinhalte: Verlagerung der Forschungsschwer-
- IR-Detektoren punkte auf Halbleiter und deren
- II/VI-Verbindungshalbleiter, z. B. ZnS Anwendungen (auf Drängen des
- Mikrowelleneigenschaften BMVg: »... keine Zeit für Hobbys ...«).
- von Halbleitern
Erste Arbeiten zu Flüssigkristallen.
Erstes ziviles Drittmittelprojekt:
Gas-Chromatographie an Wein u. a.
1965 1966 1967
1960 planarer Transistor, MOSFET
Rubin-Laser
1962 stimulierte Lichtemission aus GaAs p-n-Diode
erster Halbleiter-Laser
1963 Konzept der Heterostruktur
1965 Moore'sches Gesetz
10–50 Jahre Fraunhofer IAFDer neue Schwerpunkt: Halbleiter
Erste Ionenimplantationsanlage für
verschiedene Ionen in Deutschland
wird am IEW in Betrieb genommen.
Adolf Goetzberger übernimmt FhG wird in die institutionelle IEW wird in Fraunhofer-Institut für
die Institutsleitung. Förderung des Bundes aufgenommen. angewandte Festkörperphysik IaFP
umbenannt.
Halbleitertechnologie, auch an
Si/SiO2-Grenzflächen, wird Institut nimmt Mittelposition ein zwi-
Forschungsschwerpunkt. schen Grundlagen- und angewandter
Forschung auf dem Gebiet der
Halbleiter- und Festkörperphysik.
1968 1969 1970
Doppelheterostrukturlaser im Dauer-
Ga- und As2-Absorption: strichbetrieb bei 300 K und Glasfaser:
Anfang der Molekularstrahlepitaxie reduzierte Dimensionalität: Beginn der optischen Nachrichtentechnik
Quantenfilme, -drähte und -punkte
Metallorganische Gasphasenepitaxie Liquid Crystal Display (LCD)
von GaAs erste GaN-Schichten erster 1 kB-DRAM
50 Jahre Fraunhofer IAF –1113./14. Dezember: Interministerielles
Abkommen über gemeinsame Finan-
zierung des Instituts durch BMVg und
BMFT.
Sieben Abteilungen:
- Festkörperphysik
- Festkörperchemie
- Halbleiter
- Ionenimplantation
- IR-Technik
- Mikrowellenphysik
- Flüssigkristalle
IAF-Trakt wird aufgestockt. Institutsleiter Goetzberger überwacht Baufortschritt.
Forschungsthemen:
- Gunn-Effekt
- IR-Photokathoden aus PbSnTe
- III/V-Halbleiter
IaFP richtet 1. Infrarot-Kolloquium 29. Mai: Erste Sitzung des
sowie 1. Freiburger Arbeitstagung Institutsleitungsausschusses (ILA). Inbetriebnahme der ersten SIMS
»Flüssigkristalle« aus. (Secondary Ion Mass Spectrometry).
Betriebshaushalt: 3,0 Mio DM,
davon 92 % BMVg-grundfinanziert
Investitionen: 0,6 Mio DM
ca. 70 Mitarbeiter/innen,
davon 40 Wissenschaftler/innen
1971 1972
1973
Niederdruck-CVD
erste GaN-LEDs
Theorie des Quantenkaskadenlasers
DFB-Laser
µ-Prozessor MOCVD für ternäre und quaternäre III/V-Verbindungen
12–50 Jahre Fraunhofer IAFIAF wird größer:
zivile Forschung
Forschungsthemen: Betriebshaushalt: 5,2 Mio DM, Umbenennung in IAF.
Gunn- und InP IMPATT-Dioden davon 75 % BMVg-grundfinanziert
aus GaAs und InP. Investitionen: 2,0 Mio DM Herausgabe des ersten
Tätigkeitsberichts.
Forschungsthemen:
- 90 GHz-Schottky-Mischerdioden
- und InP-Gunn-Dioden
- Fluoreszenz-aktivierte
- Flüssigkristall-Displays (FLAD)
1974 1975
1976
erster Mikroprozessor von Intel
»Intel 8080: the most important product of the 20th century«
elektrischer Transport in Übergittern
stimulierte Lichtemission aus GaN Molekularstrahlepitaxie für Bauelemente
quantisierte Elektronenzustände im Potentialtopf:
(AlGa)As-Quantenfilme QW-Laser-Emission
50 Jahre Fraunhofer IAF –13Sonnenkollektoren werden entwickelt. Raumnot: 2000 m2 sind zu wenig für Kleinserienherstellung von
PbSnTe Detektor- und FLAD-Techno- das wachsende Institut. Oberflächenwellenfiltern und
logie werden an Industrie transferiert. Esaki-Dioden.
IAF installiert erste MBE-Anlage.
Betriebshaushalt: 6,4 Mio DM, Fraunhofer-Preis an
davon 66 % BMVg-grundfinanziert Erster Fraunhofer-Preis R. Diehl, W. Jantz, W. Wettling:
Investitionen: 1,4 Mio DM geht an IAF-Mitarbeiter »High-Intensity Brillouin Scattering
115 Mitarbeiter/innen, W. Greubel und G. Baur: from Parametrically Excited Phonons in
davon 46 Wissenschaftler/innen »Fluoreszenz-aktivierte Displays FeBO3 and Vapour Growth of Bulk
(FLAD)«. FeBO3 Single Crystals«.
1977
1978 1979
Heterostruktur mit zweidimensionalem
Elektronengas
Konzept des vertikal emittierenden
erstes Glasfasernetz in Chicago Lasers
14–50 Jahre Fraunhofer IAFIAF wird kleiner ...
Gründung einer »Befristeten Goetzberger verlässt mit 20 Mitar- Materialentwicklungen zu HgCdTe.
Wissenschaftlichen Arbeitsgruppe für beiter/innen das IAF: Gündung des Mikrowellenkomponenten für
Solare Energiesysteme« durch Adolf Fraunhofer-Instituts für Solare 40 – 140 GHz.
Goetzberger. Energiesysteme ISE.
Versuche zur Lösungszonenzüchtung
Gerhard Meier wird kommissarischer von Kristallen (für Spacelab).
Institutsleiter des IAF.
Betriebshaushalt
Fraunhofer-Preis an U. Kaufmann: und Investitionen: 10 Mio DM
»Arbeiten über Defektanalyse in 123 Mitarbeiter/innen
III/V-Halbleitern«.
1980 1981
HEMT (high electron mobility
transistor)
erster PC von IBM
hohe optische Verstärkung in
Quantenfilmen und -punkten GRINSCH-Laser
50 Jahre Fraunhofer IAF –15... und wieder größer
Ausrichtung des Instituts auf III/V- BMFT startet industrieorientierte 1. Mai: Hans S. Rupprecht wird
Halbleiter und deren Anwendungen. Verbundforschung, so auch »GaAs- Institutsleiter.
Elektronik«.
Neugliederung mit Abteilungen für IAF koordiniert BMFT-Verbundpro-
- Festkörperphysik Thematische Neuausrichtung auf III/V- gramm »GaAs-Elektronik«. IAF baut
- Materialforschung Halbleiter wird durch Zukauf des damit zivile Vertragsforschung aus.
- Prozesstechnologie Gebäudes Sonnenstraße 5 und dortige
- IR-Bauelemente Reinraumeinrichtung flankiert. Betriebshaushalt: 11 Mio DM,
- Mikrowellen-Bauelemente davon 70 % BMVg-grundfinanziert
- Displaytechnik Inbetriebnahme der ersten Investitionen: 8 Mio DM
Elektronenstrahllithographie-Anlage. 137 Mitarbeiter/innen
Umfangreiche Investitionen in
Ausrüstung (MBE, ESCALAB u. a.). IAF gehört zu den Fraunhofer-Preis an H. Ennen,
Gründungsmitgliedern des A. Axmann, W. Haydl: »Lumineszenz
Institut mit insgesamt 2447 m2 auf Fraunhofer-Verbunds Seltener Erden in III/V-Halbleitern und
7 Standorte in Freiburg verteilt. »Mikroelektronik«. Silizium«.
1983 1984
1985
Massenproduktion von
Konzept QWIP (quantum well infrared photodetector) Al(Ga)As-Laser mit MBE
16–50 Jahre Fraunhofer IAFDas Haus wird größer: Tullastr. 72
Verstärkte Kooperation mit Industrie IAF erwirbt Gebäude Tullastraße 72. Umbau des Gebäudes Tullastraße 72.
im Verbund »GaAs-Elektronik«.
Betriebshaushalt: 18 Mio DM
IAF-Technologie basiert auf modernen hohe Investitionen von 15 Mio DM
Quanteneffekt-Bauelementen wie im Rahmen des Schwerpunkts
HEMTs und QW-Lasern. GaAs-Elektronik (12 Mio vom BMFT)
162 Mitarbeiter/innen,
Fraunhofer-Preis an J. Windscheif und davon 63 Wissenschaftler/innen
W. Wettling: »Infrarot-Topografie von
Gallium-Arsenid-Substraten«.
1986
1987 1988
erster funktionsfähiger QWIP optisches Transatlantik-Kabel
50 Jahre Fraunhofer IAF –17Erfolg durch Patente
Patentanmeldung G. Baur, W. Fehrenbach,
R. Kiefer, B. Weber, F. Windscheid: »Elektro-
optisches Flüssigkristallschaltelement«. Dies
ist das bislang erfolgreichste IAF-Patent.
»Fertigungslinie« für GaAs-Elektronik QWIPs für 3 – 5 µm und 8 – 12 µm Beginn der BMFT-Verbundprogramme
in der Sonnenstraße geht in Betrieb. am IAF realisiert. »Drei-Fünf-Elektronik« (1991 – 1995)
und Photonik I (1991 – 1994). Koordi-
Umbau des neuen Institutsgebäudes nation beider Programme durch IAF.
Tullastraße 72 beendet, Gesamtkosten
ca. 70 Mio DM. IAF verfügt jetzt über IAF begleitet Materialentwicklung bei
10 000 m2 Büro- und Laborfläche mit Freiberger Elektronikwerkstoffe GmbH.
einem Reinraum von 1000 m2. Umzug
aus der Eckerstraße beginnt.
1989
1990 1991
Quantenpunktlaser
Nanotechnologie: Atome werden manipuliert
18–50 Jahre Fraunhofer IAFDer Reinraum ist fertiggestellt, die Neue Forschungs- und Technologie- BMFT-Forschungsverbund zur
Prozesstechnologie zieht aus der themen (FuT): Entwicklung »Blauer LEDs«
Sonnenstraße in die Tullastraße. - GaN für kurzwellige Lichtemission (1994 – 1997).
- und Leistungselektronik
Betriebshaushalt: 23,4 Mio DM, - Sb-haltige Übergitter für IR-Technik Koordination des Leitprojekts
davon 38 % BMVg-grundfinanziert LASER 2000 (1994 – 1997) durch IAF.
Investitionen: 8,2 Mio DM IAF ist Veranstalter des »20th Inter-
190 Mitarbeiter/innen, national Symposium on GaAs and Die Abteilung Display-Technologie wird
davon 67 Wissenschaftler/innen Related Compounds« in Freiburg. aufgelöst, neue Abteilungsstruktur:
- IR-Technik
Fraunhofer-Preis an M. Konstanzer: Zwei Fraunhofer-Preise für das IAF: - Bauelemente- und
»Entwicklung neuer Verfahren und an W. Haydl, M. Schlechtweg, Schaltkreisentwicklung
Geräte zum stromstoßfreien Ein- A. Hülsmann für »Koplanare Leitungs- - Prozesslabor
schalten von Netztransformatoren«. technik und ihre Anwendung in - Explorative Technologie
Mikrowellen- und Millimeterwellen- - Analytik
Systemen« und an K.-H. Bachem, - Materialforschung
W. Pletschen für »Der GaInP/GaAs-
Hole-Barrier-Bipolartransistor«.
1992 1993 1994
Quantenkaskadenlaser
Pentium-Mikroprozessor mit
3 Millionen Transistoren kommerzielle GaN-DH-LEDs
50 Jahre Fraunhofer IAF –19Von der Technologie zur Anwendung ...
31. März: Hans S. Rupprecht scheidet
als Institutsleiter aus, Manfred Berroth
wird kommissarischer Institutsleiter.
1. Oktober: Günter Weimann wird
Institutsleiter.
Beginn BMBF-Verbundprogramm
Photonik II (1995 – 1998).
1. Jahrestagung LASER 2000.
In der IR-Technik werden 64 x 64-
QWIP-FPAs realisiert.
InAs/GaSb-Übergitter für Detektoren
in der Entwicklung.
Erfindung »Plasmareaktor« für die
Abscheidung von CVD-Diamant von
M. Füner, P. Koidl, C. Wild wird zum
Patent angemeldet.
Hans S. Rupprecht erhält Bundes-
verdienstkreuz für seine Beiträge zur
nationalen GaAs-Forschung.
Fraunhofer-Preis an K.-H. Bachem,
J. Winkler, J. Wiegert: »MOVPE-
Reaktor für die Massenproduktion
von III/V-Halbleitern«.
1995
blaue und grüne GaN-LEDs
20–50 Jahre Fraunhofer IAFVeränderte Förderung des BMBF: GaAs-Linie wird auf 4"-Substrate
»Anwendung statt Technologie«, umgestellt.
verstärkte Industriekooperationen. IR-Laser für 2 – 5 µm werden
entwickelt.
QWIPs mit 256 x 256 Pixel. 256 x 256-QWIPs erreichen 13 mK
InAs/GaSb-Übergitter erreichen Temperaturauflösung.
Anwendungsreife.
IAF koordiniert NOVALAS
IAF richtet Internationalen Workshop (1997 – 2002), den Nachfolgeverbund
EXMATEC (Expert Evaluation & Con- von LASER 2000.
trol of Compound Semiconductor
Materials & Technologies) in Freiburg Die Erfindung von H. Schneider und
aus. M. Walther: »Halbleiterheterostruktur-
Strahlungsdetektor für Wellenlängen
Gemeinschaftserfindung mit Siemens aus dem infraroten Spektralbereich«
AG (heute Osram Opto Semicon- wird zum Patent angemeldet. IAF arbeitet an Europas ersten blauen
ductors) zu LUKO-LEDs wird zum Diodenlasern.
Patent angemeldet. IAF-Miterfinder Fraunhofer-Preis an J. Schneider, Erste GaN-Leistungstransistoren.
sind J. Schneider, P. Schlotter, P. Schlotter, R. Schmidt: »Weiße QWIPs mit 640 x 512 Pixel.
R. Schmidt. Single-Chip LEDs«. IAF-QWIPs in kommerziellen IR-Kameras.
Betriebshaushalt: 31,9 Mio DM
Investitionen: 5,3 Mio DM
Personal erreicht Höchststand mit
240 Mitarbeiter/innen.
1996 1997 1998
Tbit/s-Übertragung über Glasfaser MOS-Transistor mit 14 nm-Gate
50 Jahre Fraunhofer IAF –21... mit Qualität, Preisen, Ausgründungen
Sonderbriefmarke zum 50-jährigen
Jubiläum der Fraunhofer-Gesellschaft.
Laserbarren mit 200 W Ausgangs- Strategiediskussion am IAF führt zur
leistung. Definition von fünf Geschäftsfeldern
mit abteilungsübergreifender Struktur:
Ausgründung von EpiNova GmbH zur - MMICs
Herstellung von Halbleiterschichten. - Mischsignalschaltungen
- Infrarot-Sensoren
Fraunhofer-Preis an M. Füner, P. Koidl, - Laser und LEDs
C. Wild: »Plasmaabscheidung großflä- - CVD-Diamant
chiger Diamantwafer«.
1999 2000
Strukturen < 100 nm in
Mikroelektronik-Produktion
Nobelpreis in Physik für Herbert
Krömer für Heterostruktur
22–50 Jahre Fraunhofer IAFH. Schneider, J. Fleissner, M. Walther
erhalten gemeinsam mit Mitarbeitern
von AIM Infrarot-Module GmbH den
Wissenschaftspreis des Stifterverbandes
für die Deutsche Wissenschaft 2001:
»Thermographie-Kamera höchster
thermischer Auflösung«.
Entwicklung von Quantenkaskaden- IAF ist Gründungsmitglied des Betriebshaushalt: 16,8 Mio €
lasern beginnt. Fraunhofer-Verbunds für Verteidi- hohe Investitionen von 6,1 Mio €
gungsforschung und Wehrtechnik, für Großgeräte
Für gesamtes Institut wird Qualitäts- später Verbund für Verteidigungs- 214 Mitarbeiter/innen,
managementsystem nach DIN EN ISO und Sicherheitsforschung (VVS). davon 83 Wissenschaftler/innen
9001:2000 eingeführt.
FuT-Schwerpunkte sind IR-Detektoren M. Kelemen, M. Mikulla, R. Kiefer,
Ausgründung der m2k-laser GmbH und GaN-Leistungselektronik. M. Walther erhalten den Landesfor-
zur Herstellung von Hochleistungs- schungspreis Baden-Württemberg
diodenlasern. für Angewandte Forschung 2002:
»Höchstbrillante Diodenlaser«.
2001 2002
50 Jahre Fraunhofer IAF –23Hohe Frequenzen, hohe Bitraten
IAF greift Aufbau- und Modultechnik
auf, um »Komplettlösungen« zu
bieten.
Das Institut geht enge Kooperation
mit AIM Infrarot-Module GmbH ein
auf dem Gebiet der IR-Technik.
Ausgründung der Diamond Materials
GmbH für Diamantprodukte.
Heinrich-Hertz-Preis 2004 der EnBW-
Stiftung an Günter Weimann für sein
Lebenswerk »Beiträge zur Anwen-
dung und richtungweisenden Weiter-
entwicklung von III-V-Halbleiterstruk-
turen für die Optoelektronik«.
MMICs mit 220 GHz setzen weltweite
Bestmarke.
Mischsignalschaltungen auf Basis der
InP-DHBTs für 100 Gbit/s.
Kooperationsvertrag mit EADS
Defence für verteidigungsbezogene
Elektronik.
IAF-Mitarbeiter gründen die Semimap
GmbH für Waferanalytik.
2003
2004
Prescott-Prozessor mit 125 Millionen
Transistoren
90 nm-Strukturen
24–50 Jahre Fraunhofer IAF... und hohe Leistung
ISCS 2005: Günter Weimann
und Klaus von Klitzing bei der
Tagungseröffnung
Neues FuT-Thema: Die Forschungs- und Technologie- Betriebshaushalt: 15,5 Mio €,
Großflächige CdHgTe-Epitaxie. bereiche des IAF werden in vier davon 41 % BMVg-grundfinanziert
Abteilungen neu strukturiert: Investitionen: 3,8 Mio €
GaN-Leistungsverstärker für - HF-Bauelemente und -Schaltungen 187 Mitarbeiter/innen,
Basisstationen erreichen 100 W - Epitaxie und IR-Komponenten davon 68 Wissenschaftler/innen
Ausgangsleistung. - Optoelektronische Module
- III/V-Technologie Fraunhofer-Preis an C. Wild,
IAF richtet »32nd International E. Wörner, D. Brink: »Hochpräzise
Symposium on Compound Bisher größtes Industrieprojekt des IAF Diamant-Hohlkugeln für die
Semiconductors ISCS 2005« in Rust (mit NXP und UMS) hat Kommerzia- Trägheitsfusion«.
bei Freiburg aus. lisierung der GaN-Elektronik als Ziel.
2005
2006
Moore'sches Gesetz am Ende?
2- und 4-Kern-Prozessoren
50 Jahre Fraunhofer IAF –25IAF wird 50!
heller – schneller – stärker
Günter Weimann und Oliver Ambacher mit den Kuratoren des IAF im Juni 2007.
Oliver Ambacher wird auf eine Professur für Verbindungs-
halbleiter und Mikrosysteme an der Universität Freiburg und
als künftiger Institutsleiter des IAF berufen.
IAF erhält zum zweiten Mal den Landesforschungspreis
Baden-Württemberg für Angewandte Forschung: »Bispektrale
hochauflösende Infrarot-Kameras – Farbbilder im Infraroten«.
Preisträger sind M. Walther, R. Rehm, J. Fleissner, J. Schmitz.
2007
26–50 Jahre Fraunhofer IAFÜberall verfügbar und sauber – netzunabhängige
Stromversorgung mit erneuerbaren Energien
Als Forscher sind wir
gefragt – damals und heute.
50 Jahre Fraunhofer IAF –2728–50 Jahre Fraunhofer IAF
Das Fraunhofer-Institut für
Angewandte Festkörperphysik
im Kontext der bundesdeutschen
Forschungs- und Innovationsgeschichte:
Ein zeithistorischer Essay
Helmuth Trischler
Dieser Essay aus zeithistorischer Perspektive
ordnet die Herausbildung und Entwicklung des
Fraunhofer-Instituts für Angewandte Festkörper-
physik (IAF) in Freiburg in einen doppelten Kon-
text ein: erstens in die bundesdeutsche Zeit-
geschichte seit dem Wiederaufbau der 50er-
Jahre, die Forschungs- und Technologiepolitik
des Bundes und der Länder und die Entwicklung
des nationalen Innovationssystems, zweitens in
die Entwicklung der 1949 gegründeten Fraun-
hofer-Gesellschaft, in deren Verbund das IAF seit
seiner offiziellen Gründung im Jahr 1957 agiert.
Dabei werden auch markante Entwicklungen
in den vom IAF jeweils vorrangig bearbeiteten
Forschungs- und Technologiefeldern zu berück-
sichtigen sein und damit Prozesse, die aus dem
nationalen Innovationsraum herausführen.
Der Essay ist in vier Perioden gegliedert, die die
bundesdeutsche Forschungs- und Innovations-
geschichte mit der Entwicklung des IAF verknüp-
fen. Er endet mit einem resümierenden Blick
auf aktuelle und künftige Perspektiven, die sich
aus der Langzeitbetrachtung der Institutsent-
wicklung ergeben.
50 Jahre Fraunhofer IAF –29Primat der Verteidigungsforschung
Das Freiburger Institut in den
50er- und 60er-Jahren (1949/57 – 1968)
Publikationen war Deutschland in der Zwischen-
Das bundesdeutsche Forschungs- und kriegszeit eine im internationalen Vergleich ein-
Innovationssystem im Wiederaufbau malige Wissensgesellschaft. Hinzugefügt werden
muss, dass der bereits im Ersten Weltkrieg geleg-
In Deutschland bildete sich in den Jahrzehnten te Pfad der Autarkie, der durch die nationalsozia-
zwischen der Reichsgründung von 1871 und dem listische Rüstungs- und Kriegswirtschaft breit aus-
Ersten Weltkrieg ein nationales Innovationssystem gebaut wurde, einen Großteil dieses Innovations-
heraus, das aufgrund seiner hohen wissenschaft- potenzials absorbierte.1
lichen Leistungsfähigkeit international viel beach-
tet und vielfach nachgeahmt wurde. Die Universi- Der doppelte Aderlass der Vertreibung der jüdi-
täten entwickelten sich durch den Ausbau der schen Wissenschaftler nach 1933 und der Ein-
Seminare und den Aufbau moderner Labora- berufungen und Verluste des Zweiten Weltkriegs
torien zu forschungsorientierten Institutionen führte das deutsche Innovationssystem in den
weiter, die im Bereich der Natur- und Ingenieur- Niedergang. Als die Alliierten 1945/46 die deut-
wissenschaften mit den sich herausbildenden sche Forschung mit umfassenden Verboten be-
Technischen Hochschulen um die wachsende Zahl legten, einem formal bis zu den Pariser Verträgen
von Studierenden konkurrierten. Sowohl auf der vom Mai 1955 dauernden Regime der Kontrolle
Ebene der Einzelstaaten als auch des Reiches dif- unterwarfen, und mit den »Intellektuellen Re-
ferenzierte sich eine breite Landschaft von außer- parationen« der teils freiwilligen, teils erzwunge-
universitären Forschungseinrichtungen aus, aus nen Abwanderungen tausender Wissenschaftler
der seit 1911 die Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, die und Ingenieure einem erneuten Aderlass unterzo-
Vorläuferin der Max-Planck-Gesellschaft (MPG), gen, hatte Deutschland in vielen Bereichen der
herausragte. Parallel dazu entstand in der Indus- Naturwissenschaft und Technik bereits seine
trie, ausgehend von den neuen Branchen der Spitzenstellung eingebüßt.
Chemie und der Elektrotechnik, eine breite Infra-
struktur von Forschungslaboratorien, die mit den Umso bemerkenswerter ist es, wie rasch es ge-
Hochschulen und außeruniversitären Forschungs- lang, das tradierte Innovationssystem in seinen
einrichtungen eng vernetzt waren. In Reaktion Strukturen wiederaufzubauen und um neue, der
darauf entfaltete der sich ausdifferenzierende
1
Leistungs- und Interventionsstaat Instrumente der Aus der Fülle der Literatur vgl. bes. die resümierenden
Artikel von Otto Keck: The National System for Technical
Wissenschaftsadministration.
Innovation in Germany, in: Richard R. Nelson (Hrsg.):
National Innovation Systems. A Comparative Study. Oxford
Dieses hoch leistungsfähige Innovationssystem u. a. 1993, S. 115-157, Margit Szöllösi-Janze: Wissensge-
fächerte sich während und im Gefolge des Ersten sellschaft in Deutschland. Überlegungen zur Neubestim-
mung der deutschen Zeitgeschichte über Verwissenschaft-
Weltkriegs weiter aus, insbesondere durch die lichungsprozesse, in: Geschichte und Gesellschaft 30 (2004),
Gründung der Notgemeinschaft für die Deutsche S. 275-311, und Ulrich Wengenroth: Die Flucht in den
Wissenschaft, die sich 1932 in Deutsche For- Käfig. Wissenschaft und Innovationskultur in Deutschland
1900-1960, in: Rüdiger vom Bruch/Brigitte Kaderas (Hrsg.):
schungsgemeinschaft (DFG) umbenannte.
Wissenschaften und Wissenschaftspolitik. Bestandsauf-
Gemessen an der Quantität und Qualität der nahmen zu Formationen, Brüchen und Kontinuitäten im
Wissenschaftler und der von ihnen produzierten Deutschland des 20. Jahrhunderts. Stuttgart 2002, S. 52-59.
30–50 Jahre Fraunhofer IAFPrimat der Verteidigungsforschung
Das Freiburger Institut in den 50er- und 60er-Jahren (1949/57 – 1968)
parlamentarischen, föderalistischen Demokratie für Datenverarbeitung und Mikroelektronik – auf-
angepassten Institutionen zu erweitern. Schon legte, mündete 1969 in einer Grundgesetzände-
vor Gründung der Bundesrepublik im Mai 1949 rung. Der neue Art. 91b zementierte die Domi-
bildete sich die Max-Planck-Gesellschaft heraus, nanz des Bundes in der Forschungspolitik.2
ebenso der Stifterverband für die Deutsche
Wissenschaft. Die in Deutsche Forschungsge- Und doch blieben Leerstellen im nationalen
meinschaft (DFG) umbenannte Notgemeinschaft Innovationssystem, die erst allmählich gefüllt
für die Deutsche Wissenschaft und der von wurden. Die zwei markantesten Leerstellen bilden
Werner Heisenberg gegründete Deutsche For- den Hintergrund für die spätere Gründung des
schungsrat konkurrierten einstweilen um die Freiburger Instituts: die angewandte Forschung
politische Akzeptanz als führende Selbstver- und die Verteidigungsforschung. Das Füllen die-
waltungsorganisation der Wissenschaft, ehe sie ser beiden Lücken verlief als Doppelprozess, in
1951 zur neuen DFG fusionierten. Die Bundes- dem sich zwei Entwicklungen wechselseitig
länder fanden im Königsteiner Staatsabkommen bedingten.
vom 24. März 1949 zu einer rechtlich-admini-
strativen Übereinkunft zur Finanzierung der
Forschungs- und Kultureinrichtungen von
überregionaler Bedeutung. Die Gründung der Fraunhofer-Gesellschaft
im Spannungsfeld von Verteidigungs- und
Mit den 1954/55 eingerichteten Kernforschungs- Vertragsforschung
zentren in Karlsruhe, München, Jülich und Geest-
hacht bei Hamburg und der Wiedergründung Gerade einmal zwei Tage, nachdem sich die
einer ganzen Handvoll von Forschungseinrich- Bundesländer in Königstein auf das grundlegen-
tungen der Luftfahrt besetzte die Bundesrepublik de Abkommen zur Finanzierung der überregiona-
noch vor dem offiziellen Ende der alliierten Ver- len Forschungseinrichtungen verständigt hatten,
bote zudem zwei Forschungsfelder, die zeitge- wurden in München weitere Weichen für den
nössisch als besonders zukunftsträchtig galten. Ausbau des deutschen Innovationssystems ge-
Aus der Kernforschung und Luftfahrtforschung stellt. Am 26. März 1949 versammelte sich im
heraus bildete sich schließlich die institutionelle großen Sitzungssaal des Bayerischen Wirtschafts-
Innovation der Großforschung. Die Großfor- ministeriums eine illustre Runde, um die Fraun-
schungseinrichtungen wurden im Verlauf der hofer-Gesellschaft für angewandte Forschung
60er-Jahre zur forschungspolitischen Hausmacht (FhG) zu gründen. Die neue Forschungsgesell-
des Bundes, auf der er seinen Positionsgewinn schaft wählte den prominenten Physiker und
gegenüber den Ländern gründete. Die Erweite- Rektor der Universität München, Walther Gerlach,
rung des Bundesatomministeriums zum Bundes- zu ihrem Präsidenten. Sie verstand sich als dritte
ministerium für wissenschaftliche Forschung Säule der bundesdeutschen Forschung neben der
1962, das den Ausbau der Raumfahrt- und
Weltraumforschung betrieb und zum Ende der 2 Vgl. Margit Szöllösi-Janze und Helmuth Trischler (Hrsg.):
60er-Jahre ein ganzes Bündel von Förderpro- Großforschung in Deutschland. Frankfurt a. M. und New
grammen für Neue Technologien – darunter auch York 1990.
50 Jahre Fraunhofer IAF –31Primat der Verteidigungsforschung
Das Freiburger Institut in den 50er- und 60er-Jahren (1949/57 – 1968)
DFG und der MPG, die in den Worten ihres Präsi- naler Bedeutung auszufüllen, eine Vermittlungs-
denten Aufgaben bearbeitete, »die in Gemein- stelle für Vertragsforschung aufzubauen, ging es
schaftsarbeit zwischen Wissenschaft und Wirt- doch darum, das drohende Ausgreifen des ameri-
schaft durchgeführt werden«.3 kanischen Battelle-Instituts auf den deutschen
Forschungsmarkt zu verhindern. Meinungs-
Tatsächlich aber hatte es der homo novus schwer, führende Kreise der Industrie, allen voran der
seine Position gegenüber den etablierten Insti- Vorstandsvorsitzende der Metall-Gesellschaft
tutionen durchzusetzen. Die in München ansässi- und Vorsitzende des Stifterverbandes, Richard
ge Gesellschaft wurde als »weiß-blaue Extra- Merton, nahmen im Verein mit den Spitzen der
wurst« tituliert und heftig angefeindet. Allen Forschung Battelle als Fortsetzung der intellek-
voran der Stifterverband, dem die Konkurrenz tuellen Ausplünderung Deutschlands nach dem
der FhG bei der Einwerbung industrieller Zweiten Weltkrieg wahr.5
Spendengelder ein Dorn im Auge war, und die
DFG, die um ihre Position als Repräsentantin der Den Ausweg aus der Krise wies die 1954 einset-
gesamten bundesdeutschen Forschung fürchtete, zende Kooperation mit der Stuttgarter Landes-
versuchten, den Münchnern das Wasser abzu- regierung, die die traditionell starke Position des
graben. Auf der Suche nach einer institutionelle Südweststaats in der angewandten Forschung
Stabilität und Wachstum ermöglichenden Auf- weiter auszubauen anstrebte. Auf Stuttgarter
gabenstellung fuhr die FhG im ersten Jahrzehnt Initiative hin verlegte sich die FhG nun darauf,
ihrer Existenz einen Schlingerkurs, der sich auch eigene Institute aufzubauen bzw. zu betreiben.
darin zeigte, dass sich Gerlach aufgrund heftiger Als erstes Institut wurde im Juli 1954 in Mann-
Anfeindungen gegenüber seiner Linie einer fried- heim das Fraunhofer-Institut für angewandte
lichen Koexistenz zu Stifterverband und DFG zum Mikroskopie, Photographie und Kinematographie
Rücktritt veranlasst sah. (IMPK) gegründet.
Ein Rettungsanker in ihrem Überlebenskampf war
3 Protokoll der ersten Senatssitzung der FhG am 6.5.1949,
das Angebot des Bundeswirtschaftsministeriums,
IfZ, ED 721/29; vgl. hierzu und zum Folgenden Helmuth
an der Vergabe von Mitteln des European Re- Trischler und Rüdiger vom Bruch: Forschung für den Markt.
covery Program (ERP) im Rahmen des Marshall- Geschichte der Fraunhofer-Gesellschaft. München 1999,
Plans mitzuwirken. Im Unterschied zu den S. 30-83, sowie Helmuth Trischler: Problemfall – Hoffnungs-
anderen westeuropäischen Staaten floss in der träger – Innovationsmotor: Die politische Wahrnehmung der
Vertragsforschung in Deutschland, in: Peter Weingart und
Bundesrepublik ein gewichtiger Teil der ERP- Niels C. Taubert (Hrsg.): Das Wissenschaftsministerium. Ein
Mittel in die Förderung anwendungsorientierter halbes Jahrhundert Forschungs- und Bildungspolitik in
Forschung, und die FhG partizipierte an deren Deutschland. Bielefeld 2006, S. 236-267.
4 Vgl. John Krige: American Hegemony and the Postwar
Verteilung.4 Sie weitete damit nicht nur ihr wis- Reconstruction of Science in Europe. Cambridge und
senschaftliches Netzwerk aus, sondern auch ihre London 2006, S. 36.
5 S. dazu auch Winfried Schulze: Der Stifterverband für
Kontakte zu Bonner Regierungsstellen. Dennoch
drohte ihr 1953/54 das forschungspolitische Aus, die Deutsche Wissenschaft 1920-1995. Berlin 1995, und
Jürgen Lieske: Forschung als Geschäft. Die Entwicklung
als sie es nicht vermochte, die ihr von Stifterver- von Auftragsforschung in den USA und Deutschland.
band und DFG zugedachte Aufgabe von natio- Frankfurt a. M. und New York 2000.
32–50 Jahre Fraunhofer IAFPrimat der Verteidigungsforschung Überall
Das Freiburger Institut in den 50er- und 60er-Jahren (1949/57 – 1968) verfügbar
und sauber
– netzun-
Nach der Gründung des Bundesverteidigungs- schaft. In einer Phase, in der die DFG und die
ministeriums und dem offiziellen Beginn des MPG penibel jeden Kontakt mit dem Verteidi-
Aufbaus der Bundeswehr im Mai 1955 waren gungsministerium vermieden, war dies für Bonn
die Karten neu gemischt. Nun bot sich der von besonderem Wert. Im Gegenzug sicherte die
Fraunhofer-Gesellschaft die Option, sich durch ministerielle Finanzierung der vier Verteidigungs-
die Kooperation mit der Hardthöhe einen festen institute der Fraunhofer-Gesellschaft ihre
Platz im Innovationssystem zu sichern. Ihr Ge- Existenz, und die hohen durchlaufenden Mittel
schäftsführer Norbert Hederer, der als ehemaliger der verteidigungsbezogenen Forschung vergrö-
Referent im Reichsluftfahrtministerium über viel- ßerten ihren Spielraum, parallel dazu zivile
fältige Kontakte zum Verteidigungsbereich ver- Institute aufzubauen und sich allmählich als
fügte, schnürte Mitte des Jahres 1955 ein Paket, Einrichtung für Vertragsforschung zu etablieren.
das die forschungspolitischen Interessen Baden-
Württembergs und des BMVg mit dem Bedarf Diese symbiotische Beziehung löste die beiden
von Fraunhofer an engen Beziehungen zur forschungspolitischen Außenseiten aus ihrer
Stuttgarter Landesregierung und an einer Randstellung im nationalen Innovationssystem.
bundespolitischen Ausweitung seiner Aktivitäten Freilich brachte diese Kooperation der Fraun-
abstimmte. Geschickt brachte er die föderalen hofer-Gesellschaft den zweifelhaften Ruf ein,
Vorbehalte Baden-Württembergs in Stellung, um vor allem Militärforschung zu betreiben. In der
zu verhindern, dass »wieder ein Heeres-Waffen- reform- und friedensbewegten Phase der späten
amt mit seinen bekannten unerfreulichen Er- 60er-Jahre sollte sich dieser Ruf als schwere
scheinungen« entstehe; stattdessen regte er an, Bürde erweisen.
in Freiburg einen regionalen Schwerpunkt prak-
tisch orientierter Forschung zu bilden und »damit
eine Dezentralisation sicherzustellen«.6
Das Institut für Elektrowerkstoffe
Ab 1956/57 ging die Fraunhofer-Gesellschaft in der Ära Reinhard Mecke
eine enge Kooperation mit dem BMVg ein.
Erstens vergab sie im Rahmen der sogenannten Die Geschichte der Gründung und institutionellen
»Verwaltungshilfe« Aufträge des Ministeriums an Etablierung des Freiburger Instituts ist im ersten
Einzelforscher sowie akademische und außeruni- Jahrzehnt seiner Existenz von dem Physiker
versitäre Einrichtungen; zweitens betrieb sie Reinhard Mecke (1895 – 1969) geprägt. Mecke
Institute, die an verteidigungsbezogenen Auf- war es, der das Institut in einem Alter gründete,
gabenstellungen arbeiteten, allen voran das 1957 in dem andere Wissenschaftler sich bereits auf
gegründete Fraunhofer-Institut für Elektrowerk- ihre Emeritierung vorbereiten, und noch ein
stoffe (IEW) in Freiburg; drittens erschloss sie dem volles Jahrzehnt lang leitete.
Ministerium Kontakte zur Wissenschaftlergemein-
In der Person Meckes spiegeln sich dabei jene
6
Brüche und Kontinuitäten wider, die so viele
Hederer an Hipp vom 15.6.1955 (Archiv des Instituts für
Zeitgeschichte (im Folgenden IfZ), ED 721/102); s. auch wissenschaftliche Karrieren Deutschlands in den
Trischler/vom Bruch, Forschung, S. 71. ersten beiden Dritteln des 20. Jahrhunderts
50 Jahre Fraunhofer IAF –33Sie können auch lesen