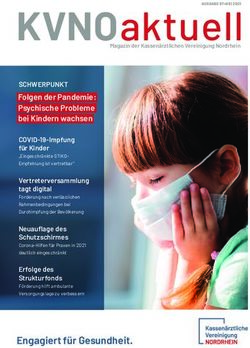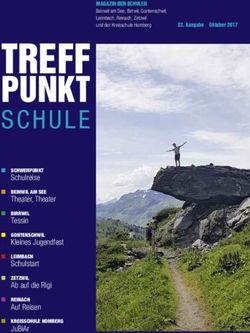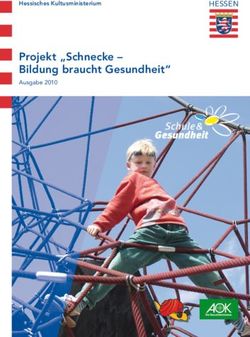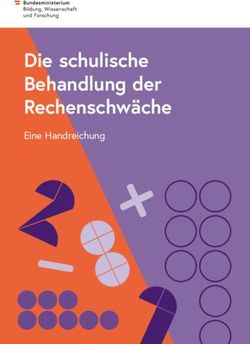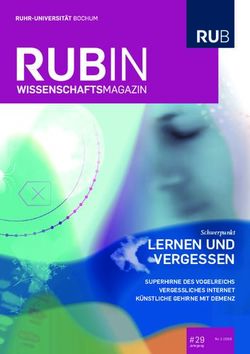Ich du wir Ein Magazin für psychiatrisch Tätige - Edition 2021 1 Psychoedukation - Netzwerk Angehörigenarbeit Psychiatrie
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Edition 2021· 1
Psychoedukation
ich · du · wir
Ein Magazin für psychiatrisch Tätige
www.angehoerige.chVor dem Hintergrund neuester Untersuchungen zu den
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gesund-
heit und psychosozialen Problematiken von Kindern
und Jugendlichen kann man die beiden Beiträge von
Nicole Friedrich sowie das Interview von Tobias Furrer
wahrhaftig als spannende Trilogie hervorheben. Die
Lesenden werden zunächst durch die beiden Kinder-
buch-Autorinnen Anna Gabriel Lanz und Cynthia Stei-
ner-Berger in die Bedeutung kindlicher Phantasiewel-
ten eingeführt, bevor Nicole Friedrich kombiniert in
Interview-Form und einem Fachartikel einerseits in ein-
drücklicher Weise die subjektive Perspektive und Ausei-
nandersetzung zweier jugendlicher Geschwister mit der
Erkrankung ihrer Mutter schildert, sowie andererseits
den Scheinwerfer auf die essentiellen Bausteine der
Psychoedukation im Kindes- und Jugendalter wirft. Eine
abschliessende Buchbesprechung von NIKI und der
lange Schal regt zum Nachdenken und der weiteren
Lektüre an.
Die Fachartikel von Thomas Lampert und Prof. Dr. Tho-
mas Bock analysieren unterschiedliche Herangehens-
weisen und Techniken der Psychoedukation sowohl
krankheitsübergreifend als auch spezifisch in Bezug auf
Manie und Depression. Die Autoren zeigen hierbei in
konzis-verständlichen Formulierungen die Spannungs-
felder der Konzeption und Umsetzung psychoedukati-
ver Arbeit sowie die Wichtigkeit der Bedürfnisorientie-
rung und Interaktion bzw. das „mehr“, das es benötigt,
auf. Das Plädoyer von Stephan Kälin für den Flipchart
und die Ermunterung der Leserschaft, sich ihrer Talente
zu bedienen, schliesst den Kreis der Unabdingbarkeit
möglichst optimaler Kommunikation und verständli-
chen Darstellung im Bereich der Wissensvermittlung.
Liebe Leserschaft,
Die NAP bedankt sich herzlich mich für Ihr andauerndes
Interesse an unserem Magazin und wir wünschen
Wenn die vergangenen 18 Monate uns eines gelehrt Ihnen viel Freude bei der Lektüre.
haben, dann ist dies voraussichtlich, welch eminent
wichtige Rolle Wissensvermittlung, Kommunikation
und die verständliche Darstellung komplexer Zusam-
menhänge für das Miteinander in einer hochentwickel-
ten, globalisierten Gesellschaft einnehmen und dass Es grüsst Sie freundlich
essentielle menschliche Fähigkeiten wie Freiheit, Soli-
darität sowie der gerechte, sorgsame Umgang mitein-
ander nur durch ein gemeinsames Verständnis der
Gegenwart in ihrer Gänze zu tragen kommen. Das mitt-
lerweile siebte Fachmagazin ich-du-wir exploriert vor Janis Brakowski
diesem hochaktuellen Hintergrund die Herausforderun- Vorstandsmitglied NAP
gen wie auch die Chancen der mitunter intensiven
Arbeit mit psychisch Erkrankten sowie deren Angehöri-
gen und setzt hierin den Fokus auf die Psychoeduka-
tion, welche wiederum im Kern die Informationsver-
mittlung, den selbstwirksamen Umgang mit sowie die
Verständnisförderung von psychischen Erkrankungen
und insbesondere die Krankheitsbewältigung umfasst.
Der fachlich-wissenschaftliche Rahmen wird durch die
renommierten Forscher mit ausgewiesener klinischer
Fachexpertise, Frau PD Dr. Gabriele Pitschel-Walz und
Prof. Josef Bäuml von der TU München gesteckt. In
ihrem Artikel „Welchen Nutzen hat Psychoedukation
für Angehörige?“ beleuchten sie einerseits die wissen-
schaftlich-historischen Grundlagen der Psychoeduka-
tion und geben andererseits einen praktischen Einblick
in die zentralen Elemente plus Ziele und die Wirksam-
keit professioneller Einzel- und Gruppenangebote
innerhalb dieser diffizilen wie teilweise kontroversen
Thematik.
2FOKUS
Angehörige einbeziehen – nicht
erziehen
Lehren aus dem Trialog im Umgang mit Familien
Von Thomas Bock
Vorweg: Ich versuche, mit diesem Beitrag, der sich vor
allem an Profis richten soll, auch Angehörige anzuspre-
chen – zum einen aus didaktischen Gründen, zum
anderen weil wir alle auch Angehörige sind, auch wenn
sich unsere Sorgen als Eltern, Partner, Geschwister, Kin-
der nicht immer auf krankheitswertige psychische
Besonderheiten beziehen.
Niemand wird alleine psychisch krank, niemand Als Angehöriger sehe ich auch das erkrankte Familienmit-
alleine gesund glied nicht nur durch die Brille der Krankheit. Eine gewisse
Unbefangenheit ist wichtig und muss bleiben. Es ist fatal,
Wir entwickeln uns in einem Kontext, der uns begleitet, wenn
spiegelt, trägt, verunsichert, verletzt, heilt – von allem
etwas; das gilt mit und ohne diagnostizierter psychi-
scher Erkrankung. Angehörige können zu Krisen, • Eltern Früherkennung betreiben
manchmal auch zu tiefen Verletzungen beitragen. Ihre • Partner alle schlechten Eigenschaften des anderen der
Präsenz ist aber zugleich oft die entscheidend nötige Krankheit zuschreiben
Ressource, um halbwegs elegant wieder aus dem Schla-
massel herauszukommen. Missbrauch und Gewalt • Sich Freundschaften in Helferbeziehungen wandeln
geschehen überwiegend im Nahbereich; die meisten • Geschwister sich (aufgrund von Krankheitsangst oder
psychisch erkrankten Menschen werden hier Opfer und Schuldgefühlen) verlieren
Täter. Das gilt übrigens auch für die, die – warum auch
immer – gesund bleiben. Das gehört zum Leben. Und Gleichzeitig ist es natürlich wichtig, dass Angehörige die
es hilft auch wenig, jede Auffälligkeit und Besonderheit Erkrankung nicht leugnen, die Hypothek des anderen aner-
mit diagnostischen Etiketten zu belegen. Wir können kennen, Erwartungen (vorübergehend) anpassen und
auch böse sein – mit und ohne Erkrankung. ohnehin fragwürdige Leistungsansprüche hintanstellen. In
Mit der tiefen Verunsicherung eines anderen Men- diesem Spagat hilft ein Verständnis psychischer Störungen,
schen in der unmittelbaren persönlichen Nähe konfron- das ich anthropologisch, andere systemisch oder psychody-
tiert zu sein, bleibt für niemanden spurlos. Diese Erfah- namisch nennen: Niemand ist nur gesund oder nur krank,
rung hat vermutlich jede/r von uns gemacht – in sondern wir alle bewegen uns auf einem Kontinuum zwi-
beiden Rollen, wenn auch sicher mit unterschiedlicher schen gesund und krank. Psychischen Störungen sind
Intensität und Dauer. Diese wechselseitige Verantwor- zunächst mal zutiefst menschliche Reaktionen auf widrige
tung und Verletzlichkeit gilt völlig unabhängig von der Umstände und Widersprüche und als solche nicht sinnlos,
professionellen Betrachtung, der Zuständigkeit ver- können dann aber eine Eigendynamik entfalten (somatisch,
schiedener Hilfen und der damit zusammenhängenden psychisch und sozial), die in krankheitswertige Zustände
Diagnostik. Dass Psychiatrie und Psychotherapie nicht führt – mit Anspruch auf Krankengeld und eben auch Hilfe.
selten als einzige zuständig sind, kann man als kulturellen
Fortschritt oder als Verarmung ansehen. Ich neige eher
zu letzteren, doch auch hier gibt es wohl beide Möglich-
keiten und gilt kein vereinfachendes entweder-oder. Psychische Störungen sind zutiefst menschlich
Die Pathologie betont das statistisch besondere, das Norm-
Im Zweifel hat die Angehörigenrolle Vorrang abweichende und Fremde; die Anthropologische Psychiat-
rie, wie sie aus dem Trialog heraus neu belebt wurde,
Vater/Mutter, Bruder/Schwester, Sohn/Tochter bin und erweitert den Blick auf das allen Menschen gemeinsame,
bleibe ich, ob ich will oder nicht. Partnerschaften, Ehen auf das zutiefst Menschliche, den biographischen Zusam-
und Freundschaften sind Wahlverwandschaften. Doch menhang, die subjektive Bedeutung und die Funktionalität,
für alle Angehörigen gilt, dass Sie einzigartig sind. Und die nahezu alle Symptome neben und in der Störung haben
das durchaus im Gegensatz zu TherapeutInnen oder können (Bock 2012, 2014, Bock u.a. 2013).
andren professionellen HelferInnen. Schon deshalb gilt:
versuchen Sie nie, die eine Rolle durch die andere zu Angst zu haben, ist keine Krankheit, sondern eine überle-
ersetzen. Bleiben Sie sich und der familiären Rolle treu. bensfähige Fähigkeit des Menschen, um sich vor Gefahr zu
Und auch wenn Sie sich Rat von Profis holen, lassen Sie schützen. Erst die Verallgemeinerung, Generalisierung
sich nicht verführen, deren Rolle zu übernehmen. oder Zuspitzung der Angst macht sie zur „Störung“ und
Unweigerlich würde etwas viel wertvolleres verloren damit einer Psychotherapie zugänglich. Die Frage nach
gehen. der Funktionalität bleibt.
3Zwänge oder Rituale zu entwickeln, kann ebenfalls Aus- Unterschiedliche Perspektiven und Sorgen von Angehörigen
druck des Bemühens sein, (künstliche) Ordnung zu ent-
wickeln wo Chaos und Orientierungslosigkeit droht. Die verschiedenen Angehörigen bringen sehr unter-
Und je unsicherer ein Mensch ist und je weniger ihm schiedliche Perspektiven, Erfahrungen, Ressourcen,
natürliche, soziale, biographische oder religiöse Rituale Belastungen und Fragen mit sich. Das erscheint selbst-
zur Verfügung stehen, desto eher mag er/sie zu patho- verständlich - und hat doch im psychiatrischen Alltag
logischen Ausdrucksformen kommen. leider oft noch zu wenig Widerhall (Bock 2016):
Auch eine Depression ist zunächst als Schutzmechanis- Eltern fragen vor allem nach der eigenen Verantwor-
mus der Seele – vor zu starken oder zu vielfältigen/ver- tung und Schuld, ob sie zuviel oder zuwenig geliebt, zu
wirrenden Gefühlen, vor unlösbaren Konflikten oder früh oder zu spät losgelassen haben. Der Erziehungs-
Entscheidungen – bzw. als Totstellreflex zu verstehen. prozess ist schon bei gesunden Kindern kompliziert,
Erst die vielfache psychische, soziale und somatische erfordert eine ständige Balance von Autonomie und
Eigendynamik macht daraus eine Erkrankung. Bindung und ist als solcher fehleranfällig. Das gilt erst
recht, wenn in einer Psychose gleichzeitig sehr unter-
In diesem Sinne mag die Manie am Ende zwar zerstöre- schiedliche Beziehungsmuster, -wünsche und -ängste
risch und belastend sein, zunächst ist sie jedoch auch zutage treten. In dieser Situation brauchen Eltern Ent-
„Flucht nach vorne“, Spiegel der Seele, vermeintlicher lastung und Fehlerfreundlichkeit, wie sie sich z.B. in
Ausweg aus Überanpassung ... diesem Zitat aus einer Angehörigengruppe spiegelt:
„Wenn Sie nichts falsch machen, ist das falsch; denn
Im anthropologischen Kontext ist die Borderline-Stö- fehlerlose Eltern sind unerträglich“.
rung immer noch tendenziell selbstverletzend und
beziehungsextremistisch, doch zunächst auch ver- Geschwister fühlen sich mit Recht oft vernachlässigt
gleichbar einer ausweglosen Pubertät mit Spannungs- (Bock u.a. 2008). Sie werden wenig einbezogen,
feldern, die für jeden Menschen bedeutsam sind: Zwi- schauen kritisch auf die Psychiatrie und sind doch in
schen Nähe und Distanz, Autonomie und Bindung, Familiengesprächen sehr hilfreich, wenn es darum
Anpassung und Widerstand – mit der jeweils verbunde- geht, Krankheits- und Generationsdynamik auseinan-
nen Angst. derzuhalten. Sie einzubeziehen, gebietet sich aber auch
wegen des Risikos, dass sie unter dem Druck einer
Psychosen können personale Grenzen auflösen – in „Überlebensschuld“ selbst erhebliche Einbussen der
einer Kultur, die diese masslos heiligt. Ob diese Auflö- Lebensqualität erleiden oder an unseren falschen Kurz-
sung eher angstvoll oder spirituell wahrgenommen schlüssen zur Genetik verzweifeln.
wird, ist nicht allein krankheitsbedingt, sondern auch
kulturabhängig. Die psychologische Konsequenz der Partner bringen je nach Beziehungsgeschichte sehr
Durchlässigkeit: Innere Konflikte werden Person und unterschiedliche Zweifel und Fragen mit, von denen
Stimme („Halluzination“), äussere Ereignisse treffen fil- zwei aber besonders prägend sind: Warum tut er / sie
terlos ins Innere („Paranoia“). Wobei genau diese mir das an? Und wie halte ich das aus? Die eine Frage
Beziehungssetzung entsprechend den Wunsch und verweist auf die Gleichzeitigkeit von Krankheits- und
Angstanteilen eines Traums verschieden besetzt sein Beziehungsdynamik, die je nach Akutheit der Situation
kann: Wer drei Geheimdienste hinter sich wähnt, hat unterschiedlich zu beantworten ist und im Verlauf der
Angst, aber auch Bedeutung: Wenn wir gar kein Echo Genesung immer wieder neue spannende Diskurse
mehr haben, können Halluzinationen diesen Raum fül- erlaubt bzw. erfordert. Die andere Frage verdeutlicht,
len; wenn wir keine Bedeutung mehr haben, können dass Partner aus eigenem Interesse aber auch im Sinne
wir veranlasst sein, diese zu konstruieren – sogar um des Patienten achtsam mit sich selbst sein, also Nähe
den Preis des Realitätsbezugs. und Distanz immer wieder austarieren müssen: Wieviel
Nähe ist möglich, um mich nicht selbst zu gefährden?
Wieviel Abstand brauche ich, um meine Liebe zu ret-
ten? Die Komplexität der Situation macht deutlich, dass
«Menschen müssen im Unterschied zu anderen Lebe- Partner hier – privat oder professionell - Hilfe brauchen
wesen um ihr Selbstverständnis/-gefühl ringen. Es und dass es ein Kunstfehler ist, sie allein zu lassen.
gehört zu unseren Möglichkeiten, an uns zu zweifeln
und dabei auch zu verzweifeln, über uns hinaus zu Das gilt natürlich besonders, wenn Kinder im Spiel sind,
denken und uns dabei auch zu verlieren ... Wer darü- insbesondere wenn sie im gemeinsamen Haushalt
ber psychotisch wird, ist also kein Wesen vom anderen leben. Ihre kindgemäss mystische Weltsicht lässt sie oft
Stern, sondern zutiefst menschlich». über sich hinauswachsen, in der Zuschreibung aller Ver-
AG Psychoseseminare 2007 antwortung und Kausalität an sich selbst und im Bemü-
hen, Mama oder Papa zu retten. Sie zu entlasten, erfor-
dert kindgemässe Aufklärung und die Gewährleistung
Diese Sichtweise reduziert das Risiko von Selbst- und alternativer Bezugspersonen in Krisen.
Fremdstigmatisierung. Sie hilft Patienten, sich die
befremdliche Erfahrung wieder abzueignen, sie kritisch Freunde fragen, wieso der/die andere sich so verändert
als Person auch wieder mit sich selbst in Verbindung zu und ob er/sie noch zu ihnen passt. Damit geht es um
bringen und nicht nur als abstrakte Erkrankung an Solidarität, im Konkreten leider oft ganz banal auch
Fremde zu delegieren. Diese Sichtweise hilft aber eben bezogen auf den Umgang mit Alkohol oder Drogen.
Angehörigen in ihrem Spagat zwischen Respekt vor der Freunde sind ein Schatz, wenn es sie noch gibt. Sie
Erkrankung und dem Ringen um Erhalt des normalen haben mehr Einfluss als andere, sodass es sich als
Lebens. Sie hilft, immer auch einen Teil Verantwortung Betroffener lohnt, um sie zu kämpfen, und als Thera-
beim erkrankten Familienmitglied zu belassen und das peut, bei der Klärung zu helfen. Im Hinblick auf Drogen
eigene Leben nicht aus dem Blick zu verlieren. kann es hilfreich sein, die Ungerechtigkeit zu benen-
4nen, die damit verbunden ist, dass mit bzw. nach einer Doppelte Peerarbeit – von/für Betroffenen, von/für
psychischen Erkrankung die Folgen des Konsums sehr Angehörige
verschieden sind.
Aus dem Trialog ist (in Deutschland) auch Peer-Support
Schon diese Auflistung (ohne Grosseltern, Enkel und wei- und Genesungsbegleitung entstanden. Im Rahmen eines
tere Verwandte) zeigt, welchen Reichtum unser Bezie- Forschungsprogramms ist es in dann Hamburg europa-
hungsgefüge birgt und wie lohnend es ist, es im doppel- weit erstmalig gelungen, doppelte Peerarbeit als eigen-
ten Sinne – als Ressource und als Konfliktfeld mit ständige Dienstleistung (Genesungsbegleitung und
eigenen Bedürfnissen – wahrzunehmen und es direkt Gesundheitslotsen) an der Schnittstelle ambulanter und
oder indirekt einzubeziehen. stationärer Versorgung flächendeckend zu etablieren und
auf hohem Niveau zu evaluieren. Die Ergebnisse sind
ermutigend: Bei Betroffenen stärkt Peerbegleitung u.a.
Visionen des Trialogs ihre Selbstwirksamkeit (Mahlke u.a. 2017) inkl. Selbstver-
trauen und –verantwortung mit Rückwirkung auf Teil-
Der Trialog hat die Rollen verändert - als Vision, aber habe, Stigmaresistenz, Rehospitalisierungsrate. – Bei
auch im konkreten Geschehen eines Psychoseseminars, Angehörigen reduziert die Begleitung durch geschulte
Trialogforum oder eines der Folgeprojekte aus dem Peers die subjektive Belastung und stärkt die Lebensquali-
Bereich Antistigmaarbeit, z.B Irre menschlich Hamburg tät (Heumann u.a. 2016). Das erste kann entscheidend
(Bock u.a. 2016), Beschwerdestellen (Bombosch 2009) sein auf dem Weg der Genesung und das zweite ist ein
oder Forschung, z.B. Nutzerorientierte Wissenschaftsbe- wesentlicher Bestandteil von Prävention.
ratung NoW – inkl. Angehörige (Demke u.a. 2017). Tri-
alog meint das Gegenteil von Psychoedukation, also
keine einseitige Belehrung oder unterschwellige Rollen-
veränderung, keine um Objektivität bemühte Beratung, Zugespitzte Konflikte
sondern persönlicher wechselseitiger Lernprozess mit
einem Schwerpunkt auf den Austausch subjektiver Pers-
pektiven und wechelseitiger Fragen. Ziel dieses „herr- Spaziergang trotz Depression?
schaftsfreien Diskurses“ (Habermas 1981) ist nicht
Compliance bei den Patienten und Anpassung bei den Mal angenommen, durch Psychoedukation oder Googeln
Angehörigen, sondern Empowerment bei beiden. Für wüsste ich alles über Depression, was folgt daraus für die
Angehörige ist spannend, dass manchmal fremden Frage, ob ich meinen Mann oder meine Frau am morgen
Betroffenen und umgekehrt fremden Angehörige leich- versuche zu einem Spaziergang zu motivieren? Die Ant-
ter zuzuhören und besser von ihnen zu lernen ist als wort ist komplex und möglicherweise viel näher bei mir
zuhause in den eigenen vier Wänden mit all den einge- selbst als mir lieb ist: Erst muss ich klären, ob die Einla-
fahrenen Spielregeln (Bock & Priebe 2005, Bock u.a. dung halbwegs authentisch ist; dann muss ich anerken-
2013). nen, wie unendlich schwer der Start sein kann. Dann viel-
leicht ein kleines Stück anbieten. Das fällt leichter, wenn
ich mich erinnere, dass die Kräfte auch schon mal anders
«Psychoedukation läuft, wenn sie zu eng verstanden verteilt waren, ich zugleich meine Ohnmachtsgefühle res-
wird, in Gefahr, die Rollen der Beteiligten einzuengen pektiere– zumindest vor mir selbst.
und ihre Handlungsfreiheit zu beschränken».
Todesurteil oder Liebeserklärung?
Psychoedukation läuft, wenn sie zu eng verstanden wird,
in Gefahr, die Rollen der Beteiligten einzuengen und ihre Mal angenommen, Ihr Sohn oder Tochter hört eine
Handlungsfreiheit zu beschränken: Was ist gewonnen und Stimme, die ihm nahelegt, Mutter oder Vater zu töten.
vor allem was geht verloren, wenn wir Angehörige erst zu Auch wen wir alle viele nahestehende Menschen schon
„SchülerInnen“ und dann zu Co-TherapeutInnen machen? auf den Mond schiessen wollten, ist das in dieser Konkret-
Was passiert mit ihren erkrankten Familienmitgliedern, heit erschreckend, kann dadurch Schuldgefühle wecken
wenn sie anschliessend auch zuhause (nur) durch die oder Zwangsreaktionen hervorrufen. Wenn man aber
Krankheitsbrille gesehen werden. Selbstverständlich brau- bedenkt, dass in Psychosen unsere Grenzen durchlässig
chen Angehörige Unterstützung, um sich zu besinnen, zu werden, innere Dialoge zu äusseren werden (Halluzinatio-
begrenzen, dem/r anderen nicht ins Nirvana zu folgen, auf nen) oder äussere Ereignisse uns filterlos treffen (Para-
entlastende professionelle Hilfen zu bestehend, um Bezie- noia), dann wird auch vorstellbar, dass Nähe bedrohlich
hung und Liebe zu retten. Vor allem braucht es gemein- werden kann, dass gerade die Menschen, die wir lieben,
same familienbezogene Hilfen für PatientInnen und Ange- mit Abwehrreaktionen rechnen müssen. Die Herausforde-
hörige, um sich gegenseitig nicht aus dem Auge zu rung für Angehörige liegt also darin, beizustehen ohne zu
verlieren, eine gemeinsame Sprache zu erhalten bzw. die sehr auf die Pelle zu rücken, den/die andere/n weiter als
Sprache der Symptome zu entschlüsseln, wechselseitig Erwachsenen zu sehen, auch wenn sich symbolisch oder
Respekt zu bewahren für Empfindlichkeit und Besonder- konkretistisch in Wahrnehmungen oder Übertragungen
heit des/r anderen, bestimmte Spielregeln zu retten, die kindliche Muster äussern (Bock 2007).
das gemeinsame Leben erfordert oder einen guten Weg
zu finden, Abstand zu finden, zu wahren, wieder herzu-
stellen. Doch diese Prozesse sind so komplex und alle Flucht nach vorne aus der Überanpassung?
Beteiligten sind letztlich (mit/ohne/trotz Erkrankung)
eigenverantwortlich, dass „Psychoedukation“ (im Wort- Manien belasten die sozialen Beziehungen – in alle
sinn) zu kurz greift. Vor allem, wenn diese die existentiel- Richtungen, egal ob sie bei Kind, Elternteil, Geschwister
len Fragen, die immer mitschwingen, auf Erkrankung oder Partner/In verortet ist. Der/die andere wird tref-
reduziert (Amering & Schmolke 2011). fend und verletzend, fühlt oder erscheint sogar grossar-
5tig mit absehbaren, manchmal aber auch vorweggenom- Literaturverzeichnis
menen Katastrophen. Mir hilft es im Blick zu behalten,
dass der/ die manische Patent/In ansonsten überange- AG der Psychoseseminare (2007); Es ist normal verschieden zu
passt erscheint, bemüht ist es allen recht zu machen, nicht sein - erhältlich unter www.irremenschlich.de oder www.tri-
gelernt hat, rechtzeitig Nein zu sagen. Wenn es doch alog-psychoseseminar.de
einen Psychotherapeuten/in gäbe, um zu lernen, das
Amering M, Schmolke M (2011); Recovery – Das Ende der
Ungewöhnlich im Alltag unterzubringen, anstatt es für die Unheilbarkeit, Köln: Psychiatrieverlag
nächste Manie aufzubewahren.... Umso wichtiger ist es ,
nicht mit Kanonen auf Spatzen zu schiessen, den Spiel- Bock T (2007); Eigensinn und Psychose – Noncomplaince als
raum des anderen und auch den eigenen (!) nicht unnötig Chance, Neumünster: Paranusverlag
einzuengen. Umso wichtiger ist es aber auch, die eigenen
Grenzen deutlich zu machen – möglichst mehr mit Ich- Bock T (2012) Krankheitsverständnis – zwischen Stigmatisierung
Botschaften als mit Gegenangriffen und möglichst recht- und Empowerment, Schweizer Archiv für Neurologie und Psych-
zeitig, bevor die eigene Kränkung so mächtig, die eigene iatrie, 163 (4), S. 138-144
Wut federführend ist und ich so der manischen Energie
ins Messer laufe. Das gilt im Übrigen auch für Psychothe- Bock T (2014); Wird die Menschheit kränker oder die Krankheit
menschlicher? Editorial, Psychiatrische Praxis 4/2014
rapeut/Innen, die hoffentlich bald aufhören, die Men-
schen mit besonderer Spannweite hinsichtlich Stimmung Bock T (2016): Raum und Psyche – aus sozialpsychiatrischer,
und Antrieb, also die „Bipolaren“ zu stignatisieren bzw. zu anthropologischer, trialogischer Sicht, in: Haslinger B (Hrsg)
meiden (Bock 2020). Raum und Psyche – ein transdisziplinärer Dialog zu Freiräumen
in der Psychiatrie, Psychosozial Verlag
Abschliessendes Resumé Bock, T (2020); Achterbahn der Gefühle – Leben mit Manie und
Depression, Psychiatrieverlag 2020
„Wenn ich psychotisch werde, möchte ich in meiner
Gewordenheit verstanden, in meinen So-Sein respektiert Bock T, Priebe S (2005); Psychosis-seminars: An unconventional
approach for how users, carers and professionals can learn from
und in meiner Zukunftsperspektive ermutigt werden“. each other. Psychiatric Services 2005; 11: 1441-1443
Dieses Zitat von Gwen Schulz (2012) verdeutlicht Wün-
sche an Psychotherapie und prägt zugleich das Selbstver- Bock T, Fritz-Krieger S, Stielow K (2008); Belastungen und Her-
ständnis von Peerberatung. Information alleine ist zuwe- ausforderungen – Situation und Perspektive von Geschwistern
nig. schizophrener Patienten, Sozialpsychiatrische Informationen,
Wenn ich das Zitat auf Angehörigenperspektive übertrage, Psychiatrieverlag Bonn, Jg 38, 1/2008, S. 28 ff.
dann könnte es so lauten: „Wenn ich als Vater/Mutter,
Sohn/Tochter, Bruder/Schwester, Opa/Oma, Enkel/In Bock T, Meyer HJ, Rouhiainen T (2013); Trialog – eine Herausfor-
oder Freund mit der existentiellen Krise eines geliebten derung mit Zukunft, in: Roessler W, Kawohl W. Handbuch Sozi-
Menschen konfrontiert werde, dann möchte ich meine alpsychiatrie Bd 2 Anwendung, Kohlhammerverlag
eigene Geschichte nicht vergessen, meine eigenen Gefüh- Bock T, Klapheck C, Ruppelt F (2013); Sinnsuche und Genesung.
len, Wünsche und Grenzen wahrnehmen, in meiner eige- Köln: Psychiatrieverlag
nen Rolle/Sicht respektiert und gesehen, sowie in meiner
eigenen und der gemeinsamen Entwicklung ermutigt wer- Bock T, Urban A, Schulz G, Sielaff G, Kuby A, Mahlke C (2016);
den“. Nach meinem Verständnis braucht das mehr oder Overcoming Stigma and Discrimination „Irre menschlich Ham-
jedenfalls etwas im Ansatz anderes als Psychoedukation. burg“ – Example of a Bottom-Up Project; in: Gaebel W, Sartorius
N (Ed) Mental Illness Stigma – End f the Story, Springer 2016
«Aneignung macht Hoffnung – das dürfen Angehörige Bombosch J (2009); Qualitätsentwicklung in der Sozialpsychiat-
wissen, können sie vielleicht sogar befördern». rie – selbstverständlich im Trialog, Sozialpsychiatrische Informatio-
nen (Themenheft Trialog), 3/2009, 39: S. 10 ff
Demke E, Heumann K, Mahlke C, Bock T (2017); EmPeeRie –
Wem es gelingt, die psychotische oder bipolare Erfahrung Empower Peers to research, Vorstellung eines Hamburger Pro-
mit dem eigenen Leben in Verbindung zu bringen, sie wie- jekts zur Förderung von partizipativer und betroffenenkontrollier-
der anzueignen (Bock u.a.2013), gewinnt an Zuversicht ter Forschung, Sozialpsychiatrische Informationen 2/2017, 43-53
und schaut hoffnungsvoller in die Zukunft. Das dürfen
Angehörige wissen, das können sie vielleicht sogar beför- Heumann K, Janßen L, Ruppelt F, Mahlke C, Sielaff G, Bock T
dern und der Zusammenhang könnte auch Ihnen Mut (2016). Auswirkungen von Peer-Begleitung für Angehörige auf
machen. Das alles spricht sehr dafür, Angehörige wahr- Belastung und Lebensqualität – eine Pilotstudie. Zeitschrift für
zunehmen, zu entlasten, zu unterstützen, vor allem sie Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie, 64(1).
einzubeziehen. Mahlke C, Krämer U, Becker T, Bock T (2014); Peer support in
mental health services, current opinion Vol 27, No 4, July 2014
Prof. Dr. phil. Thomas Bock
war Leiter der Ambulanz für Mahlke C, Priebe S, Heumann K, Daubmann A, Wegscheider K,
Psychosen und Bipolare Stö- Bock T (2017); Effectiveness of one-to-one peer support for
patients with severe mental illness – a randomised controlled
rungen, über 40 Jahre am Uni-
trial. Euro Psychiatry
versitätsklinikum Hamburg-
Eppendorf tätig und ist Mit- Schulz G (2012); Spurensuche, Zu-Trauen, Geduld, Übersetzen,
begründer des Trialogs. S Hoffen – mein Wunsch an Psychotherapie. In: v.Haebler D, Men-
tzos, S, Lempa G (Hrsg.) Psychosenpsychotherapie im Dialog,
Kontakt: bock@uek.de
Band 26, Göttingen; Vandenhoeck & Ruprecht
Foto:UniversitätsklinikumHamburg-Eppendorf
6BUCH
Ratgeber
Thomas Bock ist Professor für Klinische Psychologie und
Sozialpsychiatrie, Psychologischer Psychotherapeut, seit
40 Jahren am Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf,
Autor von Fach- und Kinderbüchern. Er hat mit Dorothea
Buck die Psychoseseminare und weitere trialogische Pro-
jekte gegründet und Auszeichnungen für Versorgung,
Lehre und Forschung bekommen.
Achterbahn der Gefühle
Himmelhochjauchzend, zu Tode betrübt – so übersetzt
der Volksmund extreme Stimmungsschwankungen, die
Menschen wie auf einer Achterbahn in die Euphorie
katapultieren und ebenso schnell in grosse Hoffnungslo-
sigkeit stürzen lassen. Betroffene wünschen nichts sehn-
licher, als wieder die innere Balance zu finden. Dieses
Buch sagt wie.
Psychose und Eigensinn
Thomas Bock erzählt in diesem Buch Geschichten von
eigensinnigen Patienten – er berichtet von kreativen
Wegen des Zugangs zu jungen Ersterkrankten und zu
langfristig Psychoseerfahrenen. Sein Credo: Gerade von
eigensinnigen Patienten können wir viel lernen über die
Bedeutung von Psychosen, die notwendigen strukturel-
len Veränderungen der Psychiatrie, über angemessene
Beziehungskultur.
Seine Schilderungen werden ergänzt durch ein Gespräch
mit Dorothea Buck über den »eigenen Sinn von Psycho-
sen« und durch eine wissenschaftliche Analyse von Prof.
Michaela Amering aus Wien zu den subjektiven Voraus-
setzungen von Genesung: »Hoffnung macht Sinn«.
Stimmenreich
»Nie war über Psychosen authentischer zu lesen!«,
schrieb der Spiegel enthusiastisch über die Erstausgabe
von »Stimmenreich«. Psychosen sind erschütternde
Erfahrungen, die Sprachlosigkeit und Isolation für die
davon betroffenen Menschen zur Folge haben.
Das vorliegende Buch zeigt Wege zur Verständigung. Es
präsentiert die wichtigsten Beiträge der »Erfinder« der
Psychose-Seminare. Wer Psychosen begreifen will, dem
sei dieses Buch sehr zu empfehlen.
7FOKUS
Welchen Nutzen hat Psychoedu-
kation für Angehörige?
Von Josef Bäuml und Gabriele Pitschel-Walz
„Dr. Google“ und die Suche nach der „Wahrheit“
»Doktor-Google« hilft in allen Lebenslagen! Sobald das
Wort „Psychose“ gefallen ist, wird nach der geheimnis-
umwitterten „Wahrheit“ geforscht. Diese Informations-
suche ist aus Psychoedukations-Sicht selbstverständlich
zu begrüssen, um Selbstwirksamkeit und Empowerment
zu erhöhen. Allerdings kann die Flut an unterschiedli-
chen und sich teilweise widersprechenden Informatio-
nen auch sehr verunsichern. Um die »Spreu vom Wei- der Betroffenen und Angehörigen. In der somatischen
zen« zu trennen zwischen wissenschaftlichem Gold- Medizin hat sich diese Kompetenzerweiterung längst
Standard und Aussenseiterpositionen, braucht man ein bewährt und durchgesetzt.
umfangreiches Vorwissen. Vor allem Familien von Erst-
erkrankten (Amaresha et al., 2018) müssen strukturiert PE muss neben der Wissensvermittlung zugleich die
und psychologisch adäquat unterstützt an diese Erkran- »Berührungsängste« vor der Erkrankung nehmen und
kung herangeführt werden. Andernfalls können sich lai- erleichternde »Aha-Erlebnisse« ermöglichen. Sie muss
das Wissen so aufbereiten und »dolmetschen«, dass es
für medizinische Laien an Bedrohlichkeit verliert und
«Wenn laienhafte und pseudowissenschaftliche als hilfreich empfunden wird. Kultursensiblen Faktoren
Überzeugungen sich verfestigen, können die dann oft kommt hierbei eine immer grössere Bedeutung zu
jahrelang die professionelle Behandlung unnötig (Khalil et al., 2018; Koch et al, 2016).
erschweren».
Definition von Psychoedukation
enhafte und pseudowissenschaftliche Überzeugungen (»Handbuch der Psychoedukation«; Bäuml, Pitschel-
verfestigen, die dann oft jahrelang die professionelle Walz et al., 2016)
Behandlung unnötig erschweren. Deshalb ist eine
strukturierte und didaktisch gut aufbereitete Psy- »Unter dem Begriff der PE werden systematische didakt-
choeduktation (PE) sehr wichtig, trotz und vielleicht isch-psychotherapeutische Interventionen zusammen-
sogar wegen »Doktor Google«! gefasst, um Patienten und ihre Angehörigen über die
Krankheit und ihre Behandlung zu informieren, ihr
Krankheitsverständnis und den selbstverantwortlichen
Historischer Hintergrund der Psychoedukation Umgang mit der Krankheit zu fördern und sie bei der
Krankheitsbewältigung zu unterstützen…Die Wurzeln
Psychoedukation wird im deutschen Sprachgebrauch der PE liegen in der Verhaltenstherapie, wobei aktuelle
immer wieder missverständlich übersetzt als »erzie- Konzepte auch gesprächstherapeutische Elemente in
hen« statt »weiterbilden«. 1980 wurde von Anderson unterschiedlicher Gewichtung enthalten«.
im Kontext einer non-direktiven Aufklärung in Verbin-
dung mit Social-Skills-Training, Problemlösetraining und
Angehörigenberatung zur Verbesserung der basalen Psychoedukation und Adhärenz / Compliance
Kommunikationsfertigkeiten die PE eingeführt (Ander-
son et al., 1980). Bereits sehr früh konnte der Vorteil Die Einführung der Psychopharmaka seit den 1950er
dieser psychoedukativen, familienzentrierten Interven- Jahren führte in Kombination mit psychosozialen Thera-
tion in der Behandlung von Schizophrenie nachgewie- piemassnahmen zu deutlich besseren Behandlungser-
sen werden (Pitschel-Walz et al., 2001; Lincoln et al., gebnissen (Deutschenbaur et al., 2014; Huhn et al.,
2007; Xia et al., 2011; Bäuml, Pitschel-Walz, 2020). 2014; Möller et al., 2018). Dennoch verspüren viele
Patienten und oft auch deren Angehörige eine intuitive
Skepsis gegenüber Medikamenten. Daraus resultieren
Begegnung auf Augenhöhe: Wissensvorsprung der Non-Complianceraten von 30–90% (Hamann et al.,
Profis ausgleichen 2020; Bäuml et al., 2012; Vauth, Stieglitz, 2017). Die ini-
tial hervorragende neuroleptische Response von 75–
Der Dialog/Trialog auf »gleicher Augenhöhe« geriete 85% bei Schizophrenie wird durch die schleichende
zur Farce, wenn der natürliche Wissensvorsprung der Malcompliance verspielt angesichts einer dramatisch
professionellen Helfer bezüglich psycho-physiologischer zunehmenden Nonadhärenz von 50% im ersten und
Fakten und den sich daraus ergebenden Behandlungs- 75% im zweiten Behandlungsjahr. Deshalb muss im
konsequenzen nicht bearbeitet würde. PE versteht sich geduldigen interaktiven Dialog ein kleinster gemeinsa-
als Brückenschlag zwischen dem objektiven professio- mer Nenner erarbeitet werden, um die wirkungsvolle
nellen »Know-how« und dem subjektiven »So now?« Kombination aus pharmakotherapeutischen und psy-
8chosozialen Hilfen in Gang zu setzen und auch langfris-
tig aufrecht zu erhalten (Tab. 1) (Bäuml, Pitschel-Walz
et al., 2016). Engagierte Angehörige fordern mittler-
weile auch ein „Recht auf Behandlung“ ein, wenn dies
die Patienten krankheitsbedingt nicht mehr schaffen
sollten (Bäuml, 2021).
Tabelle 1: Ziele der Psychoedukation Tabelle 3: Spezifische Wirkfaktoren der PE (nach Bäuml, Pitschel-Walz et al., 2016)
Curricularer Aufbau der Psychoedukativen Gruppen
Zentrale Elemente der Psychoedukation und Wirkfaktoren
Die inhaltlichen Schwerpunkte und ihre curriculare
Unbedingte Wertschätzung, empathisches Eingehen Staffelung können Tabelle 4 entnommen werden.
auf die Teilnehmer sowie Echtheit und Selbstkongruenz
der Therapeuten sind selbstverständlich. Durch bedürf-
nis- und ressourcenorientiertes Vorgehen soll den
Menschen bildungsunabhängig die angstfreie Diskus-
sion über ihre Erkrankung ermöglicht werden.
Die interaktive Informationsvermittlung muss stets mit
einer situationsadäquaten emotionalen Entlastung ein-
hergehen (Tab. 2), da viele Fakten zunächst als »Zumu-
tung und Kränkung« empfunden werden können
(»schizophrene Psychose«, »affektive Minderbelas-
tung«, „Persönlichkeitsstörung“ etc.). Die unsensible
Konfrontation mit den negativen Auswirkungen der
Erkrankung kann mit erhöhter Suizidalität einhergehen
(Massons et al. 2017). Die Vermittlung von Störungs-
wissen sollte immer mit der Erarbeitung von hilfreichen
Bewältigungsstrategien einhergehen, um Ängste zu
reduzieren und der Selbststigmatisierung (Cavelti et al.,
2012) entgegenzuwirken. Tabelle 4: Curriculum mit Themenschwerpunkten der PE-Gruppen bei Schizophre-
nie für Patienten und Angehörige (nach Bäuml, Pitschel-Walz et al., 2010/2016)
Praktische PE-Veranschaulichung der »zweigeteilten Wirk-
lichkeit« in eine »allgemeine« und eine »private« wäh-
rend einer akuten Psychose
»Viele Patienten wehren sich zu Recht gegen die Unterstel-
lung, während einer Psychose sei man total „ver-rückt“. Die
meisten haben sehr wohl auch während der akuten Erkran-
kung viele gesunde Anteile und können wesentliche Belange
ihres Lebensalltages, ihrer „allgemeinen“ Wirklichkeit, gut
bewältigen.
So ist es durchaus möglich, dass sie mit Freunden über einen
Zeitungsartikel diskutieren und durch ihre Belesenheit und
Tabelle 2: Zentrale Elemente der Psychoedukation guten Argumente Respekt und Anerkennung erfahren („all-
gemeine Wirklichkeit“).
Die partnerschaftliche Begegnung mit den Patienten Und gleichzeitig kann es für die Patienten in ihrer parallel
und der respektvolle Umgang mit von der Schulmedizin existierenden „privaten Wirklichkeit“ ganz logisch sein, diese
abweichenden Meinungen werden als wesentliche Zeitung anschliessend ins Zimmer mit zu nehmen um einen
»Wirkfaktoren« betrachtet. Ziel ist die Erarbeitung Schutzwall zu errichten, der gegen die Strahlen aus der
eines funktionellen Krankheitskonzeptes auf der Basis Nachbarwohnung schützen soll, die sie deutlich spüren.
des Vulnerabilitäts-Stress-Bewältigungs-Modells als Da helfen meistens keine Beschwichtigungen und keine
kleinstem gemeinsamen Nenner mit der Kombination guten Ratschläge. So lange der überhöhte Dopaminspiegel
von professionellen Therapieverfahren und individuel- nicht ausreichend korrigiert wird, kann man als Betroffener
len Selbsthilfestrategien. Für die Einbeziehung von die Fremdartigkeit dieser „privaten‹ Realität nicht erkennen,
Angehörigen gibt es praktisch keine Kontraindikationen. die wirkt für sie total „normal und logisch“…«
9Wirksamkeit der Psychoedukation bei Angehörigen Fazit
Ausgehend von den Therapiestudien von Goldstein et Aus psychiatrisch-psychotherapeutischer Sicht ist die
al. (1978) wurden vor dem Hintergrund des Vulnerabili- frühzeitige und intensive Einbeziehung der Angehöri-
täts-Stress-Bewältigungsmodells schizophrener Psycho- gen sowohl in die Akut- als auch in die Langzeitbehand-
sen (Nuechterlein u. Dawson, 1984) eine Vielzahl psy- lung ein wesentlicher Garant für eine erfolgreiche
choedukativer Interventionen für Angehörige Behandlung und sollte flächendeckend realisiert wer-
entwickelt. Neben den »klassischen« Formen mit den.
Behandlung der Familie unter (nicht immer ständigem)
Einbezug des Patienten (Falloon et al., 1982) sind dies Damit sie ihrer wichtigen Funktion sowohl als „Kothera-
multiple Familientherapiegruppen, z. T. mit Patienten- peuten“ auf dem Weg zur besten Behandlung als auch
teilnahme (Berger, Friedrich, Gunia, 2004/2016; McFar- freundschaftliche Begleiter in allen schwierigen Zeiten
lane et al., 1995), und die therapeutische Gruppenar- gewachsen sind, brauchen sie eine intensive PE-Basis-
beit mit Angehörigen ohne Einbezug der Patienten schulung in Sachen Erkrankung und Behandlung. Dies
(Buchkremer et al., 1995 a, b; Cassidy et al., 2001). Die verleiht Kraft und Stärke mit dem Gefühl, stets auf dem
bifokale Gruppenarbeit besteht aus Angehörigen- und neuesten Stand des aktuellen Wissens zu sein und in
parallel dazu stattfindenden PE-Patientengruppen der Gruppe durch den regelmässsigen Erfahrungsaus-
(Bäuml et al., 2010/2016; Behrendt et al., 2004; Lewan- tausch mit den anderen Betroffenen Rückhalt und
dowski u. Buchkremer, 1988; Kissling et al., 1995). Neu emotionale Entlastung zu finden. Das sind die denkbar
ist der Einsatz von Angehörigen als Peer-to-peer-Grup- besten Voraussetzungen für einen möglichst gelingenden
penleiter (Rummel et al., 2005/2013). Angehörigenar- Genesungsverlauf der Erkrankten.
beit in der Schizophreniebehandlung hat neben der
rückfallverhindernden Wirkung günstige Effekte auf das Was würden sich Angehörige mehr wünschen?
Ausmasss an Expressed Emotions (EE), beeinflusst das
Familienklima positiv und führt zu einer Verringerung
von Stress und Belastung der Angehörigen (Bruns u. Prof. Bäuml war bis 2018 Lei-
Hornung, 1998; Glauser et al, 2021). tender OA in der Klinik für Psy-
chiatrie und Psychotherapie
PE-Programme für Familien sind sehr gut evaluiert (Pit- des Klinikums rechts der Isar
schel-Walz et al., 2001). Geringere Rückfallraten, bes- der TU München mit den wis-
sere Erholung der Patienten und familiäre Interaktion senschaftlichen Schwerpunk-
(McFarlane et al, 2003), v.a. bei bifokalen – Angehörige ten Psychoedukation, Angehö-
und Patienten in jeweils eigenen Gruppen - PE-Inter- rigenarbeit, Langzeittherapie
ventionen (Buchkremer u. Hornung, 1995; Bäuml, Pit- bei Menschen mit Psychosen
schel-Walz et al., 2007/2015) mit signifikant besserem aus dem schizophrenen For-
5-7-Jahresverlauf (Hornung et al. 1996a; Bäuml et al, menkreis sowie sozialpsychiat-
2007a). rische Feldforschung zu woh
nungslosen Menschen mit seelischen Erkrankungen
Positive Kosteneffektivität (Breitborde et al., 2009; (SEEWOLF-Studie).
Bäuml et al., 2010). In den S-3-Leitlinien hat die PE von Seit 20 Jahren leitet er zusammen mit Dr. Berger das
Patienten wie Angehörigen mittlerweile das Level „A“ D Münchner Psychose-Seminar am Klinikum rechts der
(„soll“!) (Hasan et al, 2019; Gühne, Riedel-Heller, Isar, aus dem 2020 die trialogische Publikation der „Psy-
2019). cho-Tisch“ hervorging. Kontakt: Baeuml.Josef@tum.de
Darüber hinaus gibt es einige Studien, die zeigen, dass Priv.-Dozentin Dr. rer. biol.
PE-Programme für Angehörige von Patienten mit ande- hum. Gabriele Pitschel-Walz
ren Diagnosen wie z.B. Depressionen (Shimazu et al., ist Leitende Psychologin an
2011), bipolaren Störungen (Reinares et al., 2004; Gex- der Klinik und Poliklinik für
Fabry et al. 2015; Hubbard et al., 2016) oder Borderline Psychiatrie und Psychothera-
Persönlichkeitsstörungen (Sutherland et al., 2020) den pie der TU München, Klini-
Angehörigen nützliches Wissen vermitteln und zu ihrer kum rechts der Isar (Foto: Kli-
emotionalen Entlastung beitragen können. nikum rechts der Isar)
Kontakt:
Psychose-Seminare und Selbsthilfestrategien gabriele.pitschel-walz@tum.de
Die von Thomas Bock und Dorothea Buck 1989 ins
Leben gerufenen Psychose-Seminare (Bock, et al., Literaturverzeichnis
1994) stellen nach dem Verständnis der DGPE (Deut- Amaresha AC, Kalmady SV, Joseph B, Agarwal SM, Narayanas-
sche Gesellschaft für PE) eine ideale Ergänzung und wamy JC, Venkatasubramanian G, Muralidhar D, Subbakrishna
Fortführung der PE-Behandlungsphilosophie dar DK (2018) Short term effects of brief need based psychoeduca-
(Bäuml et al., 2007b /2020). Auf dem Boden eines gesi- tion on knowledge, self-stigma, and burden among siblings of
cherten Wissens können die Betroffenen und deren persons with schizophrenia: A prospective
Angehörige von einer informierten Warte aus selbstbe- controlled trial. Asian J Psychiatr.; 32:59–66. doi: 10.1016/j.ajp.
2017.11.030. Epub 2017 Dec 2.
wusst in den Trialog mit anderen Betroffenen, Angehö-
rigen und auch Profis treten, um ihr persönliches Erfah- Anderson CM, Gerard E, Hogarty GE, Reiss DJ (1980) Family
rungswissen mit den Erlebnissen anderer abzugleichen treatment of adult schizophrenic patients: A psycho-educational
und zu erweitern. approach. Schizo Bull; vol. 6, no, 3: 490–505
10Bäuml J, Froböse T, Kraemer S, Rentrop M, Pitschel-Walz G (2006) Hubbard AA, McEvoy PM, Smith L, Kane RT. Brief group psychoeduca-
Psychoeducation: A basic Psychoth. Intervent. of patients with schizo- tion for caregivers of individuals with bipolar disorder: A randomized
phrenia and their families. Schizo Bull; Vol. 32; S1: 1-9 controlled trial. J Affect Disord. (2016) 200:31–6. doi: 10.1016/j.jad.
2016.04.013
Bäuml J, Pitschel-Walz G, Volz A, Engel R, Kissling W (2007a) Psy-
choeducation in schizophrenia: Rehospitalisation and hospital days – Huhn M, Tardy M, Spineli LM, Kissling W, Förstl H, Pitschel-Walz G,
7 year follow-up of the Munich Psychosis Information Project – study. Leucht C, Samara M, Dold M, Davis JM, Leucht S (2014) Efficacy of
J Clin Psychiatry; 68: 854–861 pharmacotherapy and psychotherapy for adult psychiatric disorders:
a systematic overview of meta-analyses. JAMA Psychiatry; 71(6):706–
Bäuml J, Berger H, Mösch E, Pitschel-Walz G (2007b) Psychose-Semi- 15
nar. In: Becker T, Bäuml J, Pitschel-Walz G, Weig W (Hrsg.) Rehabilita-
tion bei schizophrenen Erkrankungen. Deutscher Ärzteverlag, Köln. S Khalil AH, ELNahas G, Ramy H, Abdel Aziz K, Elkholy H, El-Ghamry R
271–292 (2018) Impact of a culturally adapted behavioural family psychoedu-
cational programme in patients with schizophrenia in Egypt. Int J Psy-
Bäuml J (2008) Psychosen aus dem schizophrenen Formenkreis. Ein chiatry Clin Pract.1–10. doi: 10.1080/13651501.2018.1480786. [Epub
Ratgeber für Patienten und Angehörige. Zweite Auflage. Springer- ahead of print]
Verlag. Heidelberg.
Koch E, Assion H-J, Bender M (2016) Psychoedukation und Migration.
Bäuml J, Pitschel-Walz G, Berger H, Gunia H, Juckel G, Heinz A (2010) In: Bäuml J, Behrendt B, Henningsen P, Pitschel-Walz G (Hrsg.) Hand-
Arbeitsbuch PsychoEdukation bei Schizophrenie (APES) Schattauer- buch der Psychoedukation für Psychiatrie, Psychotherapie und Psy-
Verlag, Stuttgart. chosomatische Medizin. Schattauer-Verlag, Stuttgart: 551-530
Bäuml J, Baumgärtner J, Froböse T, Gsottschneider A, Keller Z, Lincoln T M, Wilhelm K, Nestoriuc Y, Lincoln T M, Wilhelm K, Nesto-
Lüscher S, Scherr M, Pitschel-Walz, Jahn T (2012) Partizipationsver- riuc Y (2007) Effectiveness of psychoeducation for relapse, symptoms,
halten schizophren erkrankter Patienten in Psychoedukationsgrup- knowledge, adherence and functioning in psychotic disorders: a
pen: Erste Ergebnisse mit dem Teilnahmequalitätsbogen. Psychothe- meta-analysis. Schizophrenia Research; (96): 232–245
rapeut, Vol. 57; 4: 301–312
Massons C, Lopez-Morinigo JD, Pousa E, Ruiz A, Ochoa S, Usall J,
Bäuml J, Behrendt B, Hennigsen P, Pitschel-Walz P (Hrsg.) (2016) Nieto L, Cobo J, David AS, Dutta R (2017) Insight and suicidality in psy-
Handbuch der Psychoedukation für Psychiatrie, Psychotherapie und chosis: A cross-sectional study. Psychiatry Res. 252:147–153
Psychosomatische Medizin. Schattauer-Verlag, Stuttgart
Möller HJ, Laux G, Kapfhammer HP (2018) (Hrsg.) Psychiatrie, Psycho-
Bäuml J, Pitschel-Walz G (2020) Psychoedukation und Angehörigen- somatik, Psychotherapie. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg
arbeit bei Schizophrenie. Psych up2date,14; Thieme-Verlag, Stuttgart:
111-124 Pitschel-Walz G, Bäuml J (2018). Psychoedukative Gruppen. Kerbe –
Forum für Soziale Psychiatrie 3: 31–34
Bäuml J (2020) Psychoedukation und Psychose-Seminar: Zwei Seiten
der gleichen Medaille? In: Berger H, Bechmann P, Dehimi V, Devalerio Pitschel-Walz G, Leucht S, Bäuml J, Kissling W, Engel RR (2001) The
K, Bäuml J (Hrsg.) Psycho-Tisch. Pabst-Verlag, Lengerich: 248-260 effect of family interventions on relapse and rehospitalization in schi-
zophrenia – A meta-analysis. Schizophr Bull; 27, 1: 73–92
Bäuml J, Maurus I, Wagner A, Flissakowski O, Benta R, Lüscher S, Pit-
schel-Walz G, Jahn T (2021) Der Stellenwert der Angehörigen in der Reinares M, Vieta E, Colom F, Martínez-Arán A, Torrent C, Comes M,
psychiatrisch-psychotherapeutischen Behandlung aus Sicht der Profis et al. Impact of a psychoeducational family intervention on caregivers
und Angehörigen. In Vorbereitung of stabilized bipolar patients. Psychother Psychosom. (2004) 73(5):
312–9. doi: 10.1159/000078848 Shimazu K, Shimodera S, Mino Y et
Bock Th, Deranders JE, Esterer I (1994) Im Strom der Ideen. Stimmen- al. (2011). Family psychoeducation for major depression: randomized
reiche Mitteilungen über den Wahnsinn. Psychiatrie-Verlag, Bonn controlled trial. Br J Psychiatry 198(5): 385-390.
Cavelti M, Kvrgic S, Beck EM, Rüsch N, Vauth R (2012) Self-stigma and Sutherland R, Baker J, Prince S. Support, interventions and outcome
its relationship with insight, demoralization, and clinical outcome for families/carers of people with borderline personality disorder: A
among people with schizophrenia spectrum disorders. Compr Psychi- systematic review. Personal Ment Health. (2020) 14:199-214. doi:
atry. 53(5):468–79 10.1002/pmh.1473
Deutschenbaur L, Lambert M, Walter M, Naber D, Huber CG (2014) Taipale H, Rahman S, Tanskanen A, Mehtälä J, Hoti F, Jedenius E,
Pharmakologische Langzeitbehandlung schizophrener Erkrankungen. Enkusson D, Leval A, Sermon J, Tiihonen J, Mittendorfer-Rutz E (2020)
Nervenarzt; 85: 363–377 Health and work disability outcomes in parents of patients with schi-
Gex-Fabry M, Cuénoud S, Stauffer-Corminboeuf M-J, Aillon N, Per- zophrenia associated with antipsychotic exposure by the offspring.
roud N, Aubry J-M. Group psychoeducation for relatives of persons Scientific Reports 10:2019 I https://doi.org/10.1038/
with bipolar disorder: Perceived benefits for participants and patients. s41598-020-58078-4
J Nerv Ment Dis. (2015) 203(9):730-4. doi: 10.1097/NMD.
0000000000000355 Tarrier N, Barrowclough C, Porceddu K, Fitzpatrick E (1994) The Sal-
ford Family Intervention Project: relapse rates of schizophrenia at five
Glauser S et al (2021) Angehörigenarbeit in der Psychiatrie. Ich-Du- and eight years. Br J Psychiatry; 165: 829–832
Wir-Zeitschrift. Bern. In Vorbereitung
Xia J, Merinder LB, Belgamwar MR (2011) Psychoeducation for schi-
Gühne U, Riedel-Heller S (2019) S-3-Behandlungsleitlinie: Psychosozi- zophrenia. Cochrane Database Syst Rev (Issue 6 Art. No.: CD002831);
ale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen. Springer-Ver- DOI: 10.1002/14651858.CD00 2831.pub2
lag, Heidelberg
Vauth R, Stieglitz RD (2017) Behandlungsbereitschaft bei Menschen
Hamann J, Heres S (2020) Why and How Family Caregivers Should mit schizophrenen Störungen nachhaltig aufbauen. Zeitschrift für Psy-
Participate in Shared Decision Making in Mental Health. Psychiatric chiatrie, Psychologie und Psychotherapie; 65 (2): 73–82
Services; Vol. 70; I5: 418-421
Zhao S, Sampson S, Xia J et al (2015) Psychoeducation (brief) for
Hasan A, Falkai P, Gaebel W (20219) S-3-Behandlungsleitlinie Schizo- people with serious mental illness.
phrenie. Springer-Verlag, Heidelberg Cochrane Database Syst Rev (Issue 4. Art. No.: CD010823); DOI:
0.1002/14651858.CD010823.pub2
Hornung P, Feldmann R, Klingberg S, et al. (1999) Long-term-effects
of a psychoeducational psychotherapeutic intervention for schizo- Zubin J, Spring B (1977) Vulnerability: A new view of schizophrenia.
phrenic outpatients and their key-persons – results of a five-year fol- Journal of Abnormal Psychology; 86: 103–126
low-up. Eur Arch Psychiatry. Clinical Neuroscience; 249: 162–167
11Berger I Bechmann I Dehimi I De Valerio I Bäuml (Hrsg.)
BUCH
Psycho-Tisch
Psycho- Geschichten und Bilder aus dem Münchner
Psychose-Seminar
Tisch „Psycho-Tisch“ ist ein aussergewöhnliches Buch mit Bil-
dern und Texten, die Einblicke in die Welt psychischer
Ausnahmezustände gewähren. Es versammelt authenti-
sche Geschichten und Gedichte, die so verschieden sind,
wie die 37 Autorinnen und Autoren dieses Buches.
Was empfindet ein Lehrer, der mit seiner Ente vor einem
vermeintlichen Geheimdienst flüchtet? Was passiert,
wenn einer nachts auszieht, Papst zu werden? Wie geht
es einem Professor der Psychiatrie, dessen Gespräch mit
der Familie vom paranoid erkrankten Patienten heimlich
mitgeschnitten wird? Was schreiben fünf Betroffene in
Gedichten über ihr ambivalentes Verhältnis zu Medika-
menten?
Auf über 300 Seiten werden mutige, komische, erhel-
lende, bittere, informative und wissenschaftliche Texte
Geschichten auf dem „Psycho-Tisch“ ausgebreitet. Bilder und Foto-
grafien von Künstlerinnen und Künstlern bereichern das
und Bilder Buch um eine weitere Dimension. Was alle Beteiligte
verbindet, ist die Erfahrung einer Psychose – als Erle-
aus dem bende, Behandelnde oder Angehörige.
Münchner Lassen Sie sich anstecken, vom Mut und der Offenheit
Psychose-Seminar der Autorinnen und Autoren des Münchner Psychose-
Seminars, die durch ihre Kreativität einen besonderen
Beitrag zur Inklusion leisten.
BUCH
Handbuch der Psychoedukation
Therapeutische Interventionen sind umso wirksamer, je
besser sich die Patienten von den Behandlern verstan-
den fühlen – und je besser sie selbst ihr Krankheitsbild
und ihre Behandlung verstehen. Die hohe Relevanz von
Psychoedukation für das Krankheitsverständnis von Pati-
enten und Angehörigen und damit letztlich für die
Salutogenese wird immer offensichtlicher. Dieses Hand-
buch vermittelt das notwendige Wissen dazu: Führende
Experten beschreiben, welche psychoedukativen Kon-
zepte bei unterschiedlichen psychischen, psychosomati-
schen und medizinischen Beschwerden zur Verfügung
stehen – von affektiven Erkrankungen und Psychosen
aus dem schizophrenen Formenkreis über psychische
Verhaltensauffälligkeiten bis hin zu neurologischen und
besonders häufigen somatischen Krankheitsbildern.
Neben den wichtigsten Fakten zu den einzelnen Erkran-
kungsbildern wird jeweils dargestellt, welche Manuale
für Patienten und Angehörige es gibt und wie der Thera-
peut psycho-didaktisch am besten vorgehen kann. Plasti-
sche Interaktionsszenen zeigen, wie Psychoedukation in
der Praxis gelingen kann.
Dabei kommen viele psychoedukative Basics zur Spra-
che: Wie wecke ich das Interesse an der Auseinanderset-
zung mit der Erkrankung? Wie dolmetsche ich kompli-
ziertes Krankheitswissen? Wie vermittle ich Hoffnung
und Mut auch bei chronischem Verlauf?
12BUCH
Wie ein Kinderbuch ensteht
Anna Gabriel Lanz und Cynthia Steiner-Berger im Inter-
view mit Tobias Furrer
NIKI und der lange Schal, so heisst das Kinderbuch zum
Thema elterliche Angststörung der beiden Psychomoto-
riktherpeutinnen Anna Gabriel Lanz und Cynthia Stei-
ner-Berger. «Es ist nie zu früh um mit Psychoedukation
zu starten»: so Steiner-Berger im Interview. Kinder
erkennen unterbewusst was es mit ihrer eigenen Situa-
tion zu tun hat und dürfen doch mit der Geschichte
etwas Abstand nehmen und müssen nicht die ‘Ich’-
Position einnehmen und von sich erzählen. Das Buch ist
jedoch nicht nur für Kinder im Kindergarten geeignet.
Niki steht bereits in Bücherregalen von Kinderheimen,
Schulen, bei Psychotherapeuten, Grosseltern und bei
vielen Kinder zuhause im Bücherregal. Lanz hat auch
die Rückmeldung bekommen, dass es für Erwachsenen CSB: Wir beide lieben schöne Kinderbücher und allge-
spannend ist, da psychische Krankheiten nicht fassbar mein Bücher. Es ist etwas zum anfassen und die Kinder
sind und die Sprache in Kinderbüchern Bilder entstehen haben etwas in der Hand. Auf der letzten Seite haben
lassen. «Bei einer Lesung mit Eltern, der Lehrerschaft wir auch ein psychomotorisches Element eingebaut,
und Kinder bis zur sechsten Klasse war es spannend das Kind kann mitwirken und helfen den Schal tatsäch-
welche Fragen, dass da kamen. Es konnte gut ein lichabzulegen.
Schwenker zu allen psychischen Erkrankungen gemacht
werden» erzählt Steiner-Berger.
Wie ist die Geschichte von NIKI entstanden?
Was hat euch zu diesem Buch bewogen? AGL: Als Erstes, haben wir viele andere Psychoedukati-
onsbücher studiert, um zu verstehen, wie die Themen
Anna Gabriel Lanz: Unsere Dozentin, Rut Brunner Zim- vermittelt werden. Da uns die Eigenschaften eines Eich-
mermann, welche auch Kinderpsychologin ist, hat uns hörnchens gefallen haben, entschieden wir uns für die-
über das Thema Psychoedukation informiert. Als es im ses sympathische Tierchen welches mutig von einem
Jahr 2017 dann um unsere Bachelorarbeit in unserem Ast zum anderen hüpft sich jedoch auch ganz schüch-
Psychomotorikstudium ging, haben erste Recherchen tern hinter dem Baum vor uns Menschen versteckt und
ergeben, dass es noch kein Buch über Angststörungen voller Bewegungsfreude wieder hinter dem Baum her-
gibt, das hat uns motiviert die Lücke zu füllen. vor blinzelt. Diese Bewegungsfreude wurde jedoch
durch Mamma’s Angst stark behindert. Wir wollten
Cynthia Steiner-Berger: Angststörungen sind häufig und symbolisieren, wie sich die Krankheit der Mutter auf
passen gut zu unserem Arbeitsalltag als Psychomotorik- andere Familienmitglieder, vorallem auf Kinder auswir-
therapeutinnen. Kinder welche Psychomotorik benöti- ken kann. Wie die Geschichte genau entstanden ist,
gen, haben nicht selten Eltern welche ängstlich sind können wir nicht mehr genau sagen. Es war ein
und den Kindern wenig Möglichkeiten geben etwas gemeinsamer Prozess.
auszuprobieren.
CSB: Obwohl es ein recht schweres Buch ist, wollten wir
auch schöne Szenen mit der Mutter zeigen. Die Mutter
Heute gibt es so viele tolle Medien wie Trickfilm und ist an sich nicht Böse, die Angststörung lässt die Situa-
Apps, weshalb habt ihr euch für ein gedrucktes Buch tion so schwierig werden.
entschieden?
AGL: Wir haben drei Szenen gewählt welcher Niki ein-
AGS: Wir haben über die Bedeutung von Bilderbüchern geschränkt wurde. Um möglichst
recherchiert und wurden in unserer Entscheidung viele Anknüpfungspunkte für die Kinder zu bieten,
bestätigt. Mit einem Buch kann man sich als Erwachse- haben wir bei jedem Mal eine andere Perspektive
ner dem Tempo des Kindes viel besser anpassen. Einige gewählt, in welcher die Lesenden immer näher ans
Seiten können etwas länger betrachtet werden und Schicksal von Niki kommen. Wer ganz genau
man kann in der Geschichte vor und zurück springen. schaut sieht, die Kindergärtnerin (Frau Dachs) ist
Beim Erzählen eines Buches kann man mit dem Kind jedoch immer irgendwo mit einem wachsamen
interagieren und der Raum für Fragen bleibt offen. Mit Auge dabei.
einem Film ist das Kind etwas alleine gelassen.
CSB: Im Prozess gab es auch Tage welche uns nicht wei-
terbrachten und dann plötzlich ist uns die Idee gekom-
«Beim Erzählen eines Buches kann man mit dem Kind men. So zum Beispiel bei Frau Eule, welche die Psycho-
interagieren und der Raum für Fragen bleibt offen.» login darstellt, war es für uns ganz logisch, dass dieses
weise Tier die Helferin in der Not ist.
13Sie können auch lesen