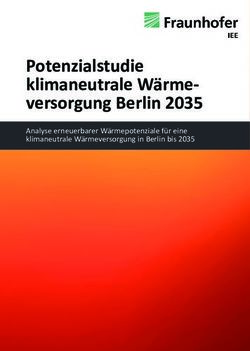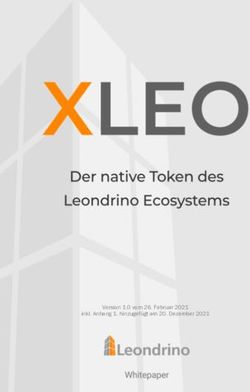Konfektion und Repression - Das Schicksal jüdischer Unternehmer im Nationalsozialismus auf dem Areal des heutigen Dienstsitzes des Ministeriums - BMJV
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
MINISTERIUM UND GESCHICHTE Konfektion und Repression Das Schicksal jüdischer Unternehmer im Nationalsozialismus auf dem Areal des heutigen Dienstsitzes des Ministeriums
Übersichtsplan von Berlin, Bl. III A Städtisches Vermessungsamt, Stich, Druck und Verlag Geographisches Institut Julius Straube, Berlin 1908, LAB F Rep. 270, A 2012. Titelbild Berlinerinnen begutachten die neue Frühjahrsmode in einem Schaufenster in Berlin, 1932. Foto: Timeline Classics
Konfektion und Repression Das Schicksal jüdischer Unternehmer im Nationalsozialismus auf dem Areal des heutigen Dienstsitzes des Ministeriums
5
Das Bundesministerium der Justiz und Mit dieser Studie wollen wir das
für Verbraucherschutz hat seinen Andenken an die vertriebenen
Sitz im einstigen jüdischen Konfektions- und ermordeten Menschen pflegen
viertel von Berlin. Dieses Viertel gab und uns der Verantwortung für die
es solange, bis die Nazis die Betriebe erst Gegenwart stellen. Es gibt kein Ende
enteignet und dann die Unternehmer der Geschichte. Auch heute gibt es
ermordet haben. Gefahren für Humanität und Freiheit.
Das Wissen um die Geschichte kann
Unser Ministerium steht im Dienst von unsere Sinne dafür schärfen, wenn
Recht und Gerechtigkeit. Wer heute Menschenrechte und Rechtsstaatlich-
in diesem Haus arbeitet, sollte deshalb keit wieder in Frage gestellt werden.
wissen, welches Unrecht den Menschen
geschehen ist, die früher am gleichen
Ort tätig waren.
Wir haben deshalb die Humboldt-Uni- Christine Lambrecht, MdB
versität gebeten, die Geschichte unseres Bundesministerin
Gebäudes und das Schicksal seiner der Justiz und für Verbraucherschutz
Bewohnerinnen und Bewohner zu
erforschen. Mein Dank gilt Dr. Christoph
Kreutzmüller, Eva-Lotte Reimer und
Prof. Dr. Michael Wildt für die Studie,
die wir mit dieser Broschüre der Öffent-
lichkeit vorstellen.7 0 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Jüdische Unternehmen zwischen Mohren-, Kronen- und Jerusalemer Straße . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Die Frühphase der Verfolgung (1933) Graumann & Stern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Die „Nürnberger Gesetze“ (1935) Max Behrendt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Die Radikalisierung der Verfolgung (1937/38) Karl Leissner, Ernst Loepert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Der Novemberpogrom (1938) Wolf & Schlachter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Flucht – Nach Shanghai (1938/39) Familie Salomon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Die Deportationen (ab 1941) Charlotte Baehr, Sally Fraenkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Die Textilindustrie im Krieg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 Entschädigung und Rückerstatung(1945–heute) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Literatur, Quellen, Archive & Einzelnachweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Einleitung
Der auf den Grundmauern des ehemali- Bundesministeriums zur Aufgabe ge-
gen Stadtgefängnisses angelegte Haus- zwungen. Insgesamt wurden mindestens
vogteiplatz war bis zum Zweiten Welt- neun Betriebe in den Besitz von Nicht-
krieg das unbestrittene Zentrum der Juden überführt, 50 wurden liquidiert. 1
deutschen Modewelt – und ein Ort von
internationaler Ausstrahlung. Viele der Während viele Konfektionäre, auch dank
bekannten Konfektionshäuser wurden ihres internationalen Renommees,
von Unternehmern geführt, die jüdisch emigrieren konnten, wurden andere
waren oder auch von den National- von den Nationalsozialisten verschleppt
sozialisten als Juden betrachtet wurden. und ermordet. Das Reichsjustizminis-
Allein auf dem Areal des heutigen terium flankierte den arbeitsteilig
Dienstsitzes des Bundesministeriums durchgeführten Massenmord mit
der Justiz und für Verbraucherschutz Gesetzesinitiativen.
(BMJV) befanden sich nachweislich
neunundfünfzig [!] jüdische Betriebe. Die vorliegende Broschüre entstand im
Auftrag des Bundesministeriums der
Ab 1933 wurden diese Betriebe von den Justiz und für Verbraucherschutz. Sie
Nationalsozialisten, ihren Helfern und verfolgt das Ziel, die konkreten Schick-
Claqueuren, durch gewalttätige Blocka- sale der jüdischen Unternehmen und
den und Boykotte angegriffen und mit Unternehmer im Gebäude des heutigen
einer Flut von Verordnungen und Geset- Dienstsitzes des Ministeriums aufzu-
zen behindert. Zwar konnten einige über zeichnen und so dem Vergessen zu
das Auslandsgeschäft zunächst Einbußen entreißen. Angesichts der erstaunlichen
im Inland kompensieren, spätestens Fülle von Firmen haben wir uns im
nach dem Pogrom im November 1938 Sinne der Lesbarkeit dazu entschieden,
wurden aber alle jüdischen Gewerbetrei- vor allem einzelne Schicksale, die
benden auf dem Areal des heutigen besonders aussagekräftig und spannend9
waren, exemplarisch zu entfalten und auch Akten des Archivs des Bundesamtes
sie in die Phasen der Vernichtung der für zentrale Dienste und offene Ver-
jüdischen Gewerbetätigkeit einzubetten. mögensfragen ausgewertet. Für die
Unser Anspruch ist dabei, aufzuzeigen, individuellen Schicksale der jüdischen
dass die jüdischen Konfektionäre sich – Verfolgten waren Akten der Entschädi-
oft mit Verve und manchmal sogar mit gungsbehörde Berlin von besonderer
Erfolg – gegen die Verfolgung zu be- Bedeutung, ebenso wie die Findmittel
haupten suchten. und Bestände der Stiftung Warburg
Archiv (Hamburg), des Archivs der
Ausgangspunkt der Recherchen war die Gedenkstätte Yad Vashem (Jerusalem),
Datenbank jüdischer Gewerbebetriebe der Central Archives for the History of
(DjGB), ergänzend wurden Akten des the Jewish People (Jerusalem) sowie der
Berliner Handelsregisters, die im Landes- Wiener Library (London).
archiv Berlin überliefert sind, Akten der
Berliner Wiedergutmachungsämter Dr. Christoph Kreutzmüller
(ebenfalls im Landesarchiv Berlin) sowie Eva-Lotte Reimer
– dank der Unterstützung des BMJV – Prof. Dr. Michael Wildt
Zwei Romane über den Hausvogteiplatz
1932 erschienen zwei Romane über das
Konfektionsviertel. In „Konfektion“ und
„Leute machen Kleider. Roman vom Haus-
vogteiplatz“ gaben die jüdischen Autoren
Werner Türk und Gustav Hochstetter, aus-
gehend von der Wirtschaftskrise, einen
ungeschminkten Einblick in den oft hek-
tischen Betrieb der Konfektionshäuser am
Hausvogteiplatz. Die Bücher wurden am
10. Mai 1933 auf dem heutigen Bebelplatz
verbrannt. Werner Türk gelang die Emigra-
tion nach Großbritannien, wo er 1986
verstarb. Gustav Hochstetter wurde in das
Ghetto Theresienstadt deportiert und
Umschläge der Romane „Konfektion“ von Werner
fiel dort 1944 den schrecklichen Lebensbe-
Türk und „Leute machen Kleider. Roman vom
dingungen zum Opfer.
Hausvogteiplatz“ von Gustav Hochstetter (beide:
Berlin, 1932).Signets jüdischer Unternehmer
Bildnachweise auf Seite 60Jüdische Unternehmen zwischen Mohren-, Kronen- und Jerusalemer Straße Der heutige Standort des BMJV umfasst die Grundstücke Mohrenstraße 36 bis 38, Kronenstraße 35 bis 41, und Jerusalemer Straße 24 bis 28. Auf diesem Gelände befanden sich um 1933 insgesamt 59 jüdische Gewerbebetriebe: Mohrenstraße 36 bis 38 36 / 37 • S. Binswanger Knopfgroßhandlung (1900–34) • Meyersohn & Tobias Seidenwaren (1902–38) • Max Behrendt Kostümröcke (1904–40) • Salomon & Kaminsky Damen- und Mädchenmäntel (1910–37) • Glaß & Graetz Damenmoden im besseren Genre (1911–40) • Wolf & Schlachter Damenbekleidung (1919–39) • Brüder Feige Damenmäntelfabrik (1920–38) • Graumann & Stern Damenmäntel und Kleider (1922–38) • Ahders & Basch Modellkollektionen (1928–38) • Walter Wachsner Damenkonfektion (1933–38) • Motü Modische Kleider und Blusen GmbH (1934–36) • Ernst Nußbaum Kleider (1936–39)
13 37 • Ella Lehmann GmbH, vorm. Conrad & Rogozinski Damensportbekleidung (1934–36) • Max Leissner, Einzelkaufmann, Inhaber (1935–39) 37 a • Simon Westmann Damen Konfektion & Trauer Magazin (1900–32) • Gebrüder Ries Textilwaren en gros (1920–40) • Hirsch & Süßkind Damenkonfektion (1923–39) • Ernst Plachta Pelzfabrikation (1926–39) • Georg Eichelgrün Damenmäntel (1927–33) • Paul Aschner Damenbekleidung (1933–35) • Lebram & Wallach Damenmäntel (1933–39) • Herbert Labandter Damenkleiderherstellung (1934–38) 38 • Sally Fraenkel Damenmäntel und Jacken (1901–34) Kronenstraße 35 bis 41 36 • Embeco Modische Bekleidungs-Kompagnie Abromeit & Huth Damen-Oberbekleidung (1901–39) • H. Kantorowicz & Co. Damenblusen, Kinderkleider (1902–39) • Max Frank jr. Futterstoffe (1905–39) • Hermann Schwersenzer Kleider und Blusen (1929–38) • Arthur Gadiel Kleiderkonfektionsfabrik (1934–37) • Heinrich Bielschowsky Damenmäntel (1934–38) • Ernst Loepert Damenbekleidung (1934–39) • Erwin Feder Damenmäntelfabrik (1937–40)
14
38 / 40
• Bibo & Jackier Damenmäntel (1902–38)
• Hugo Ivers Textilvertretungen (1903–39)
• Leonhard Wertheim Spezialfabrik für garnierte Kleider (1905–37)
• Adolf Wittkowski Schürzen und Jupons (1907–37)
• Berthold Hammel Damen- und Kinderbekleidung (1911–41)
• Arnold Frischmann Damenkonfektion (1913–39)
• Jakobowski & Cohen Damenkonfektion (1914–37)
• Sonnenfeld & Jaroczynski (1919–38)
• Gumpel, Rosenbach & Co. Damenmäntel-Fabrikation (1919–40)
• Treitel & Meyer Blusen und Kleider (1920–39)
• Lux & Co. Backfisch- und Knabenkonfektion (1921–39)
• Goldberg & Sander Damen- und Kinderbekleidung en gros (1922–38)
• Weinstein & Landauer AG (1932)
• Fritz Weil & Co. Damenbekleidung (1935–39)
• Philipp Gerber Blusen (1936–39)
41
• S. Jaraczewer Damenbekleidung Mittelgenre (1902–39)
• Lewinnek & Schönlank Mädchenmäntel en gros und Export (1910–40)
• Fließer & Rosenthal Damenkonfektion (1930–40)
• Hielscher & Co. Backfisch- und Damenmoden (1933–40)
• Erwin Leibke Bekleidung (1934–39)
• C. Neumann & Co. Damenkleiderfabrikation (1937–38)
Jerusalemer Straße 24 bis 28
24
• Max Süßkind & Co. GmbH Kostüme (1926–35)15
26
• Mendelsohn, Meyerhof & Co. Bernhard Mendelsohn Blusen und Kleider
(1934–36)
• B. Rosenberg & Co. Kleider, Blusen und Röcke (1934–39)
• A. Falkowitz & Co. Damenkonfektion (1935–40)
28
• Eugen Herzberg Agentur (1901–40)
• S. Rosenbaum Damenmäntel en gros (1902–38)
• Silberberg & Auerbach Besatzartikel (1910–36)
Eine Fotografie aus der jüdischen Bran- täglich „Mittag gegen 3 Uhr“ dieses
chenzeitschrift „Der Konfektionär“ vom Haus aufsuchten in der Hoffnung,
1. April 1930 zeigt vier Männer mit Aufträge zu erhalten. Überraschend ist
langen dunklen Mänteln, die Filzhüte die Bezeichnung der Wand als „Klage-
tragen und weiße Blätter an einen mauer“, laut Untertext handelte es sich
Pfeiler drücken. Das – inszenierte – Foto um „ein Stück der ‚Original-Klagemau-
wurde aus einigen Metern Entfernung er’ in Jerusalem“, das „vor kurzem nach
bei Tageslicht aufgenommen, scheinbar Deutschland überführt“ worden sei.
steht das Grüppchen links von einer
Hofeinfahrt. Wo das Bild aufgenom- Offensichtlich handelte es sich hierbei
men wurde, erfährt der Betrachter um eine Tatarenmeldung – wäre ein
durch die Überschrift: am Hausvogtei- Teil der Klagemauer tatsächlich aus
platz – mitten im Berliner Konfektions- Jerusalem nach Berlin verschifft und
viertel und in nächster Nähe des heuti- am Hausvogteiplatz aufgebaut worden,
gen Dienstsitzes des BMJV. Die hätte es wohl für mehr mediales Auf
Unterschrift konkretisiert den Ort: sehen gesorgt, als nur für diese Erwäh-
„Zwischen Hausvogteiplatz und Dön- nung in einer Branchenzeitschrift.
hoffplatz“ – das heißt in der Jerusale- Allerdings verrät das Ensemble von
mer Straße (s. Karte). Laut Bildunter- Überschrift, Bild und Bildunterschrift
schrift handelte es sich bei den viel: Es weist den Hausvogteiplatz als
Männern um „Textilvertreter“, die tag- einen Pilgerort der deutschen Mode-16
industrie aus. Jeder, der auf Aufträge Hausvogteiplatz außerdem als jüdischer
angewiesen war, musste dort auf Auf- Ort markiert. In Anbetracht der antise-
tragserteilungen hoffen, wo die Mode- mitischen Atmosphäre in Berlin 1930
firmen en masse angesiedelt waren. liegt es zunächst nahe, hinter dieser
Die trockene, ironisch wirkende Fest- Meldung Antisemitismus zu vermuten.
stellung, dass die Auftragszettel leer Allerdings gehörte die Zeitschrift dem
blieben, führt dem Betrachter die Verlag „L. Schottlaender & Co.“ in der
Wirtschaftskrise vor Augen, die sich Krausenstraße an, der ab 1933 von
natürlich auch in der Textilbranche Nationalsozialisten als jüdisch betrach-
niederschlug. Durch die Verwendung tet, im Laufe der 1930er-Jahre von
des Begriffes „Klagemauer“ wurde der Nicht-Juden übernommen wurde. 2
Eine Klagemauer am Hausvogteiplatz –
Ein Aprilscherz?
Zum Hausvogteiplatz pilgerten die
Zwischenmeister, um als Subunter
nehmer der bekannten Konfektions
häuser Aufträge zu erhalten. In der
vom jüdischen Verlag „L. Schottlaender
& Co.“ herausgegebenen Branchenzeit-
schrift wurde satirisch dargestellt, wie
schlecht die Auftragslage während der
Weltwirtschaftskrise 1930 war.
Artikel aus „Der Konfektionär“,
1. April 1930Die Frühphase der Verfolgung (1933) Trotz der antisemitischen Stimmung in betreiber Isidor Dobrin schmerzlich der deutschen Hauptstadt, mit ihren erfahren, dessen stadtbekannte Kondi- Straßenkämpfen zwischen KPD- und torei in der Jerusalemer Straße ver- NSDAP-Anhängern, zog es in den frühen wüstet wurde. 4 Nach betriebsinternen 1930er-Jahren viele jüdische Familien antisemitischen Angriffen starb aus der deutschen Provinz nach Berlin. Walther Rabow, der Sozius der bekann- Der offene Antisemitismus in kleinen ten Konfektionsfirma „Graumann & Gemeinden zwang viele Menschen dazu, Stern“ bereits im Januar 1931 an Herz- ihre Geschäfte aufzugeben und ein versagen. 5 neues Auskommen in der Metropole zu finden. In Berlin lebten ein Drittel der Die Machtübernahme der Nationalso- Juden in Deutschland und über die zialisten am 30. Januar 1933 bedeutete Hälfte der Juden aus Preußen. 3 Der (nicht nur) für jüdische Konfektionäre Hausvogteiplatz galt innerhalb Berlins gleichwohl eine Zäsur. Denn nun fielen als „jüdisches Viertel“, ebenso galt die letzte Hemmschwellen, verband sich Konfektionsindustrie als jüdisch. Anti- antisemitische Gewalt mit Verfolgungs- semitische Angriffe begannen dort nicht maßnahmen auf städtischer und staat- erst mit der Machtübernahme der licher Ebene. Wenn auch die „National Nationalsozialisten 1933, sondern sozialistische Betriebszellenorganisation“ können bereits für 1930 nachgewiesen (NSBO) in der Textilindustrie zahlen werden, als gewaltbereite NSDAP- mäßig nicht die gleiche Rolle wie etwa Anhänger nach der konstituierenden in Belegschaften von Gerichten oder Reichstagssitzung im Oktober 1930 Versicherungsanstalten spielte 6, gab es neben den Einkaufsstraßen Leipziger auch in Konfektionsbetrieben aktive Straße und Friedrichstraße auch im Nationalsozialisten, die sich in „Betriebs- benachbarten Konfektionsviertel randa- zellen“ organisierten und ihre jüdischen lierten und Geschäfte demolierten. Vorgesetzten (und Arbeitskollegen) terro- Dies musste zum Beispiel der Caféhaus- risierten. Stellten sie auch quantitativ
18
keine Mehrheit dar, sollte aus mikrohis- ehemalige Konfektionäre diesen Tag als
torischer Perspektive die Qualität ihrer Beginn der Verfolgungsmaßnahmen.
antisemitischen Aktionen in der Wahr- Bei dieser gewaltsamen Aktion im April
nehmung der jüdischen Unternehmer 1933 handelte es sich um einen ersten
und den daraus resultierenden Folgen Schritt zur „Vernichtung der jüdischen
nicht unterschätzt werden. Gewerbetätigkeit“. Der Begriff „Boykott“
bildet dabei die Realität nicht ab, die
Der staatlich organisierte, inszenierte Aktion ist wohl eher als Blockade zu
und reichsweit durchgeführte „Boykott“ betrachten 7: Von der SA durchgeführt,
am 1. April 1933 bedeutete für die jüdi- die zumindest im größten Reichsland
schen Konfektionäre einen neuerlichen Preußen den Status von Hilfspolizei
tiefen Einschnitt. In ihren Erinnerungs- hatte, und in vielen Fällen einhergehend
berichten beschrieben überlebende mit Gewalt, waren keine politischen
Boykott?
Über den sogenannten Boykott berichtete der Berliner
Börsen-Courier mit Blick auf die Zensur nur mit
großer Zurückhaltung. Dass diese erste reichsweite
Aktion gegen Unternehmen, Arzt- und Anwaltspraxen
nicht nur mit gewaltsamen Übergriffen einherging,
sondern auch ein immenser Schock für alle Juden
bedeutete, blieb so unerwähnt.
Börsen-Courier über den „Boykott“ am 1. April 1933.19
Veränderungen das Ziel, sondern nur Die Gründungsmitglieder waren beken-
die Vernichtung der jüdischen Gewerbe- nende Nationalsozialisten und beruflich
tätigkeit. Der jüdische Rechtsanwalt an Schnittstellen von Bekleidungsindus-
Eduard Reimer jedenfalls hatte noch trie und Politik angesiedelt. Die Spitze
1935 den Mut, den „Boykott“ vom des Vereins bildeten neben anderen
1. April 1933 als „sittenwidrig“ zu brand- Georg Riegel und Herbert Tengelmann,
marken. Sein Buch wurde bei Erschei- NSDAP-Mitglieder und Funktionsträger
nen offenbar indiziert und ist deshalb der IHK. 11 Als Hauptsitz wählte die
bis heute nur in sehr wenigen Bibliothe- „Adefa“ Räume inmitten des Berliner
ken zu finden. 8 Konfektionsviertels – in der Kronen
straße 48 / 49. Ziel der „Adefa“ war es
Auf städtischer Ebene, auf der Ebene des zunächst, möglichst alle nicht-jüdischen
Magistrats von Groß-Berlin, fingen Unternehmen innerhalb der Beklei-
Industrie- und Handelskammer (IHK) dungsbranche zu vereinen. Diese sollten
und Amtsgericht überdies damit an, gemeinschaftlich die Kooperation mit
Konfektionsunternehmen, die sie als jü- jenen Unternehmen auflösen, die als
disch betrachteten, genau zu überprüfen jüdisch erachtet wurden. Die „Adefa“
und nicht selten gezielt zu schikanieren. 9 betrieb Propaganda, veranstaltete
Die IHK arbeitete eng mit der Devisen- Modenschauen und Messen und zeich-
stelle des Landesfinanzamtes zusam- nete sich durch aggressives Auftreten
men, hier standen vor allem exportstar- aus. Sie kooperierte, zumindest in Berlin,
ke Unternehmen im Fokus. Wenn es um auch mit der Industrie- und Handels-
nationalsozialistische Akteure geht, die kammer. 12
am Hausvogteiplatz antisemitisch tätig
wurden, muss auch die „Adefa“ genannt
werden. Hinter der Abkürzung verbarg Graumann & Stern
sich die „Arbeitsgemeinschaft deutsch-
arischer Fabrikanten der Bekleidungs- Im „Dreikaiserjahr“ 1888 gegründet,
industrie e.V.“, ein im Mai 1933 gegrün- gehörte das Unternehmen „Graumann &
deter und reichsweit agierender Verein, Stern“ bereits vor dem Ersten Weltkrieg
der prominente Fürsprecher besaß und zu den international renommierten
durch das Reichswirtschaftsministe- Damenkonfektionsfirmen. 13 Als Aus-
rium, das Reichspropagandaministe- druck ihrer wirtschaftlichen Stärke und
rium, die IHK sowie die Deutsche ihres Standings kann der Bau eines
Arbeitsfront (DAF) unterstützt wurde. 10 eigenen Konfektionshauses in der20
Briefkopf „Graumann & Stern Kommanditgesellschaft auf Aktien“
ws Konfektionsviertel prägte. Links im Bild sind die von Carl Gotthard Langhans 1787 erbauten
„Mohrenkollonaden“ zu sehen, die ursprünglich als Laubengang über den Festungsgraben
dienten und heute den Eingangsbereich des BMJV bilden.
Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten Berlin – Abt. I – Entschädigungsakte,
Reg.-Nr. 271990 (Seev William Stern), Bl. 11 E 2.
Mohrenstraße 36 gelten – das 1900 / 01 gang des BMJV. Darüber hinaus existier-
erbaute „Haus Stern“, das zum 25. ten weitere Betriebsräume von „Grau-
Firmenjubiläum um mehrere Etagen mann & Stern“ in der Mohrenstraße 33
erweitert wurde. 14 und 34 / 35. 15 Nach dem Ersten Welt-
krieg unterhielt „Graumann & Stern“
Im Jahr 1913 waren die Brüder Albert neben dem Berliner Stammhaus auch
und Siegfried Stern Eigentümer der namenhafte Dependancen in New York,
Häuser Mohrenstraße 36, 37 sowie London, Kopenhagen und Amsterdam.
Eigentümer des „Laden 1 Unter den In den 1920er-Jahren kaufte das Unter-
Kolonnaden“ – dem heutigen Hauptein- nehmen die „Sommerfelder Textilwerke21
AG“ auf, eine Spinnerei und Weberei im erfahrenen Konfektionär, der seit
Kreis Krossen, östlich von Frankfurt / Kindertagen darauf vorbereitet wurde,
Oder, im heutigen Polen, gelegen. Durch den traditionsreichen Familienbetrieb
dieses Novum innerhalb der Berliner in der Mohrenstraße zu übernehmen,
Konfektionsbranche konnte alles, „ (...) gut. Auf 800 qm Betriebsfläche arbeite-
vom Spinnen der Garne bis zum fertigen ten rund 40 kaufmännische Angestellte
Mantel vollkommen in eigener Regie (...) “ und über 65 Zwischenmeister erhielten
hergestellt werden. 16 Die Expansion Aufträge für die Herstellung von Damen-
führte zu fast einer Verdopplung des mänteln und -kostümen.
Jahresumsatzes von 12 Millionen auf
20 Millionen Reichsmark 1920. 17 Jedoch veränderte sich bereits vor der
Machtübernahme das Betriebsklima
Nachdem die Firmengründer 1931 aus zusehends und Wilhelm Stern hatte mit
Altersgründen aus der Gesellschaft antisemitisch eingestellten Angestellten
ausgeschieden waren, führten Heinz und Kunden zu kämpfen, deren – zu-
Graumann und Wilhelm Stern die Firma nächst verbale – Angriffe sich häuften.
als oHG weiter, bevor auch Graumann Die NS-Machtübernahme fiel in das
ausschied und Stern daraufhin im erste Geschäftsjahr unter Sterns Leitung,
Sommer 1932 alleiniger Eigentümer der das am 1. Dezember 1932 begonnen
Firma wurde, die man zu diesem Zwecke hatte. Stern wurde Zeuge des staatlich
in eine Einzelfirma umwandelte. 18 Es verordneten „Boykotts“ und zog aus den
hatte sich zwar die juristische Verfasst- politischen Entwicklungen für sich und
heit der Firma geändert. Aber nach seine Familie die Konsequenz, Berlin zu
außen blieb „Graumann & Stern“ zu- verlassen. Allerdings hatte er unter-
nächst unverändert bestehen. Aufgrund schätzt, wie attraktiv sein Unternehmen
der Wirtschaftskrise und der antisemi war. In Anbetracht von Massenarbeits-
tischen Atmosphäre entschied Wilhelm losigkeit und einer schwachen wirt-
Stern sich dazu, den Betriebsumfang zu schaftlichen Lage hätte der Wegfall
verkleinern und zu modernisieren. dieses devisenbeschaffenden Unterneh-
Während eines ausgedehnten USA- mens, sei es auch ein jüdisches, einen
Aufenthaltes hatte er sich bestens mit Verlust bedeutet. Stern erfuhr dies auf
den modernen Methoden hinsichtlich schmerzliche Weise: In seinem Betrieb
Betriebsführung und Produktionsver- in der Mohrenstraße 36 bildete sich eine
fahren vertraut machen können. 19 „Betriebszelle“, zu deren Obmann Sterns
Die Ausgangslage war also für den Chauffeur Steffin avancierte. 20 Dieser22
Rädelsführer hatte die Kündigungs- sellschafter von Stern, für den die Kondi-
schreiben aller Angestellten gesammelt tionen jedoch wenig lukrativ waren:
und nötigte Stern unter Androhung von Keiner der neuen Gesellschafter musste
Gewalt dazu, eine „Verpflichtungserklä- nennenswertes eigenes Kapital in die
rung“ zu verfassen, in der er erklärte, Gesellschaft einbringen. Doch wurde
die Firma „zum Nutzen der Belegschaft ihnen bereits im ersten Geschäftsjahr
und des deutschen Volkes“ weiterführen eine Gewinnbeteiligung von 25 %
zu wollen. 21 Jedoch genügte diese Szene versprochen, die im Folgejahr auf ein
Steffin offenbar noch nicht: Gefolgt von Drittel steigen sollte. 25 Stern nutzte
einer Horde von 25 SA-Männern drang die Zwangsveränderung, um im euro-
er in der darauffolgenden Nacht in die päischen Ausland Exportaufträge für
Wohnung der Familie Stern ein und die Damenmäntel- und Kostüme von
zwang seinen Chef dazu, eine neue „Graumann & Stern“ einzuholen.
Erklärung zu schreiben, in der er die Der Umsatz des Unternehmens stieg im
Firmenschließung revidierte und der zweiten Geschäftsjahr wieder an und
„Betriebszelle“ seine Kooperation lag bei zwei Millionen Reichsmark.
zusicherte. 22 Diese Methode, durch Stern reiste in die Niederlande und in
Gewaltausübung Herrschaft zu erlangen die Schweiz, warb Kunden in Belgien
und zu sichern, bildete einen funda- und Luxemburg an, fuhr auch vermehrt
mentalen Bestandteil der frühen Phase nach Palästina. Dort war seine Ehefrau
des Nationalsozialismus. 23 mit den zwei Kindern im Herbst 1933
als Touristin eingereist und hatte sich
Was darauf folgte, war zunächst „wirt- niedergelassen. Von einer Reise nach
schaftlich unsinnig, aber unter den Palästina im März 1935 kehrte auch
Verhältnissen notwendig“, wie es Stern Wilhelm Stern nicht wieder zurück.
einige Jahrzehnte später nüchtern Die Familie Stern lebte nun in dem
rekapitulierte. 24 Der Konfektionär bot kleinen Ort Ramot-Hashawim, der
zwei langjährigen Angestellten an, als 1933 von deutschen Juden in Palästina
Mitgesellschafter in das Geschäft ein- gegründet wurde. 26 Sie hatten alle
zusteigen. Zum neuen Geschäftsjahr am Vermögenswerte, ihr gesamtes Hab
1. Dezember 1933 wurde die Einzelfirma und Gut in Berlin zurückgelassen und
erneut in eine offene Handelsgesell- versuchten, sich in Palästina ein neues
schaft (oHG) umgewandelt. Herbert Unternehmen eine neue Existenz
Brückner, der Christ war und Max aufzubauen, indem sie in der Landwirt-
Sternberg, ein Jude, wurden die Mitge- schaft arbeiteten. 2723 Am 14. Januar 1936 teilte Wilhelm Stern dem Berliner Amtsgericht seinen Austritt aus der Firma seines Vaters mit und erklärte sich damit einverstanden, dass seine Mitgesellschafter das Unternehmen weiterführten. Nachdem auch Max Sternberg als Jude aus der Firma aus- scheiden musste, führte Brückner sie bis zu ihrer Liquidation 1938 weiter; die Abwicklung sollte sich jedoch bis in die 1940er-Jahre hinziehen. 28 Brief von Wilhelm Stern an das Amtsgericht Berlin, 14. Januar 1936. Landesarchiv Berlin, A Rep. 342-02, 18687.
Die „Nürnberger
Gesetze“ (1935)
Das Jahr 1935 war in Berlin von Gewalt die Gewalt zu erheben und sich dem an-
geprägt, die im Juli sogar zu pogromarti- tisemitischen Treiben zu widersetzen. 30
gen Ausschreitungen am Kurfürsten- Einer von ihnen war Gerhard Jacobowitz,
damm führte, bei denen Schaufenster der viele Jahre in der Kronenstraße 35
zerschlagen und Menschen, die in den ein- und ausgegangen war.
Augen der (meist) jugendlichen Angreifer
jüdisch aussahen, attackiert wurden. Der Konfektionär und bekennende
Allerorten wurden in der Stadt nun so Sozialdemokrat musste miterleben, wie
genannte Stürmerkästen aufgestellt, in sein Bruder 1933 in eine Folterstätte der
denen das antisemitische Hetzblatt aus SA-Hilfspolizei verschleppt wurde, die im
Nürnberg ausgebreitet wurde. Auf Zuge der Machtübernahme überall in
professionell gefertigten Aufklebern, die Berlin „eigenmächtig oder im staatli-
zunächst in Bezirken am Berliner Stadt- chen Auftrag“ errichtet wurden. 31
rand, im Laufe des Jahres aber auch in Geschockt von omnipräsentem Antise-
Berlin Mitte angebracht und verteilt mitismus, äußerte sich Jacobowitz offen
wurden, war gleichzeitig zu lesen „Wer gegen die Politik der NSDAP. Nach der
beim Juden kauft ist ein Volksverräter“. 29 Verabschiedung der „Ersten Verordnung
Provokationen wie diese brachten jedoch zum Reichsbürgergesetz“ 1935, nach
andere Berliner dazu, ihre Stimme gegen denen Jacobowitz als „Volljude“ galt,
Passfoto und Unterschrift von Gerhard Jacobowitz auf
einem Ausweis der belgischen Delegation des Hohen
Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen
U.N.H.C.R., Brüssel 1952.
LABO Berlin, Entschädigungsakte, Reg.-Nr. 265926
(Gerhard Jacobowitz), Bl. M 525
Am 17. Juli 1939 beantragte Adolf Ausreisegenehmigung
Schönlank die Löschung seiner Firma Aufgrund eines Herzleidens wurde Ludwig Lewinnek
und unterzeichnete mit dem Zwangs- am 19. März 1942 eine befristete Ausreisegenehmigung
vornamen „Israel“. aus dem südfranzösischen Internierungslager für einen
Landesarchiv Berlin, A Rep. 342-02, Kuraufenthalt in Aix-en-Provence ausgestellt.
44617, Bl. 21 LABO Berlin, Entschädigungsakte, Reg.-Nr. 64806
(Ludwig Lewinnek), o. Bl.
denunzierte ihn jemand bei der Gestapo. überstand daher diese Situation
Der couragierte Konfektionär hatte und folgte kurz darauf ihrem Mann in
jedoch das Glück, rechtzeitig von einem ihre Heimat. 32
Frontkameraden aus dem Ersten Welt-
krieg, der für die Berliner Gestapo Auch Hermann Mansfeld floh nach den
arbeitete, gewarnt zu werden. Jacobo- „Nürnberger Gesetzen“ 1935 ins Ausland.
witz flüchtete am 22. September 1935 Er war handlungsbevollmächtigter
Hals über Kopf nach Belgien. Am Gesellschafter bei „Lewinnek &
nächsten Tag stand die Gestapo vor Schönlank“ in der Kronenstraße 41
seiner Berliner Wohnung, traf jedoch und emigrierte nach Amsterdam.
nur noch auf Jacobowitz’ Ehefrau Zoé Ludwig S. Lewinnek und Adolf Schön-
Lauvaux. Als belgische Staatsangehörige lank konnten die Firma als oHG bis zur
musste sie 1935 noch keine akute ihrer Liquidation 1939 weiterführen.
Angst vor Verhaftungen in Berlin haben, Lewinnek emigrierte im Mai 1939 nach26
Einladungskarte der Firma Max Behrendt zur Präsentation
der Frühjahrskollektion, Berlin 1930–1939.
Jüdisches Museum Berlin, Foto: Jens Ziehe.
Belgien, wo er Gertrude Wolff heiratete. Im Jahr 1904 hatte der damals 25-jähri-
Wenige Monate später musste das ge Kaufmann Max Behrendt eine – wie
frischgebackene Ehepaar aufgrund es seinerzeit hieß – „Kostümrockfabrik“
der deutschen Besatzung untertauchen. gegründet, die schnell zu einer der
Noch im Mai 1940 wurde Ludwig erfolgreichsten Firmen der Branche
S. Lewinnek entdeckt und in das süd- avancierte. Behrendt exportierte vor
französische Lager Gurs verschleppt. allem Waren nach Dänemark und
Zwei Jahre später, 1942, gelang es ihm, Großbritannien, wo er eine Zweignie-
aufgrund einer Herzkrankheit aus dem derlassung aufbaute, in der er nach
Lager entlassen zu werden. Er kehrte seiner Flucht aus Deutschland weiterhin
zu seiner Frau zurück und gemeinsam als Kaufmann tätig sein konnte.
flüchteten sie in die Schweiz. Dort
wurden sie bis 1945 in einem Flücht- Durch die Export-Geschäfte geriet
lingslager bei Basel interniert und Behrendt unter die verschärfte
emigrierten nach dem Ende des Krie- Kontrolle der Devisenprüfstelle. 34
ges nach Australien. Behrendt war es gelungen, die deutsche
Steuerbehörde nicht gänzlich über den
Max Behrendt Vermögenstransfer für die Errichtung
der Londoner Zweigniederlassung in
Der Kaufmann Max Behrendt, Allein- Kenntnis zu setzen. In einem Prüf
inhaber der gleichnamigen Firma in bericht im Oktober 1938 schlug der
der Mohrenstraße 36 / 37, emigrierte Sachverständige vor, den nicht-jüdi-
am 15. Oktober 1935 mit seiner Ehefrau schen Prokuristen in der Mohrenstraße,
nach London. 33 „der zwar Arier ist, aber eine jüdische27
Schreiben Chr. E. Iversen an
Irmgard Behrendt, 10. Februar 1957
Für das Entschädigungsverfahren bestätigte
der dänische Kaufmann, welchen ausgezeich-
neten Ruf die Firma Max Behrendt genoss.
LABO Berlin, Entschädigungsakte,
Reg.-Nr. 51346 (Max Behrendt), Bl. 2 E 2.
Bescheid über die Judenvermögensabgabe,
27. Januar 1939
Nach dem Pogrom im November 1938 wurde den
Juden in Deutschland eine Sondersteuer auferlegt.
Die „Sühneleistung“ war in vier Raten zu zahlen
und spülte insgesamt mehr als eine Milliarde
Reichsmark in die klammen Kassen des Reichs.
LABO Berlin, Entschädigungsakte,
Reg.-Nr. 51346 (Max Behrendt), Bl. D 2.
Konfektionsfirmen wie Max Behrendt stellten keine
Maßkleider, sondern Kleider in bestimmten Größen her,
die sie teils in den eigenen Geschäftsräumen verkauften,
teils an Warenhäuser lieferten und exportierten.
Jüdisches Museum Berlin, Farblithographie,
Papier, 56 x 36 cm, Foto: Jens Ziehe28
„Brief des Amtsgerichts an Max Behrendt vom 2. Dezember 1939“
„Mit dem Brief teilte das Amtsgericht dem Kaufmann mit, dass seine Firma aus dem Handelsregister
gelöscht werde. Hiergegen konnte Max Behrendt keinen Einspruch erheben, da das Amtsgericht den
Brief nur an die Firmenadresse sendete und Briefverkehr mit dem Vereinigten Königreich wegen des
Krieges nur sehr eingeschränkt möglich war.
Landesarchiv Berlin A Rep 342-02, 28764.29
Frau hat“, verhaften zu lassen und Wie rasant der wirtschaftliche und
dadurch Druck auf den Geflüchteten soziale Abstieg sich für verfolgte
auszuüben. Man nahm dem Prokuris- Konfektionäre und deren Angehörige
ten zu diesem Zweck sogar schon den vollziehen konnte, zeigt das Schicksal
Pass ab, um eine Flucht auszuschließen. 35 des Kleider- und Blusen-Fabrikanten
Bernhard Mendelsohn. Mendelsohn
Nach dem Pogrom kam der Betrieb völ- war seit 1934 Firmeninhaber einer
lig zum Erliegen. Die hohen Guthaben Blusen- und Kleiderfabrik in der
der Firma wurden nun dazu benutzt, Jerusalemer Straße 26. Nach zunächst
die so genannte Judenvermögensabgabe positiven Geschäftsabschlüssen
und andere Steuern abzuführen. Im April wurde er von Diffamierungen und
1940 wurde die Firma dann aus demHan- Verfolgung vermutlich aus dem Um-
delsregister gestrichen. In England geriet feld der „Adefa“ gequält und erlitt
Max Behrendt indessen in Zahlungs- einen Schlaganfall, der ihn arbeitsun-
schwierigkeiten und 1941 musste ein fähig machte. Um sich wirtschaftlich
Zwangsvergleich mit den Gläubigern ge- zu behaupten, versuchte seine nicht-
schlossen werden. Er verstarb wenige Ta- jüdische Ehefrau den Betrieb fort-
ge vor der Befreiung Berlins in London. 36 zuführen, was jedoch missglückte. 37
Armutszeugnis vom 26. Juni 1936
Das Armutszeugnis attestierte Mendelsohn, er sei „arm und
ohne Beeinträchtigung des notwenigen Unterhaltes außerstan-
de, die Kosten für die Löschung der Fa. Bernhard Mendelsohn
im Handelsregister zu bestreiten“. 38
Landesarchiv Berlin, A Rep. 342-02, 45206.Die Radikalisierung
der Verfolgung (1937/38)
Seit ihrer Gründung im Mai 1933 war „Ware aus arischer Hand“ versehen
die „Adefa“ unermüdlich damit beschäf- sollten. 40 Dieser Beschluss ging einher
tigt, Rundbriefe an ihre Mitglieder zu mit einer mehrwöchigen Propaganda-
versenden. In diesen wurden diese stets kampagne, die die Arbeit der „Adefa“
dazu aufgefordert, ihre Handelsbezie- der Bevölkerung näher bringen sollte. 41
hungen mit jüdischen Unternehmen zu Zeitgleich sorgte Hermann Göring als
beenden. Aus den Schreiben wird bis Nachfolger von Hjalmar Schacht als
1938 deutlich, dass viele Kaufmänner Reichswirtschaftsminister dafür, dass
zwar der „Adefa“ angehörten, sie jedoch jüdische Gewerbebetriebe definiert und
weiterhin mit ihren jüdischen Kollegen systematisch benachteiligt wurden.42
Geschäfte abschlossen. All diese Aktionen zeigen jedoch
indirekt auch, dass sich jüdische Unter-
Ein Grund dafür lag sicher darin, dass nehmer in der Bekleidungsbranche
es wirtschaftlich unsinnig gewesen bis dahin noch gegen die Verfolgungen
wäre, langjährige Geschäftsbeziehun- behaupten konnten.
gen abzubrechen. Auch das Reichswirt-
schaftsministerium verfolgte bis Ende Karl Leissner
1937 eine eher pragmatische Politik
und wies darauf hin, dass die Judenver- Dass die antisemitische Verfolgung
folgung sich nicht (zu sehr) auf das durch die „Adefa“ mit der Politik der
Exportgeschäft auswirken dürfe. 39 Industrie- und Handelskammer Hand
Außerdem gab es noch keine einheit- in Hand ging, zeigt das Beispiel einer
liche Regelung darüber, wann ein Konfektionsfirma in der Mohren-
Unternehmen als „jüdisch“ anzusehen straße 37. Diese Firma wurde ursprüng-
sei. Deshalb beschloss der Vorstand der lich im Juli 1933 vom Nicht-Juden Kurt
Adefa im November 1937, dass sich alle Schmidt gegründet. Schmidt hoffte
Mitgliedsbetriebe als solche ausweisen darauf, auch ohne Branchenerfahrung
und ihre Waren mit der Aufschrift mithilfe eines Zwischenmeisters ein31
lukratives Unternehmen aufbauen zu Absicht in Kenntnis, den Firmennamen
können, erwirtschaftete jedoch keine in „Max Leissner“ ändern zu wollen.
nennenswerten Gewinne. In dieser Für die Übergangszeit stempelte er den
Situation wandte sich Schmidt an sei- Schriftzug „Kurt Schmidt“ mit „Jetzt:
nen Freund Karl Leissner, der ihm Ende Max Leissner“ über (s. Abbildung). 45
1933 ein Darlehen zum Ausbau des
Unternehmens gewährt hatte. Darauf- Der Anwalt von Leissner stellte gegenüber
hin warf die IHK dem Unternehmen dem Amtsgericht klar, dass weder der Ruf
vor, Kurt Leissner sei de facto der Ge- der Firma, noch ihr geschäftlicher Erfolg
schäftsführer und sprach von „unzuläs- von dem Firmennamen „Kurt Schmidt“
siger Namensleihe“. 43 Dies war jedoch abhänge, da niemand diese Firma kannte.
mitnichten der Fall: Karl Leissner Leissner schaffte es mit seinem coura-
übernahm erst 1934 die Geschäftsfüh- gierten Verhalten, die Geschäfte von 1935
rung, allerdings ohne den Firmennamen bis 1938 zu führen. Da er polnischer Jude
„Kurt Schmidt“ zu ändern. Da Leissner war, genoss er im nationalsozialistischen
allerdings ebenfalls kaum Erfahrung in Deutschland noch einen gewissen Schutz.
der Damenkonfektion besaß, wandten Dies sollte sich allerdings im Oktober
sich die Geschäfte auch unter seiner 1938 grundlegend ändern, denn Leissner
Leitung nicht ins Positive. Daraufhin wurde Opfer der sogenannten „Polenak-
übernahm sein Bruder, Max Leissner, im tion“. Hintergrund waren diplomatische
Dezember 1935 die Firma. Max Leissner Auseinandersetzungen zwischen Polen
war, wie sein Bruder, polnischer Jude und Deutschland und die – in erster Linie
mit Wohnsitz in Berlin. Er hatte bereits antisemitische – Absicht Polens, im
über 15 Jahre Berufserfahrung und Ausland lebenden Polen die Staatsange-
unter seiner Federführung schrieb das hörigkeit abzuerkennen. Daraufhin
Unternehmen erstmals schwarze Zahlen. verhing Heinrich Himmler ein Aufent-
haltsverbot für polnische Juden und
Die „Adefa“ hatte die betrieblichen Ver- organisierte eine Gestapo-Aktion, wäh-
änderungen beobachtet und denun- rend der 17.000 polnische Juden verhaf-
zierte Max Leissner bei der IHK, die tet, mit Zügen an die deutsch-polnische
ihm daraufhin erneut vorwarf, unter Grenze verschleppt und über die Grenze
falschem Namen eine Firma zu leiten. getrieben wurden. 46 Auch Max Leissner
Er wurde daraufhin aufgefordert, seine wurde deportiert und nach Polen abge-
Firma zu löschen. 44 Max Leissner schoben. Aus Warschau bevollmächtigte
jedoch setzte das Amtsgericht über seine Max Leissner dann einen deutschen Treu-32
händer, die Löschung und die Liquida- schafter einerseits und ihre Zulieferer
tion der Firma vorzunehmen. und Kunden andererseits öffentlich
zu bedrohen, einzuschüchtern und sie
Über die Ausmaße der Verdrängung so zur Aufgabe zu zwingen. Herbert
jüdischer Konfektionshäuser am Haus Labandter führte seit 1934 ein Fabrika-
vogteiplatz konstatierte die SoPaDe, die tionsgeschäft im Erdgeschoss des
Exilorganisation der Sozialdemokrati- Hauses Mohrenstraße 37 a, das er am 7.
schen Partei Deutschlands, dass zum Juli 1934 feierlich eröffnete. 49 Laband-
„1.April [1938] (...) etwa 40 der größten ter war spezialisiert auf die Herstellung
Berliner Konfektionsfirmen die Schließ- und den Vertrieb von schwarzen Trau-
ung ihrer Betriebe oder die Überführung erkleidern und Brautkleidern. 50 Hier-
in arische Hände beschlossen (...)“ hatten! 47 von erhoffte sich der Konfektionär
In ihren Stimmungsberichten berichtete vermutlich einen konstanten Absatz,
die SoPaDe über die aggressive Politik der keine saisonal bedingten Einschrän-
der „Adefa“ am Hausvogteiplatz. kungen in sich barg. Obwohl die Be-
hauptung des „Stürmer“ nicht stichhal-
Bereits im Januar 1938 war ein Hetzarti- tig war, trat offenbar der beabsichtigte
kel in der antisemitischen Wochenzeitung Effekt ein. Die Firma Labandter wurde
„Der Stürmer“ erschienen, der Stimmung noch im gleichen Jahr unter unbekann-
gegen jüdische Bekleidungsfirmen ma- ten Umständen liquidiert.
chen sollte. 48 Der Artikel führte die
Firmennamen und Anschriften von 21 Ernst Loepert
Berliner Damenbekleidungsfirmen auf,
die angeblich erst 1938 gegründet wur- Ernst Loepert, dessen gleichnamige Firma
den. Dazu zählten auch die Firmen ebenfalls aufgelistet wurde, befand sich
„Herbert Labandter“ in der Mohrenstra- zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gar
ße 37 a, „Ernst Nußbaum“ in der Mohren- nicht mehr in Deutschland. Er war unter
straße 36 / 37 sowie „Ernst Loepert“ in der Zurücklassung seines Geschäftes im
Kronenstraße 45. Die Eintragungsdaten Februar 1938 nach Manchester / England
im Berliner Handelsregister beweisen emigriert. 51 Loepert, Jahrgang 1895, war
jedoch, dass keine dieser Firmen erst vor der Firmengründung als Reisender in
1938, sondern zwischen 1934 und 1936 der Mädchenkonfektion tätig. Mit einem
gegründet wurden. Die Behauptung im Eigenkapital von 10.000 RM gründete er
„Stürmer“ war schlichtweg eine Lüge und seine eigene Firma am 1. Januar 1933,
hatte die Funktion, die jüdischen Gesell- nur wenige Wochen vor der Machtüber-33
Vollmacht Max Leissner, Warschau 22. November 1938
Von Warschau aus bevollmächtigte Max Leissner einen
deutschen Treuhänder, die Liquidation und Löschung seiner
Firma vorzunehmen.
Landesarchiv Berlin, A Rep. 342-02, 43467.
Antisemitische Hetze
Im Januar 1938 erschien ein Hetzartikel in der
antisemitischen Wochenzeitung „Der Stürmer“ mit falschen
Behauptungen gegen jüdische Bekleidungsfirmen.
Artikel aus „Der Stürmer“, Januar 1938.
nahme durch die Nationalsozialisten. Um Betriebe hinsichtlich ihrer Existenz
In der Kronenstraße 36 mietete Loepert und wirtschaftlichen Lage zu überprü-
150 qm große Betriebsräume für eine fen, schrieb die Berliner Industrie- und
monatliche Miete von 250 RM an. Sie Handelskammer seit Herbst 1937 jedes
umfassten je einen Verkaufs-, Büro-, handelsgerichtlich gemeldete Unterneh-
Einrichtungs- und Packraum. Ange- men an. Dieses Prozedere sollte der
stellt waren ein „kaufmännisches Aktualisierung des Handelsregisters
Lehrmädchen“ sowie ein Konfektionär dienen. Erhielt die IHK keine Antwort,
und ein Hausdiener. Bis zu 15 Zwi- beantragte sie die Löschung der Firma
schenmeister erhielten Aufträge von aus dem Handelsregister und veröffent-
Loepert, die sie außer Haus in ihren lichte die vorgesehene Löschung, ver-
Werkstätten anfertigen ließen. 52 sehen mit einer Löschungsfrist von drei34
Brief des Amtsgerichts an den Polizeipräsidenten,
19. Juni 1939
Auf Anfrage der Beamten, die das Handelsregister
führten, ermittelte das Meldeamt des Polizei-
präsidenten, dass John Feige „am 28.5.38 nach
London abgemeldet“ war.
Landesarchiv Berlin, A Rep. 342-02, 37773.
Monaten. 53 Überdies wurde die aktu- wurde Ernst Loepert durch das Amts-
elle Anschrift beim Einwohnermelde- gericht zur Löschung aufgefordert.
amt erfragt. Vor diesem Hintergrund Jedoch befand Loepert sich bereits in
wandte sich die IHK am 12. November Manchester / England, wie es das
1938 an das Amtsgericht, um die Einwohnermeldeamt Berlin dem
Löschung der Firma „Ernst Loepert“ Amtsgericht mitteilte. 55
aus dem Handelsregister zu beantra-
gen, denn die Überprüfung habe Durch die „Dritte Verordnung zum
ergeben, dass der Betrieb „seit Jahren Reichsbürgergesetz“ vom 14. Juni 1938
eingestellt“ sei. 54 wurde schließlich offiziell festgelegt,
wann ein Unternehmen als jüdisch
Dieser bürokratische Routinevorgang zu betrachten sei: Sobald mindestens
wirkt im Kontext der jüdischen Konfek- ein Inhaber, Gesellschafter oder
tionsbetriebe am Hausvogteiplatz Kapitaleigner als Jude nach den „Nürn-
makaber, da am 12. November 1938 berger Gesetzen“ von 1935 galt. 56
die gewaltsamen antisemitischen Gleichzeitig konnten nun auf eine
Ausschreitungen in Berlin noch immer Anordnung des Polizeipräsidenten hin
nicht völlig beendet und die Betriebs- jüdische Gewerbebetriebe in Berlin
räume der jüdischen Firmen am gekennzeichnet werden. 57 Die Flut an
Hausvogteiplatz ausgeplündert und Verordnungen und die Konkurrenz
zerstört waren. Wenige Tage später durch „Adefa“-Mitglieder, deren liqui-35
Bescheinigung Karl Stier,
31. Dezember 1957
Für das Entschädigungsverfahren
bestätigte der Frankfurter Kauf-
mann, welchen ausgezeichneten
Ruf die Firma Brüder Feige
genoss. Ihre Mäntel waren von
solcher Qualität, dass „gleichwerti-
ger Ersatz“ nicht zu finden war.
LABO Berlin, Entschädigungsakte,
Reg.-Nr. 50555 (John Feige), K 17 f.
de Mittel schier unendlich waren, Entsprechend gehörten sie zu den weni-
führten auf dem Areal zwischen der gen Häusern, die nach 1933 mit Geneh-
Mohren-, Kronen- und Jerusalemer migung des Reichwirtschaftsministe-
Straße dazu, dass bereits vor dem riums eine Niederlassung in London
Novemberpogrom 1938 sechs jüdische aufbauen konnten. Doch litten die
Konfektionsunternehmen aufgelöst Brüder ab 1934 darunter, dass die
wurden. 58 Nationalsozialistische Betriebszelle in
ihrem Betrieb gegen sie hetzte. Immer
Ebenso vor dem Novemberpogrom häufiger lösten auch alte Kunden ihre
emigrierten die Brüder Feige, deren Geschäftsbeziehungen. Als die Brüder
Firmensitz sich in der Mohrenstraße Feige persönlich von der Gestapo
36 / 37 befand. Die Brüder Alfred, Erich vorgeladen und bedroht worden waren,
und John Feige kamen nach dem entschlossen sie sich im Frühjahr 1938
Ersten Weltkrieg aus Ostpreußen nach zur Flucht nach London. In der Folge
Berlin und gründeten hier 1926 unter trat ihre Firma in Liquidation und
ihrem Namen eine Damenmäntel wurde im April 1940 aus dem Handels-
fabrik. Der Ruf der Firma war so bedeu- register gelöscht. Die erheblichen
tend, dass sie keine Vertreter zu be- Außenstände und Guthaben der Firma
schäftigen brauchten. War eine und ihrer Gesellschafter wurden zur
Kollektion fertig gestellt, strömten die Begleichung von willkürlich konstruier-
Kunden in die Mohrenstraße. 59 ten Steuerschulden eingezogen. 60Der Novemberpogrom
(1938)
„Eine Gruppe von zehn bis elf Mann drang, mit langen Eisenstangen und Beilen
bewaffnet, in die Engros-Geschäfte ein, um dort alles, aber auch alles, was es
nur zu zerstören gab, in Trümmer zu schlagen. (...) Kleider, Pelze, Schreibmaschinen,
Lampen, Garderobenständer, ja sogar Blumentöpfe aus den großen Verkaufsräumen
wurden auf die Straße geworfen. Die gesamten Buchhaltungen, Arbeitszettel und
Kartotheken flogen auf die Straße. (...) Unten sorgten Antreiber und Aufpasser dafür,
dass die Straße frei war.“ 61
So beschrieb eine Passantin, was sie der Wilhelmstraße ein, dem heutigen
während des mehrtägigen Pogroms im Dienstsitz des Bundesfinanzministe-
Berliner Konfektionsviertel gesehen riums, um die Konsequenzen des Pog-
hatte. Es war nicht das erste Mal, dass roms zu besprechen. Eine Folge war die
das Konfektionsviertel, ein als „jüdisch“ „Verordnung zur Ausschaltung der
stigmatisierter Ort, von gewaltbereiten Juden aus dem deutschen Wirtschafts-
Antisemiten aufgesucht wurde. leben“, die die Schließung von jüdischen
Jedoch bildete der Novemberpogrom Einzelhandelsunternehmen, Hand-
den Höhepunkt der Gewalt gegen die werksbetrieben und Genossenschaften
jüdischen Gewerbetreibenden am zum 1. Januar 1939 vorsah. 62 Nur wenige
Hausvogteiplatz. Viele der Geschäfte, Wochen später, am 3. Dezember 1938,
die es noch gab, wurden vor aller Augen sollten jüdische Unternehmer mit der
bei Tageslicht zerstört. „Verordnung über den Einsatz jüdischen
Vermögens“ gezwungen werden, ihre
Nach den Gewaltexzessen berief Her- Gewerbebetriebe zu veräußern oder
mann Göring, Preußischer Minister- abzuwickeln. 63
präsident und Leiter der Vierjahresplan-
behörde, am 12. November 1938 etliche Noch in den Wintermonaten des Jahres
NS-Institutionen, Wirtschafts- und 1938 und 1939 wurden 17 jüdische
Versicherungsvertreter zu einer Konfe- Konfektionsunternehmen auf dem
renz im Reichsluftfahrtministerium in heutigen Areal des BMJV liquidiert und37
Pogrom
In Amsterdam und London sammelten der aus Deutschland geflüchtete Alfred Wiener und sein
Team systematisch Informationen aus dem Deutschen Reich, um die Welt über das Schicksal der
Juden aufzuklären. Der Bericht der unbekannten Dame ist Teil dieser Sammlung.
Wiener Library London, Bericht, o. D. 046-EA-0450. Books. B.161.
zwei weitere Firmen in den Besitz von der Mohrenstraße 36 und ab 1938 in der
Nicht-Juden überführt. Im Jahr 1940 Kronenstraße 42/43. 65 Gesellschafter
wurden weitere neun Bekleidungsfirmen waren Louis Schlachter und Bruno Wolf,
liquidiert, eine wurde übernommen. 64 die sich vor allem auf den Export von
Damenkleidung konzentrierten, wes-
Wolf & Schlachter halb ihre Umsätze auch nach der Macht-
übernahme der Nationalsozialisten
Die 1919 gegründete Firma „Wolf & nicht einbrachen. Im Dezember 1935
Schlachter“ gehörte zu jenen Konfek- teilte die Industrie- und Handelskam-
tionsunternehmen, die direkt nach dem mer dem Amtsgericht im Zuge einer
Novemberpogrom in den Besitz von Betriebsprüfung einen Jahresumsatz
Nicht-Juden überführt wurden. Die von rund 1 Million RM sowie die Be-
Betriebsräume des Unternehmens schäftigung von über 20 Arbeitnehmern
befanden sich ursprünglich in der mit. 66 Louis Wolf emigrierte dennoch
Jerusalemer Straße 21, seit Juli 1933 in 1935 nach Paris und bevollmächtigte38 Das Foto zeigt die Belegschaft der Konfektionsfirma „Wolf & Schlachter“ in der Mohrenstraße 36 / 37. Im Hintergrund sind die konfektionsmässig hergestellten Damenmäntel auf Kleiderstangen zu erkennen. Berlin ca. 1918–1920. Jüdisches Museum Berlin, Schenkung von Peter Sinclair. Bruno Schlachter, Gesellschafter der Firma „Wolf & Schlachter“ ca. 1935 mit Besuchern in seinem Büro in der Mohrenstraße. Jüdisches Museum Berlin, Schenkung von Peter Sinclair.
39
Georg Zahl, der Käufer der etablierten und exportstarken jüdischen Damenmäntelfabrik „Wolf & Schlachter“,
ließ für die Übergangszeit Briefpapier drucken, auf dessen Briefkopf sowohl der alte, als auch der neue
Firmenname zu lesen war.
Landesarchiv Berlin, A Rep. 342-02, 14736, Bl. 70.
seinen Kompagnon Bruno Schlachter, Unternehmen vom nationalsozialisti-
alle Entscheidungen in seinem Namen schen Gauwirtschaftsberater Heinrich
zu treffen. Schlachter blieb in Berlin und Hunke prüfen, der als besonders radi-
erlebte nach und nach seine eigene kal galt, trotzdem aber nach dem Krieg
Entmachtung als Geschäftsführer. seine Karriere im niedersächsischen
Zunächst ernannte er einen seiner nicht- Finanzministerium fortsetzen konnte. 68
jüdischen Angestellten zum Treuhänder Ebenfalls geprüft wurden der potentielle
der Firma, wie es seinerzeit viele jüdische Käufer, besonders das fachmännische
Unternehmen tun mussten. Dieser Wissen, die Höhe des Eigenkapitals,
wurde schließlich 1938 durch den aber auch die nationalsozialistische
Berliner „Reichstreuhänder der Arbeit“ Linientreue standen dabei im Vorder-
als „Betriebsführer“ eingesetzt. 67 grund. Am 23. November 1938 wurde
Nach dem Pogrom blieb Schlachter keine der Kaufvertrag zwischen den Gesell-
andere Möglichkeit mehr, als sein Unter- schaftern der oHG „Wolf & Schlachter“
nehmen zu veräußern. und dem Kaufmann Georg Zahl abge-
schlossen. Bruno Schlachter und seine
Der Erwerb eines jüdischen Unterneh- Kollegen mussten sich darin verpflich-
mens durch einen Nicht-Juden musste ten, Georg Zahl einzuarbeiten und
zunächst beim Berliner Polizeipräsiden- bezüglich der Exportgeschäfte beratend
ten beantragt werden. Dieser ließ das zur Seite zu stehen. 69Sie können auch lesen