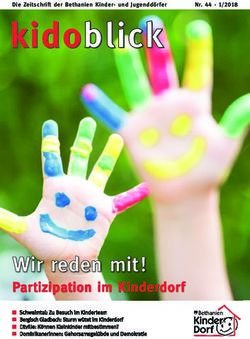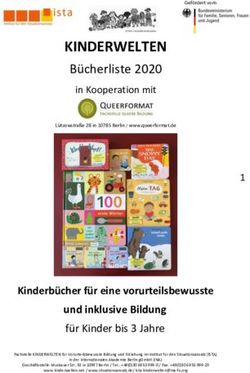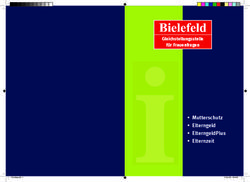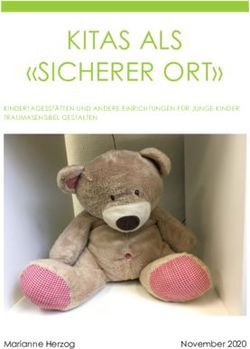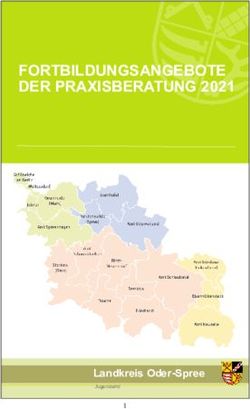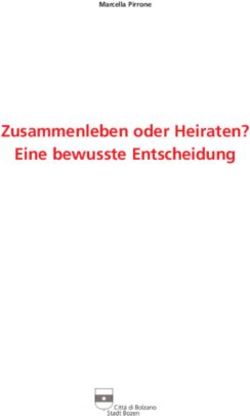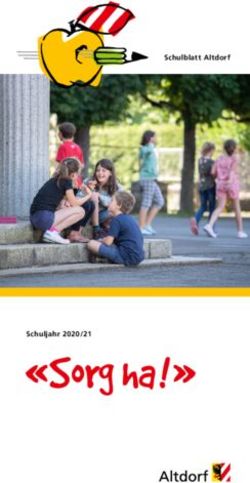KONZEPTION - "ERZIEHUNG IST LIEBE - SONST NICHTS." 89257 ILLERTISSEN - STADT ILLERTISSEN
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
KONZEPTiON
„Erziehung ist Liebe – sonst nichts.“
Friedrich Wilhelm August Fröbel
89257 Illertissen
Saumweg 7Kinderkrippe Glühwürmchen
Inhaltsverzeichnis:
1. Struktur und Rahmenbedingungen unserer Einrichtung
1.1. rechtlicher Auftrag Seite 3
1.2 Geschichte Seite 3
1.3 Unsere Einrichtung Seite 4
1.3.1 Träger Seite 4
1.3.2 Öffnungs- und Ferienzeiten Seite 5
1.3.3 Leitbild Seite 5
1.3.4 Räumliche Situation Seite 6
2. Bild vom Kind
2.1. Selbstbild und Grundhaltung Seite 7
2.2. Eingewöhnung Seite 7
2.3. Eingewöhnung praktisch Seite 8
2.4. Bindungsaufbau Seite 9
2.5. Übergang in den Kindergarten Seite 9
3. Bildung und Erziehung in der Kinderkrippe
3.1. beziehungsvolle und achtsame Pflege Seite 10
3.2. freie Bewegungsentwicklung und Spiel Seite 12
3.3. Kleinkinder untereinander – Kontakte in der Gruppe Seite 11
3.4. Tagesablauf – Verlässlichkeit und Veränderung Seite 11
3.5. Gesundheitspädagogik – gesunde Ernährung, Sauberkeitsentwicklung Seite 12
3.6. Entwicklung und Stärkung der Basiskompetenzen Seite 13
3.7. Rolle/Aufgabe der Pädagogen Seite 17
3.8. ganzheitliches und differenziertes Lernangebot Seite 17
3.9. Beziehungsgestaltung Seite 18
4. Wahrnehmen / Beobachten der Eigenaktivität Seite 19
4.1. Vorbereitung / Gestaltung einer anregenden Lernumgebung Seite 19
4.2. Beteiligung der Kinder Seite 20
4.3. Entwicklungsbegleitung in die Zone der nächsten Entwicklung Seite 21
5. Dokumentation der Lernschritte Seite 21
6. Partnerschaftliche Kooperation mit den Eltern Seite 22
7. Fachaustausch und Weiterbildung Seite 23
8. lokales Netzwerk mit anderen Institutionen Seite 24
9. Inklusion Seite 24
10. Kinderschutz Seite 25
11. Qualitätssicherung – und Qualitätsverbesserung Seite 25
2Kinderkrippe Glühwürmchen
1. Rahmenbedingungen
1.1 Rechtlicher Auftrag
Auf internationaler Ebene sind gemeinsame Regelungen vorherrschend. Insbesondere folgende UN-
Konventionen, denen Deutschland beigetreten ist, und EU-Richtlinien enthalten gemeinsame
Vorgaben zum Bildungsauftrag:
Die UN-Konvention über die Rechte des Kindes gesteht Kindern ein Recht auf bestmögliche Bildung
von Anfang an und ein Recht auf umfassende Mitsprache und Mitgestaltung ihres Bildungsprozesses
zu. Mit der Ratifizierung der UN-Konvention über die Rechte der Menschen mit Behinderung, die das
Recht auf Bildung für alle Kinder in inklusiven Einrichtungen festschreibt, hat sich Deutschland
verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem schrittweise einzuführen und umzusetzen. Kulturelle
Vielfalt als Bereicherung zu betrachten und durch interkulturelle Bildung den Dialog und die
Zusammenarbeit zwischen Menschen mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund zu befördern
sind Bildungsgrundsätze, die in der UN-Konvention über den Schutz und Förderung der Vielfalt
kultureller Ausdrucksformen niedergelegt sind. Der Europäische und der Deutsche
Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR/DQR) definieren Lernergebnisse (erworbene
Kenntnisse, Fertigkeiten, Kompetenzen) auf verschiedenen Bildungsniveaus, um dadurch
Bildungsgänge und- Abschlüsse zwischen den EU-Staaten transparent und vergleichbar zu machen
und allen Bildungsteilhabern mehr Mobilität zu ermöglichen.
Eine weitere Konkretisierung des gemeinsamen Bildungsauftrags findet in erster Linie auf der Ebene
der Länder statt. Obgleich die Grundsätze und Ziele des Bildungsauftrags von Kindertagespflege,
Kindertageseinrichtung sowie Grund- und Förderschulen in verschiedenen Landesgesetzen verankert
sind, herrschen inhaltliche Gemeinsamkeiten vor. Mit Verabschiedung der Bildungsleitlinien wird ein
gemeinsamer verbindender Bezugsrahmen geschaffen.
Recht auf Bildung und Grundsätze des gemeinsamen Bildungsauftrags
Das Recht auf Bildung von Anfang an wird in den bundesrechtlichen Rahmenvorgaben zur Förderung
von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege1 sichergestellt. Diese regeln den Platzanspruch
für Kinder im Kindergartenalter und ab 1. August 2013 auch für Kinder ab dem ersten Lebensjahr
und werden durch Landesrecht konkretisiert. Das 2005 neu eingeführte Bayerische Kinderbildungs-
und Betreuungsgesetz (BayKiBiG) und dessen Ausführungsverordnung tragen dem hohen
Stellenwert der frühen Bildung Rechnung. Sie rücken den Bildungsauftrag in den Vordergrund und
stärken diesen durch verbindliche Regelung von Bildungsgrundsätzen und -zielen.2 Als
Orientierungsrahmen schaffen der 2005 ebenfalls neu eingeführte Bayerische Bildungs- und
Erziehungsplan für Kinder in Tageseinrichtungen bis zur Einschulung (BayBEP).
1.2 Geschichte
Das Gebäude der Glühwürmchen ist das ehemalige Bürogebäude der Lechwerke, zu erkennen an
den grünen Fenstern. Das Gebäude liegt sehr zentral im Herzen Illertissens.
Die Kindertageseinrichtung Stadtpiraten nutzte übergangsweise das Gebäude, bis sie in ihre neue
Einrichtung in der Mozartstraße einzogen. Zunächste wurde das Gebäude im Erdgeschoss für eine
1
§§22-26 Achtes Buch Sozialgesetzbuch – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII)
2
Art. 10 – 17 BayKiBiG, §§ 1 -14 AVBayKiBiG
3Kinderkrippe Glühwürmchen
eine Krippengruppe umgebaut. An September 2021 eine zweite Krippengruppe auf dem
gleichen Stockwerk geplant. Die Kinderkrippe Glühwürmchen ist für 2 Gruppen vorgesehen.
In dem zweiten Stockwerk befindet sich die Musikschule Illertissen.
1.3 Unsere Einrichtung
Kinderkrippe Glühwürmchen
Saumweg 7
89257 Illertissen
Kontakt Leitung Frau Edeltraud Baedeker:
Telefon: 07303/1579913
Mobil: 0152 05471293
Mail: Krippe-Saumweg@illertissen.de
Homepage: https://www.illertissen.de/krippe-gluehwuermchen
1.3.1 Träger
Die Trägerschaft des Kindergartens liegt bei der Stadt Illertissen.
Vertreter dieser Gemeinde ist der erste Bürgermeister Jürgen Eisen.
Erster Bürgermeister
Jürgen Eisen
4Kinderkrippe Glühwürmchen
Kontakt Träger
Bei schriftlichen oder telefonischen Anfragen können Sie sich an folgende Adresse wenden:
Stadt Illertissen
Hauptstraße 4
89257 Illertissen
Homepage: https://www.illertissen.de
Telefon 07303 172 – 43 bzw. 46
Telefax 07303 172 - 27
E-Mail: Poellmann@illertissen.de
Roemer@illertissen.de
1.3.2 Öffnungs- und Ferienzeiten
Die Kinderkrippe Glühwürmchen öffnet jeden Morgen um 7.00 Uhr ihre Türen. Die Betreuungszeit
dauert bis 17.00 Uhr. Um effektiv mit den Kindern arbeiten zu können, beenden wir die Bringzeit um
8.00 Uhr. Nachdem alle Kinder im Haus sind, wird die Haustüre aus Sicherheitsgründen
abgeschlossen.
Die Abholzeit beginnt um 12.00 Uhr
Unter Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen werden unsere Schließtage am Anfang des
Kindergartenjahres vom Träger erstellt und den Eltern bekannt gegeben.
Festgelegte Schließtage sind:
Weihnachten
Sommerferien (3 Wochen)
drei pädagogische Tage
Faschingsdienstag
Betriebsausflug
Weiterbildungen für das pädagogische Personal (2 Tage)
1.3.3 Leitbild
Jedes Kind stellt für uns eine eigenständige Persönlichkeit dar, die ernstgenommen und
wertgeschätzt werden möchte. Deshalb hat das Kind ein Recht darauf, so zu sein wie es ist, mit all
seinen Schwächen und
Stärken.
„Du bist mir wichtig!“
Diese Botschaft vermitteln wir im täglichen Beisammensein und bringen dem Kind das Gefühl von
Geborgenheit und Verständnis entgegen. Die geäußerten Meinungen, Gefühle und
unterschiedlichen Bedürfnisse jedes Kindes gilt es für uns wertschätzend aufzunehmen.
5Kinderkrippe Glühwürmchen
„Kinder sind Akteure ihrer eigenen Entwicklung.“
In ihnen steckt eine Menge an Neugierde und sie sind wissbegierig nach jeglicher Art von
Erfahrung. Für uns heißt dies, jedem Kind den benötigten Rahmen für seinen persönlichen Weg zu
geben.
Kinder lernen sehr vielseitig und häufig auf ganzheitliche Weise.
Das Kind lernt und entwickelt sich im Dialog mit anderen Kindern.
Deshalb sind die einzelnen Kinder in der Gruppe wichtig.
Ebenso von großer Bedeutung für die kindliche Entwicklung ist der
Umgang mit Spielmaterialien, dem Raum, sowie Dinge, die zum
Erforschen und Experimentieren dienen.
1.3.4 Räumliche Situation
Kinder unter 3 Jahren brauchen Räume, die Geborgenheit vermitteln. Die Kinderkrippe
Glühwürmchen verfügt über einen großen Wickelraum mit 2 Wickeltischen und kleinen
Kindertoiletten. Der Gruppenraum ist getrennt durch eine Verbindungstür, daran angegliedert ist ein
Bewegungsraum.
Es gibt eine Garderobe für das pädagogische Fachpersonal und eine Toilette für Erwachsene. Für die
Kinder befindet sich im Eingangsbereich die Kindergarderobe. Das Leiterinnenbüro befindet sich
neben dem Ausgang. Im vorderen Bereich des Geländes befindet sich ein Sandkasten.
6Kinderkrippe Glühwürmchen
2. Bild vom Kind
2.1 Selbstbild und Grundhaltung
Selbstbild
Jedes Kind ist einzigartig und verdient Zuwendung. Daher ist es wichtig, dass wir, das päd.
Fachpersonal, Spaß bei der Arbeit haben. Offenheit und Freundlichkeit sind notwendig, um allen
Kindern gerecht zu werden.
Durch einen offenen Umgang mit unseren eigenen Gefühlen ermöglichen wir den Kindern unsere
Empathie zu zeigen.
Grundhaltung - Empathie
Besonders bei kleinen Kindern ist es wichtig, dass wir, als päd. Fachpersonal, die Gefühle
der Kinder erkennen und deuten können. Daher arbeiten wir daran, gezielt auf die Bedürfnisse
einzelner Kinder einzugehen. Auf diese Weise lernen Kinder ganz automatisch, ebenfalls auf die
Bedürfnisse und Wünsche anderer Kinder einzugehen.
Transparenz und Glaubwürdigkeit
Wir sind ehrlich gegenüber den Kindern. Wir bringen unsere Meinung zum Ausdruck und
agieren offen gegenüber den Kindern. Sie sollen nicht das Gefühl haben, dass sie uns nicht
trauen können.
Motivation
Wir motivieren die Kinder stets dazu, etwas Neues auszuprobieren. Wir setzen stets neue Reize,
um Kinder zu fordern
2.2 Eingewöhnung
Der Eintritt in die Kinderkrippe stellt einen prägenden Übergang im Leben eines Kindes dar.
Der Übertritt vom Elternhaus in die Kinderkrippe fordert eine enge Zusammenarbeit von
pädagogischen Bezugspersonen und Eltern. Ein individueller Austausch und ein verständnisvolles
Miteinander erleichtern die Eingewöhnung. In dieser sensiblen Phase für Kinder und Eltern steht
das pädagogische Personal unterstützend und beratend zur Seite.
Zur Orientierung am ersten Tag laden wir in der Regel Eltern und Kind ein. Löst sich das Kind
bereitwillig von den Eltern ab, bleibt es für einen kurzen Zeitraum alleine in der Gruppe (die Eltern
befinden sich in einem Nebenzimmer oder sind in Rufbereitschaft).
In den ersten Wochen (Eingewöhnungszeit) erstellen wir mit den Eltern einen individuellen Zeitplan.
In der Regel richten wir uns nicht nach der Betreuungszeit, sondern nach den Bedürfnissen des Kindes.
Man spricht in den ersten Monaten von einer sogenannten Eingewöhnung, da Kinder in dieser Zeit
Verhaltensweisen zeigen, die im Zusammenhang mit dem Krippeneintritt stehen können. Kinder
bewältigen ihren Übergang in einem individuellen Tempo.
Um einen guten Start in die Kinderkrippe zu ermöglichen, wollen wir für Eltern und Kind eine offene
Atmosphäre schaffen. Rituale und Aufnahmespiele erleichtern den Kindern die Eingewöhnung.
7Kinderkrippe Glühwürmchen
Die Eingewöhnungszeit ist gelungen, wenn folgende Merkmale vorliegen:
- Der Wechsel von Familie und Krippe in der Bring- und Abholzeit gelingt gelöst und entspannt.
- Das Kind zeigt positive emotionale Empfindlichkeit und entwickelt Interesse für die Angebote
unserer Krippe
- Erste Freundschaften werden geknüpft und es ist ein erstes Zugehörigkeitsgefühl
zur Kindergruppe erkennbar
- Das Kind lernt die Regeln, die für den Tagesablauf und für das soziale Miteinander
gelten
2.3. Eingewöhnung praktisch
Trennungserfahrung ist für die Entwicklung des Kindes zur Selbstständigkeit nötig.
Es gewinnt mehr Vertrauen zu sich, aber auch zu seinen verlässlichen Bezugspersonen. Dadurch, dass
die Erziehungsberechtigten zwar weggehen, aber garantiert immer wiederkommen, verliert es die
Angst, verlassen zu werden. Übergänge brauchen Zeit. Die Kinder müssen sich am neuen Ort
eingewöhnen und Vertrauen in die Umgebung und zu den pädagogischen Fachkräften entwickeln. Erst
dann können Eltern für kurze - und allmählich längere Zeit weggehen.
Es kann geschehen, dass Kinder, die bisher bei Trennungen nicht geweint haben, plötzlich damit
beginnen: Sie weinen herzzerreißend und weigern sich, allein zurück zu bleiben. Das heißt aber nicht,
dass Sie deswegen gleich aufgeben müssen.
Größere Selbstständigkeit muss oft ein wenig „erlitten“ werden – sowohl vom Kind, als auch von den
Eltern. Häufig ist das Kind nach einem tränenreichen Abschied ganz vergnügt und zufrieden, sobald
die Eltern außer Sicht sind!
Da Eltern das nicht mehr selber beobachten können, bieten wir Ihnen an, telefonisch nachzufragen,
ob sich ihr Kind beruhigt hat.
Beim Abschied nehmen, ist es besonders wichtig, den Zeitpunkt der Trennung nicht hinauszuzögern.
Ein kurzer, bestimmter und herzlicher Abschied fällt dem Kind meist leichter als ein „langsamer
Abschied“, bei dem der schmerzliche Moment der Trennung hinausgezögert wird.
Unterstützend kann auch ein persönliches Ritual sein, mit dem der Abschied immer gleich gestaltet
wird. Auch wenn ein Kind weint, wenn sich die Mutter verabschiedet und geht, können wir den
Abschiedsschmerz nicht „ersparen“.
Ein kleines persönliches Ritual in unserer Einrichtung ist, dass ein Kind immer zum gleichen Fenster
nach Verabschiedung der Bezugsperson winkt, auf dem Arm des pädagogischen Fachpersonals.
Ablauf der Eingewöhnung:
Schritt 1: Die ersten zwei Tage kommt das Kind in Begleitung einer Bezugsperson
für ein bis zwei Stunden
Schritt 2: Am dritten Tag erfolgt ein Trennungsversuch, je nach Reaktion des
Kindes wird über den weiteren Verlauf der Eingewöhnung entschieden
Schritt 3: Erst wenn die Pädagoginnen vom Kind als sichere Basis akzeptiert sind und
sich von ihnen trösten lässt, ist die Eingewöhnung abgeschlossen.
Siehe auch: Eingewöhnung Berliner Modell nach Professor Laewen
8Kinderkrippe Glühwürmchen
2.4 Bindungsaufbau
Wenn ein Kleinkind in unsere Kinderkrippe kommt, verlässt es in der Regel zum ersten Mal für
längere Zeit den engen Kreis seiner Familie. In der neuen Situation ist es zunächst unsicher,
verängstigt und unglücklich. In dieser Übergangsphase ist es wichtig, dass die pädagogische
Bezugsperson möglichst schnell zu einer primären Bezugsperson wird – zu einer Basis, wo sich das
Kind beschützt und geborgen fühlt. Aus dieser Situation heraus kann es die Umgebung erkunden
und mit anderen Kindern Kontakt aufnehmen. Es kann zu der pädagogischen Bezugsperson
zurückkehren, um sich trösten zu lassen und wieder Mut für neuen Unternehmungen zu finden.
Bindungen entstehen leichter in kleinen, stabilen Gruppen.
Um eine gute Bindung zwischen pädagogischem Fachpersonal und den Kindern zu entwickeln,
brauchen die Pädagogen Eigenschaften und Verhaltensweisen wie Sensibilität, Empathie, Respekt,
Wertschätzung, Rücksichtnahme, emotionale Wärme und Zuneigung.
Akzeptanz der Persönlichkeit und des Wesens des Kindes sowie Anerkennung seiner Individualität
sind ebenfalls wichtig. Jede Pädagogin ist sich bewusst, wie wichtig Bindungen im Leben von
Kleinkindern sind.
Carlson (2006) betont die Bedeutung des Körperkontakts für den Aufbau und die Pflege von
Bindungen. Sie schreibt:“ Wenn man Kinder warmherzig berührt, sie auf den Schoß nimmt und
fürsorglich reagiert, wenn sie unglücklich sind, dann gibt man ihnen die für ein gesundes Selbstbild
erforderlichen Zutaten – man gibt ihnen das Gefühl, geschätzt, gehegt und beschützt zu werden.3“
2.5 Übergang in den Kindergarten
Unsere Kinder sollen diesen Übergang positiv erleben. Mit Freude und Zuversicht sollen sie sich auf
die neue Lernumgebung der Kindergartengruppe einlassen können. Der Abschied von der
Kinderkrippe ist immer auch mit Trennung und Loslassen verbunden. Trennungsschmerz muss
angesprochen werden. Abschied nehmen wird in Rituale, wie beispielsweise ein Abschiedsfest und
ein Geschenk eingebettet.
Zum Abschied werden wir uns noch einmal das Portfolio des Kindes anschauen und darüber reden,
was es alles gelernt hat und welche großen Entwicklungsschritte damit verbunden waren. Damit
wird dem Kind vermittelt, dass es auch neue Herausforderungen bewältigen kann.
Mit dem Besuch einer Kindergartengruppe sind für Krippenkinder neue Anforderungen verbunden.
Im Gegensatz zur behüteten Atmosphäre in der Krippe werden sie in der Regel auf größere Gruppen
stoßen, im sozialen Miteinander müssen sie sich gegenüber den vielen neuen und oft auch älteren
Kindern behaupten. Sie müssen sich an einen Tagesablauf gewöhnen, der in der Regel weniger
Ruhephasen und Pflegezeit bietet.
In unserem Krippenalltag wird das Thema „Kindergarten“ durch Themenbücher veranschaulicht.
Bei einem Besuch in einen nahegelegenen Kindergarten, kann gemeinsam mit den großen Kindern
auf dem Kindergartenaußengelände gespielt werden. Wir erleben dort einen Vormittag mit
Frühstück, Freispielund vielen tollen Dingen.
Die Kinder können so erste Kontakte aufbauen und ein neues Umfeld kennenlernen. Sie wissen, dass
ihnen nach einigen Stunden die überschaubare und behütete Atmosphäre der Kinderkrippe wieder
zur Verfügung steht. Für die Kooperation zwischen Krippe und Kindergarten ist es uns wichtig, dass
wir uns mit den Kindergartengruppen der umliegenden Einrichtungen austauschen.
3
Textor (2006), S. 21
9Kinderkrippe Glühwürmchen
Da an unserer Kinderkrippe kein Kindergarten angegliedert ist, können Sie direkt bei der
Anmeldung mitteilen, in welchen Wunsch-Kindergarten Ihr Kind ab dem 3. Lebensjahr gehen
soll. Somit können wir Ihnen einen Platz in Ihrer Wunsch-Einrichtung ermöglichen – ohne dass eine
erneute Anmeldung notwendig ist.
3. Bildung und Erziehung in der Kinderkrippe
3.1 Beziehungsvolle und achtsame Pflege
In der Kinderkrippe spielt Körper- und Gesundheitspflege der unter Dreijährigen eine besondere
Rolle. Dabei geht man davon aus, dass die hier gemachten Erfahrungen für die Kinder bereits sehr
wertvolle soziale Momente sind, in denen sie auch schon wichtige Lernerfahrungen machen.
Die ungarische Kinderärztin Emmi Pikler, die neue Sichtweisen in die Kleinkind- und Säuglingspflege
einbrachte, spricht in diesem Zusammenhang von beziehungsvoller und achtsamer Pflege.
In der „Pikler-Pädagogik“ geht man davon aus, dass Kinder sichere, stabile Beziehungen und
Geborgenheit in Pflegesituationen brauchen und sie möglichst selbstständig und aktiv an den
Situationen teilhaben sollen.
Grundgedanke ist dabei, dass kleine Kinder bereits als selbstständige Persönlichkeiten verstanden
werden.
Das bedeutet in diesem Zusammenhang, dass wir während der Pflegetätigkeit viel mit dem Kind
sprechen. Wir erklären ihm, was als nächstes in dem Waschprozess passieren wird. Wir stellen auch
Fragen und warten auf die Zustimmung des Kindes. Augenkontakt und Zeit für diese Prozesse sind
uns wichtig. Stress und Unkonzentriertheit führen leider schnell zu einer gehetzten Atmosphäre, die
auch das Kind wahrnimmt. Auch kleine Kinder sind in der Lage zu kooperieren, z.B. bei Socken oder
Mütze an- und ausziehen.
Eine Pflegesituation wird daher nicht als schnelle Aufgabenerledigung betrachtet, sondern als
wertvolle Beziehungsarbeit verstanden.4
3.2 freie Bewegungsentwicklung und Spiel
Anhand von Textauszügen aus dem sehr empfehlenswerten Buch „Halt mich fest, dann wird
ich stark“ von Wolfgang Bergmann (2008) möchte ich verdeutlichen, wie Selbstständigkeit
Kinder bilden und gleichzeitig schwierigen Kindern helfen kann, ihr Leben in den Griff zu
bekommen:
a. Trainieren führt nur zu eng umschriebenen Verhaltensweisen
b. Überbehütung führt zu ungeschicktem – weil ungeübtem - sozialem Verhalten
c. Freies Spiel muss beachtet und wertgeschätzt werden, damit sich Kinder darauf
einlassen können und wollen
d. Seelische Verwundungen können im freien Spiel besser verarbeitet werden
Das kindliche Spiel ist einerseits ein Training, um Alltagserlebnisse zu verarbeiten und sich in
verschiedene Rollen einzufühlen, andererseits gewinnen die Kinder durch Wiederholungen und
4
Grieper Aus Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Erziehung, M.Ed. Elenea Grieper S.
10Kinderkrippe Glühwürmchen
ähnliche Situationen Sicherheit und Routine. 5
Bewegung in der Krippe
Das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die eigene Wirkungsmöglichkeit, das durch die
tägliche Erfahrung geschwächt oder verstärkt werden kann, hat eine grundlegende Wirkung auf
die Tätigkeit der Kinder, ihr Verhalten und ihre Ziele, wie auf die gesamte Struktur ihrer späteren
Persönlichkeit“ schreibt Emmi Pikler in ihrem Hauptwerk zur Bewegungsentwicklung „Lasst mir
Zeit“ (Pikler 2001,166). Damit weist sie auf eine Dimension hin, die dem Bewegungslernen eigen ist:
Es beinhaltet nicht nur das Erreichen einzelner Etappen auf dem Weg zum freien Stehen und Gehen.
Die Art und Weise, wie dieses Lernen geschieht, hat wesentlichen Einfluss auf das Selbstvertrauen,
das körperliche und soziale Selbstbild, die Eigenverantwortlichkeit und das Problemlösungsverhalten
des kleinen Kindes, also auf wichtige Facetten der Persönlichkeitsstruktur.6
3.3. Kleinkinder untereinander- Kontakte in der Gruppe
Schon Babys sind von der Anwesenheit anderer Kinder fasziniert. Einjährige spielen einfache Spiele
wie Vormachen und Nachmachen, Verstecken und Suchen. Sie trösten sich gegenseitig und sie
schließen Freundschaften, wenn sie häufig beieinander sind.
Ältere Kinder, Zwei- und Dreijährige, brauchen nicht mehr ständig die geballte mütterliche Fürsorge
bei ihren sozialen Kontakten. Sie wollen allein ausprobieren. Das erweitert ihren sozialen Horizont,
denn andere Kinder verhalten sich anders als Erwachsene. Sie sind nicht immer so fürsorglich,
nehmen keine Rücksicht, wollen nicht belehren. Auch damit muss man lernen umzugehen. Wo
Kinder verschiedenen Alters zusammen sind, lernen Größere Rücksicht auf Kleinere zu nehmen,
Kleinere gucken sich viel bei den Größeren ab.
Unsere Kleinen schauen sich bei den Großen ab, wie man Türen aufmacht, wie Bälle geworfen
werden, wie man Brotdosen öffnet usw. Ganz selbstverständlich und ohne großen Aufwand.
3.4 Tagesablauf - Verlässlichkeit und Veränderung
Unser Tagesablauf gestaltet sich so:
7.00 Uhr – 8.00 Uhr Ankommen und Begrüßung der Kinder
8.30 Uhr – 9.00 Uhr Morgenkreis
9.00 Uhr – 9.30 Uhr gemeinsames Frühstück
9.30 Uhr - 11.00 Uh Freispiel oder gezielte Angebote, Ausflüge, Naturerfahrungen
11.00 Uhr Wickeln – Toilettengang
11.30 Uhr Mittagessen
12.00 Uhr Abholzeit
11.30 Uhr- 12.30Uhr Schlafenszeit
nach dem Schlafen, Wickeln bzw. Toilettengang
13.30 Uhr Mittagssnack
5
Monika Aly – Anja Werner. das Kita- Handbuch
https://www.kindergartenpaedagogik.de/fachartikel/freispiel-spiele/2002
6
Aus Pikler International – Bewegung Krippe
piklerinternational.com/de/aktivitaeten/109-bewegung-in-der-krippe
11Kinderkrippe Glühwürmchen
ab 14.00 Uhr Freispielzeit bzw. Abholzeit
16.00 Uhr - 17.00Uhr Spätgruppe
Unser Angebot wird regelmäßig durch Ausflüge, Geburtstagsfeiern, jahreszeitliche Feste und
Projekte ergänzt bzw. ersetzt. Kinder die in unserer Krippe einen heilpädagogischen Platz besetzen,
erhalten während der Öffnungszeiten individuelle Therapiestunden von Therapeuten, die von
außerhalb
kommen.
Raum für Veränderungen
So stabilisierend ein fester Tagesablauf auch ist, so sehr achten wir natürlich auch darauf,
dass noch Raum für spontane Unternehmungen, Muße und Veränderung bleibt. Total verplante
Tage sind Gift für kindliche Kreativität. Die Struktur des Krippenalltags sollte dem gelebten Leben
entsprechen- und sich wie dieses wandeln können.
3.5 Gesundheitspädagogik- gesunde Ernährung, Sauberkeitsentwicklung
Gesunde Ernährung
Von großer Bedeutung für die Gesunderhaltung des Körpers sowie die Verhütung und Vorbeugung
Von Krankheiten ist die Ernährungserziehung. Kinder sollten in der Tageseinrichtung an eine
gesunde, abwechslungsreiche und bedürfnisorientierte Nahrung gewöhnt werden, die reich an
Vitaminen, Mineral- und Ballaststoffen ist. Die Fähigkeit in Maßen zu genießen, ist ein wichtiger
Bestandteil der Lebensqualität.
Kinder sollen erfahren,
was gesund oder ungesund ist
was und wieviel sie trinken sollen
wie ein gesundes Frühstück und Mittagessen zusammengesetzt ist
dass man Mahlzeiten langsam isst und gut kaut
dass Süßigkeiten und gezuckerte Getränke nur in Maßen konsumiert werden soll
dass man gesunde Nahrungsmittel (Rohkost, Obst, Nüsse, Rosinen) mit allen Sinnen
genießen kann7
Wir haben in der Einrichtung einen Caterer, der sich auf den Krippenbereich spezialisiert hat.
Das Frühstück bringen die Kinder von zu Hause mit. Im Rahmen der Ernährungserziehung können
wir einzelne Snacks mit frischen Zutaten mit den Kindern vorbereiten.
Sauberkeitserziehung
Die körperliche Reife nimmt in der Sauberkeitserziehung eine wichtige Rolle ein. Experten weisen
darauf immer wieder darauf hin, dass eine vollständige Darmkontrolle erst zwischen und dem
dritten Lebensjahr entwickelt ist. Die Mehrheit der Kinder ist sogar erst im dritten und vierten
Lebensjahr sauber und trocken. Wichtig ist, dass sich durch ein voreiliges Training der
Reifungsprozess der Darm- und Blasenkontrolle nicht beschleunigen lässt. Genügend Zeit und Raum
für Intimität sind zentrale Bestandteile einer erfolgreichen Sauberkeitserziehung.
Bei unserer Sauberkeitserziehung lassen wir ab ca. 2,5 Jahren bei den Kindern die Windel aus und
gehen öfter zur Toilette. Benutzt das Kind mit Erfolg die Toilette oder das Töpfchen, so lassen wir das
7
Textor, Martin. Gesundheitserziehung
12Kinderkrippe Glühwürmchen
Kind wissen, wie gut wir das finden und dass wir zufrieden sind. Alle Erfolge werden gelobt.
Häufig allerdings gibt es auch ein kleines „Unglück“. Dieser „Misserfolg“ wird von uns nicht beachtet
und als schlimm angesehen. Das Kind wird ohne viel Aufhebens einfach umgezogen. Macht sich das
Kind von selbst bemerkbar, dass es zur Toilette muss, so begleiten wir es selbstverständlich zum
Wickelraum und bleiben in der Nähe.
In der Kinderkrippe wird die Sauberkeitsentwicklung erleichtert, denn Kinder lernen von Kinder
durch Nachahmung. Gerade in dieser Phase hat die Vorbildfunktion, meist älterer Kinder, sowie die
gegenseitige Unterstützung der Kinder untereinander, eine sehr große Bedeutung.8
3.6 Entwicklung und Stärkung der Basiskompetenzen
Der Bayrische Bildungs- und Erziehungsplan ist Grundlage unserer Arbeit.
Der BEP ist der Leitfaden für die Umsetzung des im Bayrischen Kinderbildungs- und
Betreuungsgesetzes (BayKiBiG Art.10 und 13) dargestellten Bildungsauftrages und der in der
Ausführungsverordnung zum Bayrischen Kinderbildungs- und Betreuungsgesetz verbindlich
festgeschriebenen Bildungs- und und Erziehungsziele.
Er unterstreicht den Wert frühkindlicher Bildung und dementsprechend die Wichtigkeit
pädagogischer Arbeit. Die zentralen Ziele des Plans sind die Stärkung der Kinder, der kindlichen
Autonomie und der sozialen Mitverantwortung. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Förderung
grundlegender Kompetenzen und Ressourcen, die die Kräfte des Kindes mobilisieren und es
befähigen, ein Leben lang zu lernen.
Voraussetzungen zum Erlernen von Basiskompetenzen sind:
eine Atmosphäre von gegenseitiger Akzeptanz und Zusammengehörigkeit. Wir unterstützen das
Kind in seinem Selbstwertgefühl und seiner Selbstbestimmung. Achtung und Toleranz gegenüber
Allen sind ebenso wichtig wie ein gesundes Selbstbewusstsein. Die Kinderkrippe möchte
Orientierungshilfen anbieten, sich in einer komplexen Welt zurechtzufinden.
Kinder sollen möglichst umfassend auf das Leben vorbereitet werden und müssen lernen in
sämtlichen Lebenssituationen zurechtzukommen. Dazu brauchen sie die Entwicklung von
unterschiedlichen Fähigkeiten, die in den Basiskompetenzen zu finden sind.
Zur Bildung der gesamten Persönlichkeit des Kindes unterstützt
und fördert das Team folgende Basiskompetenzen.
> Den Erwerb von personalen und motivationalen, physischen und sozialen Kompetenzen
>Die Kompetenz, neues Wissen bewusst, selbstgesteuert und reflektiert zu erwerben (BEP S.66)
lernmethodische Kompetenzen
> Die Stärkung des Kindes, der kindlichen Selbstbestimmung und der
sozialen Mitverantwortung.
> Kinder wollen selbst bestimmen, nicht fremdgesteuert, sondern selbstgesteuert (autonom)
handeln.
8
https//kinderbetreuung-staatsbibliothek.de/paedagogik/koerperliche-entwicklung-sauberkeitentwicklung
13Kinderkrippe Glühwürmchen
Aus diesem Grund erhalten die Kinder in unserer Einrichtung möglichst oft die Gelegenheit,
selbst zu entscheiden, was sie tun und wie sie es tun wollen. Dies geschieht in Projekten, die von
den Kindern erfragt werden, oder wo die Kinder Interesse zeigen,
wie z.B. „Was kriecht auf der Erde? (motivationale Kompetenz).
> Erinnerungsvermögen oder Neugierde (kognitive Kompetenz).
> Im Gruppengeschehen sollen „unsere“ Kinder lernen, mit Anderen Beziehungen aufzubauen, die
durch Sympathie und gegenseitigen Respekt gekennzeichnet sind (soziale Kompetenz).
> Im täglichen Miteinander wird gegenseitige Hilfsbereitschaft gefördert und das
Einfühlungsvermögen in die Anderen gestärkt (Empathie).
> In unserer Einrichtung lernen die Kinder, in der Gruppe zusammenzuhalten und sich füreinander
einzusetzen (Solidarität).
> Durch das grundlegende Bedürfnis des Kindes nach sozialer Zugehörigkeit übernimmt es die Werte
der Bezugsgruppe und diese Werte zu seinen eigenen (Werthandlungen).
> Kinder lernen, dass sie selbst für Ihr Verhalten und Erleben verantwortlich sind und sich für
Schwächere und Benachteiligte einsetzen (Verantwortungsübernahme).
> Durch Konsensfindung im Gespräch lernen die Kinder, sich demokratisch zu verhalten. Ebenso
lernen Kinder auf diese Weise, Konflikte zu lösen (demokratische Teilhabe).
> Durch unsere Pädagogik werden die Kinder auch befähigt, mit Veränderungen und Belastungen
umgehen zu können und somit ihre Widerstandfähigkeit zu stärken (Resilienz).
> Außerdem ist uns wichtig, dass unsere Kinder Sensibilität für ihre Umwelt und alle Lebewesen
entwickeln.
Sprachkompetenz
Sprachkompetenz ist die Grundlage für die Teilnahme am gesellschaftlich-kulturellen Leben.
> Freude an Sprache entwickeln
> Fähigkeit und Motivation entwickeln, Gefühle und Bedürfnisse auch sprachlicH auszudrücken
> Entwicklung und Ausdifferenzierung vielfältiger nonverbaler Ausdrucksformen
(Mimik, Intonation und Körpersprache)
> Fähigkeit zuzuhören
> Interesse an Dialog, Dialogfähigkeit
> Freude an Büchern, Geschichten und Reimen (Literacy- Förderung)
>Zwei- und Mehrsprachigkeit positiv erleben
> Interesse für fremde Sprachen entwickeln
Die Kinder unserer Einrichtung holen täglich Bilderbücher mit einfachen Darstellungen aus der
Bücherkiste. Kurze Reime und Fingerspiele bringen sie zum Lachen, wie z.B. „Eine kleine
Dickmadam.“ Da wir Kinder aus unterschiedlichen Kulturkreisen haben, lernen sie kleine Worte
ausländisch, wie Danke auf Griechisch.
Werteorientierung und Religiosität
Wir feiern christliche Feste des Jahreskreises, wie St. Martin, Advent, Weihnachten und Ostern in
unserer Krippe. Zum Martinstag basteln wir Laternen mit unseren Kindern und machen einen
kleinen Martinsumzug mit den Eltern. Im Advent zünden wir jede Woche eine Kerze an und singen
Adventslieder. Die Tradition eines Adventskalenders und Adventskranzes, pflegen wir auch. In der
Weihnachtsfeier werden Weihnachtslieder gesungen und es gibt ein Gruppengeschenk.
14Kinderkrippe Glühwürmchen
Geschenke für die Eltern wurden gebastelt von den Kindern und werden verteilt, damit sie
verschenkt werden können.
An Ostern suchen wir die Osterkörbchen, die mit den Kindern gebastelt werden. Da wir auch Kinder
aus anderen Kulturkreisen haben, ist es möglich, auch deren Feste in den Krippenalltag
miteinzubeziehen.
Respektvoller Umgang miteinander, ist eine Wertehaltung die wir vorleben und den Kindern
vermitteln wollen. Das beginnt schon in kleinen Auseinandersetzungen bei den kleinen Kindern,
dass sie nicht gleich handgreiflich werden, obwohl es mit dem Reden noch nicht so gut klappt.
Ein praktisches Beispiel: Unsere Kinder teilen sehr gern ihr Frühstück mit anderen Kindern. Da
unsere Kinder aus unterschiedlichen Kulturkreisen kommen, lernte ein Kind, dass Heidelbeeren sehr
gut schmecken, die er vorher noch nicht kannte
Mathematische Bildung
Die Kinder lernen den Umgang mit Formen, Mengen, Zahlen sowie Raum und Zeit.
> Grundlegendes Mengenverständnis
> Spielerisches Erfassen von geometrischen Formen mit allen Sinnen
> Förderung der Zählkompetenz
> Erwerb einer realistischen und lebendigen Größenvorstellung
> Gebrauch von Zahlwörtern (z.B. Abzählen)
> Grundbegriffe der zeitlichen Ordnung (Tag, Woche, Monat, Uhrzeit)
> Mathematische Werkzeuge und ihren Gebrauch kennen (z.B. Waage. Lineal)
Die Krippenkinder mögen die Formautos, bei denen sie Würfel aus unterschiedlichen
Formen durchdrücken können. Das Zählen bis 3 mit Fingern ist manchmal möglich.
Sie lieben auch ein Puzzle, das aus unterschiedlichen Schichten besteht. Formen erfassen
dabei und da immer wieder ausprobieren ist sehr wichtig.
Naturwissenschaftliche und technische Bildung
Die Glühwürmchen-Krippe bietet vielfältige Zugänge zu naturwissenschaftlichen Themen.
> Das Wahrnehmen und Hinterfragen der belebten und unbelebten Umwelt mit
allen Sinnen
> Phänomene aus der Welt der Akustik und Optik erfahren
> Naturmaterialien kennenlernen und beschreiben
Da wir täglich mit den Kindern unterwegs sind, erleben sie direkt ihre Umwelt. Sie erleben die
Geräusche der Straße und der Natur. Autos beim Anfahren und Starten der Motoren, Hupen und
das Fahren der Autos bei Regen. Die Enten quaken schon von Weitem, wenn sie uns sehen. Sie sind
in Vorfreude auf ihre Leckerbissen.
Umweltbildung und Erziehung
Ein Bewusstsein für die Natur und die Umwelt ist uns wichtig.
> Wertschätzung der Natur
> Verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen
> Vorstellung über die Artenvielfalt im Pflanzen- und Tierreich entwickeln.
> Die Umwelt mit allen Sinnen w ahrnehmen
15Kinderkrippe Glühwürmchen
> Bewusste Vermeidung von Müll
Wir gehen mit den Kindern fast täglich zum Ententeich, um dort die Enten zu füttern.
Die Kinder schauen aufmerksam zu, wenn die Enten gierig das mitgebrachte Brot verschlingen. Wir
nehmen die Jahreszeit, den Winter mit dem Schnee und Eis wahr. Herumliegenden Müll, werfen
wir in den Mülleimer.
Medienbildung- und Erziehung
Erwerb von Medienkompetenz umfasst folgende Bereiche:
. Mit Medien bewusst und kontrolliert umgehen
. Die Bedeutung und Verwendungsmöglichkeiten von alltäglichen Medien
und Geräten in ihrer Lebenswelt kennen lernen
. Medieninhalte kritisch bewerten (Trennung von Realität und Fantasie)
Im Gruppenraum hören wir öfters eine Musik-CD. Die Kinder wünschen sich meistens das Lied:
„Backe Kuchen“, das eigentlich „In der Weihnachtsbäckerei“ heißt, und machen gerne Bewegungen
dazu.
Ästhetik, Kunst und Kultur
Neugier, Lust und Freude am eigenen kreativen Tun sind Antrieb der kindlichen
Persönlichkeitsentwicklung
. Umwelt und Kultur bewusst mit allen Sinnen wahrnehmen
. Besuch von Theater, Museen und Ausstellungen
. Grundverständnis von Farben und Formen
. Ausdruckskraft von Farben und deren Wirkung auf Stimmung und Gefühle
Wahrnehmen.
Durch Gegenstände in der Einrichtung fragen wir öfters, welche Farbe der Gegenstand hat.
Es macht den Kindern Spaß, sich was zu merken.
Musikalische Bildung und Erziehung
Das Kind er fährt Musik als Quelle von Freude und Entspannung sowie als
Anregung zur Kreativität.
. Freude am gemeinsamen Singen und Musizieren entwickeln
. Musik als Ausdrucksmöglichkeit der eigenen Stimmungen, Gefühle und Ideen
erfahren
. die eigene Sprech- und Singstimme entwickeln
. spielerische Erfahrungen mit Tanz und Rhythmus machen
. differenzierte und musikalische Reize konzentriert wahrnehmen und
unterscheiden
. laut - leise, hoch – tief, schnell – langsam, unterscheiden lernen
. Kennenlernen und Handhabung von Instrumenten
Zu besonderen Festen, singen wir bestimmte Lieder. Es gefällt den Kindern, wenn Liedtexte
als Ritual wiederholt werden. Sie holen sich dazu einfache Musikinstrumente wie Rasseln und
Schellen.
16Kinderkrippe Glühwürmchen
3.7 Rolle/Aufgabe der Pädagogen
In unserer Kinderkrippe Glühwürmchen haben wir zwei pädagogische Kräfte und eine pädagogische
Fachkraft, die langjährige Erfahrung mit Krippenkinder hat.
Die päd. Fachkraft ist zugleich Leitung der Einrichtung und hat eine Zusatzqualifikation zur Fachkraft
für Eltern- und Konfliktgespräche und eine Grundausbildung in der systemischen Therapie.
Fortbildungen zur Krippenpädagogik sind für das gesamte Team geplant.
Wir verstehen unsere Rolle als pädagogische Fachkräfte in der Begleitung und Unterstützung der
Kinder in ihrer Entwicklung und fördern sie durch gezielte pädagogische Angebote. Dabei betrachten
wir jedes Kind als individuelle Persönlichkeit mit eigenen Bedürfnissen und Fähigkeiten. Wir
gestalten den Tag gemeinsam und sind den Kindern dabei in unserer Rolle als pädagogische
Fachkräfte stets ein Vorbild.
Als Vertrauensperson und Partner stehen wir dem Kind stets zur Seite und begleiten es
durch den Alltag, durch besondere Momente, Lernprozesse aber auch Krisen und
Schwierigkeiten.
Gemeinsam im Team ergänzen wir uns durch unterschiedliche Erfahrungen, Kompetenzen
und Interessen. Unsere regelmäßigen Teambesprechungen nutzen wir, um uns im Team
aufeinander abzustimmen, uns in unsere Arbeit zu reflektieren, zusammen pädagogische
Aktivitäten zu planen und um uns gegenseitig zu unterstützen.
Zusammenarbeit Träger
Voraussetzung für eine gute Zusammenarbeit sind Interesse, Verständnis und Offenheit, damit
eine gegenseitige Vertrauensbasis besteht.
Es findet ein kontinuierlicher Austausch zwischen Kindergartenleitung und der Trägervertreterin
statt. Dabei werden Absprachen getroffen, Verhandlungen geführt und organisatorische Aufgaben
geregelt, z.B. Einstellung von Personal, Genehmigung von Fortbildungen, Urlaub,……..
Eine gute Zusammenarbeit besteht auch mit den verschiedenen Amtsstellen der Stadtverwaltung.
Die Arbeit wird von unserem Träger unterstützt. Eine gemeinsame Richtung wird verfolgt,
damit wir unsere Ziele erreichen.
3.8 Ganzheitliches und differenziertes Lernangebot
Kinder lernen in Situationen, in denen das Erfahren, Entdecken und Erforschen mit allen Sinnen im
Mittelpunkt steht. Die Natur bietet viele Spiel- und Lernsituationen, die eine Herausforderung zum
Eigenen Denken, Fühlen, Erleben und Handeln darstellen.
Ganzheitliches Handeln findet so natürlich statt:
- Bewegung
- Wahrnehmung
- Konzentration
- Entspannung
- Rhythmus
- Rituale
Sicherheit, Bewegung und Wahrnehmung sind somit als Verhaltensstabilisierende und- fördernde,
menschliche Bedürfnisse anzusehen.
17Kinderkrippe Glühwürmchen
Da wir jeden Tag mit den Kindern in die Natur gehen, haben sie ein festes Ritual, auf das sie
sich freuen.
Sie bewegen sich gerne und konzentrieren sich gut auf ihre Bewegungsabläufe. Wenn sie danach
wieder in ihrem Wagen sitzen, können sie sich entspannen.
- Unsere Lernangebote sind an den Interessen des Kindes bzw. der Gruppe angeknüpft und wir
reagieren flexibel auf aktuelle Ereignisse. (z.B. haben die Kinder gerade viel Spaß beim
Musikmachen mit Rasseln, dann ist dies vorrangig).
Wir wollen die unterschiedlichen Erfahrungen und Erlebnisse des einzelnen Kindes für die
Kommunikation untereinander nutzen.
- Wir helfen den Kindern bei Verarbeitung von Konflikten, geben ihm aber den Freiraum,
seine Absichten und Möglichkeiten im Rahmen seiner Fähigkeiten zu verwirklichen.
Wir begleiten sie in ihren Entwicklungsschritten und selbstbestimmten Lernen.
Dabei lassen wir ihnen Zeit und hören zu.
Ethische und religiöse Bildung (Art6 BayIntG)
Die Krippe ist den demokratischen Grundwerten der Freiheit, Gleichheit,
Gerechtigkeit, Toleranz und Solidarität verpflichtet. Die Würde der Kinder als eigenständige,
individuelle Lebewesen und heranwachsende Mitglieder der Gesellschaft wird von den
Erzieherinnen und Eltern respektiert, zugleich sollen die Kinder damit erlernen, die Würde der
anderen Kinder und Erwachsenen wahrzunehmen und zu achten. Den Kindern soll
vermittelt werden, dass sie Teil einer Gemeinschaft sind. Innerhalb dieser Gemeinschaft sollen sie
altersgemäß durch Erfahrung lernen, sich für Ihre Rechte und die Rechte der anderen einzusetzen,
die Verantwortung für Ihr Handeln übernehmen, Schwächeren beizustehen, Konflikte untereinander
selbstständig verbal zu lösen. Die Einrichtung ist konfessionell nicht gebunden und keiner Religion
angehörig. Gleichwohl werden, den regional kulturellen Gepflogenheiten entsprechend, die
christlich motivierten Feste des Jahres in der Krippe.
3.9 Beziehungsgestaltung
Für viele Kinder bedeutet der Eintritt in die Kinderkrippe, die erste langfristige Loslösung von
den vertrauten Bezugspersonen im familiären Umfeld und deren Erziehungsstrategien oder-
Gewohnheiten. Sie müssen im außerfamiliären Rahmen eine Beziehung zu dem pädagogischen
Fachpersonal aufbauen bzw. entwickeln. Das ist nicht einfach.
Es müssen auch die Sorgen und Ängste der Mütter überwunden werden. Mütter haben nicht
selten die Befürchtung, dass sich ihr Kind viel zu stark an die päd. Fachkraft binden könnte.
Auch Eltern müssen erst lernen, mit den andersartigen Erziehungszielen in der
Kindertageseinrichtung umzugehen.
Erziehung lässt sich nur auf der Basis sicherer Bindungen gestalten, die dem Kind aber auch
genügend Freiraum für Autonomie lassen. Kinder zeigen uns täglich aufs Neue, dass sie wissen,
was sie brauchen.
Beste Erziehungsvoraussetzungen sind:
> wenn ein Kind sich wohl fühlt und aktiv ist
> wenn es über ausreichend Selbstwertgefühl verfügt und spürt, dass es angenommen wird
mit allen seinen Fähigkeiten und seinem Wissen
> wenn seine Bedürfnisse nach körperlicher und psychischer Geborgenheit ausreichend
18Kinderkrippe Glühwürmchen
befriedigt werden
> wenn es genügend Zuwendung bekommt sowie sozial akzeptiert und integriert ist
> wenn es Fähigkeiten und Verhaltensweisen entwicklungsgemäß erwerben kann.
Leider werden Regeln und Konsequenz nur zu oft als überholte Erziehungsmethoden eingestuft.
Fühlt sich ein Kind in der Zuneigung der päd. Fachkraft aufgehoben – ohne Abhängigkeit - ,
und zwar in einer Bindung, die ihm aber auch Entscheidungsfreiheit und Selbstverwirklichung
lässt, und bei Grenzen, die Orientierung geben, dann werden Erziehungsziele erreicht, die man
gar nicht zu planen gewagt hätte. Wichtig ist zu erkennen, dass Freiheit auch Grenzen braucht.
Kinder fordern sie immer wieder. Eine zu enge und zu feste Bindung kann und soll die päd.
Fachkraft nicht zulassen. Ihre Privatsphäre muss sie auch vor den Kindern schützen.
Um jedem Kind gerecht zu werden, bevorzugen wir eine professionelle Grundhaltung den
Kindern gegenüber, die durch Eigenreflexion und Reflexion im Team mit der Zeit erreicht werden
kann, aber immer überprüft werden sollte. Denn jedes Kind will gleich beachtet und gefördert
werden.
4. Wahrnehmen/Beobachten der Eigenaktivität, der für Kinder bedeutsamen
Handlungen
Verlaufsbeobachtung
Professionelle pädagogische Qualität ist ohne Beobachten nicht möglich. Wir beobachten die Kinder
objektiv und regelmäßig, um aus den Ergebnissen Handlungskonzepte zu entwickeln. Gerade bei
verhaltensauffälligen Kindern ist es von großem Nutzen, Aufzeichnungen von verschiedenen
Beobachter(innen) zu haben, um einen objektiveren Blick auf das (auffällige) Verhalten zu haben.
Ebenso wird (auffallendes) Verhalten über einen längeren Zeitraum erfasst und mit dem Verhalten
Gleichaltriger verglichen. Manchmal ist das Verhalten in dieser Altersgruppe völlig normal,
während sie in einer anderen Auffälligkeit darstellen.
Die spontanen Beobachtungen werden im Team reflektiert und wir überlegen gemeinsam,
was genau gesehen und gehört haben und was wir nicht gesehen und nicht gehört haben !
Portfolio
Mit Hilfe des Portfolios werden die Entwicklungs- und Lernschritte des Kindes auf eine bildliche
kindgerechte Art und Weise dokumentiert. Die Kinder arbeiten bei der Gestaltung ihres „Ordners“
mit. Sie nutzen gern ihr Portfolio, um zu berichten, was sie alles schon können. Sie lernen dabei
ihr Wissen und sich selbst einzuschätzen und stolz auf sich zu sein.
Einmal im Jahr gibt es für die Eltern einen Portfolio-Nachmittag, wo sie mit ihren Kindern bei
Kaffee und Kuchen die Ordner zusammen anschauen können.
4.1. Vorbereitung /Gestaltung einer anregenden Lernumgebung
Grundsätzlich ist die Gestaltung der Lernumgebung abhängig von den zur Verfügung stehenden
Räumlichen und finanziellen Ressourcen. Wenn möglich werden Räume und Materialien zu
folgenden Bildungsbereichen geschaffen:
- Körper, Bewegung und Gesundheit
19Kinderkrippe Glühwürmchen
- Soziales und kulturelles Leben
- Sprachen, Kommunikation
- Bildnerisches Gestalten
- Musik
- Mathematik und Naturwissenschaften
Die Kinder können sich in den Räumen bewegen, Orientierung, Anregung und Sicherheit finden.
Die Räume bieten Möglichkeiten für Kommunikation, Zusammenarbeit und Rückzug.
Sie wecken die Neugierde und laden zum Experimentieren und Forschen ein. Die Kinder entscheiden
selbst, welche Anregung sie aufgreifen wollen.
Wir verfügen über einen Bewegungsraum. Hier können die Kinder klettern, springen, rollen, sich
verstecken, mit Softbällen werfen und fangen üben.
Im Gruppenraum gibt es eine Kiste mit Schellen und Rasseln, eine kleine Trommel mit Schläger,
zur Verfügung der Kinder. Es gibt einfache Bilderbücher, Puzzles, Bauklötze, Holzautos, Bagger -
alles zugänglich für die Kleinen. Für Rollenspiele gibt es eine Kinderküche, 3 Puppenwagen,
viele Fahrzeuge zum Draufsitzen. Der Flur wird gerne dazu genutzt.
Außerdem gibt Spielmaterial, wie die Formautos, oder Schichtpuzzle, um Formen zu erfassen.
In der Küche gibt es eine kleine Kinderbar, wo sie ihre Brotdosen und Getränke deponieren und
jederzeit trinken können.
4.2 Beteiligung der Kinder
Lebensnahes Lernen in Projekten ist ein Schwerpunkt unserer Arbeit. Die Themenauswahl sollte,
wenn möglich, völlig bei den Kindern und ihren Interessen liegen. Das Projekt begleitet die Kinder
über einen längeren Zeitraum. Gemeinsam werden Ideen, Anregungen und Wünsche zum Thema
gesammelt, um sich auf den Weg zu machen, zu experimentieren, Staunen, und Antworten auf die
entstehenden Fragen zu suchen. Auch Eltern und Fachleute werden mit einbezogen. Durch Zuhören
oder Beobachten der Kinder malen wir zwei oder drei Vorschläge zur Abstimmung. Vor das gemalte
Bild (z.B. Hund, oder Ente) kommt eine Schale für die Muggelsteine. Jedes Kind erhält einen
Muggelstein und wirft ihn in die Schale, vor dem Bild, welches Projekt es interessiert. Es wird
nachgefragt, ob das Kind verstanden hat, für was es abgestimmt hat.
„Beteiligung ist von klein auf möglich. Eine auf Dialog basierende Beteiligung ist nicht auf verbalen
Austausch beschränkt. Beobachtung, Interaktion und nonverbale Kommunikation sind Teile des
Dialogs. Je jünger die Kinder sind, desto wichtiger sind die feinfühlige Beachtung ihrer
ausgesendeten Signale und ihrer Körpersprache und der Versuch, diese zu verstehen.“ 9
Im Alltag findet eine partizipatorische Bildungspraxis durch Zutrauen und Vertrauen in die
Fähigkeiten der Kinder statt:
> durch bedürfnisorientierte Situationen in der Pflege, beim Essen und Schlafen
> in der Eingewöhnung
> bei der Gestaltung von Spielsituationen und der Planung und Durchführung von Projekten
> bei der Bewältigung von Aufgaben (Aufräumen)
> durch ein gemeinsames Setzen von Regeln und Grenzen
> in einer demokratisch geprägten Gemeinschaft
> durch klare Raumstruktur – frei und selbstbestimmte Nutzung der Räume und Auswahl der
Bildungsaktivitäten
9
StMAS/IFP,2010, S.122
20Kinderkrippe Glühwürmchen
4.3 Entwicklungsbegleitung in Zone der nächsten Entwicklung
Wir müssen davon ausgehen, dass die Kleinkinder zunächst eine neue Aufgabe nicht begreifen.
Letztere versuchen, die Erzieher/innen und die Aufgabe zu verstehen, während erstere die
("primitiven") Denkprozesse der Kinder zu verstehen suchen. Oft müssen die Fachkräfte die Aufgabe
strukturieren (zerlegen), so dass die Kinder sie Schritt für Schritt bewältigen können. Ferner können
die Erzieher/innen
o ihnen zunächst die jeweilige Aktivität vormachen (Modell- bzw. Nachahmungslernen),
o sie verbal anleiten,
o sie durch Nachfragen auf den richtigen Weg bringen (aktiviert Denkprozesse),
o ihnen Feedback geben (z.B. darüber, wie nah sie dem Ziel sind) und
o durch Zeigen von Interesse, Lob und Ermutigung ihre Motivation aufrechterhalten (Ver-
stärkung).
Auch können wir ihnen helfen, neue Informationen oder Erfahrungen mit Bekanntem in Bezug zu
setzen, Erklärungen zu finden, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden usw. Wir dürfen die
Kinder dabei weder über- noch unterfordern; die Aufgaben sollten mit einer gewissen Herausforde-
rung verbunden sein, so dass die Kinder möglichst oft in der Zone der nächsten Entwicklung "funkti-
onieren" müssen. Dann wird die Reifung noch nicht ausgereifter Fertigkeiten und geistiger Funktio-
nen beschleunigt. Reagieren Kinder hingegen nicht auf die Anleitung und Unterstützung durch die
päd. Fachkräfte, so ist die Aktivität zu schwer. Außerdem haben ihre Fragen eine gewisse Signal-
funktion, da sie verdeutlichen, wie viel Hilfe noch nötig ist. Aber auch wenn die Kinder eine Aufgabe
bewältigt haben, bedeutet dies nicht, dass sie sie verstanden haben: Begreifen und Kompetenz re-
sultieren erst aus der eigenständigen Wiederholung, dem mehrfachen Üben.
Wir müssen also laut Wygotski zum einen die einzelnen Kinder sehr gut kennen, sie genau beobach-
ten und ihren Entwicklungsstand, insbesondere hinsichtlich der Zone der nächsten Entwicklung,
richtig beurteilen.
5. Dokumentation der Lernschritte
„Aussagekräftige Beobachtungsergebnisse vermitteln Einblicke in das Lernen und in die Entwicklung
von Kindern, sie helfen die Qualität von pädagogischer Arbeit zu sichern und
weiterentwickeln.“ (BEP, (1)
Unsere Beobachtungen sind auch individuelle Lerngeschichten, die dem Kind vorgelesen,
besprochen und gemeinsam reflektiert werden. So kann das Kind Selbstvertrauen in sein eigenes
Handeln entwickeln. Seine individuellen Kompetenzen werden damit von dem
päd. Fachpersonal anerkannt und wertgeschätzt. Dies fördert die Fähigkeit beim Kind zu erkennen,
was es gelernt und erreicht hat. Diese positiven Erinnerungen können Bausteine für neue
und noch unsichere Situationen sein, indem die Zuversicht und Mut geben, sich solchen
Situationen auszusetzen. 10
10
Kazemi-Veisari, 2006
21Kinderkrippe Glühwürmchen
Wir nutzen die gewonnenen Erkenntnisse, um Entwicklungsschritte entsprechend zu fördern.
Unsere Beobachtungsinstrumente sind beteiligungsorientierte Methoden, wie Portfolio und
Bildungs- und Lerngeschichten, sowie Verlaufsbeobachtungen. Diese bilden die Voraussetzung, für
qualifizierte Elterngespräche.
6. Partnerschaftliche Kooperation mit den Eltern
„Bildung und Erziehung fangen in der Familie an. Die Familie ist der erste, umfassendste, am längste
und stärkste wirkende, einzig private Bildungsort von Kindern und in den ersten Lebensjahren der
wichtigste.“11
Die Krippe baut auf die familiäre Ausgangssituation auf und legt großen Wert auf die
Zusammenarbeit mit den Eltern.
Die Einrichtung braucht Eltern, die offen sind und diesen Gedanken mittragen. Ziel ist die Entfaltung
der Persönlichkeit der Kinder. Fördernd wirkt sich hierbei ein natürliches und verständnisvolles
Miteinander aus. Dies setzt gegenseitiges Verständnis, Respekt, Vertrauen sowie eine angenehme
Atmosphäre voraus.
Aufnahmegespräche
Um die besonderen Bedürfnisse der jeweiligen Kinder zu erfahren, tauschen sich die Eltern und die
Leitung vor dem Krippeneintritt aus. Dieses Gespräch ist einer der ersten Kontakte zwischen Eltern/
Kind und Krippe. Hier ist die Möglichkeit gegeben, Informationen über die Einrichtung zu erhalten
und sich gegenseitig kennenzulernen.
Bei der Aufnahme des Kindes tragen wir Sorge zur Vorlage einer Bescheinigung über die
regelmäßige Teilnahme altersentsprechenden Früherkennungsuntersuchungen
(U-Untersuchungen). Kann diese nicht oder nicht vollständig vorgelegt werden, wird mit der
betroffenen Familie die mögliche Vorgehensweise besprochen.
Schnuppertag
Vor Krippeneintritt des Kindes wird in der Krippe ein Schnuppertag durchgeführt, um den Start in die
Krippe zu erleichtern. Die Eltern sind an diesem Tag auch eingeladen, die Einrichtung
kennenzulernen.
Tür- und Angelgespräche
In diesen täglichen Kontakten zwischen Eltern und Team, werden kurz pädagogische und
organisatorische Fragen geklärt. Informationen werden ausgetauscht. Das sind zum Beispiel
besondere Ereignisse oder Ergebnisse, die zu Hause oder in der Kinderkrippe passieren. Dadurch
kann das Kind in seinem Verhalten besser verstanden werden.
Entwicklungsgespräche
Ein längerer Austausch zwischen Eltern und Krippenleitung, ist in der Elternsprechzeit möglich.
Ein geeigneter Termin hierfür kann individuell vereinbart werden. Für Entwicklungsgespräche im
Herbst und Frühjahr, kann sich jedes Elternteil in eine Liste eintragen. Unsere
Verlaufsbeobachtungen, sowie das Portfolio und die Entwicklungsgeschichten, sind die
11
BEP, (1) S. 437
22Sie können auch lesen