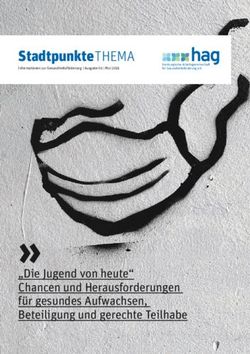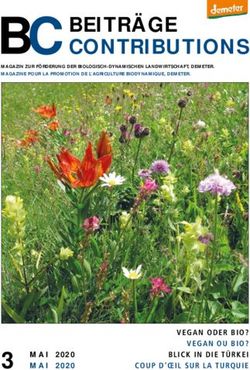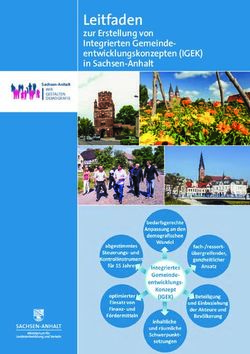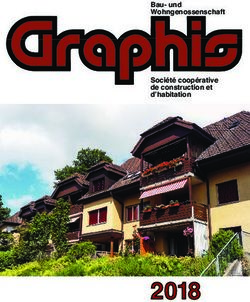LE BIEN-ÊTRE ET LA SANTÉ DES JEUNES AU LUXEMBOURG - RAPPORT NATIONAL SUR LA SITUATION DE LA JEUNESSE AU LUXEMBOURG 2020 - Jugendbericht 2020
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
RAPPORT NATIONAL SUR LA SITUATION DE LA JEUNESSE AU LUXEMBOURG 2020 LE BIEN-ÊTRE ET LA SANTÉ DES JEUNES AU LUXEMBOURG NATIONALER BERICHT ZUR SITUATION DER JUGEND IN LUXEMBURG 2020 WOHLBEFINDEN UND GESUNDHEIT VON JUGENDLICHEN IN LUXEMBURG
Impressum
Rapport national sur la situation de la jeunesse au Luxembourg 2020
Le bien-être et la santé des jeunes au Luxembourg
Editeur : Ministère de l‘Éducation nationale, de l‘Enfance et
de la Jeunesse & Université du Luxembourg
Luxembourg, 2021
Relecture: DRUCKREIF Text & Lektorat, Trier
Traduction: T & I Portfolios, Riegelsberg
Tirage : 600
Mise en page : Bakform
Photos de couverture: Andres Barrionuevo, Antonio Hugo, Armin Staudt,
axelbueckert, Bruno Giuliani, criene, davidpereiras,
krockenmitte, nektarstock, nicolasberlin & przemekklos
via photocase.de
ISSN : 2418-4284
ISBN: 978-99959-1-296-3
Informationen und Materialien zum Jugendbericht: www.jugendbericht.lu
Inhalt
Vorwort des Ministers für Bildung, Kinder und Jugend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Vorwort des Dekans der Fakultät für Geisteswissenschaften, Erziehungswissenschaften
und Sozialwissenschaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A. Das Wohlbefinden der Jugendlichen stärken und fördern! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Beitrag des Ministeriums für Bildung, Kinder und Jugend
B. Wohlbefinden und Gesundheit von Jugendlichen in Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
R. Samuel, H. Willems (Hrsg.)
Kapitel 1
E inleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
R. Samuel, H. Willems
Kapitel 2
Konzeption des Jugendberichtes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
A. Schumacher, A. Heinen, H. Willems, R. Samuel
Kapitel 3
Gesellschaftliche Kontextbedingungen für das Wohlbefinden und die Gesundheit
von Jugendlichen in Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
A. Schumacher, H. Willems, E. Schembri
Kapitel 4
Wie Jugendliche ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit einschätzen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
A. Heinz, C. Residori, T. Schulze, A. Heinen, R. Samuel
Kapitel 5
Was Jugendliche für ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit tun oder nicht tun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
A. Heinen, M. Schobel, C. Residori, T. Schulze, R. Samuel
Kapitel 6
Welche Bedeutung das soziale Umfeld für das Wohlbefinden der
Jugendlichen hat: Familie, Freunde, Schule und weitere Lebensbereiche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
A. Heinen, T. Schulze, M. Schobel, E. Schembri, H. Willems
Kapitel 7
Wie Jugendliche die Covid-19-Pandemie und die Maßnahmen wahrnehmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
C. Residori, L. Schomaker, M. Schobel, T. Schulze, A. Heinen
Kapitel 8
Wie Experten über das Wohlbefinden und die Gesundheit Jugendlicher diskutieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
S. Biewers Grimm, C. Meyers
Kapitel 9
Synopse der zentralen Ergebnisse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Synopsis des principaux résultats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
A. Schumacher, A. Heinen, E. Schembri, H. Willems, R. Samuel
Kapitel 10
Herausforderungen für Politik und Praxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
Défis pour la politique et la pratique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
A. Schumacher, A. Heinen, H. Willems, R. Samuel
Anhang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
5WOHLBEFINDEN UND
GESUNDHEIT VON
JUGENDLICHEN IN
LUXEMBURG
B
Robin Samuel & Helmut Willems (Hrsg.)Inhalts verzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Introduction. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
R. Samuel, H. Willems
Kapitel 2
Konzeption des Jugendberichtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
A. Schumacher, A. Heinen, H. Willems, R. Samuel
2.1 Themenschwerpunkte, Zielsetzung und analytische Perspektiven
des Jugendberichtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.1.1 Fragestellungen des Jugendberichtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.1.2 Wohlbefinden und Gesundheit aus sozialwissenschaftlicher Perspektive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.2 Wohlbefinden und Gesundheit aus theoretischer Sicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2.1 Wohlbefinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
2.2.2 Gesundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.2.3 Wohlbefindensorientiertes und gesundheitsrelevantes Handeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.3 Einflussfaktoren und Ressourcen für Wohlbefinden und Gesundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.3.1 Personale Faktoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.3.2 Soziale Faktoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.3.3 Strukturelle Faktoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.4 Datengrundlage und methodische Vorgehensweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.4.1 Health Behaviour in School-aged-Children (HBSC) und Youth Survey Luxembourg (YSL) –
Quantitative Studien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.4.2 Eine qualitative Studie zu Wohlbefinden und Gesundheit von Jugendlichen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.4.3 Eine qualitative Studie zu Fachdiskursen zu Wohlbefinden und Gesundheit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.4.4 Young People and Covid-19 (YAC+) – Eine Mixed-Methods-Studie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.4.5 Sekundärdatenanalyse zur Bestimmung von Kontextbedingungen für das Wohlbefinden und
die Gesundheit von Jugendlichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.5 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Kapitel 3
Gesellschaftliche Kontextbedingungen für das Wohlbefinden und
die Gesundheit von Jugendlichen in Luxemburg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
A. Schumacher, H. Willems, E. Schembri
3.1 Einleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.2 Politische Strukturen und allgemeine Lebensbedingungen in Luxemburg ������������������������������������������������������������������ 49
3.3 Demografische Struktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.4 Bildungs- und Erwerbsstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.5 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen, soziale Ungleichheit und Armut ������������������������������������������������������������������������ 58
3.6 Soziale Sicherung und Gesundheitsversorgung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.7 Rechtliche Rahmenbedingungen des Aufwachsens. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.8 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Spotlight: Veränderungen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen in Luxemburg für Jugendliche
durch Covid-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Kapitel 4
Wie Jugendliche ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit einschätzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
A. Heinz, C. Residori, T. Schulze, A. Heinen, R. Samuel
4.1 Einleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.2 Wohlbefinden und Gesundheit – Die Sicht der Jugendlichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.2.1 Was Jugendliche unter Wohlbefinden verstehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
21Inhalts verzeichnis
4.2.2 Was Jugendliche unter Gesundheit verstehen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
4.2.3 Wohlbefinden und Gesundheit – Zusammenhänge aus Sicht der Jugendlichen ���������������������������������������� 75
4.3 Die Bewertung des Wohlbefindens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4.3.1 Das affektive Wohlbefinden und seine Bedingungsfaktoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.3.2 Das kognitive Wohlbefinden und die Bedeutung der Lebenszufriedenheit �������������������������������������������������� 78
4.3.3 Stressempfinden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
4.4 Die Bewertung der Gesundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4.4.1 Die Bewertung des allgemeinen Gesundheitszustandes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4.4.2 Chronische körperliche Erkrankungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4.4.3 Der Gewichtsstatus und dessen subjektive Einschätzung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4.4.4 Psychosomatische Gesundheitsbeschwerden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
4.4.5 Psychische Gesundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
4.5 Zusammenfassung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Spotlight: Veränderung des Wohlbefindens durch die Covid-19-Pandemie �������������������������������������������������������������������������� 95
Kapitel 5
Was Jugendliche für ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit tun oder nicht tun . . . . . . . . . . . 99
A. Heinen, M. Schobel, C. Residori, T. Schulze, R. Samuel
5.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
5.2 Jugendliches Handeln und selbstberichtete Motive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
5.2.1 Ernährungs- und Bewegungsverhalten der Jugendlichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
5.2.2 Mediennutzung und digitale Kommunikation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
5.2.3 Substanzkonsum bei Jugendlichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
5.2.4 Zwischen Gesundheitsverhalten und Risikoverhalten: eine Typologie ���������������������������������������������������������� 113
5.3 Die Ambivalenz von Handlungen: zwischen Gesundheitsgefährdung und Steigerung
des Wohlbefindens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
5.3.1 Negative Auswirkungen ambivalent bewerteten Handelns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
5.3.2 Die Abwägung zwischen der kurzfristigen Steigerung des subjektiven Wohlbefindens
und möglichen Gesundheitsschäden in der Zukunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5.3.3 Selbstregulationen im Umgang mit kognitiver Dissonanz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5.4 Bewältigungshandeln im Umgang mit Belastungen – eine Typologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
5.5 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Spotlight: Das veränderte Freizeitverhalten während der Covid-19-Pandemie und dessen Einfluss
auf das Wohlbefinden der Jugendlichen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Kapitel 6
Welche Bedeutung das soziale Umfeld für das Wohlbefinden der Jugendlichen hat:
Familie, Freunde, Schule und weitere Lebensbereiche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
A. Heinen, T. Schulze, M. Schobel, E. Schembri, H. Willems
6.1 Einleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
6.2 Die Bedeutung von Familie und Freunden für das Wohlbefinden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
6.2.1 Familie als Ressource oder Belastung für das Wohlbefinden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
6.2.2 Freundschaften und Paarbeziehungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
6.3 Das subjektive Wohlbefinden von Jugendlichen in außerfamilialen Lebensbereichen ������������������������������������������ 136
6.3.1 Schulisches Wohlbefinden: Unterstützung durch das Lehrpersonal, die Bewältigung
hoher Anforderungen und des Leistungsdrucks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
6.3.2 Jugendhäuser: Vertrauensvolle Beziehungen und die Interaktion mit Gleichaltrigen. . . . . . . . . . . . . . . . 140
6.3.3 Jugendliche in Heimen (Foyer) und betreuten Wohnstrukturen (Slemo) ������������������������������������������������������ 141
6.3.4 Jugendliche in der Erwerbsarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
6.4 Die Bedeutung gesellschaftlicher Rahmenbedingungen und Entwicklungen für
das subjektive Wohlbefinden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
6.5 Zusammenfassung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Spotlight: Die Bedeutung von Familie und Freunden für das Wohlbefinden der Jugendlichen
während der Covid-19-Pandemie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
22Inhalts verzeichnis
Kapitel 7
Wie Jugendliche die Covid-19-Pandemie und die Maßnahmen wahrnehmen . . . . . . . . . . . . . . 155
C. Residori, L. Schomaker, M. Schobel, T. Schulze, A. Heinen
7.1 Einleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
7.2 Die Perspektive der Jugendlichen auf die Covid-19-Pandemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
7.3 Der Umgang der Jugendlichen mit Informationen und Medien während der Covid-19-Pandemie. . . . . . . . . . 159
7.4 Die Bewertung und Umsetzung der Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19
durch die Jugendlichen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
7.4.1 Die Bewertung der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie ������������������������������������������������ 161
7.4.2 Die Umsetzung der Maßnahmen im Alltag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
7.5 Die Mitverantwortung für andere als Motivation für das Umsetzen der Maßnahmen �������������������������������������������� 165
7.6 Einschätzungen der Jugendlichen zur Schule und zum Lernen während der Covid-19-Pandemie. . . . . . . . . . . 167
7.7 Die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf die Jugendlichen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
7.8 Die Bewältigung der Belastungen durch die Covid-19-Pandemie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174
7.9 Zusammenfassung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Kapitel 8
Wie Experten über das Wohlbefinden und die Gesundheit
Jugendlicher diskutieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
S. Biewers Grimm, C. Meyers
8.1 Einleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
8.2 Feldspezifische Diskurse zu Wohlbefinden und Gesundheit in der Schule, der Jugendarbeit,
der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe sowie im Arbeitsbereich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
8.2.1 Gesundheitsbezogene Diskurse im Kontext der formalen Bildung: Zwischen neuen
Zielsetzungen und strukturellen Beharrungstendenzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
8.2.2 Wohlbefinden und Autonomieförderung durch Partizipation: Zur Förderung von
Wohlbefinden in der Jugendarbeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
8.2.3 Emotionale Sicherheit und Resilienzförderung als Grundelemente von Wohlbefinden
in der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
8.2.4 Umgang mit erhöhten Belastungen: Wohlbefinden und Gesundheit im Arbeitsbereich ������������������������ 188
8.3 Feldübergreifende Diskurse zum Wohlbefinden und zur Gesundheit der Jugendlichen �������������������������������������� 190
8.3.1 Gesundheitsgefährdung und jugendtypische Risikofaktoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
8.3.2 Psychische Gesundheit von Jugendlichen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
8.3.3 Der Zusammenhang von Digitalisierung und Gesundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
8.3.4 Die Frage der Verantwortlichkeit für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Jugendlichen . . . . . . 196
8.4 Zusammenfassung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
Spotlight: Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf Diskurse und Praktiken zum Wohlbefinden
und zur Gesundheit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Kapitel 9
Synopse der zentralen Ergebnisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
A. Schumacher, A. Heinen, E. Schembri, H. Willems, R. Samuel
9.1 Die Einschätzung von Wohlbefinden und Gesundheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
9.2 Die Veränderung von Wohlbefinden und Gesundheit im Zeitverlauf und der Vergleich zu
anderen Ländern. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208
9.3 Erklärungsfaktoren für unterschiedliche Einschätzungen von Wohlbefinden und Gesundheit �������������������������� 208
9.4 Eigenverantwortung und der Stellenwert von wohlbefindens- und gesundheitsorientiertem
Handeln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
9.5 Die Beurteilung der Covid-19-Pandemie und der damit verbundenen Maßnahmen �������������������������������������������� 209
9.6 Der Blick luxemburgischer Experten auf das Wohlbefinden und die Gesundheit von Jugendlichen. . . . . . . . . 210
9.7 Zusammenfassung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
23Inhalts verzeichnis
Synopsis des principaux résultats. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
9.1 La perception du bien-être et de la santé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
9.2 L’évolution du bien-être et de la santé au fil du temps et comparaison avec d’autres pays ���������������������������������� 213
9.3 Facteurs explicatifs des différentes perceptions du bien-être et de la santé �������������������������������������������������������������� 213
9.4 Responsabilité personnelle et importance de l’action axée sur le bien-être et la santé ������������������������������������������ 214
9.5 Évaluation de la pandémie de Covid-19 et des mesures prises dans ce contexte ���������������������������������������������������� 214
9.6 Le regard posé par les experts luxembourgeois sur le bien-être et la santé des jeunes ������������������������������������������ 215
9.7 Synthèse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Kapitel 10
Herausforderungen für Politik und Praxis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
A. Schumacher, A. Heinen, H. Willems, R. Samuel
10.1 Folgen sozialer Ungleichheit für Wohlbefinden und Gesundheit von Jugendlichen ���������������������������������������������221
10.2 Genderspezifische Differenzen in Wohlbefinden und Gesundheit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
10.3 Altersbezogene Differenzen und Risikofaktoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222
10.4 Körperliche Gesundheitsprobleme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223
10.5 Mentale Gesundheitsprobleme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
10.6 Transitionsunsicherheit, Zukunftsängste und gesellschaftlicher Zusammenhalt ���������������������������������������������������224
10.7 Familie als Sozialisationsort und Schutzfaktor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
10.8 Peers als Ressourcen und Risiko. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
10.9 Fokussierung des Wohlbefindens in institutionellen Kontexten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226
10.10 Strukturelle Rahmenbedingungen für Gesundheit und Wohlbefinden �������������������������������������������������������������������226
10.11 Jugendliche als kompetente Akteure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
10.12 Die Covid-19-Pandemie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
10.13 Entwicklungsperspektiven des luxemburgischen Jugendberichtes und Forschungsbedarf. . . . . . . . . . . . . . . 228
Défis pour la politique et la pratique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
10.1 Conséquences de l’inégalité sociale sur le bien-être et la santé des jeunes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
10.2 Différences liées au genre dans le bien-être et la santé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
10.3 Différences liées à l’âge et facteurs de risques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
10.4 Pathologies physiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232
10.5 Problèmes de santé mentale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
10.6 Insécurité quant à la transition, peur de l’avenir et cohésion sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
10.7 La famille, lieu de socialisation et facteur de protection. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
10.8 Les pairs, ressource et risque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
10.9 Focalisation du bien-être dans des contextes institutionnels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234
10.10 Conditions-cadres structurelles pour la santé et le bien-être. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
10.11 Les jeunes, des acteurs compétents. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235
10.12 La pandémie de Covid-19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
10.13 Perspectives de développement du rapport luxembourgeois sur la jeunesse
et besoins de recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
Anhang
Glossar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240
Literaturverzeichnis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
Abbildungsverzeichnis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
Tabellenverzeichnis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265
Abkürzungsverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Autorinnen und Autoren des Jugendberichtes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268
24KAPITEL 9
SYNOPSE DER
ZENTRALEN ERGEBNISSE
9
Anette Schumacher
Andreas Heinen
Emanuel Schembri
Helmut Willems
Robin Samuel9. S ynopse der zentralen Ergebnisse
Synopse der zentralen Ergebnisse
Der Jugendbericht hat auf der Basis umfangreicher 3. Welche Erklärungsfaktoren für unterschiedliche Ein-
Untersuchungen eine Vielzahl von Befunden zu Wohlbe- schätzungen der Jugendlichen zu ihrem Wohlbefinden
finden und Gesundheit von Jugendlichen in Luxemburg und ihrer Gesundheit können identifiziert werden?
aufgezeigt. In diesem abschließenden Kapitel werden
die zentralen Ergebnisse zusammengefasst. Der Aufbau 4. Welcher Stellenwert kommt den Jugendlichen selbst
dieser Synopse orientiert sich hierbei an den in Kapitel 2 und ihren Handlungen dabei zu? Welche Verhaltens-
aufgeworfenen Fragestellungen: weisen sind förderlich und welche beeinträchtigen ihr
Wohlbefinden und ihre Gesundheit?
1. Wie schätzen Jugendliche in Luxemburg ihr Wohlbe-
finden und ihre Gesundheit ein? 5. Wie beurteilen Jugendliche die Covid-19-Pandemie
und die damit verbundenen Maßnahmen?
2. In welchem Maße haben Wohlbefinden und Gesund-
heit der Jugendlichen sich in den letzten Jahren 6. Wie blicken Experten aus den gesundheitsbezogenen
verändert? Fachpolitiken und Praxisfeldern in Luxemburg auf das
Wohlbefinden und die Gesundheit von Jugendlichen?
9.1 Die Einschätzung von Wohlbefinden und Gesundheit
Das Wohlbefinden der luxemburgischen Jugendlichen ein als Mädchen und junge Frauen; ältere Jugendliche
und die Zufriedenheit mit ihrer persönlichen Lebenssi- und Jugendliche mit niedrigem Sozialstatus schätzen
tuation in der luxemburgischen Gesellschaft kann als ihre Gesundheit durchschnittlich etwas schlechter ein.
hoch angesehen werden. Im Einklang mit diesem Befund Entsprechend empfinden sich Jugendliche mit niedrigem
berichten drei von vier Jugendlichen über ein mittleres Sozialstatus häufiger als zu dick, haben häufiger multiple
bis hohes Maß an affektivem Wohlbefinden und an Gesundheitsbeschwerden, depressive Symptome und
Lebenszufriedenheit zu verfügen. diagnostizierte psychische Krankheiten.
Je größer die finanziellen Ressourcen und je höher Bei den psychosomatischen Beschwerden zeigt sich,
der Sozialstatus der Jugendlichen, desto höher sind auch dass Mädchen bzw. junge Frauen, Jugendliche mit nied-
die Lebenszufriedenheit und das affektive Wohlbefinden, rigem Sozialstatus und Jugendliche im Alter zwischen
wobei Personen ohne Migrationshintergrund sich oftmals 15 und 17 Jahren häufiger von Beschwerden berichten
zufriedener einschätzen als Jugendliche mit Migrations- als Jungen bzw. junge Männer, Jugendliche mit hohem
status. Zudem erweisen sich die sozialen Netzwerke und Sozialstatus und Jugendliche in anderen Altersgruppen.
Beziehungen der Jugendlichen als überaus wichtig für ihr Aus den schulmedizinischen Untersuchungen geht
Wohlbefinden. Vor allem die Eltern, aber auch persönliche hervor, dass Schüler des enseignement secondaire général
Freunde und Peernetzwerke spielen dabei eine große (ESG) eher einen Avis erhalten als Schüler des enseigne-
Rolle. ment secondaire classique (ESC). Bei ihnen liegen also ver-
Auch in Bezug auf die Einschätzung der eigenen mehrt gesundheitliche Probleme vor, über die die Eltern
Gesundheit wird ein überwiegend positives Bild erkenn- informiert werden. Der niedrigere Anteil an Avis bei den
bar. Die Mehrheit der Jugendlichen verfügt über ein Schülern des ESC entspricht dem gut belegten Ergebnis
außerordentlich positives Gesundheitsempfinden. Aller- der HBSC-Studie, wonach Schüler des ESC im Vergleich zu
dings zeigen sich hier zum Teil große Unterschiede nach Schülern des ESG ihre Gesundheit als insgesamt besser
soziodemografischen Merkmalen. Jungen und junge einschätzen.
Männer schätzen ihre Gesundheit durchschnittlich besser
2079. S ynopse der zentralen Ergebnisse
9.2 D
ie Veränderung von Wohlbefinden und Gesundheit im Zeitverlauf
und der Vergleich zu anderen Ländern
Das Wohlbefinden der luxemburgischen Jugendlichen hat ihren Eltern über Dinge sprechen, die ihnen Sorgen berei-
sich in den vergangenen Jahren kaum verändert und ist ten. Dass trotz dieser positiven Trends in einigen Bereichen
recht stabil auf einem hohen Niveau geblieben. Die sub- dennoch Probleme und Risiken zugenommen haben, zei-
jektive Gesundheitseinschätzung der Jugendlichen hat sich gen die gestiegene Zahl Jugendlicher mit Übergewicht, der
sogar weiter verbessert. Heute schätzen mehr Schüler ihre Rückgang körperlicher Aktivitäten sowie die Zunahme psy-
Gesundheit als „ausgezeichnet“ ein als noch vor 15 Jahren, chosomatischer Beschwerden. Zudem hat der Schulstress
wobei dieser Anstieg vor allem für die Mädchen gilt. Die in den vergangenen Jahren kontinuierlich zugenommen,
Einschätzung der Jungen hat sich kaum verändert. insbesondere bei Mädchen. Als Ursache dafür werden v.a.
Dieser insgesamt positive Trend bezüglich der all- der erhöhte Leistungsdruck und Prüfungsstress genannt.
gemeinen Gesundheitseinschätzung von Jugendlichen Im internationalen Vergleich liegen luxemburgische
spiegelt sich auch in Veränderungen einzelner Verhaltens- Jugendliche hinsichtlich der subjektiven Einschätzungen
weisen wider, wie dem Rückgang von Mobbing, dem redu- ihres Wohlbefindens und ihrer Gesundheit meist im oberen
zierten Konsum von Alkohol und Tabak, dem steigenden Mittelfeld. Die Trends hinsichtlich der Veränderung kör-
Anteil Jugendlicher, die sich gesund ernähren, und einer perlicher und mentaler Gesundheitseinschätzungen und
verbesserten Mundhygiene. Weitere Verbesserungen Verhaltensweisen ähneln weitgehend den internationalen
betreffen das soziale Umfeld: Mehr Schüler können mit Trends und den Entwicklungen in den Nachbarländern.
9.3 E
rklärungsfaktoren für unterschiedliche Einschätzungen
von Wohlbefinden und Gesundheit
In den luxemburgischen Fachdiskursen hat das Thema stark vom sozialen Umfeld geprägt wird. So beeinflussen
der psychischen Gesundheit und des Wohlbefindens insbesondere die Familien, die Freunde und Peers das
von Jugendlichen in den letzten Jahren zunehmend an Wohlbefinden. Eltern spielen eine wichtige Rolle für
Bedeutung gewonnen. Experten aus den verschiedenen das Ernährungs- und Bewegungsverhalten, während
Handlungsfeldern beschreiben die Zunahme psychischer Freunde besonders den Alkohol- oder Tabakkonsum der
Belastungen und Erkrankungen im Jugendalter als ein Jugendlichen beeinflussen. Weiterhin können negative
Problem, das in allen gesellschaftlichen Milieus zuge- Erfahrungen mit Peers, etwa in Form von Mobbing, das
nommen habe. Die Ursache dafür wird in allgemeinen Wohlbefinden beeinträchtigen.
gesellschaftlichen Entwicklungen gesehen, wie einem Für einen Großteil der luxemburgischen Jugendli-
steigenden Leistungsdruck und dem damit verbundenen chen sind Eltern zudem wichtige Ansprechpartner, von
Stress, dem Jugendliche vor allem in der Schule, aber denen sie im Lebensalltag, aber auch bei Problemen
auch in der Erwerbsarbeit ausgesetzt sind. Allerdings große Unterstützung erfahren. Eine stabile und unter-
können auch die gestiegene Behandlungsbereitschaft stützende Beziehung zu den Eltern trägt maßgeblich zum
und -kapazität sowie die abnehmende Stigmatisierung Wohlbefinden der Jugendlichen bei. Umgekehrt können
psychischer Erkrankungen für die Zunahme der erfassten problembelastete Beziehungen das Wohlbefinden stark
psychischen Erkrankungen mitverantwortlich sein. beeinträchtigen. Freunde sind für Jugendliche ebenfalls
Der ansteigende Leistungsdruck und die Zunahme wichtige Vertrauenspersonen, in deren Gemeinschaft sie
sozialer Probleme innerhalb der Familien werden von den sich wohlfühlen und Unterstützung erfahren.
Experten als mögliche Ursachen für eine Beeinträchti- Auch strukturelle Merkmale der Institutionen (v. a.
gung des Wohlbefindens in Betracht gezogen. Regeln oder Anforderungen), wie sie die Jugendlichen in
Externe Rahmenbedingungen, wie beispielsweise die Schulen, Jugendhäusern, Heimen und betreuten Wohn-
in Luxemburg hohe Armutsgefährdungsquote der Jugend- strukturen sowie am Arbeitsplatz vorfinden, prägen das
lichen sowie die ausgeprägte Jugendarbeitslosigkeit und Wohlbefinden der Jugendlichen. Vertrauensvolle, unter-
fehlende finanzielle Ressourcen, schränken Verwirkli- stützende Beziehungen zu Erwachsenen (Lehrer, Erzieher,
chungschancen von Jugendlichen ein und beeinträchtigen Vorgesetzte) und anderen Jugendlichen (Mitschüler,
somit auch ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit. Bewohner, Arbeitskollegen) in diesen Lebensbereichen
Zudem hat sich gezeigt, dass das wohlbefindens- fördern das Wohlbefinden in besonderem Maße.
und gesundheitsorientierte Handeln der Jugendlichen
2089. S ynopse der zentralen Ergebnisse
9.4 E
igenverantwortung und der Stellenwert von wohlbefindens- und
gesundheitsorientiertem Handeln
Jugendliche sind mehrheitlich der Ansicht, dass sie Jugendliche sehen sich in einer großen Verantwor-
ihre Gesundheit und ihr subjektives Wohl befinden tung für ihr Wohlbefinden und ihre Gesundheit und
im Rah men der gege benen Möglichkeiten selbst reflektieren über die möglichen negativen Folgen und
aktiv beeinflussen können. Sie gehen also davon Risiken ihres Verhaltens. Als schädigendes Handeln
aus, diesbezüglich über Handlungsmächtigkeit bewerten sie Alkoholkonsum, Rauchen, ungesunde
und -möglich keiten zu verfügen. Ihre körperliche Ernährung und Bewegungsmangel. Einige schätzen
Gesundheit und Fitness versuchen sie gezielt etwa zudem einen übermäßigen digitalen Medienkonsum als
durch gesunde Ernährung und sportliche Aktivitäten zu schädigend ein.
erhalten oder zu verbessern. Tendenziell ernähren sich Die Jugendlichen bewerten diese Verhaltensweisen
Mädchen, jüngere Personen und Personen mit hohem ambivalent, da sie auch bei gesundheitsschädigendem
Sozialstatus besonders gesundheitsbewusst. Sportlich Verhalten durchaus positive Auswirkungen auf ihr
aktiver sind vor allem Jungen, jüngere Personen und subjektives Wohlbefinden erkennen. So können etwa
Personen mit höherem Sozialstatus. die Entspannung beim Rauchen oder beim Anschauen
Für das Wohlbefinden von Jugendlichen sind die von Serien, der soziale Kontakt mit Freunden beim Alko-
Realisierung individueller Interessen und Freizeitakti- holtrinken oder die soziale Anerkennung beim Alkohol-
vitäten von großer Bedeutung – besonders Aktivitäten und Tabakkonsum zu einer kurzzeitigen Steigerung des
mit Freunden. Zudem tragen künstlerische, musische Wohlbefindens führen. Gleichzeitig bewerten sie diese
oder sportliche Tätigkeiten sowie die Mediennutzung zu Handlungen jedoch als schädlich für ihre Gesundheit. Im
ihrem Wohlbefinden bei. Digitale Medien spielen dabei Umgang mit dieser Diskrepanz zeigen Jugendliche unter-
für alle Jugendlichen eine große Rolle, wobei Mädchen schiedliche Strategien, indem sie ihr Handeln relativieren
und jüngere Personen etwas häufiger im Internet sur- oder Wünsche zur Verhaltensänderung äußern.
fen und Serien oder Filme streamen als Jungen und Grundsätzlich verwenden Jugendliche unterschied-
Jugendliche höheren Alters. Jungen hingegen spielen liche Strategien, um mit Belastungen umzugehen, die
häufiger Konsolen- und Computerspiele als Mädchen. ihr Wohlbefinden beeinträchtigen. Diese reichen von
Positive Auswirkungen des digitalen Medienkonsums Vermeidungsverhalten und Ablenkung oder eigenstän-
auf das subjektive Wohlbefinden sehen die Jugendlichen digem Problemlösen bis hin zu der Suche nach sozialer
vor allem im sozialen Austausch, den sie dadurch mit Unterstützung, psychologischer Beratung und Therapie.
Freunden und Familienmitgliedern haben, sowie in der Dabei nimmt für einen Großteil der Jugendlichen das
Entspannung und im Ausgleich zum Alltag. Gleichwohl soziale Umfeld eine zentrale Rolle in ihrem Bewältigungs-
zeigt ein – wenn auch kleiner – Teil der Jugendlichen ein handeln ein, da viele auf die Hilfe und Unterstützung der
problematisches Nutzungsverhalten in Bezug auf den Familie oder des Freundeskreises zurückgreifen.
Konsum sozialer Medien.
9.5 D
ie Beurteilung der Covid-19-Pandemie und der damit verbundenen
Maßnahmen
Die Covid-19-Pandemie und die Maßnahmen zur Jugendlicher mit einer hohen Lebenszufriedenheit als
Bekämpfung der Pandemie haben den Lebensalltag der auch der Anteil Jugendlicher mit einer niedrigen Lebens-
Jugendlichen stark verändert und sich auf ihr Wohlbefin- zufriedenheit ist angestiegen. Vor allem der Sozialstatus
den und ihre Gesundheit ausgewirkt. ist hier ein differenzierender Faktor. Bei Jugendlichen mit
Insgesamt zeigt sich, dass die Jugendlichen gut mit einem niedrigen Sozialstatus hat die Lebenszufriedenheit
der Situation zurechtkommen. Allerdings gilt dies nicht deutlicher abgenommen als bei Jugendlichen mit einem
für alle Jugendlichen gleichermaßen. Mädchen und höheren Sozialstatus.
junge Frauen, aber auch Jugendliche mit niedrigem Mit der Umstellung auf Homeschooling als Folge der
Sozialstatus kommen mit der Situation grundsätzlich Schulschließungen und der anschließenden stufenwei-
schlechter zurecht als Jungen und Jugendliche mit sen Rückkehr zum Präsenzunterricht kamen nicht alle
höherem Sozialstatus. Auch die Lebenszufriedenheit Jugendlichen gleich gut zurecht. Einige Jugendliche
der Jugendlichen hat sich verändert. Sowohl der Anteil bewerten das höhere Maß an Autonomie positiv, andere
2099. S ynopse der zentralen Ergebnisse
berichten von der fehlenden Unterstützung durch die Arbeitslosigkeit, Einkommensverluste und unklare
Lehrpersonen. Insbesondere für weibliche und ältere Übergänge in das Arbeitsleben führen dazu, dass sich
Schüler hat sich der Schulstress durch die Schulschlie- vor allem ältere Jugendliche Sorgen um ihre Zukunft
ßungen aber offenbar reduziert. machen.
Das Freizeitverhalten der Jugendlichen hat sich durch Die Ergebnisse unserer Studie haben gezeigt, dass
die Covid-19-Pandemie und vor allem während des Con- Jugendliche insgesamt sehr gut über die Maßnahmen im
finements stark verändert. Gemeinschaftliche Aktivitäten Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie informiert
– die Jugendliche als besonders wichtigen Faktor für ihr sind und sich für die aktuellen Entwicklungen interessie-
Wohlbefinden beschreiben – haben deutlich abgenom- ren. Dies gilt insbesondere für den Beginn der Pandemie.
men. Die fehlenden persönlichen Kontakte zu anderen Einige Jugendliche erleben die vielen Informationen über
Jugendlichen bewerten Jugendliche als negativ und die verschiedenen Informationskanäle aber als überfor-
teilweise auch als belastend. Vielen gelingt es zwar über dernd und schränken ihren Nachrichtenkonsum zum
digitale Kommunikationsmedien den Kontakt aufrechtzu- Selbstschutz ein.
erhalten, diese Kommunikation sehen Jugendliche aber Hinsichtlich der Maßnahmen und Hygieneregeln
nicht als gleichwertigen Ersatz für persönliche Kontakte. zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie zeigt sich
Aktivitäten, die allein gemacht werden können, wie eine große Akzeptanz der Jugendlichen. Die Mehrzahl
Spazierengehen oder Zeit in der Natur zu verbringen, der Jugendlichen findet die Maßnahmen gerechtfertigt
kreative Tätigkeiten oder Sport im Freien oder zu Hause und angemessen und setzt sie im Alltag um. Die meisten
sind, ebenso wie der Medienkonsum, angestiegen. Jugendlichen sehen sich selbst jedoch durch das Virus
Jugendliche schätzen die Auswirkungen der Pande- nicht besonders gefährdet. Es geht ihnen bei der Ein-
mie auf ihren Haushalt und ihre Familie unterschiedlich haltung der Maßnahmen daher weniger um ihre eigene
ein. Während einige Jugendliche die Zeit mit ihrer Familie Gesundheit, sondern vorrangig um die der anderen
und die räumliche Nähe zu anderen Familienmitgliedern Menschen. Die Motivation der Jugendlichen besteht
positiv bewerten, sehen andere darin Auslöser für Span- also vor allem darin, andere Personen, insbesondere
nungen und familiäre Konflikte. Risikogruppen, zu schützen.
In Bezug auf die Übergänge insbesondere von der Diese Ergebnisse beruhen auf Daten, die im Zeitraum
Schule ins Studium oder vom Studium in den Beruf sind Juli bis September 2020 erhoben wurden. Es ist davon
Jugendliche durch die Covid-19-Pandemie zunehmend auszugehen, dass sich mit dem Fortgang der Pandemie
mit Unsicherheiten konfrontiert, die sie teilweise als und den getroffenen Maßnahmen neue Dynamiken
belastend wahrnehmen. Kurzarbeit, steigende (Jugend-) eingestellt haben.
9.6 D
er Blick luxemburgischer Experten auf das Wohlbefinden und die
Gesundheit von Jugendlichen
Experten unterschiedlicher fachlicher Disziplinen und Die Diskurse unterscheiden sich bereichs-, disziplin-
aus verschiedenen luxemburgischen Handlungsfeldern und funktionsbezogen. So werden gesundheitsbezogene
bieten eine zusätzliche Perspektive auf Gesundheit und Phänomene in der Kinder- und Jugendhilfe, der Jugend-
Wohlbefinden von Jugendlichen, die sich von der Per- arbeit sowie im therapeutischen Bereich häufiger auf
spektive der Jugendlichen in einigen Punkten deutlich einer individuellen oder pädagogisch-fachlichen Ebene
unterscheidet. Grundsätzlich betrachten die Experten diskutiert, während sie in der Schule, der öffentlichen Ver-
das Wohlbefinden und die Gesundheit der Jugendlichen waltung sowie in der Arbeitswelt häufiger in einer struk-
meist als Resultat gesellschaftlicher Rahmenbedingun- turell-administrativen Form wahrgenommen werden.
gen und Entwicklungen einerseits und der individuellen So befasst sich der Gesundheitsdiskurs im Schulbereich
Ressourcen der Jugendlichen anderseits. tendenziell eher mit dem Wechselverhältnis zwischen
Außer auf spezifische Themen wie Ernährung und schulischer Gesundheitsförderung und ihrer Begrenzung
Bewegung sowie das jugendtypische Risikoverhalten durch curriculare Vorgaben sowie den Möglichkeiten
beziehen sich die aktuellen Expertendiskurse vor allem ganzheitlicher und schulklimabezogener Schulkonzepte,
auf Fragen zum adäquaten Umgang mit den gesundheits- während sich der Diskurs in der Kinder- und Familienhilfe
bezogenen Problematiken der digitalen Mediennutzung und der Jugendarbeit eher auf Fragen der individuellen
sowie auf den Anstieg von psychischen Belastungen und Autonomieförderung sowie niedrigschwelliger Ansätze
Erkrankungen. der Unterstützung und Bildung bezieht.
2 109. S ynopse der zentralen Ergebnisse
Quer durch alle Untersuchungsfelder wird der Diskurs zu wenig mitgestalten können. Die vormals tendenziell
über Wohlbefinden und Gesundheit geprägt durch einen paternalistische und auf den Schutz der Jugendlichen
Bedeutungsaufschwung ganzheitlicher und vernetzter ausgerichtete professionelle Grundhaltung geht zuneh-
Konzepte, orientiert an der subjektiven Bedürfnislage mend über in eher partizipative, bedürfnisorientierte
der Jugendlichen. Das Paradigma „Der Jugendliche im und befähigende Herangehensweisen, die den Ermög-
Mittelpunkt“ lässt sich sowohl an Schulkonzepten wie lichungsraum der Jugendlichen für die eigene (Mit-)
dem whole school approach und den neuen Strukturen Gestaltung gesundheitsbezogener Themen erweitern.
und Angeboten der nonformalen Bildung in den Schu- Festzustellen ist, dass in den verschiedenen Untersu-
len als auch an den veränderten Diagnoseansätzen chungsfeldern ein gemeinsames und umfassendes Ver-
und Netzwerkstrategien der neuen Kompetenzzentren ständnis von Wohlbefinden als körperliches, psychisches
ablesen. Im Allgemeinen wird den Erfolgschancen der und soziales Wohlbefinden existiert, das häufig auf die
verschiedenen Aktionspläne zur Verhaltens- und Ver- Herstellung positiver und befähigender Strukturbedin-
hältnisprävention skeptisch begegnet. Bemängelt wird, gungen ausgerichtet ist.
dass die Zielgruppen zu wenig Resonanz erfahren und
9.7 Zusammenfassung
Insgesamt berichtet eine überwiegende Mehrheit der Auch hinsichtlich der Folgen der Covid-19-Pandemie
Jugendlichen ein mittleres bis hohes Wohlbefinden und werden Unterschiede nach sozioökonomischen und
schätzt die eigene Gesundheit als „ausgezeichnet“ ein. soziodemografischen Faktoren deutlich. Jugendliche
Die luxemburgischen Jugendlichen bewegen sich damit mit niedrigem sozioökonomischem Status haben in der
im internationalen Vergleich im oberen Mittelfeld. Das Tendenz eher negative Folgen zu gewärtigen, während
hohe Maß an Wohlbefinden in der jungen Bevölkerung Jugendliche mit gutem Zugang zu verschiedenen Res-
ist über die letzten Jahre weitgehend stabil geblieben, sourcenpools besser mit den Einschränkungen zurecht-
während sich das subjektive Gesundheitsempfinden zukommen scheinen und sogar von positiven Effekten
sogar positiv verändert hat. Treiber dieser Entwicklung berichten.
sind insbesondere die positiven Veränderungen bei In den luxemburgischen Fachdiskursen sind Wohl-
Mädchen und jungen Frauen. befinden und insbesondere die psychische Gesundheit
Obwohl grundsätzlich alle Bevölkerungsgruppen zentrale Themen. Zunehmend dominieren Konzepte, die
auch von geringem Wohlbefinden oder vermehrten den Jugendlichen als Akteur in den Mittelpunkt stellen
gesundheitlichen Problemen betroffen sein können, und eine bedürfnisorientierte und befähigende Herange-
zeigt sich hinsichtlich der Verteilung eine deutliche hensweise verfolgen. Damit spiegeln sie die von vielen
soziale Schieflage: Sozioökonomisch benachteiligte Jugendlichen berichtete Einschätzung, das eigene Leben
Jugendliche sind deutlich häufiger von gesundheitli- handlungsmächtig planen und gestalten zu wollen.
chen Problemen betroffen und weisen insgesamt auch
ein niedrigeres Wohlbefinden auf als Jugendliche mit
höherem Sozialstatus.
Während die Experten gesamtgesellschaftliche
Hintergründe für die Entwicklung von Gesundheit und
Wohlbefinden mitverantwortlich machen, sind viele
Jugendliche der Ansicht, dass sie ihre Gesundheit und
ihr subjektives Wohlbefinden weitgehend selbst aktiv
beeinflussen können. Zudem werden starke soziale
Beziehungen zu Eltern, Familie und Freunden als posi-
tive Faktoren genannt. Für wenige Jugendliche können
solche Beziehungen jedoch auch negative Auswirkungen
auf das Wohlbefinden haben. Ein Mangel an Handlungs-
möglichkeiten, etwa aufgrund fehlender finanzieller Res-
sourcen oder familiärer Unterstützung, kann es zudem
erschweren, Verwirklichungschancen zu ergreifen und
Wohlbefinden positiv zu gestalten.
211FR S YNOP SIS DE S PRINCIPAUX RÉSULTATS
Synopsis des principaux résultats
Sur la base d’analyses circonstanciées, le rapport sur 3. Quels sont les facteurs susceptibles d’expliquer les
la jeunesse a fourni un grand nombre de résultats sur différences dans la perception des jeunes quant à leur
le bien-être et la santé des jeunes au Luxembourg. Les bien-être et leur santé ?
principaux résultats sont synthétisés dans ce chapitre
final. La structure de la présente synopsis est axée sur les 4. Quel rôle les jeunes eux-mêmes et leurs actions
questions soulevées dans le chapitre 2 : jouent-ils dans ce domaine ? Quels comportements
sont bénéfiques et quels sont ceux qui altèrent leur
1. Comment les jeunes au Luxembourg perçoivent-ils bien-être et leur santé ?
leur bien-être et leur santé ?
5. Comment les jeunes évaluent-ils la pandémie de
2. Dans quelle mesure le bien-être et la santé des jeunes Covid-19 et les mesures prises dans ce contexte ?
ont-ils évolué au cours des dernières années ?
6. Quel regard les experts issus des domaines politiques
et de la pratique ayant trait à la santé au Luxembourg
portent-ils sur le bien-être et la santé des jeunes ?
9.1 La perception du bien-être et de la santé
Le bien-être des jeunes luxembourgeois et leur satisfac- jeunes femmes ; en moyenne, les jeunes plus âgés et
tion vis-à-vis de leur situation personnelle dans la société les jeunes dont le statut social est faible la perçoivent
luxembourgeoise peuvent être considérés comme élevés. un peu moins bien. En conséquence, les jeunes dont le
En accord avec ce fait, trois jeunes sur quatre indiquent statut social est faible se trouvent plus souvent trop gros,
disposer de niveaux moyens à élevés de bien-être affectif souffrent plus fréquemment de multiples problèmes de
et de satisfaction de leur vie. santé, de symptômes dépressifs et de maladies mentales
Plus les ressources financières sont importantes et diagnostiquées.
plus le statut social des jeunes est élevé, plus leur satis- Quant aux troubles psychosomatiques, il s’avère que
faction de la vie et leur bien-être affectif sont élevés ; il les filles resp. jeunes femmes, les jeunes avec un statut
arrive cependant fréquemment que les personnes sans social faible et les jeunes âgés de 15 à 17 ans souffrent
parcours migratoire s’estiment plus satisfaites que les jeu- plus fréquemment de troubles que les garçons resp.
nes issus de l’immigration. Par ailleurs, les réseaux sociaux jeunes hommes, les jeunes avec un statut social élevé et
et les relations des jeunes s’avèrent être très importants les jeunes dans d’autres tranches d’âge.
pour leur bien-être. Les parents notamment, mais aussi Il ressort des examens médicaux scolaires que les élè-
les amis proches et les réseaux de pairs jouent un rôle ves de l’enseignement secondaire général (ESG) reçoivent
important dans ce contexte. plus souvent un avis que les élèves de l’enseignement
La perception de leur propre santé donne globale- secondaire classique (ESC). Ces élèves souffrent donc plus
ment une image positive. La majorité des jeunes a une fréquemment de problèmes de santé dont sont informés
perception extrêmement positive quant à leur état de les parents. Le pourcentage plus faible d’avis concernant
santé. Des différences apparaissent toutefois en partie les élèves de l’ESC est conforme au résultat bien étayé de
selon des caractéristiques socio-démographiques. Les l’étude HBSC, selon laquelle les élèves de l’ESC perçoivent
garçons et les jeunes hommes ont en moyenne une globalement mieux leur santé que ceux de l’ESG.
meilleure perception de leur santé que les filles et les
212S YNOP SIS DE S PRINCIPAUX RÉSULTATS FR
9.2 L’évolution du bien-être et de la santé au fil du temps et
comparaison avec d’autres pays
Le bien-être des jeunes luxembourgeois n’a guère changé Pourtant, malgré ces tendances positives, les problèmes
au cours des années passées et est resté relativement et les risques ont augmenté dans certains domaines, ce
stable à un niveau élevé. La perception subjective de la que montrent le nombre croissant de jeunes en surpoids,
santé par les jeunes s’est même améliorée. Aujourd’hui, le manque d’activités physiques et l’augmentation de
plus d’élèves pensent être en « excellente » santé qu’il y troubles psychosomatiques. Par ailleurs, le stress scolaire
a encore 15 ans ; cette hausse concerne notamment les a augmenté constamment au cours des années passées,
filles. La perception des garçons n’a guère évolué. notamment chez les filles. Ce phénomène s’explique
Cette tendance globalement positive quant à la notamment par la plus forte pression liée à la perfor-
perception générale qu’ont les jeunes de leur santé se mance et par le stress dû aux examens.
traduit également par des changements de certains À l’échelle internationale, les jeunes luxembourgeois
comportements, tels que le recul du harcèlement se situent le plus souvent au-dessus de la moyenne quant
moral, la réduction de la consommation d’alcool et de à la perception subjective qu’ils ont de leur bien-être et
tabac, le pourcentage croissant de jeunes qui adoptent de leur santé. Les tendances observées dans le change-
une alimentation équilibrée et une meilleure hygiène ment des perceptions de la santé physique et mentale
bucco-dentaire. D’autres améliorations portent sur l’en- et des comportements ressemblent pour l’essentiel à
vironnement social : davantage d’élèves sont en mesure celles que l’on observe à l’échelle internationale et aux
de parler à leurs parents de choses qui les préoccupent. évolutions dans les pays voisins.
9.3 Facteurs explicatifs des différentes perceptions du bien-être
et de la santé
La question de la santé mentale et du bien-être de jeunes social. Ainsi, les familles, les amis et les pairs notamment
a gagné en importance dans les discours professionnels influencent leur bien-être. Les parents jouent un rôle
menés au Luxembourg au cours des dernières années. important dans le comportement alimentaire et l’activité
Des experts travaillant dans les différents champs d’ac- physique alors que les amis influencent en particulier la
tion estiment que l’augmentation du stress psychique consommation d’alcool et de tabac des jeunes. Des expéri-
et des troubles mentaux pendant la jeunesse est un ences négatives faites avec des pairs, prenant par exemple
problème que l’on retrouve de plus en plus dans tous la forme de harcèlement moral, peuvent altérer le bien-être.
les milieux sociaux. La cause de ce phénomène est attri- Pour une grande partie des jeunes luxembourgeois,
buée à des évolutions générales de la société, tels que la les parents sont en outre des interlocuteurs importants
pression croissante sur les performances et le stress qui qui leur apportent un grand appui dans la vie quo-
y est lié, auquel se voient exposés les jeunes notamment tidienne, mais aussi en cas de problèmes. Une relation
à l’école, mais aussi dans le travail rémunéré. Toutefois, stable et encourageante des parents contribue fortement
la plus grande disposition à se faire traiter, la capacité de au bien-être des jeunes. À l’inverse, des relations prob-
traitement et la déstigmatisation croissante des troubles lématiques peuvent profondément altérer le bien-être
mentaux peuvent avoir leur part de responsabilité dans la des jeunes. Les amis sont également pour les jeunes des
hausse du nombre de troubles mentaux recensés. personnes de confiance importantes, en compagnie
Outre la pression accrue sur les performances, les desquels ils se sentent à l’aise et soutenus.
experts associent surtout l’augmentation des problèmes Les caractéristiques structurelles des institutions
sociaux au sein des familles à des conséquences négati- (notamment les règles ou exigences), que les jeunes
ves pour le bien-être des jeunes. trouvent à l’école, dans les maisons de jeunes, les foyers
Des conditions cadre externes, comme le taux élevé et les structures de logement encadrées ainsi que sur
de risque de pauvreté des jeunes au Luxembourg, le chô- leur lieu de travail, impactent fortement le bien-être des
mage prononcé des jeunes et le manque de ressources jeunes. Des relations de confiance et le soutien apporté
financières, réduisent les chances des jeunes de s’épa- par les adultes (enseignants, éducateurs, supérieurs
nouir et altèrent ainsi leur bien-être et leur santé. hiérarchiques) et d’autres jeunes (camarades de classe,
Il s’avère par ailleurs que l’action des jeunes axée sur le résidents, collègues de travail) dans ces domaines stimul-
bien-être et la santé dépend fortement de l’environnement ent tout particulièrement le bien-être.
213Sie können auch lesen