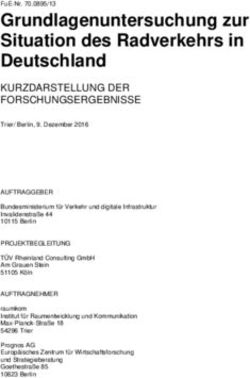MASTERPLAN RADVERKEHR 2030 - Stadt Innsbruck
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Herausgeber Landeshauptstadt Innsbruck Maria-Theresien-Straße 18 6020 Innsbruck www.innsbruck.gv.at Ressortzuständig: Vizebürgermeisterin Ursula Schwarzl Amt für Tiefbau, Amtsvorstand Walter Zimmeter Leitung und Projektkoordination: Teresa Kallsperger, Christian Schoder fuss-radkoordination@innsbruck.gv.at Innsbruck, November 2020 Redakteur*innen: Aus den Ämtern/Geschäftsstellen der Stadt Innsbruck: Bau-, Wasser-, Gewerbe- und Straßenrecht; Geographisches Informationssystem (GIS); Grünanlagen; Marke –und Markenkommunikation; Straßenbetrieb; Tiefbau; Verkehrsplanung, Umwelt; Wald und Natur sowie Innsbrucker Verkehrsbetriebe und Stubaitalbahn GmbH Engele Stefan Feichter Roland Flecker Rudolf Gajic Nemanja Gatternigg Gudrun Giuliani Wilhelm Gruber Klaus Gura Martina Hauschild Martin Hirsch Manfred Hillebrand Thomas Kaufmann Michael Klingler Thomas Neuner Albuin Pinter Markus Pixner Emanuel Poller Arnold Romillo Johanna (Grafik/Layout) Ranninger Eckehard Schwendinger Gernot Stefanon Doris Stockner Walter Mit der Unterstützung von CLAVIS (Kapitel 3) The wordsmith (Lektorat) AGFK Bayern (Kapitel 1.7) Zitierweise: Landeshauptstadt Innsbruck, 2020: Masterplan Radverkehr 2030, Fuß- und Radkoordination, Amt für Tiefbau, Innsbruck
INHALT
Vorwort 5
Einleitung 7
1 INFRASTRUKTUR AUSBAUEN
1.1 Radnetz erweitern 13
1.2 Radrouten sichtbar machen 35
1.3 Radabstellanlagen anbieten 39
1.4 Einbahnen öffnen 45
1.5 Stadtrad nutzen 49
1.6 Zeit fair teilen 53
1.7 Baustellen störungsarm gestalten 57
1.8 Extras anbieten 65
2 SICHERHEIT GEWÄHRLEISTEN 75
3 BEWUSSTSEIN SCHAFFEN 79
ANHANG 93
Literatur 94
Glossar 96
Maßnahmen 98
4VORWORT
Sehr geehrte Leser*innen, Die Landeshauptstadt Innsbruck braucht österreichweit
liebe Radverkehrs-Interessierte! kaum einen Mobilitätsvergleich zu scheuen: Bereits heute
bescheinigt uns die internationale Umweltschutzorganisation
Sie halten den ersten Radmasterplan der Stadt Innsbruck Greenpeace mit einem Anteil der umweltfreundlich zurück-
in Händen. Auf den folgenden Seiten finden Sie die besten gelegten Wege von 70% den österreichweit gemeinsam mit
Ideen für den Ausbau des Radverkehrs in Innsbruck. Damit Wien höchsten Wert. Und das, obwohl Innsbruck wegen der
der Masterplan schrittweise vom Plan zum Meisterstück Hanglagen schwerer zu erradeln ist, als so manch andere
für den Radverkehr werden kann, wird die Landeshaupt- Landeshauptstadt. Den im österreichischen Mobilitätsranking
stadt Innsbruck in den nächsten Jahren einiges an Geld in erworbenen zweiten Rang hinter Wien können wir noch ge-
die Hand nehmen. Jeder in den Radverkehr investierte Cent nau um einen Rang verbessern. Dazu sollen der Radmaster-
kommt um ein Mehrfaches zurück: Sichere Radwege erhö- plan und seine Umsetzung einen großen Beitrag leisten.
hen den Radverkehrsanteil und ein hoher Radverkehrsanteil Unser Dank gilt den zahlreichen Ämtern, die an der Erarbei-
bedeutet weniger öffentliches Geld, das für die Instand- tung dieses Masterplans beteiligt waren, den Vertreter*innen
haltung der Straßen, für Klimastrafzahlungen oder für den aller Stadtsenatsfraktionen, welche die Erarbeitung laufend
öffentlichen Personenverkehr in die Hand genommen wer- begleitet haben, und Ihnen: Denn viele Innsbrucker*innen
den muss. Wer Rad fährt, bleibt gesünder, nimmt weniger haben in den letzten Jahren ihre Fahrradwünsche bei uns in
öffentlichen Raum in Anspruch und verursacht keine Abgase, der Stadtverwaltung deponiert. Ganz besonders danken wir
die unseren Planeten zerstören. Wenn Sie schon Radfah- den beiden Koordinator*innen Teresa Kallsperger und Chris-
rer*in sind: Hier ist unser Plan, wie wir Ihr Radfahrer*innen- tian Schoder, ohne deren Engagement dieser Radmasterplan
Leben verbessern und erleichtern wollen. Und wenn Sie erst jetzt nicht in Ihren Händen liegen würde.
am Umsteigen vom Pkw aufs Fahrrad sind: Hier ist unsere
Rutsche, damit Ihnen das Wechseln der Verkehrsmittel In diesem Sinn: viel Freude bei der Lektüre und wir hoffen,
leichter fällt. viel Freude mit den neuen Radwegen und der verbesserten
Infrastruktur für Fahrradfahrer*innen, die jetzt sukzessive
umgesetzt werden.
Georg Willi Uschi Schwarzl
Bürgermeister 1. Vizebürgermeisterin
Landeshauptstadt Innsbruck Landeshauptstadt InnsbruckAbbildung 1 Kann Radfahren die tragende Säule der verkehrlichen Mobi-
Modal-Split der werktägigen Wege mit Innsbruck-Bezug lität in der Stadt sein? Dies klingt für Manche wie ein Rück-
schritt in der Verkehrsentwicklung. Für Manche ist er jedoch
Innsbrucker*innen und Nicht-Innsbrucker*innen der Ausweg aus einer Fehlentwicklung. Vieles spricht für das
596000 Wege täglich Radfahren – es ist gesund für Körper, Geist und Klima. Es ist
einfach, anpassungsfähig und sparsam an Zeit und Geld. Rad-
fahren kann jede*r – Alt und Jung. Radfahren ist sozial, sport-
Öffentlicher Verkehr
lich, elegant und chic. Radfahrerende benötigen wenig Platz –
20,8%
und trotzdem müssen sie ihren Platz behaupten. Ihren Platz
Pkw-Lenker*in
im Straßenraum und ihren Platz der Anerkennung im Beitrag
37,1%
zur urbanen Mobilität. So ist es bereits ein Fortschritt, wenn
Rad
9,6%
der Radverkehr gleich berechtigt wird, in der Wahrnehmung,
der Akzeptanz und im Raumanspruch. Darum geht es im Mas-
terplan Radverkehr – einem Plan zur Förderung des Radfah-
rens in Innsbruck: Der Radverkehr soll sich inmitten einer viel-
Fuß fältigen urbanen Mobilität positionieren.
Pkw-Mitfahrer*in 22,7%
9,6%
AUSGANGSLAGE – DA STEHEN WIR DERZEIT
Laut letztem bundesweiten Datenstand bzgl. der Ver-
kehrsmittelwahl für Innsbruck aus der österreichweiten
Innsbrucker*innen Nicht-Innsbrucker*innen Erhebung „Österreich Unterwegs 2013/14“ liegt der Rad-
verkehrsanteil der Innsbrucker*innen samt Einpend-
354000 Wege 242000 Wege ler*innen bei 9,6% 1. Diese Datengrundlage gilt als Aus-
gangsbasis für die Stadt Innsbruck. 1
17,8% Öffentlicher Verkehr 25,2% Öffentlicher Verkehr
Daneben gibt es Erhebungen, die für den Innsbrucker
13,8% Rad 3,3% Rad Radverkehrsanteil weitaus besser ausfallen. So z.B. das
28,0% Fuß 14,9% Fuß Greenpeace Mobilitätsranking der Landeshauptstädte,
in dem ein Radverkehrsanteil von rund 17 % angeführt
8,2% Pkw-Mitfahrer*in 11,6% Pkw-Mitfahrer*in wird 2. Im Vergleich zu anderen Städten ist der Anteil
44,6% Pkw-Lenker*in
jedenfalls ausbaufähig. In Innsbruck steht ein gut ausge-
31,9% Pkw-Lenker*in
bautes Netz des Öffentlichen Personen-Nahverkehrs in
Konkurrenz zur Steigerung des Radverkehrs.
Quelle: Österreich Unterwegs 2013/20141 Der Radverkehr ist in mehreren politischen Konzepten
verankert 3, wie z. B. dem Verkehrskonzept aus dem Jahre
1989/90, dem kürzlich novellierten örtlichen Raumord-
nungskonzept (ÖROKO 2.0) und dem derzeit bestehen-
den Arbeitsübereinkommen der Koalition. Auf Landes-
ebene besteht das Radkonzept Tirol 4 und seit einigen
8 EinleitungJahren eine spezielle Förderstrategie. Die im Jahr 2004 ZIELSETZUNG – DA WOLLEN WIR HIN
gestartete Initiative "klimaaktiv" des BMK (Bundesminis-
terium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, In- „Stark und Furchtlos“ (Alltagsradfahrende): 0,5 % der Das Fahrrad bezüglich sicheren, flüssigen und leichten
novation und Technologie) für aktiven Klimaschutz und Bewohner*innen von Städten fahren selbstbewusst und Fahrens als gleichberechtigtes Verkehrsmittel anerken-
Teil der Österreichischen Klimastrategie und enthält auch ohne Angst Fahrrad, unbeirrt ob es eigene Radfahran- nen, sowohl im Bewusstsein aller Verkehrsteilnehmen-
ein Förderprogramm für den Radverkehr 5. All diese Stra- lagen gibt oder nicht. Das Fahren im Mischverkehr macht den als auch in der Praxis.
tegien sehen den Radverkehr als Konzept der Zukunft. ihnen keine Angst oder Probleme. Das Fahrrad prägt ihre
Wir gehen einen Schritt weiter und sehen den Radverkehr Identität sehr stark. Die Formulierung dieser Vision mag wenig ambitioniert
in Anlehnung an den bekannten „Berlin Standard“ von wirken, da laut StVO der Radverkehr als gleichberechtig-
Heinrich Strößenreuther 6 als systemrelevant: deshalb, tes Verkehrsmittel in unser Verkehrssystem eingebunden
weil der Platz in Innsbruck sehr beengt ist. Aber auch in „Begeistert und überzeugt“ (Gewohnheitsfahrende): ist. Das Innsbrucker Verkehrssystem zeichnet jedoch ein
Anbetracht der gegenwärtigen Herausforderungen der 6,5 % fahren begeistert und überzeugt Fahrrad. Sie be- anderes Bild. Dies ist zum einen in der Aufteilung von
Klimakrise. Wir sind überzeugt, dass der Radverkehr zu vorzugen baulich getrennte Radfahranlagen und fahren Raum und Zeit zu beobachten, zum anderen im gerin-
einem lebenswerten und qualitativ hochwertigen Inns- bei Bedarf nicht ganz angstbefreit im Mischverkehr. Sie gen Verständnis der Verkehrsträger untereinander. Dies
bruck maßgeblich beiträgt. Die kompakte städtebauliche fahren gern und regelmäßig Fahrrad und zählen zu den lässt sich als Verkehrsteilnehmer*in selbst erleben sowie
Form Innsbrucks ist ideal für den Radverkehr, die topo- Gewohnheitsfahrenden. in Erfahrungsberichten diverser Institutionen und Bür-
grafischen Herausforderungen relativieren sich durch die ger*innen nachlesen. Daher ist es dringend erforderlich,
zunehmende elektrische Unterstützung. das bereits gesetzlich Definierte in die Praxis umzusetzen
„Interessiert, aber besorgt“ (Gelegenheitsfahrende): und im Bewusstsein aller, die am Verkehrsleben in Inns-
Um den Radverkehr in Innsbruck zu stärken, betrachten 60 % sind am Radfahren sehr interessiert und würden bruck teilnehmen, zu verankern. In diesem Sinne hat sich
wir zunächst, wer denn eigentlich mit dem Fahrrad unter- gern mehr Fahrrad fahren. Diese Mehrheit fährt fast aus- die Stadtführung Innsbrucks vorgenommen, das Fahrrad
wegs ist und welche Anforderungen diese Gruppierung schließlich auf baulich getrennten Radfahranlagen, da sie als Standard-Verkehrsmittel in der Gesellschaft zu etablie-
an das Radverkehrssystem hat, um freiwillig und über- das Fahren im Mischverkehr als zu gefährlich erachtet. ren. Gerade in Tirol wird der Radverkehr oft mit Freizeit
zeugt mit dem Fahrrad zu fahren. Radfahrende sind eine Der Großteil (ca. 60 %) setzt sich aus Frauen, Kindern assoziiert, da die Topografie dafür wie geschaffen ist und
sehr vielfältige Gruppe. Was sie alle verbindet, ist, dass sie und deren Eltern sowie älteren Personen zusammen. Sport in der Gesellschaft eine elementare Rolle spielt. Das
sich durch die eigene Muskelkraft bewegen. Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel ist noch nicht in der
Mitte des gesellschaftlichen Verständnisses angekommen.
Mit baulichen, organisatorischen und bewusstseinsbil- „Auf gar keinen Fall“ (Nichtfahrende): 33 % fahren auf Im Zuge dessen wollen wir die Vorzüge des Fahrrads als
denden Maßnahmen stellen wir nicht nur bereits aktive gar keinen Fall Fahrrad („no way no how“). Die Gründe schnellstes innerstädtisches Verkehrsmittel (gemessen an
Radfahrende zufrieden, damit diese weiterhin mit dem liegen in der Gesundheit, Topografie, Streckenlänge oder der Gesamtreisezeit) bei Streckenlängen von eineinhalb
Fahrrad fahren, sondern wollen wir auch weitere Ziel- im Desinteresse. bis fünf Kilometern bzw. den optimalen Einsatzbereich
gruppen erschließen. Da es keine vergleichbaren Um- des Fahrrads effektiv an die Zielgruppen kommunizieren.
fragen aus Innsbruck gibt, greifen wir auf eine etablierte Darüber hinaus wollen wir, dass die gebündelten Vorteile
Typisierung von Radfahrenden zurück, die Roger Geller, der ganzjährigen aktiven Mobilität im Sinne der Gesund-
langjähriger Radkoordinator aus Portland, USA, unter heit der Bevölkerung, der Umwelt sowie der Volkswirt-
dem Titel „Four Types of Cyclists“ 2005 entwickelt hat. schaft wertgeschätzt werden. Den Radverkehr zu fördern,
Aus dieser gehen vier Nutzer*innen-Gruppen hervor 7: heißt auch sanfte Mobilität im Sinne hoher Lebensquali-
tät für den Aufenthalt in der Stadt zu fördern. Die damit
verbundenen Veränderungen im Straßen- und Stadtbild
führen dazu, dass der Straßenraum für die Innsbrucker
Bevölkerung angenehmer erlebbar gemacht wird. Dies
9Vision gilt gleichermaßen auch für Fußgänger*innen, welche
gleichermaßen durch eine Transformation maßgeblicher
Straßenräume profitieren sollen. Neben den optischen
Anerkennung des Fahrrads als gleichberechtigtes Verkehrsmittel und
Veränderungen führt die aktive Fortbewegung durch den
Verankerung im Bewusstsein aller Verkehrsteilnehmer*innen sowie in der Praxis Straßenraum zu einer bewussteren Wahrnehmung der
Umgebung. Das Transportmittel Fahrrad wollen wir als
Ziel Schlüssel zum modernen, gedeihenden und zukunftswei-
senden Innsbruck verstanden wissen. Dazu zählt neben
Steigerung des Radverkehrs auf 20 % im ganzen Jahresverlauf, ohne der physischen Mobilität auch die geistige Mobilität, die
durch die aktive Fortbewegung durch das Fahrrad geför-
Beeinträchtigung des öffentlichen Verkehrs und des Fußverkehrs dert wird. Es handelt sich damit um einen Prozess, der
in der Gesellschaft bereits wahrnehmbar angelaufen ist,
jedoch mit dem Masterplan Radverkehr als strategischem
Handlungsfelder Prozess in Szene gesetzt werden soll.
Infrastruktur ausbauen
ZIELSETZUNG
Sicherheit gewährleisten Den Radverkehr im ganzen Jahresverlauf auf 20 % zu
steigern, ohne den ÖV und den Fußverkehr zu beein-
trächtigen. Dieses Ziel wollen wir mit folgenden Unter-
Bewusstsein schaffen zielen erreichen:
• Ein möglichst lückenloses Radwegenetz bereitstellen:
Die Innsbrucker Radinfrastruktur bauen wir nach de-
Verwaltung Politik Bürger*innen finierten Ausbauqualitäten so aus, dass sämtliche We-
geverbindungen lückenlos mit dem Fahrrad erreichbar
sind.
• Die Sicherheit im Radverkehr sicherstellen: Wir redu-
zieren Radverkehrsunfälle im Stadtgebiet. Dazu analy-
sieren wir relevante Unfälle systematisch und zyklisch
und leiten effektive Maßnahmen für die Umsetzung ab.
• Die Geschwindigkeit je nach ortsspezifischen Anforde-
rungen beeinflussen: Um die Sicherheit im Radverkehr
zu erhöhen, gilt es neben dem Ausbau an Infrastruktur
auch die Geschwindigkeit im gesamten Verkehrssystem
abhängig der jeweiligen örtlichen Bedingungen anzu-
gleichen.
• Den Anteil des Winterradverkehrs anheben: Wir ma-
chen den Radverkehr im ganzen Jahresverlauf attrak-
tiver. Wenn Radfahrende in den Wintermonaten auf
den ÖV wechseln, belasten sie diesen in einer hoch-
10 Einleitungfrequentierten Zeit. Volkswirtschaftlich ist daher eine Gestaltung von Baustellen und vieles mehr. Neben den DIE DREI SÄULEN
jahresdurchgängig möglichst gleichförmige Nutzung infrastrukturellen Maßnahmen legen wir einen Fokus Die Erarbeitung dieses Konzepts erfolgte unter Berück-
von Vorteil. auf das Thema Sicherheit. Wir sehen die angepasste Ge- sichtigung der drei Säulen:
• Bisherige Radfahrende zufriedenstellen: Wir stellen schwindigkeit im Verkehrssystem als Schlüssel zu mehr
bestehende Radfahrer*innen in ihrem subjektiven Ge- Sicherheit für alle Verkehrsträger, auch den Radverkehr. Verwaltung Politik Bürger*innen
fühl zufrieden. Somit wird gewährleistet, dass sie Rad- Als drittes Handlungsfeld wollen wir mehr Bewusstsein
fahrende bleiben und nicht zu anderen Verkehrsträgern in der Gesellschaft schaffen und die bestehende Fahrrad-
wechseln. kultur in Innsbruck stärken. Wir adressieren dies anhand
• Neue Zielgruppen erschließen: Wir begeistern mehr verschiedener Formate neben bereits aktiven Radfahren- • Verwaltung: die fachliche Analyse erfolgte unter der
Personen für den Radverkehr, das heißt, dass wir beste- den auch an zukünftige Radfahrende. amtsübergreifenden Mitwirkung vieler Mitarbeitenden
hende Autofahrerende als neue Zielgruppe erschließen. des Stadtmagistrats Innsbruck, die das Thema Fahrrad
• Die positive Einstellung zur Fahrradkultur der Für die Förderung des Radverkehrs bekennen wir uns zu mit ihrer Kompetenz und Verantwortlichkeit betreuen.
Gesellschaft stärken: Neben dem klaren Bekenntnis einer Vielzahl an Maßnahmen innerhalb der drei Hand-
zum Fahrradfahren wollen wir Innsbruck als Stadt lungsfelder. Wir setzen auf die Strategie, je nach ortsspezi- • Politik: die politischen Repräsentanten wurden in
mit einer gelebten Fahrradkultur im allgemeinen fischen Gegebenheiten zu entscheiden, ob der inkludier- Form einer Mentoring-Gruppe eingebunden, die in
Bewusstsein verankern und breite Akzeptanz dafür te Mischverkehr bei geringem Geschwindigkeitsniveau acht Sitzungen beratend und steuernd zur Seite stand
schaffen, dass Investitionen in den Radverkehr fließen. besser oder schlechter geeignet ist als ein Radschnellweg. und die Inhalte in die politischen Klubs zurückspielten.
Beide Formen sind zur Förderung des Radverkehrs ge- Eingegangene Stellungnahmen wurden im Masterplan
Um die definierten Ziele zu erreichen und die erarbeite- eignet, nur müssen sie an geeigneter Stelle zum Einsatz inhaltlich bewertet und berücksichtigt. Daneben wurde
ten Maßnahmen umsetzen zu können, sollen die notwen- kommen. der Projektfortschritt regelmäßig im Ausschuss für
digen budgetären Mittel planbar vorausschauend sicher- Umwelt, Energie und Mobilität berichtet.
gestellt werden. Anhand der Ausgaben pro Radfahrer*in Der Masterplan formuliert die Handlungsstrategie für
bzw. Einwohner*in wird laufend evaluiert und transpa- die Stadtführung, auf der Seite der politischen Repräsen- • Bürger*innen: Anregungen aus der Bevölkerung
rent gemeldet, welchen Stellenwert der Radverkehr im tanten und auf der Seite der Stadtverwaltung. Handelnde werden laufend zur Verbesserung der Situation für
Innsbrucker Haushaltsbudget erhält. sind aber auch Interessensgruppen und rechtlich institu- Radfahrende aufgenommen. Zudem wurden im 1. Inns-
tionalisierte Interessensvertretungen, Medienschaffende brucker Radworkshop die Wünsche, Ideen und
und Meinungsbildner – und ganz besonders alle Radfah- Anregungen der Innsbrucker Bevölkerung zum
HANDLUNGSFELDER renden. Radnetz, insbesondere zu bestehenden Lücken,
Um die Ziele zu erreichen, verwenden wir drei Hand- Radrouten und zum Thema Sicherheit aufgenommen.
lungsfelder. Für jedes dieser Handlungsfelder ist in Inns- An die 200 Besucher*innen haben im Workshop Ihre
bruck ein erheblicher Qualitätsanstieg notwendig, um die ZEITHORIZONT Anliegen deponiert.
oben definierten Zielsetzungen zu erreichen. Zentral ist Die in diesem Konzept erarbeiteten Maßnahmen werden
der Ausbau der Fahrradinfrastruktur, insbesondere des für die kommenden zehn Jahre bis 2030 definiert.
Innsbrucker Radnetzes. Durchgängig, sicher und hinder-
nisarm soll es werden. Eine Vielzahl an weiteren Faktoren
machen das Gesamtpaket für eine attraktive Fahrrad-
infrastruktur aus. Dazu gehören qualitativ hochwertige,
sichere und gut zugängliche Radabstellanlagen, intuitive
Wegweiser an Hauptradrouten, die Öffnung von Einbah-
nen, das Angebot von Leihrädern in der Stadt, die faire
Verteilung von Zeit im Straßenraum, die störungsarme
11© Johanna Romillo
RADNETZ ERWEITERN
Ziele Maßnahmen
• Radnetz erweitern • Der Radverkehr wird im gesamten Jahresverlauf auf Umsetzung bis: 2030
einen Anteil von 20 % gesteigert, ohne den ÖV und
• Sicherheit gewährleisten den Fußverkehr zu beeinträchtigen. • Die Lücken im hochrangigen Radnetz werden bevorzugt
geschlossen.
• Geschwindigkeit
beeinflussen • Die Anbindung des Radverkehrs an die Gemeinde Natters
sowie die Vitalregion wird umgesetzt.
• Winterradverkehr
anheben • Die Lücken im lokalen Netz werden geschlossen.
• Radfahrende
zufriedenstellen
• Neue Zielgruppen
erschließen
• Fahrradkultur stärken
ANGESPROCHENE NUTZUNGSGRUPPE
Stark und furchtlos
1.1
Begeistert und überzeugt
Interessiert, aber besorgt
Auf gar keinen Fall
13Tabelle 1
Qualitätskriterien Radkonzept Tirol Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Verkehr und Straße: Radkonzept Tirol, Innsbruck 20144
ALLTAG
FREIZEIT
Überregionale/regionale Verbindung Lokale Verbindung
KRITERIEN KATEGORIEN S R1 R2 L1 L2 F
Durchgehend befahrbar x x x x x x
Verkehrssicher x x x x x x
Einbindung in Netz x x x x x x
Direkte Wegführung, keine Umwege x x
FÜHRUNG
Intermodale Umsteigemöglichkeit x x
Querungen und Kreuzungen vermeiden x
ausschließlich Radverkehr, Radweg x
Trennprinzip
komb. Geh- und Radweg, Radstreifen x
nur „Anrainerverkehr“ x
Mischprinzip
geringer Kfz-Verkehr x x
Abseits von Lärmquellen x
Landschaftlich attraktiv x
Gute Entwässerung x x x x x x
ERRICHTUNG
Frei von Hindernissen x x x x x x
Befestigte glatte Oberfläche x x x
≥ 4,5m (Überholmöglichkeit) x
Breite des Verkehrsraumes (Zweirichtg) ≥ 3,5m (Anhänger | Anhänger) x
≥ 2,5m (Rad | Anhänger) x x x x
≥ 22m (bis zu 30 km/h) x x
Kurvenradien außerorts ≥ 14m (bis zu 25 km/h) x
≥ 8m (bis zu 20 km/h) x x x
≤ 3% x x
Steigung ≤ 6% (bis 500 m) x
≤ 8% (bis 250 m) x x x
Erhaltung x x x x x x
WARTUNG
Reinigung x x x x x x
Winterdienst x x x
Beschilderung x x x x x x
Abstellanlagen an Zielen x x x x x x
AUSSTATTUNG
Einkehrmöglichkeiten x
Rastplätze x
Servicestationen x x
Beleuchtung x
Infotafeln x
Attraktivierung (Mülleimer, Fußstützen,...) x
14 Kapitel 1 Infrastruktur ausbauen1.1.1 FACHLICHE ANALYSE • Radschnellwege S Vervollständigt wird das Innsbrucker Radroutennetz
1.1.1.1 QUALITÄTSKRITERIEN UND WUNSCHLINIENNETZ • regionale Radrouten R1 durch sogenannte Hochradwege H. Diese sind zwar für
Die Einteilung der Innsbrucker Radrouten basiert auf dem • regionale Radrouten R2 den Alltagsradverkehr relevant, jedoch nicht jahresdurch-
Kriterienkatalog des Radkonzepts Tirol, der zwischen • lokale Radrouten L1 gängig befahrbar, da große Höhenunterschiede bewältigt
überregionalen, regionalen und lokalen Verbindungen im • lokale Radrouten L2 werden müssen.
Alltagsverkehr und dem Freizeitverkehr unterscheidet. • Hochradwege H Somit ergibt sich das gesamte Wunschliniennetz in Inns-
Bei den überregionalen und regionalen Verbindungen bruck. 5
findet eine Einteilung in S, R1 und R2 statt, während die Radschnellwege S verlaufen entlang des Inns, sind durch-
Bezeichnungen L1 und L2 für lokale Verbindungen lau- gehend befahrbar und von großer überregionaler Bedeu-
ten. Verbindungen für den Freizeitverkehr werden mit tung. Sie zeichnen sich durch eine möglichst kreuzungs- 1.1.1.2 STATUS QUO IN INNSBRUCK
F festgelegt. Eine genaue Auflistung der einzelnen Krite- freie, durchgehend befahrbare Wegführung auf eigenen Der Radverkehr wird im Misch- oder Trennprinzip ge-
rien findet sich in Tabelle 1. 1 Radverkehrsanlagen aus, bieten durch entsprechende führt. Für Radschnellwege ist ausschließlich der Radver-
Breiten Möglichkeiten zum Überholen, sind entspre- kehr im Trennprinzip vorzusehen, während für die re-
Aufgrund der Platznot können nicht alle Kriterien der chend beschildert und werden im Winter geräumt. 2 gionalen Radrouten R1 auch ein kombinierter Geh- und
jeweiligen Kategorien im innerstädtischen Straßennetz Radweg zweckmäßig ist. Die restlichen Kategorien (regio-
erfüllt werden. Für die derzeit bestehende Förderung des Regionale Verbindungen R1 binden Nachbargemeinden nale Radrouten R2, lokale Radrouten L1, lokale Radrouten
Bundesministeriums (klimaaktiv) müssen Radschnell- an, führen in das Stadtzentrum bzw. zu wichtigen Ein- L2, Hochradwege H) können allesamt im Mischprinzip
verbindungen folgende Kriterien aufweisen8: richtungen. Sie können als kombinierte Geh- und Rad- abgewickelt werden, wobei für regionale Radrouten R2
• Mindestlänge von fünf Kilometern wege geführt werden, die durchgehend befahrbar sind, nur ein Mischprinzip mit Anrainer*innenverkehr anzu-
• Festlegung in den Planungsdokumenten des Bundes- im Winter geräumt werden und entsprechend beschildert streben ist. Auf Grund des beengten Platzes lässt sich dies
landes sind. Regionale Verbindungen R2 binden ebenso Nach- im Stadtgebiet nicht immer umsetzten. Hier gilt: eine Rad-
• Potenzial von mindestens 2.000 Radfahrenden pro 24 bargemeinden an, führen in das Stadtzentrum bzw. zu verkehrsanlage an den Radrouten mit Qualitätseinschrän-
Stunden wichtigen Einrichtungen. Sie können auch im Mischprin- kungen und sicherheitsrelevanten Ausgleichsmaßnahmen
• Niveaufreiheit gegenüber dem Kfz-Verkehr bzw. Vor- zip geführt werden können, solange nur Anrainer*innen- ist besser, als keine Radverkehrsanlage umzusetzen.
rang an niveaugleichen Kreuzungen Verkehr herrscht und sind durchgehend befahrbar. 3
• Projektierungsgeschwindigkeit: 30 Kilometer pro Stunde Innsbrucks Radinfrastruktur ist mit sämtlichen Anlagen
• Verkehrsraumbreiten: Für die lokalen Verbindungen sind die Kategorien L1 und (Radwege, Mehrzweckstreifen, Radfahren gegen die Ein-
- Zweirichtungsradweg: mehr als vier Meter L2 vorgesehen. Sie ergänzen das überregionale Radnetz. bahn etc.) derzeit wie in Abbildung 6 dargestellt ausge-
- Einrichtungsradweg: mehr als zwei Meter Lokale Verbindungen L1 sind wichtige innerstädtische baut. 6
je Fahrtrichtung Radwege, die relevante öffentliche Einrichtungen mit dem
Fahrrad erreichbar machen. Sie sind durchgängig befahr- Im Innsbrucker Stadtgebiet stellen die gemischten Geh-
Unter Berücksichtigung der Zielsetzung zur Förderung bar und können im Mischprinzip geführt werden. Lokale und Radwege, gefolgt von den getrennten Radwegen und
des Radverkehrs wird für Innsbruck ein Wunschlinien- Verbindungen L2 bieten Ergänzungen im Netz und er- Mehrzweckstreifen jene Radinfrastruktur dar, welche an-
netz erstellt. Das Wunschliniennetz für den Radverkehr schließen Wohngegenden. 4 hand ihrer Länge am meisten vertreten sind. 7
lässt sich in Nord-Süd- bzw. Ost-West-Achsen einteilen.
Dazwischen verbinden und verfeinern Netzergänzungen
die Hauptrouten. Das Radroutennetz wurde in Anleh-
nung an die Kategorien des Landes Tirols eingeteilt:
15Abbildung 2
Radrouten Innsbruck – Radschnellwege S Quelle: Amt der Tiroler Landesregierung, Abteilung Verkehr und Straße: Radkonzept Tirol, Innsbruck 2014
Radschnellweg S
16 Kapitel 1 Infrastruktur ausbauenAbbildung 3
Radrouten Innsbruck – S und regionale Radrouten R1, R2 Quelle: Stadt Innsbruck
regionale Radroute R1
regionale Radroute R2
Radschnellweg S
17Abbildung 4
Radrouten Innsbruck – S, R1, R2 und lokale Radrouten L1 Quelle: Stadt Innsbruck
lokale Radroute L1
lokale Radroute L2
regionale Radroute R1
regionale Radroute R2
Radschnellweg S
18 Kapitel 1 Infrastruktur ausbauenAbbildung 5
Wunschliniennetz Innsbruck – Radrouten S, R1, R2, L1, L2 und Hochradwege H Quelle: Stadt Innsbruck
Route Nachbargemeinden
Hochradweg
lokale Radroute L1
lokale Radroute L2
regionale Radroute R1
regionale Radroute R2
Radschnellweg S
lradweg
198
Abbildung 6
Überblick der Radinfrastruktur in Innsbruck Quelle: Stadt Innsbruck
bestehende Radfahranlagen
20 Kapitel 1 Infrastruktur ausbauenAbbildung 7 Abbildung 13
Radrouten Innsbruck – Radschnellwege S Methodik des Rankingmodells Quelle: Österreichischer Städtebund, 2012 9
Radweg gemischt 14230 m
Vorhaben
Radweg 13658 m
Investitionsbedarf verkehrliche
Mehrzweckstreifen 10539 m Betriebskosten Wirkungsmengen
Einnahmen Erreichbarkeit
Radweg getrennt 6847 m
Monetarisierung der
Wirkungsmengen
RF gegen Einbahn 6687 m
Radfahrstreifen 2061 m Beschreibung gesamt- betriebs- regionalwirtsch.
strateg. wirschaftlicher Umweltnutzen wirtschaftlicher Effekte
Fahrradstraße 586 m Ausrichtung Nutzen Erfolg (Schienenprojekte)
Quelle: Stadt Innsbruck
Abbildung 10
verwendete Radverkehrszählstellen in Innsbruck (Mittelwerte je Monat)
5000
2000
1500
1000
500
1285
2935
2054
3415
3509
2950
3651
2252
3335
2502
2125
1345
1343
1243
1671
2312
1791
1846
2492
3144
2088
2719
2169
2313
3939
4404
3082
2646
2424
2397
3063
2011
2390
3042
2311
2036
3997
2289
2692
1771
1766
1830
1144
940
810
803
980
0
*
Jänner Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Zählstellen: UNI Geiwi Sillpark * keine Daten für den Zeitraum Dezember 2019 vorhanden
Karwendelbrücke Herzog-Otto-Ufer Quelle: Stadt Innsbruck
211.1.1.3 LÜCKEN (räumliche Einheiten, die mit ihren Strukturdaten als Lückenschlüsse. Diese entsprechen im Prognosemodell
Lücken im Radnetz zu beseitigen kommt eine besondere Quelle und Ziel des Verkehrsaufkommens fungieren) und den für den Endausbau vorgesehenen Streckentypen.
Bedeutung zu, denn ein durchgängiges Netz mit entspre- Distanzfunktionen aus dem vorhandenen Verkehrsmo-
chender fahrradfreundlicher Infrastruktur trägt maßgeb- dell herangezogen.
lich zur Steigerung des Radverkehrs bei. Dazu sind vier 1.1.1.5 UMLEGUNGSVARIANTEN
unterschiedliche Lückenkategorien definiert: Bei der Verkehrsmittelwahl für den Radverkehr wird bei Bei den zwei berechneten Umlegungsvarianten wird zwi-
• LK0… „Radinfrastruktur ausreichend“ der Nutzenfunktion die tatsächliche Fahrtzeit berücksich- schen dem Analysemodell (bestehendes Radverkehrsnetz
• LK1… „fehlende Radinfrastruktur“ tigt. Dadurch fließen Höhenunterschiede und Umwege und aktuelle Verkehrsnachfrage) sowie einem Prognose-
• LK2… „fehlende Radinfrastruktur, aber mit dem Rad mit in die Berechnung der Verkehrsmittelwahl ein. Mithil- modell (Radwegenetz ohne Lücken und erhöhter Ver-
befahrbar“ fe des Google API (application programming interface)10 kehrsnachfrage) unterschieden. Die Differenz der zwei
• LK3… „Radinfrastruktur vorhanden, jedoch nicht der werden aus Google Maps die tatsächlichen durchschnitt- Umlegungsmodelle ergibt die Eingangswerte für die Nut-
Routenkategorie entsprechend“ lichen Fahrzeiten zwischen den einzelnen Verkehrszellen zen-Kosten-Analyse.
abgefragt und bei der Nutzenfunktion mitberücksichtigt. Das Analysemodell bildet den heutigen Radverkehr in
Entlang der Radrouten werden immer beide Fahrtrich- Innsbruck ab. Es fußt auf folgenden Grundlagen:
tungen getrennt bewertet und entsprechend im Verkehrs- Das für die Umlegung benötigte Netz und sämtliche da- • Abbildung des Radverkehrs innerhalb von 24 Stunden
modell für die Berechnungen eingearbeitet. Die Radinfra- zugehörende Anbindungen (Verbindungen zwischen den für einen typischen Werktag .
struktur wurde fahrtrichtungsweise ins Verkehrsmodell Verkehrsbezirken und dem Streckennetz) sowie Knoten- • Ableitung der Verkehrsmittelwahl Österreich Unterwegs
eingepflegt, zur Berücksichtigung der unterschiedlichen widerstände (Zeitwiderstände, die mit den Knoten z.B. 2013/14 (9,6% Radanteil) .
Attraktivität der jeweils vorliegenden Radinfrastruktur. Kreisverkehr, VLSA etc. und der jeweiligen Haupt- bzw. • Die Radverkehrsstärke für die Analyse wird in Abbil-
Sämtliche Lücken sind in Abbildung 8 verzeichnet. 8 Abbiegerichtung verknüpft sind) wurden für das Radver- dung 9 dargestellt. 9
kehrsmodell neu implementiert. Das Bestandsnetz bildet
Die relevantesten Lückenschlüsse wurden monetär be- die tatsächliche Radinfrastruktur in Innsbruck ab sowie all Für das Prognosemodell wurden folgende Annahmen ge-
wertet und die budgetwirksamsten Projekte in die Kos- jene Straßenzüge, welche im Wunschliniennetz dargestellt troffen:
ten-Nutzen-Berechnung eingepflegt. sind und nicht bereits bei der Radinfrastruktur berücksich- • Der Prognoseverkehr bildet den Radverkehr innerhalb
tigt wurden (z.B. Radfahren in verkehrsarmen Straßen). 24 Stunden für einen typischen Werktag ab.
• Der Radverkehrsanteil in der Verkehrsmittelwahl wird im
1.1.1.4 MODELLBERECHNUNG Es wurden folgende Streckentypen mit dazugehöriger Vergleich zum Analyseverkehr verdoppelt (19.2% Rad-
Im Modell wird der Alltagsradverkehr (durchschnittlich Geschwindigkeit im unbelasteten Streckennetz (v0) ver- anteil). Der zusätzlich entstehende Radverkehr wird zur
werktägige Verkehrsnachfrage) im Streckennetz rech- wendet (E-Biker*innen wurden bei der Ermittlung der Gänze aus dem Verkehrsaufkommen des mIV geschaffen.
nerisch abgebildet. Die Berechnung der Verkehrsströme Geschwindigkeiten nicht berücksichtigt): • Auf einen Prognosezeitraum wird verzichtet. Verände-
baut auf ein vier-Stufen Modell auf. Der Algorithmus für • Radweg…20 km/h rungen in der Bevölkerung und in der örtlichen Arbeits-
die Berechnung ist wie folgt gegliedert: • Rad- und Fußweg (Mischprinzip)…17 km/h platzverteilung werden demnach nicht berücksichtigt.
• Verkehrserzeugung (Strukturdaten) • Radfahrstreifen…18 km/h Die Gesamtwege der Quell-Ziel-Beziehungen bleiben
• Verkehrsverteilung (Quelle-Ziel-Beziehungen) • Mehrzweckstreifen…16 km/h konstant.
• Verkehrsmittelwahl (Modal Split) • Fahrradstraße…16 km/h • Im Prognosenetz wird davon ausgegangen, dass alle Lü-
• Umlegung der Verkehrsnachfrage auf Radrouten der • Führung in verkehrsarmer Straße…16 km/h cken auf den relevanten Routen geschlossen sind. Wech-
Kategorien S, R1, R2 (Verkehrsbelastungen) • Hochradwege…8 km/h selwirkungen bei Nichtumsetzung einzelner Maßnah-
• Lückenschluss…0 km/h men sind im Modell nicht berücksichtigt.
Die Erzeugung und Verteilung wurde aus dem bereits • Die Verkehrsdaten von vier Radzählstellen sind in die Ver-
bestehenden mIV-Modell für Innsbruck übernommen. Für das Prognosemodell ändern sich die Streckentypen kehrsmodellierung mit eingeflossen, siehe Abbildung 10.
Dabei werden sämtliche Strukturdaten, Verkehrszellen für die in der wirtschaftlichen Bewertung angegebenen 10
22 Kapitel 1 Infrastruktur ausbauenDie Radverkehrsströme für die Prognose werden in Ab- wie für Maßnahmen zur umweltfreundlicheren Nutzung
bildung 11 dargestellt. 11 des Autos (z.B. Fahrgemeinschaften, etc.) umfassen.
Die Differenz des Prognose- zum Analysemodell bildet Der gesamtwirtschaftliche Nutzen errechnet sich mit
die Verkehrswirksamkeit der Lückenschlüsse ab. In Ab- folgender Formel:
bildung 12 ist die Verkehrswirksamkeit ersichtlich. Der Betrachtungszeitraum des Bewertungsverfahrens
12 wird einheitlich für eine Betriebszeit von 15 Jahren fixiert.
Ein Vorhaben ist aus gesamtwirtschaftlicher Sicht reali-
In der Differenzdarstellung lässt sich der Zuwachs- bzw. die sierungswürdig, wenn sich ein Nutzen-Kosten-Verhältnis
Abnahme des Radverkehrsaufkommens unter den getrof- von deutlich über eins ergibt und dadurch der gesamt-
fenen Randbedingungen für den Prognosezustand ablesen. wirtschaftliche Nutzen durch das Vorhaben deutlich über
Dabei ist zu sehen, dass die Zuwächse vorwiegend am hö- den gesamtwirtschaftlichen Kosten liegt.
herrangingen Radwegenetz mit den in der Berechnung ge- Das Analyse- und Prognoseverkehrsmodell basiert auf
schlossen Lücken auftreten (siehe Museumsstraße). dem durchschnittlich werktäglichen Verkehr (Alltagswe-
ge). Das Rankingmodell verwendet als Eingangsdaten die
1.1.1.6 NUTZEN-KOSTEN-ANALYSE Jahresverkehrsstärken. Daher wurden die Verkehrsdaten
Zur qualitativen und objektiven Bewertung des Nutzen- anhand der Daten von vier repräsentativen Zählstellen
Kosten-Verhältnisses von geplanten bzw. notwendigen umgerechnet.
Infrastrukturmaßnahmen wird das Rankingmodell des
österreichischen Städtebundes herangezogen. Im Wesent- 1.1.1.8 ERGEBNISSE DES RANKINGMODELLS
lichen beruht es darauf, die Verkehrswirksamkeit mit den Folgende Lücken (der Kategorien S, R1, R2) wurden im
Kosten der Lückenschlüsse in ein Verhältnis zu setzen. Rankingmodell bewertet, siehe Abb. 14 und Tabelle 2.
14 2
1.1.1.7 RANKINGMODELL
Das Umweltverbund-Rankingmodell wurde 2012 vom
Städtebund herausgegeben. Demnach ist es dazu geeignet, Bei 16 Lückenschlüssen liegt der Gesamtnutzen über den
Vorhaben im Umweltverbund (Radverkehr, Fußgänger- Kosten, das heißt das Nutzen-Kosten-Verhältnis (NKV)
verkehr, ÖV) im Hinblick auf ihren volkswirtschaftlichen ist größer als eins. Für diese Lückenschließungen ergeben
Nutzen, ihren Umweltnutzen, deren betriebswirtschaftli- sich unter den getroffenen Annahmen volkswirtschaftli-
chen Nutzen und auf die dadurch ausgelösten regional- che Nutzen.
wirtschaftlichen Effekte abzubilden9. Das Rankingmodell
soll die Entscheidungsgrundlage bei anstehenden öffent- Das Rankingmodell berücksichtigt keine politischen
lichen Investitionen im Umweltverbund maßgeblich ver- Zielsetzungen oder überregionale Zusammenhänge.
bessern und ist daher auch Grund-lage für Förderansu- Derartige Kriterien sowie die Summe der subjektiven
chen. 13 Einschätzungen aus der Bevölkerung sollen auch in die
Maßnahmenbeurteilung einfließen, um ein gesamthaftes
Der Begriff eines „Vorhabens“ steht im Sinne des Ran- Ergebnis zu erhalten. Erst damit kann ein vollständiges
kingmodells für die Summe der Maßnahmen, die ein zu Bild aus Fakten, Einschätzungen und Wünschen geschaf-
bewertendes Projekt ausmachen. Diese können sowohl fen werden.
infrastrukturelle, betriebliche und organisatorische Maß-
nahmen für den Fußgänger-, Fahrradverkehr, den ÖV so-
23Abbildung 8
Überblick der Lücken im Innsbrucker Radwegenetz Quelle: Stadt Innsbruck
Lückenschlüsse
LK0
LK1
LK2
LK3
24 Kapitel 1 Infrastruktur ausbauenAbbildung 9
Radverkehrsstärke laut Analysemodell (Radanteil 9,6%) Quelle: Stadt Innsbruck
Radverkehrsstärke
24 h werktags
2500
5000
10000
25Abbildung 11
Radverkehrsstärke laut Prognosemodell Quelle: Stadt Innsbruck
Radverkehrsstärke
24 h werktags
2500
5000
10000
26 Kapitel 1 Infrastruktur ausbauenAbbildung 12
Verkehrswirksamkeit der Lückenschlüsse als Differenz vom Prognose- zum Analysemodell Quelle: Stadt Innsbruck
Radverkehrsstärke
24 h werktags
2500
5000
10000
Abnahme 0
27Abbildung 14
Im Rankingmodell bewertete Lückenschlüsse Quelle: Stadt Innsbruck
6 6
6
1
10
1
8 8 5
17
12 11
4b
4a
9
2a 3a 13
3 7
2b
15 16
5
5
Radschnellweg S
Lückenschluss
28 Kapitel 1 Infrastruktur ausbauenTabelle 2
Nutzen-Kosten Ergebnisse für Innsbruck Quelle: Stadt Innsbruck
Nr. Kategorie *) Lückenname Lückenbereich Maßnahme NKV
Kreuzungsumbau,
12 R Geyrstraße Geyrstraße / Dr.-Ferdinand-Kogler-Straße Radwegverbreiterung, >1
Rampenanpassung
Verbreiterung des Gehweges und
2b S Flöckingerpromenade Sieglanglersteg bis Uferstraße >1
Erhöhung des Geländers
3 R südlicher Südring Olympiabrücke bis Karwendelstraße Radwegbau >1
S Begleitweg Barmherzige Schwestern Mühlauer Brücke bis Tiflis Brücke Radwegbau >1
1
S Marktplatz Gastgarten Cammerlander Radweganpassung >1
4a R Hauptbahnhof / Pradl Brücke über den Bahnhof bis Frachtenbahnhof Brückenbau >1
Fischnalerstraße / Franz-Gschnitzer-Promenade / Inn /
4b R Brücke Schöpfstraße Brückenbau >1
Schöpfstraße
14 R Egger-Lienz-Straße Kreuzung Innrain VLSA Anpassung >1
17 L Saurweinweg Karl-Innerebener-Straße bis Speckweg Radwegbau >1
R Brücke Kirschentalgasse Kirschentalgasse / Mariahilfpark / Markthalle Brückenbau
8 >1
R Großer-Gott-Weg Speckweg bis Sternwartestraße Radwegbau
9 R Mitterweg / Karwendelbahn Mitterweg, Würth Unterführung >1
Brücke Haller Straße Inn, Sillzwickel Brückenbau
6 R Schrebergartensiedlung entlang ÖBB Westbahn Radwegbau >1
Fuchsrain entlang ÖBB Westbahn Einbahnaufhebung
Anbindung Rum landwirtschaftliche Wege Radwegbau
Querung über Innrain Umbau Kreuzung Umbau Kreuzung
Beleuchtungsumbau in der
5 R Anpassung der Unterführung der Brennerstraße Beleuchtungsumbau in der Unterführung durch die IKB >1
Unterführung durch die IKB
Verbindung Richtung Natters, Stubaital, Wipptal begleitender Geh- und Radweg begleitender Geh- und Radweg
Radwegbau entlang ÖBB
15 L Mentlberg Völser Straße bis Karwendelstraße >1
Stocksportanlage
11 R Pradl Ost / Baggersee Egerdachstraße bis Baggersee 3 Unterführungen + Radwegbau >1
2a S Brücke Völs Inn, Völs Cyta Brückenbau >1
13 R Winkelfeldsteig Paschbergweg bis Geyrstraße Radwegbau >1
Radwegbau
7 R Aldranser Straße Neubau vom Schloß Ambras bis zur KG Grenze1.1.2 1.1.3 3
BÜRGER*INNEN UND POLITIK ERGEBNIS Umsetzung der Schließung der Lücken im lokalen Netz:
Soweit sich die Wünsche und Vorschläge aus Politik und Bei der Umsetzung des Maßnahmenpakets entlang der
Bürger*innen von Bürger*innen auf die Radrouten S, R1 und R2 be- betrachteten Radrouten werden 37 Einzelmaßnahmen
Anregungen aus der Bevölkerung zu den verschiedensten ziehen, sind sie im Rankingmodell enthalten. Darüber aus dem lokalen Netz mitberücksichtigt, um örtliche Ver-
Themen des Radverkehrs werden laufend zur Verbesse- hinaus bestehen viele Vorschläge, die das lokale Netz be- besserungen zu erreichen. Diese umfassen einen Kosten-
rung der Situation für Radfahrende aufgenommen. Um treffen, individuelle Wünsche darstellen und für welche rahmen von sieben Millionen Euro.
gerade für die Radnetzplanung eine Möglichkeit zu schaf- die Verkehrswirksamkeit im Verkehrsmodell nicht bere-
fen, Anregungen als Bürger*in einzubringen, fand im chenbar ist. Diese Maßnahmen haben jedoch ebenso Be- Die geschätzten Gesamtkosten der baulichen Maßnah-
Februar 2020 der erste Innsbrucker Radworkshop in der deutung für die Akzeptanz des Verkehrsmittels Fahrrad, men umfassen einen Kostenrahmen von 33,2 Millionen
Stadtbibliothek statt. An die 200 Besucher*innen gaben weil letztlich jede Fahrt im kleinräumigen Netz beginnt Euro. Dabei ist zu vermerken, dass eine Vielzahl der Maß-
Wünsche, Ideen und Anregungen zum Innsbrucker Rad- und endet. Sie sind daher nicht zu vernachlässigen und nahmen auch der Förderung des Fußgänger*innen-Ver-
netz ab. Dabei sind 121 Meldungen zum Thema Lücken werden für die Maßnahmenpakete aufgegriffen. kehrs dienen. Insbesondere die Errichtung und Anpas-
und 96 Routenvorschläge gemacht worden, die über das sung von Unterführungen und Brücken führt dazu, dass
gesamte Stadtgebiet verteilt sind. 15 16 Trennwirkungen reduziert werden. Diese sollen als kom-
1.1.4 binierte Geh- und Radweganlagen ausgeführt werden.
Politik MASSNAHMEN Fußgänger*innen profitieren somit von der Förderung
Gesellschaftliche Fragestellungen zur Aufteilung der Flä- des Radverkehrs durch bauliche Maßnahmen mit Hilfe
chen im Straßenraum sowie der Verwendung vorhan- 1 von
dener Geldmittel bleiben letztlich der repräsentativen Prioritäre Schließung der Lücken im hochrangingen Rad- • reduzierter Umgwegigkeit
Demokratie und somit der politischen Entscheidung netz: Alle Lücken im hochrangingen Radnetz, die aus der • erleichterten Querungs-Möglichkeiten
vorbehalten. Die Aspekte der politischen Umsetzbarkeit Bewertung des Rankingmodells ein Nutzen-Kostenver- • erhöhter Barrierefreiheit.
werden daher für einen langfristigen, über Gemeinderats- hältnis größer eins erzielt haben, werden anhand von 22
perioden hinausgehenden, Masterplan berücksichtigt. definierte Maßnahmen umgesetzt. Damit können ent-
Die fachliche Vorgehensweise sowie die Ergebnisse der sprechende Fördermittel lukriert werden. Die Gesamt-
Lückenschlüsse wurden in diversen Mentoring-Sitzungen kosten teilen sich auf die Stadt Innsbruck und potentielle
behandelt und die politischen Klubs zu Stellungnahmen Fördergeber auf. Der Kostenrahmen für dieses Maßnah-
eingeladen. Daneben wurden die Zwischenergebnisse im menpaket liegt bei 24 Millionen Euro. 3
Ausschuss für Umwelt, Energie und Mobilität in fünf Sit-
zungen präsentiert. 2
Die ergänzenden Anregungen aus Politik und Bürger*in- Umsetzung der Anbindung Natters und Vitalregion: Für
nen-Beteiligung wurden auf Plausibilität überprüft und die regionalen Radwege in die Umlandgemeinden (Natters
eingearbeitet. und Vitalregion) bestehen zusätzliche Effekte, die im Ran-
kingmodell des Alltagsverkehrs keine Berücksichtigung
finden konnten. Diese sind die Mitnutzung durch den Tou-
ristik- und Freizeitverkehr, die Nutzung durch E-Bikes in
den topografisch höher gelegenen Lagen, sowie die Erwei-
terung des Fußwegenetzes. In diesem Zusammenhang sind
die Erschließungen Natters und Igls zur Umsetzung emp-
fohlen. Diese umfassen einen Kostenrahmen von zwei Mil-
lionen Euro (Finanzierung durch Stadt und Land). 4
30 Kapitel 1 Infrastruktur ausbauenAbbildung 15
Wünsche zu Lückenschlüssen und örtlichen Verbesserungen aus der Bürger*innen-Beteiligung Quelle: Stadt Innsbruck
Lücken
Lücken
31Abbildung 16
Radroutenvorschläge aus der Bürger*innen-Beteiligung Quelle: Stadt Innsbruck
Routenanregungen
Routenanregungen
32 Kapitel 1 Infrastruktur ausbauenTabelle 3
Prioritäre Schließung aller Lücken im hochrangingen Netz Quelle: Stadt Innsbruck
Nr. Kategorie *) Lückenname Lückenbereich Maßnahme NKV
Kreuzungsumbau,
12 R Geyrstraße Geyrstraße / Dr.-Ferdinand-Kogler-Straße Radwegverbreiterung, >1
Rampenanpassung
Verbreiterung des Gehweges und
2b S Flöckingerpromenade Sieglanglersteg bis Uferstraße >1
Erhöhung des Geländers
3 R südlicher Südring Olympiabrücke bis Karwendelstraße Radwegbau >1
S Begleitweg Barmherzige Schwestern Mühlauer Brücke bis Tiflis Brücke Radwegbau >1
1
S Marktplatz Gastgarten Cammerlander Radweganpassung >1
4a R Hauptbahnhof / Pradl Brücke über den Bahnhof bis Frachtenbahnhof Brückenbau >1
Fischnalerstraße / Franz-Gschnitzer-Promenade / Inn /
4b R Brücke Schöpfstraße Brückenbau >1
Schöpfstraße
14 R Egger-Lienz-Straße Kreuzung Innrain VLSA Anpassung >1
17 L Saurweinweg Karl-Innerebener-Straße bis Speckweg Radwegbau >1
R Brücke Kirschentalgasse Kirschentalgasse / Mariahilfpark / Markthalle Brückenbau
8 >1
R Großer-Gott-Weg Speckweg bis Sternwartestraße Radwegbau
9 R Mitterweg / Karwendelbahn Mitterweg, Würth Unterführung >1
Brücke Haller Straße Inn, Sillzwickel Brückenbau
Schrebergartensiedlung entlang ÖBB Westbahn Radwegbau
6 R >1
Fuchsrain entlang ÖBB Westbahn Einbahnaufhebung
Anbindung Rum landwirtschaftliche Wege Radwegbau
Querung über Innrain Umbau Kreuzung Umbau Kreuzung
Beleuchtungsumbau in der
5 R Anpassung der Unterführung der Brennerstraße Beleuchtungsumbau in der Unterführung durch die IKB >1
Unterführung durch die IKB
Verbindung Richtung Natters, Stubaital, Wipptal begleitender Geh- und Radweg begleitender Geh- und Radweg
Radwegbau entlang ÖBB
15 L Mentlberg Völser Straße bis Karwendelstraße >1
Stocksportanlage
11 R Pradl Ost / Baggersee Egerdachstraße bis Baggersee 3 Unterführungen + Radwegbau >1
2a S Brücke Völs Inn, Völs Cyta Brückenbau >1
Tabelle 4
Umsetzung der Anbindung Natters und Vitalregion
Nr. Kategorie *) Lückenname Lückenbereich Maßnahme NKV
Radwegbau
7 R Aldranser Straße Neubau vom Schloß Ambras bis zur KG Grenze© Johanna Romillo
RADROUTEN SICHTBAR MACHEN
Ziele Maßnahmen
• Radnetz erweitern • Die Radrouten sowie die rad-relevanten Angebote (wie Umsetzung: bis Ende 2022
z.B. Service-Stationen, Stadtrad-Stationen, etc.) sind im • Die einheitliche Beschilderung der Hauptradrouten im
• Sicherheit gewährleisten Innsbrucker Stadtbild sowie auf digitaler Ebene sichtbar. gesamten Innsbrucker Stadtgebiet wird basierend auf
dem Leitsystem des Landes Tirol umgesetzt, dazu wird
• Geschwindigkeit ein städtisches Konzept ausgearbeitet.
beeinflussen
Umsetzung: bis Ende 2021
• Winterradverkehr • Eine Karte mit den Radrouten der Stadt sowie rad-
anheben relevanten Angeboten in Innsbruck wird digital und
analog veröffentlicht.
• Radfahrende
zufriedenstellen Umsetzung: laufend
• Die Innsbrucker Radrouten werden in die Plattform GIP
• Neue Zielgruppen eingespielt und laufend aktualisiert.
erschließen
• Fahrradkultur stärken
ANGESPROCHENE NUTZUNGSGRUPPE
Stark und furchtlos
1.2
Begeistert und überzeugt
Interessiert, aber besorgt
Auf gar keinen Fall
3517 18
19 20
22
Abbildung 17: Naturstandskarte in WebOffice (Quelle: Stadt Innsbruck)
Abbildung 18: Naturstandskarte in WebOffice, Thema Verkehrseinrichtungen (Quelle: Stadt Innsbruck)
Abbildung 19: Dashboard (Quelle: Stadt Innsbruck)
Abbildung 20: Plattform GIP (Quelle: GIP 11)
Abbildung 21: Radrouting Tirol (Quelle: https://radrouting.tirol/ 12)
21
Abbildung 22: Beschilderung Innradweg (Quelle: Stadt Innsbruck)
36 Kapitel 1 Infrastruktur ausbauen1.2.1 Graphenintegrations-Plattform (GIP) 1.2.4
EINLEITUNG Die GIP ist die Basis für die Verkehrsauskunft Österreich MASSNAHMEN
Um die Radrouten im städtischen Straßennetz sichtbar zu (VAO), die alle Verkehrsarten abbildet. Die Informatio-
machen, bedarf es der Wegweisung und der Kenntlich- nen über das Straßennetz werden in die GIP übergeführt. 1
machung in digitaler und analoger Form in Karten, Plä- Über eine Schnittstelle beim Land Tirol werden die städ- Die einheitliche Beschilderung der Hauptradrouten
nen und Routensystemen. Auf den Radrouten bestehen tischen Daten eingepflegt und in weiterer Folge an das im gesamten Innsbrucker Stadtgebiet wird basierend
noch bauliche oder funktionale Lücken. Eine Routenweg- Österreichische Institut für Verkehrsdateninfrastruktur auf dem Leitsystem des Landes Tirol umgesetzt. Dazu
weisung und -darstellung muss jedoch durchgängig sein. übergeben. Die Datenaufbereitung und Darstellung ist wird ein städtisches Konzept ausgearbeitet: Die Über-
Daher sind bei diesen Lücken Ersatzwege, Umleitungen sehr komplex, da alle Geh- und Fahrbeziehungen, die im sichtlichkeit der Wegweisung wird insgesamt gefördert,
etc. zu berücksichtigen. Straßennetz möglich sind, dargestellt werden. Die GIP wenn gleichartige Wegweiser gleichartig angeordnet und
stellt die Grundlage für jede Abfrage aller Verkehrsarten positioniert werden. Damit wird die Fähigkeit des Men-
dar und ist somit die Basis für Auskünfte mit Fahrplänen, schen für selektives Erfassen genutzt. Daher werden die
1.2.2 Auto-, Fuß- und Radrouting. 20 Wegweiser für den Fahrradverkehr möglichst an eigenen
DIGITALE SICHTBARMACHUNG Stehern im Sichtfeld von Radfahrenden auf der rechten
Mit den Softwareprogrammen VMS, WebOffice und Radrouting Tirol Straßenseite angebracht. Im Zuge der Umsetzung werden
der Plattform GIP werden die Routen digital sichtbar ge- Mit der Übertragung der Daten in die GIP wird es mög- auch Themenradwege mitberücksichtigt sowie überflüssi-
macht. lich, über das öffentlich zugängliche Programm Radrou- ge Schilder entlang der Radrouten im Stadtgebiet entfernt.
ting Tirol12 die optimale Radroute zu generieren. Die Aus-
Naturstandskarte kunft für Alltagsradfahrende beinhaltet Zeitdauer, Länge 2
Bauliche Änderungen in der Natur werden nach deren und Höhenunterschied. 21 Eine Karte mit den Radrouten der Stadt sowie rad-rele-
Abschluss vermessen und digitalisiert. 17 vanten Angeboten in Innsbruck wird digital und analog
veröffentlicht: In diese Karte werden die Hauptradrouten
Fachdaten in VMS und WebOffice 1.2.3 eingezeichnet. Zu diesen werden rad-relevante Angebote,
Basierend auf der Naturstandskarte werden in der Spe- ANALOGE SICHTBARMACHUNG wie z.B. die Stadtradstationen, Service-Stationen etc. ein-
zialsoftware VMS (Verkehrsmanagement System) und Die analoge Wegweisung muss mit der digitalen Rou- gezeichnet.
in WebOffice laufend Verkehrsfachdaten zu Verkehrs- tenführung konformgehen und macht die Radrouten im
zeichen (inkl. Verordnungen, Fotos usw.), Bodenmarkie- Innsbrucker Stadtgebiet sichtbar. Eine weitere Unterstüt- 3
rungen und Wegweisung eingepflegt. Die Fachdaten aus zung sind gedruckte Karten, die das gesamte Stadtgebiet Die Innsbrucker Radrouten werden in die Plattform
VMS sind tagesaktuell in WebOffice abgebildet. 18 mit den Routen abbilden. GIP sowie ins Radrouting Tirol eingespielt und laufend
aktualisiert.
Dashboard Für die Radwegbeschilderung in Tirol hat das Land Tirol
Für einen schnellen Überblick in der Stadtverwaltung ein Radwanderwege-Leitsystem entwickelt. Das Leitsys-
über die Themen Radinfrastruktur und Radweganlagen tem wurde bereits für den Innradweg und die Vitalrad-
besteht ein Dashboard, über welches Kennzahlen abge- route Patscherkofel umgesetzt. Diese Angebote bestehen
fragt werden. 19 unabhängig neben den Routenwegweisungen im Stadtge-
biet und haben überregionale Bedeutung. 22
37Sie können auch lesen