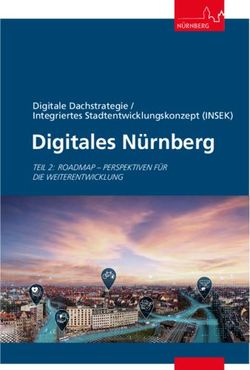NACHHALTIGE ENTWICKLUNG IM KANTON ZÜRICH: AUF KURS? - Zahlen und Fakten 1990 2005 - Nachhaltigkeitsbericht Kanton Zürich
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
IM KANTON ZÜRICH: AUF KURS?
Zahlen und Fakten 1990 – 2005
Nachhaltigkeitsbericht Kanton Zürich
1Nachhaltigkeitsbericht Kanton Zürich
VORWORT
Mit der Verpflichtung der Schweiz zur Agenda 21 an der UNO-Konferenz über
Umwelt und Entwicklung von Rio 1992 sowie mit den Bestimmungen in der Bun-
desverfassung und der Kantonsverfassung wurde die Nachhaltige Entwicklung
für den Bund und die Kantone als verbindliche Aufgabe anerkannt. In den Legis-
laturschwerpunkten 2003 bis 2007 des Regierungsrats wurde festgehalten, dass
die Nachhaltigkeit in allen Politikfeldern immer wichtiger wird, und dass staatliche
Entscheide zur Gestaltung des Wirtschafts- und Lebensraumes Zürich deshalb
vermehrt auf Nachhaltigkeit auszurichten sind.
Ist der Kanton Zürich, was die Nachhaltige Entwicklung angeht, auf Kurs? Mit
dem vorliegenden Bericht verfolgen wir einen ganzheitlichen Ansatz, der mit 33
Themenbereichen einen gemeinsamen Orientierungsrahmen für die Entwicklung
der Nachhaltigkeitsdimensionen Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft bildet. Mit
der Festlegung von Indikatoren und der Definition der angestrebten Entwicklungs-
richtung wird die Nachhaltige Entwicklung «messbar gemacht». Der Nachhaltig-
keitsbericht gibt einen Überblick über die Entwicklungstendenzen innerhalb des
Kantons und ermöglicht so eine Standortbestimmung. Damit schafft der Bericht
Entscheidungsgrundlagen für das staatliche Handeln.
Als aktuelles Beispiel führt uns die Klimaerwärmung die Notwendigkeit nachhaltigen
Handelns drastisch vor Augen. Es muss davon ausgegangen werden, dass die durch
den Menschen verursachten Veränderungen unserer Umwelt zu hohen wirtschaft-
lichen wie auch gesellschaftlichen Kosten führen werden. Die Klimaerwärmung ist
allerdings nur ein Thema, worauf sich eine Nachhaltige Entwicklung bezieht – wenn
zweifellos auch ein akutes. Nachhaltige Entwicklung konzentriert sich aber nicht nur
auf Umweltschutz. Oberstes Ziel ist eine ausgewogene Entwicklung von Wirtschaft,
Umwelt und Gesellschaft mit dem Credo, den Handlungsspielraum nachfolgender
Generationen nicht zu schmälern.
Der vorliegende Bericht gibt zwar Antworten auf zahlreiche Fragen, wirft aber
gleichzeitig auch wieder neue Fragen auf. Klar und deutlich geht aus dem Bericht
hingegen hervor, dass langfristig kein Weg an einer Nachhaltigen Entwicklung vor-
bei führt. Auf Dauer können wir nicht vom Kapital leben, wir müssen es schaffen,
mit den Zinsen auszukommen. Der Kanton Zürich stellt sich dieser Herausforderung
und nimmt die Verantwortung gegenüber künftigen Generationen wahr.
Regierungsrätin Dr. Ursula Gut-Winterberger,
Baudirektorin
2Nachhaltigkeitsbericht Kanton Zürich
INHALT
Nachhaltige Entwicklung im Kanton Zürich 7
Nachhaltigkeitsbericht: Ziele und Vorgehen 8
Wirtschaft
Attraktiver Wirtschaftsraum 11
Einkommen 12
Lebenskosten 14
Arbeitsmarkt 16
Investitionen 18
Ressourceneffizienz 20
Innovationen 22
Wirtschaftsstruktur 24
Know-how 26
Öffentlicher Haushalt 28
Steuern 30
Umwelt
Umwelt unter Druck 33
Biodiversität 34
Natur und Landschaft 36
Energiequalität 38
Energieverbrauch 40
Klima 42
Rohstoffverbrauch 44
Wasserhaushalt 46
Wasserqualität 48
Bodenverbrauch 50
Bodenqualität 52
Luftqualität 54
Gesellschaft
Gesellschaft im Wandel 57
Lärm / Wohnqualität 58
Mobilität 60
Gesundheit 62
Sicherheit 64
Einkommens- / Vermögensverteilung 66
Partizipation 68
Kultur und Freizeit 70
Bildung 72
Soziale Unterstützung 74
Integration 76
Gleichstellung von Frau und Mann 78
Überregionale Solidarität 80
Zusammenfassung / Synthese 82
Ausblick 85
Nachhaltige Entwicklung –
Antwort auf neue Herausforderungen (Gastkommentar) 86
Informationen zur Nachhaltigen Entwicklung 90
Impressum 91
3Abkürzungen
ALN Amt für Landschaft und Natur
AMOSA Arbeitsmarktbeobachtung Ostschweiz
ARA Abwasserreinigungsanlage
ARV Amt für Raumordnung und Vermessung
AWA Amt für Wirtschaft und Arbeit
AWEL Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft
BFS Bundesamt für Statistik
CO2 Kohlendioxid
ETH Eidgenössische Technische Hochschule
FNS Fachstelle Naturschutz
ha Hektare
IPP Integrierte Produktepolitik
KEF Konsolidierter Entwicklungs- und Finanzplan
KOF Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich
KVA Kehrrichtverbrennungsanlage
kWh Kilowattstunde
LBI Langzeit-Belastungs-Index (Luft)
LRV Luftreinhalteverordnung
NFA Neuer Finanzausgleich
NO2 Stickstoffdioxid
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
öV öffentlicher Verkehr
O3 Ozon
PISA Programme for International Student Assessment
PM10 Feinstaub
RAV Regionales Arbeitsvermittlungszentrum
SIA Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein
TBA Tiefbauamt
ZVV Zürcher Verkehrsverbund
4Nachhaltigkeitsbericht Kanton Zürich EINLEITUNG
NACHHALTIGE ENTWICKLUNG IM KANTON ZÜRICH
Die Brundtland-Kommission formulierte 1987 die Bei Entscheiden von grosser Tragweite ist es nahe-
mittlerweile breit akzeptierte Definition der Nach- liegend, dass es zu Interessenkonflikten zwischen
haltigen Entwicklung: den drei Dimensionen kommen kann. Nach dem Ver-
ständnis des Bundesrates und des Regierungsrates
«Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, des Kantons Zürich können Nachteile in einer Dimen-
die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, sion durch klare Vorteile in den anderen zwei Dimen-
ohne zu riskieren, dass künftige Generationen sionen kompensiert werden. Negative Auswirkungen
ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen dürfen dabei aber nicht stetig zu Lasten derselben
können.» Dimension gehen und kritische Grenzen dürfen nicht
unter- bzw. überschritten werden. Solche kritischen
Konkretisiert wurde diese Vision durch die «Erklärung Grenzen sind beispielsweise gesundheitlich relevan-
von Rio zu Umwelt und Entwicklung» der Vereinten te Umweltnormen (Luftqualität), sozial-politische
Nationen von 1992. Dabei bildet die gleichwertige Normen (gleiche Chancen, minimale Einkommen,
Berücksichtigung der drei Dimensionen Wirtschaft, menschenwürdige Lebensbedingungen usw.) oder
Umwelt und Gesellschaft das Kernprinzip einer Nach- die Gewährleistung der Menschenrechte. Diese stel-
haltigen Entwicklung. Dieses Konzept wird meist len nicht verhandelbare Minimalanforderungen und
durch drei Kreise dargestellt, ergänzt durch die Zeit- Schwellenwerte dar. Diese Interpretation wird auch
und die Nord-Süd-Dimension. als «schwache Nachhaltigkeit Plus» bezeichnet.
Der Bund und der Kanton Zürich haben sich in ih-
Nord ren Verfassungen dem Grundsatz der Nachhaltigkeit
verpflichtet. Artikel 6 der Verfassung des Kantons
Zürich hält fest:
UMWELT
«Kanton und Gemeinden sorgen für die Erhal-
tung der Lebensgrundlagen. In Verantwortung
Generation WIRTSCHAFT GESELLSCHAFT Generation für die kommenden Generationen sind sie einer
heute morgen
ökologisch, wirtschaftlich und sozial Nachhalti-
gen Entwicklung verpflichtet.»
Süd
Der Kanton Zürich verfügt für diese junge Verfas-
Damit wird Folgendes zum Ausdruck gebracht: sungsbestimmung (2005) derzeit noch über keine
• Nachhaltige Entwicklung bedeutet, dass wirtschaft- Anschlussgesetzgebung und über keine «Strategie
liche Leistungsfähigkeit und gesellschaftliche Soli- Nachhaltige Entwicklung», welche die Nachhaltig-
darität gestärkt und gleichzeitig der Umwelt- und keitspolitik im Kanton verankert und die Aktivitäten
Ressourcenverbrauch auf ein dauerhaft tragbares in diesem Bereich festlegt. Der Regierungsrat hat
Niveau gesenkt werden (von den Zinsen leben und aber in seinen Legislaturschwerpunkten 2003 – 2007
nicht vom Kapital). festgehalten, dass staatliche Entscheide zur Gestal-
• Wirtschaftliche, gesellschaftliche und ökologische tung des Wirtschafts- und Lebensraumes Zürich
Prozesse sind vernetzt zu betrachten. Das Handeln vermehrt auf Nachhaltigkeit auszurichten sind. Eine
öffentlicher wie auch privater Akteure darf nicht strategische Planung in Richtung Nachhaltigkeit
isoliert und eindimensional erfolgen, sondern muss braucht eine periodische Standortbestimmung. Der
die Auswirkungen auf alle Dimensionen berücksich- vorliegende Nachhaltigkeitsbericht kommt dieser
tigen (ganzheitliches Denken und Handeln). Forderung nach.
• Die Auswirkungen des heutigen Handelns auf die Die Nachhaltige Entwicklung ist ein fortwährender ge-
Zukunft sind einzuberechnen, damit die kommen- sellschaftlicher Such-, Lern- und Gestaltungsprozess,
den Generationen ihre Bedürfnisse auch decken bei dem es um die Gestaltung unserer Zukunft
können (Handlungsspielraum für zukünftige Ge- geht.
nerationen bewahren).
• Globale Abhängigkeiten und Bedürfnisse sind zu
berücksichtigen. Die Interessen aller Erdbewohner/
innen sind einzubeziehen (Solidarität innerhalb
einer Generation).
7EINLEITUNG
NACHHALTIGKEITSBERICHT: ZIELE UND VORGEHEN
Ziele Vom Abstrakten zum Greifbaren
Die Nachhaltige Entwicklung betrifft alle Bereiche Der Kanton Zürich beteiligte sich in den Jahren 2001
staatlichen Handelns. Bisher fehlte dazu ein perio- bis 2005 an einem Projekt mehrerer Bundesämter,
disch erstellter Gesamtüberblick über die Entwick- Kantone und Städte, bei dem ein gemeinsamer Ori-
lung im Kanton Zürich. Es stellt sich die Frage «Wohin entierungsrahmen für eine Nachhaltige Entwicklung
geht die Reise des Kantons?» Geht sie in Richtung durch festgelegte Zielbereiche geschaffen wurde.
einer Nachhaltigen Entwicklung oder sind entgegen- Die Nachhaltige Entwicklung wurde «messbar» ge-
gesetzte Tendenzen festzustellen? Im vorliegenden macht, indem für jeden Zielbereich ein so genannter
Nachhaltigkeitsbericht wurden die Nachhaltigkeits- Kernindikator festgelegt und die angestrebte Ent-
dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft wicklungsrichtung definiert wurde (vgl. Bericht des
durch Zielbereiche konkretisiert und durch Indikato- Cercle Indicateurs «Kernindikatoren für die Nach-
ren «messbar» gemacht. Damit wird eine periodische haltige Entwicklung in Städten und Kantonen»). Ein
Standortbestimmung möglich. Nicht nachhaltige Ent- idealer Kernindikator zeichnet sich dadurch aus, dass
wicklungen in wichtigen Politikbereichen können so er einfach erhebbar, für die Gesamtentwicklung aus-
erkannt (Frühwarninstrument) und ein Handlungsbe- sagekräftig, verständlich, gut kommunizierbar und
darf kann sichtbar gemacht werden. mit anderen Kantonen vergleichbar ist. Zudem soll
Der Nachhaltigkeitsbericht des Kantons Zürich hat er den Zielbereich möglichst umfassend repräsentie-
zum Ziel, im Sinne einer Bestandesaufnahme, eine ren. Aufgrund dieser hohen Anforderungen konnte
Gesamtübersicht für die Entscheidungsträger/innen nicht für alle Zielbereiche ein idealer Kernindikator
und die interessierte Öffentlichkeit zu ermöglichen. gefunden werden.
Mittel- bis langfristig ist er somit eine Art Gradmesser
bzw. Erfolgskontrolle des staatlichen Handelns auf Definition Nachhaltige Entwicklung
Brundtland-Definition, Bundesverfassung,
Ebene Kanton. Im Sinne eines Monitorings werden Kantonsverfassung
die Entwicklungen in 33 verschiedenen und für eine
Nachhaltigkeitsdimensionen
Nachhaltige Entwicklung wichtigen Zielbereichen be- Wirtschaft, Umwelt, Gesellschaft
schrieben und durch «Fachverantwortliche» aus den
Zielbereiche
einzelnen Direktionen entsprechend gewürdigt. Der
in den Nachhaltigkeitsdimensionen
vorliegende Bericht nimmt aber weder eine Schwer- (z.B. Arbeitsmarkt)
punktbildung, noch ein Ausräumen von Zielkonflik-
Kernindikatoren
ten vor. Dies kann er aufgrund seines Auftrags als zu den Zielbereichen
Monitoring-Instrument nicht leisten. Der vorliegende (z.B. Arbeitslosenquote)
Bericht fliesst in die von der Staatskanzlei zuhanden
des Regierungsrates vorzunehmende Umfeldanalyse Um einen Gesamtüberblick zu ermöglichen ist es er-
ein und leistet dadurch auch einen Beitrag zur Festle- forderlich, ein überschaubares, das heisst kleines Set
gung der Legislaturziele 2007 – 2011. Ziel ist es, die von Zielbereichen und Kernindikatoren zu verwen-
Berichterstattung alle vier Jahre fortzuführen. den. Deshalb galt die Devise «so wenige wie möglich,
so viele wie nötig».
Bezug zu anderen Berichterstattungen
Um die komplexe Leitidee der Nachhaltigen Ent- Kernindikatoren für den Kanton Zürich
wicklung überschaubar darzustellen, wurde bewusst Für den vorliegenden Nachhaltigkeitsbericht wurde
eine hohe «Flughöhe» gewählt. Der Bericht hat den grösstenteils das gemeinsam mit dem Bund und
Anspruch, einen Gesamtüberblick zu geben, wohin- anderen Kantonen entwickelte Kernindikatoren-
gegen andere fachspezifische Berichterstattungen set verwendet. Damit ist die Möglichkeit für einen
einen Bereich vertieft betrachten. Der Nachhaltig- Quervergleich zwischen den Kantonen gegeben.
keitsbericht will und kann nicht andere fachspezi- In einigen Fällen hatte der Kanton Zürich jedoch
fische Berichterstattungen wie beispielsweise den bessere statistische Daten zur Verfügung, oder der
Raumplanungsbericht, den Sozialbericht, den Stand- Zielbereich wurde durch einen weiteren Kernindika-
ortförderungsbericht, den Umweltbericht oder den tor umfassender abgebildet. Entsprechend wurden
Gesundheitsbericht ersetzen. weitere Kernindikatoren integriert. Gesamtschwei-
zerische Durchschnittswerte wurden – falls sinnvoll
und verfügbar – in die Betrachtung mit einbezogen.
Die Kernindikatoren zu den 33 Zielbereichen einer
Nachhaltigen Entwicklung können der nachstehen-
den Auflistung entnommen werden.
8Nachhaltigkeitsbericht Kanton Zürich EINLEITUNG
Gesellschaft Kernindikatoren
Wirtschaft Kernindikatoren
Lärm / Wohnqualität • Durch Industrie- und Verkehrs-
Einkommen • Volkseinkommen
lärm belastete Bevölkerung
Lebenskosten • Durchschnittliche Mietpreise
Mobilität • Durchschnittliche Luftdistanz
• Zürcher Städteindex der
vom Wohnort zur nächsten
Konsumentenpreise
Haltestelle des öffentlichen
Arbeitsmarkt • Arbeitslosenquote Verkehrs
• Arbeitsplätze
Gesundheit • Verlorene potenzielle Lebens-
Investitionen • Öffentliche und private jahre
Bauinvestitionen
Sicherheit • Unfälle mit Personenschäden
Ressourceneffizienz • Gesamtenergieverbrauch pro und Getötete im Strassenverkehr
Volkseinkommen • Verurteilungen für Gewaltdelikte
Innovationen • Beschäftigte in innovativen Einkommens- / • Steuerpflichtige mit niedrigem
Branchen Vermögensverteilung Einkommen
• Ungleichverteilung der
Wirtschaftsstruktur • Beschäftigte in wertschöpfungs- Einkommen (Gini-Index)
starken Branchen
Partizipation • Stimm- und Wahlbeteiligung
Know-how • Abgeschlossene Ausbildung
auf tertiärer Stufe Kultur und Freizeit • Staatsausgaben für Kultur und
• Weiterbildungskurse der Freizeit
erwerbstätigen Bevölkerung
Bildung • Fachkompetenzen am Ende der
Öffentlicher Haushalt • Mittelfristiger Ausgleich der obligatorischen Schulzeit
Laufenden Rechnung • Abgeschlossene Ausbildungen
auf der Sekundarstufe II
Steuern • Gesamtindex der Steuer-
belastung Soziale Unterstützung • Sozialhilfequote
• Sozialhilfefälle
Integration • Einbürgerungen von
Umwelt Kernindikatoren Ausländer/innen
Biodiversität • Brutvogel-Index Gleichstellung von • Frauen in Unternehmens-
• Bestandessicherung bedrohter Frau und Mann leitungen
Arten • Lohngleichstellung
Natur und Landschaft • Fläche wertvoller Naturräume Überregionale • Ausgaben für den Finanz-
• Durch Schutzmassnahmen Solidarität ausgleich
gesicherte Lebensräume • Hilfsaktionen am Total der
laufenden Ausgaben
Energiequalität • Erneuerbare Energien
und Abwärme
Energieverbrauch • Gesamtenergieverbrauch
Falls möglich wurden für den vorliegenden ersten
Klima • CO2-Emissionen Nachhaltigkeitsbericht die Indikatorenwerte für die
Rohstoffverbrauch • Siedlungsabfallmenge Zeitreihe von 1990 bis 2005 erhoben. Vereinzelte
• Separatsammelquote Indikatoren müssen in Zukunft verbessert bzw. er-
Wasserhaushalt • Wasserabflussmenge aus setzt werden, um den Zielbereich besser abbilden zu
Abwasserreinigungsanlagen können. Insbesondere bei den Indikatoren der gesell-
• Mittlerer Tagesverbrauch
schaftlichen Dimension ist es zum Teil schwierig, den
an Trinkwasser
Zielbereich zufrieden stellend durch einen oder zwei
Wasserqualität • Nitratbelastung des Grundwassers
Indikatoren abzudecken. Gesellschaftliche Realitäten
Bodenverbrauch • Bauzonenentwicklung und sind grundsätzlich vielseitig und schwer durch quan-
-verbrauch
titative Grössen zu erfassen. Für die Beurteilung eines
Bodenqualität • Versauerte Waldstandorte Zielbereichs ist neben der graphischen Darstellung
(Bodensäuregrad)
der Kernindikatoren auch die textlich vorgenom-
Luftqualität • Langzeit-Belastungs-Index mene Bewertung/Würdigung des Zielbereiches zu
• Stickstoffdioxid
beachten. Dabei sind auch Hinweise zu weiterfüh-
renden Informationen aufgeführt.
Zusammenarbeit aller Direktionen
Der erste Nachhaltigkeitsbericht des Kantons ist ein
Kursiv gedruckte Indikatoren wurden zusätzlich in das Bericht aller Direktionen. Er wurde nur durch die
bestehende Kernindikatorenset aufgenommen bzw. Zusammenarbeit über alle Politikbereiche hinweg
wurden neu definiert. möglich.
9WIRTSCHAFT 10
ATTRAKTIVER WIRTSCHAFTSRAUM Nachhaltigkeitsbericht Kanton Zürich
Struktur und Entwicklung
Aufgrund seiner Bedeutung als Finanzplatz, Bildungs- der Kanton Zürich auf eine sehr gute Infrastruktur be-
und Forschungsstandort sowie als Verkehrsknoten ist rufen. Gerade im Bereich Verkehr gewährleistet der
der Kanton Zürich ein wichtiger Motor der schweize- Flughafen die Anbindung an andere Wirtschaftsräu-
rischen Volkswirtschaft. Ein Sechstel der Bevölkerung me und die öffentlichen Verkehrssysteme weisen eine
der Schweiz lebt im Kanton Zürich und erwirtschaftet hohe Zuverlässigkeit und Effizienz auf. Der Anschluss
dabei fast einen Viertel des nationalen Volkseinkom- an das europäische Hochgeschwindigkeitsnetz der
mens. Gut drei Viertel der Beschäftigten im Kanton Bahnen ist jedoch bisher nur mangelhaft erfolgt und
Zürich arbeiten in Unternehmen des Dienstleistungs- die Entwicklung des Flughafens ist zumindest gefähr-
sektors. Im Zeitraum von 1985 bis 2000 – bis zur det. Als absolut zentraler Standortfaktor gelten auch
Börsenkrise – wuchs insbesondere das Kredit- und das Vorhandensein und die Verfügbarkeit von hoch
Versicherungsgewerbe. Im gleichen Zeitraum fand qualifizierten Arbeitskräften.
im Kanton Zürich ein starker Rückgang der Beschäf-
tigten im industriellen Sektor statt. Lebensqualität zieht hoch Qualifizierte an
Die «alte» Industrie wurde teilweise durch Branchen Die Zürcher Volkswirtschaft wird immer stärker durch
der neuen Technologien in den Bereichen Informati- die wissensbasierten und wertschöpfungsstarken
ons- und Kommunikationstechnologie, Life Science Industrie- und Dienstleistungsbranchen geprägt, wo-
und Hightech ersetzt. Dabei kommt diesen Unter- rin auch ihr Potential zu sehen ist. Dabei kommt dem
nehmen die Kleinräumigkeit des Wirtschaftsraumes Humankapital eine Schlüsselrolle zu, und die Ver-
Zürich entgegen, welche die Netzwerkbildung för- fügbarkeit von hoch qualifizierten Arbeitskräften ist
dert. Netzwerke sind wiederum wichtig, um so ge- zu einem entscheidenden Standortfaktor geworden.
nannte kreative Milieus zu schaffen. Auch die Nähe Dem Standort Zürich wird in verschiedenen Studien
zu den Hochschulen und die enge Zusammenarbeit regelmässig eine sehr hohe, in der jährlich erschei-
von Forschung und Wirtschaft sind zu erwähnen. All nenden Mercer-Studie sogar weltweit die höchste
dies fördert die Innovationskraft dieser Unterneh- Lebensqualität attestiert. Eine hohe Lebensqualität
men. zieht hoch qualifizierte Arbeitskräfte an. Über die
Nach einer konjunkturellen Flaute Ende der 90er Jah- Hälfte der zwischen 2003 und 2005 in die Schweiz
re hat sich wiederum ein solides Wirtschaftswachs- eingewanderten Personen verfügen über eine univer-
tum eingestellt – weltweit und in der Schweiz. Die sitäre oder gleichwertige Ausbildung. Dies sind meist
Abkühlungstendenzen Ende 2004 wurden rascher jüngere, in wertschöpfungsintensiven Branchen tä-
als erwartet überwunden. Die konjunkturelle Ver- tige Personen aus Nord- und Westeuropa sowie aus
besserung ist auch auf dem Arbeitsmarkt langsam Nordamerika.
spürbar.
Standortattraktivität stetig verbessern
Zürich im Wettbewerb mit der Welt Die vielen Vorteile des Wirtschaftsstandorts Zürich
Im Zuge der Globalisierung hat sich die Standort- und das regelmässige Belegen von Spitzenplätzen
wahl der Unternehmen zunehmend auf die inter- in internationalen Rankings dürfen jedoch keine
nationale Ebene ausgeweitet. Internationale Unter- falsche Sicherheit aufkommen lassen. Weltweit
nehmen werden immer mobiler und überprüfen ihre werden grosse Anstrengungen unternommen, die
Standorte regelmässig auf Stärken und Schwächen. Standortvorteile zu verbessern, was zu einem immer
Der Kanton Zürich steht deshalb in erster Linie als härter werdenden Wettbewerb auf internationaler
Metropolregion der Schweiz mit den ausländischen Ebene führt. Beispielsweise werden zur Stärkung des
Standorten im Wettbewerb und erst in zweiter Linie Humankapitals in zahlreichen Ländern grosse Inves-
mit den umliegenden Kantonen. titionen getätigt, um über gut qualifizierte Arbeits-
Das Bestehen im globalen Standortwettbewerb erfor- kräfte – als Voraussetzung für wertschöpfungsstarke
dert eine Vernetzung weit über die Kantonsgrenzen Branchen – zu verfügen. Für den Kanton Zürich ist es
hinaus. Der Wirtschaftsstandort Zürich wird auf inter- daher unerlässlich, seine Standortattraktivität ständig
nationaler Ebene als äusserst attraktiv wahrgenom- zu verbessern.
men. Die Vorteile des Wirtschaftsraumes sind vielfäl-
tig. Die zentrale Lage in Europa, die hohe Sicherheit
und die grosse politische Stabilität in der Schweiz
spielen eine Rolle. Zudem sind die relativ niedrigen
Steuersätze ein wichtiges Kriterium für die Standort-
wahl von globalen Unternehmen. Weiter kann sich
11
11WIRTSCHAFT
EINKOMMEN
Das Volkseinkommen pro Kopf und Jahr beträgt knapp 70 000 Franken.
Attraktive wirtschaftliche Rahmenbedingungen, ein gut funktionierender
Arbeitsmarkt und eine Spitzenstellung punkto Lebens- und Umwelt-
qualität sind unverzichtbar, damit das Volkseinkommen auch in Zukunft
weiter steigen kann.
Volkseinkommen Zielrichtung
80 000
70 000
60 000
in Franken pro Kopf und Jahr
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Schweiz Kanton Zürich
Definition des Indikators
Das Volkseinkommen setzt sich aus den Primäreinkommen der privaten Haushalte, des Staates
und der Kapitalgesellschaften zusammen. Ein Primäreinkommen wird durch Erwerbs- und
Besitzeinkommen (ohne Renten, Arbeitslosengeld usw.) erzielt. Die Einkommen werden dem
Wohnsitzkanton ihres Eigentümers oder demjenigen Kanton zugeteilt, in welchem sich der
Hauptsitz des betreffenden Unternehmens befindet. Dabei werden die Einkommenskompo-
nenten hauptsächlich indirekt (top-down) ermittelt, d.h. durch Aufteilung der gesamtschwei-
zerischen Aggregate auf die Kantone mittels verschiedener Verteilschlüssel. Aufgrund einer
Anpassung an das Europäische System der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (2003)
wurden die Daten ab 1998 überarbeitet. Der Vergleich mit früheren Jahren ist damit nur
beschränkt möglich.
Datenquelle
Bundesamt für Statistik (BFS), Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung
12Nachhaltigkeitsbericht Kanton Zürich WIRTSCHAFT
Nachhaltige Entwicklung und Einkommen
Das Einkommen ist ein primäres Merkmal des Wohl- stammt nur knapp die Hälfte des Volkseinkommens
stands. Ein Einkommen zu erzielen ist in modernen aus den privaten Haushalten. Im Kanton Zürich sind
Gesellschaften eine notwendige Voraussetzung, es 79%. Damit hängt die Entwicklung des Volks-
Grundbedürfnisse wie Nahrung, Wohnraum, Beklei- einkommens im Kanton Zürich in erster Linie von
dung, usw. zu decken. Die Nachhaltige Entwicklung der Entwicklung der Primäreinkommen der privaten
strebt an, dass alle Menschen ihre Grundbedürfnisse Haushalte ab. Massnahmen zur Erhöhung des Pri-
befriedigen können. Darüber hinaus soll auch weite- märeinkommens von Kapitalgesellschaften wie die
ren Bedürfnissen wie Erholung, Kultur oder Weiterbil- Ansiedlung neuer Firmen oder Steuererleichterungen
dung nachgegangen werden können. Ein steigendes wirken sich deshalb weniger stark auf das kantonale
Volkseinkommen widerspiegelt zu einem grossen Teil Volkseinkommen aus als in anderen Kantonen.
auch Produktivitätsgewinne. Somit ist ein möglichst Was die Beeinflussung der Einkommenshöhe be-
hohes Volkseinkommen pro Kopf der Bevölkerung trifft, verfügt der Kanton grundsätzlich über geringe
anzustreben. Handlungsmöglichkeiten. Vielmehr bestimmen die
wirtschaftliche Entwicklung und die entsprechende
Ausgangslage und Interpretation der Entwicklung Situation auf dem Arbeitsmarkt die Höhe des Volks-
Mehr als ein Fünftel des schweizerischen Volksein- einkommens.
kommens wird im Kanton Zürich generiert. Der Anteil Indirekt ergeben sich trotzdem diverse Handlungs-
des Kantons Zürich am schweizerischen Volkseinkom- felder, welche das Einkommen der privaten und der
men (22%) liegt über dem Bevölkerungsanteil (17%). juristischen Personen beeinflussen. Zürich erhält in
Die nächstgrösseren Kantone, Bern und Waadt, errei- internationalen Vergleichen hinsichtlich Lebensqua-
chen mit 11% bzw. 9% jeweils weniger als die Hälfte lität regelmässig Höchstnoten. Eine weitsichtige
des Anteils des Kantons Zürich. Standortpolitik und die Erhaltung und Förderung
Beim Volkseinkommen pro Kopf der Bevölkerung der hohen Lebens- und Umweltqualität beeinflus-
belegt der Kanton Zürich hinter Basel-Stadt und Zug sen sowohl Firmen als auch Privatpersonen, sich im
den dritten Platz. Im Jahr 2004 lag der Wert für den Kanton Zürich niederzulassen bzw. hier zu bleiben.
Kanton Zürich um 28% über dem schweizerischen Ein Standort mit hoher Lebensqualität und attrak-
Mittel. Über dem schweizerischen Mittel liegen ins- tiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zieht
gesamt nur neun Kantone, 17 Kantone weisen ein wertschöpfungsstarke Unternehmen und in der
unter dem Mittel liegendes Volkseinkommen pro Folge auch gut qualifizierte Arbeitnehmer/innen an.
Kopf der Bevölkerung aus. Eine hervorragende Lebensqualität für Arbeitnehmer/
Im Zeitraum mit vergleichbaren Daten zwischen 1998 innen und die im Kanton Zürich wohnende Bevölke-
und 2004 stieg das Volkseinkommen pro Kopf der rung kann somit einen entscheidenden Beitrag zu
Bevölkerung im Kanton Zürich um knapp 10%. Die- einem langfristig hohen Volkseinkommen leisten.
ser Anstieg entspricht dem schweizerischen Mittel. Das Volkseinkommen könnte auch durch eine Erhö-
Damit konnte der Kanton Zürich seinen Anteil am hung der Erwerbsquote und des Beschäftigungsum-
schweizerischen Volkseinkommen wahren, aber im fanges von Frauen gesteigert werden. Dafür wäre
Gegensatz zum Kanton Basel-Stadt nicht ausbau- unter anderem eine bessere Vereinbarkeit von Familie
en. Aufgrund seiner Wirtschaftsstruktur wurde der und Beruf wichtig.
Kanton Zürich durch den Einbruch des Finanzsektors
im Jahr 2001 besonders hart getroffen. Erst 2003 Weiterführende Informationen
erreichte der Pro-Kopf-Wert wieder den Stand von • Statistisches Amt des Kantons Zürich, www.statistik.zh.ch
2000. Für die Zukunft kann beim Volkseinkommen • Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung: Eine Einführung
ein weiteres Wachstum erwartet werden. in Theorie und Praxis, Bundesamt für Statistik (2003)
• Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, Resultate 1999 –
2004, Bundesamt für Statistik (2006)
Handlungsfelder
Das Volkseinkommen pro Kopf soll mittel- bis lang-
fristig weiter steigen. Das Ziel des Kantons Zürich
kann sich nicht auf das Halten der heutigen Positi-
on beschränken. Im Gegensatz zum Kanton Zürich
konnte der Kanton Basel-Stadt seine Position markant
verbessern. Diese beiden Kantone unterscheiden sich
bei der Bedeutung der einzelnen Komponenten des
Volkseinkommens deutlich. Im Kanton Basel-Stadt
13WIRTSCHAFT
LEBENSKOSTEN
Die Zürcher Haushalte geben rund einen Viertel für das Wohnen aus.
Zürich ist weltweit die viertteuerste Stadt. Dank dem hohen Lohn-
niveau verfügen die Zürcherinnen und Zürcher global betrachtet über
die höchste Kaufkraft.
Durchschnittliche Mietpreise Zielrichtung
110%
105%
100%
indexiert, 2000 = 100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Schweiz Kanton Zürich
Definition des Indikators
Der Indikator erfasst den Durchschnitt der Mietpreise (Mittelwert der Quartalsmediane), wobei
die Entwicklung indexiert dargestellt ist. Als 100% gilt der Durchschnitt der Mietpreise im
Mai 2000.
Datenquelle
Statistisches Amt des Kantons Zürich, Mietpreiserhebung; Bundesamt für Statistik (BFS)
Zürcher Städteindex der Konsumentenpreise Zielrichtung
110%
105%
100%
indexiert, 2000 = 100%
95%
90%
85%
80%
75%
70%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Kanton Zürich
Definition des Indikators
Der Zürcher Städteindex der Konsumentenpreise misst die Entwicklung des Preises eines
durchschnittlichen Waren- und Dienstleistungskorbes der privaten Haushalte der Städte im
Kanton Zürich. Die Entwicklung ist indexiert dargestellt (Dezember 2000 entspricht 100%).
Datenquelle
Statistisches Amt des Kantons Zürich
14Nachhaltigkeitsbericht Kanton Zürich WIRTSCHAFT
Nachhaltige Entwicklung und Lebenskosten
Die Nachhaltige Entwicklung hat zum Ziel, dass die rem Lohn am meisten leisten. Werden für die Stadt
Menschen ihre Bedürfnisse decken können. Die Be- Zürich Preis- und Lohnniveau miteinander verglichen,
völkerung soll über einen möglichst hohen Wohlstand so zeigt sich, dass die Zürcher/innen weltweit über
verfügen, welcher neben dem erzielten Einkommen die höchste Kaufkraft verfügen. Die Zeit, die jemand
massgeblich durch die Höhe der Lebenshaltungskos- durchschnittlich arbeiten muss, um sich ein Kilo Brot
ten bestimmt wird. Für die privaten Haushalte fallen kaufen zu können, verdeutlicht die globalen Unter-
dabei vor allem die Kosten für den Wohnraum ins schiede. In Zürich sind es 10 Minuten, in Mexiko 53
Gewicht. Insbesondere Personen mit tiefem Einkom- Minuten. Auch im Vergleich mit der übrigen Schweiz
men sollen nicht durch die anfallenden Fixkosten von ist das Leben in Zürich teuer. Den Zürcherinnen und
Armut betroffen werden. Aus wirtschaftlicher und Zürchern stehen jedoch auch schweizweit die höchs-
gesellschaftlicher Sicht sind die Lebenshaltungskos- ten Lohnsummen zur Finanzierung des Lebensunter-
ten möglichst tief zu halten. halts zur Verfügung.
Ausgangslage und Interpretation der Entwicklung Handlungsfelder
Die wichtigste Grundlage für die Messung der Le- Stabile Lebenshaltungskosten und tiefe Kosten für
benskosten ist für die Schweiz der Landesindex der das Wohnen sind wichtige Standortfaktoren für
Konsumentenpreise und für den Kanton Zürich der einen attraktiven Lebens- und Wirtschaftsstandort.
Zürcher Städteindex der Konsumentenpreise. Die Der Kanton Zürich als Teil der schweizerischen Volks-
Veränderungen dieser Preisindizes zeigen die Verän- wirtschaft kann auf die Lebenshaltungskosten nur
derungen der Lebenskosten auf. Betrachtet man die in geringem Masse Einfluss nehmen. Die Rahmen-
Preise für Güter aus dem so genannten «Warenkorb» bedingungen werden vor allem durch den Markt
(repräsentative Menge von Gütern zur Erfassung der bestimmt. Einen gewissen Entscheidungsspielraum
Preisentwicklung), so gibt es zwischen Zürich und haben die Nationalbank, das eidgenössische Parla-
der Schweiz insgesamt nur geringe Unterschiede. Die ment und der Bundesrat. Diese sind aber durch die
wesentliche Differenz liegt bei der Gewichtung des internationalen Rahmenbedingungen eingeschränkt.
Wohnens und der Entwicklung der Mietpreise. Eingriffe des Staates in die wirtschaftlichen Abläufe
Die Haushalte in den Städten im Kanton Zürich ge- sind umstritten und oft unerwünscht. Dem Kanton
ben für das Wohnen durchschnittlich knapp 24% bleiben höchstens punktuelle Massnahmen wie bei-
aus. Im schweizerischen Mittel liegt der entspre- spielsweise solche, die Einfluss auf die Wohnkosten
chende Anteil bei gut 22%. Die Gegenüberstellung haben können. Dazu zählt das Schaffen günstiger
der Mietpreisindexreihen für die Städte im Kanton Bedingungen für die Wohnbautätigkeit, die Förde-
Zürich und die Schweiz zeigt, dass die Zürcher Reihe rung des gemeinnützigen Wohnungsbaus und die
markantere Ausschläge aufweist als die schweize- Subventionierung von Wohnungen.
rische. Die Mietpreise der Zürcher Städte reagieren
auf Veränderungen der Hypothekarzinsen rascher Weiterführende Informationen
und stärker. Dies gilt sowohl bei Anstiegen als auch • Statistisches Amt des Kantons Zürich, www.statistik.zh.ch
bei Rückgängen und ist auf den überdurchschnittlich • Preisstatistik 2005, Inventar der preisrelevanten
hohen Anteil von Wohnungen der öffentlichen Hand politischen Massnahmen, Bundesamt für Statistik (2005)
und von gemeinnützigen Bauträgern in den Zürcher • Entwicklung des Mietpreisindexes seit 1993, Pelli C.,
Statistische Berichte des Kantons Zürich, Heft 1 (2000)
Städten zurückzuführen.
• Zürcher Städteindex der Konsumentenpreise im Jahr 2005,
Die Hypothekarzinsentwicklung ist nicht der einzige,
Annaheim M., Statistik Stadt Zürich (2006)
aber ein wichtiger Faktor für die Entwicklung der
• Preise und Löhne, Ein Kaufkraftvergleich rund um die Welt,
Mietzinse. Weiter zu beachten ist, dass der Bedarf an UBS (2006), www.ubs.com/research
Wohnfläche pro Person in den letzten Jahren stetig
zugenommen hat. Dies hat einerseits mit demogra-
fischen Veränderungen zu tun (Überalterung) sowie
mit veränderten Lebensformen (mehr Singles und
kinderlose Paare). Andererseits sind die Ansprüche
an das Wohnen gestiegen und damit auch die Bereit-
schaft, höhere Wohnkosten in Kauf zu nehmen.
Gemäss einer Studie der UBS ist Zürich weltweit
die viertteuerste Stadt, nach Kopenhagen, London
und Oslo. Trotzdem können sich die Stadtzürcher/
innen – aufgrund des hohen Lohnniveaus – von ih-
15WIRTSCHAFT
ARBEITSMARKT
Der Zürcher Arbeitsmarkt bietet nicht nur viele, sondern auch vielfältige
Arbeitsplätze. Er reagiert aber sensibler auf konjunkturelle Veränderun-
gen als der schweizerische Durchschnitt. Von den Erwerbspersonen wird
berufliche Flexibilität erwartet.
Arbeitslosenquote Zielrichtung
6%
5%
Anteil in % aller Erwerbspersonen
4%
3% Arbeitslosenquote Zielrichtung
6%
2%
5%
Anteil in % aller Erwerbspersonen
1%
4%
0%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
3%
Schweiz Kanton Zürich
2%
Definition des Indikators
Die Arbeitslosenquote zeigt das Verhältnis der Arbeitslosen zu den Erwerbspersonen
1%
(Erwerbstätige plus Stellensuchende) auf. Als arbeitslos gelten Personen, die beim Arbeitsamt
0% (RAV) gemeldet und sofort vermittlungsfähig sind. Nicht registrierte Personen und Personen
Arbeitsplätze
in Kursen
1990 1991 oder
1992Beschäftigungsprogrammen
1993 1994 1995 1996 1997werden1998 nicht
1999 oder
2000 nur
2001teilweise Zielrichtung
erfasst.
2002 2003 2004 2005
104% Datenquelle Schweiz Kanton Zürich
102% Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA), Kanton Zürich
100%
indexiert, 1990 = 100%
98%
96% Arbeitsplätze Zielrichtung
104%
94%
102%
92%
100%
90%
indexiert, 1990 = 100%
98%
88%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
96%
Schweiz Kanton Zürich
94%
92%
90%
88%
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Schweiz Kanton Zürich
Definition des Indikators
Die Anzahl Arbeitsplätze zeigt auf, wie viele Beschäftigte im Arbeitsmarkt integriert sind.
Als Beschäftigte werden diejenigen Personen erfasst, die pro Woche mehr als sechs Stunden
einer vertraglich vereinbarten Arbeit nachgehen.
Datenquelle
Bundesamt für Statistik (BFS), Beschäftigungsstatistik und Betriebszählung
16Nachhaltigkeitsbericht Kanton Zürich WIRTSCHAFT
Nachhaltige Entwicklung und Arbeitsmarkt
Aus Sicht der Wirtschaft und der Gesellschaft ist gezeigt, dass der Zürcher Arbeitsmarkt stärker als
ein gut funktionierender Arbeitsmarkt ein zentra- andere Regionen auf konjunkturelle Bewegungen
ler Zielbereich der Nachhaltigen Entwicklung. Arbeit reagiert. Dies kann durch die überproportionale Ver-
ist ein wichtiges menschliches Bedürfnis. Neben der tretung des Dienstleistungssektors im Kanton Zürich
Einkommenssicherung sind auch soziales Ansehen erklärt werden. Vier von fünf Arbeitsplätzen sind im
und das Ausüben einer sinnstiftenden Beschäftigung «Dritten Sektor» angesiedelt. Dieser Sektor reagiert
wichtig. Die Nachhaltige Entwicklung strebt Arbeits- schneller auf einen Wandel der Nachfrage und passt
stellen in genügender Zahl und Vielfalt an. Dies, um seinen Personalbestand entsprechend an.
als Arbeits- und Wirtschaftsstandort attraktiv zu sein. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist ein wichtiger
Gleichzeitig soll die Anzahl Personen, die von Arbeits- Indikator für die Kapazität des Arbeitsmarktes, Stel-
losigkeit betroffen sind, möglichst gering gehalten lensuchende in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Als
werden. Langzeitarbeitslose werden diejenigen Arbeitslosen
bezeichnet, die länger als ein Jahr bei einem Regi-
Ausgangslage und Interpretation der Entwicklung onalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) gemeldet
Jeder fünfte Arbeitsplatz der Schweiz befindet sich sind. 2005 waren dies im Jahresdurchschnitt 18%
im Kanton Zürich. 720 000 Arbeitnehmende sind hier aller Arbeitslosen. Diese Quote ist seit 2004 im Sin-
tätig. 81,8% der Bevölkerung zwischen 15 und 64 ken begriffen und liegt inzwischen unterhalb des
Jahren gehen einem Erwerb nach. Damit schöpft der Schweizer Durchschnitts.
Kanton Zürich sein Arbeitskräftepotential von allen
Kantonen der Schweiz am stärksten aus. Handlungsfelder
In den 80er Jahren ist die Erwerbsquote und das Der Kanton will seine für die gesamte Schweiz wich-
Angebot an Stellen stark gestiegen. Nach einem tige Stellung als Wirtschaftsstandort behalten und
Höchststand Anfang der 90er Jahre ist die Zahl der ausbauen. Die Rahmenbedingungen für mehr und
Arbeitsplätze jedoch deutlich zurückgegangen. Bis zugleich vielfältige, attraktive Arbeitsplätze sollen
1997 ging im Kanton Zürich jeder zehnte Arbeits- weiter gestärkt werden. So betreibt das Amt für Wirt-
platz verloren. Viele dieser Arbeitsplätze wurden in schaft und Arbeit einerseits aktive Standortförderung,
der darauf folgenden konjunkturellen Entspannung begünstigt die Niederlassung ausländischer Firmen
wieder geschaffen. Ein weiteres Wachstum wurde im Kanton, erteilt ausländischen Arbeitskräften Be-
aber vorerst gestoppt. willigungen und kontrolliert die Arbeitsbedingungen
Kurzfristig wird die Zahl der Arbeitsplätze vor allem in den Unternehmen. Andererseits beraten und ver-
durch die konjunkturelle Entwicklung beeinflusst. mitteln die RAV Stellensuchende und organisieren
Der Arbeitsmarkt wird darüber hinaus durch meh- Kurse, um deren Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu
rere langfristig wirkende strukturelle Einflüsse ge- erhöhen. Zur Erreichung des Ziels, Arbeitslose mög-
prägt. Dazu gehören das Wachstum im Dienstleis- lichst schnell und dauerhaft in den Arbeitsmarkt zu
tungssektor, der starke Anstieg der Erwerbsquote integrieren, arbeiten die RAV mit Arbeitgebern, priva-
von Frauen, der Anstieg der Teilzeitarbeitsstellen und ten Stellenvermittlungen und verschiedenen Partnern
die Zunahme bei den Temporärarbeitsstellen. Diese der öffentlichen Hand zusammen.
auch gesamtschweizerisch zu beobachtenden Trends
werden sich in den nächsten Jahren weiter fortsetzen. Weiterführende Informationen
Der durch den technologischen Fortschritt geprägte • Amt für Wirtschaft und Arbeit, AWA, Kanton Zürich,
wirtschaftliche Wandel verändert die Anforderungen www.awa.zh.ch
an die Arbeitnehmenden kontinuierlich. Die hohe • Regionale Arbeitsvermittlungszentren, Kanton Zürich,
www.rav.zh.ch
Dynamik auf dem Zürcher Arbeitsmarkt fordert in
• Arbeitsmarktbeobachtung Ostschweiz, Aargau und Zug,
zunehmendem Masse berufliche Flexibilität (Tätigkeit,
www.amosa.net
Arbeitszeit usw.), Mobilität und konstante Weiterbil-
• Arbeitsverhältnisse im wirtschaftlichen Strukturwandel,
dung der Arbeitnehmenden. Bentz D., statistik.info 03 (2006), www.statistik.zh.ch
In den frühen 90er Jahren und erneut nach 2002
ist die Zahl der Arbeitslosen stark gestiegen. Die
Börsenschwäche in den Jahren 2001 und 2002, der
Nachfrageeinbruch in der Flugverkehrsbranche usw.
führte auch dazu, dass viele gut qualifizierte Arbeit-
nehmende entlassen wurden. Besorgniserregend
ist ausserdem die hohe Jugendarbeitslosigkeit. Seit
2006 ist eine deutliche Erholung spürbar. Es hat sich
17WIRTSCHAFT
INVESTITIONEN
Investitionen bilden die Basis für die Produktion von morgen.
Bauinvestitionen helfen das physische Kapital (Hochbauten,
Infrastrukturanlagen usw.) zu erhalten oder zu erweitern.
Geeignete Investitionen sollen optimale Rahmenbedingungen
für die Wirtschaft schaffen und einen Nutzen für Gesellschaft
und Wirtschaft generieren.
Öffentliche und private 1) Investitionen in Neubau ohne Abbruch; Zielrichtung
Bauinvestitionen 2) Investitionen in Neubau mit Abbruch / Umbau / Abbruch; Zielrichtung
20‰
18‰
Anteil an GVZ-Versicherungssumme in ‰
16‰
14‰
12‰
10‰
8‰
6‰
4‰
2‰
0‰
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
1) Investitionen in Neubau ohne Abbruch 2) Investitionen in Neubau mit Abbruch / Umbau / Abbruch
Definition des Indikators
Die beiden Indikatoren machen Aussagen zur Investitionstätigkeit im Bausektor durch Private
und die öffentliche Hand. Die beiden Indikatoren werden wie folgt berechnet:
1) Investitionen in Neubau ohne vorhergegangenem Abbruch / Totalwert der Bausubstanz
(gemäss Versicherungssumme der Gebäudeversicherung Kanton Zürich, GVZ). Damit bildet
man im Wesentlichen die Aufwendungen für die Vermehrung des physischen Kapitals ab.
2) (Investitionen in Neubau mit vorhergegangenem Abbruch + Investitionen in Umbau +
Investitionen für Abbruch) / Totalwert der Bausubstanz (gemäss Versicherungssumme der
Gebäudeversicherung Kanton Zürich, GVZ). Damit bildet man im Wesentlichen die Aufwen-
dungen für die Aufrechterhaltung und den Ersatz des physischen Kapitals (alle Arten von
Hochbauten und Infrastrukturanlagen) ab.
Datenquelle
Bundesamt für Statistik (BFS); Gebäudeversicherung Kanton Zürich (GVZ)
18Nachhaltigkeitsbericht Kanton Zürich WIRTSCHAFT
Nachhaltige Entwicklung und Investitionen Handlungsfelder
Private und öffentliche Investitionen ermöglichen den Der Kanton Zürich kann in diesem Bereich massgeb-
Erhalt bzw. den Ausbau eines wichtigen Produktions- lich zu einer Nachhaltigen Entwicklung beitragen.
faktors, nämlich des produzierten Kapitals. Investitio- Dies einerseits durch seine Investitionstätigkeit für
nen bilden die Basis für die Produktion von morgen Infrastrukturanlagen und Hochbauten. Andererseits
und helfen die Grundlage für die wirtschaftliche und kann er Rahmenbedingungen schaffen, welche An-
gesellschaftliche Entwicklung für kommende Gene- reize für nachhaltige Investitionen erzeugen.
rationen zu erhalten oder gar zu verbessern. Dabei Als Instrumente können die kantonale Richtplanung,
sollen getätigte Investitionen langfristig einen Nutzen Bauvorschriften, Förderprogramme usw. dienen,
für Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft zeitigen. damit vermehrt ökologisch und sozial verträgliche
Bauinvestitionen – private und öffentliche – helfen Siedlungen und Hochbauten erstellt werden. So kön-
die bestehende Struktur auch für kommende Gene- nen häufiger auch private Investoren eingebunden
rationen zu erhalten oder zu erweitern. Sie leisten werden.
so einen Beitrag zu einer Nachhaltigen Entwicklung, Durch nachhaltiges Bauen kann wesentlicher Einfluss
indem das physische Kapital (Hochbauten, Infra- auf das physische Kapital genommen werden. Nach-
strukturanlagen usw.) erhalten oder erhöht wird. haltiges Bauen heisst, den Menschen mit einzubezie-
Andererseits besteht auch die Gefahr negativer Aus- hen und ökonomisch akzeptable sowie ökologisch
wirkungen. Dies trifft dann ein, wenn Investitionen verträgliche Lösungen für Bauvorhaben zu finden.
Umweltkapital zerstören oder den Handlungsspiel- Dabei ist speziell eine langfristige Perspektive zu
raum kommender Generationen einschränken. Ge- wählen. Die SIA Empfehlungen 112/1 bilden einen
rade bei Investitionen in neue Infrastrukturanlagen wichtigen Orientierungsrahmen für «Nachhaltiges
ist dies speziell zu berücksichtigen. Allerdings be- Bauen» im Hochbau. Der darin enthaltene Kriteri-
schränken sich die beiden Indikatoren auf die Bau- enkatalog beinhaltet qualitative Zielvereinbarungen
investitionen und klammern die Ausrüstungs- und für die Bereiche Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt.
Forschungsinvestitionen aus. Im Bereich Gesellschaft soll beispielsweise auf eine
gute soziale Durchmischung und auf eine optimale
Ausgangslage und Interpretation der Entwicklung Erreichbarkeit durch den öffentlichen Verkehr ge-
Der erste Indikator – Investitionen in Neubauten ohne achtet werden. Aus wirtschaftlicher Sicht braucht es
Abbruch im Verhältnis zum Totalwert der Bausub- eine Bausubstanz mit hoher Wertbeständigkeit und
stanz – ist seit 1994 rückläufig. Vor allem im Jahr niedrige Unterhaltskosten. Im Bereich Umwelt gibt
2005 kam es zu einem starken Rückgang der Inves- es Kriterien zum Schadstoffgehalt der Baustoffe und
titionen ohne Abbruch. Diese Entwicklung, das heisst, zum Energiebedarf für Heizung und Warmwasser.
die Abnahme der Bauinvestitionen «auf der grünen
Wiese» ist unter dem Gesichtspunkt der Nachhal- Weiterführende Informationen
tigen Entwicklung erwünscht. Solche Investitionen • Finanzverwaltung Kanton Zürich, www.fv.zh.ch
vermindern das Umweltkapital und bewirken ten- • eco-bau, Nachhaltigkeit im öffentlichen Bau,
denziell eine Zunahme der Aufwendungen für Bau, www.eco-bau.ch
Betrieb und Unterhalt der Infrastrukturanlagen. • Schweizerischer Ingenieur- und Architektenverein, SIA,
www.sia.ch
Der zweite Indikator – Investitionen in Neubau mit
vorhergegangenem Abbruch plus Investitionen in
Umbau plus Investitionen in Abbruch im Verhältnis
zum Totalwert der Bausubstanz – bewegt sich im
Zeitraum von 1994 bis 2004 in einer engen Band-
breite. Seit 2003 ist er jedoch stark gestiegen. Im
Verhältnis zum Totalwert der Bausubstanz haben die
Erhaltungs- und Erneuerungsinvestitionen am physi-
schen Kapital also zugenommen. Ob dies im Einklang
mit der Nachhaltigen Entwicklung steht, ist schwer
zu beurteilen. Dazu müssten qualitative Angaben zu
den Investitionen verfügbar sein.
19WIRTSCHAFT
RESSOURCENEFFIZIENZ
Es braucht eine dauerhafte Entkoppelung von Wirtschaftswachstum
und Energie- bzw. Ressourcenverbrauch. Nur so können der Wohlstand
hoch gehalten und die negativen Auswirkungen auf Mensch und
Umwelt verringert werden. Dazu braucht es Verbesserungen bei der
Energie- und Ressourceneffizienz.
Gesamtenergieverbrauch pro Volkseinkommen Zielrichtung
0,7
0,6
Volkseinkommen (kWh / SFr.)
Gesamtenergieverbrauch /
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Definition des Indikators
Der Indikator setzt den Gesamtenergieverbrauch (in kWh; Endenergieverbrauch der Bereiche
Wirtschaft, Haushalt, Verkehr) ins Verhältnis zum Volkseinkommen (in SFr.). Der Indikator ver-
deutlicht damit, wie viel Energie (in kWh) aufgewendet werden muss, um einen Franken Volks-
einkommen zu erwirtschaften. Der Berechnung liegt das inflationsbereinigte Volkseinkommen
(bezogen auf 2004) zugrunde. Weitere Informationen zur Erhebung des Volkseinkommens
finden sich im Kapitel «Einkommen» (siehe Seite 12). Der zusammengesetzte Wert ist gemäss
der Zielerreichung (Entkoppelung von Wohlstand und Energieverbrauch) ein wichtiger Indika-
tor. Er ist jedoch nicht eindeutig zu interpretieren, da der Gesamtenergieverbrauch wie auch
das Volkseinkommen durch die verschiedensten Faktoren beeinflusst werden.
Datenquelle
Statistisches Amt des Kantons Zürich; Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft (AWEL)
20Nachhaltigkeitsbericht Kanton Zürich WIRTSCHAFT
Nachhaltige Entwicklung und
Ressourceneffizienz
Ein verantwortungsbewusster Umgang mit natürli- ceneffizienz steht dementsprechend auch im Interes-
chen Ressourcen stellt eine zentrale Grundlage für se der Unternehmen. Steigen die Preise für Rohstoffe
die Nachhaltige Entwicklung dar. Die Nachhaltige weiter an, wird die Ressourceneffizienz vermehrt zu
Entwicklung verfolgt das Ziel, den Ressourcenver- einer unternehmerischen Notwendigkeit.
brauch zu senken und gleichzeitig den Wohlstand
zu steigern. Dabei wird eine dauerhafte Entkopplung Handlungsfelder
von Wirtschaftswachstum und Umweltbelastung an- Die Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und
gestrebt. In dieser Hinsicht fällt der Wirtschaft eine Ressourcenverbrauch muss weiter vorangetrieben
zentrale Rolle zu, da ressourcenextensivere Produk- werden, so dass nicht nur die Effizienz von Ener-
te und Prozesse nur über Innovationen entstehen. gie- und Materialeinsatz zunimmt, sondern auch
Damit kann langfristig eine Steigerung der Ressour- der Gesamtverbrauch sinkt. Des Weiteren soll der
cen- und Energieeffizienz erreicht werden. Ersatz von nicht erneuerbaren Ressourcen durch er-
neuerbare gefördert werden. Dies würde nicht nur
Ausgangslage und Interpretation der Entwicklung die Abhängigkeit von erschöpfbaren Ressourcen
Global betrachtet hat in den letzten 25 Jahren eine reduzieren, sondern auch die Umweltbelastung ins-
zunehmende Entkoppelung von Wirtschaftswachs- gesamt verringern. Eine Dienstleistungsgesellschaft,
tum und Ressourcenverbrauch stattgefunden. Im welche verarbeitungsintensive Produkte – zusammen
Vergleich zum Ressourcenabbau vergrösserte sich das mit viel «grauer Energie» – importiert, soll darüber
Weltbruttoinlandprodukt gut um das Doppelte. Die hinaus eine global ausgerichtete Strategie verfolgen.
Weltwirtschaft nutzt die Ressourcen zwar effizienter, Die so genannte «integrierte Produktepolitik» (IPP)
gleichzeitig produziert sie aber auch immer mehr verfolgt das Ziel, dass Produkte und Dienstleistun-
Güter. Der Energie- und Materialinput der Weltwirt- gen während des gesamten Lebenszyklus (Planungs-,
schaft stieg somit – absolut betrachtet – weiter an, Herstellungs-, Nutzungs- und Entsorgungsphase)
und die globalen Ökosysteme konnten nicht entlastet hohen wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen
werden. Anforderungen genügen. Die öffentliche Hand kann
Die Abbildung zeigt, dass auch im Kanton Zürich eine IPP im Sinne ihrer Vorbildfunktion verfolgen.
eine Tendenz zur Entkoppelung zu beobachten ist. Die Unternehmen sollen die Forderung nach verbes-
Bei ungefähr gleich bleibendem Energieverbrauch serter Ressourceneffizienz als Herausforderung wahr-
(siehe Zielbereich «Energieverbrauch», S. 40) konnte nehmen. Die Entwicklung neuer Produktionsprozesse
mehr Volkseinkommen generiert werden. Diese Ent- ist innovationsfördernd und kann zur Steigerung der
koppelung ist zum einen auf eine verbesserte Energie- Wettbewerbsfähigkeit beitragen. Eine verbesserte
und Materialeffizienz zurückzuführen, resultiert aber Ressourceneffizienz und ein insgesamt geringerer
auch aus einem wirtschaftlichen Strukturwandel in Verbrauch von Material und Energie kommen sowohl
Richtung Dienstleistungsgesellschaft. Produkte, bei den Unternehmen als auch der Umwelt zugute.
denen eine geringe Wertschöpfung erzielt wird und Die Handlungsmöglichkeiten des Kantons Zürich sind
die einen hohen Material- und Energieinput erfor- relativ beschränkt, da hauptsächlich die Rohstoffprei-
dern, werden immer häufiger importiert. Der Bedarf se die Nutzungsintensität bestimmen. Es könnten
an Energie für Herstellung, Transport und Lagerung jedoch vermehrt Anreize geschaffen werden, bei-
(so genannte «graue Energie») verlagert sich dem- spielsweise durch Lenkungsabgaben, welche zu
entsprechend ins Ausland. einem effizienteren – und auch absolut verringerten
Der Ölpreis und die Preise für andere Rohstoffe wie – Ressourcenverbrauch führen.
Kupfer, Nickel, Platin, Aluminium usw. sind in den
letzten Jahren stark angestiegen. Aufgrund der enor- Weiterführende Informationen
men Nachfrage nach Rohstoffen, gerade auch durch • Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, AWEL,
Schwellenländer wie China, Indien oder Brasilien, ist Kanton Zürich, www.awel.zh.ch
langfristig keine Wende bei der Preisentwicklung in • Energieeffiziente Produkte, www.topten.ch
Sicht. Die grosse und weiter steigende Nachfrage
nach Ressourcen und die verstärkten Investitionen,
die in die Förderung und Aufbereitung getätigt wer-
den müssen, werden die Preise weiter nach oben
treiben. Eine Steigerung der Energie- und Ressour-
21Sie können auch lesen