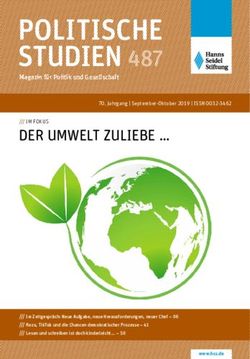RUNDBRIEF - Forum Umwelt & Entwicklung
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
RUNDBRIEF
Forum Umwelt und Entwicklung 2/2021
REICHT’S FÜR ALLE ?
WELTERNÄHRUNG AN DEN
GRENZEN DES WACHSTUMS
WATER FUTURES MANCHMAL IST
DIE TRANSFORMATION ERNÄHRUNGSSYSTEME WENIGER MEHR
ALS ANLAGEOBJEKT Eine gefährliche Form
DER ERNÄHRUNGSSYSTEME der Kommerzialisierung Abschied von Weltmärkten
Richtungs- & Machtfragen Folgen der Finanzialisierung durch global-solidarische
von Ernährung & von Wasser
der Welternährungspolitik Regionalisierung
Landwirtschaft › Seite 32
› Seite 17 ISSN 186 4-0 982
› Seite 14
› Seite 7RUNDBRIEF 2 /2021
WELTERNÄHRU NG
SCHWERPUNKT
So viel Hunger – so viel Nahrung 2
Warum es uns nicht gelingt, das Recht auf Nahrung für alle
Menschen durchzusetzen
Roman Herre
Wer steuert die Transformation der Ernährungssysteme, 7
und wohin?
Bei der aktuellen Kontroverse um den UN-Food Systems Summit geht es
um Richtungs- und Machtfragen der zukünftigen Welternährungspolitik
Martin Wolpold-Bosien
11 Schritte für eine Zukunft ohne Hunger 11
Welternährung 2030
Lutz Depenbusch
Ernährungssysteme als Anlageobjekt 14
Die Finanzialisierung von Ernährung und
Landwirtschaft und ihre Folgen
Flora Sonkin und Magdalena Ackermann
Water Futures – die Zukunft des Wassers?
Eine gefährliche Form der Kommerzialisierung von Wasser
17 AKTUELLES
Maude Barlow Neue Spielräume für 42
AGRA – Unheilvolle Allianz für eine grüne Revolution in Afrika 20 nachhaltige Entwicklung?
Bilanz zu einer als Anti-Armutsprogramm getarnten Die Schöpfung von Sonderziehungsrechten
Lobbyorganisation für Agrarkonzerne als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie
Josephine Koch Manuel F. Montes
Fehlernährung ist Symptom einer globalen Syndemie 23 Internationale Verhandlungen 45
...und eine Folge des Zusammenwirkens von um Geld und Artenvielfalt
Klimawandel, Hunger und Übergewicht Finanzierung und Finanzen im neuen globalen
Dinah Stratenwerth Rahmen für die Biodiversität
Florian Titze
SaisonarbeiterInnen stärken! 26
Gewerkschaften und Beratungsstellen gehen neue Wege Handel über Demokratie 48
Benjamin Luig Wie internationale Freihandelsabkommen
der chilenischen Bevölkerung ihr
Krank durch Pestizide 29 Selbstbestimmungsrecht absprechen
Über das Ausmaß der globalen unbeabsichtigten Pestizidvergiftungen Veronica Rossa
Susan Haffmans
Manchmal ist weniger mehr 32
Wie der Abschied von Weltmärkten durch global-solidarische
Regionalisierung gelingen kann AUS DEM FORUM
Nelly Grotefendt
Schluss mit Hormongiften! 51
Die Tierwohlabgabe als Instrument für bessere 35 NGOs fordern von der Bundesregierung, endlich
Haltungsbedingungen die Belastung mit Hormongiften zu stoppen
Sie kann aber nur ein erster Schritt sein Wolfgang Obenland
Ann-Cathrin Beermann
Aus Alt mach Öl 54
Der Wald als Nahrungsquelle 38 Doch Kreislaufwirtschaft sieht anders aus
Wie Agroforstwirtschaft zur Ernährungssicherung Tom Kurz
weltweit beitragen kann
Ulrike Bickel Publikationen aus dem Forum 57
Schwerpunktpublikationen 41
Das Forum Umwelt & Entwicklung wurde 1992 nach der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung gegründet und koor-
diniert die Aktivitäten der deutschen NGOs in internationalen Politikprozessen zu nachhaltiger Entwicklung. Rechtsträger ist
der Deutsche Naturschutzring, Dachverband der deutschen Natur-, Tier- und Umweltschutzorganisationen (DNR) e. V.
Die nächste Ausgabe des Rundbriefs erscheint im November 2021.
IMPRESSUM
HERAUSGEBER: Forum Umwelt & Entwicklung, Marienstraße 19 – 20, 10117 Berlin, Telefon: 030 / 678 17 75 920, E-Mail: info@forumue.de,
Internet: www.forumue.de, Twitter: @ForumUE VERANTWORTLICH: Jürgen Maier REDAKTION: Ramona Bruck und Wolfgang Obenland
MITARBEIT: Judith Hermann LEKTORAT: Marion Busch LAYOUT: STUDIO114.de | Michael Chudoba TITELBILD: Nadine Primeau/unsplash
DRUCKEREI: Knotenpunkt Offsetdruck GmbH REDAKTIONSSCHLUSS: 31. Mai 2021
Die dargestellten Inhalte und Positionen liegen in der Verantwortung der jeweiligen AutorInnen und geben nicht zwingend Standpunkte des
Forums, seiner Mitglieder oder Förderer wieder.Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
im Herbst dieses Jahres lädt der Generalsekretär der Vereinten Nationen Antó-
nio Guterres zu einem Welternährungsgipfel nach New York – dem UN Food
Systems Summit (UNFSS). Der soll Weichen stellen, um die Ziele für nach-
haltige Entwicklung (SDGs) doch noch zu erreichen. Antworten auf die drin-
gendsten Probleme des globalen Ernährungssystems sollen gefunden werden:
zunehmender Hunger, Mangel- und Fehlernährung, Biodiversitätsverlust und
die fortschreitende Klimakrise. Doch bei genauerem Hinsehen entpuppen sich
die hehren Ziele und der Gipfel selbst als Rückschritt für Inklusivität und Partizipation. Er bietet Lobbyisten
eine Spielwiese und untergräbt bestehende UN-Prozesse und Institutionen.
Grund für uns, einen genaueren Blick auf den Gipfel, seine Agenda sowie die dringendsten Herausforde-
rungen des globalen Ernährungssystems zu werfen. Die Speicher sind voll, doch die Teller bleiben leer. Diesem
Paradox kommt Roman Herre im Leitartikel auf die Spur. Er schildert eindrücklich, wie das industrielle Ernäh-
rungssystem und seine festgefahrenen, industriefreundlichen Strukturen Menschrechte untergraben, und fühlt
strukturellen Ursachen auf den Zahn. Dass auch der UNFSS keine Abhilfe verspricht, darüber schreibt Martin
Wolpold-Bosien. Besorgniserregend zeichnen sich problematische Verflechtungen u. a. zur „Allianz für eine
grüne Revolution in Afrika“ (AGRA) ab. Josephine Koch wirft einen kritischen Blick auf diese Allianz, welche
auch von der deutschen Bundesregierung unterstützt wird und die Lage der afrikanischen Kleinbäuerinnen
und -bauern nicht verbessert. Zu sehr setzt sie auf industrielle Landwirtschaft.
In den vergangenen Jahrzehnten nahm der Einfluss von Finanzmarktakteuren und Märkten auf alle öko-
nomischen und gesellschaftlichen Bereiche zu. Flora Sonkin und Magdalena Ackermann betrachten die ge-
fährlichen Prozesse der Marktliberalisierung und „Finanzialisierung“ hinsichtlich Ernährung und Landwirt-
schaft. Maude Barlow schildert die Entwicklung der Kommerzialisierung der Ressource Wasser und warum
das kein Beitrag zur Lösung der globalen Wasserkrise ist. Dinah Stratenwerth zeigt am Beispiel Mexiko, wie
Fehlernährung eine Folge des industriellen Ernährungssystems und ein Symptom des Zusammenwirkens von
Klimawandel, Hunger und Übergewicht ist. Doch Gefahren für Gesundheit lauern bekanntlich nicht nur in
Zucker. Susan Haffmans berichtet über das Ausmaß der globalen, unbeabsichtigten Pestizidvergiftungen bei
LandarbeiterInnen, die täglich auf Plantagen und in Gewächshäusern Pestiziden zum Teil schutzlos ausge-
liefert sind.
Die Zeit ist reif für eine ambitionierte und umfassende agrarökologische, menschenrechtsbasierte Transfor-
mation der Ernährungssysteme. Ulrike Bickel schreibt darüber, wie Agroforstwirtschaft dazu beitragen kann.
In der Rubrik Aktuelles finden Sie diesmal finanzpolitische Artikel. Zum einen den zweiten Teil von Manuel
Montes‘ Ausführungen zu frischen Sonderziehungsrechten als Reaktion auf die Pandemie. Zum anderen einen
Beitrag von Florian Titze zu Finanzierungsfragen im Kontext des aktuell verhandelten globalen Rahmenab-
kommens zum Schutz der Biodiversität. Für ein erfolgreiches Abkommen muss nicht nur mehr Geld lockerge-
macht werden. Umweltschädliche Finanzströme müssen genau so dringend beendet oder umgelenkt werden.
Die chemiepolitischen Referenten des Forums übernehmen in dieser Ausgabe die dritte Rubrik. Während
Wolfgang Obenland die Forderungen der Kampagne „Hormongifte stoppen!“ auf den Punkt bringt, beschreibt
Tom Kurz das Pyrolyse-Verfahren, das von der chemischen Industrie als umweltfreundliche Zukunftstechno-
logie verkauft wird, „doch Kreislaufwirtschaft sieht anders aus.“
Ich denke, es ist wieder für jede und jeden etwas dabei. Ich wünsche Ihnen eine bereichernde und ermutigende
Lektüre.
Ramona BruckSO VIEL HUNGER –
SO VIEL NAHRUNG
Warum es uns nicht gelingt, das Recht auf
Nahrung für alle Menschen durchzusetzen
Nach Angaben der UN leidet fast ein Zehntel der Weltbevölke-
rung unter chronischem Hunger. Drei Milliarden Menschen sind
zu arm, um sich gesund ernähren zu können. Durch COVID-19
droht die Zahl derjenigen, die von schweren Gesundheitsschäden
bis hin zum Hungertod bedroht sind, von 150 auf 280 Millionen
zu steigen. Dabei liegt die Menge der pro Kopf verfügbaren
Lebensmittel auf einem historischen Höchststand.
2 SchwerpunktChris Robert/Unsplash
D
ie Zahl der Hungernden steigt seit fünf Jahren Trotz Bevölkerungswachstums steht pro Kopf 30 % mehr
kontinuierlich an. Rund 690 Millionen Men- Nahrung zur Verfügung als noch vor 60 Jahren. Dieser
schen sind chronisch unterernährt. 144 Millio- Trend hält auch unter Corona-Bedingungen an: Nach
nen Kinder unter fünf Jahren – weltweit mehr als jüngsten Schätzungen der FAO werden die Getreideernten
ein Fünftel aller Kinder – sind in ihrem Wachstum beein- 2020 rund 2,6 % über denen des Vorjahres liegen. Bereits
trächtigt. Pro Jahr sterben rund fünf Millionen Kinder vor 2019 wurden für Weizen und Mais Rekordernten eingefah-
ihrem fünften Geburtstag, häufig infolge von Unterernäh- ren. Alle geernteten Pflanzen zusammen liefern etwa das
rung. Und insgesamt zwei Milliarden Menschen sind von 2,5-fache der zur Ernährung benötigten Kalorienmenge.
„mittlerer bis schwerer Ernährungsunsicherheit“ betroffen, UN-ExpertInnen schätzen, dass es derzeit genügend Nah-
hungern also temporär. rung für zehn bis zwölf Milliarden Menschen gibt. 1
Zwar haben Länder wie China und Vietnam seit der Nicht nur die globalen Produktionsvolumina liegen
Jahrtausendwende große Fortschritte gemacht. Jedoch steigt auf Höchststand, auch die Getreidespeicher sind so voll
in Afrika und Lateinamerika die Zahl der Betroffenen wei- wie nie zuvor. Die Weltgetreidevorräte sind seit 2014 um
ter an. In Afrika südlich der Sahara hat fast ein Viertel der ein Drittel auf 927 Millionen Tonnen angestiegen (so die
dortigen Bevölkerung nicht ausreichend zu essen, weshalb Corona-bedingt konservative Schätzung für 2020). Dass
Afrika als Hungerkontinent wahrgenommen wird. Doch globale Lagerbestände und die Zahl dauerhaft hungernder
auch in Indien hungern 195 Millionen Menschen – und Menschen parallel ansteigen, zeigt, wie stark Agrarproduk-
damit fast so viele wie südlich der Sahara (230 Millionen). tion und Hunger heute entkoppelt sind. Auch dies entlarvt
den immer wiederkehrenden Ruf nach mehr Produktion
Hungern im Überfluss seitens der Agrarindustrie und vieler Staaten als weitgehend
Laut Welternährungsorganisation (FAO) wurde noch nie interessendominiertes Argument.
so viel Nahrung produziert wie heute. Seit 1960 hat sich die Wir haben und produzieren also immer mehr – aber
Getreideernte mehr als verdreifacht, die Fleischproduktion was und für wen? Ein Blick auf die Entwicklung der global
mehr als vervierfacht und die Fischmenge gar versechsfacht. bedeutendsten Anbauprodukte zeigt, dass unser Agrar- und
Forum Umwelt & Entwicklung – Rundbrief 2/ 2021 3Ernährungssystem überhaupt nicht darauf ausgerichtet ist,
hungernde Menschen zu ernähren.
Anbau für die Satten
Die sechs Pflanzen mit den größten Flächenzuwächsen sind
Mais, Palmöl, Soja, Zuckerrohr, Raps und Cassava. Ihre
weltweite Anbaufläche ist seit dem Jahr 2000 um 51,1 % oder
145 Millionen Hektar gewachsen. Ihnen ist gemein, dass sie
große Bedeutung als Futtermittel, Energiepflanzen, für die
Bioplastik-Produktion und andere industrielle Nutzungen
haben.
An der Entwicklung des Maisanbaus seit der Jahrtau-
sendwende lässt sich dies besonders gut illustrieren: Dessen doxerweise jene Bevölkerungsgruppen, die selbst Nahrung
globale Anbaufläche ist von 137 Millionen Hektar auf 197 produzieren und die Versorgung mit Nahrung sicherstellen.
Millionen Hektar regelrecht explodiert. Mit einem Zuwachs Die wichtigsten Ursachen hierfür sind Marginalisierung
von 60 Millionen Hektar – also der fünffachen Ackerfläche und Diskriminierung: Die Landbevölkerung hat meist nur
Deutschlands! – ist Mais weltweit am stärksten expandiert. wenige Möglichkeiten, Einfluss auf politische Entscheidun-
Jedoch werden gerade einmal 15 % der globalen Maisernte gen zu nehmen, wird wirtschaftlich benachteiligt und oft in
für die direkte Ernährung verwendet. Demgegenüber ist die widrige Gebiete abgedrängt – mit schlechten Böden, Tro-
Anbaufläche von Weizen, der zum Großteil direkt als Nah- ckenheit, Hanglagen, schlechtem Zugang zu Märkten oder
rungsmittel verwendet wird, seit 2000 um gerade einmal 3,6 fehlender Infrastruktur.
Millionen Hektar angestiegen. Jene für Kartoffeln ist sogar Auch die Arbeitsbedingungen von Plantagenarbeiter
um eine knappe Million Hektar gesunken. Nimmt man Reis Innen haben sich in den vergangenen Jahrzehnten weiter
mit hinzu, ist die Anbaufläche dieser drei wichtigen Grund- verschlechtert. Die Löhne sind oft nicht existenzsichernd,
nahrungsmittel um gerade einmal 4 % gewachsen. gewerkschaftliche Organisation wird kriminalisiert. Die
Nur noch 43 % der Weltgetreideernte landen heute laut Ursachen hierfür liegen nicht zuletzt in der Marktkonzen-
FAO direkt auf dem Teller. Ein wachsender Anteil hinge- tration beim Handel und bei der Verarbeitung von Nah-
gen wird als Futtermittel (36 %), für industrielle Nutzung rungsmitteln. Der daraus resultierende Preisdruck führt
(11 %) und zur Energiegewinnung (10 %) verwendet. Wäh- zum Preisverfall der von Kleinbauern und -bäuerinnen
rend die Bedeutung von Anbauprodukten für Tierfutter, verkauften Nahrungsmittel. La Via Campesina, ein Bünd-
Biosprit oder Bioplastik stark gewachsen ist, stagnieren nis von Kleinbauern und -bäuerinnen, LandarbeiterInnen,
also die Flächen für Grundnahrungsmittel. So hat sich die FischerInnen, Landlosen und Indigenen aus über 80 Län-
Agrarproduktion schleichend und weitgehend unbemerkt dern, bringt diese Benachteiligungen auf den Punkt: „Heute
von ihrer primären Aufgabe, der Ernährungssicherung können wir kein Einkommen mehr erwirtschaften, das uns
entfernt, und viele Kalorien gehen durch industrielle und ermöglicht, in Würde zu leben. Eine Mischung aus natio-
energetische Nutzung, Fleischproduktion und Verarbei- nalen Politiken und internationalen Rahmenbedingungen
tungsverluste verloren. ist verantwortlich dafür, dass wir ausgelöscht werden.“ 2
Auch das gebetsmühlenartige Rezitieren, wir müssten Das größte Problem ländlicher Bevölkerungsgruppen
mehr produzieren, hilft nicht wirklich weiter: Der Blick bleibt der mangelnde Zugang zu Ressourcen, insbesondere
auf die Produktion muss zwingend mit einem Blick darauf Land, Wasser und Saatgut. Auch an günstigen Krediten,
gekoppelt werden, wer auf welchen Flächen was für wen lokaler Lagerhaltung oder öffentlicher, konzernunabhän-
anbaut. giger Schulung fehlt es oft. Die Ursachen sind vielfältig:
die Verschuldung vieler Staaten des Südens, ungünstige
Landbevölkerung überproportional betroffen politische Rahmenbedingungen wie das Verbot von Zoll-
Für eine Bewertung der Welternährungslage sind globale schranken für den Agrarsektor, eine einseitige Förderpolitik
Produktionszahlen allein aber bei Weitem nicht ausrei- etwa bei der Ausweisung großer Landflächen für agrarin-
chend. Es stellen sich zwei einfache, aber grundlegende dustrielle Farmen, die Vergabe von Forschungsgeldern nur
Fragen: Wer hungert überhaupt? Und warum? für kommerzielles Saatgut und Steuererleichterungen für
Trotz anhaltender Urbanisierung leben heute so viele Großinvestoren.
Menschen von der Landwirtschaft wie nie zuvor. Zählt man
Familienangehörige mit, sind es laut FAO rund 2,6 Milli- Unsere verzerrte Wahrnehmung der Ursachen
arden Menschen. Die meisten davon sind kleinbäuerliche In der hiesigen Berichterstattung werden jedoch zumeist
NahrungsmittelproduzentInnen. Etwa 300 bis 400 Millio- der Klimawandel und bewaffnete Konflikte als zentrale
nen arbeiten als LohnarbeiterInnen, viele davon in extrem Hungerursachen genannt. Richtig ist, dass beide Faktoren
prekären Arbeitsverhältnissen auf Plantagen. Sie halten das die Situation verschärfen. So haben die Kriege in Syrien,
industrielle Ernährungssystem am Laufen. Südsudan und Jemen zu Millionen Hungernden geführt.
Zugleich leidet insbesondere die Landbevölkerung unter Trotz eindeutiger Verbote im Völkerrecht wird Aushun-
Hunger: Kleinbauern und -bäuerinnen machen rund die gern weiterhin als Methode der Kriegsführung eingesetzt.
Hälfte der Betroffenen aus, LandarbeiterInnen 22 %, No- Und auch die Erderwärmung führt schon heute zum An-
madInnen und Indigene rund 8 %. Es hungern also para- stieg des Hungers. Durch extreme Wetterereignisse, die
4 SchwerpunktDie Welternährung ist mittlerweile gefährlich
einseitig. 75 % der Nahrungsmittel stammen
von nur zwölf Pflanzen und fünf Tierarten.
sich seit 1990 mehr als verdoppelt haben, nehmen regi- Zwischen Weltmarkt und Bauernmärkten
onale Störungen in der Agrarproduktion zu. Die Länder Im Globalen Süden wird die Landwirtschaft von kleinbäu-
südlich der Sahara haben Anbauflächen verloren. Durch erlichen Strukturen dominiert. In vielen Ländern sind über
Naturkatastrophen werden doppelt so viele Menschen ver- 70 % aller Erwerbstätigen in der Landwirtschaft aktiv. Sie
trieben wie durch Krieg. Laut einem aktuellen UN-Bericht bilden das Rückgrat der lokalen und nationalen Ernäh-
droht die Erderwärmung „für hunderte Millionen Men- rungssicherung. Trotz dieser wichtigen Funktion werden
schen mangelhafte Ernährung, erzwungene Migration, sie von ihren Regierungen kaum unterstützt. Deren Fo-
Krankheit und Tod“ mit sich zu bringen. Damit stünden kus – wie auch jener der Entwicklungszusammenarbeit
„sämtliche Fortschritte auf dem Spiel, die für die globale des Globalen Nordens – liegt auf der Exportproduktion
Entwicklung, Gesundheit und Armutsbekämpfung in den (Cash Crops) und agrarischen Wertschöpfungsketten. Diese
letzten 50 Jahren erzielt wurden“. 3 Dennoch stehen zum Ausrichtung baut jedoch in erster Linie auf den Interessen
gegenwärtigen Zeitpunkt noch andere Hungerursachen global agierender Agrar- und Ernährungsunternehmen auf.
im Vordergrund. Die Weltbank propagiert seit den 1980er-Jahren den
Ansatz der „handelsbasierten Ernährungssicherung“. Die
Die Ernährung ist oft einseitig und ungesund Produktion soll sich demnach auf den Weltmarkt ausrich-
Auch wenn die bunten Lebensmittelregale in den Geschäf- ten, die nationale Ernährungssicherung hingegen verstärkt
ten anderes suggerieren, ist die Welternährung mittlerwei- über den Import von Nahrungsmitteln gewährleistet wer-
le gefährlich einseitig. 75 % der Nahrungsmittel stammen den. Hierfür sind Handelsliberalisierungen wie niedrige
von nur zwölf Pflanzen und fünf Tierarten ab. Gerade drei Zölle von zentraler Bedeutung. Durch diese einseitige Po-
Nahrungsmittel – Reis, Weizen und Mais – stellen 60 % der litik wurden die fünfzig ärmsten Länder seit den 1980er-
pflanzlichen Kalorienversorgung sicher. Jahren von Selbstversorgern und Netto-Exporteuren von
Hierzu tragen Akteure wie die Allianz für eine Grüne Nahrungsmitteln zu Netto-Importeuren. Heute müssen
Revolution in Afrika (AGRA) stark bei. Mit einer Milliarde diese Länder jährlich 46 Milliarden US-Dollar für den
US-Dollar privater und staatlicher Gelder versucht AGRA Import von Grundnahrungsmitteln aufwenden. 4 Diese
seit 15 Jahren, eine industrielle Landwirtschaft mit Fokus Abhängigkeit erklärt auch, wie der rasante Anstieg der
auf wenige kommerzielle Pflanzen – bei AGRA vor allem Weltmarktpreise für Nahrungsmittel in Folge der Finanz-
Mais – zu befördern. Hierdurch ändert sich die Landnut- krise 2007/2008 zu Hungerrevolten in rund 40 Ländern
zung gravierend: Laut einer aktuellen Untersuchung ex- führte.
pandierte in den 13 Ländern, in denen AGRA aktiv ist, die Ein weiteres Problem der Fokussierung auf den „freien“
Anbaufläche von Mais um 45 %. Die Anbaufläche nahrhaf- Weltmarkt ist die extrem ungleiche Förderung der Land-
ter, lokal angepasster Pflanzen wie Hirse sank hingegen. wirtschaft: Die OECD-Staaten unterstützen ihre Landwirt-
Eine ähnliche Entwicklung ist in Südamerika durch den schaft jährlich mit 346 Milliarden US-Dollar, während die
explodierenden Soja-Anbau zu beobachten, der den Anbau Hilfen für kleinbäuerliche Landwirtschaft im Globalen
von Obst, Gemüse und anderen Grundnahrungsmitteln Süden oft minimal sind. 5 Dies auch, weil dort vorhandene
zurückdrängt. Förderungen im Rahmen der Strukturanpassungsmaßnah-
Viele agrarindustrielle Exportländer wie die USA oder men von Weltbank und Internationalem Währungsfonds
Argentinien leisten starken Widerstand dagegen, in inter- (IWF) seit den 1980er-Jahren immer mehr zusammenge-
nationalen Vereinbarungen frische Nahrungsmittel und strichen wurden.
lokale Ernährungssysteme zu verankern oder Gesund- Zugleich werden die für die Versorgung zentralen lo-
heitsrisiken von hochverarbeiteten Nahrungsmitteln zu kalen Bauernmärkte von der Politik ignoriert. Der Gene-
thematisieren. Als Teil einer Gegenbewegung wurde das ralsekretär des Westafrikanischen Kleinbauernnetzwerkes
Konzept der Ernährungssouveränität populär: Es betont ROPPA erklärt dazu: „Die ‚unsichtbaren‘ Märkte, in denen
das Recht von Regierungen, die eigene Landwirtschaft vor die meisten KleinproduzentInnen aktiv sind, fallen unter
Nahrungsmittelimporten, Dumpingpreisen und dem Ein- den Radar. Dies sind die Märkte, durch die die meisten
fluss des Agro-Business zu schützen. Zentrales Anliegen Nahrungsmittel fließen, aber sie werden ignoriert. Wir ver-
von Ernährungssouveränität sind mehr Rechte für Klein- langen, dass die Politik diese Strukturen fördert, anstatt
produzentInnen, etwa Zugang zu Land und mehr Rechte Entscheidungen auf Basis internationaler Märkte zu treffen,
der KonsumentInnen auf freie Wahl ihrer Nahrungsmittel. die völlig anders funktionieren.“ 6
Forum Umwelt & Entwicklung – Rundbrief 2/ 2021 5Menschenrechte im Zentrum der Lösung nicht nur inhaltlich falsch. Die tonangebenden Akteure
Das Recht auf Nahrung gehört zu den verbrieften Men- schaffen es damit auch, ihre eigene Markt- und Machtex-
schenrechten und ist damit Teil des internationalen Rechts. pansion in eine Lösung für den Hunger in der Welt umzu-
Es betont den Zugang zu produktiven Ressourcen und da- etikettieren.
mit das Recht, sich selbst in Würde ernähren zu können.
Marginalisierte Gruppen genießen bei der Umsetzung Pri- Roman Herre
orität. Über die Einhaltung wacht der UN-Sozialausschuss.
Dieser äußerte sich schon vor über zwanzig Jahren deut- Der Autor ist Agrarreferent der Menschenrechtsorganisation
lich zu den Debatten um globale Produktionsmengen: „Im FIAN Deutschland und Sprecher des Leitungskreises des
Grunde liegt die Wurzel von Hunger und Mangelernährung Forums Umwelt & Entwicklung.
nicht in einem Mangel an Nahrungsmitteln, sondern im
mangelnden Zugang großer Teile der Weltbevölkerung zu
den verfügbaren Nahrungsmitteln.“ 7 1 Economic and Social Council of the United Nations (2006):
Eine Welt ohne Hunger wird es daher nur geben, wenn Report of the Special Rapporteur on the right to food, S.4.
die Verwirklichung der Rechte von benachteiligten Men-
2 Final Declaration of the international Conference on Peasants
schen an erster Stelle steht. Dafür dürfen Hungernde und
Rights: „In the 60th anniversary of the Universal Declaration of
Fehlernährte nicht als passive Bedürftige gesehen werden.
Human Rights, we peasants demand our own convention“; 24.
Sie müssen vielmehr die Rolle von aktiv handelnden Sub-
June 2008, Jakarta.
jekten einnehmen können. Ein Positivbeispiel auf globaler
Ebene ist der Welternährungsrat CFS, in dem organisierte 3 Climate Change and Poverty (2019).
PlantagenarbeiterInnen, Kleinbäuerinnen und -bauern, https://undocs.org/A/HRC/41/39
Indigene und andere von Hunger betroffene Gruppen bei 4 Statistische Datenbank der UNCTAD.
Strategien zur Hungerbekämpfung direkt mitreden können. 5 OECD (2017); Agricultural Policy and Evaluation 2017.
Anstatt diesen Ansatz zu stärken, wird jedoch gerade im
6 CSM, Hands off the Land (2015) Connecting Smallholdrers to
Fahrwasser des UN Ernährungsgipfels versucht, an ihm
Markets; S.7 Eigene Übersetzung.
die Axt anzulegen (siehe den folgenden Artikel in dieser
Ausgabe). Die Erfahrungen von Menschenrechtsorganisa- 7 CESCR (1999): Allgemeiner Rechtskommentar 12 zum Recht auf
tionen zeigen deutlich, dass völkerrechtliche Mindeststan- Nahrung.
dards wie Kernarbeitsnormen, Menschen-, Frauen- und
Landrechte nur dann effektiv durchgesetzt werden, wenn
die betroffenen Gruppen es schaffen, sich zu organisieren
und Handlungsdruck auf staatliche Akteure und auf Un-
ternehmen auszuüben.
Das Konzept der Ernährungssicherheit – entstanden
in den 1970er-Jahren im Kontext der Hungerbekämpfung
durch die FAO – bietet hingegen keine ausreichenden Ant-
worten auf die strukturellen Probleme. Die Verengung auf
technische und vermeintlich politisch neutrale Lösungen
mit einseitigem Fokus auf globale Produktionsmengen ist
Was sind Ernährungssysteme?
Ein Ernährungssystem – engl. „Food System“ – Ernährungssysteme werden ständig von
beinhaltet alle Elemente und Aktivitäten, verschiedenen Kräften und Entscheidungen vieler
die im Zusammenhang mit der Produktion, unterschiedlicher Akteure wie Regierungen,
Verarbeitung, Verteilung und Zubereitung sowie Saatgut- und Pestizidindustrie, Handelsketten,
dem Verzehr von Nahrungsmitteln stehen sowie Bäuerinnen und Bauern, KonsumentInnen bis
deren – direkten und indirekten – sozialen, hin zu aktiven Basisinitiativen beeinflusst und
wirtschaftlichen und ökologischen Auswirkungen. verändert. Nachhaltige Ernährungssysteme
Ernährungssysteme bieten im Gegensatz zum müssen an öffentlichen Interessen wie dem
derzeit vorherrschenden Fokus auf agrarische Menschenrecht auf ausreichend gesunde Nahrung
Lieferketten einen ganzheitlichen Blick, der sowohl (z. B. über Gemeinschaftsverpflegung in Schulen
die verschiedenen Wechselwirkungen innerhalb und Kantinen), dem Klimaschutz oder dem Erhalt
des jeweiligen Ernährungssystems als auch dessen von genetischer Vielfalt ausgerichtet sowie
unterschiedliche Auswirkungen, z. B. auf Klima inklusiv, gerecht und widerstandsfähig sein.
und biologische Vielfalt sowie die Gesundheit
von Menschen, sei es als KonsumentInnen
oder LandarbeiterInnen – einbezieht.
6 SchwerpunktGayatri Malhotra/Unsplash
WER STEUERT DIE
TRANSFORMATION DER
ERNÄHRUNGSSYSTEME,
UND WOHIN?
Bei der aktuellen Kontroverse um den UN-Food
Systems Summit geht es um Richtungs- und
Machtfragen der zukünftigen Welternährungspolitik
Für September 2021 lädt der Generalsekretär der Vereinten Nationen
António Guterres zum UN-Food Systems Summit (FSS). Der Gipfel zu den
Ernährungssystemen soll ein Beitrag zur Aktionsdekade zur Verwirkli-
chung der Ziele für nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development
Goals, SDG) sein. Was zunächst wie ein nützlicher und dringend notwen-
diger Beitrag zur wachsenden Ernährungskrise erscheint, entpuppt sich
bei genauerer Analyse als problematischer Versuch, die globale Steue-
rung (Global Governance) zu Ernährungssicherheit in andere, industrie
freundlichere Bahnen zu lenken.
Forum Umwelt & Entwicklung – Rundbrief 2/ 2021 7Z
wischen dem Welternährungsgipfel 1996 und dem
FSS liegen 25 Jahre. Mit dem Gipfel von Rom 1996
und den Nachfolgegipfeln 2002 und 2009 wurden
die Grundsteine für ein menschenrechtsbasiertes,
inklusives und partizipatives Institutionengefüge für Er-
nährungssicherheit gelegt. Das Menschenrecht auf Nah-
rung stand im ersten Artikel des römischen Aktionsplans
von 1996 und wurde dann zwischen 2002 und 2004 in den
Leitlinien zum Recht auf Nahrung ausformuliert. Es wa-
ren die ersten Verhandlungen mit aktiver Beteiligung der
Zivilgesellschaft.
Dieser Präzedenzfall wurde 2009 durch die Reform
des UN-Ausschusses für Welternährung (UN Commit-
tee on World Food Security, CFS) stilbildend für die neue
Global Food Governance: Unter dem Druck der Hunger-
revolten und Ernährungskrisen von 2008/2009 gelang der
Durchbruch zu einem neuen CFS: Die menschenrechtliche
Perspektive wurde zum Leitbild; alle relevanten Sektoren
sollten am Tisch Platz haben, mit besonderer Beachtung
der gefährdeten sozialen Gruppen und des Grundsatzes:
„nothing about us without us“ (nichts über uns, ohne uns).
Dazu gab es eine klare Rollenverteilung: Staaten als Mitglie-
der, die die Entscheidungen treffen und verantworten, die wie andere UN-Gremien auch zur Zielscheibe von Attacken
anderen als TeilnehmerInnen, die an den Beratungen und geworden, die den Multilateralismus zugunsten nationaler
Verhandlungen vollumfänglich beteiligt sind, nicht mehr und Partikularinteressen schwächen wollen.
nur als BeobachterInnen. Gerade in dieser massiven Auseinandersetzung um die
Seither hat sich der CFS – unterstützt und begleitet vom großen Themen wird letztlich die zentrale Rolle des CFS
Civil Society and Indigenous Peoples‘ Mechanism for rela- bestätigt. Die Konzerne und agrarexportierenden Staaten
tions with the UN Committee on World Food Security, dem kämpfen im CFS buchstäblich gegen die immer stärker
CSM – als die weltweit breiteste Plattform der Regierungen, werdende Agrarökologie, gegen die Rechte der Bäuerinnen
der UN-Institutionen, Wissenschaft, Zivilgesellschaft und und Bauern, gegen die Reduktion von chemischen Düngern
Wirtschaft zu Ernährungssicherheit bewährt. Zahlreiche und Pflanzenschutzmitteln, gegen die Überwindung nicht
erfolgreiche CFS-Politikkonvergenzprozesse haben zusam- nachhaltiger Ernährungssysteme. Der Richtungsstreit zwi-
mengenommen ein neues Narrativ zu Ernährungssicherheit schen Agrarökologie und Grüner Revolution hat hier seinen
gesetzt. 1 Ort. Gleichzeitig wird der CFS weiterhin von der Mehrheit
der aktiven Staaten und TeilnehmerInnen unterstützt und
Der CFS ist kein Ponyhof verteidigt.
Mehrere einflussreiche Regierungen fahren massive An-
griffe auf den Menschenrechtsansatz, gegen Frauenrechte, Die neue globale
die Unteilbarkeit der Menschenrechte und die menschen- Ernährungskrise hat begonnen
rechtliche Rechenschaftspflicht. Zuletzt mit der drastischen Das globale Steuerungsgefüge zur Ernährungssicherheit
Folge, dass der CSM die neuen CFS-Leitlinien zu Ernäh- steht angesichts vielfältiger, zeitgleicher Krisen vor enormen
rungssystemen nicht mehr zu unterstützen bereit war. 2 Herausforderungen: Schon vor Corona war klar, dass es
Immer wieder wird versucht, das Konzept der Inklusivität ohne eine radikale Reform der Ernährungssysteme unmög-
umzudeuten, d.h. die besondere Rolle der marginalisier- lich sein würde, das zweite Ziel für nachhaltige Entwicklung
ten Gruppen (NomadInnen, indigene Völker, FischerIn- „Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere
nen, LandarbeiterInnen, Bäuerinnen und Bauern, städtische Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft
Arme etc.) zu relativieren. Aus Sicht der Zivilgesellschaft fördern“ beziehungsweise die SDGs insgesamt zu erreichen.
steht Inklusivität zuerst und vor allem für die Einbeziehung Eine massive Kurskorrektur weg von industriellen, kon-
der bis heute zumeist Ausgeschlossenen, nicht für die der zern-dominierten Ernährungssystemen hin zu nachhalti-
wirtschaftlichen Eliten, die schon immer Zugang zur Macht gen, menschenrechtsbasierten und agrarökologischen Er-
hatten. nährungssystemen war und ist unumgänglich. Nur so kann
Auch der wissenschaftliche Beirat, das sogenannte es gelingen, den drängenden Klima- und Ökosystemkrisen,
High-Level Panel of Experts (HLPE) des CFS, wird immer den wachsenden sozialen und wirtschaftlichen Ungleich-
wieder von einigen Staaten kritisiert, weil er unangenehme heiten, den enormen Konzentrations- und Machtakkumu-
Analysen liefert, für eine radikale Transformation der Er- lationsprozessen im Agrar- und Ernährungsbereich sowie
nährungssysteme argumentiert und einem methodischen den neuen Konflikt- und Migrationskrisen wirkungsvoll
Ansatz verpflichtet ist, der verschiedene Formen des Wis- zu begegnen.
sens einbezieht. Dazu gehören auch indigenes, bäuerliches Mit COVID-19 und seinen enormen Folgen hat sich
und anderes traditionelles Wissen. Insgesamt ist der CFS die Dringlichkeit für eine umfassende Transformation
8 SchwerpunktDie globale Ernährungspolitik muss
einen drastischen Richtungswechsel
vornehmen, wenn sie zur Bewältigung
der heutigen Krisen ihren Beitrag leisten
will. Für viele Millionen Menschen ist die
neue globale Ernährungskrise bereits
Realität.
noch verschärft. Die globale Ernährungspolitik muss ei- Der problematische Multistakeholder-
nen drastischen Richtungswechsel vornehmen, wenn sie Ansatz des Food Systems Summit
zur Bewältigung der heutigen Krisen ihren Beitrag leisten Der UN Food Systems Summit, der für September 2021
will. Mehrere Berichte des HLPE, der Welternährungsor- in New York geplant ist und eine Vorbereitungskonfe-
ganisation FAO und des CSM 3 zeigen: Die neue globale renz in Rom vom 26.-28. Juli mit einschließt, ist formal
Ernährungskrise ist für viele Millionen Menschen bereits eine Initiative des UN-Generalsekretärs, vergleichbar mit
Realität. Der Bericht zum Zustand der Ernährungssicher- dem Climate Action Summit im September 2019. Er ist
heit der FAO von 2020 schätzt, dass zwischen 83 und 132 kein zwischenstaatlicher Gipfel wie die Ernährungsgipfel
Millionen Menschen zusätzlich in Ernährungsnot geraten zwischen 1996 und 2009 und hat daher kein normatives
werden. Die jüngsten Zahlen des Global Report on Food Mandat. Das FSS-Abschlussdokument wird nicht von den
Crises 2021 bestätigen den alarmierenden Trend. 4 UN-Mitgliedstaaten ausgehandelt, sondern lediglich vom
Vor diesem Hintergrund ist deutlich, dass die im CFS UN-Generalsekretär verantwortet. Es entsteht in einem
erreichten Standards für Global Governance essenzielle Er- auch für ExpertInnen kaum zu durchschauenden Prozess
rungenschaften sind, hinter die wir nicht mehr zurückfallen zwischen fünf sogenannten Action Tracks, zahlreichen
dürfen. Vielmehr braucht es eine dringende Stärkung in nationalen und thematischen Ernährungsdialogen, einer
den folgenden vier Schlüsselbereichen, weit über den CFS Scientific Group, einem Advisory Committee und dem
hinaus: FSS-Sekretariat.
1. Menschenrechtsbasierte Institutionen und Zentralität Die Initiative für den FSS fällt zusammen mit einem
der RechteinhaberInnen: Frauenbewegungen, Indige- höchst umstrittenen Partnerschaftsabkommen zwischen
ne Völker, Bäuerinnen und Bauern, LandarbeiterInnen, dem Davoser Weltwirtschaftsforum und dem UN-Sekre-
VerbraucherInnen etc. müssen besser gehört werden. tariat, das im Juni 2019 unterzeichnet wurde. Der FSS ist in
2. Öffentliches Interesse vor Konzerninteressen: Der seinem Prozessdesign ein Pilotprojekt des Multistakehol-
Einfluss der Konzerne muss massiv zurückgedrängt und der-Ansatzes auf UN-Niveau, zu dem alle relevanten Ak-
eingeschränkt werden durch klare und verpflichtende teurInnen eingeladen sind. Dabei wird nicht unterschieden
Regeln auch für das Finanzkapital. Die Unabhängigkeit zwischen den verschiedenen Rollen und Verantwortlich-
der Wissenschaft muss gesichert werden, auch durch keiten der TeilnehmerInnen: Mitgliedstaaten, UN-Insti-
robuste Maßnahmen gegen Interessenkonflikte. tutionen, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft.
3. Umfassende, agrarökologische Transformation der in- Dieser Ansatz erlaubt eine unangemessene Einflussnahme
dustriellen Ernährungssysteme durch Politikstrategien, industrieller Interessen und vermeidet robuste Regeln ge-
die eine gesunde Ernährung für alle sowie soziale und gen Machtasymmetrien und Interessenkonflikte. In dieser
wirtschaftliche Gerechtigkeit mit einer ökologischen diffusen Gemengelage sind effektive menschenrechtliche
Wende zum Schutz des Klimas und der Artenvielfalt Rechenschaftspflichten nicht umsetzbar. Der High-Level
verbinden. Panel of Experts und der Präsident des CFS warnen vor
4. Inklusiver Multilateralismus statt Multistakeholder der Entwicklung von Parallelstrukturen und weiterer Frag-
ismus: Die internationalen öffentlichen Institutionen mentierung, wie sie vom Wissenschaftlichen Beirat des FSS
müssen gestärkt und demokratisiert werden; sie dür- vorangetrieben werden. 5
fen nicht durch diffuse sogenannte Multistakeholder- Die Organisationen des CSM haben den FSS-Entste-
Plattformen ersetzt werden. hungsprozess über mehr als ein Jahr beobachtet und mit
Forum Umwelt & Entwicklung – Rundbrief 2/ 2021 9kritischen Fragen konfrontiert. 6 Überzeugende Antworten die strukturellen Schwächen der dominierenden Modelle
auf ihre Kritik blieben aus. Mit dem offenen Aufruf der noch sichtbarer gemacht haben. Es ist Zeit zu handeln: für
Zivilgesellschaft und Indigenen Völker, der beim CFS im eine demokratische Stärkung der öffentlichen Institutionen
Oktober 2020 vorgestellt wurde, hat sich ein breiter und und der Steuerungsmodelle des inklusiven Multilateralis-
unabhängiger Prozess von mehreren hundert Organisa- mus. Es ist Zeit für ein ökologie- und menschengerechteres
tionen formiert, der die Vorbereitungskonferenz vom 26. Narrativ, das vor den enormen Herausforderungen der Zu-
bis 28. Juli in Rom mit einer alternativen Mobilisierung kunft bestehen kann.
herausfordern wird.
Betrachten wir den FSS-Prozess in den vier oben ge- Martin Wolpold-Bosien
nannten Schlüsselbereichen, zeigt sich im Wesentlichen,
dass der Gipfel in genau den Bereichen Schwächen zeigt, Der Autor leitet das Büro des CSM, der Plattform der
in denen eine Stärkung der zukünftigen Global Governance Zivilgesellschaft und Indigener Völker beim UN-Ausschuss für
für Ernährungssicherheit notwendig wäre: Welternährung (CFS) in Rom.
» Der FSS ist schwach beim Menschenrechtsansatz:
Von Anfang an waren die Organisationen der Rechte-
inhaberInnen und Risikogruppen in einer Nebenrolle; 1 HLPE (2020): Food Security and Nutrition – A Global Narrative
die über mehr als 25 Jahre aufgebauten Plattformen der Towards 2030.
sozialen Bewegungen, Zivilgesellschaft und Indigenen http://www.fao.org/3/ca9731en/ca9731en.pdf
Völker wurden weitgehend ignoriert.
2 http://www.csm4cfs.org/civil-society-indigenous-peoples-new-
» Der unangemessene Einfluss der konzernnahen Inter
cfs-voluntary-guidelines-food-systems-nutrition-fail-pave-way-
essensgruppen und Plattformen im bisherigen Prozess
profound-transformation/
ist deutlich erkennbar. 7 Mögliche Interessenkonflikte
werden nicht transparent gemacht, auch nicht in der 3 CSM (2021a): Policy response to COVID-19.
Scientific Group, dem wissenschaftlichen Beirat des FSS. http://www.csm4cfs.org/need-policy-response-covid-19/
» Rhetorik ohne Substanz: Zwar wird das FSS-Abschluss- HLPE (2020): Impacts of Covid-19 on food security and
dokument nach massiver Kritik von außen und von in- nutrition: developing effective policy responses to address the
nen Begriffe wie Menschenrechte und Agrarökologie hunger and malnutrition pandemic.
enthalten. Ihre Erwähnung bleibt aber kosmetisch. Sie http://www.fao.org/cfs/cfs-hlpe/issues-paper-covid19/en/
werden nicht durchdekliniert. Eine umfassende men- FAO (2020): The State of Food Security and Nutrition in the
schenrechtsbasierte, agrarökologische Transformation World (SOFI) 2020.
der industriell dominierten Ernährungssysteme ist nicht http://www.fao.org/publications/sofi/2020/en/
in Sicht. 4 World Food Programme (2021): Global Report on Food Crises –
» Multistakeholderismus statt inklusivem Multilatera 2021. https://www.wfp.org/publications/global-report-food-
lismus: Der FSS ist ein Paradebeispiel für diese pro- crises-2021
blematische Entwicklung. Es ist schwer zu verstehen, 5 https://www.devex.com/news/opinion-why-reinvent-the-wheel-
warum selbstbewusste Staaten einen solchen Verlust on-food-security-and-nutrition-99929
an Macht, Verantwortung und Kontrolle hinnehmen.
6 CSM (2021b): Key CSM and CFS communications on the United
Machtasymmetrien und Interessenkonflikte werden
Nations Food Systems Summit.
nicht bearbeitet. Eine menschenrechtliche Rechen-
http://www.csm4cfs.org/14024/
schaftspflicht kann unter solchen Umständen weder
klar zugeteilt noch effektiv gemessen werden. 7 Darunter: World Business Council for Sustainable Development
(WBCSD), Alliance for the Green Revolution in Africa (AGRA),
Kein Wunder, dass viele Bewegungen, Fachleute und auch Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN), World Economic
Regierungen befürchten, dass der Gipfel genutzt wird, um Forum (WEF), Scaling Up Nutrition (SUN), etc.
bisherige Errungenschaften inklusiver Governance-Ar- 8 Die unterschiedlichen Visionen für Transformation und
chitektur, wie sie im CFS etabliert wurden, zu schwächen Multilateralismus waren auch Gegenstand eines konstruktiven
und diffuse Multistakeholder-Modelle als Mittel politischer Dialogs zwischen der stellvertretenden UN Generalsekretärin
Steuerung voranzubringen. Dabei verschwimmen die Kon- und CSM zum FSS Ende April, http://www.csm4cfs.org/
turen zwischen Regierungen, Konzernen, Wissenschaft multilateralism-transformation-corporate-food-systems-
und Zivilgesellschaft. Die problematische Tragweite die- different-visions-different-pathways/
ses Multistakeholderismus-Ansatzes für die Steuerung von 9 CSM (2021c): Vision on Food Systems and Nutrition – An
Ernährungssystemen und das damit einhergehende Risiko Alternative to the CFS Voluntary Guidelines on Food Systems
für demokratisch legitimierte Entscheidungsprozesse und and Nutrition (VGFSYN).
inklusiven Multilateralismus in der UN dürfen nicht un- http://www.csm4cfs.org/wp-content/uploads/2016/02/EN-
terschätzt werden. 8 vision-VGFSyN.pdf
Wir schulden es unserer Zeit, dem Planeten und den
zukünftigen Generationen, eine ambitionierte und umfas-
sende agrarökologische, menschenrechtsbasierte Transfor-
mation der Ernährungssysteme einzuleiten. 9 Das gilt gerade
jetzt, wo die katastrophalen Konsequenzen von COVID-19
10 SchwerpunktSiamek Djamei/Unsplash
11 SCHRITTE FÜR
EINE ZUKUNFT
OHNE HUNGER
Welternährung 2030
Bis zum Jahr 2030 soll der Hunger der Vergangenheit angehören. Das hat
die Staatengemeinschaft 2015 im zweiten Ziel für nachhaltige Entwick-
lung (SDG) beschlossen. Diesem Ziel zum Trotz hungerten vier Jahre spä-
ter 34,5 Millionen Menschen mehr als zuvor. Die Prognosen der Vereinten
Nationen lassen vermuten, dass diese Zahl zwischen 2019 und 2030 von
690 Millionen auf 840 Millionen steigen könnte. Dabei ist unbestritten,
dass global derzeit ausreichend Lebensmittel zur Verfügung stehen.
D
ie weitaus größere Herausforderung ist es, al- chen, müsste auch auf den Äckern die Vielfalt zunehmen.
len Menschen nicht nur Zugang zu ausreichend Die Produktion von Obst, Gemüse, und Hülsenfrüchten
Kalorien, sondern zu einer abwechslungsreichen müsste deutlich steigen. Gleichzeitig sind umweltschädliche
und vielfältigen Ernährung zu ermöglichen. Die- Praktiken und Ernährungsweisen abzulösen, denn die heu-
ses Menschenrecht wird derzeit drei Milliarden Menschen tige Ernährungswirtschaft zerstört die Umwelt und heizt
verwehrt. Um die Vielfalt auf den Tellern möglich zu ma- das Klima an.
Forum Umwelt & Entwicklung – Rundbrief 2/ 2021 11„Nicht über uns,
sondern mit uns“
Lösungsansätze für eine Welt ohne Hunger wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
Bisherige Versuche, diese Probleme zu lösen, sind geschei- (BMZ) gezielt agrarökologische Ansätze fördern und
tert. Daher fordern 46 deutsche Organisationen im Positi- bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 einen Akti-
onspapier Welternährung 2030 ein Umsteuern in elf Schrit- onsplan vorlegen. Dabei ist entscheidend, dass die Pläne
ten. Der Schlüssel liegt in der menschenrechtsbasierten nicht hinter die zehn Prinzipien der Agrarökologie der
Bekämpfung der strukturellen Ursachen des Hungers. Den FAO zurückfallen.
betroffenen Menschen muss ermöglicht werden, Program-
me und Politikmaßnahmen als selbstbestimmte Akteure 3. Land umverteilen statt
mitzugestalten. Die Ungleichheit im Zugang zu Ressourcen Landkonzentration vorantreiben.
und Macht muss als zentraler Grund für den Hunger in der Die Landkonzentration hat in den letzten Jahren rasant
Welt auch vorrangig bekämpft werden. zugenommen. Das BMZ sollte daher der menschen-
Die Forderung an Bundesregierung und UN ist daher, rechtsbasierten Landpolitik wieder mehr Bedeutung
die globalen Ernährungssysteme grundlegend umzugestal- beimessen. Die Beschlüsse der UN (u. a. die Freiwilli-
ten. Sie müssen ökologisch, gerecht, gesund und demokra- gen Leitlinien für die verantwortungsvolle Regulierung
tisch werden. Dazu sind aus Sicht der 46 Organisationen von Eigentums-, Besitz- und Nutzungsrechten an Land,
aus den Bereichen Entwicklungszusammenarbeit, Umwelt, Fischgründen und Wäldern im Rahmen nationaler Er-
Ernährung und Landwirtschaft folgende elf Schritte not- nährungssicherheit und Artikel 17 der Erklärung der
wendig. Eine Übersicht der Forderungen ist hier zusam- Vereinten Nationen über die Rechte von Kleinbauern
mengetragen. Für Details lohnt sich der Blick in das Po- und -bäuerinnen und anderen Menschen, die in ländli-
sitionspapier. chen Regionen arbeiten [UNDROP]) müssen umgesetzt
werden. Landrechte müssen geschützt und legitime An-
1. Mit Menschenrechten gegen den Hunger statt sprüche auf Rückgabe oder Umverteilung unterstützt
Vereinnahmung durch Konzerne. werden. Der legitime Zugriff auf Ressourcen muss auch
Den Hungernden und Fehlernährten muss der Status für WanderhirtInnen erhalten werden. Die Finanzbe-
aktiv handelnder Subjekte gegeben werden. Der Slo- hörden müssen verhindern, dass Land als Kapitalanlage
gan lautet „Nicht über uns, sondern mit uns“. Gerade missbraucht wird.
die Rechte häufig marginalisierter Gruppen müssen
geschützt und gefördert werden. Dazu gehört einer- 4. Saatgutvielfalt statt (alte und neue) Gentechnik.
seits, die für das Recht auf Ernährung relevanten Men- Saatgut- und Patentgesetze können ErzeugerInnen da-
schenrechtsnormen anzuwenden und durchzusetzen. ran hindern, Saatgut zu erhalten, zu handeln und zu
Andererseits bedeutet es, die Einflussnahme mächtiger tauschen. Dabei stammen geschätzte 80 % des Saatguts
wirtschaftlicher Akteure zu begrenzen. Unter ande- im Globalen Süden aus bäuerlichen Saatgutsystemen.
rem sollte das Bundesministerium für Wirtschaftliche Daher muss das bäuerliche Recht auf Saatgut, wie es im
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) in seiner Saatgutvertrag der FAO und in UNDROP festgeschrie-
Förderung dazu robuste Schutzmaßnahmen gegen In- ben ist, konsequent umgesetzt werden. Die Pflanzen-
teressenkonflikte, menschenrechtliche Folgenabschät- züchtung ist als gesamtgesellschaftliche Aufgabe wahr-
zungen und einen effektiven Beschwerdemechanismus zunehmen. Für die alte und neue Gentechnik muss das
für Betroffene einführen. Vorsorgeprinzip gelten.
2. Agrarökologie statt Agribusiness fördern. 5. Agrarökologische Klimaanpassung statt
Die Interessen der lokalen kleinbäuerlichen Erzeuge- Klima anheizen durch Agribusiness.
rInnen, ArbeiterInnen und KonsumentInnen müssen Durch die Umwandlung von Land für die Produktion
Vorrang vor Profitinteressen der Agrar- und Lebens- von Futtermitteln und anderen landintensiven Roh-
mittelindustrie haben. Zum Aufbau ökologischer, ge- stoffen, die Produktion synthetischer Mineraldünger
rechter und widerstandsfähiger lokaler und regionaler und Pestizide oder den Energieverbrauch für Lage-
Ernährungssysteme sollte das Bundesministerium für rung und Handel trägt die konventionelle Landwirt-
12 Schwerpunktschaft erheblich zum Klimawandel bei. Dabei könnte ren Handlungsspielraum, gerade während der Corona-
eine agrarökologische Bewirtschaftung einen aktiven Pandemie. Deutschland und die internationale Gemein-
Beitrag zum Klimaschutz leisten. Die Bundesregierung schaft müssen diesen Ländern durch ein Aussetzen der
sollte die Agrarökologie daher zum zentralen Mittel des Schuldendienstzahlungen bis 2022 und Schuldenerlasse
Klimaschutzes und der Klimaanpassung in der Land- die Möglichkeit geben, für ihre BürgerInnen zu sorgen.
wirtschaft machen. Langfristig muss unter dem Dach der UN ein faires und
geordnetes Staatsinsolvenzverfahren etabliert werden.
6. Menschenwürdige Arbeitsbedingungen statt
Hungerlöhne und Ausbeutung. 10. Rechte von Frauen stärken, statt
Weltweit leiden viele LandarbeiterInnen unter katast- patriarchale Strukturen stützen.
rophalen Arbeits- und Lebensbedingungen. Versuche Die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ist im
dieser Menschen, sich zu organisieren, werden oft un- Kampf gegen den Hunger elementar. Doch patriarcha-
terdrückt. Das BMZ sollte daher seinen Einsatz für faire le Strukturen erschweren oder verhindern die Teilhabe
Löhne in der Landwirtschaft durch den Dialog mit loka- von Frauen und machen deren Arbeit unsichtbar. Ob-
len Gewerkschaften und die Unterstützung der Arbeit- wohl das BMZ dem Gender Mainstreaming verpflichtet
nehmerInnenrechte vor Ort ergänzen. In Deutschland ist, sind in den letzten Jahren die Mittel für Projekte
müssen ein starkes Lieferkettengesetz und die Umset- gesunken, die schwerpunktmäßig Frauen fördern. Das
zung der EU-Richtlinie zum unlauteren Wettbewerb sollte sich wieder ändern. Auf internationaler Ebene
einen Beitrag leisten. Als besonders hohes Risiko für sollte die Regierung sich für den gleichberechtigten
ArbeiterInnen müssen hochgefährliche Pestizide, der Zugang von Frauen zu Ressourcen wie Land, Wasser,
Liste des Pestizid-Aktions Netzwerks (PAN) folgend, Saatgut, Wissen und Technologie einsetzen.
auf europäischer und internationaler Ebene schrittweise
verboten werden. 11. Soziale Sicherung ausbauen, statt
Bedürftige hungern lassen.
7. Nachhaltige, lokale und regionale Für viele Menschen, die zu wenig verdienen, die im
Ernährungssysteme statt Abhängigkeit von Arbeitsleben diskriminiert werden oder aus anderen
krisenanfälligen Weltagrarmärkten. Gründen nicht arbeiten können, ist ausreichende Nah-
Die Verwerfungen der Corona-Krise haben gezeigt, wie rung nicht bezahlbar. Die Bekämpfung des Hungers ist
gefährlich es ist, wenn Ernährungssysteme von Impor- daher auf die Schaffung rechtebasierter, universaler so-
ten abhängen. Die Politik sollte die Fokussierung auf den zialer Sicherungssysteme angewiesen. Die Realisierung
Export aufgeben und Anreize für lokale und ökologische des sozialen Basisschutzes in den 57 Ländern mit den
Wertschöpfungsketten setzen, die den Zugang zu einer niedrigsten Einkommen würde nur 0,23 % des globalen
ausgewogenen Ernährung sichern. Die Handelspolitik Bruttoinlandsprodukts kosten. Die deutsche Politik soll-
muss dieses Ziel unterstützen. Gleichzeitig muss die te die Einrichtung dieser Systeme durch die finanzielle
Marktmacht übermächtiger Konzerne gebrochen wer- Förderung, technische Unterstützung und eine Initiative
den. Dazu bedarf es rechtlicher Grundlagen zur Regu- für einen globalen Fonds unterstützen. Dabei sollte die
lierung und Entflechtung. Möglichkeit genutzt werden, auf Maßnahmen der Not-
und Flüchtlingshilfe aufzubauen.
8. Gerechter Agrarhandel statt
neoliberale Handelspolitik. Das Fazit lautet: Der Weg zum Ende des Hungers beginnt
Die internationale Handelspolitik ist zu stark an den mit nur 11 Schritten.
Interessen der großen Konzerne ausgerichtet. Die Schaf-
fung von Sonderklagerechten verdeutlicht dies. Anstelle Lutz Depenbusch
der Verkürzung auf eine Dichotomie zwischen Freihan-
del und Protektionismus braucht es eine echte Debatte Der Autor ist Referent für Landwirtschaft und Entwicklung
über die Ausgestaltung des Handels. Dabei müssen die beim Bischöflichen Hilfswerk MISEREOR.
planetarischen Grenzen und die Menschen- beziehungs-
weise Arbeitsrechte respektierte werden. In Europa wie
auch im Globalen Süden darf der Handel eine solidari-
sche und umweltgerechte Regionalisierung der Ernäh- MISEREOR et al.
rungssysteme nicht untergraben. (2020): Positionspapier
Welternährung 2030: 11
Schritte für eine Zukunft
9. Vorrang der Menschenrechte vor Profitgier, ohne Hunger. Aachen.
Nahrungsmittelspekulation und Schuldendienst.
Die zweite EU-Richtlinie über Märkte für Finanzinstru- https://www.misereor.de/
fileadmin/publikationen/
mente (MiFID II) sollte die Spekulation mit Nahrungs-
positionspapier-
mitteln regulieren, doch sie hat zu viele Schlupflöcher.
welternährung-2030_01.pdf
Diese müssen geschlossen und niedrigere Positionsli-
mits festgelegt werden. Auf zwischenstaatlichem Niveau
begrenzt der kritische Schuldenstand vieler Länder ih-
Forum Umwelt & Entwicklung – Rundbrief 2/ 2021 13Sie können auch lesen