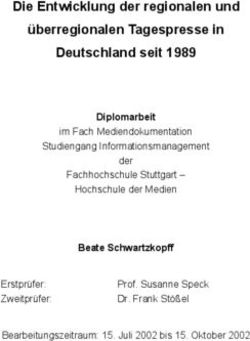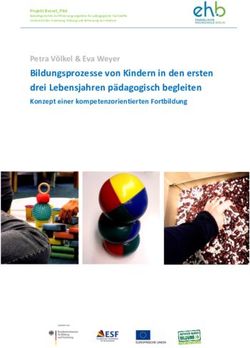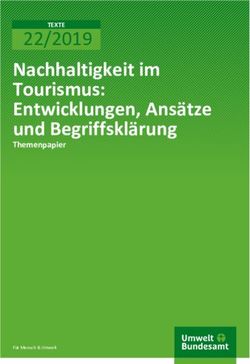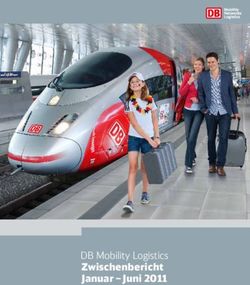Nachhaltigkeitsstrategie - Essener
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
IMPRESSUM
Herausgeber / Copyright
Stadt Essen
Porscheplatz 1
45121 Essen
E-Mail: info@essen.de
Ansprechperson
Koordination Nachhaltigkeitsstrategie
Marie Syberg | Rathaus, Porscheplatz 1 | 45121 Essen
marie.syberg@gha.essen.de
Projektleitung „Global Nachhaltige Kommune in NRW“ (GNK NRW)
Dr. Klaus Reuter,
Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V.
Dr. Till Winkelmann,
Servicestelle Kommunen in der Einen Welt von Engagement Global
Landesarbeitsgemeinschaft Agenda 21 NRW e.V. (LAG 21 NRW)
Deutsche Straße 10 | 44339 Dortmund
0231-9369600
www.lag21.de | info@lag21.de
SKEW - Servicestelle Kommunen in der Einen Welt
von Engagement Global gGmbH
Friedrich-Ebert-Allee 40 | 53113 Bonn
www.service-eine-welt.de | info@service-eine-welt.de
Umsetzung und Textgestaltung
LAG 21 NRW
Gestaltung
yella park, Aachen
Druck
Druck & Verlag Kettler GmbH, Bönen/Westfalen
Für den Inhalt dieser Publikation ist allein die LAG 21 NRW e.V. verantwortlich;
die hier dargestellten Positionen geben nicht den Standpunkt von Engage-
ment Global oder des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit und Entwicklung wieder.
Die vorliegende Essener Nachhaltigkeitsstrategie stellt das Ergebnis der
Teilnahme am Projekt „Global Nachhaltige Kommune in NRW“ dar und er-
langt ihre Gültigkeit erst mit der positiven Beschlussfassung durch den Rat.
Essen im August 2021
mit ihrer mit Mitteln des
in Kooperation mit unterstützt durchEssener Nachhaltigkeitsstrategie Inhalt
Inhalt
Vorwort 5
1 Kommunales Kurzportrait der Stadt Essen 6
2 Einleitung 8
3 Projektkontext 10
3.1 Grundprinzipien einer Nachhaltigen Entwicklung 11
3.2 Agenda 2030 und Globale Nachhaltigkeitsziele 12
3.3 Nachhaltige Entwicklung in der EU 13
3.4 Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 13
3.5 Nachhaltigkeitsstrategie Nordrhein-Westfalen 14
4 Entwicklungsprozess der Essener Nachhaltigkeitsstrategie 16
4.1 Arbeitsgremien 18
4.2 Wissenschaftliche Bestandsaufnahme 20
4.3 Themenfelder einer nachhaltigen Kommunalentwicklung 21
4.4 Struktur des Zielsystems 24
4.5 Formeller Beschluss der Nachhaltigkeitsstrategie 25
5 Zielsystem der Essener Nachhaltigkeitsstrategie 26
5.1 Präambel 28
5.2 Themenfeld 1 · Lebenslanges Lernen & Kultur 30
5.3 Themenfeld 2 · Soziale Gerechtigkeit &
zukunftsfähige Gesellschaft 34
5.4 Themenfeld 3 · Klima, Ressourcen & Mobilität 38
5.5 Themenfeld 4 · Globale Verantwortung & Eine Welt 43
5.6 Themenfeld 5 · Wohnen & Nachhaltige Quartiere 45
5.7 Gesamtübersicht der Bezüge zur Agenda 2030 48
6 Ausblick und Verstetigung des Strategieprozesses 50
6.1 Umsetzung und Monitoring 51
6.2 Evaluation und Weiterentwicklung 51
7 Anhang 52
7.1 Glossar 53
7.2 Abkürzungsverzeichnis 55
7.3 Literaturverzeichnis 56
7.4 Abbildungsverzeichnis 57Essener Nachhaltigkeitsstrategie Vorwort Vorwort Liebe Leserinnen und Leser, Nachhaltigkeit ist das zentrale Handlungsprinzip des 21. Jahrhunderts. Bei allen Vorhaben oder Zielsetzungen ist es für uns heutzutage wichtig, die Frage zu beant- worten, wie klimaschonend, umweltverträglich, sozial- und wirtschaftsverträglich ein geplantes Projekt ist. Zur Orientierung und als Grundlage für die Erarbeitung eigener Antworten ha- ben die Vereinten Nationen internationale Nachhaltigkeitsziele – die „Sustainable Development Goals“ – formuliert. Entsprechend dem Motto „Global denken – lokal handeln“ kommt den Kommunen durch ihre Nähe zu den Bürgerinnen und Bür- gern bei der Erreichung der Ziele eine zentrale Rolle zu. Die Stadt Essen fühlt sich als „Grüne Hauptstadt Europas – Essen 2017“ beson- ders verpflichtet, sich für Nachhaltigkeit zu engagieren. Die Auszeichnung ist kein Lorbeerkranz, auf dem sie sich ausruhen kann, im Gegenteil, für uns gilt: Einmal Grüne Hauptstadt – immer Grüne Hauptstadt. Deshalb ist die Stadt Essen seit Mai 2019 Modellkommune im Rahmen des Projekts „Global Nachhaltige Kommune NRW“. Ziel ist die Entwicklung einer integrierten Nachhaltigkeitsstrategie, koordi- niert durch unsere „Grüne Hauptstadt Agentur“, in Zusammenarbeit mit dem Büro für „Europaangelegenheiten, Internationales und nachhaltige Entwicklung“. Die Stadt Essen entwickelt damit erstmalig ein konkretes, differenziertes, lokales Zielsystem für nachhaltige Entwicklung im Kontext der global gültigen Nach- haltigkeitsziele der UN. Nachhaltigkeit ist eine Gemeinschaftaufgabe. Deswegen bindet die Strategie nicht nur die Stadtverwaltung selbst, sondern die gesamte Stadtgesellschaft mit ein. Für eine Großstadt wie Essen ist die Entwicklung einer solchen Strategie ein anspruchsvoller Prozess, an dem alle Geschäftsbereiche der Verwaltung sowie ein Beirat mit über 60 Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Zivilgesellschaft, Wissenschaft und Wirtschaft beteiligt sind. Unser Handeln in Essen hat Auswirkungen auf das Heute und die Zukunft. Wir alle sollten unsere Verantwortung dabei ernst nehmen. Mit freundlichen Grüßen Ihr Thomas Kufen Oberbürgermeister der Stadt Essen
6 Essener Nachhaltigkeitsstrategie Kurzportrait der Stadt Essen
1 Kommunales
Kurzportrait der
Stadt Essen
Die Stadt Essen zeigt, wie die Transformation von einer grauen Industrieland-
schaft zur drittgrünsten Stadt Deutschlands erfolgreich gestaltet werden kann.
Dafür wurde sie als Grüne Hauptstadt Europas – Essen 2017 ausgezeichnet. Die
Stadt Essen war schon immer im Wandel: Mit ihrer kommunalen Nachhaltig-
keitsstrategie stellt die Stadtgesellschaft gemeinsam die Weichen für eine nach-
haltige Zukunft.
Mit rund 590.000 Einwohner*innen ist Essen die zehntgrößte Stadt Deutschlands
und liegt inmitten der Metropole Ruhr, die mit etwa 5,2 Mio. Menschen nach Lon-
don und Paris den drittgrößten Ballungsraum Europas bildet. So zentral gelegen
in Europa stellt Essen einen bedeutenden Industrie- und Dienstleistungs- sowie
Messe- und Kongressstandort dar. Den Wirtschaftsstandort Essen charakteri-
siert ein guter Mix aus Dax-Konzernen, Großunternehmen sowie Mittelstand und
Handwerk. Etwa 81 Prozent aller Erwerbstätigen arbeiten im Dienstleistungs-
sektor. Die hohe Anzahl an Arbeitsplätzen bringt täglich rund 156.000 Berufs-
pendler*innen in die Stadt.
Essen ist außerdem ein bedeutender Universitätsstandort. An der 2003 fusio-
nierten Universität Duisburg-Essen studieren rund 43.000 Student*innen. Darü-
ber hinaus ist die Stadt kulturelle Hochburg in der Metropole Ruhr. Das Museum
Folkwang und das Red Dot Design Museum bieten international beachtete Ein-
blicke in die Welt von Kunst und Design. Das Aalto-Theater und die Philharmo-
nie sind repräsentative Spielstätten für Oper, Ballett und Konzerte. Vor diesem
Hintergrund ist Essen 2010 zur Kulturhauptstadt Europas ernannt worden und
repräsentierte die gesamte Metropole Ruhr.
Bis heute prägt die Vergangenheit als Kohle- und Stahlstadt die städtische
Entwicklung. Der Krupp-Gürtel ist mit einer Gesamtfläche von 230 Hektar eine
der größten Konversionsflächen Deutschlands und Standort der thyssenkrupp
Hauptverwaltung. Das Weltkulturerbe der UNESCO Zeche Zollverein symboli-
siert als Wahrzeichen der Stadt die Industriekultur, ebenso wie die Villa Hügel
der Familie Krupp und die Gartenstadt Margarethenhöhe.
Der Titel Grüne Hauptstadt Europas – Essen 2017 zeichnet die erfolgreiche
Transformation der Stadt „von grau zu grün“ aus. Ob Schwimmen im Baldeney-
see, die Renaturierung der Emscher, das Projekt ESSEN.Neue Wege zum Was-
ser, der Radschnellweg RS1 oder Wanderwege in den Ruhrhöhen: Alles mitten
in der Stadt. Auch die Anzahl von Beschäftigten in der Umweltwirtschaft steigt
stetig. Essen ist eine Blaupause für Kommunen, die trotz schwieriger Haushalts-
lage den Wandel zu einer modernen, zukunftsfähigen und lebenswerten Stadt
ermöglichen wollen.Essener Nachhaltigkeitsstrategie Kurzportrait der Stadt Essen 7
Blick über die Stadt Essen / © Johannes Kassenberg
7
6
„Essen – mitten in Europa“: Nachhaltige Entwicklung wird in Essen über Stadt-
grenzen hinaus realisiert, etwa in Netzwerken wie dem Konvent der Bürger-
5
meister*innen, dem Klima-Bündnis, dem European Green Capital Network, IC-
4
LEI – Kommunen für Nachhaltigkeit, EUROCITIES, der Urban Transition Alliance,
3
dem Chefdialog Nachhaltigkeit oder als Fairtrade-Stadt. Jährlich fließen durch-
2
schnittlich 35,4 Millionen Euro EU-Fördermittel nach Essen und tragen zu einer
nachhaltigen Stadtentwicklung bei. In Projektpartnerschaften -in der Mongolei
1
und im Nordirak- setzt sich Essen dafür ein, Gesundheitssysteme krisensicher
zu gestalten und übernimmt so globale Verantwortung.
2019 setzt Essen mit der Mitzeichnung der Musterresolution „2030-Agenda für
Nachhaltige Entwicklung: Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten“ des
Deutschen Städtetags das Signal, die 17 Globalen Nachhaltigkeitsziele der Ver-
einten Nationen auch zu ihren eigenen zu machen und vor Ort umzusetzen. Als
logischer nächster Schritt erfolgte die Teilnahme am Projekt „Global Nachhal-
tige Kommune NRW“ (GNK) zur Entwicklung der kommunalen Nachhaltigkeits-
strategie.
Einmal Grüne Hauptstadt – immer Grüne Hauptstadt: Essen ruht sich nicht auf
Fortschritten aus, sondern arbeitet fortlaufend für eine nachhaltige Zukunft.
Essen versteht sich im Projektkontext GNK NRW als Modellkommune für Groß-
städte, die eine Vielzahl unterschiedlicher Ziele in Einklang bringen sowie Lö-
sungen für die globalen Herausforderungen unserer Zeit suchen bzw. umsetzen
und damit den Weg für die nachhaltige Transformation der Städte ebnen.8 Essener Nachhaltigkeitsstrategie Einleitung
2 Einleitung
“Be a global citizen. Act with „Seien Sie globale Bürgerinnen und Bürger. Handeln Sie
passion and compassion. Help
us make this world safer and mit Leidenschaft und Mitgefühl. Helfen Sie uns, die Welt
more sustainable today and for
the generations that will follow
sicherer und nachhaltiger zu gestalten – sowohl heute als
us. That is our moral responsi- auch für nachfolgende Generationen. Dies ist unsere mo-
bility."
ralische Verantwortung.“
(Ban Ki-Moon, UN-Generalsekretär von 2007 – 2016)
Im September 2015 verabschiedete die Vollversammlung der Vereinten Nationen
(engl. United Nations, UN) mit der Agenda 2030 und ihren Globalen Nachhaltig-
keitszielen (engl. Sustainable Development Goals, abgekürzt SDGs) ein univer-
selles Zielsystem, um eine weltweite Transformation in Richtung einer Nachhal-
tigen Entwicklung anzustoßen. Das Zielsystem besteht aus 17 Hauptzielen sowie
169 Unterzielen und stellt erstmals einen gemeinsamen Bezugsrahmen für alle
UN-Mitgliedstaaten dar.
Für die erfolgreiche Umsetzung der Agenda 2030 müssen alle politischen
Handlungsebenen – international, national, regional und kommunal – einbezo-
gen werden. In Deutschland sind Bund, Länder und Kommunen deshalb auf-
gefordert, die globalen Ziele auf ihre jeweilige Ebene „herunterzubrechen“. Vor
diesem Hintergrund wurde die Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie (DNS) über-
arbeitet und ihre inhaltliche Struktur an den 17 Globalen Nachhaltigkeitszielen
ausgerichtet. Auch die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes Nordrhein-West-
falen (NHS NRW) orientiert sich an der Agenda 2030 und stellt entsprechende
Bezüge zu den SDGs dar.
In Wissenschaft, Politik und Praxis herrscht weitgehend Einigkeit darüber, dass
die kommunale Ebene eine zentrale Rolle für die erfolgreiche Umsetzung der
SDGs spielt. So sieht die Agenda 2030 die Kommunen in einer Schlüsselposition
und fordert eine enge Einbindung lokaler Behörden. Auf der konkreten Umset-
zungsebene vor Ort werden entscheidende Weichen für die Erreichung vieler
SDG-Unterziele gestellt. Vor diesem Hintergrund haben bereits rund 191 deut-
sche Kommunen die Musterresolution „2030 – Agenda für Nachhaltige Entwick-
lung: Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten“ (Deutscher Städtetag,
Rat der Gemeinden und Regionen Europas/Deutsche Sektion) unterzeichnet, so
auch die Stadt Essen im Jahr 2019.
Im Projekt „Global Nachhaltige Kommune NRW“ (GNK NRW) werden ausgewähl-
te Modellkommunen bei der Entwicklung ihrer kommunalen Nachhaltigkeits-
strategie von der Landesarbeitsgemeinschaft 21 NRW begleitet. Das Projekt
GNK NRW wurde von der Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW)
von ENGAGEMENT GLOBAL in Zusammenarbeit mit der LAG 21 NRW im Auftrag
des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
umgesetzt. Die Stadt Essen war eine der ausgewählten Modellkommunen in derEssener Nachhaltigkeitsstrategie Einleitung 9
Gruppenfoto zur Auftaktveranstaltung im Projekt GNK NRW am 27.06.2019 in Düsseldorf /
© LAG 21 NRW
7
Projektlaufzeit GNK NRW von Juni 2019 bis März 2021.
6
5
• In der vorliegenden Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Essen werden in
4
Kapitel 3 zunächst der Projektkontext sowie allgemeine Grundlagen er-
3
läutert. Hierzu werden die Grundprinzipien einer Nachhaltigen Entwick-
2
lung, die Agenda 2030, die DNS und die NHS NRW vorgestellt.
• Nachfolgend wird in Kapitel 4 auf das Modell zur Entwicklung und
1
Umsetzung von kommunalen Nachhaltigkeitsstrategien inklusive der
einzelnen Elemente und der jeweiligen Prozessschritte eingegangen.
• Kapitel 5 stellt das Kernstück der Nachhaltigkeitsstrategie dar. Es
beinhaltet das Zielsystem der Nachhaltigkeitsstrategie zu priori-
sierten Themenfeldern. Nach einer einleitenden Präambel werden zu
jedem Themenfeld 1.) Leitlinie, 2.) strategische Ziele und 3.) operative
Ziele vorgestellt. Anschließend werden die inhaltlichen Bezüge zur
Agenda 2030 dargestellt.
• Kapitel 6 geht abschließend auf den weiteren kommunalspezifischen
Prozessverlauf und die Verstetigung der Strategie ein.3
10 Essener Nachhaltigkeitsstrategie Projektkontext
3 Projektkontext
Die Entwicklung der Essener Nach- Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie sowie
haltigkeitsstrategie beruht auf den die Nachhaltigkeitsstrategie des Landes
Grundprinzipien einer nachhaltigen NRW systematisch berücksichtigt. Eine
Entwicklung. Darüber hinaus ist die Global Nachhaltige Kommune leistet
vertikale Integration der verschiedenen somit insgesamt einen Beitrag für die
politischen Handlungsebenen relevant. Umsetzung internationaler, nationaler
Bei der Entwicklung der kommuna- und regionaler Nachhaltigkeitsziele im
len Nachhaltigkeitsstrategien werden Sinne einer nachhaltigen Stadtentwick-
entsprechend die Zielsetzungen auf lungspolitik, die sektorenübergreifendes
globaler Ebene (Agenda 2030), die Denken und Handeln fördert.
Europäische Nachhaltigkeitspolitik, die
Überblick
3.1 ––– Grundprinzipien einer Nachhaltigen Entwicklung 9
3.2 ––– Agenda 2030 und Globale Nachhaltigkeitsziele 10
3.3 ––– Nachhaltige Entwicklung in der EU 12
3.4 ––– Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie 13
3.5 ––– Nachhaltigkeitsstrategie Nordrhein-Westfalen 14Essener Nachhaltigkeitsstrategie Projektkontext 11
3.1 Grundprinzipien einer Nachhaltigen Entwicklung
Die Inhalte der Nachhaltigkeitsstrategie orientieren sich an drei Grundprinzi-
pien: 1.) Starke Nachhaltigkeit, 2.) Generationengerechtigkeit sowie 3.) Men-
schenrechte.
Starke Nachhaltigkeit
Im Konzept der Starken Nachhaltigkeit finden wirtschaftliches und sozia-
les Handeln innerhalb der Ökosystemgrenzen der Erde statt. Die natürlichen
Ressourcen und die Umwelt bilden somit die Grundlage für alle menschlichen
Entwicklungsfelder inklusive der entsprechenden ökonomischen und sozialen
Subsysteme. Abbildung 1 zeigt auf, wie das anthropogene Handeln das Natur-
andel
kapital negativ beeinflusst bzw. inwiefern die natürlichen Planetaren Ökologi-
schen Grenzen (engl. planetary boundaries) überschritten werden. Vier der neun
Neue Substanzen definierten planetaren Belastungsgrenzen (Klimawandel, Biodiversitätsverlust,
(Chemikalien) Stickstoffkreislauf und Flächennutzung)1 werden bereits überschritten. Diese
Überbeanspruchung bedroht mittel- bis langfristig die menschlichen Lebens-
? grundlagen.
Stratosphärischer
Klimawandel
Ozonabbau Biosphären-
7
Integrität genetische
Vielfalt Neue Substanzen
6
funktionale (Chemikalien)
Vielfalt
5
?
? ?
4
3
Atmosphärische Stratosphärischer
Flächennutzung
Aerosolbelastung Ozonabbau
2
1
Ozeanversauerung
?
deutliche Überschreitung der planetaren Süßwassernutzung Atmosphärische
Belastungsgrenzen (hohes Risiko) Aerosolbelastung
Überschreitung der planetaren
Belastungsgrenzen (steigendes Risiko)
Einhaltung der planetaren Grenzen (sicher) Phosphor
Stickstoff Ozeanversauerung
? noch nicht quantifiziert Biogeochemische Ströme
deutliche Überschreitung der planetaren
Belastungsgrenzen (hohes Risiko)
Überschreitung der planetaren
Belastungsgrenzen (steigendes Risiko)
Abbildung 1: Die Planetaren Ökologischen Grenzen / © LAG 21 NRW nach Steffen et al. 2
Einhaltung der planetaren Grenzen (sicher)
? noch nicht quantifiziert
Generationengerechtigkeit
Der Begriff der Nachhaltigen Entwicklung ist eng mit jenem der Generationenge-
rechtigkeit verbunden. Die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung (WCED)
hat 1987 in ihrem wegweisenden „Brundtland-Bericht“ Nachhaltige Entwicklung
definiert als eine „[…] Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befrie-
digt, ohne zu riskieren, dass künftige Generationen ihre eigenen Bedürfnisse
nicht befriedigen können.“ Damit ist die heutige Generation in der Verantwor-
1 vgl. Steffen et al. (2015) tung, im Interesse der Perspektiven späterer Generationen ihren Ressourcen-
2 Steffen et al. (2015) verbrauch entsprechend zu gestalten und anzupassen.12 Essener Nachhaltigkeitsstrategie Projektkontext
Menschenrechte
Die allgemeinen Menschenrechte bilden die Grundlage demokratischer Rechts-
systeme. Es handelt sich um universelle Grundrechte, die allen Menschen zuste-
hen. Die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen haben diese Rechte in der Allge-
meinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 verabschiedet.3 In den meisten
Staaten haben sie Verfassungscharakter, so auch in Deutschland. Im Kontext der
Agenda 2030 hat insbesondere der universelle Charakter der Menschenrech-
te konzeptionelle Bedeutung. Denn die UN-Mitgliedstaaten haben die Globalen
Nachhaltigkeitsziele explizit am Prinzip „Niemanden zurücklassen“ orientiert.
3.2 Agenda 2030 und Globale Nachhaltigkeitsziele
Am 25. September 2015 verabschiedeten die Regierungschef*innen der UN-Mit-
gliedsstaaten ein global gültiges Zielsystem: „Transformation unserer Welt: die
Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung“ mit den 17 UN-Nachhaltigkeitszie-
len (Sustainable Development Goals, kurz SDGs).4 Das Zielsystem beinhaltet 17
Hauptziele (goals, siehe Abbildung 2) und 169 Unterziele (targets). Die Zielerrei-
chung soll anhand von rund 230 Indikatoren gemessen werden, die von einer Ar-
beitsgruppe, bestehend aus Fachorganisationen und Expert*innen der Mitglieds-
staaten, erarbeitet wurden. Die Globalen Nachhaltigkeitsziele bilden erstmals für
alle Staaten einen gemeinsamen Bezugsrahmen und sind auch in Deutschland für
Bund, Länder und Kommunen handlungsleitend.
Im Jahr 2016 haben erstmals Mitgliedstaaten auf UN-Ebene freiwillig über die
Umsetzung der Agenda 2030 Bericht erstattet, darunter auch die Bundesrepublik
Deutschland. Im Rahmen des sogenannten „Hochrangigen Politischen Forums
für Nachhaltige Entwicklung“ der UN legen jährlich verschiedene UN-Mitglieds-
staaten einen entsprechenden Bericht vor. Seit 2018 veröffentlichen weltweite
Pionierkommunen (u.a. die Städte Bonn und Mannheim) freiwillige Berichte zur
3 UN-Generalsversammlung (1948)
Umsetzung der Agenda 2030 auf der kommunalen Ebene an die UN – sogenannte
4 UN-Generalversammlung (2015) Voluntary Local Reviews (VLR).
Abbildung 2: Die 17 Globalen Nachhaltigkeitsziele / © United NationsEssener Nachhaltigkeitsstrategie Projektkontext 13
3.3 Nachhaltige Entwicklung in der EU
Reflexionspapier der Europäischen Kommission
Als Reaktion auf die Agenda 2030 hat die Europäische Kommission Anfang 2019
das Reflexionspapier „Auf dem Weg zu einem nachhaltigen Europa bis 2030“
verabschiedet.5 Darin werden zentrale Herausforderungen, vor denen Europa
steht, bewertet und mögliche Zukunftsszenarien dargestellt. Zu den wesent-
lichen Grundlagen für eine nachhaltige Zukunft werden folgende Themenbe-
reiche identifiziert: ein Übergang von der linearen zur Kreislaufwirtschaft; eine
nachhaltige Ausrichtung der Landwirtschaft und des Lebensmittelsystems; eine
zukunftssichere, kohlenstoffarme Gestaltung der Energieversorgung, Gebäude
und Mobilität; die Sicherstellung einer sozial gerechten Nachhaltigkeitswende;
der Schutz der biologischen Vielfalt und der Ökosysteme sowie die Bekämpfung
des Klimawandels. Das Reflexionspapier führt das Projekt GNK als europäi-
sches Best-Practice-Beispiel für SDG 11 („Nachhaltige Städte und Gemeinden“)
auf.
Europäischer „Green Deal“
Ende 2019 stellte die Europäische Kommission den europäischen „Green Deal“
als integralen Bestandteil zur Umsetzung der der Agenda 2030 vor.6 Der „Green
7
Deal“ umfasst einen Fahrplan zur Umgestaltung der EU-Wirtschaft für eine
6
nachhaltige Zukunft. Er stellt als übergeordnetes Ziel auf, Europa zum ersten
klimaneutralen Kontinent zu machen. Bis 2050 sollen in der EU die Netto-Emis-
5
sionen von Treibhausgasen auf null reduziert werden. Dieses Ziel wurde im
4
Frühjahr 2020 in einem Vorschlag für ein europäisches Klimagesetz verankert.
3
Zur Finanzierung kündigte die Kommission an, eine Billion Euro zu mobilisieren.
2
3.4
1
Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie
Die erste nationale Nachhaltigkeitsstrategie für Deutschland legte die Bun-
desregierung im Jahr 2002 vor. Seit 2004 wird die Strategie in Form von Fort-
schrittsberichten alle vier Jahre regelmäßig weiterentwickelt. Alle zwei Jahre
dokumentieren zudem Indikatorenberichte des Statistischen Bundesamtes die
Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie. Vor dem Hintergrund der nationa-
len Umsetzung der globalen Agenda 2030 verabschiedete die Bundesregierung
Anfang des Jahres 2017 eine umfassend überarbeitete Neuauflage mit dem Titel
„Deutsche Nachhaltigkeitsstrategie“ (DNS).
Mit der Verabschiedung der DNS hat die Bundesregierung die Globalen Nach-
haltigkeitsziele der Agenda 2030 als zentrales Strukturelement für die Nachhal-
tigkeitsstrategie auf Bundesebene eingeführt. So entsprechen die 17 nationalen
Ziele den globalen Zielsetzungen.7
Die DNS zielt auf eine wirtschaftlich leistungsfähige, sozial ausgewogene und
ökologisch verträgliche Entwicklung ab, wobei die „planetaren Belastungsgren-
zen“8 zusammen mit der „Orientierung an einem Leben in Würde für alle“ die
5 Europäische Kommission
(2019a) absolute äußere Beschränkung vorgeben. Die Strategie sieht Maßnahmen zur
6 Europäische Kommission Umsetzung der SDGs auf drei Ebenen vor: Maßnahmen mit Wirkung in Deutsch-
(2019b)
7 Vgl. Bundesregierung (2017)
land, Maßnahmen durch Deutschland mit weltweiten Wirkungen sowie Maßnah-
8 Vgl. Steffen et al. (2015) men mit Deutschland im Rahmen der Zusammenarbeit mit anderen Ländern. Im14 Essener Nachhaltigkeitsstrategie Projektkontext
Frühjahr 2021 wurde die vom Bundeskabinett beschlossene Aktualisierung der
DNS veröffentlicht. Das Projekt GNK wurde vom Staatssekretärsausschuss der
Bundesregierung als Leuchtturmprojekt 2018 zur Deutschen Nachhaltigkeits-
strategie ausgezeichnet.
3.5 Nachhaltigkeitsstrategie Nordrhein-Westfalen
Neben der Bundesregierung verfügt die große Mehrzahl der Bundesländer über
eigene Nachhaltigkeitsstrategien. Die nordrhein-westfälische Landesregierung
hat erstmals im Juni 2016 eine Nachhaltigkeitsstrategie für NRW (NHS NRW) be-
schlossen. Diese war die erste Strategie eines Bundeslandes, welche die globale
Agenda 2030 und die SDGs systematisch berücksichtigt. Sie wurde im Rahmen
einer breiten öffentlichen Konsultation diskutiert. Im September 2020 wurde eine
umfangreiche Aktualisierung der NHS NRW durch einen Kabinettsbeschluss der
Landesregierung verabschiedet.9 Über den Fortschritt der Umsetzung der NHS
NRW soll einmal pro Legislaturperiode online Bericht erstattet werden.
9 Landesregierung NRW (2020)Essener Nachhaltigkeitsstrategie Projektkontext 15
Übersicht der 30 Modellkommunen
des Projekts GNK NRW (erste und
zweite Projektlaufzeit)
7
6
5
4
3
2
1
GNK NRW Kommunen
der ersten Projektlaufzeit
GNK NRW Kommunen
der zweiten Projektlaufzeit
Abbildung 3: Die 30 Modellkommunen des Projektes GNK NRW / © LAG 21 NRW4
16 Essener Nachhaltigkeitsstrategie Entwicklungsprozess
4 Entwicklungsprozess
der Essener Nachhaltig-
keitsstrategie
Das folgende Kapitel skizziert die stellung der Aufbauorganisation und
Arbeitsschritte, die der Erarbeitung des Projektablaufs sowie eine Darstel-
der kommunalen Nachhaltigkeits- lung der Ergebnisse der Bestandsauf-
strategie der Stadt Essen zugrunde nahme und der daraus resultierenden
liegen. Das Kapitel beinhaltet die Vor- Themenfeldauswahl.
Überblick
4.1 ––– Arbeitsgremien 17
4.2 ––– Wissenschaftliche Bestandsaufnahme 19
4.3 ––– Themenfelder einer Nachhaltigen Kommunalentwicklung 22
4.4 ––– Struktur des Zielsystems 24
4.5 ––– Formeller Beschluss der Nachhaltigkeitsstrategie 24Essener Nachhaltigkeitsstrategie Entwicklungsprozess 17
2
Bestands-
aufnahme
A U O R G A NI S A
TI
FB
AU
ON
1 6 3
Er- und
KOORDINATION, Evaluation und Überarbeitung der
KERNTEAM, Fortschreibung Nachhaltigkeits
BEIRAT strategie
7
5 4
6
5
Umsetzung und Formeller
Monitoring Beschluss
4
3
2
1
Abbildung 4: Kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) / © LAG 21 NRW
Die Essener Nachhaltigkeitsstrategie wurde nach dem GNK NRW-Modell zur
Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien auf kommunaler Ebene entwickelt
und basiert auf einem kooperativen Planungsverständnis.10 Alle beteiligten Ak-
teur*innen werden von Beginn an in den Planungsprozess eingebunden, sodass
die Nachhaltigkeitsstrategien gemeinsam in einem partizipativen Prozess ent-
wickelt werden.
Die Entwicklung und Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie ist zudem als
kontinuierlicher Verbesserungsprozess (KVP) angelegt (siehe Abbildung 4). Der
KVP stellt als fortwährender Überarbeitungszyklus die Wirksamkeits- und Er-
folgskontrolle der Nachhaltigkeitsstrategie sicher und zielt auf die stetige Ver-
besserung und Weiterentwicklung der formulierten Inhalte (u. a. thematische
Leitlinien sowie strategische und operative Ziele) ab.
10 vgl. Selle (2000)
13 vgl. Wagner (2015): 72ff.
Nach dem GNK NRW-Modell gliedert sich der Prozess in sechs wesentliche
Arbeitsschritte (siehe Abbildung 4): 1.) Einrichtung einer Aufbauorganisation, 2.)
Bestandsaufnahme, 3.) Erarbeitung des Zielsystems, 4.) Politischer Beschluss
der Nachhaltigkeitsstrategie, 5.) Umsetzung und Monitoring sowie 6.) Evaluation
und Fortschreibung.18 Essener Nachhaltigkeitsstrategie Entwicklungsprozess
AKTEURE Verwaltung, Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und
Zivilgesellschaft
BEIR AT
FUNKTION Inhaltliche Schwerpunkte, Erarbeitung der Nachhaltig-
keitsstrategie
NTE A M
K ER AKTEURE Alle Geschäftsbereiche der Stadtverwaltung
FUNKTION Analyse und fachübergreifende Aufstellung und
Abstimmung der Ziele
O RDIN ATI
O
KO AKTEURE Grüne Hauptstadt Agentur & Büro für Europa
N
angelegenheiten, Internationales und Nachhaltige
Entwicklung
FUNKTION Koordination des Strategieprozesses in der Verwaltung
und mit stadtgesellschaftlichen Akteuren
Abbildung 5: Aufbauorganisation / © LAG 21 NRW
4.1 Arbeitsgremien
Das Modell sieht für die Entwicklung und Umsetzung einer Nachhaltigkeitsstra-
tegie die Bildung von drei Arbeitsgremien vor: 1.) Koordination, 2.) Kernteam und
3.) Beirat (siehe Abbildung 5).
Koordination
Die Stadt Essen hat sich von Beginn an für ein geschäftsbereichsübergreifendes
Koordinierungsteam aus zwei Stabsstellen entschieden: Die Grüne Hauptstadt
Agentur koordiniert als Stabsstelle des Dezernats für Umwelt, Verkehr und Sport
die Zukunftsthemen Klimaschutz, Energie, Nachhaltigkeit, Mobilität und Stadtent-
wicklung im Konzern Stadt Essen. Das Büro für Europaangelegenheiten, Internati-
onales und Nachhaltige Entwicklung setzt als Stabsstelle des Oberbürgermeisters
den Schwerpunkt ihrer Nachhaltigkeitsaktivitäten vor allem auf die globale Verant-
wortung. Kommunale Entwicklungspolitik sowie die Integration der Agenda 2030
in die Stadtverwaltung und Bekanntmachung in der Öffentlichkeit sind besonders
hervorzuheben. Durch die geschäftsbereichsübergreifende Koordinierung der
Nachhaltigkeitsstrategie wird deren Bedeutung für die gesamte Stadtverwaltung
hervorgehoben und über unterschiedliche Zugänge in die Verwaltung eingebracht.
Die Koordination ist dabei Teil des Kernteams (siehe Abbildung 5).
Kernteam
Das verwaltungsinterne Arbeitsgremium setzt sich aus Vertreter*innen aller
Geschäftsbereiche und verschiedener Fachbereiche zusammen. Zentrale Auf-
gabe des Kernteams ist die fachliche Ausarbeitung und Abstimmung der Ziele
sowie die Vor- und Nachbereitung der Beiratssitzungen. Das Kernteam begleitet
den Strategie- als auch den späteren Umsetzungsprozess und ist Teil des Beirats
(siehe Abbildung 5).Essener Nachhaltigkeitsstrategie Entwicklungsprozess 19
Gruppenfoto zur zweiten Sitzung des Projektbeirats am 16.01.2020 / © Moritz Leick, Stadt Essen
Beirat
Der Beirat setzt sich aus stadtgesellschaftlichen Akteur*innen zusammen, die in
ihrer Funktion unterschiedliche gesamtgesellschaftliche Interessen vertreten.
Da die Essener Nachhaltigkeitsstrategie die Stadtgesellschaft mitadressiert,
dient der Beirat als beratendes Gremium im Prozess. Die Beteiligung des Bei-
rats fußt auf dem Prinzip der kooperativen Planung.11 Der Beirat setzt sich aus
rund 60 Vertreter*innen aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und
7
Zivilgesellschaft zusammen. Das Gremium setzt inhaltliche Schwerpunkte für
6
das Zielsystem und gibt Impulse für die Zielsetzung. Die Entscheidungshoheit
über die Nachhaltigkeitsstrategie und die Umsetzung der unterschiedlichen Ziele
5
obliegt den formalen Entscheidungsorganen, d.h. den Ausschüssen und dem Rat
4
der Stadt Essen.
3
2
Mitglieder des Beirats:
1
• Vertreter*innen der Fraktionen • Initiative für Nachhaltigkeit
des Stadtrats • Initiativkreis Religionen in Essen
• Vertreter*innen aller Geschäfts- • Institut für Mobilitäts- und
bereiche der Stadtverwaltung Stadtplanung
• AstA der Universität • Kreishandwerkerschaft / HWK
Duisburg-Essen • Kulturwissenschaftliches Institut
• Bezev e. V. • Mädchengymnasium Borbeck
• Ehrenamtsagentur • Neue Arbeit Diakonie
• EMG • Ruhrverband
• Emscher Genossenschaft • RUTE (Runder Umwelttisch)
• Essener Verbund der • Schule Natur
Migratenvereine e. V. • Sparkasse
• Essener Versorgungs- und • Stadtverband Essen der
Verkehrsgesellschaft Kleingärtnervereine e. V.
• Ernährungsrat Essen • Stiftung Mercator
• EWG • Universität Duisburg-Essen,
• Exile e. V. Institut für Mobilitäts- und
• Fridays for Future Stadtplanung
• Gemeinsam für Stadtwandel / • Universität Duisburg-Essen,
Parents for Future Urbane Systeme
• IHK • Universitätsmedizin Essen,
• Impact Hub Institut für Urban Public Health
• Immobilien Management • Verbraucherzentrale
Essen GmbH
11 vgl. Selle (2000)20 Essener Nachhaltigkeitsstrategie Entwicklungsprozess
4.2 Wissenschaftliche Bestandsaufnahme
Die Nachhaltigkeitsstrategie wird auf Grundlage einer systematischen, wissen-
schaftlichen Bestandsaufnahme erarbeitet. Hierzu werden zum einen statistische
Daten (quantitative Analyse) und zum anderen bestehende Konzepte und Strate-
gien, Projekte, (internationale) Städte- oder Projektpartnerschaften sowie politi-
sche Beschlüsse (qualitative Analyse) mit Bezügen zu nachhaltiger Entwicklung
ausgewertet (siehe Abbildung 6).
IVE AN
TAT
TI A
N
LY
KERNINDIKATOREN
Q UA
S WOT
SE
ADD-ON-INDIKATOREN
D S AU F N A
AN
STÄRKEN
T
HM
BE S
E
SCHWÄCHEN
CHANCEN
E
ATIV ANA
IT KONZEPTE RISIKEN
L
LY
Q UA
PROJEKTE
S E
PARTNERSCHAFTEN
BESCHLÜSSE
Abbildung 6: Elemente der Bestandsaufnahme / © LAG 21 NRW (Ergänzung / © LAG 21 NRW)
Die quantitative Analyse beruht auf einem Indikatorenset, das von der LAG 21 NRW
im Auftrag des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbrau-
cherschutz NRW (MULNV) und in Abstimmung mit dem Deutschen Städtetag, dem
Städte- und Gemeindebund NRW, dem Landkreistag NRW sowie dem Landesamt
für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV), der
Bertelsmann Stiftung und IT.NRW entwickelt wurde.12 Für eine kommunenspezi-
fische Vertiefung und Ergänzung wird das Indikatorenset mit zusätzlichen kommu-
nalen Indikatoren („Add-On-Indikatoren“) ergänzt.
Im Rahmen der qualitativen Analyse werden die relevanten Konzepte, Strategien
Projekte und Maßnahmen, (internationale) Städte- und Projektpartnerschaften
sowie politische Beschlüsse auf bereits formulierte Zieldefinitionen (strategische
und operative Ziele) mit Bezug zu Nachhaltigkeit untersucht.
Die zusammengefassten Ergebnisse der quantitativen und qualitativen Bestands-
aufnahme werden in Form von zehn themenfeldspezifischen Stärken-Schwächen-
Chancen-Risiken-Analysen (SWOT- Analyse) dargestellt. Die SWOT-Analyse dient
als Entscheidungshilfe für die Auswahl der priorisierten Themenfelder im Rahmen
des partizipativen Erarbeitungsprozesses des Zielsystems.
12 vgl. Reuter et al. (2016)Essener Nachhaltigkeitsstrategie Entwicklungsprozess 21
4.3 Themenfelder einer nachhaltigen
Kommunalentwicklung
Im Rahmen des GNK NRW Modells wird mit zehn Themenfeldern einer nachhal-
tigen Kommunalentwicklung gearbeitet. Damit sich die Kommunen in einem
ersten Durchlauf inhaltlich stärker fokussieren können, ist im Projektverlauf
vorgesehen, dass zunächst fünf bis maximal sechs Themenfelder ausgewählt und
bearbeitet werden. Die Auswahl erfolgt in den Modellkommunen durch den Beirat
auf Grundlage der Bestandsaufnahme. In weiteren Fortschreibungen kann das
Handlungsprogramm sukzessive um zusätzliche Themenfelder ergänzt werden.
Die Themenfelder stellen eine Synthese aus den Zielen der Agenda 2030 und
kommunalen Kompetenzbereichen dar, die sich oftmals auch in den Zuständig-
keiten der politischen Ausschüsse in den Kommunen widerspiegeln. Weiterhin
bilden die zehn Themenfelder auch mittlerweile bundesweit einen inhaltlichen
Orientierungsrahmen für kommunale Nachhaltigkeitsberichterstattung; so sind
sie ein zentrales Strukturelement des vom Rat für Nachhaltige Entwicklung 2021
veröffentlichten „Berichtsrahmen nachhaltige Kommune (BNK)“. Die folgende Über-
sicht stellt die zehn Themenfelder einer Nachhaltigen Kommunalentwicklung mit
ihren jeweiligen Kernbezügen zu den 17 Globalen Nachhaltigkeitszielen dar.
7
6
5
4
3
1
Nachhaltige Verwaltung ∙ SDG 5: Geschlechtergerechtigkeit | SDG 10: Weniger
Ungleichheiten | SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden | SDG 12: Nach-
2
Nachhaltige
haltige/r Konsum und Produktion | SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke
1
Verwaltung
Institutionen | SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele.
Lebenslanges Lernen & Kultur ∙ SDG 4: Hochwertige Bildung | SDG 10: Weniger
Ungleichheiten | SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden | SDG 16: Frieden,
Gerechtigkeit und starke Institutionen. 2
Lebenslanges
Lernen & Kultur
Gute Arbeit & Nachhaltiges Wirtschaften ∙ SDG 5: Geschlechtergerechtigkeit |
3
SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum | SDG 9: Industrie,
Gute Arbeit & Innovation und Infrastruktur | SDG 10: Weniger Ungleichheiten | SDG 12: Nach-
Nachhaltiges
Wirtschaften haltige/r Konsum und Produktion | SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz.22 Essener Nachhaltigkeitsstrategie Entwicklungsprozess
4
Soziale Gerechtigkeit & zukunftsfähige Gesellschaft ∙ SDG 1: Keine Armut | Soziale
SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen | SDG 4: Hochwertige Bildung | SDG 5: Ge- Gerechtigkeit &
zukunftsfähige
schlechtergerechtigkeit | SDG 10: Weniger Ungleichheiten | SDG 11: Nachhal- Gesellschaft
tige Städte und Gemeinden.
5
Nachhaltiger Konsum & gesundes Leben ∙ SDG 2: Kein Hunger | SDG 3: Ge-
Nachhaltiger sundheit und Wohlergehen | SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrich-
Konsum &
gesundes tungen | SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden | SDG 12: Nachhaltige/r
Leben Konsum und Produktion | SDG 14: Leben unter Wasser.
6
Globale Verantwortung & Eine Welt ∙ SDG 4: Hochwertige Bildung |
Globale
SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden | SDG 12: Nachhaltige/r Konsum Verantwortung &
und Produktion | SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen | Eine Welt
SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele.
7
Klimaschutz & Energie ∙ SDG 7: Bezahlbare und saubere Energie | SDG 9: In-
dustrie, Innovation und Infrastruktur | SDG 11: Nachhaltige Städte und Ge-
Klimaschutz &
Energie meinden | SDG 12: Nachhaltige/r Konsum und Produktion | SDG 13: Maß-
nahmen zum Klimaschutz.
Nachhaltige Mobilität ∙ SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen | SDG 9: Indus-
trie, Innovation und Infrastruktur | SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemein-
den | SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz. 8
Nachhaltige
Mobilität
9
Ressourcenschutz & Klimafolgenanpassung ∙ SDG 2: Kein Hunger | SDG 6: Sau-
Ressourcen-
schutz & beres Wasser und Sanitäreinrichtungen | SDG 11: Nachhaltige Städte und
Klimafolgen-
anpassung
Gemeinden | SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz | SDG 14: Leben unter
Wasser | SDG 15: Leben an Land.
Wohnen & Nachhaltige Quartiere ∙ SDG 10: Weniger Ungleichheiten |
SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden | SDG 12: Nachhaltige/r Konsum
und Produktion | SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz.
10 Wohnen &
Nachhaltige
QuartiereEssener Nachhaltigkeitsstrategie Entwicklungsprozess 23
Aufgrund der Aktualität und der starken Querverbindungen der Themen Klima-
schutz, Klimaanpassung und Mobilität haben sich die Arbeitsgremien dafür aus-
gesprochen, die Themenfelder „Klimaschutz und Energie“, „Ressourcenschutz
und Klimafolgenanpassung“ sowie „Nachhaltige Mobilität“ in einem eigenen
Themenfeld „Klima, Ressourcen und Mobilität“ zusammenzufassen.
Folgende Themenfelder liegen der Essener
Nachhaltigkeitsstrategie zu Grunde:
2
Klimaschutz & Energie ∙ SDG 7: Bezahlbare und
saubere Energie | SDG 9: Industrie, Innovation
Lebenslanges und Infrastruktur | SDG 11: Nachhaltige Städte
Lernen & Kultur
und Gemeinden | SDG 12: Nachhaltige/r Kon-
sum und Produktion | SDG 13: Maßnahmen zum
Klimaschutz.
Soziale Gerechtigkeit & zukunftsfähige Gesell-
4
schaft ∙ SDG 1: Keine Armut | SDG 3: Gesundheit
Soziale und Wohlergehen | SDG 4: Hochwertige Bildung
7
Gerechtigkeit &
zukunftsfähige | SDG 5: Geschlechtergerechtigkeit | SDG 10:
6
Gesellschaft Weniger Ungleichheiten | SDG 11: Nachhaltige
Städte und Gemeinden.
5
4
3
Globale Verantwortung & Eine Welt ∙ SDG 4:
2
6
Hochwertige Bildung | SDG 11: Nachhaltige
1
Globale Städte und Gemeinden | SDG 12: Nachhaltige/r
Verantwortung &
Eine Welt Konsum und Produktion | SDG 16: Frieden, Ge-
rechtigkeit und starke Institutionen | SDG 17:
Partnerschaften zur Erreichung der Ziele.
Klima, Ressourcen & Mobilität ∙ SDG 6: Saube-
res Wasser und Sanitäreinrichtungen | SDG 7:
Bezahlbare und saubere Energie | SDG 9: Indus-
trie, Innovation und Infrastruktur | SDG 11:
Nachhaltige Städte und Gemeinden | SDG 12:
Nachhaltige/r Konsum und Produktion | SDG 13:
Maßnahmen zum Klimaschutz | SDG 14: Leben
unter Wasser | SDG 15: Leben an Land.
10
Wohnen & Nachhaltige Quartiere ∙ SDG 10:
Weniger Ungleichheiten | SDG 11: Nachhaltige
Wohnen &
Nachhaltige Städte und Gemeinden | SDG 12: Nachhaltige/r
Quartiere Konsum und Produktion | SDG 13: Maßnahmen
zum Klimaschutz.24 Essener Nachhaltigkeitsstrategie Entwicklungsprozess
4.4 Struktur des Zielsystems
Das Zielsystem bildet gemeinsam mit der Präambel den Kern der Nachhaltig-
keitsstrategie und ist eine strategische Handlungsanleitung für die Umsetzung
einer Nachhaltigen Entwicklung in der Kommune im Kontext der Agenda 2030.
Abbildung 7 zeigt die Elemente des Zielsystems auf.
PRÄ AMBEL
• Beschreibt die kommunenspezifische Motivation zur Erarbeitung und
Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie
• Stellt die intendierte Wirkungsweise der Nachhaltigkeitsstrategie dar
• Ordnet die Strategie in das gesamte Portfolio der Aktivitäten der Kommune ein
ZIELSYSTEM
● LEITLINIEN
• Zeigen eine visionäre Entwicklung in verschiedenen Themenfeldern auf
––––→ A B S T R A K T E R : handlungsleitend
• Sind motivierend und aktiv formuliert und sprechen einen großen
Akteurskreis an
• Geben dem technischen Konstrukt „Strategie“ eine emotionale Note und
mobilisieren so Unterstützung
● STRATEGISCHE ZIELE
• Legen die langfristige Ausrichtung in den Themenfeldern fest
(am Zieljahr der Agenda 2030 orientiert)
• Benennen, was im Jahr 2030 in der Kommune im Sinne einer
Nachhaltigen Entwicklung erreicht werden soll
• Gliedern ein Themenfeld in bestimmte Teilbereiche
● O P E R AT I V E S Z I E L
planungs- und handlungsorientiert
• Werden aus strategischen Zielen abgeleitet und verfügen über
einen starken Handlungscharakter
←–––– D E TA I L L I E R T E R :
• Sind auf einen kurz- bzw. mittelfristigen Zeithorizont ausgerichtet
• Werden so konkret formuliert, dass sie leicht kommunizierbar
und überprüfbar sind. Sie sind spezifisch, messbar, akzeptiert
bzw. ambitioniert, realistisch und terminiert (SMART)
• Dienen als Ankerpunkte zur Darstellung der Bezüge zu den
Nachhaltigkeitszielsetzungen übergeordneter Strategien
(Agenda 2030, DNS, NHS NRW)
Abbildung 7: Elemente des Zielsystems / © LAG 21 NRWEssener Nachhaltigkeitsstrategie Entwicklungsprozess 25
4.5 Formeller Beschluss der Nachhaltigkeitsstrategie
Die Nachhaltigkeitsstrategie wird von den formalen Entscheidungsorganen
(Ausschüsse und Rat) offiziell beschlossen. Der formelle Beschluss dient der
politischen Legitimation der Nachhaltigkeitsstrategie, sodass sie handlungslei-
tend in allen Bereichen der kommunalen bzw. regionalen Entwicklung Berück-
sichtigung findet. Das Zielsystem der Nachhaltigkeitsstrategie wird als „lebendi-
ges“ Dokument verstanden.
Das Zielsystem beinhaltet:
• Leitlinien;
• die kurz-, mittel- und langfristige Umsetzung der Nachhaltigkeitsstra-
tegie in Form eines hierarchischen Zielsystems aus strategischen und
operativen Zielen;
• den Beitrag der Kommune zur Zielerreichung der Globalen Nachhaltig-
keitsziele (SDGs) und weiterer übergeordneter Strategien (DNS, NHS NRW).
Die Konkretisierung und Planungsrelevanz der Nachhaltigkeitsstrategie
nimmt dabei von der abstrakten Ebene der Leitlinien bis hin zu den operati-
ven Zielen zu (s. Abbildung 7).
7
6
5
● LEITLINIE THEMENFELD 1
4
3
2
1
● STRATEGISCHES ● STRATEGISCHES ● STRATEGISCHES ● STRATEGISCHES
ZIEL 1.1 ZIEL 1.2 ZIEL 1.3 ZIEL 1.4
● ● ● ● ● ● ● ●
OPERATIVES OPERATIVES OPERATIVES OPERATIVES OPERATIVES OPERATIVES OPERATIVES OPERATIVES
ZIEL 1.1.1 ZIEL 1.1.2 ZIEL 1.2.1 ZIEL 1.2.2 ZIEL 1.3.1 ZIEL 1.3.2 ZIEL 1.4.1 ZIEL 1.4.2
A, B, … A, B, … A, B, … A, B, … A, B, … A, B, … A, B, … A, B, …5
26 Essener Nachhaltigkeitsstrategie Zielsystem der Essener Nachhaltigkeitsstrategie
5 Zielsystem der Essener
Nachhaltigkeitsstrategie
Das Zielsystem der Stadt Essen be- Die Leitlinie dient als Dach für das
steht aus einer übergeordneten Prä- jeweilige Themenfeld und gliedert sich
ambel sowie aus thematischen Leit- in mehrere strategische Ziele auf, die
linien, strategischen und operativen wiederum jeweils durch operative Zie-
Zielen zu den jeweiligen Themenfel- le inhaltlich konkretisiert werden. Die
dern. Abbildung 7 zeigt eine Übersicht operativen Ziele sind ergänzt um eine
der thematischen Leitlinien über alle Auflistung ihrer Bezüge zu den 169
fünf Themenfelder der Nachhaltig- SDG-Unterzielen, zu den Zielsetzun-
keitsstrategie. gen der DNS sowie der NHS NRW.
Überblick
5.1 ––– Präambel 34
5.2 ––– Themenfeld 1 ∙ Lebenslanges Lernen & Kultur 36
5.3 ––– Themenfeld 2 ∙ Soziale Gerechtigkeit &
zukunftsfähige Gesellschaft 39
5.4 ––– Themenfeld 3 ∙ Klima, Ressourcen & Mobilität 43
5.5 ––– Themenfeld 4 ∙ Globale Verantwortung & Eine Welt 47
5.6 ––– Themenfeld 5 ∙ Wohnen & Nachhaltige Quartiere 49
5.7 ––– Gesamtübersicht der Bezüge zur Agenda 2030 52Essener Nachhaltigkeitsstrategie Zielsystem der Essener Nachhaltigkeitsstrategie 27
Netzfahrplan zur Essener Nachhaltigkeitsstrategie –
Nachhaltigkeitsstrategie Essen
Übersicht der Leitlinien und strategischen Ziele in
Leitlinien und strategische Ziele
den fünf Themenfeldern
KLIMA, RESSOURCEN UND MOBILITÄT
SOZIALE GERECHTIGKEIT &
ZUKUNFTSFÄHIGE GESELLSCHAFT
Nachhaltigkeitskriterien in der
Stadtplanung verankern
Die Stadt Essen ermöglicht eine umfassende und diskriminie-
rungsfreie Teilhabe aller Menschen am gesellschaftlichen Leben. Partizipationskultur
Es gibt ein umfangreiches und zeitgemäßes Angebot von sozial- Essen wird in gemeinsamer Verantwortung und als
leben
gerechten, individuellen und digitalisierten Dienstleistungen der Aufgabe aller Akteur*innen der Stadtgesellschaft zur
Stadtverwaltung. Die Menschen in Essen leisten einen aktiven klimaneutralen Stadt. Sie begegnet den ökologischen,
Beitrag zu einem friedvollen und gesunden Zusammenleben. wirtschaftlichen und sozialen, und damit gesundheit-
Bewusstsein für nachhaltigen lichen Folgen des Klimawandels konsequent. Klima-
Konsum schaffen
und Ressourcenschutz sind bei allen Entscheidungen
Stadtverwaltung als moderne und und Planungen der Stadt Essen zu berücksichtigen.
nachhaltige Arbeitgeberin etablieren
Die Stadt Essen strebt eine Entwicklung im Sinne der
Umweltverträglichen 12 Ziele der Grünen Hauptstadt Europas – Essen 2017
Solidarisches Zusammenleben Verkehr fördern an.
fördern
Essen als Klimaschutz-Vorbild in der
Metropole Ruhr etablieren
Gleichberechtigung und Teilhabe aller
Menschen sicherstellen
Barrierefreien und
bezahlbaren Wohnraum
Vielfältige und bereitstellen
LEBENSLANGES LERNEN & Kooperative und vernetzte sichere Quartiere
KULTUR Bildungslandschaft schaffen entwickeln WOHNEN &
NACHHALTIGE QUARTIERE
Für nachhaltige
Konsummuster
sensibilisieren
Bildung und Kultur werden in Essen als Vielfältiges kulturelles Internationale Partner-
Schlüssel für eine umfassende Teilhabe Angebot sicherstellen schaften und Netzwerke
ausbauen Attraktiver, nachhaltiger und bezahlbarer
aller am gesellschaftlichen Leben verstan- Wohnraum bildet die Grundlage für die Le-
den. Die Stadtgesellschaft gestaltet die für bensqualität in allen Stadtteilen Essens.
alle zugängliche Bildungs- und Kulturland- Die Quartiere entsprechen den vielfältigen
schaft, in der die Bildung für Nachhaltige Nachhaltige Siedlungsent- Bedürfnissen der Menschen, auch den An-
Angebot im Bereich Bildung
Entwicklung (BNE) fest verankert ist, aktiv wicklung verfolgen forderungen durch den Klimawandel, und
für Nachhaltige Entwicklung
mit. werden durch diese aktiv mitgestaltet.
ausbauen
GLOBALE VERANTWORTUNG & EINE WELT
Die Essener Stadtgesellschaft übernimmt globale Verant-
wortung im Sinne der Agenda 2030 für eine Nachhaltige
Entwicklung. Sie setzt sich sowohl vor Ort in Essen als auch
in globalen Partnerschaften gegen soziale Ungleichheiten
und Diskriminierung sowie für eine klima- und sozialge-
rechte Welt ein.
mit ihrer mit Mitteln des in Kooperation mit unterstützt durch
Abbildung 8: Netzfahrplan zur Essener Nachhaltigkeitsstrategie28 Essener Nachhaltigkeitsstrategie Zielsystem der Essener Nachhaltigkeitsstrategie
5.1 Präambel
Im Sinne der global gültigen Agenda 2030 für Nachhaltige Entwicklung und ihren
17 Nachhaltigkeitszielen setzt sich die Stadt Essen für eine sozial, ökologisch
und wirtschaftlich nachhaltige Entwicklung13 – auf kommunaler Ebene mit glo-
baler Verantwortung – ein. Die Stadt Essen orientiert sich dabei an den Grund-
prinzipien der Starken Nachhaltigkeit und der Generationengerechtigkeit. Im
Konzept der Starken Nachhaltigkeit findet wirtschaftliches und soziales Handeln
innerhalb der Ökosystemgrenzen der Erde statt. Die natürlichen Ressourcen
und die Umwelt bilden somit die Grundlage für alle menschlichen Entwicklungs-
felder inklusive der entsprechenden ökonomischen und sozialen Subsysteme.
Im Sinne der Generationengerechtigkeit soll eine Nachhaltige Entwicklung die
Bedürfnisse der Gegenwart befriedigen, ohne zu riskieren, dass künftige Gene-
rationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht mehr befriedigen können.
Die Stadt Essen erkennt die Herausforderungen durch den Klimawandel, Ver-
lust von Biodiversität, Diskriminierung, soziale Ungleichheit sowie internationale
Flucht- oder Migrationsbewegungen an, die sich insbesondere für eine Großstadt
wie Essen ergeben und sieht die Notwendigkeit, entschlossen und konsequent
Maßnahmen umzusetzen. Die Stadt Essen begegnet nicht nur den Herausfor-
derungen dieser Dekade, sondern nutzt das Potenzial und die Chancen, die sich
durch eine nachhaltige Transformation eröffnen.
Vor diesem Hintergrund gibt sich die Stadt Essen mit ihrer integrierten, kommu-
13 Nachhaltige Entwicklung
schließt alle Umwelt-, Gesell- nalen Nachhaltigkeitsstrategie im Kontext der UN-Nachhaltigkeitsziele eine Vision
schafts-, Gesundheits- und für ihr eigenes Handeln und leistet so einen wichtigen Beitrag zur systematischen
Wirtschaftsbelange mit ein.
Siehe dazu die 17 SDGs (Nach- Umsetzung der globalen Agenda 2030 auf kommunaler Ebene. Die Stadt Essen
haltigkeitsstrategie Stadt entwickelt ihre Strategien partizipativ mit Vertreter*innen aus Zivilgesellschaft,
Essen S.12, Abb.2).
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung.
14 Auch wenn die Stadt Essen
quantitativ nicht alle Esse-
ner*innen erreichen kann, Die Nachhaltigkeitsstrategie und die darin definierten Leitlinien und strategischen
adressiert sie explizit alle
gesellschaftlichen Gruppen. Ziele der Stadt Essen beziehen sich auf das Jahr 2030, welches dem Bezugsjahr
Niemand wird aufgrund der der Vereinten Nationen entspricht. Aus den strategischen Zielen leiten sich die
aufgeführten individuellen
operativen Ziele ab, die i.d.R. mit dem Zeithorizont 2025 einen kurz- bis mittelfris-
oder strukturellen Privilegien
oder Benachteiligungen aus- tigen Charakter haben.
geschlossen.
15 Ergänzte Aufzählung in An-
lehnung an die Allgemeine Der gesamten kommunalen Nachhaltigkeitsstrategie liegen folgende Grundsätze
Erklärung der Menschenrech- zugrunde, die in allen Leitlinien und Zielen Beachtung finden:
te Art. 2, AEMR sowie Art. 3
Grundgesetz.
16 Gleichstellung: Obwohl die • Die Visionen der Nachhaltigkeitsstrategie für das Jahr 2030 adressieren
Gleichberechtigung aller Men- alle Menschen14 in Essen. Die Stadt erkennt die Diversität der Essener
schen im deutschen Grund-
gesetz verankert ist, bestehen Gesellschaft an und richtet ihr Handeln auf die unterschiedlichen An-
weiterhin Benachteiligungen forderungen und Bedürfnisse der Menschen aus. Diese ergeben sich aus
von gesellschaftlichen Grup-
den individuellen und strukturellen Privilegien und Benachteiligungen, die
pen in vielen Lebensberei-
chen. Gleichstellung bedeutet, Menschen aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht, sexueller Orientierung,
die tatsächlichen Benachtei- geschlechtlicher Identität, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger An-
ligungen aufzulösen, indem
Strukturen und Rahmenbe- schauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt, physischer
dingungen verändert werden und psychischer Erkrankungen, Behinderung oder sonstigem Status er-
und benachteiligte, gesell-
fahren können15. Damit entspricht die Essener Nachhaltigkeitsstrategie dem
schaftliche Gruppen ihren
Bedürfnissen entsprechende Ansatz der Agenda 2030: „Leave no one behind“. Denn Nachhaltige Entwick-
Unterstützung erhalten. Erst lung lässt niemanden zurück. In diesem Sinne sind die Gleichstellung16 aller
wenn dieses Ungleichgewicht
überwunden ist, entsteht Bürger*innen und Inklusion fester Bestandteil aller Leitlinien und Ziele
Chancengleichheit für alle. dieser Strategie.Sie können auch lesen