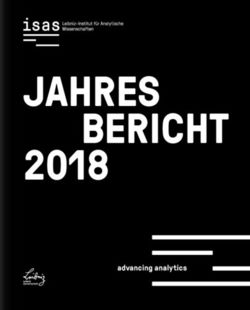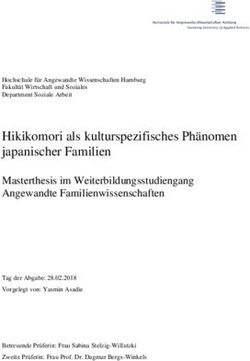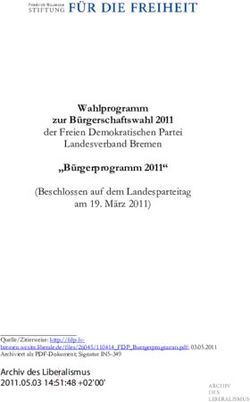Neue entwicklungspolitische Ansätze Österreichs zur Steuerung von Migration - unipub
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Mag. Miriam Liska
Neue entwicklungspolitische Ansätze Österreichs
zur Steuerung von Migration
Masterarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
eines Master of Arts
der Studienrichtung Global Studies
an der Karl-Franzens-Universität Graz
Betreuerin: Priv.-Doz. Mag. Dr. MinR Ursula Werther-Pietsch
Institut: Völkerrecht und Internationale Beziehungen
Graz, 11. September 2018Ehrenwörtliche Erklärung Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die den Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen inländischen oder ausländischen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht. Die vorliegende Fassung entspricht der eingereichten elektronischen Version. Datum: Unterschrift:
Für Noufal
INHALTSVERZEICHNIS
Abkürzungsverzeichnis 3
1. Einleitung 5
1.1 Problemstellung und Zielsetzung 5
1.2 Methodik und Gliederung 7
1.3 Theoretischer Hintergrund 8
2. Zum Zusammenhang von Migration und Entwicklung 11
2.1 Begriffsabgrenzung: Migration 11
2.1.1 Kategorisierung internationaler Migration 11
2.1.2 Irreguläre Migration vs. Fluchtmigration 12
2.2 Begriffsabgrenzung: Entwicklung 14
2.2.1 Entwicklungen auf institutioneller Ebene seit Ende des zweiten Weltkriegs 14
2.2.2 Entwicklungen auf EU- und UN- Ebene seit dem Jahr 2000 15
2.3 Der Nexus von Migration und Entwicklung 16
2.4 Die Bedeutung von Migration für eine Gesellschaft 18
2.4.1 Soziale und wirtschaftliche Folgen für die Aufnahmegesellschaft 19
2.4.2 Wirtschaftliche und sozio-politische Folgen für die Herkunftsländer 20
2.4.3 Das Beispiel Österreich 22
3. Internationale Maßnahmen zur Steuerung von Migration 25
3.1 Policy-Instrumente zur Migrationssteuerung in Europa 25
3.1.1 Schengener Übereinkommen und der Vertrag von Amsterdam 25
3.1.2 Dublin-Verordnung 26
3.1.3 Rückübernahmeabkommen 27
3.1.4 Cotonou-Kooperationsabkommen 28
3.1.5 Global Approach to Migration and Mobility 30
3.1.6 European Agenda on Migration 31
3.1.7 EU Trustfunds 32
3.1.8 EU-Turkey Deal 34
3.1.9 EU External Investmentplan 35
3.2 Policy-Instrumente zur Migrationssteuerung auf UN-Ebene 36
3.2.1 Die Agenda 2030 der Vereinten Nationen 36
3.2.2 Global Compact for Migration 37
4. Die österreichische Entwicklungspolitik und die Steuerung von Migration 40
4.1 Das Dreijahresprogramm der österreichischen Entwicklungspolitik 2019-2021 40
4.1.1 Friedliche und inklusive Gesellschaften 41
4.1.2 Umwelt und Klima 43
4.1.3 Nachhaltige Wirtschaft 45
4.1.4 Nexus: Wasser – Energie - Ernährungssicherheit 46
14.1.5 Bildung, Gesundheit, Geschlechtergleichstellung 47
4.2 Externe Aspekte der österreichischen Migrationssteuerung 48
4.2.1 Friedenssicherung und Konfliktprävention 49
4.2.2 Trio-Ansatz: Wirtschaftspartnerschaften – Berufsbildung - Rechtsstaatlichkeit 50
4.2.3 Multilaterales Engagement Österreichs 53
4.3 Migrationssensitive Entwicklungspolitik vs. Migrationsmanagement 58
5. Fokus: Migration, Wirtschaft und die Rolle lokaler AkteurInnen 63
5.1 Die Bedeutung lokaler AkteurInnen im humanitären Sektor 63
5.1.1 Vorteile der Zusammenarbeit mit lokalen AkteurInnen 64
5.1.2 Herausforderungen in der Zusammenarbeit mit lokalen AkteurInnen 65
5.2 Der Aufbau einer Wirtschaft und lokaler Kapazitäten 67
5.2.1 Wirtschaftswachstum vs. nachhaltige Entwicklung 68
5.2.2 Nachhaltige Entwicklung und die Bedeutung lokaler AkteurInnen 70
5.2.3 Konzepte der Wirtschafts- und Privatsektorenentwicklung in der OEZA 71
5.3 Wirtschaftliche Entwicklung, neue Partnerschaften und Migration 73
5.3.1 Neue Perspektiven und die Steuerung von Wirtschaftsmigration 74
5.3.2 Die Rolle lokaler AkteurInnen in der Migrationssteuerung 77
6. Schlussbetrachtung 81
7. Literatur- und Quellenverzeichnis 85
2Abkürzungsverzeichnis
ADA Agentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit
AEMR Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte
AKP Afrika – Karibik – Pazifik
AMIF Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds
AWEPA Association of European Parliamentarians for Africa
BIP Bruttoinlandsprodukt
BMEIA Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres
BMF Bundesministeriums für Finanzen
BM.I Bundesministerium für Inneres
BMZ Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
CAMM Common Agenda on Migration and Mobility
CEPAL Wirtschaftskommission für Lateinamerika und die Karibik
CSDP Common Security and Defence Policy
DAC Development Assistance Committee
DCED Donor Committee for Enterprise Development
DCdVET Donor Committee for dual Vocational Education and Training
DEZA Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit
DFID Department for International Development
EASO European Asylum Support Office
EC Europäische Kommission (European Commission)
ECOSOC Economic and Social Council der UN
EDF European Development Fund
EFSD European Fund for Sustainable Development
EGMR Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
EIC European Investigative Collaborations
EIP Europäischer Investitionsplan
EMRK Europäischen Menschenrechtskonvention
EPA Economic Parternship Agreement
ERP European Recovery Program
ERSO European Reintegration Support Organisations
EU Europäische Union
EUTF European Trust Fund
EuRH Europäischen Rechnungshof
EURODAC European Dactyloscopy
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
EZA Entwicklungszusammenarbeit
GAMM Gesamtansatz für Migration und Mobilität
GCM Global Compact for (safe, orderly and regular) Migration
3GFK Genfer Flüchtlingskonvention
GIZ Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
HVR Humanitäres Völkerrecht
IBM Integrated Border Management
ICMPD International Centre for Migration Policy Development
ILO International Labour Organization
IO Internationale Organisationen
IOM Internationale Organisation für Migration
KMU Klein- und Mittelbetriebe
LDCs Least Developed Countries
LED Liechtensteinischer Entwicklungsdienst
LED-Ansatz Local Economic Development
LRRD Linking Relief, Rehabilitation and Development
MDGs Millennium Development Goals
M4P Making Markets Work for the Poor
MP Mobilitätspartnerschaften
NAP Nationaler Aktionsplan
NRO Nicht-Regierungsorganisationen
OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
ÖFSE Österreichische Forschungsstiftung für Internationale Entwicklung
ÖRK Österreichisches Rotes Kreuz
OEZA Österreichische Entwicklungszusammenarbeit
OSZE Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
PSR Potential Support Ratio
SAS Schengen-Assoziierte Staaten
SDC Swiss Agency for Development and Cooperation
SDGs Nachhaltige Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals)
SIDA Swedisch International Development Cooperation Agency
SIS Schengener Informationssystem
TF-MH Task Force Menschenhandel
UN Vereinte Nationen (United Nations)
UNHCR Flüchtlingshochkommissariat der Vereinten Nationen
UNIDO UN Organisation für industrielle Entwicklung
UNODC UN-Büro für Drogen und Verbrechensbekämpfung
UNTOC Übereinkommen gegen grenzüberschreitende organisierte Kriminalität
VIC Vienna International Centre
WANEP West African Network for Peacebuilding
WB Weltbank
WHS World Humanitarian Summit
41. Einleitung
1.1 Problemstellung und Zielsetzung
Migrationsbewegungen existieren seit Beginn der Menschheitsgeschichte, denn Menschen
wandern, seit es sie gibt (Uerpmann-Wittzak 2017:1). Doch war die Mobilität noch nie so groß
wie sie heute ist und die Anzahl an Wanderungsbewegungen hat das höchste Niveau seit
dem zweiten Weltkrieg erreicht. Der Zustrom nach Europa verzeichnete im Jahr 2015 seinen
Höhepunkt und hat als „Migrations- bzw. Flüchtlingskrise“ in die politische Debatte Einzug
gehalten. Ursachen und Auswirkungen globaler Flucht- und Migrationsbewegungen rückten
damit erstmals ins Auge der Öffentlichkeit. Es steht außer Frage, dass die voranschreitende
Globalisierung und der damit verbundene technische Fortschritt vor allem in den Bereichen
Transport und Kommunikation die stärksten Treiber dieser Entwicklung sind. Zumal auch
humanitäre Schutzmechanismen erst greifen können, wenn schutzbedürftige Personen
bereits migrieren. Und trotzdem befinden sich viele staatliche AkteurInnen hinsichtlich ihrer
Ansätze im Migrationsmanagement nach wie vor in einem sogenannten „Pre-
Globalisierungsmodus“ (Webinger 2017:117-119) und versuchen mit reaktiven Maßnahmen
die Symptome zu bekämpfen. Doch wird dem Phänomen, dass Menschen wandern, mit
Grenzschließungen, Rücksendungen und einer Externalisierung der Zuständigkeiten allein
nicht beizukommen sein und so stellt sich die Frage nach den Ursachen dieser verstärkten
Wanderungsbewegung. Da diese in einer globalisierten Welt jedoch komplex sind und sich
nicht anhand nur einer Theorie erklären und mit nur einer Maßnahme adressieren lassen, ist
auch die Ausrichtung der aktuellen Migrationsstrategie mehrdimensional und in einen
größeren Kontext eingebettet. Im Hinblick auf die europäische Migrationspolitik, die auch in
Österreich den Rahmen vorgibt, rückt dabei der Nexus von Migration und Entwicklung immer
mehr in den Fokus des politischen Diskurses (Oberberger 2017:1). Inwieweit sich der Trend,
auf zukünftige Migrationsbewegungen mit entwicklungspolitischen Maßnahmen Einfluss zu
nehmen in der Ausrichtung der österreichischen Entwicklungspolitik niederschlägt, und
inwiefern dieser Ansatz Erfolg versprechen könnte, soll anhand der folgenden Fragestellung
und mit Hilfe der im Anschluss aufgestellten Hypothesen untersucht werden.
Forschungsfragen:
Welche Rolle spielt die Verknüpfung von Migration und Entwicklung in der neuen
österreichischen Entwicklungspolitik? Kann die Migrationsbewegung nach Österreich durch
wirtschaftliche Entwicklung in den Partnerländern langfristig eingedämmt werden? Und
welche Rolle spielen lokale AkteurInnen in der Migrationssteuerung?
5Aufgrund der steigenden Zuwanderung nach Europa kam es in den letzten zehn Jahren zu
einer strukturellen Veränderung in der europäischen Migrationspolitik. Hat sich die
Ausrichtung bis zur Jahrtausendwende fast ausschließlich auf die Sicherung der
gemeinsamen Außengrenzen beschränkt, so weist sie nunmehr eine neue externe Dimension
auf, die in einen außenpolitischen Rahmen eingebettet ist und die Entwicklungspolitik umfasst.
Mit Hilfe neuer Kooperationen mit Drittstaaten soll versucht werden, Migrationsbewegungen
bereits in den Herkunftsländern zu adressieren und präventiv einzudämmen (Spunda 2011:2;
EC 2011). Dem Nexus von Migration und Entwicklung kommt dabei eine große Bedeutung
zu, geht man aus politischer Sicht mehrheitlich davon aus, dass eine Verbesserung der
Lebensbedingungen in den Heimatländern der MigrantInnen zu einem Rückgang des Exodus
führen würde (Fanizadeh 2014:250-251). Daraus ergibt sich die folgende erste Hypothese:
1) Mit dem vermeintlichen Ziel Perspektiven vor Ort zu schaffen, kann das neue
Dreijahresprogramm der österreichischen Entwicklungspolitik als Instrumentarium zum
Schutz Österreichs vor irregulärer Zuwanderung gesehen werden.
Da im Hinblick auf die Schaffung neuer Perspektiven vor Ort, dem Aufbau einer nachhaltigen
Wirtschaft eine neue zentrale Rolle zukommt, liegt hier der Fokus dieser Arbeit. Nicht nur
existieren auf Ebene der Europäischen Union (EU) bereits einige Instrumente im
Migrationsmanagement, die auf wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit (EZA)
ausgerichtet sind, sondern zielen auch die Vorgaben und Maßnahmen der Vereinten Nationen
(United Nations - UN) auf die Beseitigung von Armut und die Verbesserung der
Lebensbedingungen durch inklusives und nachhaltiges Wachstum ab (UN-SD 2015).
Eingebettet in den europäischen Kontext, soll das Dreijahresprogramm der österreichischen
Entwicklungspolitik einen Beitrag zur Umsetzung der nachhaltigen Entwicklungsziele der UN
(Sustainable Development Goals - SDGs) leisten und gleichzeitig irreguläre Migrationsströme
eindämmen. Daraus ergibt sich die folgende zweite Hypothese:
2) Die angestrebte wirtschaftliche Entwicklung in den Partnerländern kann langfristig einen
Beitrag zur Verbesserung der Lebensbedingungen vor Ort leisten, Entwicklungspolitik
allein kann aber die Migrationsbewegung nach Österreich nicht eindämmen.
Bei der Ausrichtung der Migrationspolitik auf internationaler Ebene haben Partnerschaften mit
und in den Herkunfts- und Transitländern einen neuen Stellenwert erhalten, wobei gerade die
Zusammenarbeit mit VertreterInnen der Regierung und Zivilgesellschaft vor Ort als essentiell
für die nachhaltige Entwicklung eines Landes angesehen wird (EC 2015a). Und so legt auch
das neue Dreijahresprogramm der österreichischen Entwicklungspolitik einen Schwerpunkt
6auf Dialog und Kooperation mit seinen Partnern und den vermehrten Einbezug lokaler
AkteurInnen1 (BMEIA 2018b:25-27). Daraus ergibt sich die folgende dritte Hypothese:
3) Lokale AkteurInnen spielen eine wichtige Rolle in der Migrationssteuerung, da sie nicht
nur AdressatInnen von EZA-Leistungen, sondern auch Motor der Entwicklung sind.
Vor dem Hintergrund relevanter Migrationstheorien und den Implikationen von Migration auf
eine Gesellschaft, und eingebettet in den globalen Rahmen migrationspolitischer Instrumente,
behandelt diese Masterarbeit „Neue entwicklungspolitische Ansätze Österreichs zur
Steuerung von Migration“ auf Basis des Dreijahresprogramms der österreichischen
Entwicklungspolitik 2019-2021 mit Fokus auf die wirtschaftliche Entwicklung in den
Partnerländern und die Rolle lokaler AkteurInnen in der Migrationssteuerung.
1.2 Methodik und Gliederung
Die methodische Vorgehensweise ist eine Literaturrecherche sowie die deduktive Analyse
von Primär- und Sekundärquellen. Bei den Primärquellen handelt es sich in erster Linie um
Dokumente des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres (BMEIA), wie das
neue „Dreijahresprogramm für Entwicklungspolitik 2019-2021“. Des Weiteren stützt sich die
Untersuchung auf das „Regierungsübereinkommen 2017-2022“ der österreichischen
Bundesregierung, veröffentlichte Daten und Berichte des Migrationsrats und des
Bundesministeriums für Inneres (BM.I) sowie Programme und Leitlinien der Agentur der
Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (ADA). Auf internationaler Ebene wurden
Abkommen, Maßnahmen und Stellungnahmen der Europäischen Union und der Vereinten
Nationen für die Analyse herangezogen. Als Sekundärliteratur dienten Werke, Positions- und
Arbeitspapiere von MigrationsforscherInnen, Rechts- und PolitikwissenschaftlerInnen, sowie
Artikel zum tagesaktuellen politischen Geschehen aus seriösen nationalen und
internationalen Zeitungen und Internetquellen. Da der kontroversielle Schwerpunkt dieser
Arbeit auf irregulären Migrationsbewegungen und neuen entwicklungspolitischen
Instrumenten liegt und beide Komponenten nur schwer messbar sind, wurde eine quantitative
Analyse als nicht aussagekräftig angesehen. Dennoch werden auf Basis der untersuchten
Inhalte auch induktive Schlüsse gezogen, sofern sie sich im Verlauf dieser Arbeit ergeben und
für die Beantwortung der Forschungsfragen von Relevanz sind.
Diese Masterarbeit gliedert sich im Wesentlichen in zwei Teile: Im ersten Teil sollen die
Begriffe „Migration“ und „Entwicklung“ abgegrenzt, der Zusammenhang zwischen den beiden
1
Lokale AkteurInnen = nationale Regierungen und Nicht-Regierungsorganisationen, Zivilgesellschaft und zivilgesellschaftliche
Organisationen, universitäre- und außeruniversitäre Institutionen sowie die Privatwirtschaft.
7Phänomenen hergestellt und die Bedeutung von Migration für eine Gesellschaft erläutert
werden. Vor diesem Hintergrund wird ein Abriss über die auf internationaler Ebene
existierenden Instrumente zur Steuerung von Migration gegeben, die auch den Rahmen für
die österreichische Migrations- und Entwicklungspolitik vorgeben. Darauf aufbauend soll im
zweiten Teil das neue Dreijahresprogramm der österreichischen Entwicklungspolitik 2019-
2021 vorgestellt, wichtige externe Aspekte der österreichischen Migrationsstrategie, darunter
auch ausgewählte entwicklungspolitische Maßnahmen näher erläutert und diese dem
aktuellen Migrationsmanagement kritisch gegenübergestellt werden. Da eines der Ziele der
Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (OEZA) im Hinblick auf Migrationssteuerung
die nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und verstärkte Kooperation mit lokalen Partnern
ist, liegt hier der Fokus der Analyse. Ein Kausalzusammenhang zwischen dem Nexus von
Migration und Entwicklung und damit verbundenen zukünftigen entwicklungspolitischen
Maßnahmen sowie dem möglichen Rückgang irregulärer Migrationsbewegungen nach
Österreich lässt sich jedoch nur schwer nachweisen. Daher ist das Thema dieser Arbeit auch
nicht als Entscheidungsfrage im Hinblick auf den Erfolg des neuen Dreijahresprogramms bei
der Steuerung von Migration zu sehen. Vielmehr soll anhand der nationalen
Schwerpunktsetzung für die Jahre 2019 bis 2021 untersucht werden, inwieweit
Entwicklungspolitik in den Dienst der Migrationssteuerung gestellt werden kann und inwiefern
der Nexus von Migration und Entwicklung Resultate verspricht. Die Forschungsfragen selbst
werden mit Hilfe der aufgestellten Hypothesen im Verlauf dieser Arbeit beantwortet.
1.3 Theoretischer Hintergrund
Seit dem 19. Jahrhundert formuliert die Wissenschaft Theorien zu den
Wanderungsbewegungen der Bevölkerung. Dabei lassen sich grundsätzlich zwei Richtungen
unterscheiden: die klassischen Theorien der internationalen Migration, die sich vorwiegend
auf ökonomische Faktoren wie Arbeitsmarkt, Lohnunterschiede und Angebot und Nachfrage
von Arbeitskräften beziehen (Hahn 2015:29-30), und die neueren Ansätze der
Migrationsforschung, die sozio-politische Aspekte wie Integration, Assimilation und
Transnationalität, sowie die Entwicklung von Migrationsketten und Migrationsnetzwerken in
den Vordergrund stellen (Haug 2000:1). Da Migrationsentscheidungen wesentlich komplexer
sind, als es nur eine Theorie erahnen lässt, sind beide Richtungen für diese Arbeit relevant.
Bei den klassischen Erklärungsansätzen spielt, auf nationaler wie auch auf europäischer
Ebene, die Theorie der Push- und Pull-Faktoren aus den 1960er Jahren nach wie vor eine
entscheidende Rolle bei der Definition von Maßnahmen zur Eindämmung irregulärer
Migrationsbewegungen. Sie nimmt an, dass Migration innerhalb der Herkunftsregion von
bestimmten Push-Faktoren und hinsichtlich der Zielregion von Pull-Faktoren beeinflusst wird.
8Zu den Push-Faktoren zählen u.a. Wirtschaftslage, politische Konflikte oder ökologische
Katastrophen, die Menschen dazu veranlassen ihre Heimat zu verlassen. Als Pull-Faktoren
werden Anziehungspunkte wie Erwerbsmöglichkeiten in einem boomenden Arbeitsmarkt,
soziale Sicherheit und Stabilität, aber auch gezielte Anwerbepolitik gesehen (Grill 2015:12).
Da diese Faktoren jedoch stark ineinandergreifen, können sie keiner isolierten
Betrachtungsweise unterzogen werden und die Migrationsentscheidung bleibt häufig
Ausdruck einer signifikanten Überschneidung mehrerer Ebenen (Migrationsrat 2016:10).
Die aus den 1980er Jahren stammende Neoklassische Ökonomische Theorie geht davon aus,
dass Migration das Ergebnis von Angebot und Nachfrage nach Arbeitskräften ist (Parnreiter
2000:27). Der Mensch trifft als Nutzenmaximierer2 eine rationale Entscheidung und wandert
in Regionen aus, in denen er für seine angebotene Arbeitsleistung den bestmöglichen Preis
erzielt. Ein Ansatz, der annimmt, dass jede Form der Wirtschaftsmigration auf einer rein
rationalen Entscheidung basiert und daher in der aktuellen politischen Debatte auch häufig
mit den vermeintlich besseren Chancen in einem Wohlfahrts- und Sozialstaat in Verbindung
gebracht wird (Sieferle 2015:17). Neben dem Migrationsfaktor der Lohndisparität, müssen
nach George J. Borjas aber auch Faktoren wie finanzielle Möglichkeiten, Alter, Beruf, sowie
politische und familiäre Hintergründe miteinbezogen werden (Hahn 2015:32-33). Die These
der Lohndifferenzen als Grund für die Migrationsentscheidung wird von VertreterInnen der
New Economics of Migration wie Ode Stark infrage gestellt. Aus ihrer Sicht sind Kriterien wie
Unsicherheit, relative Verarmung und Risikoverminderung genauso zu berücksichtigen wie
die Einflussnahme der Familie (Hahn 2015:33).
Da es sich bei den klassischen Theorien um isolierte Betrachtungsweisen und monokausale
Erklärungsversuche handelt, denen der ganzheitliche Blick auf ein hoch komplexes Thema
fehlt, beschäftigen sich PolitikwissenschaftlerInnen und SoziologInnen seit Beginn des 20.
Jahrhunderts mit Ansätzen, die dem interdisziplinären Anspruch besser gerecht werden
(Hahn 2015:34). Dazu zählen die im anthropologisch-soziologischen Bereich angesiedelte
Theorie der Migrationsnetzwerke, die auch für diese Arbeit große Relevanz hat. Sie betont
nicht so sehr die Entstehung, sondern vielmehr das Andauern und die Selbstreproduktion von
Migration (Parnreiter 2000:36) und befasst sich mit sozialen Gruppierungen im Zielland (auch
Diaspora), die über eine eigene Infrastruktur verfügen, MigrantInnen mit Informationen
versorgen und durch das soziale Netzwerk ein Gefühl der Sicherheit geben (Spunda 2011:6).
Da diese Auslandsgemeinden Anfang der 1960er Jahre noch sehr klein waren, war der
2
Der homo oeconomicus kennt nur ökonomische Ziele und ist besonders durch Eigenschaften wie rationales Verhalten, das
Streben nach größtmöglichem Nutzen (Nutzenmaximierung), die vollständige Kenntnis seiner wirtschaftlichen
Entscheidungsmöglichkeiten und deren Folgen sowie die vollkommene Information über alle Märkte und Eigenschaften
sämtlicher Güter (vollständige Markttransparenz) charakterisiert (BPB 2018).
9Migrationsstrom trotz Einkommenskluft relativ gering. Mit der Vergrößerung der ansässigen
Diaspora sanken jedoch die Migrationskosten und die Migrationsströme in die Zielländer
stiegen an, wodurch sich die dort ansässigen Auslandsgemeinden weiter vergrößerten (Collier
2016:46-53). Die Theorie der Migrationsnetzwerke ist insofern von Bedeutung, als dass sie
erstmals die Rolle der Diaspora im Hinblick auf Migrationsentscheidungen betont.
Ebenso relevant für diese Arbeit ist die Theorie der Transnationalität, die vor allem im
Zusammenhang mit Rückkehrmigration und Rücküberweisungen (auch remittances3) in die
Herkunftsländer herangezogen wird. Sie geht davon aus, dass MigrantInnen auch weiterhin
eine starke Bindung zu ihrem Heimatland haben und es ihnen aufgrund des technischen
Fortschritts immer leichter möglich ist, den Kontakt zur Herkunftsgesellschaft zu pflegen.
Oftmals bleiben sie so stark mit dieser verbunden, dass sie ein Leben in sogenannten
„transnationalen Räumen“ führen. Die Herausbildung dieser transnationalen Gruppierungen
steht in einem ständigen Spannungsverhältnis zum Nationalstaat (Spunda 2011:6).
3
remittances = Geldüberweisungen bzw. Rücktransfers in die Heimat (Oberberger 2017)
102. Zum Zusammenhang von Migration und Entwicklung
Die Begriffe „Migration“ und „Entwicklung“ prägen die öffentliche Debatte mehr denn je. Beide
Termini scheinen im alltäglichen Sprachgebrauch auf keinerlei Verständnisschwierigkeiten zu
stoßen und trotzdem können ihnen je nach Verwendung und Wahrnehmung sehr
unterschiedliche Bedeutungen zukommen. Als Grundlage für diese Arbeit soll im Folgenden
eine Begriffsabgrenzung, die auch die Wechselwirkung der beiden Phänomene erläutert,
vorgenommen sowie der Einfluss von Migration auf eine Gesellschaft diskutiert werden.
2.1 Begriffsabgrenzung: Migration
Der Begriff „Migration“ bedeutet Wanderungsbewegung4. MigrantInnen sind Menschen, die
ihr Zuhause verlassen haben, um sich in einem anderen Land oder in einer anderen Stadt
vorübergehend oder dauerhaft niederzulassen (Campbell et al. 2010:168). Dem Human
Development Report zufolge lebten im Jahr 2015 rd. 244 Mio. Menschen außerhalb ihres
Heimatlandes (UNDP 2016:63), was sie zu internationalen MigrantInnen macht, die für diese
Arbeit relevant sind. Davon zu unterscheiden sind BinnenmigrantInnen, die nicht zwischen
Staaten, sondern innerhalb ihres Heimatlandes migrieren. Der letzten vorliegenden Statistik
zufolge wurde diese Gruppe im Jahr 2009 auf 740 Mio. Personen geschätzt (UNDP 2009:21).
2.1.1 Kategorisierung internationaler Migration
• Reguläre Migration: darunter fallen ArbeitsmigrantInnen (mit und ohne Familiennachzug,
temporär und permanent), BildungsmigrantInnen (Studierende, SchülerInnen, Au-Pairs),
echte Rückkehrende nach einem Auslandsaufenthalt sowie Zuziehende, die im Ausland
geboren wurden und erstmals nach Österreich einwandern (Migrationsrat 2016:18);
• Irreguläre Migration: diese Kategorie umfasst alle Personen, die rechtswidrig eingereist
und/oder ohne rechtmäßigem Aufenthaltstitel in einem Land sind, das nicht ihr
Herkunftsland ist (Migrationsrat 2016:19); dazu zählen auch MigrantInnen, die nach einem
rechtskräftig negativen Asylbescheid oder einem abgelaufenen Visum nicht ausreisen
(Spunda 2011:10);
• Asyl- bzw. Fluchtmigration: diese umfasst nach Art. 1 der Genfer Flüchtlingskonvention
1951 (GFK) alle Personen, die sich außerhalb ihres Herkunftslandes aufhalten, da ihnen
dort aus einem der fünf Konventionsgründe Verfolgung droht und kein Schutz im
Herkunftsland besteht (ebd.:8); bloße „Gewaltflüchtlinge“ erfasst die Konvention ebenso
wenig wie Klima- oder Wirtschaftsflüchtlinge (Uerpmann-Wittzak 2017:2-3).
4
https://www.duden.de/suchen/dudenonline/migration (Duden online 2018)
11Diese Kategorisierung ist vor allem im Hinblick auf den rechtlichen Anspruch auf Aufnahme
im Zielland relevant. Liegt nämlich eine begründete Flucht nach der GFK vor, so muss dieser
Person internationaler Schutz gewährt werden, was sie zu einer/m Asyl- oder subsidiär
Schutzberechtigen macht. AsylwerberInnen sind hingegen Personen, die sich zwar in einem
aufrechten Asylverfahren befinden, ihre Beweggründe aber möglicherweise nicht den
Konventionsgründen der GFK entsprechen (Spunda 2011:8-10). So lässt sich auch die
völkerrechtliche Unterscheidung zwischen freiwilliger und erzwungener Flucht – außerhalb
der klassischen Fälle eines anerkannten internationalen oder internen Konflikts – kaum
eindeutig treffen. Denn immer häufiger verlassen Menschen ihre Heimat nicht freiwillig,
sondern haben aufgrund ökonomischer, klimatischer und/oder politischer Faktoren keine
andere Wahl. Liegt eine solche Vielzahl an Migrationsgründen vor, spricht man auch von
mixed migration bzw. gemischter Wanderung (ebd.).
Nach Angaben des UN-Flüchtlingshochkommissariats (UNHCR) waren im Jahr 2016
insgesamt 65,6 Mio. Menschen auf der Flucht. Davon wurden rd. 39% bzw. 25,3 Mio.
gewaltsam aus ihrer Heimat vertrieben und fallen damit in die Kategorie der internationalen
„Asyl- bzw. Fluchtmigration“. In etwa 32% bzw. 21,3 Mio. blieben in ihrer Herkunftsregion und
waren in Ländern mit niedrigem und mittlerem Einkommen aufhältig, allen voran der Türkei,
Pakistan und dem Libanon. Nur etwa 6% bzw. 4 Mio. wagten die Reise in den Westen,
vorwiegend in die EU und die USA. Die übrigen 61% bzw. 40,3 Mio. wurden innerhalb ihres
Heimatlandes vertrieben und zählen daher zur Gruppe der „Binnenflüchtlinge“ (UNHCR
2017:2-3), die hier keine weitere Relevanz hat.
Da sich diese Arbeit neuen Ansätzen zur besseren Steuerung der Zuwanderung von
Drittstaatenangehörigen5 in die EU und nach Österreich widmet, sind in weiterer Folge die
beiden internationalen Phänomene „irreguläre Migration“ sowie „Asyl- bzw. Fluchtmigration“
von Bedeutung. Diese Auswahl liegt darin begründet, dass MigrantInnen beider Kategorien
mangels legaler Alternativen häufig den irregulären Fluchtweg wählen und dadurch die
Abgrenzung zwischen einer rechtswidrigen Einreise und einer begründeten Flucht nach der
GFK bis zum Zeitpunkt eines positiven Asylbescheids eine Schwierigkeit darstellt.
2.1.2 Irreguläre Migration vs. Fluchtmigration
Aufgrund der Abgrenzungsproblematik, die sich bei diesen beiden Migrationsphänomenen
ergibt, werden sie oft unter der Kategorie der „irregulären Migration“ zusammengefasst. Dem
Human Development Report zufolge liegt ihre Zahl im Jahr 2015 bei rd. 50 Mio. Menschen
5
Personen, die nicht aus der EU oder dem EWR stammen (Migrationsrat 2016)
12weltweit (UNDP 2016:63), wobei von einer großen Dunkelziffer auszugehen ist. In den Jahren
2015 und 2016 wurden allein auf der Mittelmeerroute mehr als 2,3 Mio. Menschen ohne legale
Dokumente von FRONTEX6 aufgespürt (EuroParl. 2017). Österreich zählt die irreguläre
Zuwanderung in einer Kriminalstatistik, die Tatverdächtige in der Kategorie „nicht
rechtmäßiger Aufenthalt“ erfasst. Dies ermöglicht einen Rückschluss auf den Bestand der in
Österreich nicht rechtmäßig aufhältigen Personen zu einem Stichtag, doch die
Schwankungsbreite ist groß. So liegt die Schätzung für das Jahr 2015 zw. 95.000 und 254.000
Personen (Migrationsrat 2018:20).
Exkurs: der „schützenswerte Flüchtling“ vs. der „illegale Migrant“
Irreguläre Migration und Fluchtmigration werden in der medialen und politischen Debatte
häufig als „illegale Migration“ bezeichnet. Ein Terminus, der diese beiden Kategorien auch im
neuen Regierungsprogramm 2017-2022 fälschlicherweise vereinheitlicht. Der Flüchtling
verschwindet damit gänzlich von der Bildfläche und der Bevölkerung wird unterschwellig
suggeriert, dass es sich bei Asylsuchenden um Personen handelt, die ihre Heimat freiwillig
verlassen haben und sich illegal im Land befinden (Die Zeit 30.12.2017). Die Verwendung des
Adjektivs „illegal“ impliziert, ein Aufenthaltsstatus sei nicht rechtmäßig verdient, ohne jedoch
das Motiv der Flucht oder die Gründe der Irregularität zu kennen. Denn wird beispielsweise
das Recht in einem Land geändert, so kann auch ein bis dahin legaler Aufenthalt plötzlich
„illegalisiert“ werden. Dieser Rechtsbruch macht aber noch keinen Menschen illegal
(Haase/Jugl 2007). Spricht man außerdem nur noch von MigrantInnen und nicht mehr von
Flüchtlingen, wird asylsuchenden Personen indirekt unterstellt, dass sie nicht zur Flucht
gezwungen waren und daher auch keinen Anspruch auf Asyl und auf die damit verbundenen
Vorteile haben sollten (Betkova 2017:131). Entscheidend bei dieser Methode des politischen
Framing7 sind hier nicht mehr die traditionellen Positionen und Inhalte, sondern wie die
Themen gesetzt und Debatten verschoben werden, um die eigene Werthaltung möglichst
mehrheitsfähig zu transportieren (Die Zeit 30.12.2017). In welche gegensätzliche Richtungen
diese mediale Einflussnahme führen kann, wird im Umgang mit der Flüchtlingskrise 2015 an
den Beispielen Deutschland und Großbritannien sichtbar. Während in Deutschland
Nationalismus und Fremdenfeindlichkeit als Bedrohung der Solidargemeinschaft angesehen
wurden, war einer der Schlüsselfaktoren für den Austritt Großbritanniens aus der EU der
Wunsch nach einer Reduktion der Zuwanderung (Betkova 2017:129-132).
6
FRONTEX = European Border and Coast Guard Agency (https://frontex.europa.eu/)
7
The framing theory suggests that how something is presented to the audience influences the choices people make about how
to process that information. Frames are abstractions that work to organize or structure message meaning. They are thought to
influence the perception of the news by the audience, in this way it could be construed as a form of second level agenda-setting
– they not only tell the audience what to think about but also how to think about that issue (Scheufele 1999)
132.2 Begriffsabgrenzung: Entwicklung
Der Terminus „Entwicklung“ umfasst die Bemühungen seit dem zweiten Weltkrieg, die
wirtschaftliche Grundlage der ärmsten Nationen aufzubauen. Dieser Fokus war das Resultat
verschiedener Faktoren wie des Wiederaufbaus nach dem Krieg und der Entkolonialisierung.
Vor allem Letzteres brachte eine Menge sehr armer Nationen hervor. Im Zuge der Einleitung
dieser neuen Ära im Jahr 1949 meinte Truman: “We must embark on a bold new program for
making the benefits of our scientific advances and industrial progress available for the
improvement and growth of underdeveloped areas… What we envisage is a program of
development based on the concept of democratic fair dealing.” (Zitat: Gelinas, in: St Martin’s
Press 1998). Und auch wenn diese Idee zum damaligen Zeitpunkt nicht mehr ganz neu war,
so hat sie trotzdem eine Bewegung hervorgebracht, die es sich zum Ziel machte, Armut
weltweit zu bekämpfen (Campbell et al. 2010:218).
Entwicklung ist seither gerade in der entwicklungspolitischen Debatte zu einem sehr
dehnbaren Begriff geworden. War das ursprüngliche Ziel der Entwicklungszusammenarbeit,
den Ärmsten der Armen zu helfen und Armut weltweit zu reduzieren, sind heutige
Entwicklungsinitiativen mannigfaltig und gehen durch die verstärkte Einbeziehung von
Eigeninteressen weit über das originäre Ziel hinaus.
2.2.1 Entwicklungen auf institutioneller Ebene seit Ende des zweiten Weltkriegs
Das erste Wirtschaftsförderungsprogramm, um nach dem zweiten Weltkrieg Armut und
Perspektivenlosigkeit in Europa zu bekämpfen geht in das Jahr 1948 zurück. Der damalige
Außenminister der Vereinigten Staaten, George C. Marshall hat unter dem Namen „Marshall-
Plan“ das European Recovery Program (ERP) ins Leben gerufen, unter dem 16 europäische
Länder Hilfslieferungen und Geldmittel für den Aufbau ihrer Wirtschaft erhielten (GLex 2018).
Zur Verwaltung des Marshall-Plans wurde 1948 die Organisation für europäische
wirtschaftliche Zusammenarbeit errichtet, die wiederum zum Vorläufer der 1961 etablierten
Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic
Co-operation and Development – OECD) wurde. Das Herzstück der OECD ist das
Development Assistance Committee (DAC), das die dreißig größten Geberinstitutionen unter
sich vereint und im Hinblick auf die globale Entwicklung im 21. Jahrhundert auf ökonomische,
soziale und ökologische Nachhaltigkeit setzt (OECD 1996:1-3; OECD 2018)
Die finanzielle Unterstützung früherer Kolonien durch Europa lässt sich bis zur Gründung der
Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) ins Jahr 1957 zurückverfolgen. Unter dem
Vertrag von Rom wurde der European Development Fund (EDF) errichtet, der seit dem Jahr
141958 auf Basis von bilateralen Partnerschaftsübereinkommen in Fünfjahreszyklen
implementiert wird. Mit dem anfänglichen Ziel afrikanischen Ländern finanzielle und
technische Hilfeleistung zu geben, hat sich das Instrument geografisch auf die Karibik und
den Pazifik ausgeweitet und ist Basis aktueller Kooperationsabkommen (EC 2018a).
Im Jahr 1994 stellt der Human Development Report der Vereinten Nationen ein neues
Konzept für menschliche Sicherheit vor. Der Vorschlag war ein Paradigmenwechsel in
Richtung einer nachhaltigen menschlichen Entwicklung, der gemeinsamen Mobilisierung
finanzieller Ressourcen und der Errichtung des Economic and Social Councils (ECOSOC) zur
Förderung einer nachhaltigen und inklusiven Entwicklung (UNDP 1994:1-11).
2.2.2 Entwicklungen auf EU- und UN- Ebene seit dem Jahr 2000
Im Jahr 2000 hat sich die Staatengemeinschaft erstmals darauf geeinigt, sich gemeinsame
Entwicklungsziele zu setzen und globale Partnerschaften zur Verwirklichung dieser Ziele
einzugehen. Daraufhin wurden acht Millennium Development Goals (MDGs) der Vereinten
Nationen völkerrechtlich verankert. Neben der Bekämpfung von Armut waren diese an die
Verbesserung von Bildung, Geschlechtergleichstellung, Gesundheit und
Umweltnachhaltigkeit gerichtet (UN 2018a). Da Migration zum damaligen Zeitpunkt noch
keine große Rolle in der öffentlichen Debatte spielte, war die Steuerung derselben auch im
entwicklungspolitischen Kontext kein Schwerpunktthema. Eine Ausnahme stellte Artikel 13
des Contonou-Kooperationsabkommens dar (siehe 3.1.4), der von „Armut, Arbeitslosigkeit
und schlechten Lebensbedingungen als Ursachen für abnorme Migrationsbewegungen“
ausgeht und diese zu adressieren versucht (ECDPM 2010).
Im November 2005 wurde der Europäische Entwicklungskonsens verabschiedet (EC 2008),
eine Weiterentwicklung der bis dahin getroffenen Vereinbarungen. Er ergänzt sie um die
Ergebnisse internationaler Entwicklungskonferenzen, wie etwa der Millenniumskonferenz und
den Konferenzen von Kairo, Johannesburg, Doha und Monterrey, und regelt die Gestaltung
der Entwicklungspolitik der Europäischen Kommission (European Commission - EC) und der
EU-Mitgliedstaaten. Die sieben Kernbereiche umfassen Handel und regionale Integration,
Umweltnachhaltigkeit und Infrastruktur, Wasser und Energie, Landwirtschaft und
Ernährungssicherheit, Demokratie und Menschenrechte, Konfliktprävention und Stabilität,
sowie menschliche Entwicklung und Beschäftigung (BMZ 2018a).
15Im September 2013 wurde die Entwicklungsagenda der MDGs mit der Nachhaltigkeitsagenda
der Rio+20 Konferenz8 zusammengeführt und gemeinsam bildeten sie die Grundlage für die
Agenda 2030 der UN für nachhaltige Entwicklung (BMZ 2018b).
„Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung bedeutet, die Bedürfnisse der
Gegenwart so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht
eingeschränkt werden. Dabei ist es wichtig, die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit –
wirtschaftlich effizient, sozial gerecht, ökologisch tragfähig – gleichberechtigt zu
betrachten. Um unsere globalen Ressourcen langfristig zu erhalten, sollte
Nachhaltigkeit die Grundlage aller politischen Entscheidungen sein.“9
Im Jahr 2015 wurden die 8 MDGs von den neu definierten 17 nachhaltigen Entwicklungszielen
bzw. SDGs abgelöst. Sowohl die Agenda 2030 der UN, wie auch die EU-
Ratsschlussfolgerungen vom Mai 2015 betonen die Wichtigkeit globaler Partnerschaften für
die erfolgreiche Umsetzung dieser Nachhaltigkeitsziele (EC 2015a).
Die in der Agenda 2030 formulierten SDGs umfassen neben den Inhalten der MDGs, Ziele
und Maßnahmen zu Energieversorgung, Wirtschaftswachstum, Industrie, Stadtentwicklung,
Konsum, Leben, Klimaschutz, Frieden und Sicherheit sowie eine Reduktion von Ungleichheit.
Letzteres ist seit dem unkontrollierten Anstieg von Migrationsbewegungen im Jahr 2015 für
den entwicklungspolitischen Diskurs von Bedeutung geworden und wird im Zuge dieser Arbeit
auch als SDG 10.7 Erwähnung finden. Neben der Reduktion von Ungleichheit innerhalb und
zwischen Ländern, geht es vor allem um die Gewährleistung einer geordneten, sicheren,
regulären und verantwortungsvollen Mobilität von Menschen, die durch die Implementierung
von Migrationsstrategien erreicht werden soll (UN-SD 2015). Von dieser vagen Formulierung
abgesehen findet Migration jedoch keine Erwähnung in den nachhaltigen Entwicklungszielen
der UN. Da aber gerade auf dieser Ebene die internationale Staatengemeinschaft beinahe
vollständig vertreten ist, wäre eine klare Zielvorgabe umso bedeutsamer.
2.3 Der Nexus von Migration und Entwicklung
Die Verknüpfung von Migration und Entwicklung ist keine Neuerung in der internationalen
Debatte. Je nach historischem Kontext wurde die hergestellte Verbindung zwischen den
beiden Phänomenen als positiv oder negativ wahrgenommen. So war die vorherrschende
Meinung in den 1950er und 1960er Jahren, dass Migration zu Entwicklung beitragen würde
und Arbeitsmigration einen positiven Effekt auf die Herkunftsländer hätte (Castles 2008:4). Da
8
UN-Konferenz zu nachhaltiger Entwicklung in Rio de Janeiro, 20.-22.6.2012
9
http://www.bmz.de/de/service/glossar/index.html?follow=adword (BMZ 2018)
16der langfristig gewünschte wirtschaftliche Erfolg jedoch gering blieb, kam es in den 1970er
Jahren zu einer eher negativen Haltung. Die Abwanderung qualifizierter Arbeitskräfte würde
zu einer Stagnation der eigenen wirtschaftlichen Entwicklung und einer erhöhten Abhängigkeit
vom Westen führen (Newland 2007). Während in den 1970er Jahren der damit verbundene
brain-drain10 im Vordergrund stand, vertrat man in den 1990er Jahren wieder mehrheitlich die
Meinung, dass Migration zu einem brain-gain11 beitragen könnte (Oberberger 2017:2).
Seit dem neuen Jahrtausend kam es zu einer Neuakzentuierung der Verbindung von
Migration und Entwicklung und Konzepte wie brain-gain, brain-circulation12 und remittances
sowie die wichtige Rolle der Diaspora rückten in den Mittelpunkt der Debatte. Sowohl in der
Migrations- wie auch in der Entwicklungsforschung war man sich einig, dass MigrantInnen
zum Aufbau ihres Heimatlandes beitragen könnten und damit zu wichtigen AkteurInnen in der
Entwicklungszusammenarbeit werden. Man betonte zunehmend das Potenzial von Migration
und versuchte migrations- und entwicklungspolitische Aspekte so zu verknüpfen, dass daraus
positive Effekte für alle Beteiligten resultierten. Dieser triple-win-Ansatz, der gleichermaßen
Vorteile für Aufnahmeländer, Herkunftsländer und MigrantInnen generieren sollte, wurde auch
von UN-Seite mitgetragen (Oberberger 2017:3; Spunda 2011:11-12). Was wiederum dazu
führte, dass die internationale Debatte angekurbelt und im Jahr 2007 das erste Global Forum
on Migration and Development organisiert wurde (Newland 2007).
Das gesteigerte Interesse an der Wechselwirkung von Migration und Entwicklung gründete
sich aus Sicht der Migrationsforschung auf drei Faktoren: 1) die positive Auswirkung der
gestiegenen remittances auf die Herkunftsländer, 2) die Unsicherheit hinsichtlich der
negativen Konsequenzen des brain-drains, sowie 3) das Anliegen der Zielländer,
Migrationsbewegungen durch EZA-Leistungen langfristig einzudämmen (Newland 2007). Aus
Sicht der Politikwissenschaften rückten vor allem remittances immer mehr ins Zentrum der
Aufmerksamkeit. Nicht zuletzt, weil man sich für die Finanzierung der MDGs – dies gilt umso
mehr für die SDGs – nach alternativen EZA-Geldern umsehen muss (Spunda 2011:12).
Die seit dem Jahr 2015 stark angestiegene Migrationsbewegung nach Europa und speziell
auch nach Österreich, hat die Auseinandersetzung mit dem Nexus neuerlich angeregt und
wieder in eine tendenziell negative Richtung gelenkt. Migration wird zunehmend als
Bedrohung der inneren Sicherheit, des Sozialstaats und der europäischen Kultur
wahrgenommen und von politischer Seite auch als solche transportiert. Verstärktes Ziel ist es
10
brain-drain = Abwanderung von Wissen und qualifizierten Arbeitskräften ins Ausland (Oberberger 2017)
11
brain-gain = Zugewinn von Wissen und qualifizierten Arbeitskräften durch Einwanderung (ebd.)
12
brain-circulation = grenzüberschreitende zirkuläre Bewegung von Wissen und qualifizierten Arbeitskräften (ebd.)
17daher, mit Hilfe der Entwicklungspolitik die Situationen in den Herkunftsländern zu verbessern,
um damit unerwünschte Migrationsbewegungen möglichst gezielt zu unterbinden (Oberberger
2017:3-4). Liegt der Fokus des internationalen Diskurses beinahe ausschließlich auf der
wirtschaftlichen Dimension von remittances, so stehen aus humanitärer Sicht nach wie vor
Rechte wie physische und menschliche Sicherheit, Aufenthalt und menschenwürdige
Behandlung von MigrantInnen im Vordergrund - zwei Perspektiven, die sich auch in der
aktuellen Debatte diametral gegenüberstehen (WB 2017; Spunda 2011:13-14).
Unabhängig von humanitären Aspekten, die die Menschenrechte der MigrantInnen in den
Vordergrund rücken, stellt sich die Frage, ob Entwicklung zu mehr internationaler Migration
beiträgt oder diese langfristig eindämmt. Auch hier existieren nach wie vor unterschiedliche
Ansichten in der akademischen und politischen Auseinandersetzung. Sieht die Außen-,
Sicherheits- und Entwicklungspolitik die Steuerung und Eindämmung irregulärer Migration
vorwiegend in der Erforschung und Bekämpfung der sogenannten root causes13, sind
MigrationsforscherInnen mehrheitlich der Meinung, dass mehr Entwicklung zu höherer
Mobilität führt und es dadurch zu einem Anstieg internationaler Migrationsbewegungen
kommen würde (Castles 2008:2).
Bei der Verwendung des Nexus von Migration und Entwicklung als Instrument zur
Migrationssteuerung erscheint es daher essentiell zu betonen, dass dieser nach wie vor von
Doppeldeutigkeit und Unschärfe geprägt ist. So kann Migration einerseits Entwicklung
hemmen und andererseits fördern. Und umgekehrt kann Entwicklung dazu führen Migration
einzudämmen, oder aber sie zu verursachen. Möchte man diesen Ansatz also tatsächlich für
die Gestaltung der Entwicklungs- und Migrationspolitik heranziehen, bedarf es einer
vorherigen Abgrenzung und kontextuellen Einbettung des Untersuchungsgegenstands, da
ansonsten lediglich von einer Wechselbeziehung auszugehen ist (Spunda 2011:21-22).
2.4 Die Bedeutung von Migration für eine Gesellschaft
Migration nimmt in jeder ihrer Ausprägungen sowohl Einfluss auf die Aufnahmegesellschaft
von MigrantInnen wie auch auf die Zurückgebliebenen in ihren Herkunftsländern. Neben einer
Vergrößerung der Diversität und einer schrittweisen Veränderung homogener
Bevölkerungsstrukturen bis hin zu Multikulturalismus und der Abwanderung von Minderheiten,
Eliten und politisch Verfolgten, sind vor allem soziale und wirtschaftliche Konsequenzen von
Interesse und Bedeutung für die Ausrichtung der Migrationspolitik.
13
root causes = tiefere Ursachen (Uerpmann-Wittzak 2017)
182.4.1 Soziale und wirtschaftliche Folgen für die Aufnahmegesellschaft
Eine Vergrößerung der Diversität durch Einwanderung kann in vielerlei Hinsicht positiv sein
und zu erhöhter Innovationskraft und Produktivität beitragen. In Zeiten großer Zuwanderung
wird gesellschaftliche Vielfalt aber häufig auch als Bedrohung der eigenen kulturellen Identität
wahrgenommen, was einige Herausforderungen mit sich bringt (Migrationsrat 2016:33-36). Je
nach Aufnahmekapazitäten, Wohlstand und wirtschaftspolitischer Ausrichtung der
Aufnahmegesellschaft sind soziale und wirtschaftliche Konsequenzen spürbar.
Soziale Aspekte
Nach den Grundsätzen einer sozialen Demokratie geht es um die Bereitstellung von
Kollektivgütern wie innere und äußere Sicherheit, ökonomische Wohlfahrt und sozialstaatliche
Garantien, Gerechtigkeit in der Verteilung von Grundgütern, Einkommen, sozialer Sicherung
und Lebenschancen sowie die Vermeidung extremer Ungleichheit (Merkel 2016:28). Sind
diese Voraussetzungen gewährleistet, erhöhen sich die soziale Inklusion und die politische
Teilhabe aller Personen an einer Gesellschaft, was wiederum positiv zur Stabilität und
Funktionalität einer Demokratie beiträgt (Meyer 2007). Bei den sozialen Folgen für die
Aufnahmegesellschaft geht es daher um Umverteilung und Kooperation und die Bereitschaft
der Erfolgreichen, die weniger Erfolgreichen mittels Transferleistungen zu unterstützen
(Collier 2016:67-69). Aber auch das Ausmaß der Einwanderung und die Geschwindigkeit, mit
der sich MigrantInnen den Vertrauensnormen und Grundwerten der Aufnahmegesellschaft
anpassen, haben soziale Auswirkungen auf dieselbe. Gegenseitige Rücksichtnahme und
sozial gerechte Einkommensverteilung sind keine angeborenen Verhaltensregeln, korrelieren
aber positiv mit gegenseitiger kultureller Toleranz und einer gemeinsamen Identität, wie am
Beispiel Europas sichtbar wird. Da Einwanderer jedoch nicht nur ihr Humankapital, sondern
auch ihre Moralvorstellungen mitbringen, sind kulturelle Unterschiede, die das Sozialverhalten
beeinflussen, oft nur schwer zu überwinden. Mitgefühl, Kooperation und gegenseitige
Verantwortung, auch seitens der weniger Erfolgreichen, erzeugen ein gemeinsames
Identitätsgefühl, während wachsende Diversität und kulturelle Distanz zu einer Verringerung
der Umverteilungsbereitschaft und der Absorptionsrate seitens der Mehrheitsgesellschaft
beitragen. Die Konsequenzen können Ausgrenzung, Rassismus und die Bildung von
Parallelgesellschaften sein, was einer raschen Integration entgegenwirkt und die
Aufnahmegesellschaft schwächt (ebd.:75-107).
Ökonomische Aspekte
Das kooperative System einer sozialen Demokratie ist fragil und kann jederzeit ins Wanken
geraten, was auch am Beispiel des Generationenvertrags sichtbar wird. Denn durch die
voranschreitende Globalisierung, in der sich die Zahl der LeistungsträgerInnen in einem Staat
19aufgrund der erhöhten Mobilität und des Geburtenrückgangs stetig verkleinert, gerät es weiter
unter Druck. Eine ökonomisch rationale Reaktion darauf wäre, die Leistungen des
Sozialstaats zurückzuschrauben, was aber vor allem zu Lasten der eigenen
Staatsangehörigen ginge. Und da dies im politischen Kontext einer demokratischen
Gesellschaft nur in geringem Maße möglich ist, richtet sich eine ökonomisch rationale
Migrationspolitik auf die alternative Option der Eindämmung irregulärer Zuwanderung. Denn
Menschen, die aufgrund geringer Qualifikationen und sprachlicher Barrieren wenig oder keine
Chancen am Arbeitsmarkt haben, würden das ohnehin schon fragile Sozialsystem noch
zusätzlich belasten und mit dem Teil der einheimischen Bevölkerung in Konkurrenz treten,
der auf staatliche Unterstützung angewiesen ist (Sieferle 2017:23-27). Doch aus rein
wirtschaftlicher Sicht hätte eine moderate Einwanderung vorwiegend positive Auswirkungen
auf die einheimische Bevölkerung. Denn gemäß den Grundlehren der Ökonomie kann bereits
die wohlhabende Mittelschicht einen Nutzen aus jeder zusätzlichen Arbeitskraft ziehen, die zu
geringeren Konditionen arbeiten würde, wie Kindermädchen und Reinigungskräfte. Und auch
die Nachfrage nach Wohnungen, Gütern und Dienstleistungen steigt durch Zuwanderung an.
Ist diese selektiv genug, um den Fachkräftemangel zu beheben, könnten Unternehmen ihre
Produktivität steigern. Die Löhne am unteren Ende der Skala würden sich dadurch zwar
kurzfristig verringern, aber langfristig aufgrund des zusätzlichen Wachstums wieder ansteigen
(Collier 2016:119-125). Bei einer massiv anhaltenden Einwanderung hingegen würden die
Löhne durch gegenseitiges Unterbieten auch langfristig sinken und die Ungleichheit innerhalb
der Bevölkerung würde sich vergrößern. Die Zunahme der Einkommensunterschiede führt zu
mehr Kapitalkonzentration auf der einen Seite und zu mehr Armut, weniger Chancen und einer
geringeren Wohlfahrt auf der anderen Seite. Um die entstandene Kluft zwischen Arm und
Reich zu verringern und weiterhin zur Überwindung des globalen Ungleichgewichts
beizutragen, müssten die Sozialtransfers aus öffentlichen Mitteln erhöht werden. Die durch
die größere Vielfalt generierten Gewinne wären daher auf lange Sicht geringer als die sozialen
Kosten eines dysfunktionalen Sozialmodells (ebd.:145; Milanovic 2016:116-131).
2.4.2 Wirtschaftliche und sozio-politische Folgen für die Herkunftsländer
Migration hat aber auch Einfluss auf die Zurückgebliebenen sowie wirtschaftliche und sozio-
politische Konsequenzen für die Herkunftsländer. Um sie zu benennen, werden häufig die
Synonyme brain-drain, brain-circulation und remittances verwendet.
Ökonomische Aspekte
Das Konzept des brain-drains kam im Entwicklungskontext bereits in den 1970er Jahren auf
und bezeichnet die Abwanderung der gebildetsten und ehrgeizigsten Mitglieder einer
Gesellschaft. Diese einseitige Darstellung des Abzugs von qualifizierten Arbeitskräften, den
20damit verbundenen Produktivitätsverlusten in den Herkunftsländern der MigrantInnen und
dem gleichzeitigen Zugewinn an Wissen und Fähigkeiten in den Zielländern, auch als brain-
gain bezeichnet, wurde in den 1990er Jahren relativiert (Oberberger 2017:10-11). Einerseits
kam die Annahme hinzu, dass die Chance auf Auswanderung nicht nur Talente abzieht,
sondern auch zu weiterer Bildung und Anstrengung motiviert und dadurch neue Talente
fördert, die den direkten Verlust wieder ausgleichen würden (Collier 2016:205-210).
Andererseits wurde deutlich, dass Auswanderungsströme nicht immer nur eindimensional
sind, da MigrantInnen mit den Zurückgebliebenen in Kontakt bleiben und/oder selbst wieder
in ihre Herkunftsländer zurückkehren. Dadurch kommt es zu einem Transfer bzw. zu einer
Zirkulation von Wissen und Know-how, auch als brain-circulation bekannt. Hinzu kommen aus
ökonomischer Sicht die Geldtransfers der MigrantInnen an ihre Angehörigen. Diese
Rücküberweisungen oder remittances wurden für das Jahr 2017 auf 444 Milliarden US-Dollar
geschätzt. Das ist beinahe das Vierfache der staatlichen Entwicklungshilfe und in etwa
dieselbe Summe wie ausländische Direktinvestitionen, nur wesentlich stabiler (WB 2017).
Tragen Rücküberweisungen in der Regel aber nur ein paar Prozent zum
Haushaltseinkommen der im Heimatland ansässigen Familienmitglieder bei, so ist ihr
Versicherungseffekt in Krisensituationen enorm. Denn immerhin werden rund 60% eines
plötzlichen Einkommensrückgangs, oftmals katastrophenbedingt, durch zusätzliche
Geldtransfers abgedeckt. Aus ökonomischer Sicht gleicht der Nutzen der Überweisungen den
Verlust an Qualifikationen wieder aus und Migration wird aus Sicht der Zurückgebliebenen als
positiv wahrgenommen, wobei Länder am unteren Ende der Weltwirtschaft am stärksten von
den negativen Folgen betroffen sind und gleichzeitig am meisten von den positiven
Auswirkungen profitieren (Collier 2016:221-231).
Sozio-politische Aspekte
Eine weitere, nicht unwesentliche Form des Einflusses von MigrantInnen auf ihr Heimatland
ist der Transfer von demokratischen und sozialen Werten, vor allem weil Angehörige von
Minderheiten eher auswandern als Angehörige der Mehrheitsbevölkerung. So sind
Auslandsgemeinden häufig Nährboden für die politische Opposition, deren Ideen und
Vorbilder oftmals Unterstützung gewinnen, da ihre Mitglieder als Rollenmodelle fungieren.
MigrantInnen können in den Aufnahmeländern sehen, wie eine gute Regierungsführung
aussieht und welche sozialen Mechanismen in ihren Heimatländern fehlen und in der Regel
übertragen sie ihr politisches Engagement auf die Zurückgebliebenen. RückkehrerInnen
bringen im besten Fall neue Normen und Werte mit und können zu Katalysatoren der
Veränderung werden, da sie mit Menschen interagieren, die für Außenstehende nur schwer
erreichbar sind. Dieser positive Transfer von einem neuen Demokratieverständnis hängt
jedoch stark davon ab, wie gut Einwanderer in die Aufnahmegesellschaft integriert waren bzw.
21Sie können auch lesen