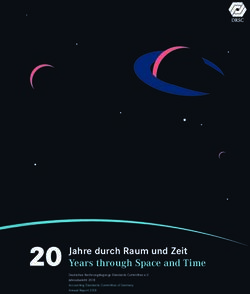I r ht immer - Ingolstadt
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
i r h t immer
Nahal t
Nachhaltigkeitsbericht Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt 2018| 19
Jährliche Durchschnittstemperatur für
Deutschland 1881–2018,
Wetterdaten: DWD
(https://showyourstripes.info/ (25.11.19).
Nachhaltigkeitsbericht
www.ku.de/ Herausgeberin:
nachhaltigkeit Katholische Eichstätt-Ingolstadt,
November 2019
Foto Titelseite: Christian KlenkLiebe Leserinnen liebe Leser
ich freue mich, als Präsidentin der Katholischen Universität Eichstätt- ■ Wie können wir noch achtsamer mit Ressourcen umgehen?
Ingolstadt das Vorwort für den Nachhaltigkeitsbericht 2018 / 2019 der ■ Wie können wir mehr Menschen zum Umdenken motivieren, damit
KU an Sie, liebe Leserinnen und Leser, zu richten. sie sich für einen nachhaltigeren Lebensstil begeistern?
Vorwort Wir können auf eine lange Tradition zurückblicken, denn dies
ist bereits der siebte Nachhaltigkeitsbericht, den die KU veröffentlicht.
■ Wie bringen wir mehr Menschen dazu, sich mit unserer Umwelt zu
beschäftigen und sie zu schützen?
Ende 2018 wurde die KU erneut vom Bundesministerium für Bildung ■ Wie schaffen wir ein Gefühl der Verbundenheit bei Nachhaltigkeits-
und Forschung sowie der Deutschen UNESCO-Kommission als be- themen?
sonderer Lernort für nachhaltige Entwicklung ausgezeichnet, da die
KU seit 2010 auf vorbildliche Weise ein Nachhaltigkeitsgesamtkonzept Ich möchte Sie, liebe Leserinnen und Leser, an dieser Stelle auch dazu
in Forschung, Lehre und Campusmanagement verfolgt. Weiter erhielt motivieren, sich bewusst mit den eigenen Auswirkungen auf die Umwelt
CHD*4@KRDQRSD4MHUDQRHSĔSHM#DTSRBGK@MCHL,ĔQYC@R9DQSHjJ@S zu beschäftigen und über Ihren eigenen Lebensstil nachzudenken. Viel-
„EMASplus“ („Eco-Management and Audit Scheme“) der Europäischen leicht lässt sich das eine oder das andere noch optimieren …
Union. Dieses anspruchsvolle Managementsystem ermöglicht es der Ein großer Dank gilt allen Autorinnen und Autoren sowie Mit-
KU, Verantwortung für ihr Handeln zu übernehmen und dabei nicht nur wirkenden, die zur Entstehung des Nachhaltigkeitsberichts beigetragen
ökologische (wie bei EMAS), sondern auch ökonomische und soziale haben und damit zur besseren Verankerung des Themas an der Katholi-
Auswirkungen zu betrachten. schen Universität Eichstätt-Ingolstadt.
Damit stellen wir uns laufend der Frage, wie wir als Menschen Bei der Lektüre des Nachhaltigkeitsberichts wünsche ich Ihnen
gerecht mit begrenzten, ökologischen Ressourcen umgehen — fair für viele neue Anregungen und gute Ideen für einen nachhaltigen Umgang
heutige und zukünftige Generationen. Denn unsere Gesellschaft ist mit der Umwelt und miteinander.
nur funktionsfähig, wenn wir uns auf gemeinsame Grundwerte eini-
gen, die jede*r Einzelne lebt. Damit wir als nachhaltige Universität uns
auch weiterhin in den sechs Handlungsfeldern Governance, Forschung, Ihre
Lehre, Transfer, studentisches Engagement und Campusmanagement Prof. Dr. Gabriele Gien
weiterentwickeln, um noch nachhaltiger zu werden, diskutieren wir in Präsidentin der KU Eichstätt, im November 2019
verschiedenen Formaten u. a. diese konkreten Fragestellungen, die wir
uns alle immer wieder ins Gedächtnis rufen sollten:
2 Nachhaltigkeitsbericht 2018 | 19 Nachhaltigkeitsbericht 2018 | 19 3Inhaltsverzeichnis Inhaltsverzeichnis
2 Vorwort 55 5.5.3 Arbeitskreis Shalom für Gerechtigkeit und Frieden
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1
56 5.5.4 DenkNachhaltig! e.V.
6 Einleitung
56 5.5.5 KHG – Katholische Hochschulgemeinde
8 1 Die KU in Zahlen und Fakten 57 5.5.6 SDS – Die Linke Hochschulgruppe Eichstätt
2 10 2 Nachhaltigkeit als Leitbild der KU 57 5.5.7 Umweltreferat
6
11 2.1 Das Nachhaltigkeitsgesamtkonzept der KU 58 6 Campusmanagement
13 2.2 Institutionalisierung und Steuerung 58 6.1 Ziele, Maßnahmen, Erfolge
3 14 3 Forschen für die Nachhaltigkeit 58 6.2 Der Campus der KU
14 3.1 Ziele, Maßnahmen, Erfolge 60 6.3 Aufbau des Nachhaltigkeitsmanagementsystems
15 3.2 Forschungsprojekte mit Bezug zur Nachhaltigkeit 60 6.2.1 Nachhaltigkeitsleitlinien
16 3.2.1 EU-Interreg-Projekt „Danube Floodplain“ 61 6.3.2 Nachhaltigkeitsorganisation
18 3.2.2 DFG-Forschungsgruppe: Veränderung hochalpiner Landschaften durch 62 6.3.3 Beschreibung der Nachhaltigkeitsorganisation
den Klimawandel 62 6.3.4 Umweltaspekte und die Handlungsfelder der KU
20 3.2.3 Quo vadis Pollen? 64 6.4 Umweltleistungen
22 3.2.4 Naturbeobachtung zur Förderung der biopsychosozialen 64 6.4.1 Strom und Heizenergie
Gesundheit und des Engagements im Naturschutz 66 6.4.2 Emissionen (CO2-Ausstoß)
24 3.2.5 Nachhaltige Lebensstile in der Region 10 68 6.4.3 Wasser und Abwasser
26 3.2.6 BNE in der Hochschullehre und an den Seminarschulen 69 6.4.4 Papierverbrauch und Abfälle
28 3.2.7 Nachhaltige Destinationsentwicklung auf Lanzarote 71 6.5 Nachhaltigkeitsprogramm und Nachhaltigkeitsziele
– ein Forschungs- und Lehrprojekt 76 6.6 EMASplus
4 30
30
31
32
4 Nachhaltigkeit im Studium
4.1 Ziele, Maßnahmen, Erfolge
4.2 Einblicke in die Studiengänge
4.2.1 Master „Geographie: Bildung für nachhaltige Entwicklung“
7 80
80
82
83
7 Partnerschaften, Kooperationen und Netzwerke
7.1 Internationale Partnerschaften
7.2 (Inter-)Nationale und bayerische Netzwerke
7.3 Regionale Netzwerke und Kooperationen
36 4.2.2 Kooperationsprojekt: Studierende an die Schulen 83 7.3.1 Steuerungsgruppe Fairtrade Stadt Eichstätt
37 4.2.3 Erwachsenenbildung für nachhaltige Entwicklung 83 7.3.2 fairEInt – Initiative nachhaltige Region Eichstätt
8
– Postgraduale Studien in Erwachsenenbildung 84 8 Nachhaltigkeit im Transfer – Dialoge ermöglichen
38 4.3 Module und Lehrveranstaltungen 85 8.1 Transferprojekt „Mensch in Bewegung“
38 4.3.1 Lehrveranstaltungen mit Bezug zur Nachhaltigkeit 88 8.2 Veranstaltungen an der KU
42 4.3.2 Grundlagen und praktische Umsetzungsbeispiele für nachhaltige Entwicklung 88 8.2.1 „Zukunftsfähige Landwirtschaft“ – Vortragsreihe und Tagung
43 4.3.3 Studium.Pro „Nachhaltige Entwicklung 1 und 2“ 90 8.2.2 Nachhaltigkeitswoche 2018:
44 4.3.4 Nachhaltigkeitsziele und Nachhaltigkeitskonzept als Seminarthemen Weniger ist mehr – Nachhaltigere Weihnachten
45 4.3.5 Mobilitätsverhalten von Studierenden der KU Eichstätt-Ingolstadt 91 8.2.3 Projekt Laudato Si‘ – „Die päpstliche Enzyklika im Diskurs
46 4.3.6 Studierende gestalten eine BNE-Konferenz mit für eine Große Transformation“
47 4.3.7 Konzeption eines Nachhaltigkeitsparcours für die Landesgartenschau 2020 92 8.2.4 Werbender Bericht – berichtende Werbung? Argumentation und
in Ingolstadt Persuasion in der Nachhaltigkeitsberichterstattung
48 4.4 Nachhaltigkeitspreis für Abschlussarbeiten 2018 93 8.2.5 Netzwerk „Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) in Schulen“
5 50 5 Nachhaltige KU als Lebensraum – studentische Initiativen 94 8.2.6 Vortragsreihe des Zentralinstituts für Lateinamerikastudien (ZILAS)
51 5.1 KU als familienfreundliche Hochschule 95 8.2.7 Ringvorlesung „Nachhaltigkeit in China“
52 5.2 Chancengerechtigkeit 96 8.3 Publikationen und Vorträge über die Nachhaltigkeit an der KU
53 5.3 „Lernen fürs Leben“ 97 8.4 Homepage
53 5.4 Partizipation und Mitbestimmung 98 Zusammenfassung & Ausblick
54 5.5 Engagement studentischer Hochschulgruppen
100 Anhang
54 5.5.1 Amnesty International Hochschulgruppe Eichstätt
55 5.5.2 Arbeitskreis Kapuzinergarten Eden
4 Nachhaltigkeitsbericht 2018 | 19 Nachhaltigkeitsbericht 2018 | 19 5Einleitung Einleitung
Ei l it g
Einleitung
Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
des Rates für nachhaltige Entwicklung (RNE
2018) (https://www.nachhaltigkeitsrat.de/wp-content/
uploads/2018/05/Deutscher_Nachhaltigkeitskodex_
Hochschulen.pdf), den Kriterien, die im Rahmen
schaften dargestellt, um für weiteres Engagement
zu motivieren. Ein Anspruch auf Vollständigkeit
besteht nicht. Es ist erfreulich festzustellen, dass
sich die KU ihrem selbstgesetzten Ziel einer nach-
des vom Bayerischen Staatsministerium für Um- haltigeren Universität mit stetigen Schritten nähert.
Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) orientiert sich seit 2010 am Leitbild VDKS TMC 5DQAQ@TBGDQRBGTSY jM@MYHDQSDM /QNIDJ- Dieser Bericht ist, wie sein Vorgänger,
einer nachhaltigen Entwicklung. Sie strebt dabei eine stärkere Etablierung einer Bildung für tes „Nachhaltige Hochschule: Kriterien zur Be- etwas weniger umfangreich als in den Jahren
nachhaltige Entwicklung (BNE) an. standsaufnahme“ (KriNaHo), dessen Leitung bei zuvor. Die Steuerungsgruppe Nachhaltigkeit
Unter nachhaltiger Entwicklung verstehen wir grundsätzlich – in Übereinstimmung mit der KU lag, entwickelt wurden (www.nachhaltige- der KU hat sich nach ausführlicher Diskussion
dem Rat für nachhaltige Entwicklung – eine ökologisch, ökonomisch und soziokulturell aus- hochschule.de/projekte) sowie an den Handlungs- entschieden, eine Print-Version des Berichtes
gewogene Entwicklung, die globale und intergenerationelle Gerechtigkeit berücksichtigt. Dabei feldern des BMBF-Verbundprojektes Hoch-N. beizubehalten, aber den Papierverbrauch wei-
vertreten wir jedoch das Ziel einer sogenannten starken Nachhaltigkeit, weil wir die natür- In Anlehnung an diese o. g. Kriterien ist SDQ YT QDCTYHDQDM 'HDQEŘQ VHQC CHD Tk@FD CDR
lichen Ressourcen als Grundvoraussetzung für alle anderen Entwicklungsfelder ansehen. der Bericht nach folgenden sechs Handlungs- diesjährigen Berichtes weiter reduziert und er-
feldern gegliedert: gänzend mit Flyern auf die Onlineversion ver-
■ Governance (Kap. 2) wiesen. Für diejenigen, die sich intensiver in-
■ Forschung (Kap. 3) formieren möchten, sind weiterführende Links
■ Lehre / Studium (Kap. 4) genannt. Wir empfehlen auch einen Blick auf
Ziel einer BNE ist, dass die zukünftigen Ent- stellen sich den aktuellen Herausforderungen ■ Lebensraum / studentisches Engagement unsere Webseite, auf der Sie stets die neuesten
scheidungsträger*innen Gestaltungskompetenz einer nachhaltigen Entwicklung und tragen zum (Kap. 5) JSHUHSĔSDMjMCDMwww.ku.de/nachhaltigkeit).
erwerben, um zu einer nachhaltigen Entwicklung Erreichen der 17 Nachhaltigkeitsziele (Sustaina- ■ Campusmanagement (Kap. 6) Ohne die Unterstützung vieler Personen
der Gesellschaft beizutragen. Eine solche Bil- ble Development Goals) der UN bei. Durch Ein- ■ Transfer (Kap. 7, 8) wäre der Nachhaltigkeitsbericht in seiner jetzigen
dung erfordert die Verbindung von Forschung beziehung der gesamten Universität hat die KU Innerhalb dieser Felder erfolgte eine Orientierung Form nicht möglich gewesen. Unser Dank gilt all
und Lehre und ist dann erfolgreich, wenn man begonnen, einen Campus zu gestalten, auf dem am Kodex des RNE und den Kriterien von Kri- denen, die dazu beigetragen haben, u. a. allen
sich auf dem Campus selbst um eine nachhaltige auch zukünftige Generationen gut leben und ler- NaHo. Autor*innen, die Texte und Bilder beigesteuert
Entwicklung bemüht. Die KU strebt daher an, nen können. Die KU agiert zudem seit 2018 ge- Dieser siebte Nachhaltigkeitsbericht der haben, den Mitgliedern der Steuerungsgruppe
(B)NE zu einem konstitutiven Element in allen meinsam mit der TH Ingolstadt durch das Trans- KU zeigt die im Jahr 2018 erzielten Erfolge in den Nachhaltigkeit & fairer Handel, Frau Claudia
Bereichen ihrer Tätigkeit (Forschung, Lehre, fer-Projekt „Mensch in Bewegung“ im Cluster oben genannten Handlungsfeldern auf und gibt Pietsch für das schöne Layout des Berichtes und
Campusmanagement, Governance, Transfer, Nachhaltige Entwicklung verstärkt in der Region einen Ausblick auf Entwicklungspotentiale im nicht zuletzt dem Präsidium der KU.
studentische Initiativen) zu machen, wie es auch 10 und darüber hinaus. Jahr 2019. Dabei werden auch kleinere Errungen-
das UNESCO-Weltaktionsprogramm BNE (2015 Nachhaltigkeitsberichterstattung an
– 2019) und der Nationale Aktionsplan BNE Hochschulen ist ein noch relativ neues Feld. Die Ingrid Hemmer (Nachhaltigkeitsbeauftragte),
(2017) für Institutionen fordern. Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI) für Johannes Baumann (Campusumweltmanager)
Nachhaltigkeit ist an der KU nicht Ziel Unternehmen lassen sich nicht ohne Weiteres auf und Ina Limmer (Mitarbeiterin der Nachhaltig-
DHMHFDQ 6DMHFDQ %@BGRODYHjRBGD HMSDQCHRYHOKH- Hochschulen übertragen. Der hier vorliegende keitsbeauftragten) sowie Samuel Steinhilber und
näre und transdisziplinäre Forschungsprojekte Bericht orientiert sich darum in erster Linie am Michaela Spindler als studentische Ko-Autor*innen
und Lehrveranstaltungen in allen Fakultäten deutschen Nachhaltigkeitskodex für Hochschulen
6 Nachhaltigkeitsbericht 2018 | 19 www.deutscher-nachhaltigkeitskodex.de Nachhaltigkeitsbericht 2018 | 19 7Die KU in Zahlen und Fakten
1
KU Eichstätt-Ingolstadt – Fakultäten Fakultät für Religionspädagogik
und Kirchliche Bildungsarbeit (FH)
Fakultät für Soziale Arbeit (FH)
Die KU in Zahlen
37.663 +DXSWQXW]ĻÁFKHLQP
Geschichts- und Gesellschaftswissen-
schaftliche Fakultät
(Dezember 2018) Mathematisch-Geographische
und Fakten Fakultät
4.955 Zahl der Studierenden
Philosophisch-Pädagogische
Fakultät
(WS 18/19)
Sprach- und Literaturwissenschaft-
924 liche Fakultät
Theologische Fakultät
D ie Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt ging 1980 aus einer Gesamt-
hochschule hervor. Sie wird getragen von der „Stiftung Katholische Universität
Eichstätt-Ingolstadt“, einer kirchlichen Stiftung des öffentlichen Rechts. Vorsitzender
Zahl der Beschäftigten
(Stichtag: 31.12.18)
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
des Stiftungsrates war bis Oktober 2018 Weihbischof Dr. Dr. Anton Losinger, seit
November 2018 ist Generalvikar Dr. Dr. Peter Beer im Amt; Magnus Cancellarius
der KU ist Reinhard Kardinal Marx. Im Jahr 1989 wurde die Wirtschaftswissen-
48
Zahl der Gebäude
Ingolstadt (WFI – Ingolstadt School
of Management)
schaftliche Fakultät auf dem Campus Ingolstadt gegründet. Die KU hat seitdem
die beiden Standorte Eichstätt und Ingolstadt und führt seit 2001 den Namen Ka-
tholische Universität Eichstätt-Ingolstadt. Das Leitungsteam der Katholischen Uni- Tabelle 1: Rahmendaten der KU Eichstätt-Ingolstadt
versität Eichstätt-Ingolstadt bestand 2018 aus Prof. Dr. Gabriele Gien (Präsidentin),
Prof. Dr. Markus Eham (Vizepräsident (VP) Studium und Lehre), Prof. Dr. Jens Hog-
reve (VP Forschung und wissenschaftlicher Nachwuchs), Prof. Dr. Klaus Stüwe (VP
(MSDQM@SHNM@KDR/QNjKDMSVHBJKTMFRNVHD3GNL@R*KDHMDQS*@MYKDQ
2018 Beschäftigte Studierende Gesamt
Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt ist in
2017
acht Fakultäten gegliedert (siehe rechte Seite Über- 6.000 6.000
6.231
6.205
6.176
6.053
5.962
5.879
sicht Fakultäten). 2016
5.410
5.426
5.330
5.269
5.120
4.955
4.000 4.000
In Eichstätt sind sieben der Fakultäten angesiedelt, in 2015
Ingolstadt hat die Wirtschaftswissenschaftliche Fakul-
784
795
805
846
842
924
2014 2.000 2.000
tät ihren Sitz. An beiden Orten gibt es Hörsäle, eine
2013 0 0
Mensa, Rechenzentrumseinrichtungen und Bibliotheks-
gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft.
In Tabelle 1 sind einige wichtige Rahmendaten der KU
Abbildung 1: Anzahl der Universitätsangehörigen
Eichstätt-Ingolstadt zusammengestellt.
(Quelle: Stiftung KU Eichstätt-Ingolstadt, Zahlen jeweils zum 01.12. des Kalenderjahres
ohne Stiftungsmitarbeiter*innen, ohne studentische Hilfskräfte, inkl. Mitarbeitende, die durch
das Ministerium oder einen anderen Arbeitgeber zugewiesen wurden)
8 Nachhaltigkeitsbericht 2018 | 19 Nachhaltigkeitsbericht 2018 | 19 9Nachhaltigkeit als Leitbild der KU
2 Nachhaltigkeit als
2.1 Das Nachhaltigkeitsgesamtkonzept der KU …
… wurde im Dezember 2010 im Rahmenpapier
„Bildung für nachhaltige Entwicklung – Vision
s c hu ng
und Auftrag der Katholischen Universität Eich- re
L eh
Leitbild der KU stätt-Ingolstadt“ von der Hochschulleitung ver-
For
abschiedet und zur Grundlage ihres weiteren
Go
Leitungshandelns gemacht. er
v
Das Nachhaltigkeitsgesamtkonzept ba- na
nc
siert auf einigen vorhergehenden Initiativen: Mitte e
Stu Tr ansfer
der 1990er Jahre wurde durch das Umweltreferat d e
E ng
nt
des Studentischen Konvents das Konzept „Pro-
NACHHALTIGERE KU
isc
2019 jekt Zukunftsfähige Universität“ erarbeitet, das
mpus- t
ag
em
hes
maßgeblich zu einer Belebung der Themen Um- en
t Ca en
welt und Nachhaltigkeit an der KU beitrug. 1995 m a n a ge m
2018
hat die KU in enger Zusammenarbeit mit Part-
nern aus Kommunen, Verbänden und Wirtschaft
■ EMASplus
das Altmühltal-Projekt durchgeführt und als eine
2017
■ externe Evaluation
der ersten Universitäten Deutschlands zur ge-
des Nachhaltigkeitskonzepts Nachhaltigkeits-
sellschaftlichen Verankerung des Leitbildes Nach-
■ für 2018 / 19 und 2019/20: Auszeichnung als Lernort konzept der KU
2016
haltige Entwicklung in einem transdisziplinären
mit hoher Strahlkraft (Weltaktionsprogramm BNE) Prozess beigetragen (vgl. www.faape.org/
■ Fairtrade Universität altmuehltal-agenda21.pdf).
2015
Nach einer Phase der Stagnation ge-
■ Auszeichnung als Lernort mit hoher wann 2008 der Studentische Konvent mit seiner Konzeption des „Sustainable
Abbildung 2: Die KU auf dem Weg zu einer nachhalti-
2013
Strahlkraft (Weltaktionsprogramm BNE) Campus“-Konzeptes einen Preis beim Ideenwettbewerb Generation D. 2010
wurde neben dem Nachhaltigkeitsgesamtkonzept in der Stiftungsverfassung der
■ EMAS-Zertifizierung
geren Universität (I. Hemmer / I. Limmer)
KU vom 15. September 2010 in Artikel 3, Absatz 5 beschrieben: Die Universität Info.Box
2012
berücksichtigt und vertieft „[…] in Forschung und Lehre dabei insbesondere das
1994 – 1995
Das Nachhaltigkeits-
christliche Menschenbild sowie die ethischen Grundsätze der Personalität, der Ge- konzept zum
■ Auszeichnung als UN-Dekade-Projekt
2010
rechtigkeit, der Solidarität sowie der Subsidiarität und Nachhaltigkeit […]“. Des Download finden Sie
Weiteren wurde 2013 dieser Anspruch in die Grundordnung der KU übernommen. unter: www.ku.de/
nachhaltigkeit
■ Erster Nachhaltigkeitsbericht Das Nachhaltigkeitsgesamtkonzept von 2010 macht deutlich, dass nach-
haltige Entwicklung an der KU bedeutet, sie zum konstitutiven Element in allen
Tätigkeitsbereichen der Universität zu machen. Im Jahr 2013 wurde das Nachhaltig-
■ Nachhaltigkeitsgesamtkonzept ■ Graduiertenkolleg Nachhaltigkeit keitskonzept der KU von der Deutschen UNESCO-Kommission als Projekt der UN-
(Forschung, Lehre, ■ Master BNE
Campusmanagement) ■ Nachhaltigkeitsbeauftragte
■ Studentisches Umweltreferat ■ Umweltringvorlesung ■ Altmühltal-Agenda 21
10 Nachhaltigkeitsbericht 2018 | 19 11Nachhaltigkeit als Leitbild der KU Nachhaltigkeit als Leitbild der KU
2.2 Institutionalisierung und Steuerung
Die Verantwortlichkeiten verteilen sich wie folgt:
Die Beschreibung erfolgt in zeitlicher Reihenfolge.
www.ku.de/unsere-ku/nachhaltigehochschule/nachhaltigkeitentwicklung
• Nachhaltigkeitsbeauftragte
Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ sowie in den Jahren 2010 Im Juli 2010 wurde Frau Prof. Dr. Ingrid Hemmer von der Hochschulleitung zur Nach-
2016 und 2018 im darauf folgenden Weltaktionsprogramms BNE Juli haltigkeitsbeauftragten ernannt. Nach dem Wechsel der Hochschulleitung wurde sie in
als Lernort für nachhaltige Entwicklung in der höhesten Stufe (drei den Jahren 2012 und 2017 erneut zur Nachhaltigkeitsbeauftragten bestellt.
ausgefüllte Blätter) ausgezeichnet. „Die Katholische Universität
Eichstätt-Ingolstadt verfolgt seit 2010 auf vorbildliche Weise ein • Nachhaltigkeitsgesamtkonzept
Nachhaltigkeitsgesamtkonzept in Forschung, Lehre und Campus- 2010 • Steuerungsgruppe
management. Sie überzeugt mit einer kontinuierlichen Umsetzung Dez. • Berichterstattergruppe
und Weiterentwicklung: Seit 2014 ist Nachhaltigkeit ein zentrales Bereits im Dezember 2010 wurde eine Steuerungsgruppe einberufen, die Vertreter*innen
Handlungsfeld im Entwicklungsplan. In der Steuerungsgruppe aus den Fakultäten, zentralen Einrichtungen und Verwaltungsbereichen sowie Studieren-
Foto 1: EMASplus-Auszeich-
nung der KU im Februar 2019 arbeiten Vertretende der Fakultäten, der Verwaltungsbereiche und der Studie- de und damit alle wesentlichen internen Anspruchsgruppen umfasst (vgl. Anhang). Die
(KU Media)
renden zusammen. Darüber hinaus hebt die Jury besonders den jährlichen Gruppe tagt ein- bis zweimal im Jahr und bespricht weitere Maßnahmen und aktuelle
-@BGG@KSHFJDHSRADQHBGS RNVHD CHD $, 2 9DQSHjYHDQTMF GDQUNQf RN CHD )TQX CDQ 'DQ@TRENQCDQTMFDM (L 1@GLDM CDQ 5NQADQDHSTMF CDQ $, 2 9DQSHjYHDQTMF JNMRSHSTHDQSD
deutschen UNESCO-Kommisssion. Nicht zuletzt konnte die KU im Juli 2017 die sich ergänzend die so genannte Berichterstatter*innengruppe (vgl. Anhang).
Info.Box Auszeichnung Fairtrade University entgegennehmen.
Seit 2018 wird in einem partizipativen Prozess, ausgehend von der • Kanzler als Nachhaltigkeitsverantwortlicher
DUK: 2012 • Campusumweltmanager
Deutsche UNESCO-
Steuerungsgruppe „Nachhaltigkeit & fairer Handel“, das Nachhaltigkeitsgesamt-
Kommission konzept überarbeitet. Es werden neue Ziele und Maßnahmen formuliert und 2012 wurde der Kanzler, Herr Thomas Kleinert, zum Verantwortlichen innerhalb der
BMBF: zudem die Handlungsfelder „Governance“, „Transfer“, „Studentische Initiativen Hochschulleitung für den Bereich Nachhaltigkeit ernannt. Ebenfalls 2012 wurde eine
Bundesministerium & Engagement“ hinzugenommen. Im Sommer 2019 wurde die Umsetzung des halbe Stelle für einen Campusumweltmanager geschaffen, die seit 2013 Herr Johannes
für Bildung und
Forschung
Nachhaltigkeitsgesamtkonzeptes von 2010 sowie der Entwurf des neuen Kon- Baumann inne hat.
zeptes extern von Expert*innen des Hoch-N-Netzwerkes evaluiert. Die Ergeb-
nisse der Evaluation werden in das neue Nachhaltigkeitsgesamtkonzept, das ab • Zentrales Handlungsfeld
TLFDRDSYSVHQC DHMkHDDM 2014 • Nachhaltigkeitsleitlinien
Im Februar 2019 erhielt die KU als erste Hochschule Deutschlands das • Erstes Umweltprogramm im Rahmen von EMAS
9DQSHjJ@Ss$, 2OKTRf -@BGCDLCHD*4ADQDHSRHL)@GQ@KRDQRSD4MHUDQRHSĔS Das Präsidium verankerte im Januar 2014 Nachhaltigkeit als zentrales Handlungsfeld
in Bayern ihr Umweltmanagementsystem nach EMAS („Eco-Management and in ihrem Entwicklungsplan, beschloss Nachhaltigkeitsleitlinien und seitdem jährlich ein
Audit Scheme“ der Europäischen Union) überprüfen ließ, ist die Universität mit dem Umwelt- (EMAS) bzw. Nachhaltigkeitsprogramm (EMASplus) (vgl. Kap. 6.5).
MDTDM9DQSHjJ@SDHMDM2BGQHSSVDHSDQFDF@MFDM$, 2OKTRDQVDHSDQSC@R4LVDKS-
L@M@FDLDMS TL DHMD RNYH@KD TMC ŅJNMNLHRBGD /DQRODJSHUD #@LHS UDQOkHBGSDS • Personelle Unterstützung der Nachhaltigkeitsbeauftragten
sich die KU dazu, ihre ökologischen, sozialen und ökonomischen Wirkungen regel- 2016 Im Herbst 2016 wurde Frau Ina Limmer zeitlich befristet als Mitarbeiterin der Nachhaltig-
Foto 2: Auszeichnung der KU als mäßig systematisch überprüfen zu lassen und kontinuierlich zu optimieren. keitsbeauftragten eingestellt, um die zahlreichen Aktivitäten im Bereich Nachhaltigkeit
Lernort mit Auszeichnung (2018/19)
im Rahmen des Weltaktions-
zu unterstützen.
programms BNE (BMBF; DUK)
• 2017 Fairtrade Universität
2017 Im Juli 2017 wurde die KU als Fairtrade Universität ausgezeichnet. Die Steuerungs-
gruppe wurde im Rahmen der Auszeichnung als Fairtrade University um den Bereich
fairer Handel erweitert.
• Januar 2018 Projekt „Mensch in Bewegung“ mit Cluster Nachhaltige Entwicklung
2018 Mensch in Bewegung ist ein gemeinsames Transfer-Projekt der KU und der TH Ingol-
Jan. stadt und wird im Rahmen des Programms „Innovative Hochschule“ (BMBF) bis Ende
2022 gefördert. (vgl. Kap. 8.1)
12 Nachhaltigkeitsbericht 2018 | 19 13Wi
ik nachhaltige Stadt- und r ts
h ch
Über die einzelnen Fächer hinweg ist die KU am Et Regionalentwicklung
aft
nachhaltiges
3
Umweltgerechtigkeit
BMBF-Projekt Hoch-N als Pilothochschule be- und Umwelthandeln Landmanagement
teiligt und im wissenschaftlichen Beirat des Bildung für nachhaltige
Entwicklung
Projektes vertreten. Neben Spezialtagungen in Weltinnenpolitik Klimafolgenforschung und
Globalisierungsforschung
einzelnen Fächern gab es 2017 Tagungen im FORSCHUNG Mensch-Umwelt-Forschung
Kontext des Projektes Laudato Si‘ (vgl. Kap. ZUR NACHHALTIGKEIT
nachhaltige
Ökosystementwicklung
8.2.3) sowie 2018 eine interdisziplinäre Vor- AN DER KU Mensch-Umwelt-
eit
tragsreihe und Tagung zur „Zukunftsfähigen Verhältnisse
htigk
Nachhaltigkeit und
Forschen für die
Umw
Nachhaltigkeits-
Landwirtschaft“ (vgl. Kap. 8.2.1). Ethik im Finanzsystem
management
Die KU ist in der Forschung Partner- Ethische Figuren
rec
nachhaltiger
elt
der Nachhaltigkeitsdiskurse Tourismus
hochschule im Hoch-N-Netzwerk und Mitglied
Ge
Nachhaltigkeit in mehreren anderen Netzwerken, die sich u. a.
auch mit Forschung beschäftigen (vgl. Kap. 7).
Die KU fühlt sich den Prinzipien gesellschaftlich
Sustainability
Reporting
Verantwortungs-
kommunikation
Laudato Sí
UDQ@MSVNQSKHBGDM %NQRBGDMR UDQOkHBGSDS 9TQ /QŘ- S oz i a l e s
fung, ob Verstöße gegen die Regeln wissenschaft-
lichen Arbeitens vorliegen, wurde bereits vor Jahren ein
wissenschaftlicher Ausschuss gegründet.
3.1 Ziele, Maßnahmen, Erfolge 3.2 Forschungsprojekte mit Im Folgenden werden einige der im Jahr 2018
laufenden Projekte näher dargestellt:
Im Rahmen ihres Nachhaltigkeitsgesamtkonzeptes Die Sichtbarmachung des Forschungsfeldes
Bezug zur Nachhaltigkeit
G@SRHBGCHD*4UDQOkHBGSDS %NRBGTMFHL!DQDHBG wurde auf der Nachhaltigkeitswebseite (https:// 3.2.1 EU-Interreg-Projekt „Danube Floodplain“ verbindet
einer nachhaltigen Entwicklung zu fördern. Bereits www.ku.de/unsere-ku/nachhaltigehochschule/ Auf der Nachhaltigkeitshomepage der KU sind Hochwasserschutz mit Artenschutz
2010 war das Graduiertenkolleg „Nachhaltigkeit in nachhaltigkeitforschung) bereits seit 2011 stetig insgesamt rund 95 abgeschlossene und laufende
Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft“ ins Leben ausgebaut. Vor allem gelang es, die bisherigen Forschungsprojekte (Stand Juli 2018) verzeichnet, 3.2.2 DFG-Forschungsgruppe SEHAG: Veränderung
gerufen worden. Daneben gab es viele weitere und aktuellen Forschungsaktivitäten im Bereich welche sich laut Auskunft der Projektleiter*innen hochalpiner Landschaften durch den Klimawandel
Forschungsprojekte mit Bezug zur Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit zu dokumentieren. Die eingestellten bzw. der Einschätzung der Nachhaltigkeitsbeauf-
Das Nachhaltigkeitskonzept der KU sieht vor, in Forschungsprojekte werden jährlich aktualisiert. tragten der Nachhaltigkeitsforschung zuordnen 3.2.3 Untersuchungen zur Pollenausbreitung und Pollen- und
enger Absprache mit dem Vizepräsidenten für Der Ausbau der Forschungsaktivitäten liegt der- lassen, darunter auch eine Reihe von gewichtigen Samenqualität als Beitrag zur Generhaltung bei der Esche
Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs zeit primär in der Hand der einzelnen Wissen- Drittmittelprojekten. Ein Anspruch auf Vollständig-
u. a. folgende Maßnahmen anzustreben: schaftler*innen. keit besteht nicht. 3.2.4 Naturbeobachtung zur Förderung der biopsycho-
Seit 2018 ist die KU gemeinsam mit der 10,8 % der Drittmitteleingänge stamm- sozialen Gesundheit und des Engagements im Naturschutz
■ Sichtbarmachung dieses Forschungs- TH Ingolstadt (THI) im Verbundprojekt „Mensch in ten 2018 von expliziten Nachhaltigkeitsprojekten,
schwerpunkts Bewegung“ aktiv, das vom Bundesministerium für weitere 18,8 % weisen nach Zuordnung durch die 3.2.5 Nachhaltige Lebensstile in der Region 10 – Eine Studie
■ Ausbau der Forschungsaktivitäten Bildung und Forschung im Rahmen des Programms Nachhaltigkeitsbeaufragte einen impliziten Bezug zum nachhaltigen Konsum
■ Beteiligung an Forschungsprogrammen „Innovative Hochschule“ für fünf Jahre gefördert zur Nachhaltigkeit auf. Die Projekte weisen eine
■ Durchführung von Tagungen wird. Im Rahmen der Clusterthemen Nachhaltige große Bandbreite im Nachhaltigkeitsspektrum auf. 3.2.6 Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE)
■ Beteiligung an Netzwerken Entwicklung, Bürgerschaftliches Engagement, In- Fast 40 Fachvertreter*innen aus unterschiedlichen in der Hochschullehre und an den Seminarschulen –
novative Mobilität und Digitale Transformation will Fachgebieten (Biologiedidaktik, Geographie, Jour- ein Forschungs- und Fortbildungsprojekt
das Projekt mit innovativen Ideen zu einem positiven nalistik, Psychologie, Religionspädagogik, Soziale
Wandel (v. a. in der Region 10) beitragen. Im Fokus Arbeit, Soziologie, Theologie, Wirtschaftswissen- 3.2.7 Nachhaltige Destinationsentwicklung auf Lanzarote
des Projektes steht der Transfer (vgl. Kap. 8.1), es schaften) und allen Fakultäten sind an den Projek- – ein Forschungs- und Lehrprojekt
dient aber damit auch der Forschung. ten beteiligt.
14 Nachhaltigkeitsbericht 2018 | 19 Nachhaltigkeitsbericht 2018 | 19 15Forschen für die Nachhaltigkeit Forschen für die Nachhaltigkeit
Hochwasser-
& Artenschutz
EU-Interreg-Projekt „Danube Floodplain“ verbindet
3.2.1 Hochwasserschutz mit Artenschutz
kŘRRDMlADJNLLDM #TQBGCHD!DSQ@BGSTMFCDR
gesamten Donauraums ist gewährleistet, dass
suchen, ob und welche positiven Effekte die
noch bestehenden Auengebiete, in die bereits
alle Anrainerstaaten von der Verbesserung des eingegriffen wurde, haben. Dazu dienen die fünf
länderübergreifenden Wassermanagements und Pilotgebiete in der Slowakei (March), in Ungarn
Projektleiter: der Hochwasserrisikovorsorge bei gleichzeitiger (Theiß), Slowenien (Krka), in Serbien (Donau) und
Prof. Dr. Bernd Cyffka (Professur für %ŅQCDQTMFCDQ!HNCHUDQRHSĔSOQNjSHDQDM in Rumänien (Donau). Deutschland und Öster-
Angewandte Physische Geographie) Durch das Projekt, das noch bis zum reich sind bei den Pilotgebieten nicht vertreten.
Laufzeit: Juni 2018 30. November 2020 läuft, werden umfassende Sie stehen aber für die Länder am Unterlauf der
bis November 2020 Erkenntnisse in Bezug auf die integrative Wasser- Donau als wichtige Ansprechpartner in Bezug
Finanzierung: EU Interreg bewirtschaftung erwartet, z. B. zur Wiederher- auf die Auenthematik und den Hochwasser-
Projekttyp: Verbundprojekt stellung von Flussauen, zur Kombination von schutz zur Verfügung, weshalb das Projekt auch
Projektpartner: 24 klassischer und grüner Infrastruktur sowie über Gelegenheit zum intensiven Austausch mit den
Projektbearbeiter*in: natürliche Wasserrückhaltemaßnahmen unter Expert*innen vor Ort bietet.
Florian Betz, Einbeziehung aller einschlägigen Interessenver- Von deutscher Seite sind die TU München mit
Marion Gelhaus treter. Basierend auf den Ergebnissen werden dem Lehrstuhl für Hydrologie und Flussgebiets-
folgende Werkzeuge erstellt: management (Prof. Dr.-Ing. Markus Disse), die
• Ein Handbuch zur Wiederherstellung und Er- KU Eichstätt-Ingolstadt mit dem Aueninstitut
haltung der Auen des Donaueinzugsgebiets, das Neuburg (Prof. Dr. Bernd Cyffka) als ausführende
sich hauptsächlich an Fachleute und Umsetzer Projektpartner sowie das Bayerische Staats-
vor Ort richtet. ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz
Foto 3: Die Vertreter der drei deutschen teilnehmenden Institutionen (v.l.n.r.): • Eine strategische Leitlinie für ein nachhaltiges mit dem Referat Nationales und Internationales
Prof. Dr. B. Cyffka (KU EI), Ministerialrat Dr. K. Arzet (STMUV) und
Prof. Dr. M. Disse (TUM) (S. Schulte-Strathaus/upd)
Auenmanagement im Donaueinzugsgebiet, die Flussgebietsmanagement (Dr. Klaus Arzet) sowie
die wichtigsten Erkenntnisse in einem Handbuch die Bundesanstalt für Gewässerkunde als asso-
für die breitere Öffentlichkeit zusammenfasst. ziierte Partner beteiligt.
#HD TDM DMSK@MF CDQ #NM@T RHMC +DADMRQ@TL EŘQ S@TRDMCD 3HDQ TMC /k@MYDM- • Ein Fahrplan für das Donaueinzugsgebiet, der Neben administrativen Aufgaben im Projekt ob-
arten und bieten gleichzeitig über Ländergrenzen hinweg einen natürlichen Rück- die nächsten Schritte und Meilensteine für die liegt der KU das Erfassen von Ökosystem-
halt von Wasser im Sinne eines „grünen Hochwasserschutzes“. Vor diesem Hinter- Realisierung von Auenprojekten benennt. leistungen, Erstellen von Habitatmodellen für
grund beteiligt sich das Aueninstitut der KU unter der Leitung von Prof. Dr. Bernd relevante Arten oder Lebensraumtypen, Unter-
Cyffka (Professur für Angewandte Physische Geographie) am EU-Projekt „Danube Die beteiligten Wissenschaftler*innen, unter der stützen bei der Priorisierung von Maßnahmen
Floodplain“, das auch den Erhalt und die Wiederherstellung von Auenbereichen Führung der nationalen rumänischen Wasser- zur Auenrenaturierung sowie Aussprechen von
zum Ziel hat. behörde „Apele Romane“ (Lead-Partner), unter- Empfehlungen für Sanierungsmaßnahmen.
Seit dem 1. Juni 2018 arbeiten 24 Projektpartner aus zehn Ländern des
Donauraums in dem Interreg-Projekt „Danube Floodplain“ zusammen. Das Projekt
wird von der EU im Rahmen des „Danube Transnational Programme“ mit rund Weitere Informationen zum Projekt unter:
3,7 Millionen Euro gefördert.
ŜinterregŞanubeŜeuŵapproeŞproje tŵanubeŞ»ooplain
„Ziel des Projektes ist eine Win-Win-Situation, bei der Fragen des Wasser-
L@M@FDLDMSRTMCCDQ/QĔUDMSHNMUNMăADQkTSTMFDMUDQATMCDMVDQCDMLHSCDL
Aspekt von Artenvielfalt, der durch Auen bewahrt und gefördert wird“, erklärte der
Leiter des Aueninstituts, Prof. Dr. Bernd Cyffka. Im Projekt „Danube Floodplain“ sol-
KDM QD@KD@TRFDVĔGKSVDQCDM HMCDMDM TDMkĔBGDM DGDL@KHFD2DHSDM@QLD 2SHKK- Foto 4: Verlauf der Donau (S. Schulte-Strathaus/upd)
FDVĔRRDQTRV VHDCDQ MRBGKTRR@MCDM'@TOSkTRRlCHD#NM@TLHSHGQDM-DADM-
16 Nachhaltigkeitsbericht 2018 | 19 Nachhaltigkeitsbericht 2018 | 19 17Forschen für die Nachhaltigkeit Forschen für die Nachhaltigkeit
Foto 6 und 7: Vergleich des Zufall-
und Langenferners im Martelltal
(Italien / Südtirol), links 1890 (Archiv
Veränderung hochalpiner Landschaften des DAV), rechts 2015 (M. Altmann).
3.2.2 durch den Klimawandel
Neue DFG-Forschungsgruppe SEHAG Abbildung 3: Die Temperaturentwicklung der Alpen im globalen
Vergleich. Hierbei zeigt sich, dass der Anstieg der Temperatur in
„SEnsitivität HochAlpiner Geosysteme gegenüber den Alpen den globalen Trend seit den 1980er Jahren deutlich
übersteigt (Prof. Dr. B. Marzeion, Klimageographie, Universität Bre-
dem Klimawandel seit 1850“ men, historische Daten: Morice et al. 2012 und Auer et al. 2007, die
Prognose bis 2050 basiert auf 15 Klimasimulationen des Modells
CMIP5 (Szenario RCP 8.5)).
Im Zentrum der Forschung stehen die drei die photogrammetrische Auswertung historischer
hochalpinen Täler Horlachtal, Kaunertal (Öster- Photographien, mit deren Hilfe Veränderungen der
Foto 5: (v.l.) KU-Präsidentin reich / Tirol) und Martelltal (Italien / Südtirol). Die mit $QCNADQkĔBGD TMC CDR !DVTBGRDR J@QSHDQS TMC
Prof. Dr. G. Gien mit dem Leiter dem Klimawandel einhergehende Veränderung gemessen werden können. Während der Projekt-
der neuen DFG-Forschungs-
gruppe, Prof. Dr. M. Becht, des Niederschlags und der Temperatur beein- laufzeit werden die Täler mit Hightechmethoden
sowie PD Dr. F. Haas und PD Dr. kTRRS M@BG CDQ QADHSRGXONSGDRD CDR /QNIDJSR UDQLDRRDM+@RDQRB@MMDQ #QNGMDMADkHDFTMFDM
T. Heckmann (Klenk/upd).
verschiedene Prozesse, die sich maßgeblich auf TMCHMRSQTLDMSHDQS*KHL@RS@SHNMDM AkTRRODFDK
Der Effekt der Klimaerwärmung das Erscheinungsbild und die Dynamik der Land- um den Zusammenhang zwischen Wetter und
eiter:
Projektl Dr. Florian ist im Hochgebirge der Alpen seit dem schaft im Hochgebirge ausgewirkt haben und Witterung einerseits und den Prozessen in der
el Becht, PD
Prof. Dr. Micha s Heckmann Ende der „kleinen Eiszeit“ genannten neuzeit- dieses weiterhin verändern werden. Die Arbei- Natur andererseits besser zu verstehen. In einer
as, PD Dr . Tobia lichen Kaltphase (ca. 1850) augenscheinlich durch das ten beschäftigen sich demzufolge nicht mit dem zweiten Projektphase (2022–2024) sollen an-
Ha 2021
: 2019 bis
Laufzeit 2024) Abschmelzen der Gletscher erkennbar. Weniger offensicht- Klimawandel selbst, sondern mit dessen Folgen. schließend, aufbauend auf den gesammelten Er-
hase: 2022 bis
(zweite Projektp lich und nur wenig untersucht sind hingegen die Auswirkungen Im Speziellen sind damit beispielsweise gemeint: kenntnissen, mittelfristige Veränderungen bis zum
rung:
nzie t (DFG) und des Klimawandels auf andere Elemente und Prozesse in Hoch- Veränderungen der Vegetation, wie z. B. der An- Jahr 2050 mithilfe von Modellen prognostiziert
ungsgemeinschaf
Fi na
Deutsche Forsch ssenschaftsfonds (FWF) gebirgslandschaften sowie auf deren Wechselwirkung und eventuelle stieg der Baumgrenze; das Abschmelzen der werden. Die Forschungsfragen haben im Hinblick
sch er Wi
Österreichi ndprojekt
Konsequenzen für die talabwärts gelegenen Gebiete. Auf diese offenen &KDSRBGDQ AkTRRCXM@LHJ TMC &DQŅKKSQ@MRONQS auf die Veränderungen des Wasserhaushalts (v. a.
yp: Verbu Fragen konzentriert sich die neue, von der DFG und dem FWF geförderte in Wildbächen; Folgen des Auftauens dauer- saisonale Verfügbarkeit zur Energiegewinnung)
Projektt
ppe)
(Forschungsgru artner :
Forschungsgruppe SEHAG. haft gefrorener Fels- und Schutthänge (Perma- und der Geröllfracht (z. B. Auffüllung von Stau-
Projektp Am 1. Januar 2019 startete das Großprojekt in Zusammenarbeit frost); Veränderungen der Schneedecke und der seen) einen Bezug zum Themenkomplex Nach-
emen,
Universitäten Br
Foto 8 und 9: Laser-
mit Wissenschaftler*innen der oben genannten Universitäten aus den Fach- Lawinenaktivität; potenziell gefährliche Ereignisse haltigkeit.
, TU Wien scanner (oben) und XR6-
Innsbruck bereichen Hydrologie, Klimatologie, Geographie, Botanik und Geodäsie. wie Steinschlag und Muren. Wer die Forschungsgruppe unterstützen Kopter (unten). Hightech-
en
und TU Münch
methoden zu Erfassung
Koordinator der Forschungsgruppe ist Prof. Dr. Michael Becht, Inhaber Das Projekt ist hierbei in zwei Phasen ge- möchte und historische Fotos (19./20. Jahr- der aktuellen Dynamik
des Lehrstuhls für Physische Geographie an der KU. Ziel dieser gliedert. In der ersten Projektphase (2019 – 2021) hundert) aus den genannten Untersuchungs- CDQ$QCNADQkĔBGDHMCDM
Untersuchungsgebieten
Forschungsgruppe ist es, die unterschiedlichen Fachdisziplinen sollen die Veränderungen seit 1850 rekonstruiert gebieten besitzt, kann sich gerne mit dem Ko- (M. Altmann).
zu vernetzen, um die Folgen der Klimaerwärmung in den werden. Hierbei bedienen sich die Wissen- ordinator der Forschungsgruppe in Verbindung
Alpen gemeinsam zu rekonstruieren und anschließend schaftler*innen historischer Daten und werten setzen (michael.becht@ku.de).
für die nähere Zukunft zu prognostizieren. diese mit neuesten Methoden aus. Hierzu zählen
verfeinerte Modellrechnungen (sog. Reanalysen)
zur Rekonstruktion des Witterungsverlaufs und
Mehr zum Projekt unter: https://sehag.ku.de/
18 Nachhaltigkeitsbericht 2018 | 19 Nachhaltigkeitsbericht 2018 | 19 19Forschen für die Nachhaltigkeit Forschen für die Nachhaltigkeit
3.2.3
3.2.1 Quo vadis Pollen?
Untersuchungen zur (effektiven) Pollenausbreitung
und Pollen- und Samenqualität als Beitrag zur
Generhaltung bei der Esche
Foto 12: Aufbau der Wetterstation auf der Eschenplantage bei
Emmendingen (A. Eisen)
Maßnahmen sind daher dringend zu klären. Das ge-
Foto 10: Eschenplantage bei Schorndorf (J. Jetschni) netische System als Summe der Mechanismen, die Foto 13: Samenernte im Auwald bei Neuburg a. d. Donau (A. Eisen)
Foto 11: Triebsterben einer Esche (J. Jetschni)
zur Weitergabe der genetischen Information führen,
Projektbetreuung: ist jedoch noch weitgehend unerforscht.
Prof. Dr. Susanne Jochner-Oette Das Hauptziel dieses Projekts unter der Lei-
Laufzeit: 2018-2021 tung von Prof. Dr. Susanne Jochner-Oette (Professur werden kann. Auch soll der Paarungserfolg in Ab-
Finanzierung: Bayerisches
Aktuelle Schadwirkungen auf Wälder werden nicht nur durch direkte und indirekte Effek- für Landschaftsökologie und nachhaltige Ökosystem- hängigkeit von der Schädigung des Vaterbaums auf-
te des Klimawandels hervorgerufen (z. B. Borkenkäfer, Windwurf), sondern auch durch entwicklung) ist es, neue Erkenntnisse zur (effektiven) gedeckt werden.
Staatsministerium für Ernährung,
Krankheiten, verursacht von pilzlichen Erregern. Die Folgen einer hohen Mortalität von Pollenausbreitung sowie zur Pollen- und Samenquali- Mit den Untersuchungen im Auwald bei
Landwirtschaft und Forsten über die
Waldbäumen sind drastisch und reichen vom Verlust der biologischen Vielfalt bis hin zu tät der vom Eschentriebsterben bedrohten Esche Neuburg a. d. Donau und in zwei Samenplantagen bei
Bayerische Landesanstalt für Wald und
Veränderungen der biochemischen Stoffkreisläufe. Da mindestens 10 % der Bäume welt- in Abhängigkeit ihres Gesundheitszustandes zu Schorndorf und Emmendingen in Baden-Württem-
Forstwirtschaft (LWF)
weit als anfällig für Krankheiten und Pathogene gelten, ist die Erforschung und das Ma- generieren. Bei einer Fragmentierung der Eschen- berg will das Projekt dazu beitragen, diese Wissens-
Projekttyp: Kooperationsprojekt
nagement biotischer Risiken, vor allem in Zeiten des Klimawandels, äußerst relevant, um ONOTK@SHNM HRS DHM DEEDJSHUDQ &DMkTRR YVHRBGDM QD- lücken zu schließen, Handlungsempfehlungen für
Projektpartner:
auch weiterhin einen nachhaltigen Waldumbau gewährleisten zu können. sistenten Bäumen notwendig, weshalb hierbei Aus- Forstwirte abzuleiten und Generhaltungsstrategien
Bayerisches Amt für
Aufgrund ihrer Wärme- und Trockenresistenz galt die Gemeine Esche (Fraxinus sagen zum Eschenpollentransport wichtig sind. zu entwickeln.
Waldgenetik (AWG),
excelsior L.) vormals als vielversprechende Baumart für den Waldumbau. Durch das Eschen- #@GDQ RNKK CDQ $HMkTRR CDQ !DRS@MCRCHBGSD TMC CDQ
Dr. Barbara Fussi
triebsterben, ausgelöst durch den Pilz mit dem Namen „Falsches Weißes Stengelbecher- Meteorologie auf den aerobiologischen Pollentrans-
chen (Hymenoscyphus fraxineus) ist die Esche akut in ihrer Existenz gefährdet. Blätter, Triebe port erforscht und die Auswirkungen des Eschentrieb-
und Holz der Esche werden nach und nach von den Sporen des Pilzes befallen und führen
HM CDM LDHRSDM %ĔKKDM CTQBG CHD RSDSHFDM $MDQFHDDHMATDM YTL ARSDQADM CDQ /k@MYD
Durch die guten Holzeigenschaften und das hohe Potenzial als klimaresistente Baumart ist
der Verlust der Esche gravierend für die Forstwirtschaft. Fragen zur Generhaltung dieser
sterbens auf die Eigenschaften von Pollen, Samen
und der Phänologie geklärt werden. Ergänzt werden
diese Untersuchungen durch das AWG (Bayerisches
Amt für Waldgenetik) mit der Analyse des effektiven
Quo vadis Pollen?
wertvollen Baumart und zur Förderung von natürlichen Resistenzbildungen durch forstliche Pollentransports, welcher anhand von genetischen
Vaterschaftsanalysen von Eschensamen festgestellt
20 Nachhaltigkeitsbericht 2018 | 19 Nachhaltigkeitsbericht 2018 | 19 21Forschen für die Nachhaltigkeit Forschen für die Nachhaltigkeit
Naturbeobachtung zur Förderung der biopsychosozialen
3.2.4 Gesundheit und des Engagements im Naturschutz
Natur &
Evaluation eines Präventionsprojekts an der Schnittstelle von Gesundheit
Natur und Gesundheit
Projektleiterin: Abbildung 5:
Prof. Dr. Elisabeth Kals Durch Naturbeobachtung die biopsychosoziale
(C. Pietsch)
Abbildung 6: Gimpel
(colourbox.de)
stellv. Projektleiterin: &DRTMCGDHS TMC CHD +DADMRPT@KHSĔS ĔKSDQDQ OkDFD-
Dr. Susanne Freund bedürftiger Menschen steigern – das ist das Ziel des Damit mussten u. a. Messinstrumente entwickelt und
Projektmitarbeiterinnen: Präventionsprojekts, welches durch den Landes- validiert werden, welche auch für diese Zielgruppe
Patricia Zieris, Veronika Zwerger bund für Vogelschutz in Bayern e. V. verfolgt wird beantwortbar sind.
Laufzeit: Oktober 2017 bis September 2020 (www.lbv.de/allevoegel). Seine Neuartigkeit ist viel- sucht, inwiefern sich Naturerfahrungen, emotiona- Die bisherigen Ergebnisse, basierend auf den Daten
Finanzierung: Landesbund für Vogelschutz fältig gestaltet: Es werden im Laufe der dreijährigen le Verbundenheit mit und Achtsamkeit in der Natur von über 1200 Personen, deuten auf positive Effekte
in Bayern e.V. (Auftraggeber), verschiedene /QNIDJSC@TDQHMHMRFDR@LSUNKKRS@SHNMĔQDM/kDFD- über verantwortungsbezogene Variablen hinaus auf und Wirkungen der Maßnahme hin. So wird
Pflegekassen einrichtungen in Bayern Vogelfutterstationen sowie naturschützende Engagementbereitschaften und die Vogelbeobachtung von der Zielgruppe an-
Projekttyp: Evaluationsprojekt an die Zielgruppe angepasstes Anschauungs- und Verhaltensweisen auswirken. genommen und in hohem Ausmaß genutzt und die
Schirmherrsachaft: Vogelbestimmungsmaterial bereitgestellt. Der demo- Hinsichtlich der genetisch verankerten Naturver- Akzeptanz der Maßnahme ist auch bei den Mit-
bayerische Staatsministerin FQ@jRBGD 6@MCDK TMC CHD YTMDGLDMCD QĔTLKHBGD bundenheit der Bewohner*innen in vollstationären arbeitenden der Einrichtungen hoch ausgeprägt.
für Gesundheit und Pflege, Distanz von Familienmitgliedern und verschiedenen /kDFDDHMQHBGSTMFDMVHQCŘADQOQŘES HMVHDEDQMCHD@M- Ebenfalls nimmt die Vogelbeobachtung großen
Melanie Huml Generationen sind nur zwei Kriterien, die die hohe Re- geleitete Vogelbeobachtung – als Maßnahme zu ihrer $HMkTRR @TE CHD ORXBGNRNYH@KD &DRTMCGDHS CDQ
levanz dieses Projekts – das in seiner Form einzigartig Erfüllung – zum biopsychosozialen Wohlergehen der Bewohner*innen, indem sie insbesondere emo-
ist – verdeutlichen. älteren Menschen beiträgt und deren Mobilität sowie SHNM@K ONRHSHUDR $LOjMCDM EŅQCDQS TBG CHD JNF
Auf Basis der „Biophilia-Hypothese“ von Edward kognitive Ressourcen fördert. Damit werden die drei nitiven Ressourcen und die Mobilität der Be-
Wilson und Stephen Kellert wird erwartet, dass sich Dimensionen der ökonomischen, ökologischen und wohner*innen scheinen durch die Vogelbeobachtung
Abbildung 4: Fern-
glas (colourbox.de) die emotionale Verbundenheit mit der Natur, die sozialen Nachhaltigkeit um die Säule des Gesund- gefördert zu werden.
in jedem Menschen genetisch verankert ist, posi- heitsschutzes ergänzt. Aus den Ergebnissen der Studien lassen sich nicht
tiv auf die biopsychosoziale Gesundheit und auch Wirksamkeit, Akzeptanz sowie die innovative Projekt- nur konkrete Handlungsempfehlungen für die Praxis
auf umweltschützende Engagements auswirkt. Zur gestaltung werden durch das Evaluationsteam der ableiten, sondern sie sind zugleich Grundlage weite-
Überprüfung der Auswirkungen der Naturverbunden- Professur für Sozial- und Organisationspsychologie, rer empirisch wissenschaftlicher Forschung in diesem
heit auf die Engagementbereitschaft von Personen unter Leitung von Prof. Dr. Elisabeth Kals, überprüft bislang vernachlässigten Feld. Darüber hinaus be-
wird parallel zum Evaluationsprojekt eine Befragung und wissenschaftlich begleitet. Dazu wurde ein kom- stätigen die Befunde, dass der Begriff der Nachhaltig-
der Allgemeinbevölkerung zum Thema „Engagement plexes Untersuchungsdesign entwickelt, das einen keit um eine gesundheitliche Säule erweitert werden
im Naturschutz“ durchgeführt. Hierbei wird unter- Längs- und Querschnitt, eine (Warte-)Kontroll- und sollte, um den Herausforderungen der heutigen Ge-
Experimentalbedingung, eine Fremd- und Selbst- sellschaft und einer zukunftsorientierten Forschung
Mehr zum Projekt unter:
einschätzung sowie eine Nachbefragung umfasst. gerecht zu werden.
www.ku.de/ppf/psychologie/psych3/
forschung/forschungsprojekte
22 Nachhaltigkeitsbericht 2018 | 19 Nachhaltigkeitsbericht 2018 | 19 23Forschen für die Nachhaltigkeit Forschen für die Nachhaltigkeit
Ähnliches diskutierten Schüler*innen, Studieren-
de und Auszubildende in einer Zukunftswerkstatt im
Januar 2019. Sie wurden in ihrer Diskussion noch konkreter.
3.2.5 Nachhaltige Lebensstile in der Region 10 Der ÖPNV müsse insgesamt attraktiver gestaltet werden, d. h. eine
verbesserte Taktung und für junge Menschen erschwingliche Preise
bieten. Alle müssten ihrer Meinung nach aktiv werden und mit vielen
kleinen Schritten einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten. Die
Eine Studie zum nachhaltigen Konsum Schüler*innen, Studierenden und Azubis waren sich einig, dass mit
bewusstem Konsum des Einzelnen viel für die globale Gesellschaft
erreicht werden könne.
nen:
eiter*in
Projektl HI) und
Barfuß (T
Prof. Dr. Georg
Foto 15: Diskussion während der Zukunftswerkstatt (A. Vogtherr)
Hemmer (KU)
Prof. Dr. Ingrid bis Ok tob er 2022 Ein Ziel des Projekts „Mensch in Be-
: Mai 2018
Laufzeit
Finanzie
rung: BM
BF wegung“ (Projektleitung Thomas Sporer) ist es, die Kleinschrittigkeit regionale Unabhängigkeit
artner:
Technische Region 10 (Eichstätt, Ingolstadt, Neuburg-Schrobenhausen Motivation
Projektp und Pfaffenhofen) nachhaltiger zu gestalten und diese zu einer Vor-
Hochschule Ingolst
eferent*
in
adt (THI)
nen: bildregion zu entwickeln. Dazu wird zunächst der Stand der Region erfasst. Vorbildfunktion ÖPNV Fleischvermeidung
Projektr Welche nachhaltigen Angebote (Information, Beratung oder Konsumgüter) gibt es
emer und
Ann-Kathrin Br
Andreas Vogtherr
bereits? Wo gibt es noch Lücken? Die Projektmitarbeiter*innen des Teilprojekts „Nach-
haltige Lebensstile“, Ann-Kathrin Bremer (KU) und Andreas Vogtherr (THI) unter Leitung
Aktivität Die sich anschließende empiri-
Verbesserung
von Prof. Hemmer (Professur für Didaktik der Geographie, KU) und Prof. Barfuß (Professur sche Studie wird in Kooperation der bei-
für Corporate Social Responsibility, THI Business School) suchten Antworten auf diese Fragen.
In einem ersten Schritt wurde gemeinsam mit den anderen Teilprojekten aus dem
BNE den Hochschulen durchgeführt, wobei die KU ihren
Fokus insbesondere auf junge Leute legt. Ziel der Studie ist
selber Machen
Foto 14: Fantasie Region
10 aus der Zukunftswerk-
Bereich Nachhaltige Entwicklung eine Stakeholder-Analyse durchgeführt. Im Zuge dieser Analyse
wurden eine Reihe von Nachhaltigkeits-Expert*innen aus den Bereichen Bildung, Wirtschaft, Ver-
es, durch eine Befragung von jungen Leuten und Unternehmen in
CDQ1DFHNMYTLDHMDMGDQ@TRYTjMCDM VHDRS@QJC@R-@BGG@KSHFJDHSR-
bewusster
Konsum
statt (A. Vogtherr) waltung und NGOs im November 2018 zu einem Workshop eingeladen, um Meinungen zu den bewusstsein und die Handlungsbereitschaft in der Region ausgeprägt
kritischen Themen in der Region einzuholen. Bei einem World-Café diskutierten sie über die sind und zum anderen, welche Maßnahmen von Seiten der Politik, Bildung,
Frage: Wie soll die Region 2030 aussehen und wie kann diese Vision umgesetzt werden? NGOs und Wirtschaft nötig sind, damit die Bevölkerung ihre individuellen
Grundsätzlich wurde eine nachhaltige Regionalentwicklung postuliert. Die Expert*innen Lebensstile nachhaltiger gestalten kann. Die untersuchten Bereiche ergaben Gemeinwohlorientierung
kamen branchenübergreifend zu den Ergebnissen, dass die Flächen effektiv genutzt sich aus den Diskussionen der beiden zuvor durchgeführten partizipativen
werden müssen, um den Flächenverbrauch der wachsenden Kommunen mög- Workshops. Parallel zur Studie soll erfasst werden, welches Angebot es
Foto 16: Teilnehmende an der
lichst gering zu halten. Durch Nahversorgung und Naherholungsangebote ADQDHSRHMCDQ1DFHNMFHAS TL+ŘBJDMYTHCDMSHjYHDQDMTMCCHDRDRHMMUNKK Zukunftswerkstatt (A. Vogtherr)
sollen Transport- und Reisewege verkürzt werden. Erste Umsetzungs- zu ergänzen.
ideen sind die Kombination von Landwirtschaft und Nah- Somit können im Anschluss Empfehlungen an Politik, Wirt-
erholung oder die Möglichkeit der Telearbeit. schaft, Bildung und NGOs abgeleitet werden, worauf bei
FahrRad der Regionalentwicklung geachtet werden kann,
um diese nachhaltiger zu gestalten.
Innovation
Mehr zum Projekt unter: Kommunikation
Vernetzung
www.ku.de/mgf/geographie/didaktik/unsere- Plastikvermeidung
forschung/aktuelleprojekte Problembewusstsein
Schlagworte: Ergebnisse der
Zukunftswerkstatt (A. Bremer)
24 Nachhaltigkeitsbericht 2018 | 19 Nachhaltigkeitsbericht 2018 | 19 25Forschen für die Nachhaltigkeit Forschen für die Nachhaltigkeit
Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)
3.2.6 in der Hochschullehre und an den Seminarschulen
Abbildung 8: Nachhaltigkeitskonzept
einer Teilnehmerin (M. Döpke)
Ein Forschungs- und Fortbildungsprojekt
r*in:
Projektleite
mer (KU)
Prof. Dr. Ingrid Hem
Coaching: Als verbindendes und vertiefendes Element
Laufzeit: 201
8-2021 bestärkt das individuelle Coaching die Teilnehmenden
: darin, Aspekte einer (B)NE in die eigene Lehre zu integrie-
Finanzierung
isterium für Umwelt
Bayerisches Staatsmin
ren und gleichzeitig BNE-Bildungsprozesse zu gestalten
z
und Verbraucherschut
Hier knüpft das Projekt FOLE_BNE_Bay, gefördert vom TMCYTQDkDJSHDQDM
Projekttyp:
laufendes Forschungs- Aufbauend auf dem UNESCO-Weltaktionsprogramm Bil- Bayerischen Staatsministerium für Umwelt und Ver- Aufbaumodul: Aktuelle Ergebnisse aus empirischen Stu-
und Fortbildungsprojekt
dung für nachhaltige Entwicklung wurde 2017 vom BMBF braucherschutz, an. Unter der Leitung von Prof. Dr. Ingrid dien zur Effektivität von Hochschullehre und Chancen
ent*innen: und der Deutschen UNESCO-Kommission der Nationa- Hemmer (Professur für Didaktik der Geographie, KU) arbei- einer BNE werden vorgestellt und im Rahmen einer Zu-
Projektrefer
le Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung (NAP tet das Team mit Christoph Koch, Marie Döpke und Ina kunftswerkstatt diskutiert. Darauf aufbauend entwickeln
Christoph Koch,
er
Marie Döpke, Ina Limm
BNE) verabschiedet. Darin werden Handlungsfelder, Ziele Limmer seit Oktober 2018 an der Etablierung von BNE in die Teilnehmenden gemeinsame Visionen, wie eine BNE
und Maßnahmen für alle Bildungsbereiche festgelegt, um die Hochschullehre. Ziel ist es, ein hochschuldidaktisches die eigene Lehre aber auch die Hochschulen trans-
das vierte SDG „Hochwertige Bildung“ – 4.7 zu BNE – der Angebot mit einem partizipativ angelegten Basis-und Auf- formieren könnte (Whole Institution Approach).
Agenda 2030 der Vereinten Nationen umzusetzen. baumodul zu entwickeln, welches Hochschuldozierende
Um Studierende und Schüler*innen als zu- dabei unterstützt, Aspekte einer BNE in die eigene Lehre
künftige Entscheidungsträger*innen und Multiplikator*innen einzubringen. Mittels einer wissenschaftlichen Begleit- Weitere Planungen: bayernweites Angebot im
für die Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung forschung wird die Wirksamkeit des BNE-Angebots eva- Rahmen von ProfiLehrePlus
zu sensibilisieren und zur Mitgestaltung dieser zu befähigen, luiert. Auf der Grundlage eines BNE-Kompetenzmodelles
ist eine gezielte Implementierung von BNE im Bildungs- werden Fortschritte in den Bereichen Fachwissen, Fach- Die im Rahmen des FOLE_BNE-Projekts konzipierten,
wesen notwendig. Dies gilt einmal mehr für die Ausbildung didaktik sowie Motivation, Selbstwirksamkeit und Hand- fächerübergreifenden Fortbildungsmodule wurden 2018
zukünftiger Lehrkräfte, zumal auch im neuen bayerischen lungsbereitschaft erfasst. bereits an den Standorten Eichstätt und Ingolstadt durch-
LehrplanPLUS das fächer- und schulartübergreifende Ziel geführt. 2019 werden die Module, auch dank des Enga-
„Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE)“ verankert ist. gements von Herrn Dr. Clemens Oberhauser, Referent für
Abb. 7: Logo SDG 4 „Hoch-
wertige Bildung“ Eine Implementierung in die Lehrerbildung erfordert je- BNE in der Hochschullehre: hochschuldidaktische Fortbildungen an der KU Eichstätt-
Foto 17, rechts: Sustainable
Development Goals (SDGs)
CNBG DHMD DMSROQDBGDMCD 0T@KHjYHDQTMF UNM 'NBGRBGTK- Aufbau des Angebots Ingolstadt, an sieben weiteren bayerischen Hochschulen in
der Agenda 2030 der UN dozierenden und Seminarlehrkräften. das Hochschuldidaktik-Programm aufgenommen. Zudem
(I. Limmer)
Basismodul: Aufbauend auf Konzepten der nachhaltigen werden Fortbildungsinhalte an der Akademie für Lehrerfort-
Entwicklung (NE) und einer Bildung für eine nachhaltige Ent- bildung und Personalführung (ALP) in Dillingen angeboten.
wicklung (BNE) werden den Teilnehmenden konzeptionelle
Grundlagen vermittelt und unterschiedliche BNE-Methoden
ausprobiert. Umsetzungsmöglichkeiten und Kriterien einer
BNE für die eigene Hochschullehre werden erarbeitet.
Mehr Informationen finden Sie unter:
https://www.ku.de/mgf/geographie/didaktik/ Foto 18: Projektteam FOLE-BNE-Bay, v.l.n.r.
Marie Döpke, Christoph Koch, Ingrid Hemmer,
unsere-forschung/aktuelleprojekte/fole-bne-bay/ Ina Limmer (F. v. d. Linden)
26 Nachhaltigkeitsbericht 2018 | 19 Nachhaltigkeitsbericht 2018 | 19 27Sie können auch lesen