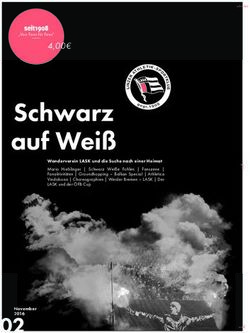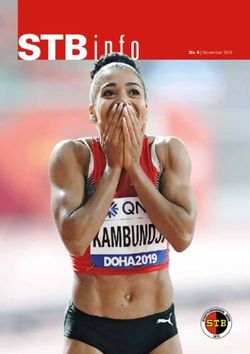Älter werden - Dokumentation: Hochschule Coburg
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Mite i n a n d e r a k t i v
älter werden
Impulse für Freizeit, Bildung und Kommune
Dokumentation: Fachtagung des Instituts für
angewandte Gesundheitswissenschaften
Coburg an der Hochschule Coburg
am 18. Oktober 2012Impressum Redaktion Prof. Dr. Michaela Axt-Gadermann Annekatrin Bütterich Melanie Nölkel Mitarbeiter Ana Maria Pfeiffer Arthur Schwarzkopf Tina Cruz Avila Herausgeber Hochschule Coburg Institut für angewandte Gesundheitswissenschaften Coburg Friedrich-Streib-Straße 2 96450 Coburg www.hs-coburg.de Informationen und Rückfragen Institut für angewandte Gesundheitswissenschaften Coburg Annekatrin Bütterich Friedrich-Streib-Straße 2 96450 Coburg Tel.: 09561 317-561 Fax: 09561 317-524 Mail: IaG@hs-coburg.de Gefördert von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) Postfach 910152 51071 Köln www.bzga.de Satz und Layout Coburger Copy Shop, Druck- und Medienzentrum Rosenauer Str. 27 96450 Coburg Bestellnummer 61412021 Fotos Frank Wunderatsch Schauensteiner Straße 6 95233 Helmbrechts Die Fachtagung in Coburg wurde gefördert durch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), eine Fachbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Gesundheit.
Inhaltsverzeichnis
5 Thematische Einleitung und Begrüßung
Prof. Dr. Michael Pötzl, Präsident der Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg
Dr. Monika Köster, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
Prof. Dr. Holger Hassel, Hochschule Coburg, Institut für angewandte Gesundheitswissenschaften
16 Fachvorträge
„Jung und Alt im Dialog“
Prof. Dr. Susanne Gröne, Dekanin der Fakultät Soziale Arbeit und Gesundheit,
Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg
„Gesundes und aktives Altern: Individuelle & gesellschaftliche Perspektiven“
Prof. Dr. Frieder R. Lang, Institut für Psychogerontologie, Universität Erlangen-Nürnberg
22 Fachexpertise
„Miteinander aktiv älter werden. Impulse für Freizeit, Bildung und Kommune“
Fachspezifische Beiträge:
• „Gesundheitsförderung – Was können Kommunen leisten? – mit Beispielen aus dem Landkreis
Coburg“
Frau Martina Berger, Landkreisentwicklung, Landratsamt Coburg
• „Für Bewegung ist man nie zu alt! Bewegungsparcours für alle Generationen“
Herr Bernhard Ledermann, Architekturplanung und Geschäftsführung des Grünflächenamts Coburg
und Frau Christiane Zinoni-Peschel, Planung Kinderspielplätze, Parkanlagen, Grünflächen des
Grünflächenamts Coburg
• „Pauschale für ‚pflegende Angehörige‘ – Dem Alltag entfliehen – Zeit für mich“
Frau Gabriele Lippmann, Geschäftsführung der ThermeNatur Bad Rodach
• „Genuss im Alter – richtig Essen und Trinken gehört dazu!“
Frau Helga Strube, DGE und BIPS, Universität Bremen
• „Kommunen und demografischer Wandel“
Frau Dr. Maria Wagner, Kreisvorstand der CDU im Main-Kinzig-Kreis Biebergemünd,
Kommunalpolitik
41 Health Café
„Einführung in das Health Café“
Prof. Dr. Holger Hassel, Institut für angewandte Gesundheitswissenschaften,
Hochschule für angewandte Wissenschaften Coburg
Forum A) Freizeit
Forum B) Bildung
Forum C) Kommune
In zwei Runden
32. Coburger Health Café – Grundidee des Health Cafés
Resümee des Zweiten Coburger Health Cafés
Ausstellung „Alternde Gesichter“
Interaktives Angebot „Alterspuzzles“
Stimmen aus dem Publikum: „Was ich für mich mitnehme ist … „
Ergänzung zu: „Gesundes und aktives Altern: individuelle & gesellschaftliche Perspektiven“
Prof. Dr. Frieder R. Lang, Institut für Psychogerontologie, Universität Erlangen-Nürnberg
73 Kontaktdaten
Ausstellerverzeichnis „Markt der Möglichkeiten“
Literaturverzeichnis
Flyer
4Thematische Einleitung und Grußworte
Thematische Einleitung und Langfristig wird sich diese Situation aber grundle-
gend ändern.
Grußworte
In Zukunft wird die Zahl der Kinder und damit auch
Prof. Dr. Michael Pötzl, Präsident der der zukünftigen Studierenden und ArbeitnehmerIn-
Hochschule Coburg nen sinken, dafür der Anteil älterer Menschen an
der Bevölkerung weiter zunehmen. Kamen im Jahr
2005 noch etwa 685.000 Kinder auf die Welt, so
werden es in ca. 40 Jahren wahrscheinlich nur noch
Sehr verehrte Gäste, 500.000 sein. Die Zahl der 80-Jährigen wird sich
ich begrüße Sie alle recht herzlich hier und heute im gleichen Zeitraum nahezu verdreifachen. Schon
an diesem wunderschönen goldenen Oktobertag jetzt sind etwa 25% der Bevölkerung 60 Jahre und
- das Wetter wurde extra bestellt - an der Hoch- älter. Die Zahl der unter 20-Jährigen hingegen liegt
schule Coburg mit diesem traumhaften Blick auf nur noch bei 18 Prozent.
die Veste Coburg. Insbesondere begrüße ich Herrn
Dr. Prof. Lang vom Institut für Psychogerontologie Diese Zunahme der Lebenserwartung bringt
der Universität Erlangen-Nürnberg, Frau Dr. Monika Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich.
Köster von der Bundeszentrale für gesundheitliche Gesundheitsförderung und Prävention werden in
Aufklärung, Frau Gabriele Lippmann, Geschäftslei- Zukunft sicher eine noch größere Rolle spielen.
terin der ThermeNatur Bad Rodach, Frau Christiane Ich freue mich deshalb, dass wir hier an der Hoch-
Zinoni-Peschel, Verantwortliche für die Planung schule mit dem Studiengang Integrative Gesund-
von Kinderspielplätzen, Parkanlagen und Grünflä- heitsförderung einen starken Motor haben, der sich
chen vom Grünflächenamt Coburg, Herrn Bernhard mit dieser Thematik befasst. Integrative Gesund-
Ledermann, Verantwortlicher für die Architekturpla- heitsförderung ist einer von 26 Bachelor- und Mas-
nung und Geschäftsführer des Grünflächenamts terstudiengängen der Hochschule Coburg.
Coburg, Frau Helga Strube, Mitarbeiterin bei der
DGE und bei dem BIPS der Universität Bremen, Um den Herausforderungen unserer Zeit gerecht
Frau Dr. Maria Wagner, Kreisvorstand der CDU im zu werden, wird zukünftig das interdisziplinäre
Main-Kinzig-Kreis Biebergemünd und Frau Martina Studieren und individuelle Fördern noch wichti-
Berger, Verantwortliche der Landkreisentwicklung ger als bisher. Hier beschreitet die Hochschule
vom Landratsamt Coburg. Coburg mit dem Projekt „Der Coburger Weg“ im
wahrsten Sinne des Wortes einen neuen Weg. Es
Die demografische Entwicklung macht auch vor geht darum, sowohl in der Lehre als auch in der
dem Landkreis Coburg und der Hochschule Coburg Forschung die einzelnen Disziplinen miteinander
nicht Halt. Durch die G-8-AbiturientInnen, die der- zu verknüpfen und den Austausch zu fördern, um
zeit an die Hochschulen drängen, werden wir den zukünftigen Veränderungen in unserer Gesell-
jedoch zunächst mit einem ganz anderen Problem schaft durch demografischen Wandel, aber auch
konfrontiert, nämlich Studierenden, die immer jün- technologischen Fortschritt, Globalisierung und
ger werden. Inzwischen beginnen viele ihr Studium soziale Diversifizierung gerecht zu werden. Die Stu-
schon mit 17 Jahren und Hochschule und Lehrende dierenden der teilnehmenden Pilotstudiengänge
müssen sich auf diese Veränderungen einstellen. Integrative Gesundheitsförderung, Soziale Arbeit,
6Thematische Einleitung und Grußworte
Innenarchitektur, Betriebswirtschaftslehre und
Versicherungswirtschaft sowie Bauingenieurwe-
sen setzen sich von Beginn des Studiums an mit
interdisziplinären Perspektiven auseinander. Gleich
im ersten Semester werden sie mit dem Thema
„demografischer Wandel“ aus ganz unterschiedli-
chen Sichtweisen konfrontiert. Wir hoffen, dass wir
mit diesem Projekt Antworten auf die Herausforde-
rungen des Studierens von morgen geben können.
Schon jetzt findet „Der Coburger Weg“ bundesweit
große Aufmerksamkeit.
Einen ganz besonderen Dank möchte ich den bei-
den Initiatoren und Kollegen Frau Prof. Dr. Michaela
Axt-Gadermann und Herrn Prof. Dr. Holger Hassel
aus dem Studiengang Integrative Gesundheitsför-
derung aussprechen, die zusammen mit ihrem Team
des Instituts für angewandte Gesundheitswissen-
schaften diese Fachtagung unter dem Titel „Mitei-
nander aktiv älter werden“ organisiert haben und
dieses brandaktuelle Thema des demografischen
Wandels hier und heute aufgreifen und mit Ihnen
diskutieren möchten. Hierdurch schaffen beide Kol-
legen eine Austauschplattform, die es ermöglicht,
neue Erkenntnisse am Ende dieses spannenden
Tages nach Hause mitzunehmen.
Ich wünsche Ihnen und uns nun eine interessante
Fachtagung, spannende Fachvorträge sowie einen
regen Austausch in den Diskussionsforen des
Health Cafés. Vielen Dank!
7Thematische Einleitung und Grußworte
Thematische Einleitung und Unsere Arbeit läuft immer in enger Zusammenar-
beit mit unseren Kooperationspartnern, denn im
Grußworte Austausch und mit vereinten Kräften können wir
auf dem Gebiet der Gesundheitsförderung viel
Dr. Monika Köster, Bundeszentrale für erreichen. Daher freue ich mich sehr, dass wir die
gesundheitliche Aufklärung heutige Veranstaltung zusammen auf den Weg brin-
gen konnten. Ich bin gespannt auf den fachlichen
Austausch, denn hier ist heute sehr viel Know-How
versammelt, Wissenschaft und Praxis, unterschied-
Sehr geehrter Herr Prof. Pötzl, liche Disziplinen, Sektoren und Zuständigkeiten
sehr geehrte Frau Prof. Gröne, sowie auch unterschiedliche Generationen sind
sehr geehrte Frau Prof. Axt-Gadermann, vertreten, so dass wir eine gute Chance haben, die
sehr geehrter Herr Prof. Hassel, anstehenden Fragen entsprechend zu diskutieren.
meine sehr geehrten Damen und Herren, Zunächst möchte ich die Gelegenheit nutzen und
mich bei den Gastgebern, Mitwirkenden und Orga-
ich freue mich, heute zu Ihnen zu sprechen und als nisatoren hier in Coburg für die gute Kooperation
Vertreterin der Bundeszentrale für gesundheitliche und die kompetente Vorbereitung der Veranstal-
Aufklärung (BZgA) die heutige Veranstaltung hier an tung „Miteinander aktiv älter werden“ ganz herz-
der Hochschule Coburg mit zu eröffnen. lich bedanken. Wir können uns auf interessante
Fachvorträge und einen umsetzungsbezogenen
Die BZgA ist im Zusammenhang ihres Themen- Austausch freuen und gleichzeitig die besonderen
schwerpunkts „Gesund und aktiv älter werden“ seit Räumlichkeiten mit Topaussicht bei strahlendem
einiger Zeit gemeinsam mit ihren Kooperationspart- Herbstwetter genießen. Die Tagungsergebnisse
nern auf Bundes- und Länderebene, mit Partnern werden dokumentiert und Ihnen allen zur Verfügung
aus Wissenschaft und Praxis darum bemüht, die gestellt.
notwendige Vernetzung zu fördern sowie auch die
erforderliche sektorübergreifende Vorgehensweise „Miteinander aktiv älter werden“, das heutige 2.
zu unterstützen. Coburger Health Café, findet nicht von ungefähr im
Rahmen des „Europäischen Jahres 2012 für aktives
Wir haben 2011 und 2012 zu diesem Thema Nati- Altern und Solidarität zwischen den Generationen“
onale Tagungen sowie zahlreiche Regionalkonfe- statt. Die Europäische Kommission hat dieses Jahr
renzen in den Bundesländern durchgeführt und auf ausgerufen, um den Blick noch einmal sehr gezielt
dieser Basis auch Materialien für Multiplikatorinnen auf den Demografischen Wandel und seine vielfäl-
und Multiplikatoren entwickelt. Seit August steht tigen Auswirkungen zu richten. Es geht darum, die
die Website www.gesund-aktiv-älter-werden.de im Herausforderungen positiv anzugehen und europa-
Netz, wir freuen uns über Ihr Feedback und Ihre weit die Möglichkeiten für ein aktives, unabhängi-
Anregungen. Unser Newsletter informiert in regel- ges, sozial integriertes und gesundes Leben im Alter
mäßigen Abständen über Aktuelles im Themenbe- zu verbessern. So stand das Thema in diesem Jahr
reich, Sie können diesen abonnieren und dort auch vielerorts in besonderem Maße auf der Agenda.
Ihre eigenen Aktivitäten und Termine einstellen.
8Thematische Einleitung und Grußworte
Meine Damen und Herren, Krankheiten einher. Ab dem Alter von 65 Jahren ist
mehr als die Hälfte aller Menschen in Deutschland
die Fakten sind bekannt: Die Menschen werden an mindestens einer, viele an mehreren chroni-
älter - und dies ist eine sehr gute Nachricht. Die schen Krankheiten erkrankt. Im Vordergrund stehen
Lebenserwartung bei Geburt liegt heute für Mäd- Herz-Kreislauferkrankungen, Erkrankungen des
chen bei 82,7 Jahren, für Jungen bei 77,7 Jahren. Bewegungsapparates, Krebserkrankungen, psy-
chische Erkrankungen (hier vorallem Depressionen
Derzeit sind 21% der Bevölkerung in Deutschland und demenzielle Erkrankungen). Auch mit den The-
65 Jahre und älter, 2030 werden es – so die Vor- men Pflege und Betreuung müssen wir uns inten-
ausberechnungen des Statistischen Bundesamtes siv beschäftigen. Wir sollten aber dennoch im Blick
- 29% sein. Hinzu kommen niedrige Geburtenra- haben, dass „älter werden“ bzw. „alt sein“ heute
ten und Wanderungsbewegungen, d.h. die Zusam- eine Lebensphase von in der Regel mehreren Jahr-
mensetzung der Bevölkerung in Deutschland, aber zehnten umfasst. Und diesem langen Prozess und
auch sehr spezifisch in den unterschiedlichen Regi- Zeitraum steht eine eigene und spezifische Bedeu-
onen, verändert sich - gesellschaftliche Strukturen tung zu. Selbstbestimmung und Gestaltungsmög-
ändern sich. Und hieraus erwachsen neue Her- lichkeiten sind gefragt, es geht um Lebensqualität
ausforderungen, die sich an die unterschiedlichen und Sinnstiftung in der zweiten Lebenshälfte.
gesellschaftlichen Bereiche und Akteure stellen.
Wenn wir dem „Defizitansatz“ einen sogenann-
Gesundheitsförderung und Prävention spielen ten „Stärkenansatz“ gegenüberstellen, sehen wir,
in einer älter werdenden Gesellschaft eine wich- dass auch und gerade ältere Menschen sehr viel
tige Rolle, weil Gesundheit auch im höheren Alter zu bieten haben. Man sagt ja auch „Die Jüngeren
die Voraussetzung für Selbstständigkeit und aktive sind schneller, die Älteren kennen die Abkürzun-
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ist. Es geht gen“. Ältere Menschen haben Lebenserfahrung, sie
um Selbstbestimmung, es geht um Teilhabe, es haben berufliche Erfahrung, sie sind an vielen Din-
geht auch um Sinnstiftung in den unterschiedlichen gen interessiert, sie sind in hohem Maße engagiert,
Phasen des Lebens. auch ehrenamtlich, sie bringen sich in vielen Fällen
intensiv in das „Miteinander der Generationen“ ein.
Gleichzeitig stellt sich die Frage nach dem Alters-
bild: Wir sollten unseren Blick keinesfalls aus- Jüngere und ältere Menschen – wobei wir wissen,
schließlich auf Defizite, Unterstützungsbedarf, dass es die Jungen und die Alten nicht gibt – kön-
Belastungen, Probleme und Kosten richten - wir nen durchaus sehr viel voneinander profitieren und
alle kennen z.B. die Formulierungen „Alterslast“, sich gleichzeitig auch gegenseitig unterstützen –
„Vergreisung der Gesellschaft“ etc. Wir sollten bei siehe Beispiel Mehrgenerationenhäuser.
unseren Konzepten und Lösungsansätzen vielmehr
ein zeitgemäßes und realistisches Bild vom Älter- Es geht z.B. sowohl in jüngeren, als auch in den
werden und Altsein vor Augen haben. höheren Altersgruppen um die gelingende Bewälti-
gung anstehender Übergänge, z.B. den Übergang
Natürlich geht die demografische Alterung, auch von der Schule in die Berufsausbildung, dann in die
wenn ein Großteil der älteren Menschen recht Erwerbstätigkeit. Oder sehen wir auf die Bereiche
gesund und aktiv ist, mit einer Zunahme chronischer Partnerschaft und Familienphase: Neue und andere
9Thematische Einleitung und Grußworte
Situationen und Aufgaben stehen an: Dann später beweglich sind oder die ggf. mit Gehhilfe oder Rol-
die Empty-Nest-Situation: Die Kinder gehen aus lator unterwegs sind.
dem Hause; der Übergang vom Beruf in den
Ruhestand steht an, es geht um die Frage der Die Voraussetzungen vor Ort müssen sehr sorg-
Sinnstiftung, um die Aufrechterhaltung sozialer fältig analysiert werden: Wo stehen wir? Welche
Kontakte. Für diese lebenslaufbezogenen Belange Strukturen sind vorhanden? Welche Akteure, Ange-
müssen wir unseren Blick weiter schärfen. bote und Möglichkeiten gibt es für welche Ziel- und
Altersgruppen? Welche Anstrengungen wurden
Wir sollten uns hierzu vor allem den Alltag und die bislang in der Region unternommen?
Lebenssituationen der Menschen ansehen. Vor
Ort, im Stadtteil, in der Wohnumgebung spielt die Wir werden uns heute mit individuellen und gesell-
Musik. Es geht auch um die sozialen Beziehungen - schaftlichen Perspektiven auseinandersetzen. In
zur Familie und zu außerfamiliären Netzwerken und den Foren geht es dann vor allem um die zentralen
Personen. Bereiche Freizeit, Bildung und Kommune. Unsere
Stichworte hier sind: Dialog, Koordinierung, Ver-
Wenn wir die Partizipation und Integration älterer netzung, interdisziplinäres Vorgehen, Berücksich-
Menschen fördern wollen und hierbei insbeson- tigung der Interessen unterschiedlicher Sektoren,
dere auch generationenübergreifende Strategien Akteure und vor allem der Zielgruppen selbst, um
und Ansätze planen, dann ist es äußerst wichtig, die es geht.
die Interessen der unterschiedlichen Beteiligten zu
kennen und ernst zunehmen. Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr auf
die heutige Diskussion und wünsche uns allen einen
Und wenn wir Gesundheit umfassend sowie auch interessanten Fachaustausch und viele Impulse
generationenübergreifend denken, sehen wir, dass und Anregungen für unsere Arbeit. Vielen Dank!
sehr viele unterschiedliche Bereiche, Sektoren
und Akteure zur Förderung dieses Miteinanders
beitragen können. Das ist nicht nur der Gesund-
heits- und Pflegebereich im engeren Sinne, da gibt
es viele weitere relevante Zuständigkeiten z.B. aus
den Bereichen Soziales, Bildung, Kultur, Freizeit,
Sport, Städtebau und Verkehrsplanung. Hier gibt
es durchaus zahlreiche Maßnahmen, die sowohl
für jüngere Menschen und Familien mit Kindern, als
auch für Ältere sinnvoll und wichtig sind, denken
wir z.B. an den Wohnungsbau, an den öffentlichen
Personennahverkehr, an Freizeit- und Sportanla-
gen, an Grünflächen und Parks, Wander- und Rad-
wege, um nur einige wenige Bereiche zu nennen.
Ein Beispiel ist die Absenkung von Bordsteinen:
Dies ist wichtig für Personen, die nicht mehr so
10Thematische Einleitung und Grußworte
11Thematische Einleitung und Grußworte
Miteinander aktiv älter werden Jährige und jeder vierte Über-85-Jährige zu wenig
trinkt. Eine Optimierung dieser defizitären Lebens-
Demographische Transition und weise ist gerade in Bezug auf die im Alter häufiger
auftretenden Erkrankungen wie Schlaganfall, Blut-
Gesundheit im Alter
hochdruck und koronare Herzkrankheiten erforder-
Prof. Dr. Holger Hassel lich (DGE 2007, Schmitt 2004, Stanger et al. 2003).
Hochschule Coburg, Institut für
angewandte Gesundheitswissenschaften Körperliche Aktivität trägt wesentlich zu einem
gesunden Altern bei. Zudem hat sie eine zent-
Die zunehmende Lebenserwartung der Deutschen rale präventive Funktion, die über den gesamten
stellt das Gesundheitswesen vor große Herausfor- Lebensverlauf wichtig ist. Ausreichende Bewegung
derungen (Statistisches Bundesamt 2003). schützt vor chronischen Krankheiten wie Osteo-
porose, Diabetes und Bluthochdruck und trägt zur
Bereits ab einem Alter von 50 Jahren ist ein deutli- Vermeidung von funktionellen Einschränkungen
cher Anstieg lebensstilbedingter Erkrankungen wie bei (Voelcker-Rehage et al. 2005, Shaw et al. 2003,
koronarer Herzkrankheiten oder Diabetes Mellitus Tinetti 2003, Tinetti et al. 1994). Positive Effekte zei-
Typ II festzustellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass gen sich auch für das Immunsystem und die see-
ältere Menschen pflegebedürftig werden, steigt mit lische Gesundheit. Allerdings nutzen ältere Men-
zunehmendem Alter deutlich an. Bei vielen Krank- schen ihr Bewegungspotenzial nicht entsprechend
heitsbildern zeigt sich ein enger Zusammenhang ihrer Möglichkeiten und sind deutlich häufiger kör-
zwischen Alter und Häufigkeit von Krankenhaus- perlich inaktiv als jüngere Menschen (Robert Koch
behandlungen (Sachverständigenrat zur Begutach- Institut et al. 2009).
tung der Entwicklung im Gesundheitswesen 2008,
Statistische Ämter des Bundes und der Länder Das Ausmaß sozialer Integration ist ein weiterer
2008, Walter 2005). wesentlicher Einflussfaktor für das subjektive Wohl-
befinden im Alter. In zahlreichen Studien konnte
An den zentralen drei gesundheits- und sozialwis- gezeigt werden, dass das Ausmaß sozialer Inte-
senschaftlichen Verhaltensbereichen Ernährung, gration einen Effekt auf den Gesundheitszustand
Bewegung und soziale Integration können die und die Lebensdauer älterer Menschen hat. Im
Bedingungsfaktoren für Gesundheit, Autonomie Durchschnitt sind unverheiratete Menschen einem
und Lebensqualität deutlich gemacht werden: höheren Risiko ausgesetzt, früher zu versterben
Ernährung und Bewegung sind eine elementare als verheiratete Menschen. Dieser Zusammenhang
Voraussetzung für ein gesundes Altern. Allerdings zeigt sich vor allem bei Männern. Nicht nur eine
ist das Ernährungs- und Bewegungsverhalten vie- feste Beziehung, auch die Einbindung in ein sozi-
ler Senioren defizitär. So zeigen sich vor allem bei ales Netzwerk und regelmäßiger Kontakt zu ande-
Nahrungsmitteln wie Obst und Gemüse ungünstige ren Menschen haben einen positiven Effekt auf die
Verzehrgewohnheiten (Payette 2005, DGE 2001, Lebensdauer. Dieser Zusammenhang wurde vor
Stehle 2000, Seiler & Stähelin 1999). Auch die allem für Frauen festgestellt (Larson R 1978, Ste-
Trinkmenge ist bei älteren Menschen zu gering. In verink 2002, Seeman 1996, Berkman 1995, Thoits
einer Studie von Volkert et al. (Volkert et al. 2004) 1995, House et al. 1982, Berkman&Syme 1979,
konnte gezeigt werden, dass jeder siebte Über-65- Shye 1995).
12Gesund alt werden Baltes&Baltes 1990).
Die wesentliche Herausforderung für eine alternde Damit wird das aktive Altern (aktiv im Sinne von
Gesellschaft ist nicht die statistische Verlänge- Beteiligung) zu einem mehrdimensionalen Prozess,
rung der Lebenserwartung, sondern der qualitative der es Menschen ermöglicht, im zunehmenden Alter
Zuwachs, der es ermöglicht, das Auftreten schwerer ihre Gesundheit zu wahren, am Leben ihrer sozia-
Krankheiten zu verzögern. Das Hinausschieben der len Umgebung teilzunehmen und ihre persönliche
Morbiditätskompression ist nach Fries um ca. 10 Sicherheit zu gewährleisten. Das Gelingen dieses
Jahre möglich (Fries 2000, 1985, 1980). Bisherige Prozesses wird sowohl vom individuellen Lebens-
empirische Ergebnisse stützen diese These für ein stil als auch durch förderliche Rahmenbedingun-
gesundes Altern (Niehaus 2006, WHO 2002, Walter gen (Lebenswelten) bestimmt und trägt entschei-
2005). Als wichtige Voraussetzung für ein gesundes dend zur Lebensqualität bei (Sachverständigenrat
Altern gilt nach dem Active-Aging-Ansatz der WHO zur Begutachtung der Entwicklung im Gesund-
(2002) neben der Risikoreduzierung für körperliche heitswesen, 2008, WHO 2002). Die Förderung
Beeinträchtigungen eine lebenslange Optimierung von Verhaltensweisen mit dem Ziel eines gesun-
von Möglichkeiten für körperliches, psychisches den Lebensstils, wie bspw. eine ausgewogene
und soziales Wohlbefinden. Damit verfolgt Active- Ernährung, haben sich in verschiedenen Studien
Aging vor allem zwei Ziele: als wichtige veränderbare Einflussgrößen für ein
gesundes Altern herausgestellt (Peel et al. 2005).
1. Die individuelle Lebensqualität besonders Wenn gesundheitsförderliche Verhaltensweisen in
durch den Erhalt der Autonomie zu steigern. gut konzipierten Interventionsmaßnahmen gezielt
2. Die finanziellen Belastungen für das Ge- gefördert werden, lässt sich nicht nur eine quan-
sundheits- und Sozialsystem zu reduzieren. titative Verlängerung des Lebens, sondern eine
qualitative Steigerung der Lebensqualität erreichen
In Anlehnung an die Salutogenese (Was erhält (Robert Koch Institut 2009).
gesund?) (Bengel et al. 1999, Antonovsky & Franke
1997) stellt der Successful-Aging-Ansatz nach Förderung der Lebensqualität älterer
Rowe und Kahn (Rowe & Kahn 1998, 1997) neben Menschen
den funktionalen Fähigkeiten im körperlichen und
mentalen Bereich vor allem das soziale Engage- Die Lebensqualität älterer Menschen zu fördern
ment im Alter (z.B. ehrenamtliche Tätigkeiten) als beinhaltet frühzeitige und dauerhafte Unterstützung
wichtige Voraussetzungen für erfolgreiches Altern im Prozess des aktiven Alterns.
heraus.
Dabei gelten in den Gesundheitswissenschaften
Nach dem Konzept von Baltes und Baltes steht settingbezogene Ansätze als wirkungsvolle Inter-
vor allem das produktive Altern im Zentrum des ventionen zur Konkretisierung der Gesundheits-
Successful-Aging-Ansatzes. Demnach zeichnet förderung im Sinne der WHO Definition (Gesunde
sich das erfolgreiche Altern besonders durch eine Städte-Netzwerk 2010, WHO 2009, Bundeszen-
förderliche Adaption an alterspezifischen Verlus- trale für gesundheitliche Aufklärung 2003). Die
ten und Herausforderungen im körperlichen, kog- Einbindung unterschiedlicher Zielgruppen und die
nitiven und sozialen Bereich aus (Baltes 1999, Durchführung sowohl universeller als auch selek-
13Thematische Einleitung und Grußworte
tiver Präventionsmaßnahmen lassen sich mit Hilfe individuellem Wohlbefinden und Nutzen. „Schätzen
des Setting-Ansatzes realisieren. Die Fokussierung sich die Projektteilnehmer in ihren unterschied-
auf universelle Prävention richtet den Blick auf alle lichen Beiträgen für die gemeinsamen Ziele, wird
im Setting agierenden Personen. Während selek- dem Einzelnen auch ein Gefühl der Selbstschät-
tive Prävention sich an potentielle Risikogruppen zung ermöglicht, weil ihm vermittelt wird, dass er
(bspw. alleinlebende Männer) richtet. Die Fokus- einen besonderen Beitrag leistet, der von den ande-
sierung auf definierte Sozialräume, wie z.B. das ren als wertvoll anerkannt wird“ (Eisentraut 2008).
Quartier, ermöglicht es, Zielgruppen genauer zu Ziel einer solchen intergenerativen Projektarbeit ist
bestimmen, adäquate Zugangswege festzulegen, es, die Potentiale älterer und jüngerer Menschen
Ressourcen zu nutzen und ein Höchstmaß an Par- im Sinne des Bürgerschaftlichen Engagements zu
tizipation zu ermöglichen. nutzen und die Lebenszufriedenheit bei jungen und
alten Menschen zu verbessern (Holbach-Gömig &
Miteinander aktiv Seidel-Schulze 2007).
Eine wesentliche Voraussetzung für das Gelingen Die moderne Industrie- und Informationsgesell-
von Partizipation im Sozialraum stellt Bürgerschaft- schaft ist einem ständigen Wandel unterzogen mit
liches Engagement dar. Es wird verstanden als der Folge, dass Wissen schnell veraltet. Zwar ver-
„unbezahlte, freiwillige und gemeinwohlorientierte fügen ältere Menschen über reichhaltigere Erfah-
Aktivität“ (Bundesministerium für Gesundheit 2009, rungen, jüngere Menschen sind jedoch mit dem
Schulte et al. 2008). Der positive Nutzen Bürger- aktuellen Wissen oft besser vertraut. Beide Berei-
schaftlichen Engagements kann aus zwei Blickwin- che – die Erfahrung der Alten und das Wissen der
keln betrachtet werden: Zum einen ergibt sich der Jüngeren – sind jedoch notwendig, um den Her-
gesellschaftliche Nutzen durch gemeinwohlorien- ausforderungen einer schnelllebigen Zeit begegnen
tierte Aktivitäten einer insgesamt älter werdenden zu können (Greger 2001). Während in den USA die
Gesellschaft, zum anderen zeigt sich der individu- Professionalisierung von Generationsarbeit struk-
elle Nutzen der sich engagierenden Personen im turell bereits weit vorangeschritten ist (Newman
Sinne einer aktiven Teilnahme und damit als aktives 1997a, b), steht die wissenschaftliche Auseinan-
Altern (Heinze &Olk 2001). Die Anerkennung und dersetzung mit diesem Thema in Deutschland erst
Akzeptanz des Bürgerschaftlichen Engagements am Anfang.
in der Kommune wird insbesondere dann gelingen,
wenn die Aktivitäten der Senioren als Unterstützung Gesundheitsmündigkeit für
für z.B. die Präventionsarbeit mit Kindern verstan- Jung und Alt
den und anerkannt werden.
Um die Lebensqualität und die Gesundheitsmün-
Durch die Entwicklung und Implementierung gene- digkeit von alten Menschen zu fördern, empfeh-
rationsübergreifender Projekte kann ein gegensei- len sich niederschwellige Interventionen, wie sie
tiger Austausch unterschiedlicher Lebenserfahrun- im Konzept zur Förderung von Health Literacy
gen und –perspektiven in Gang gesetzt werden, die zugrunde gelegt werden. Die WHO (1998) definiert
wiederum zu Prozessen intergenerativer Anerken- Health Literacy als die Gesamtheit der kognitiven
nung führen. Insbesondere die erfahrbare gegen- und sozialen Fertigkeiten, welche die Menschen
seitige Wertschätzung auf beiden Seiten führt zu motivieren und befähigen, ihre Lebensweise derart
14Thematische Einleitung und Grußworte
zu gestalten, dass sie für die Gesundheit förderlich heit zu tun, lässt sich nur durch eine ganzheitliche
ist (Nutbeam 2000). Das U.S. Department of Health Herangehensweise in den Feldern Sozialarbeit und
and Human Services (Department of Health and Gesundheitsförderung erfolgreich bewältigen.
Human Services 2010) definiert Health Literacy als
Schlüssel eines gesundheitsfördernden Verhaltens Aktuelle Forschungsergebnisse unterstreichen die
unter dem Gesichtspunkt der Eigenverantwortung Notwendigkeit, settingbezogene und womöglich
jedes Einzelnen: „The degree to which individuals intergenerative Projektarbeit zu implementieren
have the capacity to obtain, process and under- und Senioren im Hinblick auf die Gesundheits-
stand basic health information and services nee- mündigkeit zu fördern und zu unterstützen. Dabei
ded to make appropriate health decisions”. erscheint es sinnvoll, die Senioren bereits in der
Planungsphase aktiv zu beteiligen. So können neue
Für die Förderung von Health Literacy in konkre- Wege zur Förderung der Motivation, Anerkennung
ten Verhaltensbereichen fehlen in Deutschland und Unterstützung älterer Menschen erschlossen
weitgehend konkrete Leitfäden und Materialien für werden.
die Zusammenarbeit mit Senioren (Health Com-
munication Laboratory 2005). Lediglich für den (Die verwendete Literatur zu „Miteinander aktiv älter
Bereich von Food Literacy (Ernährungsmündigkeit) werden. Demographische Transition und Gesund-
ist vom Aid-Infodienst ein Konzept mit Übungen für heit im Alter“ finden Sie auf Seite 80-83)
den Einsatz in der Erwachsenenbildung veröffent-
licht worden. Hierzu wurden von Studierenden der
Hochschule Coburg Übungen für die Zusammenar-
beit mit Senioren entwickelt und mit der Zielgruppe
getestet (Aid 2010, BEST 2006). Eine solche gene-
rationsübergreifende Projektarbeit führt zu einer
bedeutsamen Ressourcenaktivierung zur Unter-
stützung des aktiven Alterns.
Bislang laufen die generationsübergreifende För-
derung von Health Literacy sowie die Partizipation
der Beteiligten in ihrem Sozialraum in der Pra-
xis häufig nebeneinander her. Die Förderung der
Gesundheitsmündigkeit von älteren Menschen,
konkretisiert in den oben ausgeführten drei gesund-
heits- bzw. sozialwissenschaftlich zentralen Verhal-
tensbereichen Ernährung, Bewegung und soziale
Integration, stellt eine zentrale Herausforderung für
die Kooperation und Vernetzung des Sozial- und
Gesundheitssystem dar. Die Erreichbarkeit und
passende Ansprache der heterogenen Gruppe der
Senioren sowie die Motivation des Einzelnen, auch
im hohen Alter noch aktiv etwas für die Gesund-
15Fachvorträge FACHVORTRÄGE 16
Fachvorträge
Jung und alt im Dialog in diesem Bereich tätig geworden sind.
Prof. Dr. Susanne Gröne Da stellt sich mir die Frage: Wieso eigentlich ist es
Hochschule Coburg, notwendig, sich um den Dialog der Generationen
Fakultät Soziale Arbeit zu kümmern? Wieso ist es notwendig, jung und alt
und Gesundheit zusammenzubringen? Hat sich etwas verändert,
gibt es zu wenig Kontakt, oder gibt es zu wenig
Verständnis, was ist da eigentlich los?
In Coburg ist in der letzten Woche etwas Unge- Hinter den vielen Aktionen stecken meiner Meinung
wöhnliches passiert: Auf Initiative des Coburger nach zwei Grundüberzeugungen:
Bürgermeisters Tessmer, durchgeführt vom Mehr- 1. Die erste These, die dahintersteckt,
generationenhaus der AWO und evaluiert von der besagt, dass junge und alte Menschen zu
Hochschule Coburg haben SchülerInnen und Seni- wenig oder zu schlecht miteinander
orInnen bei der Aktion „Passantenstopp“ in der kommunizieren
Fußgängerzone der Stadt jeweils entweder ältere 2. und die zweite Hypothese ist die, dass es
oder junge Menschen einfach mit dem Satz ange- sinnvoll wäre, wenn sie es täten.
sprochen: „Darf ich Sie ein Stück begleiten?“ Es
ging darum, auf ganz einfache Art und Weise Kon- Ich möchte zu diesen zwei Thesen einige Überle-
takte zwischen jung und alt herzustellen und mitein- gungen anstellen. Zuerst die Frage: Ist es so, dass
ander zu reden. Schlichte Kommunikation über all- junge und alte Menschen zu wenig oder zu wenig
tägliche Themen als Türöffner für mehr Miteinander. qualitätsvoll miteinander reden?
Teilnehmende haben berichtet, dass die Erwartun-
gen beider Gruppen übertroffen wurden, die jünge- Rein quantitativ gesehen sind Gespräche zwischen
ren waren überrascht, wie leicht es war, ältere Men- alten und jungen Menschen außerhalb der Familie
schen anzusprechen und miteinander in Kontakt zu oder im institutionellen Rahmen selten. Brown &
kommen, die Älteren waren ebenfalls überrascht, Rogers folgern, dass daraus ein Gefühl der Fremd-
dass die jungen Menschen, die sie angesprochen heit und Ungewissheit resultiert, der sich als Barri-
haben, offen und aufgeschlossen waren. Verände- ere herausstellt und es deshalb auch wenig Anreize
rung der Sichtweise des anderen auf beiden Seiten, zur Kommunikation gibt (vgl.: Thimm 2002).
Erfahrungen von Neuem durch eine einfache, klei-
ne, völlig unaufwändige Aktion. - Wer da übrigens Insbesondere in Bezug auf die Qualität der Kommu-
mitmachen möchte, der „Passantenstopp“ war nikation gibt es Forschungsergebnisse, die besa-
keine einmalige Aktion, sondern findet im Oktober gen, dass der Dialog zwischen jung und alt häufig
immer donnerstags und samstags in der Coburger misslingt (Thimm 2002, 177), weil sie sich in Bezug
Fußgängerzone statt. Diese ungewöhnliche Aktion auf die Sprache, die Wortwahl, das Sprechverhal-
ist nur ein kleines Beispiel für vielfältige Versuche, ten und die nonverbale Kommunikation sehr stark
junge und alte Menschen miteinander ins Gespräch unterscheiden und damit kaum Voraussetzungen
zu bringen. Es gibt Preise, die für besonders gute für wirkliches „Verstehen“ gegeben sind. Der Satz
Ideen ausgelobt werden und eine große Spannbrei- „Verstehen ist unwahrscheinlich“ von R. Sprenger
te von Initiativen, Gruppierungen und Vereinen, die bezieht sich zwar grundsätzlich auf die Kommuni-
17Fachvorträge
kation zwischen Menschen - zeigt aber an dieser äußere Welt ist eine andere geworden. Das innere
Stelle seine ganze Schärfe. Das Verstehen zwi- Erleben geht häufig damit einher und ist verändert,
schen jung und alt ist unwahrscheinlich. wir leben heute in einer anderen Welt als noch vor
dreißig Jahren.
Giles & Coupland haben in Bezug auf die Verstän-
digung zwischen Jüngeren und Älteren ein alters- Senioren können oder wollen nicht immer mit den
bezogenes Kommunikationsdilemma festgestellt Veränderungen Schritt halten. Möglicherweise ist
(Thimm 2002, 178). Stereotype wie zum Beispiel dies Ausdruck eines Defizits, möglicherweise aber
„Alte Menschen sind verhärtet, wollen Junge immer auch Ausdruck der Selbstbestimmung. Aber die
nur bevormunden, verstehen die Welt nicht mehr, Entscheidung sich nicht mehr mit einer bestimm-
brauchen Hilfe “ oder „Junge Menschen haben nie ten Sache auseinander zu setzen, vergrößert den
Zeit, hören nicht zu, denken nur an sich selbst…“ Abstand zwischen den Lebenswelten von jungen
beeinflussen die Kommunikation in eine negative und alten Menschen. Unterschiede soweit das
Richtung und sorgen dafür, dass es im Gespräch Auge reicht. Diese Unterschiede zwischen den
Anpassungsversuche der einen oder anderen Generationen hat es zwar immer schon gegeben,
Generation gibt, die dann aber häufig misslingen aber durch den schnellen gesellschaftlichen Wan-
und den Dialog zwischen jung und alt beeinträch- del ist dieser in der jetzigen Zeit besonders stark
tigen. Zum Beispiel kann es sein, dass ein junger ausgeprägt.
Mensch, der mit einem Älteren redet, ganz langsam
spricht, die Lautstärke erhöht, weil er davon aus- Aber jetzt kann man sagen, okay, so ist es – war-
geht, dass der ältere Mensch schlecht hört. In der um sollten wir das ändern? Welchen Sinn macht es,
Regel versucht einer der beiden Kommunikations- wenn jung und alt mehr oder intensiver und besser
partner sich auf den anderen einzustellen, versucht miteinander reden?
den Gesprächsverlauf zu kontrollieren. Das hat zur
Folge, dass es kein Gespräch auf gleicher Augen- Es geht bei der Verständigung um Verständnis,
höhe gibt, einer der Kommunikationspartner hat gegenseitigen Respekt, Wertschätzung und Berei-
wenig Platz zur Mitgestaltung des Gesprächsver- cherung des Lebens. Denn es ist grundsätzlich so,
laufs und folglich nicht unbedingt Interesse daran, dass der Einblick in eine fremde Lebenswelt die
den Dialog fortzusetzen. eigene bereichern kann. Die Frage nach dem ande-
ren Lebensalter ist meiner Meinung nach eine ganz
Obwohl es Verständnisprobleme natürlich schon fundamentale und verankert bei den drei großen
immer gegeben hat, ist der an vielen Stellen philosophischen Fragen des Menschen: Wer bin
beschworene gesellschaftliche Wandel neben dem ich – woher komme ich – wohin gehe ich.
altersbezogenen Kommunikationsdilemma ganz
wesentlich dabei beteiligt, dass die Kommunika- Junge Menschen können im Kontakt mit älteren
tion zwischen jung und alt sehr viel schwieriger Menschen diese Fragen näher beleuchten: „Woher
geworden ist, es hat sich in den letzten Jahren und komme ich“, was können mir die älteren Menschen
Jahrzehnten sehr viel verändert. Natürlich die Tech- über Kultur, Heimat, Geschichte, über meinen Wer-
nik, aber nicht nur, auch der Musikgeschmack, die degang erzählen. „Wer bin ich“ stellt die Frage nach
Mode, die Literatur, die Architektur, die Einrichtung der momentanen erkannten Identität, „wohin gehe
von Häusern und Wohnungen hat sich geändert, die ich“ – damit ist zwar im Endeffekt auch die Frage
18Fachvorträge
nach dem Tod gemeint, aber die Frage nach dem Literatur:
Älterwerden steht auch hier in einem engen Zusam- Thimm, Caja (2002): Alter als Kommunikationsproblem. In: Fieh-
menhang. ler, Reinhard (Hg.): Verständigungsprobleme und gestörte Kom-
munikation. Radolfzell: Verlag für Gesprächsforschung.
Wie könnte denn mein weiteres Leben ablaufen, S.177-197.
wie werde ich mich möglicherweise entwickeln, wie
verändere ich mich körperlich, geistig und seelisch,
wenn ich älter werde? „Wie werde ich sein, wenn
ich alt bin“ ist zwar keine Frage, die sich junge Leu-
te jeden Tag stellen, aber es spielt doch immer wie-
der eine Rolle bei der Gestaltung des Lebens.
Auch für die älteren Menschen gibt der Dialog mit
der Jugend Antworten auf diese Fragen, aber unter
einem anderen Blickwinkel. Der Kontakt mit jungen
Menschen lässt die eigenen jungen Seiten anklin-
gen, stellt den älteren Menschen vor die Frage, wie
war ich als junger Mensch. Was habe ich erlebt,
„der Kontakt mit jungen Menschen hält jung“ wird
oft gesagt und in diesem Sinne stimmt das, weil die
eigene Jugendlichkeit aktiviert wird. Aber oft gibt
es auch Unverständnis für die Probleme und Her-
ausforderungen von heute, weil es „damals ganz
anders war“ - aber immer wieder auch Erkennen
der eigenen Position in den Erlebnissen des ande-
ren. Der Kontakt mit den jungen Menschen geht
aber auch die transzendente Frage des Menschen
ein, was wird nach mir sein, oder was bleibt von
mir, von meinen Gedanken, hinterlasse ich Spuren?
Damit profitieren die Generationen an ganz ele-
mentarer Stelle von dem gemeinsamen Dialog, es
geht über ein bisschen „erzählen“, ein bisschen
„Verständnis“ hinaus und betrifft den ganzen Men-
schen. Und darum ist es auch so wichtig, diesen
Dialog zu fördern.
Ich freue mich, dass es dazu heute diese Tagung
gibt, die Gedanken vermitteln, Impulse geben, aber
auch aktives miteinander reden fördern will. Ich
wünsche Ihnen deshalb einen interessanten Aus-
tausch und eine für Sie ertragreiche Tagung.
19Fachvorträge
Das Neue braucht das Alte - die auf dem Arbeitsmarkt wenige Chancen haben.
Es sind die 50-64jährigen, die den großen Teil der
Das Miteinander der Freiwilligen-Arbeit und Ehrenämter leisten. Die Soli-
Generationen darität der Generationen ist eine der bedeutsamen
Leistungen unserer Gesellschaft.
Univ.-Prof. Dr. Frieder R. Lang Bedeutet dies, dass es keine Konflikte zwischen den
Friedrich-Alexander-Universität Generationen gibt? Selbstverständlich nicht. Gene-
Erlangen-Nürnberg
rationenkonflikte sind heute so präsent wie früher.
Sie gehören unverzichtbar zu unserem gesellschaft-
Im Miteinander bedeuten die Generationen einan- lichen Zusammenleben. Die Generationen haben
der zugleich Herkunft und Zukunft. Eine ungewisse einander schon immer besorgt gemacht, einander
Zukunft, die erst im Zusammenhalt der Generatio- bewegt, verärgert und verändert. Das überliefern
nen möglich wird. Ohne einander wäre man nicht. auch historische Quellen, manche Grundkonflikte
Die Jugend von gestern trifft die heute Jungen und in der Familie, zwischen älteren und jungen Men-
die Älteren von morgen treffen die schon Gealter- schen, waren nie anders als sie sich heute darstel-
ten. Wie aber können die Erfahrungen der Jungen len. Ich will einige Beispiele geben.
und die der Alten ausgetauscht und wechselseitig
nutzbar gemacht werden? Das ist die Schlüsselfra- Kommunikation: Aus vielen psychologischen
ge der Generationenforschung. In den Worten des Studien wissen wir, dass jüngere Menschen sich
90-jährigen Philosophen Professor Odo Marquard älteren und hoch betagten Menschen mit einem
liest es sich so: „Wo wir anfangen, ist niemals der eigenen besonderen Sprechstil nähern, der in der
Anfang. Vor jedem Menschen hat es schon andere Literatur als „patronisierend“ beschrieben wird und
Menschen gegeben, in deren Üblichkeiten - Tra- der in etwa der Babysprache ähnelt, die Erwachse-
ditionen - jeder hineingeboren ist und an die er, ne im Umgang mit Kleinkindern zeigen. Bekannt-
Ja sagend oder negierend, anknüpfen muss. Das lich missfällt es älteren Menschen, in dieser Wei-
Neue, das wir suchen, braucht das Alte, sonst kön- se angesprochen zu werden, auch wenn Sie sich
nen wir das Neue auch gar nicht als solches erken- wünschen, dass Andere langsam und deutlich,
nen. Ohne das Alte können wir das Neue nicht gleichwohl aber authentisch zu Ihnen sprechen.
ertragen.“ Man kann nur erahnen, wie viele Konflikte zwischen
älteren und jüngeren Interaktionspartnern unwis-
Was also bedeutet in diesem Zusammenhang die sentlich auf nicht angemessene Kommunikations-
Rede vom Miteinander der Generationen? Fast sind stile zurückzuführen sind.
wir es schon gewohnt, wenn Einige unbedacht vom
Krieg oder vom Kampf der Generationen sprechen. Generationenübergänge: Eines der großen The-
Bekanntlich ist das Gegenteil der Fall: Es steht men unserer Zeit ist die Frage, wie wir die Wei-
meist exzellent um die Qualität der Familiengene- tergabe von Verantwortung, Führung, Vermögen
rationen, die einander nahe- und beistehen, sich und Wissen innerhalb der lokalen, familialen und
helfen und unterstützen und einander das geben, politischen Eliten organisieren sollen. Immer wie-
was sie verfügbar haben und darin sogar selbst- der erleben wir, dass Jüngere es kaum abwarten
los scheinen. Auch das Ehrenamt ist eine Leistung mögen, bis „der Alte“ endlich abtritt und es den
des Alters, wobei hier gerade diejenigen glänzen, Älteren graut, wenn Sie an das denken, was da
20Fachvorträge
nach ihnen kommt (und dabei manchmal zurecht nen, denn als wahre Meisterleistung. Der Konflikt
oder zu Unrecht den Untergang ihres Lebenswerks äußert sich darin, dass die Älteren den Nutzen für
befürchten). sich nicht erkennen und die jüngeren Entwickler
kein Konzept der Bedürfnisse und Kompetenzen
Diskriminierung und Stereotype: Konflikte der dieser Nutzer haben. Es gibt also durchaus Kon-
Generationen spielen sich am häufigsten, leider oft flikte im Generationenverhältnis, aber häufig sind
unbemerkt und manches Mal auf dramatische Wei- sie auf Anpassungsprobleme bei der jüngeren oder
se, in unseren stationären Einrichtungen der Alten- der älteren Generation zurückzuführen - Anpas-
hilfe ab. Es sind die Konflikte zwischen schlecht sungsprobleme, die mit Kommunikationsdefiziten,
bezahlten und gelegentlich überforderten Pflege- unangemessenen Einstellungen, Vorurteilen, man-
kräften, Ärzten und Helfern, die für ihre außerge- gelnder Flexibilität, fehlender Erfahrung und gele-
wöhnliche Leistungen und Kompetenz in Heimen, gentlich mit Starrsinn und Selbstgefälligkeit zu tun
Kliniken und Krankenhäusern nicht die gesell- haben: All diese Herausforderungen an moderne
schaftliche Anerkennung finden, die sie tatsächlich Gesellschaften des langen Lebens erscheinen lös-
verdienen. Der Konflikt zeigt sich auch darin, dass bar. Wir sollten das Miteinander der Generationen
gerade in diesen Berufen, bei den Pflegern und den als die Leistung erkennen, die es ist, die wir ständig
Ärzten, die negativsten Einstellungen und Vorurteile erbringen, die unsere Zukunft ist.
gegenüber älteren Menschen bestehen. Das mag
daran liegen, dass heilende Berufe noch wenig auf (Die Präsentation zum Vortrag „Gesund und aktiv
die Potenziale des Alterns ausgerichtet sind. Altern: Wofür die Generationen einander brauchen
(und wofür nicht)“ finden Sie auf Seite 60-72)
Qualifikation- und Karriere: Generationenkonflik-
te begegnen uns auch am Arbeitsplatz, dann näm-
lich wenn ältere Arbeitnehmer ausgegrenzt werden,
beispielsweise weil die jüngeren nachdrängen und
sich für die eigene Zukunft bewähren wollen und
müssen. Das Bedürfnis der Jüngeren nach Erfolg
in der Karriere ist für den Älteren gelegentlich eine
Bedrohung, auch der eigenen Position. Die Konflik-
te sind vorprogrammiert.
Markt- und Produktentwicklung: Wann immer
ältere Menschen sich weigern, ein neues Produkt,
einen Computer, ein mobiles Telefon oder ein über-
lebenswichtiges medizin- technisches Gerät zu
erwerben, dann verbirgt sich dahinter vielleicht
auch ein Generationenkonflikt. Es handelt sich
um den Konflikt zwischen einem jungen Ingenieur
und Technikexperten, der mit neuen Möglichkeiten
spielt und dabei Innovationen erschafft, die älteren
Nutzern oft nur als Spielerei oder Unsinn erschei-
21Fachexpertise FACHEXPERTISE 22
Fachexpertise
Gesundheitsförderung – Der umfassenden Gesundheitsförderung kommt
was können Kommunen leisten? dabei ein besonderer Stellenwert zu, denn sie
ist der Gewährleistungsträger für den Erhalt der
– mit Beispielen aus dem Lebensqualität. Gesundheit ist die Grundvoraus-
Landkreis Coburg – setzung für alle Altersgruppen sich wohl zu fühlen
und leistungsfähig zu sein und zu bleiben, um so
Martina Berger ein selbstbestimmtes und aktives Leben führen zu
Landratsamt Coburg,
können (vgl. BZgA 2012:1). Die vor Ort vorzufinden-
Landkreisentwicklung
den Lebensbedingungen haben dabei einen star-
Obwohl die Charta von Ottawa bereits ein viertel ken Einfluss auf den Gesundheitszustand der dort
Jahrhundert alt ist, hat sie in ihren Grundaussa- lebenden Bevölkerung (vgl. Schmidt 2011:215).
gen nichts an Bedeutung verloren (WHO 1986). Sie Insofern muss sinnvollerweise auch die Gesund-
fußt auf dem durch die Weltgesundheitsorganisati- heitsförderung in der Lebenswelt ansetzen – dort
on bereits 1946 grundgelegtem Verständnis, dass wo die Menschen wohnen, arbeiten, sich versor-
Gesundheit sich nicht nur über die „Abwesenheit gen, sich bilden, sich erholen und gemeinsam mit
von Krankheit und Gebrechen“, sondern als „… der anderen ihre Freizeit gestalten – in den Städten und
Zustand des völligen körperlichen, geistigen und Gemeinden vor Ort.
sozialen Wohlbefindens …“ definiert (WHO: 1946).
Demzufolge steht auch die Förderung der Gesund- Die Gesundheitsförderung setzt dabei an den ver-
heit in einem gesamtgesellschaftlichen Kontext und schiedenen Ausgangspunkten an, die Gesundheit
verfolgt das Ziel, allen Menschen die Möglichkeit beeinflussen: Zum einen bei jedem Einzelnen und
zu eröffnen, die ihnen innewohnenden Potenziale bei dessen persönlicher Lebens- und Verhaltens-
vollständig zur Entfaltung bringen zu können. Damit weise, zum zweiten beim sozialen Umfeld, das
sind nicht nur Einzelne, sondern auch Gruppen und jeden Einzelnen beeinflusst und ggf. unterstützt,
Gemeinschaften, Kommunen und die Gesamt- zum dritten bei den spezifischen Lebens- und
politik aufgefordert, dazu beizutragen, dass die Arbeitsbedingungen und nicht zuletzt viertens bei
Entwicklung dieser Potenziale gelingen kann (vgl. den Wirkungen, die die Umwelt sowohl wirtschaft-
BZgA 2009:21). lich, kulturell als auch physisch zeitigt (vgl. Gesund-
heit Berlin-Brandenburg e.V. 2010:7).
Die Handlungsnotwendigkeit und auch der Hand-
lungsdruck werden durch den demografischen Spürbare Wirksamkeit wird Gesundheitsförderung
Wandel vor Ort zusätzlich verstärkt. In vielen Kom- da entfalten, wo verhaltensbezogene Maßnah-
munen des ländlichen Raumes findet sowohl eine men (bis hin zur Einzelfallbetreuung von Personen
Abnahme der jüngeren Bevölkerung als auch eine mit hohem Risiko) mit verhältnisbezogenen Maß-
deutliche Zunahme der älteren Bevölkerung statt. nahmen, die an den Grundvoraussetzungen für
Durch diese sich ändernde Bevölkerungsstruktur Gesundheit ansetzen und die vor allem von Seiten
ergeben sich neue Anforderungen an das zukünfti- der Politik zu initiieren sind, zusammen wirken (vgl.
ge Leben in der Gemeinschaft, die die Kommunen Schmidt 2011:218; Gesundheit Berlin-Brandenburg
vor die Aufgabe stellen, zeitnah wirksame Strate- e.V. 2010:7). Damit ist die Gesundheitsförderung
gien mit dem Ziel zu entwickeln, die Lebensquali- eine Querschnittsaufgabe in der Kommunalpolitik.
tät im ländlichen Raum nachhaltig sicherzustellen. Zahlreiche Politikfelder, wie das Siedlungs- und
23Fachexpertise
Flächenmanagement, die Ortsentwicklung und die 1
Das Gesundheitsamt deckt ein sehr breites Aufgabenspek
Verkehrsplanung, aber auch die Arbeitsmarkt- und trum ab, zu dem Gesundheitsschutz, Gesundheitsaufsicht,
Wirtschaftspolitik ebenso wie die Sozialpolitik und Gesundheitsberichterstattung und Planung, neben der Ge-
der Umweltschutz nehmen, mit den dort getroffenen sundheitsförderung auch die Gesundheitsvorsorgebera-
Entscheidungen, direkten Einfluss auf Gesundheit tung und –betreuung sowie gutachterliche Tätigkeiten und
und Wohlbefinden der Bevölkerung (vgl. Schmidt der gesundheitliche Verbraucherschutz gehören.
2011 218). Zum Teil mit gezielten Effekten, wie bei-
spielsweise dem Bau eines Thermalbades, zum sie da, wo es sinnvoll und notwendig ist, weiter-
Teil aber auch als Nebeneffekte mit hoher Bedeu- zuentwickeln, bestehende Versorgungslücken
tung, wie beispielsweise dem Bau eines Stausees und Hemmnisse aufzuzeigen und Ideen zu deren
als Wasserrückhaltebecken im Rahmen des Hoch- Behebung zu entwickeln. Im Landkreis Coburg
wasserschutzes, der von der Bevölkerung nach findet das im Rahmen der Erarbeitung einer breit
kurzer Zeit auch als Naherholungsgebiet genutzt angelegten Regionalstrategie zur Daseinsvorsorge
wird. Nicht nur bedingt durch diese vielschichtigen statt, die als eines von acht Themenfeldern auch
Wechselwirkungen ist die Gesundheitsförderung in die ärztliche Versorgung und die Gesundheitsför-
ihren Gestaltungsformen und Wirkungen von jeher derung im Fokus hat. Der vom Gesundheitsamt
von zentraler politischer Bedeutung. im Tandem mit einem Bürgermeister hierzu gelei-
tete Arbeitskreis setzt sich aus lokalen Akteuren
Innerhalb der Behördenstruktur bildet sich das zusammen, die das Ziel eint, eine gute gesund-
durch das Gesundheitsamt ab, das als untere heitliche Versorgung im Landkreis Coburg auch im
Staatsbehörde im Rahmen der Kommunalisierung Bereich der Gesundheitsförderung sicherstellen zu
den Verwaltungen der Landratsämter angegliedert wollen. Ergebnisse aus dem aktuell laufenden Pro-
wurde. Ihm obliegt als Aufgabe mit wachsender zess werden im Herbst 2013 gekoppelt mit Hand-
Bedeutung auch die Gesundheitsförderung. In mul- lungsempfehlungen vorliegen. Was wie in welchem
tiprofessionell zusammenarbeitenden Teams wird Umfang zur Umsetzung gelangt, ist in weiten Tei-
hier auf der Ebene des Landkreises das „Gerüst“ len vom Votum der Kommunalpolitik abhängig,
für eine gelingende Gesundheitsförderung errichtet. die – in diesem Fall durch die Arbeitskreisleitung
Die zentrale Herausforderung ist es dabei, nicht nur - frühzeitig in die Überlegungen mit eingebunden
einzelne Konzepte und Programme, sondern eine werden sollte. An dieser Stelle wird allerdings auch
integrative Strategie zu entwickeln, wie, mit wem eine „Sollbruchstelle“ der Kommunalisierung der
und mit welchen Schwerpunkten Gesundheitsför- Gesundheitsförderung deutlich: Sie wurde zwar
derung im Landkreis vorangebracht werden kann. stärker in die Zuständigkeit der Landkreise über-
Die Ebene des Landkreises bildet hierbei idealty- antwortet, damit ging jedoch kein Transfer an ent-
pischerweise die Kooperationsplattform, auf der – sprechenden Haushaltsmitteln einher. Die finanziell
moderiert und initiiert durch das Gesundheitsamt - oftmals sehr schwierige Lage der Kommunen führt
die zahlreichen in der Gesundheitsförderung tätigen dazu, dass sie sich vor allem auf die Pflichtleistun-
Akteure zusammenkommen, um gemeinschaftlich gen konzentrieren müssen und sich außer Stande
die vorhandenen Strukturen, Maßnahmen und Pro- sehen, die nachrangigen „Kann-Leistungen“ zu
gramme bedarfsbezogen zu überprüfen, finanzieren. Gerade im öffentlichen Gesundheits-
dienst handelt es sich jedoch vor allem um eben
jene „Kann-Leistungen“ die zu einer umfassenden
24Sie können auch lesen