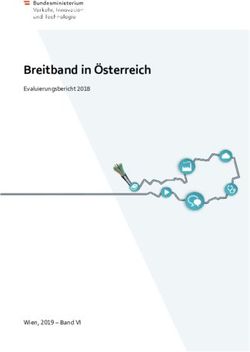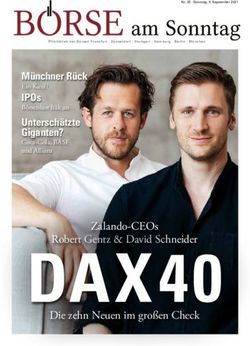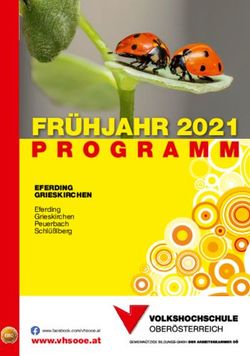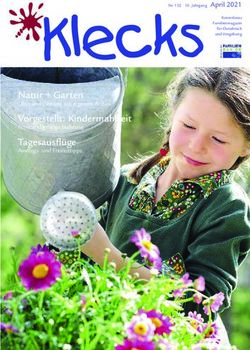SUN - UNIVERSITÄT MÜNSTER
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
SuN
Heft 01/2021
Soziologie und Nachhaltigkeit -
Beiträge zur sozial-ökologischen Transformationsforschung
Luigi Droste / Björn Wendt
Who Cares?
Eine ländervergleichende Analyse klimawandelbezogener Besorgnis
in Europa
Zusammenfassung: Dieser Beitrag untersucht Abstract: This article investigates a rarely studied
ein bislang in der deutschsprachigen Klimaforschung issue in climate change research in Germany: the
weithin vernachlässigtes Thema: Die Besorgnis worries about climate change among citizens.
über den Klimawandel in der Bevölkerung. Auf Against the backdrop of current sociological
der Grundlage eines zeitdiagnostischen Zugangs, diagnoses of the times which suggest worries as
der von der zentralen Bedeutung von Sorgen in der of central importance in present society, we first
Gegenwartsgesellschaft ausgeht, untersuchen wir in address previous research on worries about climate
einem ersten Schritt mittels eines internationalen change by taking a look at international research
Literaturüberblicks den Forschungsstand zur Wahr- on climate change perceptions. On this basis, we
nehmung des Klimawandels in der Bevölkerung formulate a set of hypotheses for explaining worries
mit Schwerpunkt auf der Dimension der Klimabe- about climate change. We examine these hypotheses
sorgnis. Davon ausgehend leiten wir Hypothesen empirically by taking on a multi-level approach and
zur Erklärung der klimabedingten Besorgnis ab, die utilizing data from the European Social Survey.
wir mittels einer Mehrebenenanalyse und auf Basis The analyses show that worry about climate change
von Daten des European Social Survey empirisch depends strongly on individual attributes, rather
überprüfen. Die Analysen zeigen, dass Klimasorgen than the country people live in. In particular, indi-
relativ weit verbreitet sind, sich jedoch nur in sehr vidual value orientations, climate change awareness
geringem Maß über die Varianz zwischen Ländern and political attitudes prove to be consistent and
erklären lassen. Vielmehr sind verschiedene soziale important correlates of climate worries.
Prädikatoren auf Individualebene von zentraler
Bedeutung. Insbesondere Variablen wie die indivi-
duelle Wertorientierung, die Gewissheit über den
Klimawandel und die politische Orientierung der
Befragten erweisen sich als konsistente und wirk-
mächtige Korrelate klimawandelbezogener Sorgen.Autoren:
Dr. Luigi Droste ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziologie der Universität
Münster. Arbeitsschwerpunkte: Wirtschaftssoziologie, Politische Soziologie, Methoden der empiri-
schen Sozialforschung.
Dr. Björn Wendt ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Soziologie der Universität
Münster. Arbeitsschwerpunkte: Soziologie der Nachhaltigkeit und Umweltsoziologie, Wissenssozio-
logie und Utopieforschung, Politische Soziologie, Elitensoziologie und Bewegungsforschung.
Soziologie und Nachhaltigkeit
Beiträge zur sozial-ökologischen Transformationsforschung
ISSN 2364-1282
Heft 1/2021, 7. Jahrgang
Eingereicht 28.08.2020 – Peer-Review 28.10.2020 – Überarbeitet 01.12.2020 – Akzeptiert 21.12.2021
Lizenz CC-BY 4.0 (www.creativecommons.org/licenses/by/4.0)
Herausgeber*innen: Benjamin Görgen, Matthias Grundmann, Anna Henkel, Melanie Jaeger-Erben,
Björn Wendt
Redaktion: Niklas Haarbusch, Jessica Hoffmann
Layout/Satz: Frank Osterloh/Niklas Haarbusch
Anschrift: WWU Münster, Institut für Soziologie
Scharnhorststraße 121, 48151 Münster
Telefon: (0251) 83-25303
E-Mail: sun.redaktion@wwu.de
Website: www.ejournals.wwu.de/index.php/sunLuigi Droste / Björn Wendt – Who Cares
Einleitung wandel ein eklatanter Mangel an empirischer
Forschung im deutschsprachigen Raum attes-
Der Klimawandel wird in vielen Ländern der
tiert werden. Überraschend ist dieses Desiderat
Welt als eine der größten globalen Bedrohungen
insofern, als dass die Umweltsoziologie seit
wahrgenommen (Poushter/Huang 2019, Fagan/
SuN 01/2021
ihrer Entstehung breit in die Untersuchung des
Huang 2019) und ist in den letzten Jahren zu
„Umwelt- und Naturbewusstseins“ bzw. umwelt-
einem kontrovers diskutierten politischen Thema
bezogener Einstellungsmuster der Bevölkerung
avanciert. Auf der einen Seite artikulieren Pro-
involviert war (prägend u. a. Van Liere/Dunlap
testbewegungen wie Fridays for Future oder
1980, 1981 sowie für Deutschland: Dierkes/
Extinction Rebellion sowie eine Reihe von Vertre-
Fietkau 1988, Poferl et al. 1997, Diekmann/
ter*innen der Wissenschaft öffentlich ausgeprägte
Preisendörfer 1998, überblickend siehe auch
Zukunftsängste und plädieren in der Folge für ein
Neugebauer 2004, Wendt/Görgen 2017). Die em-
vor-sorgend antizipierendes Handeln gegenüber
pirische Umweltbewusstseinsforschung hat sich
den mithin als apokalyptisch inszenierten Risiken
in diesem Rahmen zwar relativ früh mit der Ver-
des Klimawandels (Schellnhuber 2015, extinction
teilung und sozialen Basis von umweltbezogenen
rebellion 2019, Neubauer/Reppening 2019, Thun-
Sorgen und Ängsten beschäftigt. Allerdings ist
berg 2019, Wallace-Wells 2019). Auf der anderen
dies zum einen vor allem mit Blick auf allgemeine
Seite hat sich – sei es innerhalb von Initiativen wie
Umweltprobleme geschehen, während das Klima-
Fridays for Hubraum, in liberalen, neokonserva-
bewusstsein im Speziellen lange Zeit relativ wenig
tiven und rechtspopulistischen Milieus oder der
Beachtung gefunden hat.1 Zum anderen wurden
Klimawandelleugnungsszene – eine Gegenbewe-
Sorgen und Ängste stets als (affektive) Elemente
gung formiert, die sich über die „Klimahysterie“
des Umweltbewusstseinskonstrukts konzipiert,
der Klimaaktivist*innen und Klimawissenschaft-
sodass diese lediglich als Bestandteil in entspre-
ler*innen empört und diesen vorwirft, den Weg
chende Indizes integriert und damit im Detail nur
in einen neuen „Totalitarismus der Besorgten“
ansatzweise adressiert wurden.
(Broder 2019: 59, Hervorhebung L.D/B.W.) zu
bahnen. Diese Polarisierung der Debatte macht Obgleich klimawandelbezogene Sorgen aktuell
nicht nur deutlich, wie unterschiedlich der Kli- eine zentrale Rolle im gesellschaftspolitischen
mawandel in der Gesellschaft wahrgenommen
und bewertet wird, sondern verweist auch darauf,
dass Ängsten und Sorgen sowie Gefühlslagen per 1 Dieses Desiderat drückt sich im deutschsprachigen
Raum z. B. auch darin aus, dass die Thematik selbst in
se eine zentrale Rolle im Klimadiskurs zukommt.
klimawandel- und umweltbewusstseinsbezogenen Auf-
sätzen des Handbuchs Umweltsoziologie (Viehhöver
Nachdem Constanze Lever-Tracy noch im Jahr 2011, Reusswig 2011, Lange 2011) sowie in Sammel-
2008 prominent kritisieren konnte, dass der bänden zur sozialwissenschaftlichen Klimaforschung
(z. B. Voss 2010, Besio/Romano 2016) bisher kaum
Klimawandel in der Soziologie kaum zum For- diskutiert wurde. Wenngleich klimarelevante Einstel-
schungsgegenstand gemacht würde (Lever-Tracy lungen in den zyklischen Erhebungen des Umwelt-
bundesamtes in neueren Untersuchungen als weit
2008), hat sich inzwischen ein äußerst dynami- verbreitet, allerdings auch milieugebunden, ausge-
scher soziologischer Diskurs zu klimabezogenen wiesen werden (Rubik et. al 2019: 16 ff.), so wurden
verschiedene Aspekte des Klimabewusstseins lange
Fragestellungen entwickelt (überblickend u. a. Zeit nicht abgefragt und erst ab dem 21. Jahrhundert
Lorenz 2013, Dunlap/Brulle 2015, Sommer 2016, verstärkt aufgenommen (Kuckartz 2000; Kuckartz/
Grunenberg 2002: 47 f.; für eine Übersicht: Bauske/
Reusswig/Engels 2018, Koehrsen et al. 2020). Kaiser 2019: 58 ff.). Auch der Begriff des Klimabe-
Überraschenderweise kann jedoch mit Blick auf wusstseins selbst wird erst etwa Mitte der 2000er Jahre
in einschlägigen Publikationen verwendet (Kuckartz et
die Sorgen in der Bevölkerung über den Klima- al. 2007, Weber 2008, Kuckartz 2010).
3Soziologie und Nachhaltigkeit – Beiträge zur sozial-ökologischen Transformationsforschung
Diskurs spielen, und Untersuchungen zudem schiede in den klimawandelbezogenen Sorgen der
gezeigt haben, dass diesen eine Bedeutung für Bürger*innen erklären?
klimabewusste Handlungsbereitschaft zukommt
In einem ersten Schritt werden wir im Folgenden
(Dietz et al. 2007, Smith/Leiserowitz 2014), liegen
SuN 01/2021
kurz einige Überlegungen zum Begriff der
hierzu bislang lediglich vereinzelte und in der
Sorge und ihrer soziologischen Thematisierung
Regel beschreibende Befunde für einzelne Länder
skizzieren und in den Forschungsstand zum
vor (für Deutschland etwa Hüther et al. 2012). Dies
Klimabewusstsein und klimabezogenen Sorgen
gilt auch für die meisten ländervergleichenden
in der Bevölkerung einführen (Abschnitt 1). Aus
Analysen zur Wahrnehmung und Bewertung des
diesem Literaturüberblick werden wir in einem
Klimawandels (siehe etwa Fagan/Huan 2019).
nächsten Schritt untersuchungsleitende Hypo-
Ländervergleichende Untersuchungen, die kli-
thesen ableiten und die Datengrundlage sowie
mabedingte Besorgnis entlang verschiedener
Methode der Untersuchung vorstellen (Abschnitt
sozialer Dimensionen mit statistischen Verfahren
2). Auf Basis von Umfragedaten der achten
untersuchen, sind bis heute eine Seltenheit in der
Welle des European Social Survey (ESS) für 23
soziologischen Klimaforschung (für eine Aus-
europäische Länder aus den Jahren 2016/2017
nahme siehe aber Poortinga et al. 2019). Damit
präsentieren wir anschließend die zentralen Er-
fehlt es bislang an wichtigem Grundlagenwissen,
gebnisse eines Mehrebenenmodells, das sowohl
inwiefern die Befunde der Umweltbewusstseins-
individuelle als auch strukturelle Faktoren zur
forschung auch auf die klimabedingten Sorgen
Erklärung der Varianz der Klimasorgen berück-
der Bevölkerung bezogen werden können und
sichtigt (Abschnitt 3). Abschließend diskutieren
inwiefern sich diese Befunde seit den 1990er
wir die Befunde vor dem Hintergrund der Leit-
Jahren, in denen sich die Forschungsdisziplin vor
fragen unserer Untersuchung (Abschnitt 4).
allem mit diesen Fragen beschäftigt hat, in der
jüngeren Vergangenheit verschoben haben.2
Vor diesem Hintergrund nehmen wir in unserem 1. Klimasorgen: Zeitdiagnostische
Beitrag eine vergleichende Untersuchung der Annäherungen und der
Besorgnis über den Klimawandel in Europa vor: Forschungsstand der Klima-
Welches Ausmaß hat die Besorgnis über die bewusstseinsforschung
Folgen des Klimawandels bei den Bürger*innen in
Europa und inwiefern lassen sich hierbei Unter-
Zeitdiagnose: Die besorgte Gesellschaft
schiede zwischen bestimmten sozialen Gruppen
sowie Ländern feststellen? Wie lassen sich Unter- Menschen machen sich über vieles Sorgen.
Glaubt man soziologischen Zeitdiagnosen, so
sind Sorgen und Ängste gar zum bestimmenden
2 Eine Erklärung für den Rückgang an der diesbezügli- Gefühl unserer Zeit geworden (Beck 2008a, Bude
chen Forschung kann vor allem darin gesehen werden,
2014, Baumann 2016). Vor dem Hintergrund
dass der erwünschte und in den Ausgangsmodellen
postulierte Übersetzungsprozess eines zunehmenden einer „gesellschaftlichen Gesamtsituation, die von
Umweltbewusstseins in umweltverträgliches Ver-
Krisen, Populismus, Unsicherheit und Radikali-
halten nur sehr begrenzt stattgefunden hat. Insbeson-
dere mittels praxistheoretischer Annahmen wurden sierung geprägt zu sein scheint“ wird inzwischen
der methodologische Individualismus und der ratio- sogar vorgeschlagen „Sorge als Schlüsselbegriff
nal-choice-basierte Ansatz der Umweltbewusstseins-
und Verhaltensforschung sowie anderer klima- und der modernen Gesellschaft“ (Henkel et al. 2019:
nachhaltigkeitsbezogener Transformationszugänge
seither wiederholt kritisiert (z. B. Shove 2010, Görgen
2020).
4Luigi Droste / Björn Wendt – Who Cares
7) zu betrachten.3 Besonders prominent diagnos- Zukunft, mit allen Vorzeichen der Unsicherheit
tizierte Ulrich Beck bereits in den 1980er Jahren versehene Antizipation, die auf eine Änderung des
den Wandel der Ersten Moderne hin zur Zweiten gegenwärtigen Handelns zielt“ (Beck 2017: 160).
Moderne und beschrieb diese als eine globale
Wenn in der „Weltrisikogesellschaft“ der „Rest
SuN 01/2021
„Risikogesellschaft“ (Beck 1986), in der vor allem
risikoempfänger“ letztlich das Individuum ist,
technische und ökonomische Nebenfolgen des
auf das von Märkten und Politik die „ultimative
Modernisierungsprozesses neue ökologische und
Verantwortung des Entscheidens“ übertragen
soziale Risikolagen, Selbstgefährdungen, Unsi-
wird (Beck 2008a: 347), so geht mit einer solchen
cherheiten, Ungleichheiten, Machtverhältnisse
Vergesellschaftungsform auch ein subjektives
und Nebenfolgen-Katastrophen produzieren.
Erleben einher, bei dem Sorge und Angst vor sich
Neben Reaktorkatastrophen und Finanzkrisen, realisierenden Risiken zu einem bestimmenden
zählt zu letzteren auch der durch menschliches Lebensgefühl und handlungsleitenden Moment
Verhalten ausgelöste Klimawandel, der sogar als werden. Auch die Sorge ist demnach „gegen-
„womöglich ‚das‘ Weltrisiko der Epoche“ (Beck wärtig als eine mögliche Zukunft. Sorge wirkt
2010: 43, siehe auch Beck 2008a: 153 ff., Beck also gegenwärtig durch die Voraussicht, durch
2008b, Beck 2017) betitelt wird. Der Klima- die Vergegenwärtigung dessen, was nicht ist,
wandel, so könnte man mit Beck argumentieren, aber doch werden könnte“ (Henkel et al. 2016:
zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass er in eine 21). In diesem schwerpunktmäßig problem-kon-
„Zukunftskrise“ eingebettet ist, „deren Schau- notierten Sinne wollen wir Sorge bzw. Besorgnis
platz und politischer Auseinandersetzungsort als eine vorausschauend-emotionalisierte Bewer-
die Gegenwart ist“ (Beck 1995: 94). Wie andere tungspraxis verstehen, die antizipiert, was sich
Risiken der Zweiten Moderne, die die Zukunft in negativer Weise zukünftig ereignen könnte.4
in der Gegenwart wissens-, d.h. erfahrungs- und Kennzeichnend für das in vielen Zeitdiagnosen
erwartungsbezogen, politisieren, so kann auch be- attestierte Lebensgefühl der Angst und Besorgnis
züglich des Klimawandels diagnostiziert werden, sind dabei nicht allein selbst-bezogene Sorgen,
dass dieser zugleich „wirklich und unwirklich sondern gerade auch die Sorge „um den Anderen
ist. Einerseits sind viele Gefährdungen und Zer- und die Sorge um die Umwelt“ (Henkel et al.
störungen bereits real [...]. Auf der anderen Seite 2016: 21). Die Sorgen der Weltrisikogesellschaft
liegt die eigentlich soziale Wucht des Verelen- reichen demnach weit über das Individuum
dungsargumentes in projizierten Gefährdungen und seine potenzielle individuelle Betroffenheit
der Zukunft“ (Beck 1995: 94). Gerade in der hinaus. Ihnen wohnt in der Regel eine soziale
Antizipation dystopischer Zukunftsrisiken des Dimension inne, die besonders prominent etwa
Klimawandels und seiner Risikowahrnehmung in der vielfach im Nachhaltigkeitsdiskurs zitierte
liegt demnach das eigentliche Mobilisierungsmo- Besorgnis zum Ausdruck kommt, dass „künftige
ment der Weltrisikogesellschaft (Wendt 2020, Generationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht be-
2021). Da der „Risikobegriff“ in erster Linie „ein friedigen können“ (Weltkommission für Umwelt
Möglichkeitsbegriff“ (Beck 2000: 196) ist, so
sind auch die Klimarisiken in erster Linie „eine
4 Das Bedeutungsspektrum des Sorgebegriffs ist unge-
drohende Wirklichkeit, eine vergegenwärtigte mein groß. Im englischen Sprachraum drückt sich diese
Varianz unter anderem in der Unterscheidung zwischen
dem „Care“-Begriff, im Sinne des Sorgens für jemanden
oder etwas, und „worries“ oder „concern“ aus, als sich
3 Für überblickende und kritische Diskussionen zu dieser
um etwas oder jemanden Sorgen aus, wenngleich allen
Zeitdiagnose siehe Lübke/Delhey (2019) sowie Eckert
Begriffen diese vielschichtige normative Bestimmung
(2019).
innewohnt (Thelen 2014: 23).
5Soziologie und Nachhaltigkeit – Beiträge zur sozial-ökologischen Transformationsforschung
und Entwicklung 1987: 51), wenn weiterhin, so bezüglich der Einstellungen und allgemeinen
gewirtschaftet, verteilt und gelebt wird, wie wir es Risikowahrnehmung zum Klimawandel und
gewohnt waren und sind. zum Klimabewusstsein liegt mittlerweile eine
große Anzahl von Studien vor (siehe für Deutsch-
SuN 01/2021
In der Tat wird gesellschaftsbezogenen Sorgen auf
land etwa: Engels et. al 2013, Andor et al. 2014,
Basis von Bevölkerungsumfragen regelmäßig eine
überblickend: Capstick et al. 2015, Hornsey et al.
große Verbreitung attestiert. Dies gilt sowohl für
2016). Wie diese Untersuchungen zeigen, sind es
weltweite Befragungen (Poushter/Huang 2019,
gerade solche Risikowahrnehmungen und Ein-
Atkinson et al. 2020) als auch für Befragungen
stellungen zur Umwelt- und Klimakrise, die in
der deutschen Bevölkerung (R+V 2019, Lübke
hohem Maße politisches Engagement für den Kli-
2019). Obgleich zahlreiche Erscheinungen wie
maschutz, Akzeptanz staatlicher Klimapolitiken
etwa Armut und Ungleichheit, Arbeitslosigkeit,
und persönliche Handlungsbereitschaft in Fragen
Terrorismus, Gesundheitsfragen, Migration und
des Klimawandels beeinflussen (etwa Bord et al.
Friedenserhalt zu den größten Sorgen der Men-
2000, Engels et al. 2013).
schen zählen, so nehmen auch die Sorgen über den
Klimawandel einen zentralen Platz im Sorgenpool Bisher vorliegende Analysen von Einstellungen
der Menschen ein (Poushter/Huang 2019, Pous- zum Klimawandel haben sich in erster Linie
hter/Manevich 2019). Dass klimabedingte Sorgen auf der Individualebene damit befasst, wie der
im 21. Jahrhundert bei Menschen auf der ganzen Klimawandel wahrgenommen und bewertet
Welt weit verbreitet sind, ist weithin unumstrit- wird. Dabei scheint sich ein konsistentes Bild
ten.5 Obgleich sich die empirische Forschung mit für die Einstellungen unterschiedlicher sozialer
der Verbreitung und sozialen Strukturierung un- Gruppen zu ergeben. Generell zeigt sich, dass
terschiedlicher Sorgen und Ängste beschäftigt hat Männer, ältere Geburtskohorten und Personen
(Rackow et al. 2012, Dehne 2017, Lübke/Delhey mit niedrigem Bildungsgrad dem Klimawandel
2019), so sind die Sorgen über den Klimawandel eher skeptisch gegenüberstehen (Poortinga
bislang empirisch nur unzureichend erforscht. et al. 2011, McCright et al. 2016, Milfont et al.
2015). Für die USA wurde dementsprechend ein
Die sozial-temporale Strukturiertheit des white male effect bzw. ein conservative male
Klimabewusstseins effect postuliert, wonach gerade weiße Männer
mit konservativer politischer Orientierung im
Vielfach erforscht sind hingegen die Einstel-
Vergleich durch ein höheres Maß an Skepsis ge-
lungen der Bevölkerung zu Umweltfragen
genüber dem Klimawandel sowie einer weniger
sowie der Zusammenhang zwischen Umwelt-
ausgeprägten Sensibilität bezüglich ökologischer
bewusstsein und Umweltverhalten (Van Liere/
Dunlap 1980, Franzen/Meyer 2010, Kollmuss/
Agyeman 2002, Franzen/Vogl 2013).6 Und auch delliert: (1) dem Wissen über Umweltprobleme und
mögliche Umgänge mit ihnen (kognitive Dimension),
(2) der emotionalen Affiziertheit (affektive Dimension)
sowie (3) der Bereitschaft und dem Wille sein Handeln
5 Studien vom Pew Research Center kommen wiederholt in Anbetracht dieser Umweltprobleme zu verändern
sogar zu dem Ergebnis, dass der Klimawandel global als (konative Dimension), wobei die Umwelteinstellung
größte Bedrohung für das eigene Land wahrgenommen wiederum als Summe der zweiten und dritten Dimen-
wird (Kohut et al. 2013, Poushter/Huang 2019) und sion (Huber 2011, S. 81) oder als Teil der affektiven
weltweit von 67 Prozent der Befragten als große Bedro- Dimension des Umwelt- bzw. Klimabewusstseins kon-
hung eingeschätzt wird (in Deutschland lag der Wert zipiert wird (Weber 2008, S. 115 ff.). In den gängigen
bei 71 Prozent). Operationalisierungen wird die affektive Dimension
in Deutschland häufig mittels durch Umweltprobleme
6 Das Umwelt- bzw. Klimabewusstsein wird dabei in ausgelöste Beunruhigung, Wut oder Empörung opera-
der Regel als Konstrukt mit drei Komponenten mo- tionalisiert (Diekmann/Preisendörfer 2001: 104).
6Luigi Droste / Björn Wendt – Who Cares
und technologischer Risiken gekennzeichnet Eine ganze Reihe von Studien konnte auch zeigen,
sind (McCright 2011, McCright/Dunlap 2011b). dass Einstellungen zum Klimawandel besonders
Damit verbunden konnte zudem gezeigt werden, stark mit politischen und wertbezogenen Ori-
dass auch der Wohnort einen Effekt auf skepti- entierungen zusammenhängen. Gerade in den
SuN 01/2021
sche Haltungen zum Klimawandel hat. Während USA bilden sich Einstellungen zum Klimawandel
diese im ländlichen Raum weiter verbreitet entlang parteipolitischer Grenzziehungen ab
sind, ist Klimawandelskepsis in Städten seltener (McCright/Dunlap 2011a, Brulle et al. 2012,
(Marquart-Pyatt 2008, Whitmarsh 2011). Zudem McCright et al. 2014): Während Konservative
wurde teilweise auch deutlich, dass das Vertrauen (Republikaner) dem Klimawandel eher skeptisch
in die Problemlösungskompetenz von politischen gegenüberstehen, erkennen Liberale (Demo-
Institutionen mit positiven Haltungen zu Um- kraten) ihn in der Regel an und fordern teilweise
weltpolitiken einhergeht (Lorenzoni/Pidgeon seine Bekämpfung ein. Auch für EU-Länder lässt
2006, Konisky et al. 2008). sich eine ähnliche ökologische Konfliktlinie in der
Politik vermuten (Poortinga et al. 2011, Milfont
Sowohl ländervergleichende Untersuchungen
et al. 2015, McCright et al. 2016). Die Rolle be-
zum Klimabewusstsein als auch Analysen für ein-
stimmter Wertorientierungen für die Haltung
zelne Länder haben regelmäßig auf Alterseffekte
gegenüber sozialen Fragen bzw. politischen Sach-
oder Kohorteneffekte verwiesen (McCright 2010,
fragen ist empirisch gut belegt (Inglehart 1990).
Milfont et al. 2015, Poortinga et al. 2011). Auch für
Auch für Einstellungen zum Klimawandel scheint
den Bildungsgrad ergeben sich in vorliegenden
der Unterschied zwischen individualistischen und
Untersuchungen einheitliche Befunde. Personen
kollektivistischen sowie materialistischen und
mit einem höheren formalen Bildungsgrad oder
postmaterialistischen Wertorientierungen beson-
einer größeren Anzahl an Bildungsjahren zeichnen
ders bedeutsam (Dietz et al. 2007, Milfont et al.
sich nicht allein durch ein ausgeprägteres Um-
2015, Shi et al. 2016, Poortinga et al. 2019).
weltbewusstsein aus (z. B. Marquart-Pyatt 2008,
Franzen/Vogl 2013, Lee et al. 2015), sondern Insbesondere in Folge eines sinkenden Klima-Pro-
akzeptieren auch in höherem Maß den Klima- blembewusstseins seit Mitte der 2000er Jahre
wandel als reale Tatsache und sind sich häufiger wurde ferner vor allem für die USA vermehrt
der mit dem Klimawandel verbundenen Risiken nach strukturellen Erklärungen hierfür gesucht.
bewusst. In diesem Zusammenhang wird oftmals Scruggs und Benegal (2012) thematisierten als
angenommen, dass formale Bildung mit einem Erklärungsfaktoren die Medienberichterstattung,
besseren Wissen und Verständnis in Bezug auf Temperaturanomalien und die wirtschlichen
Klimaphänomene einhergeht. Wie gezeigt werden Entwicklungen in Folge der Finanz- und Wirt-
konnte, stellt Bildung jedoch einen eigenständigen schaftskrise der Jahre 2007/2008. Sie kamen
Faktor dar, der weitestgehend unabhängig von zu dem Ergebnis, dass eine schlechte Wirt-
Klimawissen und -verständnis ist. Beim Wissen schaftslage und steigende Arbeitslosigkeit
über den Klimawandel handelt es sich um einen einen negativen Einfluss auf die Akzeptanz des
lediglich schwachen Prädiktor von Einstellungen Klimawandels haben, globale Temperaturano-
zum Klimawandel (Whitmarsch 2011) und Klima- malien jedoch einen positiven Einfluss.7 Dies
wandelskeptiker*innen verfügen mitunter sogar
über besseres Wissen in Klimafragen als Befragte,
die sich nicht skeptisch äußern (Hornsey et al. 7 Auch Kahn und Kotchen (2011) kommen in ihrer Ana-
lyse von Suchanfragen bei Google in den USA zu dem
2016).
Ergebnis, dass erhöhte Arbeitslosenraten die Sucher-
gebnisse nach „global warming“ absenken.
7Soziologie und Nachhaltigkeit – Beiträge zur sozial-ökologischen Transformationsforschung
kann unter anderem damit erklärt werden, dass Basis von Daten des International Social Survey
klimabezogene Risiken mit anderen Problemen Programme (ISSP), dass sich in Westeuropa eine
konkurrieren und nur ein begrenzter „Pool“ an re- vergleichbare Spaltungslinie zwischen rechten
levanten Gefahren von den Individuen verarbeitet und linken ideologischen Lagern in Bezug auf
SuN 01/2021
werden kann (Whitmarsh 2011). die Meinung zu Klimafragen finden lässt, wie in
den USA, wenngleich dieser nicht ganz so stark
Brulle et al. (2012) unterscheiden in ihren Un-
ausgeprägt ist und dieser Befund nicht für die
tersuchungen ferner fünf Einflussfaktoren, die in
postkommunistischen Staaten gilt. Auch Kvaløy
der Literatur diskutiert werden: 1. Inwiefern der
et al. (2012) bestätigen mit Daten des World
Öffentlichkeit akkurate Informationen zugänglich
Value Survey (WVS), dass die Wahrnehmung
sind, 2. Extremwetterereignisse, 3. die Medienbe-
des Klimawandels als ernsthaftes Problem auch
richterstattung, 4. die Präsenz und Anwaltschaft
ländervergleichend mit einem hohen Bildungsab-
von Klima-Bewegungen und Gegenbewegungen
schluss, postmaterialistischer Wertorientierung
und 5. Hinweise auf den Klimawandel durch Eliten
sowie einer linken politischen Selbstverortung
(siehe auch: Carmichael/Brulle 2017, Carmichael
korreliert und auch religiösen Orientierungen eine
et al. 2017). Sie zeigen, dass Extremwetterereig-
Bedeutung für diese Einschätzungen zukommt.9
nisse keinen Einfluss auf die Klimawahrnehmung
in der Bevölkerung haben, sondern vor allem Auf struktureller Ebene sprechen bisherige
Bewegungen und Eliten, die das Thema öffent- Befunde entgegen einer Wohlstandshypothese
lich vertreten sowie die Medienberichterstattung bislang weder für signifikante Zusammenhänge
und wirtschaftlichen Bedingungen. Bergquist mit dem BIP, noch für einen Zusammenhang
und Warshaw (2019: 686) kommen auf der zwischen Klimawahrnehmung und CO2-Emis-
Grundlage eines Indizes, der 170 Umfragen mit sionen (siehe Mostafa 2016). Klimabewusstsein
über 400.000 Befragten umfasst, in Bezug auf ist demnach ein weltweites Phänomen, das nicht
den Zusammenhang von Klimawahrnehmung auf wohlhabende Länder begrenzt ist. Sandvik
und Temperaturentwicklung hingegen zu einem (2008) kommt mit Bezug auf die Analyse von
gegensätzlichen Befund: Auf nationaler Ebene Daten aus 46 Ländern in seiner Analyse sogar zu
spiegeln sich Temperaturentwicklungen in der dem entgegengesetzten Ergebnis. Sowohl das BIP
öffentlichen Meinung. als auch die CO2-Emmionen eines Landes korre-
lieren seinen Analysen zufolge sehr wohl mit dem
Es liegen demnach einerseits mittelweile eine
Anteil der Bevölkerung, der den Klimawandel als
Vielzahl von Befunden für einzelne Länder
ein ernsthaftes Problem bewertet, allerdings ist
(v.a. für Großbritannien und die USA8) vor, die
dieser Zusammenhang negativ.10 Die Befunde von
Einstellungen, Risikowahrnehmungen und das
Wissen zum Klimawandel auch im Zeitverlauf
untersucht haben. Zugleich geben inzwischen 9 Ähnlich auch Mostafa (2016), der neben diesen Effekten
auch noch die Kontrollüberzeugung von Personen
einige Studien auch einen Einblick in weitere län-
als einen weiteren Faktor herausarbeitet. Lewis et al.
dervergleichende Determinanten der allgemeinen (2019: 768) kommen in Bezug auf die „westliche“ Welt
zu dem Ergebnis, dass sich Frauen, jüngere und we-
Klimawahrnehmung (überblickend: Capstick et
niger religiöse Menschen in den englisch-sprechenden
al. 2015). McCright et al. (2015) bestätigen auf der Ländern der westlichen Welt mehr Sorgen über den
Klimawandel machen, während die Klimasorgen in der
restlichen Welt nur schwach mit dem Geschlecht korre-
lieren, aber mit dem Alter, der Religiosität, Bildung und
8 Für die USA siehe insbesondere auch: https://www. demokratischen Werten zunehmen.
climatechangecommunication.org/climate-chan-
10 Tranter und Booth (2015) kommen in einer länderver-
ge-in-the-american-mind-reports/
gleichenden Untersuchung zum Klimaskeptizismus
8Luigi Droste / Björn Wendt – Who Cares
Lo und Chow (2015) wiederum verweisen in Bezug Umweltbewusstseins sind (siehe Franzen/Meyer
auf den Zusammenhang zwischen nationalem 2010; Franzen/Vogl 2013) und zweitens Gefühls-
Wohlstand und Klimawahrnehmung darauf, lagen in einer spätmodernen „Affektgesellschaft“
dass in reicheren Ländern der Klimawandel als (Reckwitz 2017) als eine bedeutsame Ressource
SuN 01/2021
wichtigstes Problem, jedoch weniger als ernstzu- für klimabewusste Handlungsbereitschaft sowie
nehmende Gefahr bewertet wird. Auch Fielding klimapolitische Mobilisierung gesehen werden
et al. (2019) bestätigen dieses Ergebnis und ver- können (Dietz et al. 2007, Smith/Leiserowitz
binden in ihrer Analyse von elf OECD-Staaten 2014). So zeigen z. B. auch Untersuchungen zu
individuelle Charakteristiken ihrer Befragten, mit Fridays for Future-Protesten in Städten auf der
Haushalts- und Ländermerkmalen. Ihre Ergeb- ganzen Welt, dass Sorge über den Klimawandel
nisse zeigen, dass bei zusätzlicher Betrachtung (gefolgt von Furcht und Angst) das verbreitetste
des Gefühls der Kontrolle, die Gefahreneinschät- Gefühl unter den Protestierenden war und weitaus
zung nicht mehr mit dem nationalen Wohlstand häufiger geteilt wird als Empörung, Frustration
korreliert und schließen daraus, dass Wohlstand oder Hilflosigkeit (de Moor et al. 2020).
vor allem als eine Ressource angesehen werden
Besorgnis scheint also einerseits eine zentrale
kann, mit der auf die imaginierten Risiken des
mentale und affektuelle Auswirkung des Klima-
Klimawandels reagiert werden kann und die
wandels zu sein und beeinflusst auf der anderen
dadurch ein Kontrollgefühl erzeugt.
Seite den Anpassungsprozess an diesen (Swim et
al. 2011: 111). Untersuchungen, die, ausgehend
Klimasorgen: Forschungsstand und
vom Vorwurf von Klimaskeptiker*innen, dass Kli-
Desiderate
maaktivist*innen eine Klimahysterie betreiben,
Zwar gibt es demnach ländervergleichende Verbindungen zwischen Klimabesorgnis und
Analysen, die Klimawandelskepsis, Risiko- und pathologischer Besorgnis untersucht haben, sind
Problemwahrnehmung sowie Handlungsbereit- zum Ergebnis gekommen, dass zwischen diesen
schaft in ländervergleichenden Analysedesigns beiden Formen der Sorge kein signifikanter
adressieren (McCright et al. 2016, Tranter/Booth Zusammenhang besteht. „[H]abitual ecological
2015) und Studien, die deskriptiv untersuchen, worrying“ ist vielmehr mit umweltschonenden
als wie gefährlich der Klimawandel im Vergleich Verhaltensweisen sowie Persönlichkeitsstruk-
zu anderen Problemen in unterschiedlichen turen verbunden, die sich durch die Anerkennung
Ländern eingeschätzt wird (European Com- neuer Ideen und ein hohes Umweltbewusstsein
mission 2009, The World Bank 2009, Brechin/ auszeichnen (Verplanken/Roy 2013). Kli-
Bhandar 2011, Kohut et al. 2013, Carle 2015). masorgen stellen aus dieser Perspektive also nicht
Gefühlslagen in Bezug auf den Klimawandel (wie nur keine Pathologie und kein Hemmnis für
Sorgen) wurden im Unterschied zu den oben skiz- einen Wandel zur Nachhaltigkeit dar, sondern
zierten Einstellungen und Risikoeinschätzungen scheinen geradezu Bedingung und Ressource für
zum Klimawandel jedoch vergleichsweise wenig eine sozial-ökologische Transformation zu sein.
in den Blick genommen (Ojala 2012). Dies er- In einer Studie über die Handlungsbereitschaft
scheint überraschend, da Sorgen erstens ein fester CO2-Emissionen zu reduzieren zeigt sich, dass
Bestandteil des Konstrukts eines allgemeinen diese mit einer zunehmenden Besorgnis über die
Konsequenzen des Klimawandels zunimmt und
im Unterschied zu kognitiven Risikoeinschät-
zu dem Ergebnis, dass ein höherer CO2-Ausstoß und zungen gerade Sorgen und Ängste zum Handeln
auch die Klima-Vulnerabilität eines Landes positiv mit
diesem korrelieren. führen (Sundblad et al. 2014). Auf der einen
9Soziologie und Nachhaltigkeit – Beiträge zur sozial-ökologischen Transformationsforschung
Seite scheint Besorgnis damit transformations- concern“ auf, das ebenfalls diese Unterschiede
fördernd (siehe auch Shi et al. 2016, Stevenson/ stark macht:
Peterson 2016, Nauges/Wheeler 2017), auf der
„In short, an individual may think that climate
anderen Seite ist aus der Forschung zum Kli-
SuN 01/2021
change (and associated impacts) are likely to occur,
maskeptizismus bekannt, dass sich keine Sorgen but that doesn’t mean that someone also perceives
über den Klimawandel zu machen, ein fester climate change to be a serious issue. In turn, an in-
Bestand des „denial belief“ (McCright/Dunlap dividual can perceive climate change to be a serious
issue, but that doesn’t necessarily imply that they are
2011b) ist und die Emotionalität und Besorgnis
concerned about it. Finally, although the public may
von Klimawissenschaft und Klimabewegung express generalized concern about climate change,
von Klimawandelskeptiker*innen als Hysterie this often does not mean that people also personally
und Irrationalität delegitimiert wird (siehe auch worry about the issue or think it is a high priority”
(van der Leyden 2017: 24).
Wendt 2021). Kurzum: Klimabesorgnis stellt eine
zentrale Konfliktlinie dar, die den Klimadiskurs Wir wollen bei unserer folgenden Thematisierung
zwischen den Klimaskeptiker*innen und Klima- des Forschungsstandes zur Klimabesorgnis daher
bewegten scheidet. einen engen, trennscharfen Begriff anlegen, der
vor allem hinsichtlich seiner Operationalisierung
Zur Differenzierung unterschiedlicher Kompo-
in den Umfragen kontrolliert wurde; d. h., wir
nenten der Wahrnehmung des Klimawandels
beziehen uns nicht wie bisher auch auf Studien,
in der Bevölkerung unterscheiden Capstick et
die unter „climate concerns“ nahezu alle Katego-
al. (2015) in einer umfassenden Analyse des
rien der Klimawahrnehmung fassen, sondern auf
Forschungsfeldes neun Fragen-Foki, mit denen
Forschungen, die explizit die „Besorgnis“ oder
die Wahrnehmung des Klimawandels in der Be-
„Sorgen“ bzw. die „concerns“ oder „worries“ der
völkerung bisher untersucht wurde (Tabelle 1).
Bevölkerung zum Klimawandel abfragen und
Häufig wird in Untersuchungen nicht trennscharf
im Capstick’schen Schema daher der Kategorie 7
zwischen diesen Komponenten des Klimabe-
entsprechen. Wie verteilen sich die Klimasorgen
wusstseins der Bevölkerung unterschieden.
entlang eines solchen engen Begriffes in der Be-
Insbesondere Aussagen dazu, inwiefern der Klima-
völkerung und welche Faktoren beeinflussen sie?
wandel als eine Gefahr angesehen wird (Kategorie
4), wie ernst die Risiken eingeschätzt werden (Ka-
tegorie 5) und wie groß die Sorgen bezüglich des
Klimawandels sind (Kategorie 7), werden häufig
gemeinsam unter dem Label „climate concerns“
besprochen, wenngleich die Besorgnis nicht ex-
plizit abgefragt wird. Gleichwohl sind auch diese
Dimensionen nicht zwangsläufig in eins zu setzen,
denn der Klimawandel kann z. B. als bedrohlich
wahrgenommen werden, ohne dass man sich
deshalb Sorgen über seine Folgen machen muss
– etwa, wenn in die Problemlösungsfähigkeit der
Wissenschaft oder des politischen Personals ver-
traut wird.
Van der Leyden (2017) stellt im Hinblick auf die
zentralen Dimensionen der Wahrnehmung des
Klimawandels das Modell einer „hierarchy of
10Luigi Droste / Björn Wendt – Who Cares
Fokus Frageformulierung Antwortmöglichkeiten
1. awareness and un- • Have you heard or read anything about the issue • Yes/no/not sure
derstandings of climate of global warming? • Very well/fairly well/not very
change • Thinking about the issue of global warming, how well/not at all
well do you feel you understand this?
SuN 01/2021
2. existence of climate • As far as you know, do you personally think that • Yes/no/DK
change at present time the world’s climate is changing, or not?
3. causes of climate • Assuming global warming is happening, do you • Caused mostly by human activ-
change think it is…? ities/caused mostly by natural
changes in the environment
(also ‘none of the above’ and
‘other’)
4. perceived threats from • Please tell me how serious a problem you perso- • Very serious/somewhat serious/
climate change nally believe global warming to be in the world? not very serious/not serious at
all/DK
5. seriousness of climate • Which of the following do you consider to be the • Eight possible ‘problems’
change compared to other single most serious problem facing the world as presented, including climate
issues a whole? change, ‘the economic situa-
tion’, and ‘armed conflicts’
6. certainty of climate • Most scientists agree that humans are causing • 5-point scale from ‘strongly
science climate change agree’ to ‘strongly disagree’
7. personal concern or • [Do] you personally worry about global warming • A great deal/a fair amount/only
worry about climate ch- a great deal, a fair amount, only a little, or not at a little/not at all
ange all? • Very worried/somewhat wor-
• Are you very worried, somewhat worried, not ried/not very worried/not at all
very worried or not at all worried about global worried
warming? • Very concerned/fairly con-
• How concerned, if at all, are you about climate cerned/not very concerned/not
change, sometimes referred to as global war- at all concerned/DK
ming?
8. requirements for action • Do you think the United States should – or • USA should abide/USA should
on climate change (at nati- should not – agree to abide by the provisions of not abide
onal and personal level) the Kyoto agreement on global warming? • 5-point scale from ‘strongly
• I am prepared to greatly reduce my energy use agree’ to ‘strongly disagree’
to help tackle climate change
9. open-ended/sponta- • When you think of ‘global warming,’ what is the • Open-ended response
neous response permitted first word or phrase that comes to your mind?
Tabelle 1: Auswahl an Survey-Items für die öffentliche Meinung in Klimafragen nach Capstick et al. (2015: 41 f.)
Die Entwicklung der Klimabesorgnis in Europa, 9 f.) kamen in ihrer Untersuchung zum Klimabe-
den USA und der Welt wusstsein in Deutschland zu dem Ergebnis, dass
39 Prozent der Befragten der Aussage, dass sie
Wenngleich Meinungsumfragen ergeben, dass
sich über den Klimawandel Sorgen machen, voll
in Deutschland etwa 71 Prozent der Befragten
und ganz zustimmen, 20 Prozent eher zustimmen,
angeben, „die Veränderung des Weltklimas
26 Prozent die mittlere Kategorie wählen, und
mache ihnen persönlich besonders große Sorgen“
10 Prozent eher nicht und 5 Prozent überhaupt
(Der Westen 2017), stellen umfassendere Studien
nicht zustimmen.12 Der Klimawandel hatte dabei
zu klimabedingten Sorgen im deutschsprachigen
Raum eine Seltenheit dar.11 Hüther et al. (2012:
dels. Ein Anteil von 38 Prozent gab den mittleren Ska-
lenwert an, während 8 Prozent sich eher keine Sorgen
und 3 Prozent sich überhaupt keine Sorgen machten
11 Den Daten des SOEP zufolge schwankt der Anteil der (Statista 2020). In der jährlich in Deutschland durch-
Deutschen, der sich große Sorgen über die Klimafolgen geführten „Angst-Studie“ der R+V bekundeten im Jahr
macht, in den Jahren 2009-2016 stets zwischen etwa 2019 hingegen 41 Prozent der Befragten Angst vor den
25 und 30 Prozent (Lübke 2019: 58). Einer Umfrage Folgen des Klimawandels (R+V 2019, ähnlich auch
der Marktforschungsinstituts Marketagent zufolge Centrum für Strategische und Höhere Führung 2020).
machten sich 19 Prozent der in Deutschland lebenden
Menschen 2012 sehr große Sorgen und 34 Prozent eher 12 Eine Studie in Großbritannien kam zu dem Ergebnis,
große Sorgen über die Auswirkungen des Klimawan- dass die Sorgen bezüglich der globalen Erwärmung
11Soziologie und Nachhaltigkeit – Beiträge zur sozial-ökologischen Transformationsforschung
mit Blick auf das Verhältnis zu anderen Sorgen sehr/überhaupt nicht besorgt) in den beobach-
zusammen mit Terrorismus und Kriminalität die teten 12 EU-Ländern etwas zugenommen (1995:
höchste Priorität bei den Befragten, während sich 14 Prozent, 2002: 17 Prozent). Bemerkenswerter-
die Befragten über Ausländerfeindlichkeit, die weise ging der Anteil der Unentschlossenen im
SuN 01/2021
wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands, die Zeitverlauf immer weiter zurück von 5 Prozent
eigene Gesundheit, Zuwanderung und die eigene Ende der 1980er Jahre auf schließlich 1 Prozent
wirtschaftliche Situation deutlich weniger Sorgen im Jahr 2002. Seit 2002 wurde die Besorgnis
machten. über den Klimawandel in den Berichten an die
EU-Kommission nicht mehr auf die herkömm-
In Europa wurde zu Beginn der 1980er im Auftrag
liche Art und Weise abgefragt, sodass sich dieser
der Europäischen Kommission damit begonnen,
Trend nicht auf Basis der gleichen Messmethode
im Rahmen des Eurobarometers zu erheben,
bis in die Gegenwart verfolgen lässt.
wie besorgt die europäischen Bürger*innen über
umweltbezogene Probleme sowie explizit auch Während die Datenlage in der EU in Bezug auf
die Erderwärmung sind (siehe Abbildung 1). die Analyse längerer Zeitreihen somit äußerst
Nachdem Anfang der 1980er Jahre bereits etwa problematisch ist, existieren für die USA etab-
60 Prozent der Befragten angaben sehr oder lierte Erhebungsinstrumente, die seit Ende der
ziemlich besorgt zu sein, wuchs dieser Anteil 1980er Jahre abgefragt werden und die über etwa
1988 auf 70 Prozent und im Jahr 1992 auf sogar drei Jahrzehnte eine Polarisierung der Besorgnis
89 Prozent an (62 Prozent gaben sogar an sehr in der amerikanischen Bevölkerung aufzeigen
besorgt zu sein) (siehe hierzu z. B. Commission of (Abbildung 1). Wie auch in Europa bekundeten
the European Communities 1982). Entsprechend Ende der 1980er Jahre mehr als 60 Prozent der
ging der Anteil derjenigen, die nicht sehr oder Befragten über den Klimawandel besorgt zu
überhaupt nicht besorgt waren von etwa einem sein und auch der Anteil der Unentschlossenen
Viertel der Befragten (25 Prozent) im Jahr 1988 schrumpfte im Zeitverlauf stetig bis auf unter
bis 1992 auf etwa 9 Prozent zurück. Im Jahre 1995 ein Prozent. Insgesamt zeigen sich jedoch zwei
sank der Anteil der Besorgten allerdings erstmals markante Unterschiede. Erstens lag der Anteil
wieder und ging um etwa 5 Prozentpunkte zurück. derjenigen, die sehr oder ziemlich besorgt waren
Gleichzeitig schrumpfte in diesem Zeitraum der in den USA grundsätzlich stets unter dem jewei-
Anteil von Befragten, die sich ziemlich über den ligen europäischen Wert. Im Zeitverlauf hat dieser
Klimawandel besorgt zeigten auf 54 Prozent Abstand stetig zugenommen. Betrug der Abstand
(1995) und dann 39 Prozent (2002). Auch 2002 Ende der 1980er Jahre noch 7 Prozentpunkte,
lag der Anteil der Besorgten (sehr oder ziemlich so erhöhte er sich Anfang der 1990er auf 27 Pro-
besorgt) mit 83 Prozent etwas unter dem gemes- zentpunkte und Mitte der 1990er Jahre auf 34
senen Spitzenwert von 1992. Gleichzeitig hat seit Prozentpunkte. Auch im Jahre 2002 betrug der
1992 die Minderheit der Nicht-Besorgten (nicht Unterschied trotz Rückgangs immerhin noch 25
Prozentpunkte. Zweitens lag damit einhergehend
zwischen 2005 und 2019 durch starke Varianzen ge- der Anteil derjenigen, die sich nur wenig oder
kennzeichnet waren. Während zwischenzeitlich eine gar keine Sorgen machen in den USA seit Beginn
Annährung in Großbritannien zu beobachten war
(2011: 63 Prozent besorgt, 35 Prozent nicht besorgt) der 1990er Jahre deutlich höher als in Europa.
ist inzwischen eine ähnlich ausgeprägte Polarisierung Der Anteil derjenigen, der angab sich überhaupt
zwischen Besorgten (85 Prozent) und nicht Besorgten
(14 Prozent) zu beobachten, wie zu Beginn der Erhe- keine oder nur wenig Sorgen zu machen, wuchs
bungswelle (Dickmann/Skinner 2019). Angehörige der in den USA bis Mitte der 1990er Jahre stetig, bis
Mittelklasse äußerten dabei tendenziell eine größere
Besorgnis als die der Arbeiterklasse. auf nahezu 46 Prozent der Befragten an und ging
12Luigi Droste / Björn Wendt – Who Cares
2002 jedoch auf 40 Prozent zurück. Insgesamt ist betrachtet wird. Vor allem die Bevölkerungen der
vor diesem Hintergrund anders als in Europa, wo südeuropäischen Staaten (mit Ausnahme von
Klimabesorgnis eine weit verbreitete Gefühlslage Spanien) wiesen tendenziell die höchsten Be-
darstellt, für die USA eine Polarisierung in den sorgniswerte auf (z. B. Griechenland: 63 Prozent,
SuN 01/2021
Einstellungshorizonten der Befragten über die Italien: 49 Prozent und Portugal: 47 Prozent),
Zeit aus den Daten abzulesen. während die skandinavischen Länder (Schweden:
29 Prozent, Dänemark: 28 Prozent, Finnland:
Kommen wir noch einmal zurück zum europä-
26 Prozent), Großbritanniens (26 Prozent) und
ischen Kontext. Mit Blick auf die Verteilung der
Irland (25 Prozent) sowie Belgien (29 Prozent)
Sorgen auf unterschiedliche Länder waren bis
und die Niederlande (21 Prozent) niedrigere
Mitte der 1990er Jahre kaum Ausreißer festzu-
Werte aufwiesen (European Commission 2002:
stellen.13 In der Erhebung aus dem Jahre 2002
10). Obwohl demnach ein beachtlicher Teil der
werden hingegen ausgeprägter Unterschiede
Befragten (sehr) besorgt über den Klimawandel
sichtbar, wenn nur der Anteil der sehr Besorgten
ϳϬй
ϲϬй
ϱϬй
ϰϬй
ϯϬй
ϮϬй
ϭϬй
Ϭй
ϭϵϴϵ ϭϵϵϭ ϭϵϵϳ ϮϬϬϮ ϭϵϴϴ ϭϵϵϮ ϭϵϵϱ ϮϬϬϮ
h^
ƵƌŽƉĂ
ƐĞŚƌďĞƐŽƌŐƚ
Abbildung 1: Trend njŝĞŵůŝĐŚďĞƐŽƌŐƚ
der Klimabesorgnis in den USA und EuropaŶŝĐŚƚƐĞŚƌďĞƐŽƌŐƚ ƺďĞƌŚĂƵƉƚŶŝĐŚƚďĞƐŽƌŐƚ ǁĞŝƘŶŝĐŚƚ
Datenquellen: Eurobarometer Surveys (gewichtet) (Commission of the European Communities 1988, 1992, European Commission 1995, 2002) für
Europa und Gallup Polls (gewichtet) 1989, 1991, 1997, 2002 für die USA. Die Daten für Europa beziehen sich für alle Erhebungszeitpunkte auf 12
EU-Länder, die 1988 am Eurobarometer teilgenommen haben, um das Sample über den Zeitverlauf konstant zu halten (Belgien, Dänemark, Deutsch-
land, Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Portugal und Spanien).
13 Die Mittelwerte liegen bei fast allen Ländern im Spek-
trum von 3,3–3,6. Lediglich die griechische Bevölke-
rung (3,9) erreichte einen höheren Wert, während er in und Belgien (3,2) etwas niedriger ausfiel (European
Finnland (3,1), den Niederlanden (3,1) Frankreich (3,2) Commission 1995: 58).
13Soziologie und Nachhaltigkeit – Beiträge zur sozial-ökologischen Transformationsforschung
war, wurde in den neueren Untersuchungen Industrieunfällen (47 bzw. 46 Prozent). In der
deutlich, dass der Klimawandel auch unter den nächsten Erhebungswelle 2008 hingegen war der
Umweltthemen lange Zeit nicht an vorderster Klimawandel mit 57 Prozent die größte umweltbe-
Stelle rangierte, sondern die Zerstörung der zogene Sorge in Europa (European Commission
SuN 01/2021
Ozonschicht oder der Verlust der Regenwälder 2005: 8, European Commission 2008: 8). Im
stärkeres Gewicht bekam. Die Erhebungen zeigen Ländervergleich lassen sich hierbei erneut aus-
ferner, dass Sorgen über die Zerstörung der geprägte Unterschiede zwischen den Ländern
Umwelt im Vergleich zu anderen Sorgen, wie vor erkennen. Deutlich wird hierbei, dass Sorgen
Gewalt, Krankheiten, Arbeitslosigkeit, Armut und über den Klimawandel – abgesehen von Italien
sozialer Ausgrenzung, eine eher nachgeordnete – in „neuen“ EU-Mitgliedstaaten (Baltikum und
Rolle zukam (European Commission 1999: 15). andere osteuropäische Länder) eine vergleichs-
weise untergeordnete Rolle spielen. Wenngleich
Wie weiter oben bereits angesprochen lässt sich
zu bemerken ist, dass auch hier zwischen 38 und
die Zeitreihe der Klimasorgen nach 2002 auf Basis
51 Prozent der Befragten angaben, besorgt zu
der Eurobarometer-Daten nicht mehr weiterver-
sein. Interessanterweise fiel das Besorgnisniveau
folgen, da das Erhebungsinstrument ausgetauscht
der Befragten auch in den Niederlanden und
wurde. Seitdem wird erhoben, über welche fünf
Großbritannien weiterhin vergleichsweise gering
Umweltprobleme sich die Befragten am meisten
aus, wobei die Sorgen über die Klimafolgen in den
Sorgen machen. So rangierte der Klimawandel
skandinavischen Ländern nun im Vergleich zu
im Jahre 2005 im umweltbezogenen Sorgenpool
vorher relativ stark ausgeprägt waren.
mit 45 Prozent der Nennungen an dritter Stelle
hinter der Verschmutzung von Gewässern und
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Portugal
Dänemark
Schweden
Belgien
Irland
Ungarn
Slowakei
Tschechien
Spanien
Österreich
Polen
Deutschland
Griechenland
Niederlande
Bulgarien
Italien
Lettland
Litauen
Finnland
Luxemburg
Malta
Zypern
Frankreich
Rumänien
Slowenien
Estland
Großbritannien
Abbildung 2: Der Klimawandel als eine der fünf größten Umweltsorgen in Europa im Jahre 2008
Daten: European Commission 2008, gewichtet.
14Luigi Droste / Björn Wendt – Who Cares
Obwohl der Klimawandel im Jahre 2009 hinter den Klimawandel ist, wenngleich mitunter deut-
Armut und Wirtschaftsabschwung, aber noch liche Unterschiede zwischen einzelnen Regionen
vor Terrorismus und bewaffneten Konflikten, im und Ländern bestehen, die es durch soziologische
Sorgenpool der Befragten an dritter Stelle stand Analysen aufzuklären gilt.
SuN 01/2021
(European Commission 2009: 7), wurde er in fol-
Die sozial-temporale Basis der Klimabesorgnis:
genden Erhebungen des Eurobarometers 2009,
Individuelle und strukturelle Faktoren
2014 und auch 2017 bei den größten umweltbezo-
genen Sorgen überraschend nicht mehr abgefragt Untersuchungen, die danach fragen, wie Varianz
(European Commission 2014: 12, European Com- und Struktur der Besorgnis über den Klimawandel
mission 2017: 12). in der Bevölkerung und in ihrem Zeitverlauf
erklärt werden können, wurden erst ab der Mitte
Global betrachtet zeigt sich, dass vor allem in
der 2000er Jahre auf der Ebene einzelner Länder
Lateinamerika, Afrika und Teilen Asiens Sorgen
durchgeführt. Für Deutschland ist hierfür bisher
über den Klimawandel verbreitet sind, während
lediglich bekannt, dass Frauen, Menschen mitt-
in Europa und anderen Wohlstandsgesellschaften
leren und hohen Alters und Befragte mit einem
vor allem der IS Sorgen bereitete (Carle 2015,
niedrigen Schulabschluss (Hauptschule und
Poushter/Manevich 2017). Im Jahr 2019 ist
weniger) etwas häufiger Sorgen bekunden, als
der Klimawandel gleichwohl auch in westlichen
Männer, die jüngste Alterskohorte (18–29 Jahre)
Wohlstandsgesellschaften zunehmend als be-
und Befragte mit mittleren und hohen Schul-
sonders besorgniserregende und größte globale
abschlüssen (Hüther et al. 2012). Vorliegende
Gefahr wahrgenommen worden (Poushter &
Ergebnisse bewegen sich jedoch größtenteils auf
Huang 2019). Aktuell rangiert der Klimawandel
einer deskriptiven Ebene. Dies gilt auch für die
jedoch, wenn er im Vergleich zu anderen Sorgen
meisten weltweiten und ländervergleichenden
abgefragt wird, nicht an vorderste Stelle im Sor-
Erhebungen zur Besorgnis über den Klimawandel
genpool der Weltbevölkerung. Im Rahmen der
sei es im Querschnitt, im Trend oder auch mit
Studie „What worries the world“ liegt er lediglich
Bezug auf Zusammenhänge. Für die USA, Groß-
im Mittelfeld der geäußerten Sorgen (Atkinson
britannien, einige skandinavische Länder und
et al. 2020: 5). Nach den drei größten Sorgen
die Schweiz liegen hingegen länderspezifische
gefragt, gaben nur 16 Prozent der Befragten hier
Zusammenhangsanalysen vor.
den Klimawandel an, während Armut und soziale
Ungleichheit (34 Prozent), Arbeitslosigkeit (31 Sundblad et al. (2007) bestätigen für Schweden
Prozent), Kriminalität und Gewalt (30 Prozent) hierbei etwa, dass Frauen sich besorgter über
als auch finanzielle und politische Korruption (30 den Klimawandel äußern als Männer, während
Prozent) an der Spitze lagen. alle anderen sozio-demografischen Merkmale
keinen signifikanten Einfluss haben. Auf der
In der Zusammenschau wird somit deutlich, dass
anderen Seite wurde am Beispiel Schweden her-
Ausmaß und Reichweite der Klimabesorgnis stark
ausgearbeitet und untersucht, dass Elternschaft
von den Konjunkturen der gesellschaftlichen Ent-
bei Männern mit einer erhöhten Besorgnis in
wicklungen, bestimmten Ereignissen auf globaler
Bezug auf den Klimawandel einhergeht (Ekholm/
Ebene und der Virulenz öffentlicher Diskurse
Olofsson 2017, Ekholm 2020). Für Großbritan-
abhängen, jedoch auch auf Umfragemethodik
nien lässt sich dahingegen kein Zusammenhang
und Operationalisierung der Items zurückgehen.
zwischen Elternschaft und erhöhtem klimawan-
Gleichwohl lässt sich zweifelsfrei feststellen, dass
delbezogenem Sorgenniveau feststellen (Thomas
ein Großteil der Weltbevölkerung besorgt über
et al. 2018).
15Sie können auch lesen