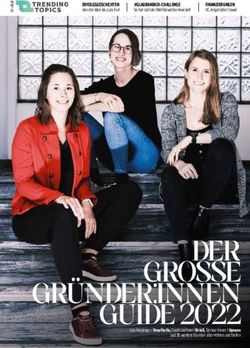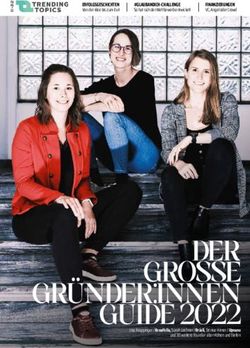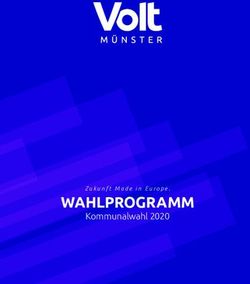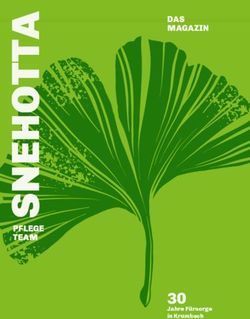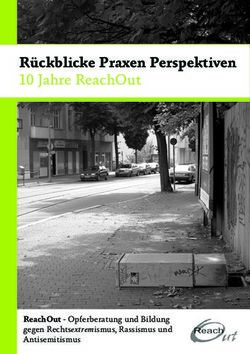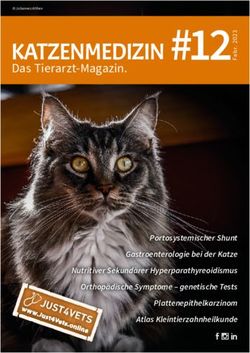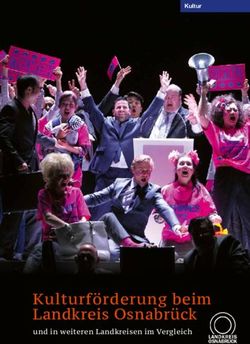Technik Design Werken - Praxishandbuch - Industriellenvereinigung
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Vorwort
Seit vielen Jahren fordert die Bundesarbeitskammer einen modernen
© Alissar Najjar
Werkunterricht. Die Trennung in Textiles und Technisches Werken
führte zu unerwünschten Nebenwirkungen. Die Aufteilung in
Textil = weiblich und Technik = männlich v erstärkte traditionelle Rollen-
bilder in der Berufsorientierung. Jetzt wurde die Zusammenlegung der
Fächer nach vielen Jahren erreicht. Aus Sicht der Arbeiterkammern
sollen junge Frauen sehr früh erleben, dass das Interesse für Technik
nicht angeboren ist. Sie sollen den breiten Horizont der Berufswahl
vor sich erkennen können. Dieses Handbuch leistet dazu einen
wertvollen Beitrag.
Renate Anderl
Präsidentin der Bundesarbeitskammer
© Marek Knopp
Technische und handwerkliche Kompetenzen sind heute wichtiger
denn je: Als Wirtschaftskammer ist es uns deshalb ein besonderes
Anliegen, junge Menschen für entsprechende Ausbildungen und
berufliche Tätigkeiten zu motivieren. Wir freuen uns, den innovativen
neuen Lehrplan mit einem praxisorientierten Handbuch für den
Unterricht unterstützen zu können. Die Vermittlung von technischen
und textilen Fachkompetenzen ist ein wichtiger Beitrag im Rahmen der
Berufsorientierung. Dem neu gestalteten Fach „Technik und Design“
kommt hierbei eine Schlüsselrolle zu – vor allem wenn es darum geht,
Brücken zwischen Handwerkstraditionen und einer digitalisierten
Arbeitswelt zu schlagen.
Harald Mahrer
Präsident der Wirtschaftskammer Österreich
© IV / Horak
Österreichs Wohlstand beruht zum überwiegenden Teil auf Forschung,
Technologie und Innovation. Aber auch die großen Herausforderungen
unserer Zeit, wie die Bekämpfung des Klimawandels, werden ohne
technologische Innovationen nicht zu lösen sein. „Technik“ wird damit
immer mehr zum Synonym für hervorragende Beschäftigungs- und
Karriereaussichten. Der Werkunterricht bietet den Kindern oftmals
die erste Chance zur Kontaktaufnahme mit der Welt der Technik und
der Werkstoffe. Die IV setzt sich dafür ein, den Gegenstand deutlich
aufzuwerten und als „Technik und Design“ zum Drehscheibenfach im
Herzen der naturwissenschaftlich-technischen Bildung zu entwickeln:
fächerübergreifend, praxisorientiert und als Spiegel der digitalen
Transformation in den schulischen Unterricht. Motto: „Wer Technik
kann, kann die Welt verändern!“
Georg Knill
Präsident der Industriellenvereinigung
Praxishandbuch Technik · Design · WerkenImpressum 1. Auflage 2023 ISBN 978-3-7063-0894-6 Autor*innen: Roberta Erkinger, Karin Gollowitsch, Sebastian Goreth, Rudolf Hörschinger, Claudia Hutterer, Paul-Reza Klein, Katrin Nora Kober, Walter Moser, Katrin Proprentner, Erich Reichel, Wolfgang Richter, Sabine Schwarz, Felix Seidl, Maria Söllradl, Viktoria Taucher, Susanne Weiß, Silvia Wiesinger Redaktion: Marion Starzacher, Andrea Liebhart Projektkoordination: Marion Starzacher Didaktisches Konzept: Marion Starzacher Herausgeber: Bundesarbeitskammer (Ansprechpartner Richard Meisel) Industriellenvereinigung (Ansprechpartner Wolfgang Haidinger) Wirtschaftskammer Österreich (Ansprechpartnerin Petra Duhm) Unterstützt von: Förderverein Technische Bildung, Pädagogische Hochschule Steiermark, Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Schule (AWS) im Rahmen des Instituts für Bildungsforschung der Wirtschaft (ibw) Layout und Grafik: Alexandra Schepelmann, donaugrafik Druck: Druckerei Berger, Horn Fotonachweis: Coverfoto Marion Starzacher, U4: Maria Söllradl, Katrin Proprentner, Susanne Weiß, Rudolf Hörschinger, Roberta Erkinger, Claudia Hutterer
V01/23
6 Inspirationen 1 Bewegung · Mobilität · Mechanik
5 Raum · Bauen · Wohnen 2 Energie · Elektrizität · Elektronik
4 Produkt · Objekt · Spiel 3 Körper · Kleidung · Mode
Wie ist die Sammelmappe aufgebaut? braucher*innenbildung sind als übergreifende Themen in
Das Praxishandbuch ist nach den fünf ergänzenden An- den kompetenzorientierten Lehrplan eingearbeitet und fin-
wendungsbereichen des Lehrplans „Technik und Design“ den sich in den Unterrichtsbeispielen wieder.
der Sekundarstufe I strukturiert. Zu diesen wird im Praxis-
handbuch ein sechster Bereich – Inspirationen – hinzu- Wie sind die Beiträge aufgebaut?
gefügt. Die Zielgruppe des Praxishandbuchs sind die Päda- • Die Beispiele folgen einer einheitlichen Struktur.
gog*innen der Sekundarstufe I in allen Schultypen, aber in • Zu Beginn jedes Beitrags liefert eine Kurzbeschreibung
den zugehörigen Beiträgen werden einerseits Übergangs- einen Einblick in den Inhalt und die Infobox gibt einen
räume im Sinn eines Spiral-Curriculums von der Elementar- Überblick über Zielgruppe, Dauer, Schwierigkeitsgrad,
stufe über die Primarstufe bis hin zur Sekundarstufe II Lehrplanbezug und den Schultyp.
thematisiert. Andererseits werden weitere Themen wie • Grundinformationen sind farblich hervorgehoben und
Fachdidaktik, Technische Bildung oder Desiderate, wie zum gliedern die Beiträge.
Beispiel das Einbinden der Kreativität in den Schulalltag, • In den Beiträgen des Praxishandbuchs gibt es Hinweise
im Kapitel Inspirationen beschrieben. Die Themen werden auf fächerübergreifende Aspekte.*
als Untertitel im jeweiligen Beitrag sichtbar. • Hinweise für die Durchführung, Tipps zur Differenzierung,
Das Kompetenzmodell des Sekundarstufenfaches „Tech- zur Adaptierung und zum Variieren der einzelnen
nik und Design“ mit den Kompetenzbereichen Entwicklung, Unterrichtsbeispiele werden von den Autor*innen in der
Herstellung und Reflexion dient als Grundlage und wird Langbeschreibung gegeben.
über die Anwendungsbereiche aufgebaut, die in die zentra- • Praxistipps zeigen Punkte auf, die für die eigene
len fachlichen Konzepte integriert sind. Umsetzung hilfreich sind.
• Die Informationen zur Berufsorientierung dienen neben
Was bringt das Praxishandbuch den Pädagog*innen? den Testimonials als Unterstützung der Lehrperson,
Die Praxisbeispiele aus dem Unterrichtsalltag sollen moti- diese Thematik in den Unterricht zu integrieren.
vierend und inspirierend für den eigenen Unterricht wirken.
Der Aufbau als Sammelmappe ist bewusst gewählt und Wie geht es mit dem Praxishandbuch weiter?
bietet genügend Platz für eigenständige Erweiterungen, Es ist geplant, spezielle Anwendungsbereiche der Sekun
Dokumentationen und die Sammlung eigener Ideen. darstufe I zu vertiefen und Praxisbeispiele der Elementar-,
Primarstufe sowie der Sekundarstufe II inklusive dem ent-
Welche Ziele verfolgt das Praxishandbuch? sprechenden Lehrplanbezug einzupflegen. Das Praxishand-
Die Kernziele dieser Mappe sind die Vielfalt des Sekun- buch ist ein dynamisches Werk, das durch die E rfahrung
darstufenfaches „Technik und Design“ zu zeigen, die Vor- und Unterrichtsbeispiele der Pädagog*innen weiterwach-
ortung der Unterrichtsbeispiele in den jeweiligen Lehr- sen wird.
plänen und die unterschiedlichen Zugänge zu Materialien,
Verfahren, Werkzeugen und Maschinen sowie zu Ge- * Aufgrund von diversen Fachumbenennungen in der Sekundarstufe sind in
staltung, Entwurf und Umsetzung zu thematisieren. der Tabelle alte und neue Fachnamen gegenübergestellt. Im Praxishand-
buch werden vorwiegend die neuen Fachnamen verwendet:
Wie breit gefächert sind die Themen der Beiträge? Fachname bis Lehrplan NEU Fachname Lehrplan NEU
Bildungs-, Berufs- und Lebensorientierung; Entrepreneur- Biologie und Umweltkunde → Biologie und Umweltbildung
ship Education; Gesundheitsförderung; Informatische Bil- Bildnerische Erziehung → Kunst und Gestaltung
dung; Interkulturelle Bildung; Medienbildung; Politische Geschichte und Sozialkunde → Geschichte und Politische Bildung
Bildung; Reflexive Geschlechterpädagogik und Gleich- Geografie und Wirtschaftskunde → Geografie und wirtschaftliche Bildung
stellung; Sexualpädagogik; Sprachliche Bildung und Musikerziehung → Musik
Lesen; Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung; Ver- Technisches und textiles Werken → Technik und Design
kehrs- und Mobilitätsbildung; Wirtschafts-, Finanz- und Ver- Berufsorientierung → Bildungs- und Berufsorientierung
Praxishandbuch Technik · Design · WerkenV01/23 1 Bewegung · Mobilität · Mechanik
2 Energie · Elektrizität · Elektronik
Kritzelroboter
Eine Zeichenmaschine, die vielleicht auch Töne von sich gibt
Felix Seidl • BG und BRG St. Pölten • felix.seidl13@gmail.com
1
In diesem Projekt geht es darum, dass die Schüler*innen das zuvor theoretisch
und / oder praktisch erarbeitete Thema „einfacher Stromkreis“ in Form eines
experimentellen Werkstücks vertiefen.
In der nächsten Phase beginnen die Schüler*innen mit
Zielgruppe der Anfertigung von Skizzen und bauen danach ein Mo-
Schulstufe 6–8 dell (z. B. aus Wellkarton) ihres Roboters. Sobald die
ersten Schüler*innen fertige Modelle erarbeitet haben,
Dauer: Clock Clock Clock Clock Clock Clock
empfiehlt es sich, eine zweite Besprechungs- und Dis-
4–6 Doppelstunden (je nach Gruppengröße)
kussionsphase einzuleiten.
Schwierigkeitsgrad:
1–2 Sterne (geeignet für Klassen, die Interesse am Dimensionen der Handlungsorientierung
forschenden und prozesshaften Lernen haben) Ausgehend von der Aufgabenstellung „Wie baue ich einen
einfachen Stromkreis mit Batterie, Schalter, Leiter und
LP Technik und Design
Bewegung · Mobilität · Mechanik /
Elektromotor?“ und den Grundkenntnissen über die kor-
Energie · Elektrizität · Elektronik rekte Verwendung der Werkzeuge setzen sich die Schü-
ler*innen mit dem Entwerfen von Robotern auseinander
LP Technisches und textiles Werken und wenden dabei die erworbenen Kompetenzen an (Bohr-
Technik führerschein von Vorteil).
Lernziel / Kompetenzen
In diesem Projekt lernen die Schüler*innen das zuvor er- Die Schüler*innen
lernte Prinzip des einfachen Stromkreises praktisch an- • experimentieren mit unterschiedlichen Materialien
zuwenden. Angeregt durch Videos von z. B. Petr Valek in Bezug auf Materialeigenschaft und Bearbeitungs-
(Akustik), „the Vape“ (visuell) oder anderen „DIY-Kritzel- möglichkeit,
robotern“ auf Youtube sollen die Schüler*innen ein eige- • prüfen, testen und optimieren Ergebnisse,
nes Modell anfertigen. Zuvor werden anhand der Videos • finden kreative Lösungsansätze,
die unterschiedlichen Funktionsweisen der Roboter be- • organisieren und planen ihre Arbeitsschritte selbst-
sprochen. Das Prinzip des „Vibromotors“ (Bewegung ständig,
durch Unwucht) und des Getriebemotors (Bewegung • lernen unterschiedliche Verfahren kennen und wenden
durch Zahnräder) werden hier thematisiert. diese an,
• wählen das notwendige Verfahren für das Projekt aus
und setzen es sachkundig sowie materialgerecht ein.
Praxishandbuch Technik · Design · Werken Kritzelroboter•Seite 1 von 4V01/23 1 Bewegung · Mobilität · Mechanik
2 Energie · Elektrizität · Elektronik
Differenzierung / Unterrichtsmethode • Wie wichtig ist die Statik bei Robotern mit Vibromotor und
Um den Schwierigkeitsgrad des Projekts zu erhöhen und wie kann ich diese verbessern / beeinflussen?
anspruchsvoller zu machen, soll die Verwendung von • Welche Rolle spielt das Gewicht bzw. die Länge der
Klebeband und Heißklebepistole entfallen. Dadurch kön- verwendeten Unwucht?
nen unterschiedlichere Lösungsansätze zum Verbinden • Wie schaffe ich es, die Drehbewegung des Getriebemotors
von Materialien entstehen und die Bandbreite an individu- in eine andere Form der Bewegung zu übersetzen?
ellen Modellen kann erhöht werden.
Um keine Langeweile aufkommen zu lassen, können die Diese Fragen sollen durch geleitete Gruppengespräche be-
Schüler*innen, die bereits fertig sind, ihren Stromkreis antwortet werden.
verlöten. Weiters können sie sich einen Namen für ihren
Roboter überlegen und ihr / ihm durch farbige Oberflächen- Überarbeitungsphase
gestaltung etwas Leben einhauchen. In der nächsten Phase überarbeiten die Schüler*innen
ihre Modelle und versuchen die besprochenen Inhalte in
Fächerübergreifende Aspekte
die Praxis umzusetzen. Manche Schüler*innen werden
Dieses Projekt lässt sich fächerübergreifend mit dem Fach
praktikablere Lösungen gefunden haben als andere. So
„Kunst und Gestaltung“ kombinieren. In der bildenden
können leistungsschwächere Schüler*innen die innovati-
Kunst gibt es mehrere Künstler*innen, die mit dem Thema
veren Lösungen ihrer Klassenkolleg*innen übernehmen
„Zeichenmaschinen“ oder „Zufallstechniken“ experimen-
und / oder adaptieren.
tieren (z. B. Jean Tinguely, Max Ernst).
Eine weitere Möglichkeit ist, dieses Projekt mit dem Fach
Die Präsentations- und Reflexionsphase
„Physik“ zu verknüpfen und dabei Grundlagen der Elektro-
Diese ist zugleich der Abschluss dieses Projekts. Hier wer-
nik und der Mechanik zu thematisieren.
den die Roboter auf ihre Funktionsweise getestet und die
gestalterische Vielfalt begutachtet. Bei einem gemeinsa-
men „Robotertanz“ können die zuvor besprochenen Inhal-
te nochmals wiederholt und im Detail hinterfragt werden:
Unterrichtsverlauf • Welche Ergebnisse erscheinen besonders spannend
und warum?
Das Hauptziel „Erschaffe einen Roboter, der grafische Spu-
• Welche Verfahrenstechniken (Materialverbindungen,
ren hinterlässt“ oder „Erschaffe einen Roboter, der zeich-
Antriebsformen, Bauweisen) eignen sich besonders gut
nen kann und eventuell auch Töne von sich gibt“ wird von
und welche nicht?
mehreren untergeordneten Lernzielen begleitet, die im
Arbeitsprozess aufgegriffen und behandelt werden.
Je nach Gruppengröße könnte dieses Projekt auch mit
der „Projektjournal-Funktion“ der „Technik und Design“-
Experimentierphase
App „TuD“ begleitet werden. Diese bietet den Vorteil,
Den Schüler*innen werden Batterien, verschiedene Strom
dass jeder Schüler / jede Schülerin den Arbeitsprozess
verbraucher, Schalter und Krokoklemmen zur Verfügung
mit Fotos dokumentieren kann und am Ende ein fertiges
gestellt. Sie müssen selbstständig herausfinden, wie die
Präsentationsblatt entsteht. Somit wäre auch die Möglich-
Motoren, LEDs, Lautsprecher usw. zum Leben erweckt
keit der Individualpräsentation gegeben. Sofern es die
werden können. Die Erkenntnisse daraus werden im
Schüler*innenzahlen erlauben, eignet sich bei diesem Pro-
Werkheft schriftlich und in Form eines Schaltplans fest-
jekt das forschende und handlungsorientierte Lernen am
gehalten.
besten. Wichtig sind hierbei jedoch mindestens eine oder
mehrere „Zwischenpräsentationen“, bei der / denen Ergeb-
Entwurfsphase mit Modellbau
nisse besprochen und auf ihre Funktionalität untersucht
Die Schüler*innen schlüpfen zu Beginn des Projekts in die
werden können.
Rolle von Designer*innen. Im Laufe des Arbeitsprozesses
werden Fragen zu weiteren Inhalten wie Statik, unter-
Material
schiedliche Verbindungs- und Umformungsverfahren und
Ein großer Grundstock an Materialien ist für dieses Pro-
Trennverfahren auftauchen.
jekt unumgänglich. Die Schüler*innen müssen genügend
Folgende Fragen können z. B. auftreten: unterschiedliche Materialien zur Verfügung haben, um er-
• Zum Antrieb: Welche Unwucht soll ich verwenden? Wie finderisch werden zu können:
übertrage ich die Bewegung des Getriebemotors am • Ein gut ausgestattetes Kleinteilesortiment (Gewinde-
besten? schrauben, Muttern, Zahnstocher, Schnüre, Gummi-
• Zur Statik: Welche Lösungen gibt es, damit mein ringe, Nägel, Papierstrohhalme, Holzschrauben,
Roboter beim Zeichnen nicht umfällt? Kabelbinder etc.)
• Zu Verbindungs- und Trennverfahren: Wie befestige ich • Ausreichend Wellkarton (am besten 2-welliger, da
die Stifte am Roboter? Wie kann ich die Elektronik am dieser stabiler ist)
Roboter befestigen? • Upcycling-Materialien (Joghurtbecher, Kunststoffver-
packungen, Dosen, Restholz etc.)
Folgende Eckpunkte sollten in der Entwurfsphase
• Fotokarton (300 g) und Motivkarton
besprochen werden:
• Batterien, Stromverbraucher, Schalter, Krokoklemmen
• Welche Materialien eignen sich besonders gut und warum?
• Motoren, LEDs, Lautsprecher
• Welche Verfahren sind besonders gut geeignet, um die
Stifte am Roboter zu befestigen?
• Welche Vor- und Nachteile haben die jeweiligen Lösungen?
Praxishandbuch Technik · Design · Werken Kritzelroboter•Seite 2 von 4V01/23 1 Bewegung · Mobilität · Mechanik
2 Energie · Elektrizität · Elektronik
Werkzeug
• Eisenlineal, Geodreieck Praxistipp
• Schneideunterlagen, Schneidemesser, Scheren
• Heißklebepistole
Bei größeren Gruppen über 15 Schüler*innen
• Schraubendreher
empfiehlt sich die Reduktion auf Zeichenroboter,
• Sägen (z. B. kleine Bügelsäge, Metallsäge, Laubsäge)
die auf dem Prinzip des Vibro-Motors basieren.
• Standbohrmaschine
Diese Herangehensweise ist vor allem für jün-
• Schraubstöcke
gere Schüler*innen (z. B. Schulstufe 6) besser
• Akku-Schrauber
geeignet, da dieses Prinzip in der Regel eher ver-
• Schraubzwingen
standen wird und daher leichter umgesetzt werden
• Lötkolben, Lötzinn, Lötpaste
kann.
• Abisolierzange
Sicherung des Unterrichtsertrags
Die Sicherung des Unterrichtsertrags erfolgt am besten
durch eine Mischung von mehreren Medien: zum einen Berufsorientierung
das Verschriftlichen des Grundprinzips eines einfachen
Stromkreises in Form von Merksätzen, Eselsbrücken oder
Die Entwicklung, die Planung und der Bau des
einprägsamen praktischen Übungen. Zum anderen sind
Kritzelroboters haben dir Spaß gemacht? Dann
Besprechungen zwischen den Arbeitsprozessen ein wei-
könnte im Bereich der M E C H ATRONIK oder des
terer Erfolgsfaktor. Schüler*innen, die spannende Ideen
M A S C H INE NB A U S dein Traumjob zu finden sein.
oder innovative Lösungen gefunden haben, sollen ihre Er-
kenntnisse mit ihren Klassenkolleg*innen teilen dürfen. Diese Stromkreise waren dir zu einfach? Dann fin-
Die Lehrperson soll diese Gruppenbesprechungen ziel- dest du vielleicht in der Ausbildung zum E LE K TRO-
führend leiten und, wenn notwendig, objektive und fachlich TECHNIKER / zur ELEKTROTECHNIKERIN deine beruf
kompetente Ideen und Ratschläge für weitere Einfälle und liche Herausforderung.
Verbesserungsvorschläge einbringen können.
Reflexion – Vorschläge für abschließende Fragen ȅ bic.at
• Welche Faktoren beeinflussen die Funktionalität des ȅ ausbildungskompass.at
Roboters (Materialität, Anordnung der Stifte = Statik, ȅ jopsy.at
Gewicht)?
• Warum zeichnen manche Roboter regelmäßige Formen
(z. B. Kreise) und andere bewegen sich scheinbar „nach
freiem Willen“?
• Macht es einen Unterschied, an welcher Stelle Motor
und Unwucht befestigt sind (oben, unten, seitlich)?
• Bei welchen Konstruktionsweisen kann, ohne die
Funktionalität zu verschlechtern, am meisten Material
eingespart werden?
• Gibt es weitere Verbesserungsvorschläge, um Material
einzusparen? Gibt es vielleicht einfachere Wege,
um Karton miteinander zu verbinden (z. B. Steckver-
bindungen)?
• Könnten manche Prototypen so weiterentwickelt werden,
dass der Sprung vom Individualdesign in die Serien-
produktion (Kleinserie) gelingt? Welche Arbeitsschritte
könnten vereinfacht und welche Materialien könnten
weggelassen oder ersetzt werden?
Beispielhafter Ablauf und Umsetzung
• Theorie – einfacher Stromkreis,
Literatur & Links
• Recherchephase, Ideenfindung und Austausch,
Stuber, T., et al. (2018), Technik und Design Lernheft, 2. und 3. Zyklus.
• Werkstattpraxis – Bau eines Modells, Bern: hep Verlag AG. http://tud.ch
• Zwischenbesprechung – Präsentation und Besprechung Robotertänze: https://youtu.be/P5ZoqlcejEo
erster Ergebnisse,
Petr-Valek-Videos:
• Werkstattpraxis – Optimieren und Verbessern, https://youtu.be/0p9Ngb_xLj0 (Kinetik und Klang)
• abschließende Präsentation und Reflexion. https://youtu.be/v0JcP3A3SZg (Zeichenmaschine 1)
„the-Vape“-Videos:
https://youtu.be/-13YSc8LV0w (drawing and audio)
https://youtu.be/6NC_PVnXNRE (drawing and audio)
Vibromotor-Prinzip:
https://youtu.be/T0vAYH51euU (Vibrobot Art)
https://youtu.be/DdxMSp3YsH4 (drawing robot – Bausatz)
Praxishandbuch Technik · Design · Werken Kritzelroboter•Seite 3 von 4V01/23 1 Bewegung · Mobilität · Mechanik
2 Energie · Elektrizität · Elektronik
Ergebnisse
Abb. 1 Abb. 2
Abb. 3 Abb. 4
Abb. 5 Abb. 6
Abb. 7 Abb. 8
Bildquellen
Alle Abbildungen: © Felix Seidl
Praxishandbuch Technik · Design · Werken Kritzelroboter•Seite 4 von 4Testimonial
Eine Karriere in der
Metallbranche
© Blum
Wer bist du und was machst du?
Mein Name ist Lisa Alge. Ich bin 19 Jahre
alt und jetzt im 4. Lehrjahr als Maschinenbau-
technikerin bei der Firma Julius Blum GmbH.
Mein Aufgabengebiet ist breit gefächert, wobei
der Schwerpunkt auf dem Reparieren und
Instandhalten von Produktionsanlagen liegt.
© Blum
Wie bist du zu deinem Beruf gekommen?
Ich habe mich lange nicht entscheiden können und habe des-
wegen viele Messen besucht. Dabei haben mich die technischen
Berufe besonders begeistert. Beim Schnuppern habe ich mir dann
die verschiedenen Berufe noch genauer angesehen. Von diesem
Beruf war ich von Anfang an total begeistert und da Mathematik
und logisches Denken meine Stärken sind, war das einfach
perfekt. Ab dem Zeitpunkt war klar, dass ich nichts Anderes mehr
machen möchte und Maschinenbautechnikerin werden will.
Welche Eigenschaften und Fähigkeiten
sind für deinen Beruf wichtig? © Blum
Interesse an der Arbeit und der Technik, Teamfähigkeit und
Motivation sind bei uns wirklich wichtig, das genaue Arbeiten
lernt man im Zuge der Ausbildung.
Was ist das Coolste an deinem Beruf?
Die Abwechslung gefällt mir wahnsinnig gut, da ich nie weiß,
was mich am nächsten Tag erwartet, denn es gibt immer neue
Herausforderungen. Für jedes Problem dann die passende
Lösung zu finden, macht Spaß und ist spannend. Das Beste
ist jedoch, am Ende des Tages vor einer Anlage zu stehen und
sagen zu können: „Das habe ich repariert.“
Praxishandbuch Technik · Design · WerkenTestimonial
Eine Karriere in der
Automobilindustrie
Wer bist du und was machst du?
© AVL / Konstantinov
Ich heiße Roland Guggi und arbeite als Calibration Engineer bei
AVL List in Graz. Mein Aufgabenbereich umfasst das Testen und
die Optimierung von Fahrzeugen, wobei der Fokus auf virtuelle
Fahrzeugmodelle gelegt wird. Anhand großer Datenmengen werden
Fahrzeuge mit spezieller Software virtuell gesteuert und simuliert,
ohne ein reales Fahrzeug zu benötigen.
© AVL / Konstantinov
Welche Ausbildung
hast du gemacht?
Ich habe mein Bachelorstudium im
Fachbereich Wirtschaftsingenieur
wesen-Maschinenbau abgeschlos-
sen. Während meines Studiums war
ich Mitglied beim TU Graz Racing
Team. Dort beschäftigte ich mich
intensiv mit der Entwicklung eines
Rennboliden, was mein Interesse
am Rennsport geweckt hat. Neben
dem theoretischen Studium war es Welche Eigenschaften
für mich immer wichtig, praxisnahe
Erfahrungen zu sammeln. Daraufhin
und Fähigkeiten sind für
begann meine Karriere als studen deinen Beruf wichtig?
tischer Mitarbeiter. Mess- und
Simulationsdaten sowie Testfahrten Kommunikative Stärke, Teamfähigkeit und
am Fahrsimulator zählen zu meinem Ausdauer sind neben einem guten technischen
täglichen Berufsalltag. Verständnis die Soft-Skills, die man für diesen
Job mitbringen soll. Da AVL ein internationales
Unternehmen ist, habe ich auch die Möglichkeit
an unterschiedlichen Standorten zu arbeiten
und somit neue Menschen und Kulturen kennen-
zulernen.
© AVL / Konstantinov
Was ist das Coolste an deinem Beruf?
Die Möglichkeit mein Hobby mit meinem Beruf zu verbinden.
Motorisierte Fahrzeuge faszinieren mich schon seit meiner Kindheit.
Bei AVL habe ich die Chance, neu entwickelte Prototypen zu sehen,
zu optimieren und diese als einer der Ersten zu testen. Meine
Arbeit ermöglicht es mir, bei der Mobilität der Zukunft mitzuwirken.
Praxishandbuch Technik · Design · WerkenV01/23 1 Bewegung · Mobilität · Mechanik
Roboterhand
Bewegliche Verbindungen experimentell erforschen
Maria Söllradl • BRG Fadingerstraße, Linz / Pädagogische Hochschule Oberösterreich • m.soellradl@prof.fadi.at
1
Das hier vorgestellte Unterrichtsbeispiel soll zum Suchen, Finden und Umsetzen
von kreativen Lösungsansätzen für die Entwicklung einer „Roboterhand“ anregen.
Dimensionen der Handlungsorientierung
Zielgruppe Durch die offen gehaltene Frage der eingesetzten Materia-
Schulstufe 7 lien und Technologien bestimmen die Schüler*innen aktiv
sowohl den Ablauf als auch die Umsetzung ihres Werk-
Dauer: Clock Clock Clock Clock
projektes. Sie bestimmen selbsttätig die Intensität der
3–4 Doppelstunden
Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Materialien.
Schwierigkeitsgrad:
Lernziel / Kompetenzen
Zwischen 1 und 3 Sternen (inhaltlich auch für
Es geht um das
Anfänger*innen geeignet, jedoch hohes Niveau an
Klassenorganisation gefordert)
• Experimentieren und Erforschen von Material und
dessen Eigenschaften,
LP Technik und Design • Sammeln und Prüfen von Material auf Elastizität bzw.
Bewegung · Mobilität · Mechanik auf Möglichkeiten von flexiblen Verbindungen und
LP Technisches und textiles Werken starren Materialien,
Technik • Suchen und Finden von kreativen Lösungsansätzen zur
Kraftübertragung.
Differenzierung / Unterrichtsmethode
Eine Roboterhand mit beweglichen Einzelgliedern soll ge-
Als Erweiterung / Differenzierung kann die Roboterhand
baut und mittels Kraftübertragung durch Schnüre bewegt
mit einem pneumatischen System umgesetzt werden. Die
werden können.
Schüler*innen setzen sich in einer Konstruktionsaufgabe
Flexible (bewegliche) Verbindungen von Materialien spie-
vorerst mit einfachen, pneumatischen Systemen aus-
len sowohl im textilen als auch im technischen Bereich
einander und erproben anschließend die gewonnenen Er-
eine Rolle. Die Schüler*innen stehen bei dieser Auf-
kenntnisse an der Roboterhand.
gabenstellung vor der Herausforderung, selbstständig
geeignete Materialien und Techniken zur Umsetzung aus-
Zum Beispiel: Mögliche Befestigung des „Kolbens“ – die
zuwählen.
Befestigung muss die unterschiedlichen Bewegungen
(Drehbewegung Verpackung) und geradlinige Bewegung
›
(Kolben) zulassen. ( Abb. 7–8)
Praxishandbuch Technik · Design · Werken Roboterhand•Seite 1 von 4V01/23 1 Bewegung · Mobilität · Mechanik
Fächerübergreifende Aspekte
Hier können je nach Fach Schwerpunkte gesetzt werden: Praxistipp
„Physik“ (Anwendung physikalischer Grundgesetze, Er-
kundung unterschiedlicher Materialeigenschaften), „Bio- Eine gemeinsame Materialsammlung unterstützt
logie und Umweltbildung“ (Funktionsaspekte aus der die Schüler*innen beim Finden und Erproben von
Tier- und Pflanzenwelt: menschliche Hand, Bionik) in Ver- möglichen starren oder flexiblen Materialien sowie
bindung mit „Kunst und Gestaltung“ (Auseinandersetzung entsprechenden Verbindungen.
mit Ideen, Entwürfen, Planungen sowie Finden innovativer
Umsetzungswege).
Berufsorientierung
Unterrichtsverlauf Der Bau der Roboterhand war eine tolle neue und
Der Einstieg wird je nach persönlicher Schwerpunktsetzung spannende Herausforderung für dich? Dann in-
gestaltet und kann als Vertiefung in Themenbereiche wie formiere dich doch über das breite und spannen-
z. B. Bionik, menschliche Hand, Robotik oder Greifsysteme de Ausbildungsfeld im Bereich B IONIK oder über
dienen. S M A R T E NG INE E R ING !
Du kannst dir vorstellen, Roboter zu konstruieren?
Die Aufgabenstellung lautet folgendermaßen:
Dann findest du vielleicht in den Bereichen M E C H A-
Erfinde eine „Roboterhand“, die als Verlängerung deiner
TRONIK oder ROB OTIK deinen Traumjob.
Hand dienen soll. Du sollst mindestens zwei „Finger“ so be-
wegen können, dass du damit verschiedene Dinge greifen
kannst. Die Finger und die Hand bestehen aus einzelnen ȅ bic.at
Gliedern. Auslösende Kraft zur Bewegung des Greifens sind ȅ ausbildungskompass.at
die Muskeln deiner Finger. Die Kraft wirkt jedoch nicht di- ȅ jopsy.at
rekt auf die einzelnen Glieder der Roboterhand, sondern soll
›
mittels Schnüren auf diese übertragen werden. ( Abb. 1)
Es ist wichtig, zu Beginn folgende Begriffe mit den Schü-
ler*innen zu besprechen:
Kraftübertragung durch Seile, Führung, Lager, Kraftangriffs-
punkt, Zugkraft, Druckkraft.
Diese Begriffe können an einem Modell aus Papier oder
›
Karton erarbeitet werden. ( Abb. 2–3)
Eine weitere Umsetzung kann in Teamarbeit durchgeführt
werden: Im Unterschied zum Modell aus Karton oder
Papier soll die Hand nun aus einzelnen Teilen, die zu-
sammengefügt werden, bestehen.
In der Umsetzung werden Experimente zum Material, zur
Verbindung der einzelnen Teile, zu unterschiedlichen Be-
festigungen sowie zur Führung der Schnur ausgeführt.
›
( Abb. 4–6)
Anmerkung: Die Aufgabe eignet sich für die Umsetzung im
Onlineunterricht.
Sicherung des Unterrichtsertrags
Die fertigen Roboterhände werden von den Schüler*innen
präsentiert. Sie erläutern den individuellen Zugang, die
Umsetzung, aufgetretene Probleme und Lösungswege. Die
Problemlösungskompetenz kann durch das Überprüfen
der Funktion (Greifen der Finger) sichergestellt werden.
Material / Werkzeug
• Individueller Materialpool zum Bauen der Roboter-
hand: Papier, Pappe, Holz, Recyclingmaterial wie
Verpackungen
Literatur & Links
• Verbindungsmittel wie Klebstoffe, Klebebänder, Kabel- Weiterführende Projekte von einfachen pneumatischen Systemen bis
binder, Schnüre, Gummibänder hydraulischen Robotern in:
• Werkzeug und Arbeitsmittel wie Schere, Schneide- Akiyama, Lance (2017): Katapult und Flitzebogen: Verrückte Gummiband-
messer, Schneideunterlagen Projekte für junge Tüftler. Bern: Haupt.
Praxishandbuch Technik · Design · Werken Roboterhand•Seite 2 von 4V01/23 1 Bewegung · Mobilität · Mechanik
Unterrichtsverlauf in Bildern
Abb. 1 | Modell aus Karton Abb. 2 | Erarbeiten von Begriffen
Abb. 3 | Führung, Lagerung Abb. 4 | Umsetzung aus Holz
Abb. 5 | Umsetzung mit Verpackungen Abb. 6 | Führung innen
Praxishandbuch Technik · Design · Werken Roboterhand•Seite 3 von 4V01/23 1 Bewegung · Mobilität · Mechanik
Bilder zu Differenzierung
Abb. 7 | Kolbenbefestigung
Abb. 8 | Verbindung mit Strumpfhose
Bildquellen
Alle Abbildungen: © Maria Söllradl
Praxishandbuch Technik · Design · Werken Roboterhand•Seite 4 von 4Testimonial
Eine Karriere bei
Otto Bock Healthcare Products
Wer bist du und was
machst du beruflich?
© Otto Bock Healthcare Products GmbH
Mein Name ist Andreas Eichler und ich bin
seit Juli 2022 Geschäftsführer der Otto Bock
Healthcare Products GmbH in Österreich und
Leiter für den Bereich Market Intelligence &
Business Modeling.
© Otto Bock Healthcare Products GmbH
Was ist das Besondere an
deinem Unternehmen?
Das Leben genießen und den Alltag unabhängig meistern –
was für viele ganz selbstverständlich ist, sollte auch für
Menschen mit eingeschränkter Bewegungsfähigkeit gelten.
Unsere Medizinprodukte geben Menschen ihre Mobilität
zurück oder erhalten wichtige Funktionen des Körpers.
Dazu zählen Prothesen, Orthesen und Rollstühle.
© Otto Bock Healthcare Products GmbH
Was erwartet junge Mitarbeiter*innen
in deinem Unternehmen?
Egal, welchen Job unsere jungen Mitarbeiter*innen bei uns erlernen, sie alle tragen dazu
bei, Menschen zu helfen, ihre Bewegungsfreiheit zu erhalten oder wiederzuerlangen.
In Wien bieten wir derzeit eine Ausbildung im Lehrberuf Mechatronik an. Dabei werden
die Kolleg*innen von Anfang an in interessante Projekte aus Entwicklung und Produk-
tion integriert, und sie lernen unterschiedliche Abteilungen kennen. Der Ausbildungsweg
lässt sich bis zur Meisterprüfung weiterführen oder mit einem Studium kombinieren.
Uns liegt viel daran, unsere jungen Kolleg*innen nach erfolgreich abgeschlossener
Ausbildung in ein festes Arbeitsverhältnis zu übernehmen.
Praxishandbuch Technik · Design · Werken© Otto Bock Healthcare Products GmbH
© Otto Bock Healthcare Products GmbH
Was hat das alles mit
dem Schulfach „Technik
und Design“ zu tun?
Bewerber*innen sollen technisches Ver-
ständnis sowie Interesse an Elektronik
und Mechanik mitbringen. Handwerkliches
Geschick und gutes räumliches Vor-
stellungsvermögen sind ebenso hilfreich
wie Freude an der praktischen Ausübung
des Berufes.
Erste Einblicke, ob ein technischer Beruf
das Richtige ist, kann dieses Schulfach
Welche Tipps kannst du mir
bieten. für meine Berufswahl geben?
Finde heraus, was deine Stärken sind und
womit du dich beschäftigen möchtest – sei
es über Praktika, Tests oder Gespräche
mit Eltern und Lehrer*innen. Es gibt keine
bessere Motivation als einen Beruf auszu-
üben, der einem Spaß macht.
© Otto Bock Healthcare Products GmbH
Firmenportrait
Firmenbezeichnung Otto Bock Healthcare Products GmbH
Standorte (national / 60 Standorte weltweit; einer von vier
international) Forschungs- und Entwicklungsstandorten
ist in Wien.
Mitarbeiter*innenzahl Weltweit mehr als 8.000; in Wien 650
Was macht das Hersteller von Medizinprodukten,
Unternehmen? z. B. Prothesen, Rollstühlen, Exoskeletten
ȅ www.ottobock.com; www.ottobock.at
Praxishandbuch Technik · Design · WerkenPraxishandbuch
Technik · Design · Werken
2
Energie
Elektrizität
ElektronikV01/23 2 Energie · Elektrizität · Elektronik
4 Produkt · Objekt · Spiel
Der Heiße Draht
Ein Klassiker mittels Informationstechnik neu entdeckt
Sebastian Goreth • Pädagogische Hochschule Tirol • sebastian.goreth@ph-tirol.ac.at
2
Bei dieser Konstruktionsaufgabe wird ein problemorientierter Ansatz verfolgt,
welcher durch eine anschließende Fertigung umgesetzt und abschließend bewertet
werden kann.
Dimensionen der Handlungsorientierung
Zielgruppe Die Schüler*innen durchlaufen die drei Bereiche Ent-
Schulstufe 7 wicklung, Herstellung und Reflexion. Während sie zu Be-
ginn konstruktiv entwickelnd tätig sind (Erarbeitung einer
Dauer: Clock Clock Clock Clock Clock
Programmierung zu einer Spielidee, Skizze des Gehäuses),
5 Doppelstunden
müssen die Schüler*innen im nächsten Schritt den H eißen
Schwierigkeitsgrad: Draht anhand ihrer Konstruktionsunterlagen fertigen. Ab-
1–2 Sterne (Es ist keine Vorbereitung notwendig.) schließend erfolgt eine reflexive Bewertung, die in eine
LP Technik und Design Adaption bzw. in eine neue Fragestellung überführen kann.
Energie · Elektrizität · Elektronik / Produkt · Objekt · Spiel Lernziel / Kompetenzen
LP Technisches und textiles Werken Die Zielsetzung dieser Unterrichtseinheit deckt folgende
Technik Punkte ab:
• Konstruktionsunterlagen (Programmierung, Skizzen
des Gehäuses) unter der Nutzung der Simulation
Die Schüler*innen können, ausgehend von der Problem- makecode.org erstellen,
stellung „Der Heiße Draht soll mit einem Mikrocontroller • Maschinen und Werkzeuge fachgerecht bedienen (inkl.
erweitert werden“, ein Spiel aus Holz / Kunststoff / Me- Sicherheitsaspekte),
tall unter Verwendung eines Mikrocontrollers (bzw. auch • Arbeitsverfahren fachgerecht anwenden,
mit elektronischen Bauteilen) planen und herstellen. • Produkte und Prozesse durch Nutzung der Bewertungs-
Beim Heißen Draht handelt es sich um ein Geschicklich- kriterien reflektieren,
keitsspiel, bei dem eine Drahtöse so schnell wie möglich • grundlegende Eigenschaften von Mikrocontrollern mit
über einen gebogenen Draht geführt werden soll, ohne Schwerpunkt micro:bit verstehen,
mit der Öse den Draht zu berühren. Andernfalls wird ein • grundlegende Kenntnisse zu EVA (Eingabe,
Stromkreis durch die Verbindung Öse–Draht geschlossen Verarbeitung, Ausgabe) erlangen.
und es erfolgt ein Ton- und / oder Lichtsignal.
Praxishandbuch Technik · Design · Werken Der Heiße Draht•Seite 1 von 4V01/23 2 Energie · Elektrizität · Elektronik
4 Produkt · Objekt · Spiel
Differenzierung / Unterrichtsmethode Dunkelschaltung, Blinklichtschaltung und die Verarbeitung
Durch die offene Aufgabenstellung eignet sich das Projekt mittels Mikrocontroller). Falls die Schüler*innen noch keine
sowohl für Anfänger*innen als auch für Fortgeschrittene. Vorerfahrungen mitbringen, bietet es sich an, erste einfache
Differenzierungsmöglichkeiten: Versuche mit dem micro:bit voranzuschalten (siehe hierzu
• Bei dieser Konstruktionsaufgabe kann ein älteres Heißes- Literaturtipps oder das Forum der Programmieroberfläche).
Draht-Modell als Ausgangslage upgecyclet werden.
Im zweiten Unterrichtsblock wird die Aufgabenstellung
• Weitere Möglichkeiten zur Differenzierung bieten sich in
bekannt gegeben. Die Schüler*innen sollen eine Spiel-
der mehr oder weniger ausführlichen Spielidee z. B. auf
idee zum Heißen Draht mithilfe des micro:bits planen.
Grundlage der Programmierung, aber auch durch den
Dazu werden erste Ideen verbal formuliert und danach mit
Einsatz externer elektronischer Bauteile (Lautsprecher,
der Oberfläche makecode.org programmiert. Die Entwürfe
Schalter etc.) oder in einer Reduktion auf eine reine
können auf der Programmieroberfläche bereits simuliert
Fertigungsumsetzung (Programmierung nach Vorgabe).
werden.
Fächerübergreifende Aspekte
In den nächsten beiden Unterrichtsstunden werden die
Es werden fachübergreifende Perspektiven (hier: „Digitale
Entwürfe fertig ausgearbeitet und ein passendes Gehäuse
Grundbildung“) mit eingeflochten, um den Schüler*innen
für den Heißen Draht konstruiert.
Unterschiede und Gemeinsamkeiten digitaler und ana-
loger Verfahren zu verdeutlichen. Dies zielt auch auf eine Die Unterrichtsstunden 7 und 8 dienen der Fertigstel-
zukünftige Berufs- und Lebensorientierung ab. lung des Werkstücks unter ständiger Erprobung der Pro-
grammierung und Verbindung zum Mikrocontroller. Die
Übergreifende Themen: Informatische Bildung, B
ildungs-,
Fertigungsverfahren zum Bearbeiten von Holz, Metall und
Berufs- und Lebensorientierung
Kunststoff (Trennen: Sägen, Bohren; Fügen: Schrauben,
Kleben; ggf. Umformen: Biegen) stehen im Fokus und wer-
den ergänzt durch das Verarbeiten elektrotechnischer Bau-
teile (bspw. externer Lautsprecher, Schalter).
Unterrichtsverlauf Die letzten beiden Unterrichtsstunden dienen der Fer-
Die ersten beiden Unterrichtsstunden zielen darauf ab, tigung und Reflexion der Werkstücke. Um die Ergeb-
eine Einführung in das Themenfeld Informationstechnik zu nisse und den Arbeitsprozess zu reflektieren (Reflexion,
geben. Dazu bieten sich Versuche mit dem micro:bit und Selbst- und Fremdbeurteilung), bietet es sich an, die von
mit LEDs an, um die Programmieroberfläche (makecode. den S chüler*innen erarbeiteten Ergebnisse mittels auf-
org) kennenzulernen. Außerdem können hierbei die Ge- bereiteten Unterrichtssettings bewerten zu lassen. So
meinsamkeiten und Unterschiede zwischen analoger können sowohl die Spielidee und das Gehäuse als auch
und d igitaler Technik erklärt werden (bspw. elektronische die Programmierung selbst besprochen werden.
Abb. 1 | Mögliche Schüler*innenentwürfe mittels makecode.org (verschiedene Niveaus mit und ohne Einbindung weiterer elektrischer Stromkreise)
Praxishandbuch Technik · Design · Werken Der Heiße Draht•Seite 2 von 4V01/23 2 Energie · Elektrizität · Elektronik
4 Produkt · Objekt · Spiel
Unterrichtsverlauf tabellarisch
Die folgende Tabelle gibt einen detaillierten Überblick über den Unterrichtsverlauf mit möglichen Lernprodukten und Ziel-
stellungen der Unterrichtsstunden:
Unterrichtsstunde Thematische Gliederung Lernprodukte
1. / 2. Stunde Einführung & Ampelsteuerung Versuchsanordnung mit micro:bit
3. / 4. Stunde Spielidee & Programmierung I Konstruktionsunterlagen
5. / 6. Stunde Programmierung II & Konstruktion Konstruktionsunterlagen
(Herstellung) des Gehäuses
7. / 8. Stunde Herstellung & Erprobung Werkstück
9. / 10. Stunde Herstellung & Bewertung Werkstück & Reflexionsbogen
Tab. 1 | Systematischer Unterrichtsverlauf am Beispiel des Heißen Drahts
Beispielhafte Bewertungskriterien
Für die Unterrichtseinheit können folgende Bewertungskriterien herangezogen werden:
Kontroll- und Beurteilungsbogen (Heißer Draht)
Bewertungskriterien Maximale Erreichte
Punktzahl Punktzahl
Spielfunktion: Ausgefallenheit des Spiels (Spielfreude, Klarheit der Spiel-
3
funktionen, unterschiedliche Spielschwierigkeiten)
Hardware (Spielkonstruktion): Qualität der Verarbeitung des Gehäuses, Design
2
des Gehäuses, einfache Möglichkeit zum Reparieren bzw. Batteriewechsel
Programmierung: Übersicht und Verständlichkeit der Programmierung
2
(Hex-Datei mit Erklärungen), Einfachheit der Programmierung
Dokumentation der Arbeitsunterlagen: Genauigkeit der Arbeitsunterlagen,
2
Skizze des Gehäuses, Vollständigkeit der Unterlagen
Reflexion 1
Tab. 2 | Mögliche Bewertungskriterien
Praxistipp Berufsorientierung
Falls vorhanden, können alte Bauteile und / oder Den Code für die Programmierung zu erstellen hat
alte Werkstücke des Heißen Drahts upgecycelt dich begeistert? Dann schnuppere doch einfach
werden. einmal in das breite Berufsfeld der INFOR M ATIK
hinein. Vielleicht ist hier dein Traumjob versteckt!
Dir den Schaltplan zu überlegen und die Platine mit
den Drähten zu verbinden hat dein Interesse ge-
weckt? Als E LE K TRONIK E R * IN gehören Leiterplatten
und digitale Steuerungen zu deiner täglichen Arbeit.
Erkunde doch einfach einmal in dieses spannende
Berufsfeld, denn Elektroniker*innen stehen von der
E NE R G IE - bis zur B IOM E D IZ INTE C H NIK viele Wege
Literatur & Links
Hagan, E. (2019): Easy micro:bit Projects. O’Reilly Media.
offen.
Weiterführende Information:
Für interessierte Pädagog*innen ohne Vorerfahrung bietet sich eine Fort- ȅ bic.at
bildung / Einschulung an oder für das Selbststudium folgende Literatur- ȅ ausbildungskompass.at
vorschläge: Loton, T. (2016). Micro:Bit Basics (englisch) & Kainka, B.
(2016). Micro:bit Praktikum (deutsch).
ȅ jopsy.at
Praxishandbuch Technik · Design · Werken Der Heiße Draht•Seite 3 von 4V01/23 2 Energie · Elektrizität · Elektronik
4 Produkt · Objekt · Spiel
Ergebnisse in Bildern
Abb. 1–2 | Beispielgehäuse „Heißer Draht“ einer Schülerin
Heißer Draht
Start Ziel
Handstück
Summer
Abb. 3 | Mögliches Anschlussschema zwischen micro:bit & Heißer Draht und einem zusätzlichen Summer
Bildquellen
Alle Abbildungen: © Leah Camilla Rusch
Tabellen 1 und 2: © Sebastian Goreth
Praxishandbuch Technik · Design · Werken Der Heiße Draht•Seite 4 von 4Testimonial
Eine Karriere bei der
Berndorf AG
© Berndorf AG / Christian Husar
Wer bist du
und was machst
du beruflich?
Mein Name ist Franz
Viehböck und ich bin
Vorstandsvorsitzender
der Berndorf AG. Ich
arbeite seit 20 Jahren
bei der Firma Berndorf
in Berndorf und bin seit
13 Jahren Vorstand.
Davor war ich acht
Jahre bei der Firma
Boeing, die im Welt-
Was ist das
raumgeschäft tätig ist, Besondere an deinem
und ich bin bisher der Unternehmen?
einzige Österreicher,
der im Weltraum war. Die Berndorf AG besteht aus mehreren klei-
nen bzw. mittelständischen Unternehmen,
die in der Metallbranche tätig sind. Wesent-
liche Aspekte sind Technologieentwicklung,
Forschung, Innovation und Engineering. Wir
sind ein globales Unternehmen mit welt-
weiten Niederlassungen, um unsere Kunden
bestmöglich zu bedienen. Die Unternehmen
der Berndorf Gruppe bauen auf Trans-
parenz, Ehrlichkeit und gegenseitigen
© Berndorf AG
Respekt. Der offene Umgang zwischen
Führungskräften und Mitarbeiter*innen
sowie eine lösungsorientierte Fehlerkultur
fördern den Dialog und motivieren dazu,
Verantwortung zu übernehmen und Initiative
zu ergreifen.
Praxishandbuch Technik · Design · Werken© Berndorf AG
Was erwartet junge Mitarbeiter*innen
in deinem Unternehmen?
Unsere Unternehmenskultur ist sehr an unseren Mit-
arbeiter*innen orientiert, denen wir auch verschiedene Weiter-
entwicklungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten bieten (talents@
berndorf, Berndorf Academy). Unsere Mitarbeiter*innen
genießen das familiäre und gute Arbeitsklima. Durch die
weltweiten Niederlassungen ergeben sich immer wieder gute
Möglichkeiten einer Auslandstätigkeit. Die spannenden For-
schungs- und Innovationsprojekte bieten genügend Gelegenheit
sich mit guten Ideen zu verwirklichen.
Was hat das alles Folgende Lehrberufe kannst du bei uns erlernen:
mit dem Schulfach Elektrotechniker*in, Industriekaufmann / frau, Konstrukteur*in,
„Technik und Metalltechniker*in, Prozesstechniker*in, Werkstofftechniker*in.
Design“ zu tun? Bist du Absolvent*in einer HTL oder HAK, einer Technischen
Universität, Wirtschaftsuniversität, Fachhochschule oder der
Das Schulfach „Technik Montanuniversität Leoben, dann bewirb dich bei uns und werde
und Design“ bildet die auch du ein Teil der Berndorf-Familie.
Grundlage für einen
möglichen späteren
Beruf in einem unserer
Unternehmen, in
denen handwerkliches
Geschick, technisches Welche Tipps kannst du mir
Verständnis und Freude für meine Berufswahl geben?
am Job gebraucht wird.
Nicht aufs Geld schauen, sondern den Job aus-
wählen, der Spaß macht!
Firmenportrait
Firmenbezeichnung Berndorf AG
Standorte (national / In 20 Ländern in Europa, USA und Asien aktiv
international)
Mitarbeiter*innenzahl 2.180 Mitarbeiter*innen
Was macht das Wir, die Berndorf AG, sind eine global agierende Unternehmensgruppe be-
Unternehmen? stehend aus mittelständischen Firmen in Nischenmärkten. Unsere Unter-
nehmen sind im Bereich der Metallverarbeitung, des Werkzeugbaus und des
Maschinenbaus tätig und erzielen über 90 % des Konzernumsatzes durch
Auslands- und Exportumsätze. Neben weltweiten Niederlassungen liegen
die Hauptfirmensitze unserer Unternehmen in Österreich und Deutschland.
ȅ www.berndorf.at
Praxishandbuch Technik · Design · WerkenV01/23 2 Energie · Elektrizität · Elektronik
4 Produkt · Objekt · Spiel
»alea iacta est«
Würfeln analog / digital
Katrin Proprentner • Pädagogische Hochschule Oberösterreich • katrin.proprentner@ph-ooe.at
2
Das hier vorgestellte Unterrichtsbeispiel beruht auf der Idee, einen analog
funktionierenden Würfel mittels Mikrocontroller digital zu erweitern.
rweiterungsmöglichkeit und den damit verbundenen
E
Zielgruppe Handlungsbedarf.
Schulstufe 7 und 8 (Phase 1 ab Schulstufe 5)
Lernziel / Kompetenzen
Dauer: Clock Clock Clock Die Schüler*innen reflektieren über ihr mathematisches
mindestens drei Doppelstunden Wissen in Bezug auf das Netz eines Körpers. Sie ent-
wickeln Ideen und persönliche Lösungswege, um einen
Schwierigkeitsgrad:
Würfel aus zwei Teilen zu konstruieren. Beim Herstellungs-
2–3 Sterne (je nach Unterrichtsmethode)
prozess werden die möglichen Entwürfe umgesetzt. Dabei
LP Technik und Design wird schon vorhandenes Wissen über die Eigenschaften
Energie · Elektrizität · Elektronik / Produkt · Objekt · Spiel von Karton und dessen Verarbeitung angewendet. In einer
zweiten Reflexionsphase wird der Kontext zur Digitalisie-
LP Technisches und textiles Werken
rung hergestellt.
Körper / Technik
Differenzierung / Unterrichtsmethode
Differenzierungsmöglichkeiten ergeben sich in der Wahl der
Gebaut wird ein Würfel aus Karton im Ausmaß 8 × 8 cm, Unterrichtsmethoden. Hier kann zwischen Fertigungsauf-
der sich in zwei Teile zerlegen lässt. Mit diesem Wür- gabe, Konstruktionsaufgabe oder Demontage gewählt werden.
fel soll analog eine Zahl von 1–6 gewürfelt werden. In Bei der Fertigungsaufgabe wird von der Lehrperson das
einem Teil des Würfels wird ein Schalter eingebaut. Die- Netz des Würfels sowie der Schalter vorgegeben. Auch das
ser kann mittels des Mikrocontrollers „MaKey MaKey“ Skript für den Programmierteil in „Scratch“ wird reflexiv be-
mit dem PC verbunden werden. Die Programmiersprache arbeitet.
„Scratch“ dient der Programmierung eines Würfels. Der Die Konstruktionsaufgabe fordert von den Schüler*innen
Schalter im Würfel löst das Programm aus. problemlösendes Denken und Handeln in Bezug auf die
Aufgabenstellung.
Dimensionen der Handlungsorientierung Bei der Demontage kann die Lehrperson verschiedene
Die Aufgabenstellung „Würfeln analog / digital“ soll vor- Möglichkeiten eines zweiteiligen Würfels bereitstellen.
handenes Wissen der Schüler*innen aktivieren und neue Durch dessen Demontage soll das Netz des Würfels aus
Aspekte hinzufügen. Neben der Herstellung eines zwei- zwei Teilen ermittelt werden. Das Skript wird in seine Teile
teiligen Würfels geht es vor allem auch um die d igitale zerlegt und, vom Ende aus, erarbeitet.
Praxishandbuch Technik · Design · Werken »alea iacta est«•Seite 1 von 4V01/23 2 Energie · Elektrizität · Elektronik
4 Produkt · Objekt · Spiel
Fächerübergreifende Aspekte Phase 3
Fächerübergreifend sollten bei dieser Aufgabe auf jeden Programmierung eines Würfels in „Scratch“ und an-
Fall die Fächer „Mathematik“, „Geometrisches Zeichnen“ schließend des „MaKey MaKey“, um mittels Schalter das
und „Informatik“ eingebunden werden. So kann z. B. die ›
Würfelprogramm auszulösen ( Abb. 8–9)
Auseinandersetzung mit dem Programm „Scratch“ in den
Kompetenzen für diese Phase
Fächern „Informatik“ und „Digitale Grundbildung“ auf-
• Objektorientierte Programmiersprache mit dem
gegriffen werden.
Programm „Scratch“ anwenden,
• gebauten Schalter mit dem „MaKey MaKey“ verbinden,
• Programmieren des Skripts in „Scratch“.
Material / Werkzeug
Unterrichtsverlauf • Computer mit Internetzugang
Der Unterrichtsverlauf besteht aus drei Phasen. Er wird zur • „MaKey MaKey“
Gänze mit der App „TuD“ von Thomas Stuber (http://tud.ch) • Programm „Scratch“
dokumentiert. ›
• gebauter Würfel ( Abb. 7)
Phase 1
Bau eines Würfels aus Karton, der sich in zwei Teile zer- Praxistipp: Was ist ein „MaKey MaKey“?
›
legen lässt ( Abb. 1–5)
Kompetenzen für diese Phase „MaKey MaKey“ (https: // makeymakey.com / ) ist
• Räumliche Vorstellung des Netzes der beiden Würfel- eine kleine Platine, mit der sich leitfähige O
bjekte
teile als Skizze aufs Papier bringen, in Computertasten umwandeln lassen. Die Plati-
• mit der Lehrperson den Entwurf besprechen, ne ist ein vorprogrammierter Arduino-kompatibler
• materialsparendes Aufzeichnen, Mikrocontroller, der sich gegenüber dem Compu-
• Umgang mit dem Geodreieck und Bleistift, ter als Tastatur ausgibt. Tastaturanschläge, Maus-
• genaues Messen, klicks und Mausbewegungen lassen sich damit
• exaktes Schneiden und Kleben, senden (vgl. Hielscher / Döbeli, S.11).
• Karton mit dem Schneidemesser für eine saubere
Faltkante anritzen.
Material / Werkzeug
• Diverser Karton Format A3 Berufsorientierung
• Geodreieck
• Bleistift
Das Programmieren des Würfels hat dir Spaß ge-
• Schneidemesser
macht? Vielleicht ist eine Karriere als S OFTWA R E-
• Schneideunterlage
D E S IG NE R * IN eine spannende Herausforderung für
• Klebstoff
dich. Oder würdest du gerne die Anwendungs- und
• Falzbein
Benutzerfreundlichkeit von Geräten analysieren?
Dann ist ein Job als U S A B ILITY E NG INE E R vielleicht
Phase 2
genau das Richtige für dich.
Wiederholung der Grundlagen des Stromkreises und Ein-
›
bau eines „Schalters“ in eine Hälfte des Würfels ( Abb. 6) Du möchtest gerne mehr über die Herstellung von
Papier und Karton erfahren? Schnuppere doch ein-
Kompetenzen für diese Phase
mal in den Beruf PA P IE R TE C H NIK hinein! Im Beitrag
• Grundlagen des Stromkreises (Verbraucher, Schalter,
Stromquelle), › Betriebserkundungen im Bereich Inspirationen
findest du einen spannenden Testimonialbeitrag
• Verstehen, wie ein Schalter funktioniert,
zur Ausbildung als Papiertechniker*in.
• Einbau des Schalters in eine Hälfte des gebauten
Würfels.
Material / Werkzeug ȅ bic.at
• Krokoklemmen ȅ ausbildungskompass.at
• 9V-Batterie ȅ jopsy.at
• Lämpchen
• Alufolie
• Selbstklebendes Kupferband
• Karton Literatur & Links
• Filz Hielscher, M./Döbeli Honegger, B.: MaKey MaKey Projektideen, Pädago-
• Kleber gische Hochschule Schwyz, 22. April 2019, Creative Commons Lizenz,
http://ilearnit.ch/download/MakeyMakeyProjektideen.pdf, letzter Zu-
• Schere
griff 07.06.2021.
Lehrplan „Technisches und Textiles Werken“: Bundesgesetzblatt für die
Republik Österreich, Jahrgang 2017, 29. November 2017, 337. Ver-
ordnung.
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2017_II_337/
BGBLA_2017_II_337.pdfsig, letzter Zugriff am 07.06.2021 (Lehrplan)
Praxishandbuch Technik · Design · Werken »alea iacta est«•Seite 2 von 4Sie können auch lesen