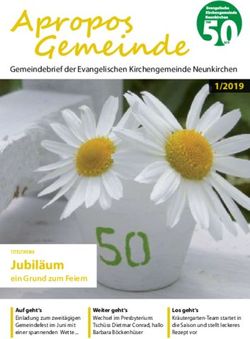TFBS für Fotografie, Optik und Hörakustik mit Internat und private HTL für Optometrie - Landesrechnungshof
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Landesrechnungshof
TFBS für Fotografie, Optik
und Hörakustik mit Internat
und private HTL für Optometrie
Tiroler LandtagAbkürzungsverzeichnis Abs. Absatz BGBl. Bundesgesetzblatt BSchOG Berufsschulorganisationsgesetz d.h. das heißt EStG Einkommensteuergesetz FAG Finanzausgleichsgesetz LGBl. Landesgesetzblatt LKA Landes-Kontrollamt LRH Landesrechnungshof LRHD Landesrechnungshofdirektor rd. rund SchOG Schulorganisationsgesetz TFBS Tiroler Fachberufsschule z.T. zum Teil Auskünfte Landesrechnungshof A-6010 Innsbruck, Eduard-Wallnöfer-Platz 3 Telefon: 0512/508-3030 Fax: 0512/508-3035 E-mail: landesrechnungshof@tirol.gv.at Erstellt: Februar bis März Herstellung: Landesrechnungshof Redaktion: Landesrechnungshof Herausgegeben: 24.5.2004, Zl. AN-0113/2
Inhaltsverzeichnis 1. Vorbemerkungen ......................................................................................................1 2. Organisatorische Grundlagen ...................................................................................1 3. Berufsschule ............................................................................................................6 4. Berufsschülerheim ..................................................................................................11 5. Private HTL des Landes - Kolleg für Optometrie .....................................................19 6. Buchhaltung, Inventar .............................................................................................23 7. Gebarung ...............................................................................................................24 7.1 Übersicht ...........................................................................................................24 7.2 Kostenträgerschaft.............................................................................................27 7.3 Sonstige Feststellungen.....................................................................................34 8. Schlussbemerkungen .............................................................................................36 Anhang Stellungnahme der Regierung
Bericht
über die TFBS für Fotografie, Optik
und Hörakustik mit Internat
und die private HTL für Optometrie
1. Vorbemerkungen
Im Jahr 1988 hatte das LKA letztmalig eine Einschau in die Ge-
barung der Landesberufsschule für Optiker und Fotografen vor-
genommen. Einzelne Bereiche wurden auch anlässlich der
Querschnittsprüfung bei den Landesberufsschülerheimen Tirols
im Jahr 1998 berührt. Nach inzwischen eingetretenen perso-
nellen und organisatorischen Veränderungen hielt es der LRH für
angebracht, die Gebarung der in Hall, Kaiser-Max-Strasse 11,
untergebrachten Schulen samt dem angeschlossenen Schüler-
heim wiederum zu überprüfen.
Prüfauftrag Zwei Prüforgane haben über Auftrag des LRHD in der Zeit vom
26.2. - 3.3.2004 an Ort und Stelle Einsicht in die Gebarungs-
unterlagen genommen. Den Prüfern standen die Buchhaltungs-
aufzeichnungen samt Belegen, die Schülerstatistik und sonstige
Unterlagen der Schulverwaltung zur Verfügung. Einzelne Erhe-
bungen wurden bei der Abteilung Landwirtschaftliches Schul-
wesen und der Abteilung Bildung des Amtes der Landes-
regierung durchgeführt. Die Angelegenheiten der berufsbilden-
den Pflichtschulen und Berufsschülerheime fallen seit Oktober
2003 in die Ressortzuständigkeit von LHStv. Ferdinand Eberle.
Über das Ergebnis der Überprüfung wird folgender Bericht er-
stellt:
2. Organisatorische Grundlagen
Gebäude In den Jahren 1977 - 1979 hat das Land Tirol auf dem 9.903 m²
großen, landeseigenen Grundstück in Hall, Kaiser–Max-Straße
11, einen Schulneubau mit Internat errichtet.2. Organisatorische Grundlagen
Das Schulgebäude wurde 2-geschossig konzipiert und umfasste
ursprünglich sieben Klassenräume mit den entsprechenden
Praxisräumen, Werkstätten, Laboratorien und Lagerräumlich-
keiten. Im Jahre 1999 erfolgte ein Zubau durch teilweise Auf-
stockung des Schultraktes mit weiteren fünf Unterrichts- und
Praxisräumen. Die räumliche und gerätemäßige Ausstattung der
Schule steht auf einem hohen Niveau und entspricht voll den ge-
stellten Anforderungen.
Das Internatsgebäude ist baulich mit dem Schulgebäude verbun-
den und umfasst sechs Geschoße. Das Kellergeschoß beher-
bergt neben den Heizungs- und Technikräumen auch Lager- und
Werkräume (für HTL) und Freizeiträume (Fitness). Im Parterre
befinden sich Räume für die Direktion und Verwaltung, Konfe-
renz- und Lehrerzimmer, ein Aufenthaltsraum sowie Küche und
Speisesaal. Auch eine Hausmeisterwohnung liegt in diesem
Gebäudeteil. Die Stockwerke 1 - 4 beherbergen je elf Zimmer mit
drei oder vier Betten, einen Aufenthaltsraum und ein oder zwei
Erzieherzimmer. Nach 25-jähriger Nutzung befindet sich der
Internatstrakt in einem teilweise sehr abgewohnten Zustand. Die
Sanitäreinheiten aller Stockwerke wurden im letzten Jahr er-
neuert. Viele Internatszimmer bedürfen aber dringend einer
Sanierung. Insbesondere der Zustand der Teppichböden und
Wandtapeten im 1. Stock ist nicht mehr zumutbar.
Stellungnahme Die zuständige Fachabteilung (Abteilung Landwirtschaftliches Schul-
der Regierung wesen) ist in Kenntnis, dass sich der Internatstrakt in einem teil-
weisen sehr abgewohnten Zustand befindet. Mit der Sanierung der
sanitären Anlagen wurde bereits begonnen. Anschließend ist beab-
sichtigt, das Internat stockwerksweise zu sanieren.
22. Organisatorische Grundlagen
Im hinteren Grundstücksbereich situiert und durch einen Gang
verbunden befindet sich ein Turnsaal. Dieser wird weder von der
Schule noch vom Heim genutzt. Der Turnsaal findet seine aus-
schließliche Benutzung durch die nahe gelegene Handels-
akademie (32 Unterrichtsstunden pro Woche) und durch örtliche
Vereine während der Abendstunden.
Berufsschule Es erhalten an dieser Schule die Lehrlinge der Lehrberufe Foto-
grafen und Augenoptiker/Feinoptiker ihre schulische Ausbildung.
Seit rd. sechs Jahren werden auch die Schüler des neuen Lehr-
berufes Hörgeräteakustiker hier ausgebildet.
Die Berufsschule wird lehrgangsmäßig mit vier Lehrgängen zu je
9 1/3 bzw. 10 Wochen pro Schuljahr geführt und seit 1.1.2002
von Herrn Berufsschuldirektor Ing. Markus RAINER geleitet.
Die Optikerschule gilt als einzige Ausbildungsstätte für alle
Bundesländer mit Ausnahme von Wien. Bei den Fotografen be-
schränkt sich der Einzugsbereich auf die Bundesländer Tirol,
Vorarlberg, Salzburg und Niederösterreich. Für die Hörgeräte-
akustiker ist es die einzige Ausbildungsstätte in Österreich. Süd-
tiroler Lehrlinge können die Schule ebenfalls besuchen.
Berufsschülerheim Das Berufsschülerheim bietet in 43 Zimmern zu je drei oder vier
Betten 153 Lehrlingen Unterkunft. Heimplätze, die von der TFBS
für Fotografie, Optik und Hörakustik nicht belegt werden können,
werden durch Schüler der TFBS für Bautechnik und Male-
rei/Absam und die TFBS Thurnfeld/Hall genutzt. Schüler der pri-
vaten HTL, Kolleg für Optometrie, welche ebenfalls im Haus be-
schult werden, nehmen keine Heimplätze in Anspruch, sondern
wohnen ausnahmslos in Privatquartieren der Umgebung.
Die Heimleitung übt der Berufsschuldirektor im Rahmen einer
Nebentätigkeit aus. Diesbezüglich hat die Landesregierung zu-
letzt am 9.3.1999 eine Erhöhung der Entschädigung für die fünf
betroffenen Berufsschuldirektoren beschlossen. Seit 1.1.1999
erhält der Berufsschuldirektor der geprüften Einrichtung für die
zusätzliche Tätigkeit € 640,32 zwölfmal jährlich.
Private HTL für Seit 1981 wurde an der Berufsschule auch eine Meisterklasse für
Optometrie Augenoptik und Kontaktlinsenoptik geführt. Im Jahr 1993 führte
eine Änderung der Organisation dieser Ausbildung zur Gründung
der „Privaten höheren technischen Lehranstalt des Landes Tirol,
32. Organisatorische Grundlagen
Kolleg für Optometrie“, welche in einem einsemestrigen
Vorbereitungslehrgang und einem viersemestrigen Aufbau-
lehrgang zur Meisterprüfung und Reifeprüfung führt. Die Schule
wird einzügig, jedes zweite Jahr beginnend, geführt, sodass sich
organisatorisch eine Klasse und jedes zweite Jahr eine Klasse
und ein einsemestriger Vorbereitungslehrgang ergibt. Die Schule
wird mit Genehmigung des entsprechenden Lehrplanes durch
das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur als
Schulversuch nach dem Schulorganisationsgesetz, BGBl.
1962/242 idgF, geführt. Das Öffentlichkeitsrecht wurde der
Schule nach dem Privatschulgesetz, BGBl. 1962/244 idgF, je-
weils befristet auf zwei Jahre, verliehen.
Die private HTL wurde bis zum 31.12.2003 vom früheren Berufs-
schuldirektor Ferdinand Thöny geleitet. Ab 1.1.2004 ist der Direk-
tor der TFBS für Fotografie, Optik und Hörakustik Ing. Markus
RAINER auch mit der Leitung der privaten HTL betraut.
Beschäftigte Entsprechend der Gliederung in Schule und Heim finden am
Standort Hall, Kaiser-Max-Straße 11, 65 Beschäftigte ihren
Arbeitsplatz. Dabei sind die Beschäftigten je nach ihrer Tätigkeit
bei drei verschiedenen Dienstgebern angestellt:
Beschäftigte
Anzahl Bezeichnung Dienstgeber Tätigkeitsbereich
23 BS-Lehrer Land Tirol BS
17 HTL-Lehrer Bund HTL
9 ErzieherInnen Land Tirol Heim
2 Sekretärinnen Land Tirol BS, HTL, Heim
1 Schulwart Stadt Hall BS, HTL, Heim
6 Küchenpersonal Stadt Hall Heim
10 Reinigungspers. Stadt Hall BS, HTL, Heim
65 Gesamt (davon drei Lehrer BS und HTL)
Die Dienstgeberfunktion für das Land Tirol übt bei den Landes-
lehrern (Berufsschullehrer) die Abteilung Bildung des Amtes der
Landesregierung aus. Für die Bundeslehrer (HTL-Lehrer) stellt
der Landesschulrat für Tirol die Dienstbehörde dar. Die
42. Organisatorische Grundlagen
Verwaltungsbediensteten (Sekretärinnen) und die Erzieher und
Erzieherinnen des Berufsschülerheimes werden dienstrechtlich
durch die Abteilung Personal des Amtes der Landesregierung
betreut. Das Hilfspersonal (Schulwart, Reinigungspersonal,
Küchenpersonal) wird entsprechend dem BSchOG von der
Standortgemeinde Hall angestellt. Die Stadtgemeinde Hall hat
jedoch dem Land gegenüber Anspruch auf Ersatz der anfallen-
den Personalkosten.
Kostentragung Das Land Tirol gilt als gesetzlicher Berufsschul- und Heimer-
halter. Die Schulerhaltungskosten umfassen den Investitions-
und Betriebsaufwand und sind vom Land zu tragen. Gegenüber
den beitragspflichtigen Gebietskörperschaften (Gemeinden) hat
jedoch das Land Anspruch auf Investitions- und Betriebsbeiträge.
Diese werden den Gemeinden vom Amt der Landesregierung
jährlich vorgeschrieben.
Die Heimerhaltungskosten umfassen ebenfalls Investitions- und
Betriebsaufwand. Gegenüber den Gemeinden können jedoch nur
Investitionsbeiträge geltend gemacht werden. Anstelle von
Betriebsbeiträgen der Gemeinden sind für die Unterbringung,
Verpflegung und Betreuung eines Berufsschülers im Schülerheim
vom Unterhaltspflichtigen Heimkostenbeiträge in höchstens
kostendeckender Höhe zu verlangen. Die Heimkostenbeiträge
sind von der Schulleitung selbst einzuheben.
Die HTL für Optometrie ist eine Privatschule des Landes Tirol.
Für die inländischen Schüler leistet die Bundesinnung der Opti-
ker ein Schulgeld in Höhe des „Kuchler Beitrages“. Ausländische
Schüler haben das Schulgeld selbst zu bezahlen.
53. Berufsschule
3. Berufsschule
Ausbildungsdauer Die Ausbildungsdauer der erstgenannten Lehrberufe Augen-
optiker/Feinoptiker und Fotografen beträgt jeweils dreieinhalb
Jahre, während für die Ausbildung im Lehrberuf Hörgeräte-
akustiker drei Jahre vorgesehen sind. Die Berufsschulzeit ist mit
3 x 10 bzw. 9,33 Wochen festgesetzt.
Die Ausbildungsdauer der Doppellehre Augenoptiker und
Hörgeräteakustiker beträgt vier Jahre, die Berufsschulzeit 4 x
9,33 Wochen. Die Ausbildung zum Hörgeräteakustiker ist relativ
neu, die entsprechende Ausbildungsordnung wurde mit BGBl.
1995/609 kundgemacht.
Die TFBS ist lehrgangsmäßig organisiert, d.h. es werden pro
Schuljahr vier Lehrgänge geführt. Die jährliche Lehrgangsein-
teilung erfolgt nach Anhören des Landesschulrates für Tirol mit-
tels Verordnung der Landesregierung. Für die geprüfte TFBS hat
die Landesregierung im laufenden Unterrichtsjahr 2003/04 fol-
gende Lehrgangseinteilung festgesetzt:
1. Lehrgang: 8.9. - 15.11.2003
2. Lehrgang: 17.11.2003 - 7.2.2004
3. Lehrgang: 16.2. - 1.5.2004
4. Lehrgang: 3.5. - 10.7.2004
63. Berufsschule
Diese Einteilung gilt für die 10-wöchigen Lehrgänge, die 9,33-
wöchigen enden einige Tage früher. Einzelne Lehrgänge sind
durch bestimmte Ferien (Weihnachten, Ostern) unterbrochen,
einzelne Samstage wurden als Heimfahrsamstage gegen Ein-
bringung der hierdurch entfallenden Unterrichtstunden für schul-
frei erklärt.
Klassen- und Die statistischen Meldungen der Schule für die letzten drei
Schüleranzahl Schuljahre wiesen folgende Klassen- und Schülerzahlen aus:
Übersicht
Schuljahr 2000/01 Schuljahr 2001/02 Schuljahr 2002/03
Klassen Schüler Klassen Schüler Klassen Schüler
Optiker 11 378 13 397 13 374
Fotografen 3 57 3 73 3 62
Hörgeräteakustiker 3 14 2 9 3 19
Doppellehre 2 38 2 32 4 50
Summe 17 487 18 511 20 505
Infolge geringer Schülerzahlen wurden die Lehrlinge des Lehr-
berufes Hörgeräteakustiker mit jenen, die eine Doppellehre
absolvieren, in Klassen derselben Schulstufe zusammengefasst.
In den letzten drei Schuljahren wurden je Lehrgang durchwegs
vier oder fünf Klassen mit durchschnittlich 125 Schülern geführt.
Feststellung Die Schülerzahlen sind bei den Optikern am höchsten. Der LRH
stellte fest, dass die Klassenschülerzahlen im Beobachtungs-
zeitraum mehrmals zwischen 30 und 36 Schülern lagen. Die
durchschnittliche Klassenschülerzahl hat sich allerdings von 34,4
Schülern im Schuljahr 2000/01 auf 28,8 Schülern im Schuljahr
2002/03 deutlich verringert, was insbesondere auf die höhere
Klassenanzahl zurückzuführen ist.
Stellungnahme Die Überschreitung der Klassenschülerhöchstzahl in mehreren Klas-
der Regierung sen im Schuljahr 2000/2001 hatte darin ihren Grund, dass die räum-
liche Erweiterung der Schule noch nicht abgeschlossen war. Eine
entsprechende Genehmigung der zuständigen Fachabteilung lag
jeweils vor. Seither wird auf die Einhaltung der Klassenschüler-
höchstzahl besonders geachtet.
73. Berufsschule
Die Überschreitung der Schülerhöchstzahl von 30 Schülern in
einer Klasse auf bis zu 36 ist gem. § 10 Abs. 1 iVm § 15 Abs. 1
lit. e und Abs. 2 BSchOG möglich, wenn dies aus räumlichen
Gründen notwendig ist. Die Klassenanzahl mit durchwegs 34 bis
36 Schülern, wie dies im Schuljahr 2000/01 in zehn von elf Klas-
sen erfolgte, mag zwar in der Einsparung von zwei bis drei Klas-
sen begründet sein, sollte allerdings nach Ansicht des LRH ins-
besondere aus pädagogischen Gründen doch eher die Aus-
nahme als die Regel sein.
Deutlich geringer sind hingegen die Klassenschülerzahlen bei
den anderen Lehrberufen. Bei den Fotografen wurde je Schul-
stufe eine Klasse geführt, bei den Hörgeräteakustikern und der
Doppellehre fehlten einzelne Klassen. Bei diesen Lehrberufen
war es vereinzelt nicht möglich, die Mindestschülerzahl von 20
Schülern zu erreichen. Nach obigen gesetzlichen Bestimmungen
darf die Mindestschüleranzahl unterschritten werden, wenn dies
aus organisatorischen Gründen notwendig ist.
Schulsprengel Nach der Tiroler Berufsschulsprengelverordnung, LGBl. 1988/19
idgF, gilt für die geprüfte TFBS als Schulsprengel das Gebiet des
Landes Tirol. Darüber hinaus werden auch viele Lehrlinge aus
anderen Bundesländern beschult, da bei den Optikern lediglich
die Stadt Wien eine eigene Berufsschule unterhält und sich bei
den Fotografen Berufsschulen nur in Wien, Linz und Graz befin-
den. Für den letztgenannten Lehrberuf werden Lehrlinge aus
Vorarlberg, Salzburg und Niederösterreich in Hall aufgenommen.
83. Berufsschule
Für Lehrlinge des Lehrberufes Hörgeräteakustiker ist die TFBS in
Hall die einzige Möglichkeit zur Erfüllung der Schulpflicht in
Österreich. Darüber hinaus kommen auch Optiker- und Foto-
grafenlehrlinge aus Südtirol in Hall ihrer Schulpflicht nach.
Herkunft Nachfolgende Darstellung zeigt die Berufsschüler des Schul-
jahres 2002/03 nach ihrer Herkunft:
Herkunft Berufsschüler
Anzahl Anteil
Burgenland 9 1,8%
Kärnten 29 5,7%
Niederösterreich 81 16,0%
Oberösterreich 94 18,6%
Salzburg 45 8,9%
Steiermark 57 11,3%
Tirol 120 23,8%
Vorarlberg 33 6,5%
Wien 12 2,4%
Südtirol 25 5,0%
Summe 505 100,0%
Stellungnahme Für Hörgeräteakustiker ist die TFBS für Optik Hall die einzige Schule
der Regierung Österreichs. Für Optiker gibt es nur noch eine Ausbildungsberufs-
schule in Wien und für Fotografen nur Schulen in Wien, Linz und
Graz. Dies ist die Erklärung dafür, dass die Schüler der Berufsschule
zum überwiegenden Teil aus anderen Bundesländern kommen.
Der LRH stellt fest, dass zwar der Großteil der Schüler aus Tirol
stammt, sich die Tiroler Lehrlinge aber insgesamt in der Minder-
zahl befinden. Eine ähnliche Verteilung hat das LKA bereits an-
lässlich seiner letzten Prüfung im Jahr 1988 festgestellt.
Wiener Lehrlinge Eine Sonderregelung besteht für einzelne Wiener Optiker-
lehrlinge, die in Hall die Berufsschulpflicht erfüllen wollen. Es
handelt sich dabei vor allem um Lehrlinge eines Unternehmens,
dessen Zentrale sich in Steyr, die Ausbildungsstätte aber in Wien
befindet. Die „Umsprengelung“ erfolgt jeweils mit Zustimmung
der zuständigen Wiener Schulverwaltung und unter der Voraus-
93. Berufsschule
setzung, dass sich das Steyrer Unternehmen anstelle der Stadt
Wien zur Leistung des Schulbeitrages (= Kuchler Beitrag) ver-
pflichtet.
a.o. Berufsschüler Der Großteil der Berufsschüler absolviert die TFBS in Hall im
Rahmen eines aufrechten Lehrverhältnisses bzw. ist nach § 21
Abs. 2 Schulpflichtgesetz 1985, BGBl. 76 idgF, zum Weiter-
besuch einer Berufsschule berechtigt. Darüber hinaus kann der
Schulerhalter (= Land) gem. § 26 Abs. 3 BSchOG Personen in
eine Berufschule aufnehmen, wenn dies in deren Interesse gele-
gen ist. Die Aufnahme ist nach Abs. 4 unzulässig, wenn sie eine
nicht vertretbare Vermehrung der Schulerhaltungskosten zur
Folge hätte. Von der Möglichkeit der Aufnahme solcher a.o.
Schüler wurde zuletzt vermehrt Gebrauch gemacht, wie nach-
folgende Darstellung zeigt:
a.o. Berufsschüler
Schuljahr Schuljahr Schuljahr
2000/01 2001/02 2002/03
Optiker 7 12 18
Fotografen 10 13 14
Hörgeräteakustiker 2 2 8
Summe 19 27 40
Der Anteil aller a.o. Schüler hat sich im Berichtszeitraum kontinu-
ierlich auf zuletzt 7,9 % erhöht. Relativ hoch war der deren Anteil
in den Lehrberufen Fotografen und Hörgeräteakustiker.
Stellungnahme Wie der Landesrechnungshof zutreffend festgestellt hat, ist in den
der Regierung vergangenen drei Jahren die Zahl der außerordentlichen Berufs-
schüler kontinuierlich gestiegen. Dies hat insbesondere darin seinen
Grund, dass von den als Lehrherren in Frage kommenden Optikern,
Fotografen und Hörgeräteakustikern immer weniger Lehrlinge aus-
gebildet werden, obwohl der Bedarf an guten Optikern, Fotografen
und Hörgeräteakustikern gleich geblieben ist.
Für die Aufnahme von außerordentlichen Lehrlingen bedarf die
Schule der Genehmigung des gesetzlichen Schulerhalters nach Ein-
holung einer Stellungnahme des Landesschulrates für Tirol. Bei der
Genehmigung wird darauf geachtet, dass keine unverhältnismäßigen
104. Berufsschülerheim
Kosten entstehen. Der Leiter der Schule wurde angewiesen, außer-
ordentliche Schüler nur aufgrund einer schriftlichen Genehmigung
der Landesregierung aufzunehmen.
Aufnahme Die Aufnahme erfolgt grundsätzlich aufgrund eines Ersuchens
des Lehrlings, befürwortender Stellungnahmen der Direktion und
des Landesschulrates für Tirol sowie einer schriftlichen Zusiche-
rung der Abteilung Bildung. Der LRH hat diesbezüglich festge-
stellt, dass in einzelnen Fällen trotz fehlender Zustimmung des
Landes Schüler von der Schulleitung einberufen wurden und die
TFBS besucht haben. Es waren zwar Ansuchen in der Schule
eingebracht, diese aber - zumindest lt. Protokoll - nicht bei der
zuständigen Abteilung des Landes eingelangt. Obwohl in diesen
Fällen die Schulbeiträge entrichtet wurden, empfiehlt der LRH
auch die formalen Regelungen einzuhalten.
4. Berufsschülerheim
Wie bereits erwähnt bietet das Internat in 43 Zimmern 153 Betten
an. Davon sind die Stockwerke I und II mit 79 Betten für Bur-
schen und die Stockwerke III und IV mit 74 Betten für Mädchen
vorgesehen. In jedem Stockwerk befinden sich ein Aufenthalts-
raum und ein bzw. zwei Erzieherzimmer.
Auslastung Nachdem die Auslastung des Heimes mit eigenen Schülern seit
Jahren nicht gegeben war, wurden seit einigen Jahren auch
Schüler der TFBS für Bautechnik und Malerei und der TFBS
Thurnfeld in das Schülerheim aufgenommen. Für das ver-
114. Berufsschülerheim
gangene und laufende Schuljahr hat der LRH die Heimbelegung
in folgender Tabelle zusammengestellt:
Heimbelegung
Schülerheim TFBS
Schuljahr BS männl. weibl. gesamt Auslastung Externe Gesamt
2002/03
1.Lehrgang eigene 32 51 83 54% 47 130
9.9. - 15.11. fremde 20 * 1 ** 21 14%
Summe 52 52 104 68%
2.Lehrgang eigene 43 65 108 70% 21 129
18.11. - 7.2. fremde 36 ** - 36 24%
Summe 79 65 144 94%
3.Lehrgang eigene 31 68 99 65% 28 127
17.2. - 3.5. fremde 39 (32*/7**) 6 ** 45 29%
Summe 70 74 144 94%
4.Lehrgang eigene 26 55 81 53% 43 124
28.4. - 5.7. fremde 35 (34*/1**) - 35 23%
Summe 61 55 116 76%
Schuljahr BS männl. weibl. gesamt Auslastung Externe Gesamt
2003/04
1.Lehrgang eigene 34 60 94 61% 36 130
8.9. - 15.11. fremde 26 * - 26 17%
Summe 60 60 120 78%
2.Lehrgang eigene 43 75 118 77% 13 131
17.11. - 7.2. fremde 40 ** - 40 26%
Summe 83 75 158 103%
3.Lehrgang eigene 36 59 95 62% 36 131
16.2. - 1.5. fremde 36 (31*/5**) 5** 41 27%
Summe 72 64 136 89%
* TFBS für Bautechnik und Malerei
** TFBS Thurnfeld
124. Berufsschülerheim
Die durchschnittliche Auslastung im vorigen Schuljahr betrug mit
127 Schülern 83 %, wobei im ersten und letzten Lehrgang
(Herbst und Frühsommer) die Heimbelegung jeweils geringer war
als während der Wintermonate. Die obige Darstellung zeigt deut-
lich, dass im Heim während des halben Jahres rd. 40 Heimplätze
nicht genutzt wurden.
Die Auslastung von 83% konnte nur erreicht werden, weil in allen
Lehrgängen auch Schüler der TFBS für Bautechnik und Male-
rei/Absam und Schüler der TFBS Thurnfeld/Hall untergebracht
wurden. Die Baugewerbeschüler nehmen allerdings nicht am
Mittagessen teil.
Vorschlag Der LRH schlägt zur Verbesserung der Auslastung vor, auch
Schülern der privaten HTL für Optometrie die Möglichkeit der
Heimunterbringung anzubieten. Bisher mussten die HTL-Schüler
sich selbst um eine Unterkunft in der näheren Umgebung der
Schule kümmern. Eine Aufnahme in das Schülerheim wurde
ihnen verwehrt.
Stellungnahme Der Berufsschulbesuch ist während eines Schuljahres von Lehrgang
der Regierung zu Lehrgang unterschiedlich. Insbesondere der erste und der letzte
der vier Lehrgänge weisen relativ geringe Schülerzahlen gegenüber
dem zweiten und dem dritten Lehrgang auf. Diese Schwankung
schlägt sich in der Auslastung der Heime nieder. Bestrebungen, die
Auslastung durch die Aufnahme von HTL-Schülern/innen zu verbes-
sern, scheiterten daran, dass HTL-Schüler und -Schülerinnen (für die
keine Heimunterbringungspflicht besteht) das ganze Schuljahr über
unterzubringen wären.
Um bei allen Heimen eine möglichst hohe Auslastung zu erreichen,
wird von der Fachabteilung (Abteilung Landwirtschaftliches
Schulwesen) jedes Jahr eine Konferenz mit den Heimleitungen und
den Schulleitungen angesetzt.
ErzieherInnen Den Tagesablauf und das Verhalten im Heim regelt eine
Internatsordnung. Zur Betreuung der Heiminsassen während der
schulfreien Zeit sind insgesamt neun Bedienstete eingesetzt, und
zwar vier Erzieher und fünf Erzieherinnen mit insgesamt 242
Wochenstunden. Die Dienstzeiten des Erzieherpersonals erge-
ben sich aus der Internat-Diensteinteilung, welche jeweils
lehrgangsmäßig erstellt wird. Nachtdienste werden zur Hälfte auf
die Dienstzeit angerechnet.
134. Berufsschülerheim
Im Jahr 2003 fielen 426,75 Überstunden des Erzieherpersonals
an und wurden ausbezahlt. Sie waren teilweise durch
Krankenstandsvertretungen verursacht.
Stellungnahme Die vom Landesrechnungshof für das Jahr 2003 festgestellten
der Regierung 426,75 Überstunden relativieren sich insofern, als es sich um die
Jahresüberstunden von ca. 10 Erziehern bzw. Erzieherinnen handelt.
Im Sinne der Anregung des Landesrechnungshofes wird danach ge-
trachtet, die Überstundenzahl so gering wie möglich zu halten.
Heimkostenbeitrag Für die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung eines Heim-
schülers hat der Heimerhalter von dem für den Schüler
Unterhaltspflichtigen einen höchstens kostendeckenden Heim-
kostenbeitrag einzuheben. Die Höhe des Heimkostenbeitrages
wird jährlich von der Landesregierung festgesetzt und im Boten
für Tirol verlautbart. Im Schuljahr 2002/03 betrug der Heim-
kostenbeitrag in der TFBS für Fotografie, Optik und Hörakustik
€ 66,20 je Woche und ab 1.9.2003 € 67,50. Die Einhebung der
Heimkostenbeiträge besorgte die Schulleitung.
Im Jahr 2003 wurden € 362.513,50 an Heimkostenbeiträgen ver-
einnahmt. Wenn man von den Gesamtausgaben von
€ 809.101,40 die Einnahmen (ohne Heimkostenbeiträge) in
Abzug bringt, ergibt sich ein Nettoaufwand von € 789.335,95. Am
Nettoaufwand erreichten die Heimkostenbeiträge einen
Deckungsgrad von 45,92 %. Der kostendeckende
Heimkostenbeitrag würde sich mit € 150,63 pro Woche
errechnen.
Empfehlung Im Falle der Unterbrechung des Heimaufenthaltes (z.B. vorzeiti-
ges Verlassen) werden die bereits bezahlten Heimkostenbeiträge
anteilsmäßig nach Tagen rückerstattet. Allerdings wird vom
Rückzahlungsbetrag ein „Spesenbeitrag“ in Höhe eines Wochen-
beitrages einbehalten. Der LRH sieht diese Vorgangsweise im
BSchOG nicht gedeckt und wiederholt die bereits 1998 getrof-
fene Empfehlung nach einer einheitlichen Neuregelung der
Kostenerstattung bei einem vorzeitigen Heimaustritt. In den
landwirtschaftlichen Schülerheimen der Landeslehranstalten
gelten vergleichsweise klare Kostenregelungen.
144. Berufsschülerheim
Stellungnahme Die Kostenerstattung im Falle der Unterbrechung des Heimaufent-
der Regierung haltes bzw. bei vorzeitigen Austritten wurde in der Zwischenzeit ein-
heitlich geregelt. Im Sinne der Empfehlung des Landesrechnungs-
hofes erfolgte eine Angleichung an die Kostenerstattungsregelung
bei den landwirtschaftlichen Heimen.
Küchenwirtschaft Einen wesentlichen Teil im Internatsbetrieb stellt die Küchen-
wirtschaft dar. In der Küche werden derzeit sechs teilzeit-
beschäftigte Bedienstete mit einem Gesamtstundenausmaß von
135 Wochenstunden beschäftigt. Mit Ausnahme der Schulferien
und der Heimfahrwochenenden (alle zwei bis drei Wochen) ist
die Küche in Betrieb. Während an Wochentagen bis zu 150
Frühstücke, 200 Mittagessen und 100 Abendessen anfallen,
reduzieren sich die Essensteilnehmer an den Wochenenden auf
5 bis 40.
Die Küchenleiterin besorgt den Lebensmitteleinkauf und erstellt
wöchentlich einen Speiseplan. Als Grundlage für die mengen-
mäßige Essenszubereitung dienen die Teilnehmerzahlen der
Lehrgänge sowie Erfahrungswerte für Externe, Lehrer und Be-
dienstete.
Verpflegskosten Aufzeichnungen über den Lebensmittelverbrauch (einschließlich
Lagerhaltung) sowie die tatsächlich ausgegebenen Mahlzeiten
(Standesmeldungen) liegen nicht vor. Lediglich auf
Durchschnittssätzen beruhende Teilnehmerzahlen und der
Lebensmitteleinkauf dienen als Grundlage für eine
Verpflegskostenermittlung. Die von der Abteilung Finanzen mit
Erlass vom 19.5.1978, Zl. 446/17, geforderten Aufzeichnungen
und Formulare werden nicht geführt. Der Prüfdienst der Landes-
buchhaltung hat bei seiner letzten Einschau auf das Fehlen der
Aufschreibungen hingewiesen, aber die Meinung vertreten, dass
die derzeitigen Aufschreibungen die Bedürfnisse der Dienststelle
abdecken.
Der LRH hält eine gewisse Dokumentation der Verpflegsausgabe
und des Warenverbrauches in jeder Küchenwirtschaft für unver-
zichtbar. Ob die von der Abteilung Finanzen im Jahr 1978 auf-
gelegten Formulare heute noch zeitgemäß sind und den laufen-
den Anforderungen entsprechen sei dahingestellt. Der LRH gibt
derzeit zum Problem Dokumentation der Küchenwirtschaft keine
Empfehlung ab. Er möchte vielmehr in einer gesonderten Prüfung
aller Landesküchen einen allgemein gültigen Vorschlag erarbei-
ten und in Abstimmung mit Buchhaltung, Abteilung Finanzen und
154. Berufsschülerheim
Betroffenen zur Anwendung bringen. Die Verpflegskosten-
abrechnung in der TFBS für Fotografie, Optik und Hörakustik
bleibt daher einer späteren Regelung vorbehalten.
Der LRH hat dennoch versucht, aus den vorhandenen Unterlagen
des Jahres 2003 eine Berechnung der Verpflegskosten vorzu-
nehmen. Das Ergebnis macht die Mangelhaftigkeit der Aufzeich-
nungen deutlich:
Verpflegskostenabrechnung
Einkauf durchschn. Anzahl Summe Kosten pro Verpflegs- Kosten pro
Monat in € Teilnehmer Tage Verpflegs- Verpflegstag tage Verpflegstag
tage gewichtet gewichtet
Jänner 3.662 152 25 3.800 0,96 2.950 1,24
Feber 9.193 139 19 2.641 3,48 1.995 4,60
März 9.650 139 29 4.031 2,39 3.045 3,17
April 7.569 139 19 2.641 2,86 1.995 3,79
Mai 4.495 117 30 3510 1,28 2.700 1,66
Juni 3.389 117 27 3.159 1,07 2.430 1,39
Juli 3.631 117 3 351 10,34 270 13,45
August 310 - - - - - -
September 1.545 123 23 2.829 0,54 2.208 0,70
Oktober 13.344 123 27 3.321 4,01 2.592 5,15
November 7.016 158 26 4.108 1,70 3.250 2,16
Dezember 6.129 158 16 2.528 2,42 2.000 3,06
Jahressumme 69.932 135 244 32.919 2,12 25.435 2,75
Die Einkaufsmengen stellen nicht den Lebensmittelverbrauch
dar. Nur über lange Zeiträume wirken sich die Verbrauchsver-
änderungen durch die Lagerhaltung in der Berechnung geringer
aus. Ohne Gewichtung der Mahlzeiten (Frühstück, Mittagessen,
Abendessen) kommen zu hohe Verpflegstage und damit
zusammenhängend zu niedrige Kosten pro Verpflegstag zu-
stande. In der hauseigenen Berechnungsmethode wurde nicht
berücksichtigt, dass zahlreiche HeimschülerInnen besonders der
164. Berufsschülerheim
Abendverpflegung und Wochenendverpflegung fernbleiben. Eine
Vergleichbarkeit mit anderen Zeiträumen oder mit anderen
Dienststellen ist nicht mehr gegeben.
Stellungnahme Die vom Landesrechnungshof angeregte, gesonderte Prüfung aller
der Regierung Landesküchen zwecks Erarbeitung eines Vorschlages für die Doku-
mentation wird begrüßt. Bei der Ausarbeitung des Vorschlages wird
in besonderer Weise auf eine verwaltungsökonomische, praktikable
Lösung geachtet werden.
Zu den Ausführungen des Landesrechnungshofes betreffend die
Berechnungsmethode für die Verpflegstage wird bemerkt, dass die
Berechnung an der TFBS für Fotografie, Optik und Hörakustik
insofern schwierig ist, als teilweise Schüler bzw. Schülerinnen von
vier bis fünf Schulen verpflegt werden.
Verpflegskosten- Die an der Verpflegung teilnehmenden LehrerInnen,
ersätze ErzieherInnen und Bediensteten werden über eigene Aufzeich-
nungen der Küche erfasst. Sie entrichten die für die Abgabe der
einzelnen Mahlzeiten von der Finanzabteilung mit Erlass vom
27.12.2000, Zl. VII-2/600/21, vorgesehenen Kostenersätze. Ein-
gehoben werden für ein Frühstück € 1,10, für ein Mittagessen
€ 3,30 und für ein Abendessen € 2,20.
Von externen SchülerInnen der Berufsschule, die am Mittag-
essen teilnehmen, werden pro Mahlzeit € 3,27 verlangt. Dieser
Tarif wurde von der Landesregierung ab 1.9.1997 festgelegt. Er
wird seither unverändert eingehoben.
Verwundert war der LRH darüber, dass die Schüler der HTL für
Optometrie das Mittagessen nicht im Haus einnehmen. Sie wan-
dern geschlossen während der Mittagspause nach Absam und
kehren nach dem Mittagessen in einer Werkskantine wieder zum
Unterricht zurück. Nach Ansicht des LRH sollte auch den HTL-
Schülern die Möglichkeit geboten werden, das Mittagessen im
Haus zu konsumieren.
Für die Verköstigung der SchülerInnen der TFBS Thurnfeld (30 -
40 je nach Lehrgang) wird dem Kloster Thurnfeld ein Betrag von
€ 5,50 pro Tag (€ 3,30 für Mittagessen und € 2,20 für Abend-
essen) jeweils nach Abschluss eines Lehrganges in Rechnung
gestellt.
174. Berufsschülerheim
Die im Heim wohnenden Berufsschüler der TFBS für Bautechnik
und Malerei nehmen an Schultagen das Mittagessen in der TFBS
für Tourismus in Absam ein. Dafür leistet das Berufsschülerheim
den gleichen Betrag von € 3,30 je Mittagessen an die betreffende
Schule.
In Einzelfällen hat die Küche auch Leistungen (Buffetzuberei-
tung) bei Sonderveranstaltungen erbracht (Beleg 418/2003,
547/2003). Der dabei entstandene Materialeinsatz für Lebens-
mittel wurde vom Veranstalter ersetzt. Für den zusätzlichen
Arbeitseinsatz wurden die Küchenbediensteten mit einem
Stundensatz von € 10,-- bis € 24,-- direkt entlohnt. Der LRH
macht darauf aufmerksam, dass Entgeltzahlungen an Bedienste-
te aus steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen
Gründen nur über die Lohnverrechnung getätigt werden dürfen.
Stellungnahme Der Ansicht des Landesrechnungshofes, wonach die HTL-Schüler
der Regierung bzw. Schülerinnen nach Möglichkeit im eigenen Haus verpflegt wer-
den sollen, wird beigepflichtet. Diesen Schülern bzw. Schülerinnen
wird ein entsprechendes Angebot im Sinne des Erlasses der Abtei-
lung Finanzen gemacht.
Im Sinne der Anregung des Landesrechnungshofes betreffend die
Abgeltung von zusätzlichem Arbeitseinsatz von Küchenpersonal bei
Sonderveranstaltungen wurde die Schulleitung ersucht, die
Entgeltzahlungen an die betreffenden Bediensteten nach den
steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften
vorzunehmen. Bemerkt wird, dass derartige Sonderveranstaltungen
nur mehr sehr selten stattfinden.
185. Private HTL des Landes - Kolleg für
Optometrie
Reinigungskräfte Zur Reinigung von Schule und Heim sind zehn Reinigungskräfte
mit einem Gesamtstundenausmaß von 226 Wochenstunden im
Einsatz. Die Putzfrauen stehen in einem Dienstverhältnis zur
Stadtgemeinde Hall. Der Kostenersatz wird der Stadtgemeinde
jährlich über Anforderung refundiert. Die Dienstaufsicht über das
Reinigungspersonal übt der Schulwart aus, der ebenfalls städ-
tischer Bediensteter ist. Die Dienstzeiten der Reinigungskräfte
werden auf Stundenlisten erfasst. Zum Jahresende 2002 hatten
acht Reinigungsfrauen ein Zeitguthaben von zusammen 263,67
Stunden und zwei Frauen einen Zeitrückstand von zusammen
43,54 Stunden. Zum Jahresende 2003 waren die Stundenauf-
zeichnungen noch nicht abgerechnet. Der LRH bemängelt den
Rückstand bei den Dienstzeitabrechnungen.
elektronische Für die Erfassung der Dienstzeiten, Urlaubszeiten und Kranken-
Zeiterfassung stände des Reinigungspersonals, der Küchenbediensteten und
der Sekretariatsbediensteten empfiehlt der LRH die Installierung
einer elektronischen Zeiterfassung (EZE), wie sie in den meisten
Dienststellen des Landes bereits in Betrieb ist. Sofern eine An-
bindung an das EZE des Landes aus technischen Gründen nicht
zweckmäßig scheint, wäre eine hauseigene Lösung anzustreben.
Stellungnahme Die Zeitguthaben der Reinigungsfrauen werden - der Anregung des
der Regierung Landesrechnungshofes entsprechend - abgebaut und die Abrech-
nung beschleunigt. Die Einführung einer elektronischen Zeiter-
fassung an der Schule wird geprüft.
5. Private HTL des Landes - Kolleg für Optometrie
Meisterschule Die Landesregierung beschloss am 14.10.1980 die Errichtung
einer Privatschule mit der Bezeichnung „Meisterschule für
Augenoptik und Kontaktlinsenoptik“, wobei insbesondere darauf
hingewiesen wurde, dass die Bundesinnung der Optiker einen
jährlichen Beitrag zu den Betriebskosten leistet. Das damals
zuständige Bundesministerium für Unterricht und Kunst hat mit
den Bescheiden vom 12.8.1981 den Lehrplan als Schulversuch
genehmigt und der Schule das Öffentlichkeitsrecht - befristet auf
zwei Schuljahre - verliehen. Die dreisemestrige Schule war zu-
nächst als berufsbildende mittlere Schule geführt.
195. Private HTL des Landes - Kolleg für
Optometrie
HTL Eine organisatorische Änderung ergab sich insofern im Jahr
1992, als das zuständige Bundesministerium mit den Bescheiden
vom 12.12.1992 die schulversuchsweise Anwendung der Lehr-
pläne des einsemestrigen Vorbereitungslehrganges und des vier-
semestrigen Aufbaulehrganges für Optometrie genehmigt hat.
Die Landesregierung nahm die Änderung der Organisationsform
mit Beschluss vom 26.1.1993 zur Kenntnis. Aufgrund der Be-
scheide des Landesschulrates für Tirol vom 28.5.1993 wird die
Schule seither als berufsbildende höhere Schule in der Schulart
Höhere technische Lehranstalt geführt.
Schulversuch Seit dem Schuljahr 2000/01 gilt gemäß dem Bescheid des
Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur vom
31.8.2000 der Schulversuchslehrplan „Kolleg für Optometrie“, der
sich insbesondere aus gemeinsamen Lehrplänen und Aufnahme-
bedingungen an Stelle der in den SchOG getrennt angeführten
Aufbaulehrgänge, Kollegs und Vorbereitungslehrgänge
zusammensetzt (Kolleg-Neu). Der Schulversuch gilt bis zu einer
etwaigen Abänderung bzw. Verkündigung im Bundesgesetzblatt.
Öffentlichkeitsrecht Um die Verleihung des Öffentlichkeitsrechtes muss das Land
laufend neu ansuchen, da die HTL als Schulversuch geführt wird
und als solcher einer zeitlichen Befristung unterliegt. Aus diesem
Grund liegen die gesetzlichen Voraussetzungen für die Ver-
leihung des Öffentlichkeitsrechtes auf Dauer nicht vor. Das ent-
sprechende Ansuchen für das laufende und nächste Schuljahr
wurde am 13.10.2003 gestellt. Eine Entscheidung des Ministeri-
ums war zum Prüfungszeitpunkt noch nicht getroffen, dürfte aber
aufgrund des vorliegenden Inspektionsberichtes, der auch den
zwischenzeitlich vollzogenen Direktorenwechsel berücksichtigt
und sich dadurch etwas verzögert hat, wie in den Vorjahren posi-
tiv ausfallen.
Vorbereitungs- Voraussetzung für den Besuch des Vorbereitungslehrganges ist
lehrgang eine positiv beurteilte Lehrabschlussprüfung sowie eine
Aufnahmeprüfung. Der Abschluss dieses Lehrganges berechtigt
die Schüler zum Eintritt in das Kolleg. Schüler mit Reifeprüfung
können dieses Semester überspringen und beginnen sogleich im
Kolleg.
205. Private HTL des Landes - Kolleg für
Optometrie
Prüfungen Die Ausbildung wird durch eine Reife- und/oder Diplomprüfung
abgeschlossen. Außerdem werden im Rahmen der Ausbildung
einschlägige Berufsprüfungen (Meisterprüfung für Augenoptiker,
Kontaktlinsenbefähigungsprüfung) abgelegt.
Die Schule wird ganzjährig geführt, wobei in jedem zweiten Jahr
ein neuer Jahrgang beginnt. Der Vorbereitungslehrgang wird un-
mittelbar vor Beginn eines neuen Jahrganges im vorausgehen-
den Sommersemester durchgeführt.
Herkunft An der Meisterschule bzw. HTL wurden bisher 14 Jahrgänge mit
insgesamt 435 Schülern geführt. Die Herkunft der Schüler verteilt
sich großteils auf das gesamte Bundesgebiet, einzelne Schüler
kamen aus dem Ausland, wie nachfolgende Darstellung zeigt:
Herkunft HTL-Schüler
Anzahl Anteil
Burgenland 5 1,1%
Kärnten 37 8,5%
Niederösterreich 42 9,7%
Oberösterreich 84 19,3%
Salzburg 52 12,0%
Steiermark 50 11,5%
Tirol 83 19,1%
Vorarlberg 39 9,0%
Wien 26 6,0%
Südtirol 4 0,9%
Ausland 13 3,0%
Summe 435 100,0%
Der Großteil der Schüler kam bisher aus den Bundesländern
Oberösterreich und Tirol.
Klassenzahlen Die Jahrgänge waren durchwegs sehr gut besucht. Die einzelnen
Schülerzahlen lagen zwischen 24 und 38 Schüler. Die bisherige
Schülerhöchstzahl von 38 wurde in zwei Jahrgängen erreicht.
Der LRH weist in diesem Zusammenhang auf § 71 SchOG hin,
wonach die Klassenschülerhöchstzahl 30 beträgt bzw. diese, um
215. Private HTL des Landes - Kolleg für
Optometrie
Abweisungen zu vermeiden, auf bis zu 36 überschritten werden
darf. In den beiden konkreten Fällen (11. und 14. Jahrgang)
wurde lt. Schulinspektor die Zustimmung des zuständigen
Ministeriums erteilt, da es sich bei den Schülern durchwegs um
erwachsene Schüler handelt.
Der Großteil der Schüler besucht auch den Vorbereitungs-
lehrgang. Von den derzeit 38 Kolleg-Schülern haben bereits 32
den Vorbereitungslehrgang absolviert.
Lehrpersonal Wie eingangs erwähnt wurde bzw. wird die HTL - mit Ausnahme
der Jahre 2002 und 2003 - vom Berufsschuldirektor geleitet. Das
Lehrpersonal setzt sich aus derzeit 17 Personen zusammen, die
an der Schule mit insgesamt rd. 70 Wochenstunden beschäftigt
sind. Der Bund hat seit 1981 ohne Vorliegen eines schriftlichen
Vertrages den gesamten Lehrerpersonalaufwand übernommen.
Der LRH empfiehlt, die derzeitige Organisation und Kosten-
tragung der Privaten HTL in einer schriftlichen Vereinbarung mit
dem Bund abzusichern.
Stellungnahme Der Entwurf einer Vereinbarung mit dem Bund betreffend den Lehr-
der Regierung personalaufwand wurde bereits ausgearbeitet und dem Bundes-
ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kunst zur Genehmigung
vorgelegt.
226. Buchhaltung, Inventar
6. Buchhaltung, Inventar
Kasse Von einer am Beginn seiner Einschau beabsichtigten Kassen-
prüfung musste der LRH Abstand nehmen, da die Schule über
keine Barkasse verfügt. Der LRH war über diese Situation inso-
fern verwundert, als von einer Mitarbeiterin sehr wohl auch Bar-
geld entgegengenommen wurde bzw. wird. Diese Praxis hat zur
Folge, dass über jede Geldannahme ein Bankeinzahlungsbeleg
anzufertigen ist und der Hausmeister das Geld - beinahe täglich,
meist aber in Verbindung mit anderen Erledigungen - bei der ört-
lichen Bank abzuliefern hat. Der LRH konnte außerdem in Er-
fahrung bringen, dass der Hausmeister über eine eigene private
Handkasse verfügt, über die er kleinere Barauslagen gegen
spätere Abrechnung vorausstreckt.
Empfehlung Der LRH erkennt in dieser Vorgangsweise keine administrativen
Vereinfachungen und verweist diesbezüglich auf die Kassen-
vorschriften des Landes. Diese sehen vor, dass der Zahlungs-
verkehr zwar grundsätzlich bargeldlos abzuwickeln ist und die
Einzahlungen tunlichst auf ein Bankkonto zu leisten sind, die ge-
samten baren Einnahmen und Ausgaben einer Dienststelle aber
durch die Kasse zu vollziehen sind. Der LRH hält daher die Füh-
rung einer Kasse insbesondere zur Bezahlung unvermeidbarer
kleinerer Barauslagen für notwendig und empfiehlt die Führung
einer schuleigenen Kasse samt den dazugehörigen Aufzeich-
nungen.
Stellungnahme Der Empfehlung des Landesrechnungshofes betreffend die Führung
der Regierung einer Kasse zur Bezahlung unvermeidbarer kleinerer Barauslagen
wird in Hinkunft Rechnung getragen.
Girokonto Der bargeldlose Zahlungsverkehr wird über das Girokonto Nr.
1800-005470 bei der Tiroler Sparkasse Bank AG Innsbruck,
Zweigstelle Hall-Kurpark, geführt. Die Zeichnungsberechtigung
darüber üben der Direktor und die Buchhalterin gemeinsam aus.
Buchhaltung Die Buchhaltung wird über das Orlando-Finanzbuchhaltungs-
programm geführt. Die monatlichen Ergebnisse sind über die
Abteilung Landwirtschaftliches Schulwesen der Abteilung
Landesbuchhaltung zwecks Einbuchung in den Landeshaushalt
mitzuteilen.
237. Gebarung
Inventar Im Juli 2003 wurde mit der landesweiten Einführung des EDV-
unterstützten Inventarverwaltungsprogrammes „InvWeb“ begon-
nen. Damit wurden die bisher geführten Inventar-Karteiblätter
abgelöst. Diese sind jedoch nach wie vor bei der Dienststelle
aufzubewahren, da lediglich der Altbestand der letzten fünf Jahre
(Anschaffungen ab 1.1.1999) in das neue EDV-Programm zu
übernehmen war. Die EDV-mäßige Erfassung des Inventars ist
auch Grundlage für die mit 1.1.2004 eingeführte Vermögens-
rechnung des Landes.
Mit der Führung des Inventars ist an der geprüften Einrichtung
das Sekretariat betraut. Der LRH hat festgestellt, dass der Be-
stand der letzten fünf Jahre in die EDV übernommen wurde und
die inventarisierungspflichtigen Gegenstände mit Ausnahme von
drei Anschaffungen aus dem Vorjahr, die noch zu inventarisieren
waren, laufend erfasst wurden.
7. Gebarung
7.1 Übersicht
Verrechnungs- Aufgrund der bereits erwähnten unterschiedlichen Kosten-
kreise tragungen sind mehrere Verrechnungskreise eingerichtet. Im
Landeshaushalt sind die beiden Schulen in den Teilabschnitten
22010 (Landesberufsschule) und 22210 (HTL für Optometrie)
sowie das Schülerheim im Untervoranschlag 25112 abgebildet.
Weiters erfolgt die Verrechnung der Personalkosten für die
Berufsschullehrer über den Teilabschnitt 22000, während die
Personalkosten der HTL-Lehrer in der Höhe von rd. € 230.000,--
zur Gänze der Bund übernimmt und diese daher im Landes-
haushalt nicht aufscheinen.
Abgesehen von den Personalkosten der Berufsschul- und HTL-
Lehrer enthielten die Rechnungsabschlüsse des Landes der
letzten drei Jahre folgende Ergebnisse für die geprüften
Organisationseinheiten:
247. Gebarung
Gebarungsübersicht
Berufsschule HTL Optometrie Schülerheim
22001 22210 25112
Leistungen für Personal 333.255
Ausgaben für Anlagen 10.079 31.160 1.683
Sonstige Sachausgaben/Pflicht- 96.390 275.329
2001 Sonstige Sachausgaben /Ermessens- 140.085 10.028 116.302
Summe Ausgaben 246.554 41.188 726.570
Einnahmen 41.967 10.155 288.405
Abgang 204.588 31.033 438.164
Leistungen für Personal 345.145
Ausgaben für Anlagen 47.281 31.300 11.599
Sonstige Sachausgaben/Pflicht- 98.471 260.516
2002 Sonstige Sachausgaben /Ermessens- 373.248 10.900 115.123
Summe Ausgaben 519.000 42.200 732.383
Einnahmen 34.332 9.447 330.184
Abgang 484.668 32.753 402.198
Leistungen für Personal 361.684
Ausgaben für Anlagen 19.660 8.220 16.433
Sonstige Sachausgaben/Pflicht- 99.402 301.182
2003 Sonstige Sachausgaben /Ermessens- 386.642 23.179 129.803
Summe Ausgaben 505.704 31.399 809.102
Einnahmen 45.896 12.243 382.279
Abgang 459.808 19.155 426.823
Anweisende Stellen Anweisende Stelle für die meisten Finanzpositionen ist die Haller
Schule, aber auch andere Dienststellen des Landes sind für be-
stimmte Maßnahmen (Bauinvestitionen, Personalkosten für
Sekretärinnen und ErzieherInnen, Versicherungen) anweisungs-
berechtigt. So sind beispielsweise in den sonstigen Ermessens-
sachausgaben Bauinvestitionen in der Höhe von € 24.124,--
(2001), € 247.343,-- (2002) und € 253.387,-- (2003) enthalten,
dessen Zahlungsverkehr über die Landesbaudirektion abge-
wickelt wurde.
257. Gebarung
Die Anweisung der Personalkosten der Berufsschullehrer erfolgt
durch die Abteilung Bildung. Der LRH hat deren Kosten in den
letzten drei Jahren mit € 722.258,--, € 800.162,-- und
€ 838.369,-- erhoben. Die Kostenentwicklung ist insbesondere
auf die zuletzt höhere Klassenanzahl zurückzuführen. Gemäß § 4
FAG 2001 erhält das Land die Hälfte dieser Kosten vom Bund
refundiert.
Weitere Beiträge erhielt das Land zu den in obiger Darstellung
unter der Berufsschule ausgewiesenen Abgängen. Für die Hälfte
der Investitions- und Betriebsaufwendungen kommen die Tiroler
Gemeinden, die betreffenden Bundesländer oder einzelne Schü-
ler selbst auf. Die entsprechende Verrechnung erfolgt im Teilab-
schnitt 22900.
Gesamtaufwand Der LRH hat festgestellt, dass sich für die geprüften
Organisationseinheiten unter Berücksichtigung aller Aufwen-
dungen ein jährlicher Gesamtaufwand von zuletzt 2,4 Mio. € er-
gab, dessen Verteilung nachfolgende Grafik verdeutlicht:
Ausgabenverteilung
60%
30% Personalausgaben
Bauinvestitionen
Betriebsaufwand
10%
Die Personalausgaben sind naturgemäß der größte Teil der Aus-
gaben. Darin nicht enthalten sind jedoch die Personalausgaben
der Gemeindebediensteten in Höhe von rd. € 350.000,--, die als
Kostenersätze an die Stadtgemeinde Hall im Betriebsaufwand
aufscheinen.
267. Gebarung
Abgangsdeckung Der LRH stellte weiters fest, dass nach Abzug aller Ersätze und
sonstigen (eigenen) Einnahmen dem Land letztlich ein Abgang in
der Höhe von 1,1 Mio. € verblieb, das sind 44 % der Gesamt-
aufwendungen. Nachfolgende Darstellung gibt einen Überblick
über die Finanzierung der geprüften Organisationseinheiten:
Abgangsdeckung
6%
11% Land Tirol
2% Bund
10% 44% Gemeinden/Bundesländer
Bundesinnung der Optiker
Heimkostenbeiträge
Sonstige Einnahmen
27%
7.2 Kostenträgerschaft
Zuordnung Aufgrund der unterschiedlichen Kostentragung kommt der ge-
nauen Zuordnung der Einnahmen und Ausgaben eine besondere
Bedeutung zu. Der LRH hat diesbezüglich festgestellt, dass die
Einnahmen und Ausgaben - soweit wie möglich - den einzelnen
Verrechnungskreisen direkt zugeordnet, andernfalls mit Hilfe von
Schlüsselzahlen aufgeteilt werden. Beispielsweise erfolgt die
Teilung der Betriebskosten, wie z.B. Öl, Strom, Wasser, Kanal
oder Rauchfangkehrer, im Verhältnis 70 : 30 zwischen Berufs-
schule und Heim. Vereinzelt, insbesondere zu Jahresende wurde
auch der Aufteilungsschlüssel geändert, wenn auf den ent-
sprechenden Verrechnungsansätzen mit dem vorhandenen Bud-
get nicht mehr das Auslangen gefunden werden konnte.
Feststellung Der LRH stellte weiters fest, dass einzelne Zuordnungen bzw.
Aufteilungen teilweise nicht den tatsächlichen Verhältnissen ent-
sprachen. So wurden ein Teil der HTL-Gebarung und die ge-
samten Instandhaltungsaufwendungen der Landesbaudirektion
277. Gebarung
auf Ansätzen der Berufsschule verbucht. Der Personalaufwand
des Sekretariats wurde dem Schülerheim zur Gänze und nicht
auch der HTL anteilig angelastet.
Die Darstellungen des vorigen Abschnittes sind daher unter die-
sen Gesichtspunkten zu sehen. Der LRH misst der möglichst ge-
nauen Zuordnung der Ausgaben und Einnahmen vor allem we-
gen der unterschiedlichen Kostenträgerschaften besondere Be-
deutung zu. Die zuständige Fachabteilung hat bereits während
der Prüfung auf diesen Hinweis reagiert und die notwendigen
Schritte eingeleitet. Auch die budgetären Vorsorgen werden
diesbezüglich zu treffen sein.
Stellungnahme Eine hundertprozentig genaue Zuordnung der Einnahmen und Aus-
der Regierung gaben an die jeweiligen Träger ist aufgrund der vorgegebenen Ver-
hältnisse nur bedingt möglich. Einem solchen Erfordernis könnte nur
dann entsprochen werden, wenn die Schülerverhältniszahlen (Heim,
HTL, Kolleg und Berufsschule) ständig gleich bleiben würden. Da
dies leider nicht der Fall ist, wären die Kostenverteilungsschlüssel
laufend neu zu berechnen bzw. anzupassen. Im Übrigen wird darauf
hingewiesen, dass die Einrichtungen von den Schülern bzw. Schüle-
rinnen meist gemeinsam mit unterstützender Auslastung benützt
werden.
Im Rahmen dieser vorgegebenen Verhältnisse wird künftighin ver-
stärkt danach getrachtet, die Zuordnung der Einnahmen und Aus-
gaben entsprechend der Anregung des Landesrechnungshofes mög-
lichst präzise und genau vorzunehmen. Die Ansatzposten für das
Heim und die HTL (bei beiden ist Kostenträger das Land Tirol zu
100%) werden im Zuge des Haushaltsvoranschlages 2005 ent-
sprechend ergänzt.
Berufsschule Der 6. Abschnitt des BSchOG regelt die Trägerschaft der Schul-
erhaltungskosten. Diese umfassen die Kosten für den
Investitionsaufwand und den Betriebsaufwand. In beiden Fällen
hat der gesetzliche Schulerhalter (= Land) Anspruch gegenüber
den beitragspflichtigen Gebietskörperschaften. Während der
Investitionsaufwand je zur Hälfte zwischen dem Land und allen
Tiroler Gemeinden getragen wird, werden die Betriebsbeiträge
der Gemeinden für die einzelnen Berufsschulen aufgrund der
errechneten Kopfquoten ermittelt. Die Kopfquote ergibt sich aus
der Teilung der Hälfte des um die eigenen Einnahmen verminder-
ten Betriebsaufwandes durch die Gesamtzahl der Schüler des
28Sie können auch lesen