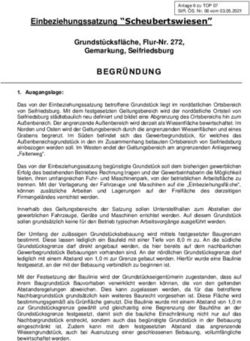Untersuchung der Beeinträchtigung der Vegetation entlang von Wanderwegen im Oberen Donautal
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
13. JANUAR 2020
Untersuchung der Beeinträchtigung der
Vegetation entlang von Wanderwegen
im Oberen Donautal
Zustandserfassung, GIS-basierte Auswertung und Visualisierung von Störungen in
Lebensraumtypen und ASP-Gebieten
ALEXANDRA KAGE, MONA HELFMEYER & MARLENE JANDT
7. SEMESTER FORSTWIRTSCHAFT, VERTIEFUNG „GIS UND LANDSCHAFTSMANAFGEMENT“Inhaltsverzeichnis
1. Danksagung ......................................................................................................................... 1
2. Das Projekt .......................................................................................................................... 1
3. Begriffe und Erläuterungen ................................................................................................. 3
3.1. Der Naturpark Obere Donau: Lage, Geologie und Klima ............................................. 4
3.1.1. Lage 4
3.1.2. Geologie und Bodenökologie ............................................................................... 4
3.1.3. Klima: Beuron in den Jahren 1980-2012 .............................................................. 5
3.2. Der Schutzgebietsstatus „Naturpark“ in Deutschland und die Umsetzung im NP Obere
Donau...................................................................................................................................... 6
3.2.1. Naturpark Obere Donau ....................................................................................... 7
3.2.2. Aufgaben des Naturparks Obere Donau e.V. ....................................................... 7
3.2.3. Ziele des Naturparks Obere Donau e.V. bezüglich Naturschutzes und
Landschaftspflege ........................................................................................ 8
3.2.4. Aufgaben und Ziel des Naturschutzzentrums Obere Donau ............................... 8
3.3. Wanderwege ................................................................................................................ 9
3.3.1. Wegekategorien ................................................................................................... 9
3.4. Besucherlenkung ........................................................................................................ 10
3.5. Vegetation und Lebensräume .................................................................................... 11
3.5.1. Artenschutzprogramm (ASP) .............................................................................. 11
3.5.2. FFH Gebiet und Lebensraumtypen .................................................................... 12
3.6. Stand der Forschung .................................................................................................. 13
4. Methodik Datenerhebung ................................................................................................. 14
4.1. Verwendete Materialien ............................................................................................ 14
4.1.1. Karten ................................................................................................................. 14
4.1.2. Software ............................................................................................................. 14
4.1.3. Zur Datenaufnahme verwendete Geräte ........................................................... 15
4.2. Datenerhebung .......................................................................................................... 15
4.2.1. Vorbereitungen zur Datenaufnahme ................................................................. 15
4.2.2. Die Datenaufnahme zum vorliegenden Schadenszustand ................................ 16
4.3. Datenaufnahme inoffizieller und offizieller Wege ..................................................... 174.4. Validität der Datenaufnahme .................................................................................... 18
5. Ausarbeitung Excel und GIS .............................................................................................. 18
5.1. Waldwege................................................................................................................... 18
5.1.1. Aufbereitung der Geodaten ............................................................................... 18
5.1.2. Erzeugung von Aufnahmepunkten ..................................................................... 19
5.1.3. Symbolik ............................................................................................................. 20
5.1.4. Prozentualer Anteil eines Weges in einem Lebensraumtyp .............................. 20
5.2. Felsköpfe .................................................................................................................... 22
5.3. Offenland ................................................................................................................... 22
6. Ergebnisauswertung.......................................................................................................... 27
6.1. Waldwege................................................................................................................... 27
6.1.2. Vergleich der Geodaten ..................................................................................... 27
6.1.3. Inoffizielle Wege ................................................................................................. 30
6.1.4. Auswertung der Wegebreite .............................................................................. 31
6.1.5. Starke Störungen ................................................................................................ 36
6.1.6. Wer ist auf den Wegen unterwegs? Untersuchung mit Hilfe der Globalen
Heatmap von Strava .................................................................................. 37
6.2. Felsköpfe .................................................................................................................... 40
6.3. Offenland ................................................................................................................... 44
6.3.2. Auswertung Offenland 1: nördlich vom Rabenfelsen ........................................ 44
6.3.3. Auswertung Offenland 2: östlich vom Kreuzfelsen ............................................ 46
6.3.4. Auswertung Offenland 3: nördlich vom Kreuzfelsen ......................................... 47
6.3.5. Gesamtbewertung Schaden ............................................................................... 48
6.3.6. Zustände innerhalb eines Transekts nach Störungsgrade ................................. 49
6.3.7. Prozentualer Anteil der Offenlandtransekte in einem Lebensraum .................. 50
7. Diskussion .......................................................................................................................... 51
7.1. Waldwege................................................................................................................... 51
7.2. Felsköpfe .................................................................................................................... 52
7.3. Offenland ................................................................................................................... 54
8. Fazit ................................................................................................................................... 58
Literatur: ................................................................................................................................... 60Abbildungsverzeichnis: ............................................................................................................. 62 Tabellenverzeichnis: ................................................................................................................. 63
1. Danksagung
Ein herzliches Dankeschön gilt unseren Projektpartnern vom Naturschutzzentrum Obere Do-
nau, namentlich Markus Ellinger und Samantha Giering für die gute Zusammenarbeit, den Pro-
jektvorschlag und die kompetente fachliche Begleitung. Außerdem danken wir Dr. Guido
Waldenmeyer und Renate Weiß vom Regierungspräsidium Tübingen, Referat Naturschutz, für
das Vertrauen und die Ermöglichung des Projektes.
2. Das Projekt
Klimawandel, Zerstörung von natürlichen Lebensräumen, das sechste Massensterben der Erd-
geschichte. Zum Thema Umwelt dominieren vor allem Negativschlagzeilen die öffentliche De-
batte. Die Ursachen dieser Entwicklung sind vielseitig, jedoch grundsätzlich auf menschliche
Aktivitäten zurückzuführen.
Es ist bekannt, dass Versiegelung, die Erschließung von Bodenschätzen oder die konventio-
nelle Landwirtschaft gravierende Auswirkungen haben. Aber welchem Erholungssuchenden,
der durch die Landschaft streift, ist bewusst, dass er unter Umständen dazu beiträgt ein emp-
findliches Ökosystem zu gefährden?
Der Gesetzgeber- sei es auf Bundes- oder EU-Ebene hat in der Absicht, dem Verlust von Bio-
diversität Einhalt zu gebieten, seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert verschiedene Instru-
mente zum Schutz der Tier- und Pflanzenwelt entwickelt. Ein vergleichsweises altes Instru-
ment ist die Berner Konvention von 1979, deren Umsetzung in der Europäischen Union in der
Vogelschutz- und Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Natura2000) formuliert ist. Darüber hinaus
hat das Land Baden-Württemberg mit dem Artenschutzprogramm (ASP) den Artenschutz ge-
setzlich gesichert.
Im Donautal zwischen Sigmaringen und Beuron existiert eine Vielzahl von Flächen mit diesen
Schutzstatus. Das Gebiet ist außerdem Teil eines von insgesamt 30 vom Bundesamt für Natur-
schutz herausgegebenen Biodiversitätshotspotregionen, namentlich der „Schwäbischen
Alb“.1
Die malerische Landschaft ist von Freizeitsportler und Touristen sehr geschätzt, und dazu von
hohem ökologischem Wert. Auf den zahlreichen Felsmassiven, welche das Donautal säumen,
1
Bundesamt für Naturschutz (o.J.).
1hat sich eine wärmeliebende und trockenheitsresistente Vegetation eingestellt, von welcher
einige Vertreter als endemische Arten gelten.
Eine wichtige Voraussetzung dafür, dass Menschen für die Kostbarkeit und Schutzbedürftig-
keit von Arten sensibilisiert werden, ist die Kenntnis von denselben. Outdoor- Freizeitaktivitä-
ten wie z.B. Wandern, Klettern oder Fahrradfahren können einen wertvollen Beitrag leisten,
wenn es darum geht, das Bewusstsein der Freizeitsportler für ihre Aktivitätskulisse „Natur“ zu
erhöhen und gegebenenfalls ein Verantwortungsgefühl für bedrohte Arten in den Menschen
zu erwecken.
Der Naturpark Obere Donau stellt mit seinem dichten Wanderwegenetz in einer idyllischen
Landschaft ein beliebtes Ausflugsziel für Freizeitsportler dar. Mit der Zeit haben sich neben
den offiziellen auch inoffizielle Wege etabliert. Einige dieser Wege führen durch empfindliche
Offenland-Lebensraumtypen. Die sensiblen Ökosysteme drohen durch übermäßigen Tritt im
Bestand zurückzugehen.
Zu einem nicht unerheblichen Teil führen die Wanderwege auch durch eine Vielzahl von Wald-
Lebensraumtypen. Davon betroffen sind z.B. Orchideen- und Waldmeister-Buchenwald.
Scharfkraut, Gebirgsschrecke und Dohle gehören zu den im Untersuchungsgebiet vorkom-
menden Arten des Artenschutzprogramms Baden-Württemberg, und sind ebenfalls von den
Störungen durch Wandertourismus betroffen.
Im Kontext des Spannungsfeldes Tourismus und Naturschutz haben die Untersuchungen die-
ser Projektarbeit zum Ziel, den Zustand der Vegetation entlang von Wanderwegen in den Un-
tersuchungsgebieten Kreuzfelsen und Rabenfelsen zu erfassen und zu beurteilen (Abbildung
1). Die fachliche Begleitung erfolgte dabei durch den Naturparkranger Markus Ellinger und
Samantha Giering vom Naturschutzzentrum Obere Donau. Aus den gewonnenen Erkenntnis-
sen lassen sich Schlussfolgerungen zur Verträglichkeit der Besucherströme in diesem Gebiet
und zur Wirksamkeit von Besucherlenkungsmaßnahmen – falls diese vorhanden sind - ablei-
ten.
2CRS: ETRS89 / UTM Zone 32n
Einheit: Meter
Maßstab: 1:15.700
Kartenhintergrund:
topographische Karte
vom RP Tübingen
Abbildung 1: Die Untersuchungsgebiete Rabenfelsen und Kreuzfelsen bei Thiergarten und Gutenstein, nördlich bzw. nord-
östlich der Donau.
3. Begriffe und Erläuterungen
Zunächst müssen einige wichtige Begriffe erläutert werden. Es findet eine geographische Ein-
ordnung des Naturparks Obere Donau statt, sowie eine Darstellung der allgemeinen rechtli-
chen Lage von Naturparks in Deutschland. Daraus folgernd ergeben sich die Aufgaben und
Ziele der Akteure im Naturpark Obere Donau.
Es folgt eine Beschreibung der Wanderwege im Naturpark, sowie der Kriterien für diverse
Wanderwegs-Kategorien in Deutschland, wie zum Beispiel Premium-Wanderwege. Zuletzt
wird auf einige Ansätze aus dem derzeitigen Stand der Forschung bezüglich den Themen Tou-
rismus und Naturschutz eingegangen.
33.1. Der Naturpark Obere Donau: Lage, Geologie und Klima
Die geographische Einordnung des Naturparks Obere Donau ist insofern von Bedeutung, als
dass sie einen räumlichen Bezug zum Untersuchungsgebiet herstellt, und da die vorliegende
Geographie ausschlaggebend für die vorhandenen Lebensräume ist.
3.1.1. Lage
Der Naturpark Obere Donau erstreckt sich über die Landkreise Tuttlingen, Sigmaringen, Biber-
ach und Zollernalbkreis auf einer Fläche von ca. 1500km².
Die montanen Höhenunterschiede im Donautal liegen zwischen 570m NN (Sigmaringen) und
825m NN (Burghalde). Der Höhenunterschied zwischen der Talsohle und den Felsköpfen liegt
im Schnitt bei 150m-200m.2
Das vorliegende Untersuchungsgebiet befindet sich zwischen den Gemeinden Gutenstein und
Thiergarten. Die zwei bedeutendsten touristischen Attraktionen sind der Kreuzfelsen bei Gu-
tenstein und der Rabenfelsen, der auf der Wanderstrecke zwischen den beiden Gemeinden
liegt.
3.1.2. Geologie und Bodenökologie
Die Felsen im Oberen Donautal bestehen aus Weißjura-Massenkalken, welche von Zwischen-
schichten von Kalkmergel und Mergel durchzogen werden. Durch Verwitterungsprozesse und
Verkarstung tragen diese in Form von Hohlkehlen, Felsterrassen und Absätze zu einem struk-
turierten und prägenden Landschaftsbild bei. Die großen Felsköpfe sind ehemalige Schwamm-
riffe, die vor ca. 160 Millionen Jahren entstanden sind: auch diese wurden durch natürliche
Abtragungsprozesse in ihre Form herauspräpariert und bestehen aus nur sehr schwach ge-
schichteten Massenkalken.3
Während auf dem mergelhaltigen Gestein häufig Pararendzina-Braunerde-Böden vorliegen,
finden sich auf den Massenkalken fast ausschließlich Rendzina-Böden. Ausgezeichnet sind
diese durch Flachgründigkeit, Skelettreichtum und einen geringen Anteil an pflanzenverfüg-
barem Wasser aufgrund des hohen Porenvolumens und der daraus resultierenden Drainage.
Der Skelettreichtum führt jedoch auch zu einer guten Bodenbelüftung und lockeren Struktur.
Aufgrund der geringen Tonanteile an den Felsköpfen werden organische Bodenstoffe kaum
2
Herter 1996: 9
3
Naturpark Obere Donau e.V. (o.J.)a
4gebunden. Sie häufen sich als schwarz gefärbten Kalkmull in den Spalten und Ritzen der Fels-
köpfe an und verleihen ihnen ein prägendes Aussehen, wie in Abbildung 2 dargestellt ist.
Abbildung 2: Kleiner Felskopf mit Ansammlung von dunklen Flechten und schwarzem Kalkmull in den Ritzen (Eigene Auf-
nahme).
Der flachgründige schwarze Kalkmull trägt zu einer Erhitzung des Bodens bei starker Sonnen-
einstrahlung auf bis zu ca. 50°C bei. Des Weiteren liegt durch den Kalkanteil ein hoher pH-
Wert vor. Diese vorliegenden Bodenbedingungen machen den Standort ideal für die ansons-
ten sehr selten auftretenden Xerothermvegetation.4
3.1.3. Klima: Beuron in den Jahren 1980-2012
Die Jahresdurchschnittstemperatur in Beuron betrug im Zeitraum 1980-2012 8.5 °C und lag
somit unter dem Durchschnitt für Baden-Württemberg von 10,6°C. Die Jahresdurchschnitts-
niederschläge waren mit 943 mm höher als der Durchschnitt in Baden-Württemberg von 784
mm.5 Damit lässt sich generell sagen, dass das Klima in Beuron noch gemäßigt warm ist, jedoch
kühlere Temperaturen und höherer Niederschläge vorzufinden sind, als vielerorts in Baden-
Württemberg. Anzumerken ist, dass Herter im Jahr 1996 die Durchschnittsniederschläge für
Tallagen mit ca. 760 mm angibt, was deutlich unter dem langjährigen Mittel zwischen den
4
Herter 1996: 12-14
5
WetterKontor (o.J.)a
WetterKontor (o.J.)b
Climate-data.org (o.J.)
5Jahren 1980-2012 liegt, das würde bedeuten, dass der Durchschnitt pro Jahr nach 1996 bis
2012 angestiegen ist. Dasselbe gilt für die Jahresdurchschnittstemperatur, welche 1996 noch
zwischen 6°C und 7,3°C betrug.6 Dabei wird angenommen, dass die von Herter in Tallagen
beschriebenen Klimadaten mit den Klimadaten von Beuron vergleichbar sind.
Doch nicht nur das allgemeine Klima spielt in Oberen Donautal eine bedeutende Rolle. Herter
schreibt: „Aufgrund […] der reichen geomorphologischen und topographischen Gliederung
des Untersuchungsgebiets ergibt sich eine Vielzahl unterschiedlicher Lokal- und Mikrokli-
mata“.7 Die oben erwähnten Kalkmullschichten können zu einer Erhitzung des Bodens auf
50°C führen, während auf den Felsen bereits Temperaturen bis zu 65°C aufgenommen wur-
den. Somit ist das Mikroklima zusätzlich sehr prägend für die aufkommende Vegetationsde-
cke.
3.2. Der Schutzgebietsstatus „Naturpark“ in Deutschland und die
Umsetzung im NP Obere Donau
Das Bundesnaturschutzgesetz § 27 definiert Naturparke folgendermaßen:
„Naturparke sind einheitlich zu entwickelnde und zu pflegende Gebiete, die 1. großräumig sind,
2. überwiegend Landschaftsschutzgebiete oder Naturschutzgebiete sind, 3. sich wegen ihrer
landschaftlichen Voraussetzungen für die Erholung besonders eignen und in denen ein nachhal-
tiger Tourismus angestrebt wird, 4. nach den Erfordernissen der Raumordnung für Erholung vor-
gesehen sind, 5. der Erhaltung, Entwicklung oder Wiederherstellung einer durch vielfältige Nut-
zung geprägten Landschaft und ihrer Arten- und Biotopvielfalt dienen und in denen zu diesem
Zweck eine dauerhaft umweltgerechte Landnutzung angestrebt wird und 6. besonders dazu ge-
eignet sind, eine nachhaltige Regionalentwicklung zu fördern“
(Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz 2019: 28).
Des Weiteren sollen sie der Bildung für nachhaltige Entwicklung dienen und unter Beachtung
der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege geplant, gegliedert, erschlossen und
weiterentwickelt werden.
6
Herter 1996:12
7
Herter 1996: 12
63.2.1. Naturpark Obere Donau
Der Naturpark Obere Donau befindet sich im ländlichen Raum. Mit 45% ist ein Großteil der
Fläche bewaldet, während 40% in landwirtschaftlicher Nutzung sind. Auf der Albhochfläche
im Norden findet Grünlandnutzung statt (15%), südlich der Donau tendenziell Ackerbau (25%).
Schutzgebiete umfassen 34,6% der Fläche.8
Der Naturpark Obere Donau e.V. und das Naturschutzzentrum Obere Donau, eine Stiftung des
bürgerlichen Rechts, welche vom Land Baden-Württemberg, den Landkreisen Sigmaringen,
Tuttlingen und Zollernalb sowie der Gemeinde Beuron getragen wird, haben beide ihren Sitz
im Haus der Natur in Beuron.
Die Institutionen sind von einer intensiven Zusammenarbeit zugunsten des Schutzes der viel-
fältigen Landschaft im Naturpark geprägt.
3.2.2. Aufgaben des Naturparks Obere Donau e.V.
Der Verein Naturpark Obere Donau e.V. ist Träger des Naturparks, der per Rechtsverordnung
1992 eingerichtet wurde. Der Verein setzt im Bundesnaturschutzgesetz und in der Verordnung
festgelegte Ziele im Auftrag des Landes Baden-Württemberg um. Schwerpunkte sind nach ei-
gener Satzung den Naturpark als Erholungslandschaft zu erhalten, entwickeln und dabei die
Vielfalt und Schönheit der unterschiedlichen Naturräume insbesondere für einen nachhalti-
gen Tourismus zu bewahren. Auf schützenswerte Tier- und Pflanzenarten sowie die Pflege von
ökologisch wertvollen Lebensräumen liegt ein Augenmerk. Dieses spiegelt sich zum Beispiel
durch das Ausweisen von Flächen mit seltenen Arten und Biotopen als Vorrangflächen, insbe-
sondere auch Natura 2000 Schutzgebieten, wider. Die Erholungsfunktion muss dabei mit an-
deren Nutzungsformen abgestimmt werden.9
Der in 2019 vom e.V. Naturpark Obere Donau entwickelte „Naturparkplan Obere Donau 2030“
hat sechs primäre Handlungsfelder ausgearbeitet:
1. Naturschutz und Landschaftspflege
2. Landnutzung und Regionalvermarktung
3. Nachhaltiger Tourismus und Sport
4. Tradition und Kultur
8
Naturpark Obere Donau e.V. 2019: 19
9
Naturpark Obere Donau e.V. 2019: 104
75. Bildung für nachhaltige Entwicklung
6. Information und Kommunikation
Damit orientiert er sich gezielt an den gesetzlichen Vorgaben eines Naturparks. Unter Punkt 1
finden sich auch die Ansätze, die Artenbestände durch Biotoptrittsteine und bessere räumli-
che Verknüpfung zu stabilisieren, sowie Wirksamkeitskontrollen für Sensibilisierungs- und Be-
sucherlenkungsmaßnahmen durchzuführen.10 Zu bemerken ist, dass ein Großteil der Ziele auf
Förderung und Erhaltung der Kulturlandschaft und eine nachhaltige Nutzung durch Tourismus,
Bildungseinrichtungen und Landwirtschaft ausgerichtet sind.
3.2.3. Ziele des Naturparks Obere Donau e.V. bezüglich Naturschutzes und Land-
schaftspflege
Die zunehmend großflächige Landwirtschaft, ein erhöhter Maisanbau um das Donautal, die
daraus resultierende Eutrophierung und ein erhöhter Stickstoffanteil in der Luft, führen zu
einer direkten Gefährdung an den Felsköpfen und den Magerstandorten. Auch durch den
Rückgang der Beweidung sind viele offene Magerstrukturen gefährdet. Ein Ziel ist es, kleine
landwirtschaftliche Betriebe und kulturhistorische Nutzungsformen zu fördern und diese wirt-
schaftlich zu machen. Außerdem ist ein Biotopverbund- und Pflegekonzept zu erarbeiten, in
welchem festgelegt werden soll, werde Offenlandflächen verbuschen können und welche zu
erhalten sind.11
Bezüglich der Natursportler findet sich in der Zielrichtlinie Folgendes:
„Die »klassischen« Sport- und Freizeitaktivitäten […] konnten in den letzten Jahren durch
Besucherlenkungsmaßnahmen und aufklärende Informationsvermittlung zufriedenstellend ge-
regelt werden“.12
Diese Aussage bezieht sich auf zahlreiche sportliche Aktivitäten im Naturpark, wie Kanufahren
auf der Donau. Auf die Frage ob dies bezüglich des Wanderverhaltens zutreffend ist, wird im
Laufe der Arbeit noch näher eingegangen.
3.2.4. Aufgaben und Ziel des Naturschutzzentrums Obere Donau
Das Naturschutzzentrum ist für die Betreuung der 44 Naturschutzgebiete und Biotope zustän-
dig. Auf der Homepage beschreiben sie dies folgendermaßen: „Je nach Bedarf reicht diese
10
Naturpark Obere Donau e.V. 2019: 13-17
11
Naturpark Obere Donau e.V. 2019: 62-63
12
Naturpark Obere Donau e.V. 2019: 63
8Betreuungsaufgabe von der bloßen Kontrolle der Einhaltung der Schutzgebietsverordnung bis
zur Planung und Durchführung von Pflegemaßnahmen“.13 Wo der Besucherdruck auf die
Landschaft besonders stark vorhanden ist, wird versucht ihn durch Besucherlenkungsmaßnah-
men zu regulieren. Dazu gehören Informationstafeln und Lehrpfade.
Das Naturschutzzentrum Obere Donau arbeitet dabei in Kooperation mit zahlreichen Gemein-
den, Verbänden, Landwirten und der Öffentlichkeit und versucht gemeinsame Aufgaben und
Projekte zu koordinieren. Insbesondere eine konstante Öffentlichkeitsarbeit ist Vorausset-
zung für ein Bewusstsein und eine Sensibilisierung gegenüber naturschutzfachlichen Themen.
Über Vorträge, Seminare, Exkursionen, Veranstaltungen, sowie eine Dauerausstellung im
Haus der Natur (diese in Zusammenarbeit mit dem Naturparkverein Obere Donau) werden
diese naturschutzfachlichen Themen Besuchern und Interessierten nähergebracht.
3.3. Wanderwege
Das Tal der Oberen Donau bietet mit seinen abwechslungsreichen Landschaftsbildern ein reiz-
volles Gebiet für Erholungssuchende. Die Kalkfelsen mit ihren vielen Aussichtspunkten sind
besonders für Wanderer attraktiv. Nach der Wahrnehmung des zuständigen Naturpark-
Rangers haben die Schäden an der Vegetation entlang von Wanderwegen zugenommen.
Wege werden breiter und es werden neue, inoffizielle Wege erschlossen. Den aktuellen Zu-
stand zu erfassen, ist das Ziel der Projektarbeit.
Die Aufnahme von Trittschäden erfolgt sowohl auf ausgewiesenen Aussichtspunkten und
Wanderwegen, als auch an Felsfußzonen (Zustiege der Kletterer), Offenlandflächen und Wald.
Diese Vielfalt an Nutzungsformen macht eine Bestimmung der Ursachen für Schäden schwie-
rig.
3.3.1. Wegekategorien
Bei einigen der untersuchten Wege handelt es sich um Premiumwanderwege. Diese zeichnen
sich durch eine besonders hohe Wegequalität aus und sollen den steigenden Ansprüchen der
Erholungssuchenden gerecht werden, sowie die Attraktivität der Region erhöhen. Sie werden
vom Naturpark speziell gefördert. Es sind kostenlose Tourenbeschreibungen erhältlich und die
meisten Wanderparkplätze sind mit Übersichtskarten ausgestattet. Premiumwanderwege
13
Naturschutzzentrum Obere Donau (o.J.)
9werden für jeweils drei Jahre ausgezeichnet. Danach werden sie erneut geprüft und zertifi-
ziert. Für die Zertifizierung müssen 9 Kernkriterien und 23 Wahlkriterien erfüllt sein, die sich
in fünf Bereiche unterteilen. Dazu zählen die Wegeführung, das Wanderleitsystem, die Infra-
struktur wie Parkplätze und gastronomische Angebote, die Landschaftsattraktivität und kultu-
relle Angebote. Je nach ihrer Bedeutung werden diese Kriterien unterschiedlich gewichtet und
als positiv oder negativ bewertet. Daraus wird eine Gesamtpunktzahl errechnet, die einen
Grenzwert überschreiten muss, um die Garantie der Wegequalität zu gewährleisten.14
Zusätzlich überschneidet sich der offizielle Weg mit dem Qualitätsweg „Donau-Zollernalb-
Weg“, der zusammen mit Weiteren einen in 14 Etappen gegliederten Rundweg von ca. 214
km über das Obere Donautal in die Südwestalb bildet. Anhand dessen wird deutlich, wie stark
frequentiert die untersuchten Wege sind.15
Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl an inoffiziellen Wegen und Trampelpfaden, die im Laufe
der Zeit durch Betretungen entstanden sind.
Mit einem großen Vorkommen an Felsen ist das Gebiet ebenfalls für Kletterer reizvoll. Grund-
sätzlich sind Felsen in Baden-Württemberg zum Klettern aufgrund ihres Wertes als Biotop der
speziellen Felsvegetation und insbesondere als Brutstätte für Vogelarten gesperrt. Um dieses
Erlebnis dennoch zu ermöglichen wurde im Jahr 2008 eine Kletterverordnung erlassen, die
2016 ergänzt wurde. Darin werden Freigaben für bestimmte Jahreszeiten eingeräumt, in de-
nen die Felsen in manchen Bereichen betreten werden dürfen. So darf beispielsweise der Ra-
benfelsen zwischen Mitte Juli bis Mitte Februar für den Klettersport genutzt werden. Voraus-
setzung dafür sind Zustiegswege. Diese sind eine behördliche Auflage und werden von Ehren-
amtlichen der IG- Klettern Donautal/Zollernalbkreis gebaut und unterhalten. Zum Schutz der
Vegetation dürfen ausschließlich diese Zustiegswege von den Kletterern genutzt werden, um
zu den Felsen zu gelangen.16
3.4. Besucherlenkung
An allen Abzweigungen der offiziellen Wanderwege sind Hinweisschilder verschiedener Träger
angebracht. Viele dieser Schilder sind von Kommunen, andere bspw. vom Schwäbischen Alb-
14
Naturpark Obere Donau e.V. (o.J.)b.
15
Donaubergland Marketing und Tourismus GmbH (o.J.)
16
IG-Klettern Donautal / Zollernalb e.V. 2014
10verein, welche die Entfernungen sowie besondere Sehenswürdigkeiten anzeigen. Ein Quali-
täts- bzw. Premiumwanderweg ist zusätzlich mit einem Siegel versehen. Auf den untersuchten
Felsköpfen gibt es keine Schilder oder sonstige Barrieren, mit Ausnahme des Bröllers und am
Rabenfelsen. Dort wird auf ein Betretungsverbot bzw. ein Biotop hingewiesen. Weitere Len-
kungsmaßnahmen sind nicht vorhanden.
3.5. Vegetation und Lebensräume
Das Obere Donautal bietet mit seinem Strukturreichtum vielfältige Lebensräume an. Aufgrund
von Zählungen geht man von mindestens 900 verschiedenen Pflanzenarten aus, die einen ho-
hen Anteil an Reliktarten aufweisen. Nach dem Ende der letzten Eiszeit und einer flächigen
Wiederbewaldung wurden viele Arten, die an offene Standorte gebunden sind verdrängt. Im
Oberen Donautal findet man daher Arten, die von besonderer Einzigartigkeit sind.
Die Felsmassive sind mit ihren großen Temperaturschwankungen, Substratarmut, starken
Sonneneinstrahlung und Wasserknappheit ein extremer Standort für die Vegetation. Dort
können nur Arten dauerhaft bestehen, die an diese Verhältnisse angepasst sind. Zu dieser so-
genannten Xerothermvegetation zählen beispielsweise das Heideröschen und die Pfingst-
nelke. Auch Orchideen wie das Helmknabenkraut und der Frauenschuh sind in großer Zahl zu
finden, kommen jedoch nicht direkt auf den Felsen vor.
Der Anteil des Waldes ist mit ca. 47% recht hoch und meist geprägt von Buchenwäldern, ge-
mischt mit weiteren Laubbäumen wie Esche, Bergahorn und Bergulme. Unmittelbar auf den
Felsköpfen findet man Kiefern und Felsenbirnen, vereinzelt auch Stieleichen.
Außerdem gibt es artenreiche Kalkmagerwiesen, die von der Naturschutzverwaltung kartiert
und für die, um einen dauerhaften Erhalt zu gewährleisten, oft Pflegeverträge mit Landwirten
abgeschlossen wurden.17
3.5.1. Artenschutzprogramm (ASP)
Seit Beginn der 90er Jahre wurden spezielle Artenschutzprogramme entwickelt, für die bis
heute mehr als 3.000 Pflanzenvorkommen erfasst und bei Bedarf besondere Schutz und Pfle-
gemaßnahmen entwickelt wurden. Das Artenschutzprogramm des Landes Baden- Württem-
berg ist im §39 des Naturschutzgesetzes verankert und ein wichtiges Instrument zum Schutz
und Erhalt von bedrohten Tier- und Pflanzenarten, als auch ihrer Lebensräume. Ziel ist es hoch
17
Naturpark Obere Donau e.V. (o.J.)c
11gefährdete, vom Aussterben bedrohte Arten, für die das Land eine besondere Verantwortung
hat, durch intensive Betreuung, Absprachen mit Grundstückseigentümern und Bewirtschaf-
tern, sowie mit Extensivierungs- und Pflegeverträgen dauerhaft zu erhalten.18
3.5.2. FFH Gebiet und Lebensraumtypen
Das Obere Donautal zwischen Beuron und Sigmaringen ist seit dem 1. Januar 2005 durch die
Regierungspräsidien Freiburg und Tübingen ein ausgewiesenes Schutzgebiet nach der Flora-
Fauna-Habitat Richtlinie. Deren Ziel ist es, wildlebende Pflanzen, Tiere und ihre natürlichen
Lebensräume durch die zunehmenden Gefährdungen zu schützen. 14% des Naturparks sind
FFH Gebiet. Alle Schutzgebiete zusammen haben eine Größe von 87.000 ha, wobei viele Flä-
chen mehrfach geschützt sind, z.B. als FFH-Gebiet, Vogelschutzgebiet und Naturschutzgebiet.
Von der gesamten Naturparkfläche sind 34,6% Schutzgebiete.19
Als Durchbruchstal der Donau durch die Schwäbische Alb weist dieses Gebiet eine enge Ver-
netzung von Extremstandorten (xerotherme Felsen, Schutthalden) mit einem hohen Anteil an
natürlichen Standorten mit seltenen und gefährdeten Arten auf.
Insbesondere der in der FFH- Richtlinie beschriebene Lebensraumtyp „Kalkfelsen mit Fels-
spaltenvegetation“ ist hier von großer Bedeutung. Darunter versteht man ein großflächiges
Gesteinsgebilde aus kalkhaltigem Material, welches einen speziellen Lebensraum für Flora
und Fauna darstellt. Flechten und Moose wachsen dort unmittelbar auf dem Felsen und er-
halten ihre Wasser und Nährstoffversorgung fast ausschließlich über die Luft oder herablau-
fendes Wasser. Zahlreiche Risse und Spalten durchziehen den Fels, in denen sich Sedimente
ablagern und so auch das Wachstum von höheren Pflanzen ermöglicht.
Sie sind überwiegend von geringer Größe (Farne, Polster, Rosettenpflanzen) und würden sich
auf weniger extremen Standorten nicht durchsetzen können.
Dieser spezielle Artenreichtum bietet auch für viele Tierarten einen Lebensraum. So finden
sich auf den blühenden Kalkmagerwiesen seltene Schmetterlinge und die Spalten der Felsen
stellen einen Brutort für beispielsweise Bienen, Wanderfalke und Kolkrabe dar.20 Weitere Le-
bensraumtypen, die im Untersuchungsgebiet liegen sind Orchideen- Buchenwald, Waldmeis-
ter- Buchenwald, Schlucht- und Hangmischwald, sowie Kiefernwald der sarmatischen Steppe.
18
Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 2019
19
Naturpark Obere Donau e.V. 2019: 11
20
Deutschlands Natur 2019
123.6. Stand der Forschung
Es ist schon lange bekannt, dass mit der Unterschutzstellung von Natur und Lebensräumen
ein Spannungsfeld zwischen Menschen (als Freizeitsportler, Touristen oder Erholungssu-
chende) und Natur zustande kommt. Schützenswerte Natur ist für Menschen landschaftlich
besonders reizvoll, sodass solche Naturräume häufig eine Vielzahl von Erholungssuchenden
anziehen.
Je nach Ausmaß, inwieweit die Nutzung durch den Menschen toleriert wird, können Raumty-
pen unterschieden werden. Wolf unterscheidet zwischen Taburäumen, in denen „ein sehr
weitgehend definierter Schutzzweck nur dann erreicht wird, wenn alle potentiell störenden
Nutzungen ausgeschlossen sind“ und Kulissenräumen, ausgezeichnet „durch hohen land-
schaftlichen Reiz und entsprechende Erholungseignung bei hoher ökologischer Belastbar-
keit“.21 Einen Kompromiss stellen demnach Naturerholungsräume dar:
„Solche naturnahen Bereiche in denen zwar der Naturschutz ebenfalls Vorrang vor anderen Flä-
chenansprüchen genießt, wo jedoch der Schutzzweck auch erfüllt werden kann, wenn hier in ein-
geschränkter Weise Freizeitaktivitäten der stillen Erholung (z.B. Wandern, Radfahren, Baden, Na-
turbeobachtung, Skilanglauf, Angeln) stattfinden“ (Wolf 1997:20).
Letzter Raumtyp wird den Zielen eines Naturparks am ehesten gerecht.
Eine Nutzung durch Freizeitaktivitäten setzt eine ausreichende Erschließung voraus. Schmitt
stellte bei seinen Untersuchungen einen Zusammenhang zwischen Erschließungsgrad und
dem Degradationsgrad fest. Die Vegetationsschäden nähmen „mit Siedlungsnähe und der
Nähe zu Parkplätzen und infrastrukturellen Einrichtungen […] zu“.22 Der Frage, ob dieser Zu-
sammenhang im Donautal ebenfalls besteht, wird in dieser Arbeit nachgegangen.
Die Forschungsergebnisse von Gotzmer zeigen, dass auch die Beschaffenheit eines Wander-
weges Einfluss auf die angrenzende Vegetation hat: „Ein Weg dem leicht zu folgen ist, bedeu-
tet, dass nur ein kleiner Teil der Vegetation dem touristischen Bedürfnis zum Opfer fällt“.23 Ist
das jedoch nicht der Fall, so verließen Wanderer die Wege, was zu Schädigungen der Vegeta-
tion und zu Erosion führe.
21
Wolf 1997: 20.
22
Schmitt 1999: 159
23
Gotzmer 2001: 51
13Weiterhin hebt Gotzmer hervor, dass „aufgrund der vernetzten ökologischen Abhängigkeiten“
das Aussterben einer einzigen Pflanzenart durch Trittschäden „das Aussterben von 10-20 Tier-
arten zur Folge haben kann“.24
Im Donautal handelt es sich bei den Felsbiotopen um vergleichsweise kleine Flächen, die Ge-
genstand des Biotopverbunds Offenland trockener Standorte sind. Die Exklusivität dieser
Standorte verstärkt ihre ökologische Bedeutung.
Herter hat in den Neunzigerjahren vegetationsökologische Untersuchungen an fast 20 Felsen
im Donautal unternommen, um die Beeinträchtigung durch „Verursacher von Biotopbelastun-
gen“ festzustellen. Für den Rabenfelsen gibt er bezüglich der Schäden folgende Beurteilung:
„Nur sehr kleinflächige Trittflächen durch Wanderbetrieb“ und weiter „keine besonderen
Maßnahmen erforderlich“.25
4. Methodik Datenerhebung
4.1. Verwendete Materialien
4.1.1. Karten
• Topographische Karten (TK 25/ TK 50) des Oberen Donautals
• Wanderwege des Oberen Donautals, Shapefile vom Regierungspräsidium (RP) Tübin-
gen (TÜ) bereitgestellt
• FFH-Lebensraumtypen und ASP-Flächen, Shapefile vom RP TÜ bereitgestellt
• Maps4BW
Koordinatenreferenzsystem: ETRS 1989 UTM Zone 32N, EPSG:25832
• Luftbilder vom Untersuchungsgebiet, bereitgestellt vom RP TÜ
4.1.2. Software
• ESRI ArcGIS
• MS Excel
• MS Paint
• MS Word
24
Gotzmer 2001: 50
25
Herter, 2000: 22
14• Mapit GIS
4.1.3. Zur Datenaufnahme verwendete Geräte
• Maßband, 10 m Schnur, Zollstock,
• Kamera
• Aufnahmebogen
• GPS-Gerät
• Mit Mapit GIS ausgestattete Tablets
4.2. Datenerhebung
4.2.1. Vorbereitungen zur Datenaufnahme
Im Vorfeld der Datenaufnahmen fanden Begehungen mit dem zuständigen Ranger im Natur-
park Oberes Donautal, Dipl. Forstingenieur Markus Ellinger und seiner Kollegin Samantha
Giering statt. Bei den gemeinsamen Begehungen wurde die Arbeitsgruppe mit dem Wander-
wegenetz und den Untersuchungsräumen vertraut gemacht. Ziel war ein Festlegen auf die zu
untersuchenden Flächen und Wege, sowie die Vermittlung eines ersten Eindrucks vom Aus-
maß der Schäden.
Nach umfassender Recherche zur Entwicklung eines „wissenschaftlichen, einfachen, aber
nicht laienhaften Aufnahmeschlüssels“ und in Abstimmung mit Herrn Ellinger und Frau Giering
wurde ein Schlüssel entwickelt, der die Beurteilung der Vegetation anhand des Deckungsgra-
des und einer subjektiven Einschätzung vorsieht.
Die Datenaufnahmen zum Vegetationszustand fanden an drei verschiedenen Terminen, zwi-
schen Ende Juli und Anfang September statt. Da sich der Zustand einer Vegetation vornehm-
lich in der Vegetationszeit feststellen lässt, kommt für die Datenaufnahmen nur ein begrenzter
Zeitraum infrage.
Der Zeitpunkt für auf Mobilen GIS basierende Aufnahme von Geodaten zu den offiziellen als
auch inoffiziellen Wegen war Ende Oktober. Herbst- und Wintermonate bieten für solche Auf-
nahmen wegen des fehlenden Blätterdaches gute Voraussetzungen.
154.2.2. Die Datenaufnahme zum vorliegenden Schadenszustand
Die verwendeten Hilfsmittel waren GPS-Gerät, Kamera, Maßband, Zollstock, eine 10m lange
Schnur und Aufnahmedokumente. Die Aufnahmebögen waren der jeweiligen Kategorie ange-
passt: Felskopf, Offenland und Wald wurden mit unterschiedlichen Methoden aufgenommen.
Um die Einheitlichkeit bei den Aufnahmen zu gewährleisten, übernahmen die Einschätzung
des vorliegenden Zustands stets dieselben Personen aus dem Team, während eine dritte Per-
son Protokoll führt.
Die Aufnahmemethode unterscheidet sich je nach Art des Biotops:
Waldwege
Auf Waldwegen wurde alle 10 m die Breite des Weges gemessen. Ein entscheidendes Krite-
rium bei der Abgrenzung des Weges ist die Vegetationskante auf beiden Seiten. Die 10 m lange
Schnur erleichterte es, einen einheitlichen Abstand zwischen den Aufnahmen einzuhalten.
Auffälligkeiten, wie bspw. hervorbrechende Wurzeln, wurden dokumentiert und mit einem
GPS- Punkt aufgenommen. An Kehrtwenden des Weges, an denen erhebliche Trittschäden
und Erosionsmerkmale vorzufinden waren, wurde die Fläche der betroffenen Stelle mithilfe
von zwei Zollstöcken ermittelt. Außerdem wurde Standort mit dem GPS-Gerät ermittelt und
im Protokoll mit Nummer hinterlegt. Markante Stellen wurden auf Fotos festgehalten und
ebenfalls mit Nummer im Protokoll notiert.
Offenland
Die Aufnahmemethode im Offenland war differenzierter als die im Wald, denn es fand zusätz-
lich eine gutachtliche Einschätzung des Störungsgrades der Vegetation statt. Im Abstand von
10 Metern wurden rechts und links des Weges die beiden Zollstöcke ausgelegt. Mit diesen
wurde jeweils ein Transekt mit einer Länge von insgesamt 160 cm und einer Breite von 40 cm
gebildet.
Die Beurteilung des Zustands orientierte sich hauptsächlich am Deckungsgrad; dabei wurde
berücksichtigt, dass der natürliche Deckungsgrad in besonders steilem Gelände grundsätzlich
gering ist. Die Neigung an der Aufnahmestelle wurde mit Hilfe von zwei Zollstöcken und einer
Wasserwage gemessen und mit dem Dreisatz ausgerechnet (in Prozent). Ausgehend von der
Mitte des Weges, wo sich die beiden Transekte berührten, fand die Zustandsbeschreibung im
Abstand von 20 cm, d.h. für jeweils eine Fläche von 20 cm x 40 cm, statt. Die Bewertungsskala,
16welche von null bis vier Punkte reicht, wird im Folgenden als Störungsgrad bezeichnet. Diese
bedeutet im Einzelnen:
0 = intakte Vegetation
1 = leicht gestört (mehr als „1%“ bis 1/3 der Vegetation gestört)
2 = mäßig gestört (mehr als 1/3 bis 2/3)
3 = stark gestört (mehr als 2/3 bis „99%“)
4 = vegetationslos
Felsköpfe
Im Untersuchungsgebiet gibt es offizielle und inoffizielle Stichwege, die zu Felsköpfen führen.
Aufgrund der unregelmäßigen Fläche von Felsköpfen war die Aufnahme von Transekten hier-
bei erschwert. Daher wurde auf die Aufnahme von Transekten verzichtet und stattdessen die
Gesamtfläche der Felsköpfe geschätzt. Zusätzlich wurde eine Skizze angelegt. Nach Einschät-
zung des natürlichen Deckungsgrades fand die gutachtliche Zuordnung zu einem Störungsgrad
statt. Des Weiteren wurde im Oktober die Fläche der Felsköpfe mit Mobilen GIS als Polygone
aufgenommen.
4.3. Datenaufnahme inoffizieller und offizieller Wege
Anfang November wurde eine abschließende digitale Datenaufnahme im Naturpark durchge-
führt. Inoffizielle Wege, zum Beispiel Abkürzungen in einer Serpentine oder Stichwege, die zu
Aussichtspunkten führen, aber auch die offiziellen Wanderwege und besondere Punkte wie
zum Beispiel Beschilderungen, wurden mit Hilfe eines mobilen GIS-Gerätes über das Pro-
gramm „Mapit GIS“ aufgenommen.
Das Mobile GIS- Gerät nutzt das Global Positioning System (GPS) zur Positionsbestimmung.
Das globale Navigationssatellitensystem nutzt WGS84 als Bezugssystem. Die zugrundelie-
gende Rechenfläche dieses geodätischen Bezugssystems ist der WGS84 Ellipsoid. Der Ur-
sprung des Koordinatenreferenzsystems befindet sich im Massenmittelpunkt der Erde. Die
Bestimmung eines Standorts ist unter guten Witterungsbedingungen (keine Wolkendecke o-
der Niederschlag) und uneingeschränktem Empfang (keine Abschirmung des Empfangs durch
ein Kronendach oder Felsen) auf wenige Meter genau möglich.
17Das aktuelle, deutschlandweite amtliche Lagebezugssystem ist das ETRS89 (European Terrest-
rial Reference System 1989).26 Für die Datenaufnahmen dieser Projektarbeit, welche in Baden-
Württemberg stattfinden, eignet sich dieses Bezugssystem gut, da das geodätische Datum an
die eurasische Platte gebunden und damit in sich konstant ist.27
4.4. Validität der Datenaufnahme
Da es sich bei den Untersuchungsobjekten um nach Naturschutz- bzw. EU-Recht streng ge-
schützte Lebensraumtypen mit äußerst seltenen und spezialisierten Pflanzenarten handelt,
wurde von einer Artenbestimmung abgesehen. Die gutachterliche Beurteilung von Trittschä-
den an der Vegetation erfüllt jedoch die Anforderungen seitens des Projektpartners und
stellte eine leicht nachvollziehbare Grundlage für nachfolgende Vergleichsuntersuchungen
dar.
Bei den GPS-Daten existiert darüber hinaus mit der der Projektgruppe verfügbaren Technik
eine Abweichung der Daten von zwei bis fünf Metern. Eine differentielle Korrektur, die zur
Reduktion dieser Ungenauigkeiten beigetragen hätte, konnte wegen Inkompatibilität zwi-
schen der bereitgestellten „Mapit GIS“-Version auf dem Tablet und den GPS Daten von Basis-
stationen, die diese Korrekturdaten zur Verfügung stellen, nicht durchgeführt werden.
5. Ausarbeitung Excel und GIS
Alle aufgenommenen Daten werden in Abhängigkeit von der Art des Lebensraumes (Offen-
land, Wald, Felskopf) in Excel-Tabellen eingepflegt. Da die Datenaufnahmemethodik für Wald-
wege, Offenland und Felsköpfe jeweils angepasst wurde, erfolgt im Folgenden eine Beschrei-
bung der Vorgehensweise zur GIS Darstellung je nach Untersuchungsgegenstand.
5.1. Waldwege
5.1.1. Aufbereitung der Geodaten
Die dokumentierten Waldwegebreiten werden getrennt nach Herkunft der Daten (Untersu-
chungsgebiet Rabenfels und Kreuzfels) in der Excel-Datei aufgelistet.
Auf dieser Grundlage findet die Visualisierung in ArcGIS statt:
26
Vermessungsbüro Jörg Schröder (o.J.)
27
Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung 2019
18In die digitale Karte werden sowohl shapefiles mit offiziellen bzw. inoffiziellen Wegen (poly-
line) und Flächen auf Felsköpfen (polygone) als auch durch Punkte (points), die Beschilderun-
gen oder Ähnliches darstellen, eingefügt. Bei den eingepflegten shapefiles handelt es sich um
die mit „Mapit GIS“ aufgenommenen Daten.
Zur Weiterarbeit mit den Geodaten ist eine Vereinheitlichung des Koordinatenreferenzsys-
tems notwendig.
Bevor mit der Verarbeitung der Feldaufnahmen begonnen werden kann, wird eine Projektion
der räumlichen Daten durchgeführt. Dies geschieht mit dem Tool „project“. Nachdem das Be-
zugssystem des Dataframe des Projektes auf ETRS89 festgelegt wurde, werden die shapefiles,
die bei den mobilen GIS-Aufnahmen entstanden sind (offizielle und inoffizielle Wege, sowie
Punktdaten von Schildern bzw. Besuchereinrichtungen), von WGS84 in das Bezugssystem
ETRS89 projiziert.
Für die Transformation wurde folgender Rechenweg ausgewählt:
„DHDN_To_ETRS_1989_8_NTv2+DHDN_to_WGS_1984_4_NTV2“.
Das Bezugssystem des dataframe wird auf ETRS89 festgelegt.
Ein Abgleich der Geodaten mit den Luftbildern macht deutlich, dass Teile der aufgenommenen
polylines in Terrain verlaufen, das unmöglich von der Projektgruppe hätte begangen werden
können. Dies trifft insbesondere auf die Kletterzustiege an der Rabenwand zu. Dem Umstand
geschuldet, dass zu einer Seite der Fels flächig mehrere Dutzend Meter in die Höhe ragt, ist
eine exakte Positionsbestimmung mit dem verwendeten GPS-Gerät nicht möglich. Diese Linien
werden mittels Editors korrigiert. Die Luftbilder dienen dabei der Orientierung.
5.1.2. Erzeugung von Aufnahmepunkten
Um die Daten der Feldaufnahmen zur Wegebreite in ArcMap zu visualisieren, wird gemäß den
Messungen alle 10 m ein Punkt auf den Linien, welche die offiziellen Wege darstellen, gesetzt.
Zu diesem Zweck wird das Tool „Construct Points“ aus dem Editor verwendet. Diese
automatisch erzeugten Punkte werden anschließend mit den Notizen der Aufnahmen
verglichen und die Anzahl der Punkte gegebenenfalls angepasst. Anpassungen in geringem
Umfang (i.d.R. 0 - 10% Abweichung von den Feldaufnahmen) sind notwendig, wenn
19beispielsweise in einer engen Kurve starke Erosionserscheinungen festgestellt wurden und
deshalb die Fläche der betroffenen Stelle, anstatt der Wegebreite, gemessen wurde.
Im Anschluss an die Erzeugung von Punkten auf den offiziellen Wegelinien findet die Ergänzung
der Attributtabelle der neu erstellten feature classes „Kreuzfels_Wegebreite_select“ und
„Rabenfels_Wegebreite_select_1“ statt. Dabei wird einerseits die Wegebreite in die Tabelle
eingepflegt und andererseits werden Auffälligkeiten wie starke Störungen auf dem Weg
vermerkt.
5.1.3. Symbolik
Der Betrachter der Karte soll einen Überblick von den Stellen mit starken Störungen und von
solchen mit wenigen Störungen bekommen. Dazu wird die Symbolik für die Wegebreite und
die Auffälligkeiten in den Layer Properties angepasst und als gruppierten layer „4_Wegebreite
u. Auffälligkeiten“ abgespeichert. Das Value-Field ist die Wegebreite. Das Spektrum reicht von
50 bis 200 cm. Die Einteilung erfolgt in sechs gleich große Klassen mit einer Klassengröße von
25 cm. Den unterschiedlichen Wegeklassen werden Farben (von grün bis rot und schwarz für
außergewöhnliche Schädigungen) zugeordnet und größeren Wegebreiten werden durch grö-
ßere Symbole dargestellt.
5.1.4. Prozentualer Anteil eines Weges in einem Lebensraumtyp
Methodik
Die Lebensraumtypen sind in den Untersuchungsgebieten unterschiedlich stark vertreten,
ebenso die kartierten Flächen mit ASP-Arten. Um den prozentualen Anteil der LRT am Gesamt-
weg herauszufinden, wird wie folgt vorgegangen:
Zunächst wird mit dem Tool Buffer aus der vereinfachten Linie der mit mobilen GIS aufgenom-
menen Daten ein Polygon erstellt. Der Puffer wird im Abstand von einem Meter entlang des
Weges erstellt. Mit der Darstellung des Weges als Fläche werden Anteilsberechnungen ermög-
licht. Dies geschieht sowohl für die inoffiziellen als auch für die offiziellen Wege.
Des Weiteren werden die im Ug. liegenden LRT und ASP-Flächen selektiert, damit die LRT ge-
trennt betrachtet und Berechnungen durchgeführt werden können.
Anschließend werden die Wege mit den kartierten Flächen (LRT, ASP) verschnitten. Dazu wird
das Tool Clip verwendet. Das Ergebnis dieses Teilschrittes sind „ausgeschnittene Wegeab-
schnitte“, welche jeweils in nur einer Schutzgebietsfläche vorkommen.
20In der Attributtabelle dieser Layer ist bereits die Flächengröße der Wegeabschnitte hinterlegt.
Diese Fläche wird nun in Relation zu der Gesamtfläche des Wege-Polygons gesetzt. Die Be-
rechnung findet in einer neu angelegten Spalte der Attributtabelle statt und wird mit dem
Field-Calculator durchgeführt:
Rechnung: Shape Area (Wegeabschnitt in Schutzgebiet) / Shape Area (Gesamtweg) = Anteil
eines Schutzgebietes auf dem Weg in Prozent
Die Berechnung eines Feldes ist ausschließlich nach Aktivierung des Editors möglich.
Ergebnis
Alle untersuchten Flächen und Wege liegen in einem kartierten Lebensraumtyp. Betrachtet
man die offiziellen Wanderwege, befindet sich der größte Anteil von diesen in Waldmeister-
Buchenwäldern (41%), gefolgt von Orchideen- Buchenwäldern (36,6%). Deutlich geringere An-
teile zählen zu den Lebensraumtypen Schlucht- und Hangmischwald (9,9%) und Kalkfelsen mit
Felsspaltenvegetation (7,7%). Lediglich ein kurzer Abschnitt des Weges durch Offenland führt
durch Steppen- Kiefernwald (0,6%). Betrachtet man allerdings die inoffiziellen Wege, steigt
der Anteil im Lebensraumtyp Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation deutlich an (20,3%). Dies
lässt sich dadurch erklären, dass sich die Besucher bevorzugt Wege zu den Felsköpfen suchen,
um eine Aussicht auf das Donautal zu haben. Der größte Anteil der inoffiziellen Wege liegt im
Lebensraumtyp Orchideen-Buchenwald (23,4%), gefolgt vom Waldmeister-Buchenwald
(20,7%). Der Lebensraumtyp Schlucht- Hangmischwald ist nur geringfügig betroffen (4,6%).
Durch Steppen- Kiefernwald führt kein inoffizieller Weg.
Weitere Überschneidungen von offiziellen und inoffiziellen Wegen gibt es mit vier Arten des
Artenschutzprogramms (ASP). 27,3% der offiziellen Wege führen durch das Gebiet der Ge-
birgsschrecke. Ähnlich verhält es sich bei den inoffiziellen Wegen (30%). Das Scharfkraut
(6,3%) hingegen wird durch die inoffiziellen Wege nicht gefährdet. Beim Berglaubsänger gibt
es allerdings einen Anstieg bei den inoffiziellen Wegen um 13,8%, bei der Dohle sind es sogar
40%. Somit sind ist bei diesen beiden Arten eine Beeinflussung bzw. Störung durch Besucher
zu verzeichnen. Vor allem bei der Dohle können Störungen dazu führen, dass keine Brut in den
Felsspalten stattfindet.
215.2. Felsköpfe
Bei den Felsköpfen wurde die Flächengröße qualifiziert geschätzt und der Störungsgrad in sei-
ner Gesamtheit gutachterlich erfasst. Dabei werden der natürliche Deckungsgrad und der An-
teil der vegetationslosen Fläche angeschätzt. Auch dieser wird per GIS als Fläche (polygon) auf
einer Karte dargestellt.
5.3. Offenland
Methodik
Beim Offenland wird die Gesamtbewertung jedes Transektes aus den Einzelabschnitten be-
rechnet. Diese ergibt sich aus der Summe der vergebenen Punkte nach Kapitel 3.2.2. (Stö-
rungsgrad 0 (intakt) bis 4 (vegetationslos)). Je höher das Ergebnis ist, desto kritischer ist der
Zustand dieses Wegeabschnitts. In Tabelle 1 ist diese Bearbeitung per Excel ersichtlich.
O1 bergseitig O1 donauseitig
Wege-breite 0,65
Nat. Deck. 95% 95%
Schirm
Neigung
50%
0-20 cm
4 4
bis 40
3 1
bis 60
3 1
bis 80
2 1
bis 100
1 0
bis 120
3 0
bis 140
1 0
bis 160
1 0
F98-102; weiter
Bemerkungen oben am Hang
gestörte Stelle ca
9m²
Summe 18 7
Strecke (m)
10 10
Tabelle 1: Beispiel für Verarbeitung mit Excel von Offenlanddaten.
Die größte Herausforderung für die Darstellung von den aufgenommenen Transekten war die
Abbildung von diesen an einem bestimmten Punkt für die der Donau zugewandte Fläche und
22der bergseitigen Fläche. ArcGIS Pro verfügt über ein Tool zur Abbildung von Transekten, dieses
ist in der uns vorliegenden Standard- ArcGIS- Version allerdings nicht vorhanden.
Die Punkte, an denen Transekte aufgenommen wurden, werden mit dem bereits bei den
Waldwegen angewandtem Tool Construct Points entlang der Offenlandwege erstellt.
Wie bereits erläutert, erhielt jeder Aufnahmepunkt im Offenland eine Gesamtwertung, da auf-
grund der geringen Auflösung auf der Karte eine Darstellung der einzelnen Abschnitte in 20cm
Abständen nicht möglich gewesen wäre. Jedes Transekt (mit 1,60m Länge) besitzt 8 Ab-
schnitte (mit jeweils 20cm Länge). Die Summe der Störungsgrade von 0 (intakte Vegetation)
bis 4 (vegetationslos) können für ein gesamtes Transekt Werte zwischen 0 und 32 annehmen.
Unsere Auswertung ergab Werte zwischen 4 und 27. Diese Werte wurden über edit in den
Attributtabellen ergänzt. Aufgrund der vorliegenden Verteilung wurde folgende in Tabelle 2
gezeigte Skala für die Einteilung in classes und der Darstellung der Transekte ausgewählt
(über: layer properties – symbology – quantities – graduated Color):
Werte 1-7 8-11 12-15 16-19 20-23 24-27
Schädi- Sehr Stark Extremer
Niedrig Mittel Höher
gung niedrig Erhöht Schaden
Stufe 1 2 3 4 5 6
Farbe
Tabelle 2: Schädigungsstufen und Kartenfärbung über die addierten Werte der acht Abschnitte eines Transekts.
Die Werte dieser Skala werden im Folgenden Schädigungsstufen genannt.
Die mit Construct Points erstellten Aufnahmepunkte werden pro Offenlandabschnitt als zwei
separate Layer dargestellt: Einer für die der Donau zugewandten Transekte, ein anderer für
die bergeseitig ausgerichteten Transekte. Diese wurden halbmondförmig abgebildet und ber-
geseitig oder donauseitig ausgerichtet übereinandergelegt. Die layer wurden als „7_Offen-
land“ abgespeichert.
Folgende Darstellungen haben sich daraus ergeben:
23Sie können auch lesen