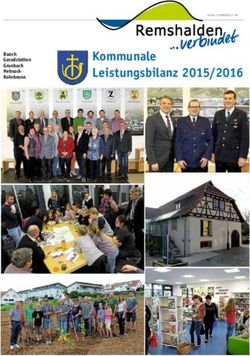WALDBERICHT 2017 - Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten - Bayern.de
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Bayerisches Staatsministerium für
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
WALDBERICHT 2017
WALDBERICHT 2017
BAYERISCHE FORSTVERWALTUNG
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
W W W.FORST.BAYERN.DE
a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a aVORWORT
Witterungsextreme und Schädlinge stellten in den vergan- Der vorliegende Bericht
genen Jahren die Wälder und ihre Besitzer vor hohe, ja teil- gibt einen Überblick über
weise vor extreme Herausforderungen. Stürme, Trockenheit, die Entwicklungen in den
Hitze und Waldbrände machen unseren Wäldern und Wald- vergangen drei Jahren.
besitzern genauso zu schaffen wie Massenvermehrungen Die Kronenzustandserhe-
heimischer Borkenkäfer. Invasive neue Schadorganismen bung zeichnet ein stabiles
wie der Asiatische Laubholzbockkäfer oder das Eschentrieb- Bild unserer Waldbestän-
sterben gefährden klimatolerantere Baumarten, die wir für de. Positiven Trends wie
den Waldumbau dringend benötigen. Gleichzeitig zeigten beim Zustand von Buche
die Starkregen, wie dringend intakte Wälder zum Schutz von und Tanne stehen Zunah-
Leib und Leben, Hab und Gut benötigt werden. Hier gilt es men aggressiver Schäd-
weiter zu forschen, wie wir die Wälder von heute erhalten linge und Wetterunbilden
und jene von morgen mit bestmöglichen Erfolgsaussichten gegenüber. Die Ergebnis-
begründen können. se belegen jedoch, dass
unsere Wälder in einem
Nach wissenschaftlichen Prognosen müssen wir uns auch guten Zustand sind und unsere Erhaltungs- und Umbau-
zukünftig auf vergleichbare oder sogar noch kritischere Situ- maßnahmen Früchte tragen. Die Arbeit vieler Generationen
ationen einstellen. Deshalb sehe ich es als vordringliche Auf- von Waldbesitzern und Forstleuten hat die Wälder Bayerns
gabe, unsere für das Allgemeinwohl so wichtigen Wälder zu einem wertvollen Schatz gemacht. Es ist unsere an-
noch schneller an die künftigen Bedingungen und Anforde- spruchsvolle Aufgabe, unsere bayerische Waldheimat auch
rungen anzupassen. Dazu hat die Staatsregierung auf meine für die Zukunft zu sichern.
Initiative hin die „Waldumbauoffensive 2030“ beschlossen,
die unser erfolgreiches Waldumbauprogramm in den nächs- Ich wünsche mir, dass alle Verantwortlichen weiterhin mit
ten 10 Jahren mit 200 Millionen Euro und 200 neuen Förster- Weitblick mit unseren Wäldern umgehen und die Bürgerin-
stellen nochmals deutlich intensiviert. nen und Bürger in Bayern sich für den Wald und seine natur-
nahe nachhaltige Nutzung einsetzen.
Insgesamt steigen die vielfältigen gesellschaftlichen An-
sprüche an den Wald, obwohl oder gerade weil die fort- München im Oktober 2017
schreitende Urbanisierung die Menschen mehr und mehr
von Natur und Urproduktion entfernt. Teilweise wird die
Nutzung des Waldes als Lieferant des nachwachsenden Roh-
stoffs Holz kritisch gesehen, obwohl heimisches Holz beliebt
ist und in Zukunft z. B. für den Wohnungsbau immer wichti-
Helmut Brunner
ger wird. Dafür rücken Freizeit- und Erholungswert des Wal-
Bayerischer Staatsminister für Ernährung,
des sowie Wünsche nach „mehr Wildnis im Wald“ stärker in
Landwirtschaft und Forsten
den Vordergrund. Von der Forstwirtschaft ist heute ein diffe-
renziertes Handeln sowie aktiver Dialog mit den Bürgern ge-
fragt. Die bayerischen Waldbesitzer vereinen die gesell-
schaftlichen Anforderungen in ihrem integrativen Ansatz
des „Schützen und Nutzen“ auf gleicher Fläche und berück-
sichtigen ökonomische, ökologische und soziale Aspekte im
Wald ausgewogen. Ich bin überzeugt, dass Bayern so den
richtigen Weg geht, um unsere Wälder mit ihren vielfältigen
Funktionen für nachfolgende Generationen zu erhalten.6 a ZUSAMMENFASSUNG 8 a 1 WALD UND ÖFFENTLICHKEIT 9 a 1.1 Forstwirtschaft in stürmischen Zeiten: Ein (selektiver) Rückblick auf 100 Jahre Forstgeschichte in Bayern 12 a 1.2 Wald und Forstwirtschaft im Klimawandel 16 a 1.3 Waldumbauoffensive 2030 „Zukunftswald schaffen – Heimat sichern!“ 18 a 1.4 Bergwald und Schutzwaldsanierung 20 a 1.5 Aktionsjahr Waldnaturschutz 22 a 2 DER ZUSTAND DES WALDES 23 a 2.1 Informationstechnologie im Wald 25 a 2.2 Witterung 27 a 2.3 Stoffeinträge 29 a 2.4 Waldernährung und Boden 31 a 2.5 Schäden am Wald 34 a 3 WALD UND ÖKOLOGIE 35 a 3.1 Integrative Waldbewirtschaftung als Ausgleich zwischen den unterschiedlichen gesellschaftlichen Interessen 37 a 3.2 Natura 2000 auf der Fläche angekommen 40 a 3.3 Neue Naturwaldreservate für Bayern 42 a 3.4 Schutz der Raufußhühner
45 a 4 WIRTSCHAFTSFAKTOR WALD
46 a 4.1 Cluster Forst und Holz – Starke Branchen im ländlichen Raum
48 a 4.2 Wirtschaftliche Lage der Forstbetriebe
52 a 4.3 Holzwirtschaft und Energieerzeugung aus Holz
55 a 4.4 Holz – Rohstoff der Zukunft und Schlüssel einer biobasierten Wirtschaft
56 a 5 WALD UND GESELLSCHAFT
57 a 5.1 Unterstützung der Waldbesitzer
62 a 5.2 Waldfunktionsplanung und Ökosystemdienstleistungen
64 a 5.3 Jagd und Gesellschaft
66 a 5.4 Waldpädagogik
68 a 6 ANHANG: KRONENZUSTAND
INHALTZUSAMMENFASSUNG
Mit Beschluss vom 27.05.2009 (Drs. 16/1451) hat der Bayerische Landtag die Staatsregie-
rung beauftragt, alle drei Jahre umfassend über den Zustand der Wälder und über wichti-
ge Entwicklungen in der Forstwirtschaft zu berichten. Aufgrund der Präsentation der
Ergebnisse der Bundeswaldinventur im Herbst 2014 war der Waldbericht 2014 auf das Jahr
2015 verschoben worden. Mit dem Bericht 2017 wird nun der reguläre dreijährige Turnus
wieder hergestellt.
DER ZUSTAND DES WALDES WALD – ÖKOLOGIE UND ÖKONOMIE
Besonders großen Einfluss auf die Vitalität des Waldes hatte Die im Jahr 2012 durchgeführte dritte Bundeswaldinventur
in den vergangenen drei Jahren der extrem heiße und tro- belegt nachdrücklich, dass der Bayerische Weg des „Schüt-
ckene Sommer im Jahr 2015. Unter dessen Auswirkungen zen und Nutzens“ auf ganzer Fläche sich bewährt hat. In
litt der Wald auch noch in den Folgejahren. Insbesondere Bayerns Wäldern hat der Anteil an Laubbäumen in den Jah-
die Fichte zeigte deshalb bei der Inventur des Kronenzu- ren 2002 – 2012 um vier Prozentpunkte auf 36 Prozent zuge-
stands im Folgesommer 2016 mit einem Anteil der Schad- nommen, in den jüngeren Waldbeständen liegt er sogar bei
stufen 2–4 (deutliche Schäden) von 29,1 Prozent einen ho- 54 Prozent. Gleichzeitig werden Bayerns Wälder immer älter.
hen Wert, der bei der Inventur im Jahr 2017, die vor den Stür- Das Durchschnittsalter der Wälder liegt mit 83 Jahren über
men erfolgte, wieder auf 22,3 Prozent zurückging. dem bundesweiten Durchschnitt von 77 Jahren. Bewirt-
Zunehmend hoch war in den vergangenen drei Jahren auch schaftung und Naturschutz im Wald können sich in vielfälti-
die Gefährdung der Fichte durch Borkenkäfer. Ein Auslöser ger Weise ergänzen und bereichern. Gerade durch die Ver-
dafür waren die Stürme der vergangenen Jahre. Auch im knüpfung beider Aspekte entsteht ein multifunktionaler
Jahr 2018 ist daher mit einer deutlich angespannten Situa- Wald, der den vielfältigen Ansprüchen der Gesellschaft ge-
tion zu rechnen. recht werden kann. Zu einem integrativen Waldnaturschutz
Sorge bereiten eine Reihe neuer Krankheiten aus anderen gehören neben der Begründung und Pflege naturnaher
Erdteilen. So hat das Eschentriebsterben, das von einem aus und stabiler Mischwälder vor allem auch die Erhaltung
Asien stammenden Pilz ausgelöst wird, inzwischen fast das wichtiger Strukturelemente – wie zum Beispiel von ausrei-
gesamte natürliche Verbreitungsgebiet der Esche durch- chend Totholz und Biotopbäumen im Wirtschaftswald.
drungen. Als Folge der Krankheit stirbt inzwischen ein er- Auch hier weist die Bundeswaldinventur überdurchschnitt-
heblicher Anteil der erkrankten Eschen ab. Sogar in jungen lich hohe Anteile des Totholzes von rund 22 Kubikmeter pro
und mittelalten Beständen sind hohe Mortalitätsraten fest- Hektar für Bayern auf.
zustellen. Tote Äste im Kronenbereich verursachen oftmals Die Bewirtschaftung von älteren Fichtenreinbeständen wird
eine Gefährdung für die Arbeits- und Verkehrssicherheit. inzwischen nicht selten von Sturm, Hitzeperioden oder Bor-
Unter besonderer Beobachtung standen in den vergange- kenkäferbefall diktiert. Die Fichte ist mit einem Anteil von
nen Jahren weitere invasive Arten aus anderen Erdteilen, knapp 42 Prozent die häufigste Baumart in Bayern. Deswe-
wie zum Beispiel der Asiatische Laubholzbock. Durch ein gen wird das bestehende bayerische Waldumbaupro-
konsequentes Beseitigen der befallenen Bäume konnte der gramm deutlich intensiviert. Bis zum Jahr 2030 sollen in
Schaden relativ gering gehalten werden. Da weitere invasi- einer von der Staatsregierung beschlossenen „Waldumbau-
ve Arten beobachtet werden, ist zu erwarten, dass das Mo- offensive 2030“ im Privat- und Körperschaftswald 200 000
nitoring dieser Quarantäneschädlinge zusätzliche Arbeits- Hektar Nadelholzreinbestände in stabile und klimatoleran-
kapazitäten binden wird. tere Wälder umgebaut werden. Diese herausragende Auf-
Das Auftreten neuer Schädlinge, die Häufung von Stürmen gabe bedarf des großen Engagements der Waldbesitzerin-
und außergewöhnlichen Witterungsereignissen wie unge- nen und Waldbesitzer und der Forstleute sowie klarer Pla-
wöhnliche Hitze- und Trockenphasen werden von der Wis- nung und kompetenter, moderner Vor-Ort-Beratung. Schon
senschaft inzwischen deutlich als Folgen des Klimawandels jetzt sind im Nachtragshaushalt für das Jahr 2018 zur Umset-
betrachtet. zung der Waldumbau-Offensive 20 neue Stellen in der
Forstverwaltung vorgesehen. Zusätzliche Mittel in Höhe
von 100 Millionen Euro stehen für die Bewältigung der
Schäden durch den Sturm Kolle (August 2017) für die Wald-
besitzerinnen und Waldbesitzer bereit.Bayerische Forstverwaltung a Waldbericht 2017 a Seite 6 – 7
WIRTSCHAFTSFAKTOR WALD WALD UND ÖFFENTLICHKEIT
Holz aus bayerischen Wäldern ist ein wertvoller heimischer Staatsminister Brunner hat in seiner Regierungserklärung im
Rohstoff. Wie die Ergebnisse der Clusterstudie 2015 zeigen, Juli 2014 ein Aktionsjahr „Waldnaturschutz“ für das Jahr 2015
hat sich der Cluster Forst und Holz mit einem Umsatz von ausgerufen. Eine Vielzahl von Aktionen begleiteten das Jahr
über 37 Mrd. Euro und 196.000 Beschäftigten besonders im 2015 und machten auf die Bedeutung des Waldnaturschut-
ländlichen Raum als wichtiger Arbeitgeber und Wirtschafts- zes, aber auch des Waldes selbst, aufmerksam. Eine Evaluie-
faktor etabliert. Ausgehend von einer guten Rohstoffversor- rung des Aktionsjahres zeigte das große Interesse der Öf-
gung, qualifizierten Beschäftigten und leistungsfähigen fentlichkeit an „ihrem“ Wald in Bayern. Es zeigte aber auch,
Unternehmen sowie aufnahmefähigen Märkten bietet der dass ein gemeinsames Vorgehen aller am Thema Wald Be-
bayerische Cluster Forst und Holz nachhaltiges Wachstums- teiligten sinnvoll und notwendig ist, um in der von Informa-
potenzial. Als Zugpferd und Motor der wirtschaftlichen Ent- tionen überfluteten Medienlandschaft Gehör und damit
wicklung hat sich in den vergangenen Jahren der Holzbau Akzeptanz zu finden.
erwiesen. Mittlerweile wird jedes fünfte Wohngebäude in Über Jahre bewährt und weiter erfolgreich ist das waldpäd-
Bayern als Holzbau geplant und realisiert. Durch die dauer- agogische Angebot in Bayerns Wäldern. Die Försterinnen
hafte Bindung von CO2 trägt das Bauen mit Holz zum Klima- und Förster konnten in den vergangenen Jahren jährlich
schutz bei. rund 180 000 Menschen, davon 118 000 Schülerinnen und
Der Waldumbau wird zukünftig zu einem höheren Laub- Schüler, zu Veranstaltungen und Führungen im Wald begrü-
holzangebot und damit zu anderen Rohstoffsortimenten ßen. Dabei ist auch Inklusion ein wichtiges Thema; unter
für die Holzverarbeitung führen. Die Entwicklung neuer, in- dem Namen „SINNESWANDELN“ wurde z. B. im April 2016
novativer und markttauglicher Produkte aus Laubholz ist am Walderlebniszentrum Gramschatzer Wald bei Würzburg
eine der wichtigsten und anspruchsvollsten Aufgaben von ein barrierefreier Walderlebnispfad eröffnet.
Forschung und Entwicklung in den kommenden Jahren. Neue Wege der Zusammenarbeit entstehen auch im digita-
Dabei bieten neue Anwendungsbereiche für Holz durch die len Bereich. Ein gefragtes Vorhaben ist die Bürgerplattform
Entwicklung innovativer Produkte und Prozesse auch die „Wildtiere in Bayern“. Sie bietet den Beteiligten vor Ort nicht
Chance, neuen Anforderungen einer biobasierten Wirt- nur Informationen, sondern auch ein Instrument, mit dem
schaft gerecht zu werden. Die Kombination mit anderen eine transparente Kommunikation und eine offene Diskus-
Materialien und die Zusammenarbeit mit anderen Indust- sion möglich sind.
rien sind sicherlich Schlüsselfaktoren für den Cluster Forst Die Ansprüche an den Wald nehmen laufend zu. Daher sollen
und Holz. der Dialog mit der Gesellschaft weiter intensiviert und das Ver-
ständnis der Öffentlichkeit für den Wald, seinen Schutz und
seine Bewirtschaftung gefördert werden.M. Piepenburg
1 WALD UND
Ö FFENTLICHKEIT
aa Forstwirtschaft hat eine lange Geschichte – zu allen Zeiten gab es große
Herausforderungen für Waldbesitzer und Forstleute und die Notwendig-
keit, sich an neue Bedingungen anzupassen. Die Anpassung an den Klima-
wandel mit all seinen Folgen stellt allerdings eine neue Dimension dar.
aa Der Wald und der Rohstoff Holz leisten durch die Bindung von CO2 einen
wertvollen Beitrag zum Schutz des Klimas.
aa Ein intensiver und offener Dialog mit der Gesellschaft soll Begeisterung für
den Wald und Verständnis für den Bayerischen Weg des „Schützen und
Nutzens“ schaffen.Bayerische Forstverwaltung a Waldbericht 2017 a Seite 8 – 9
1.1
FORSTWIRTSCHAFT IN STÜRMISCHEN ZEITEN:
EIN (SELEKTIVER) RÜCKBLICK AUF 100 JAHRE FORST
GESCHICHTE IN BAYERN
Die Landesausstellung „Wald, Gebirg und Königstraum – My- nuar 1919 über die Windschäden: „Das Sturmwüten am ver-
thos Bayern“ im Kloster Ettal wird sich im Jahr 2018 auch mit gangenen Sonntag hat in unserer Gegend verschiedentlich
bayerischer Forstgeschichte befassen. schweren Schaden verursacht. Besonders schlimm herrschte
Der Lehrstuhl für Wald- und Umweltpolitik der Technischen der Sturm in Murnau, Eschenlohe und Farchant. Viele Bäume
Universität München hat im Zug der Vorbereitung dieser wurden entwurzelt, ganze Bretterstöße vom Sturm zerstreut,
Landesausstellung im Auftrag des Bayerischen Staatsminis- Drahtleitungen gestört, Dächer abgedeckt, sogar Kamine
teriums für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten sowie sind eingestürzt. Der Schaden lässt sich noch nicht überse-
des Klosters Ettal von 2015 bis 2017 ein Forschungsprojekt hen. – Die Bahnverbindung Murnau-Oberammergau ist
zur Geschichte der Ettaler Klosterwälder bearbeitet. Im Fo- unterbrochen. – Auch in der Gegend von Tegernsee hat der
kus der Untersuchung standen die Bedeutung der Wälder Sturm schlimm gehaust.“
für die Bevölkerung sowie das Kloster und dessen Rechts- Noch ergreifender beschreibt der Murnauer Benefiziat Hans-
nachfolger. Zudem wurden die regionale Medienbericht-
erstattung zum Themenfeld Wald und die dabei genutzten
Erzählstrategien ausgewertet. Die in diesem Beitrag (Chris-
tian Malzer und Dr. Klaus Pukall) vorkommenden Beispiele
stammen daher v. a. aus dem Gebirge bzw. dem heutigen
Landkreis Garmisch-Partenkirchen.
Für die bayerischen Wälder begannen die stürmischen Zei-
ten bereits 1908 mit dem sogenannten Antrag Toerring (be-
nannt nach dem Antragsteller Graf Toerring-Jettenbach) im
Bayerischen Landtag. Unterstützt von Professor Max Endres
und getragen von Ideen der Bodenreinertragslehre nach
einer bestmöglichen Verzinsung des Waldbodenwertes soll- aa Die Spiegelauer Waldbahn im Jahre 1926; als im Winter 1929/1930
Orkanstürme den Bayerischen Wald verwüsteten, transportierte die
ten durch kurze Umtriebszeiten und im Idealfall durch Na-
Waldbahn insgesamt 160 000 Fm Nutz-, Schicht- und Brennholz aus
delholz-Reinbestände höhere Einnahmen für den Staat ge- den Wald. Foto: Fellmeth
neriert werden. Voraussetzung für eine solche Intensivie-
rung des Holzeinschlags war die Modernisierung der Holz- jakob Gebhart in seiner Staffelsee-Chronik die als Zeitzeuge
ernte- und Transporttechnik, die damals noch von Holzern erlebten Ereignisse: „Sonntag, den 5. Januar, herrscht in den
mit Handsägen, Pferden für die Holzrückung sowie Trift und Mittagsstunden ein schrecklicher Sturm. Hunderte von
Flößerei bestimmt war. Dachziegeln fliegen, tausende vom Dach der Pfarrkirche,
Mit dem Ausbau der Bahnlinien während des 19. Jahrhunderts Grabsteine stürzen, Häuser auf dem Eichholz werden schwer
hatten sich auch diese traditionellen Transportbedingungen beschädigt, hunderte von Fenstern gehen in Scherben,
Schritt für Schritt zu wandeln begonnen. In Bayern entstand fürchterlich ist das Sterben der Wälder; tausende von Bäu-
vom letzten Viertel des 19. Jahrhunderts an eine Reihe von men werden abgedreht und entwurzelt; die Insel Wörth ver-
Schmalspur-Waldbahnen. Im Jahr 1900 wurde beispielsweise liert allein 1 600 Bäume, die uralte Bonifatiuslinde wird
die Eisenbahnstrecke von Bayerisch Eisenstein über Frauenau schwer beschädigt.“ Auch in anderen Teilen Bayerns wie zum
und Spiegelau nach Grafenau fertiggestellt. Durch die Bahn Beispiel im Roggenburger Forst wurden 1920 bei einer Ka-
war es nicht nur möglich, Lang- und Stammholz problemlos tastrophe 143 000 m³ Holz geworfen, die mit einem in den
über weitere Strecken zu transportieren, sondern dies auch re- Wald gebauten Sägewerk aufgearbeitet wurden. Aufgrund
lativ günstig zu bewerkstelligen. Bis 1908 waren über sie- der fehlenden Laubholzpflanzen wuchsen auf den Freiflä-
ben Kilometer Gleise für den Holztransport und zwei Mulden- chen meist wieder reine Fichtenbestände auf, die in den Jah-
kipper für den Bau der Bahndämme in Spiegelau verfügbar. ren 1990, 1992 und 1999 erneut geworfen wurden.
Verheerend trafen die bayerischen Wälder an der Jahreswen- Diese Stürme begünstigten die weitere Mechanisierung der
de 1918/19 Stürme, die über den Freistaat hinwegzogen. Das Forstwirtschaft. Im seit 1921 wieder der Bayerischen Staats-
Weilheimer Tagblatt berichtete in seiner Ausgabe vom 8. Ja- forstverwaltung unterstehenden Revier Grafenaschau (beiMurnau) führten die massiven Windwürfe am Aschauer Berg Den letzten Modernisierungsschub in der Holzerntetechnik
dazu, dass die seit etwa 200 Jahren bestehende Holzrisse, förderten die Orkane Vivian und Wiebke im Frühjahr 1990.
auf der bisher das geschlagene Holz als Brennholz zu Tal be- Harvester wurden zur Aufarbeitung der Schadensflächen
fördert worden war, durch eine moderne Bremsbergbahn eingesetzt und verbreiteten sich dann flächendeckend über
mit Dieselmotor ersetzt wurde. Die Risse war im 18. Jahrhun- Deutschland.
dert zur Versorgung der Glashütte Grafenaschau errichtet Auch im Bereich der Holzbringung verbreiteten sich die
worden, die von 1731 bis 1890 durch ihre Produktion die Neuerungen stürmisch nach dem Zweiten Weltkrieg, da nun
Waldnutzung dominierte. Seit 1924 stand mit der Brems- die manuelle Wegeerstellung durch die Einführung der Pla-
bergbahn eine rund zwei Kilometer lange, über ein 20- nierraupe abgelöst wurde. Dies erleichterte nicht nur die
30 Prozentiges Gefälle verlaufende sowie massive Gelände- Erdarbeiten, sondern hatte auch eine Senkung der Kosten im
unebenheiten ausgleichende Transportmöglichkeit zur Ver- Wegebau zur Folge. Das Waldwegenetz wurde zudem
fügung, die auch Stammholz zu Tal befördern konnte. Die lo- schwerlastfähig gemacht. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg
kalen Gebirgswaldungen standen daher fortan nicht mehr hatte die Firma Wyssen zudem ein Seilkransystem entwi-
allein für die Brennholzernte, sondern auch für Bau- und ckelt, bei dem der Laufwagen auf dem Tragseil zum Be- und
Stammholznutzung offen. Im konkreten Beispiel bewirkte Entladen des Holzes an beliebiger Stelle fixiert werden kann,
also ein Katastrophenereignis nicht nur die Mechanisierung und der es zudem ermöglicht, die Stämme seitlich beizuzie-
der Waldwirtschaft, sondern auch eine verbesserte Erschlie- hen. Solche halbstationäre Anlagen bestimmten bis in die
ßung der Bestände durch neue Transportwege. 1960er Jahre die Forstwirtschaft im Gebirge. Heute sind sie
Die hier greifbare Entwicklung ist ein gutes Beispiel für eine fast gänzlich durch mobile Anlagen mit Trägerfahrzeugen
allgemeine Entwicklung in den bayerischen Wäldern. Die und kipp- und aufrichtbaren Masten und Seilwinden ersetzt,
Bayerische Staatsforstverwaltung richtete seit den 1920er die Dank des verbesserten Wegenetzes auch nahezu alle
Jahren mehrere Maschinenbetriebe ein, die über ganz Bay- Waldareale erreichen können. Die wesentliche Veränderung
ern verteilt waren. Sie versorgten die benachbarten Forstäm- waren hier die Verdichtung und Verbesserung der Transport-
ter mit ihren Dienstleistungen und technischen Geräten, bedingungen, die nach und nach ältere, eher punktuelle
entwickelten aber auch innovative Arbeitsverfahren und tes- und temporäre Maßnahmen ersetzten.
teten neu am Markt erschienene Geräte. Gestützt darauf ge- Neben der ökonomischen Funktion des Waldes bestimmen
lang auch der Motorsäge seit den 1950er Jahren der Durch- in den letzten einhundertfünfzig Jahren immer mehr die
bruch. Schon die Einführung der Handsägen hatte gegen- Wohlfahrtsfunktionen, die der Münchner Forstwissenschaft-
über den Äxten zu effizienteren Holzarbeiten geführt. 1959 ler Viktor Dieterich in seiner Waldfunktionlehre 1953 syste-
kam mit der Stihl Contra die erste in großer Stückzahl ver- matisierte. Die Schutzfunktion des Waldes erfuhr im bayeri-
kaufte Einmann-Motorsäge auf den Markt. Seit den 1970er schen Forstgesetz von 1852 erstmals eine juristische Defini-
Jahren sind Motorsägen aus der Forstwirtschaft nicht mehr tion. Im Gegensatz zu den ansonsten sehr liberalen Regelun-
wegzudenken. gen im Forstgesetz 1852 waren in den Schutzwäldern die
Rodung und der Kahlschlag verboten. Die gesetzliche Defi-
nition von Wald und Schutzwald blieb in den letzten 100
Jahren weitgehend stabil. Die Bedeutung der Bannwälder
als unantastbare Waldflächen ist eine besondere Leistung
des modernen Waldgesetzes für Bayern von 1972.
Anfang der 1980er Jahre löste die anfangs fachinterne De-
batte über Rauchschäden, die Bodenversauerung bzw. das
Tannen- und Fichtensterben innerhalb weniger Monate
einen Sturm in Medien und Politik aus. Der eingängige forst-
liche Fachterminus des „Sterbens“ war wie geschaffen für die
gesellschaftliche Debatte, die ungeahnte Aufmerksamkeit
auf die Wälder und ihre Bewirtschaftung sowie umweltpoli-
tische Fragen lenkte und auch das politische Parteienspekt-
rum einte, um rasche Maßnahmen (z. B. Entschwefelung der
aa Die Bremsbergbahn brachte vom »Bahnhof« auf ca. 1050 üNN Großfeuerungsanlagen, Einführung Katalysatoren bei PKWs)
das Holz mit einem Durchschnittlichen Gefälle von 30 Prozent ins zu realisieren.
Tal. Dabei wurde durch die Schwerkraft der leere Waggon vom vol-
len Waggon nach oben gezogen, also ohne Motor. Es wurde daher
Innerhalb der Forstwirtschaft wurde die Forschung zu den
nur gebremst. Quelle: Gemeindearchiv Schwaigen-Grafenaschau neuartigen Waldschäden intensiviert und ein Monitoringsys-Bayerische Forstverwaltung a Waldbericht 2017 a Seite 10 – 11
tem entwickelt, das mit den Waldschadensberichten, Wald-
zustandserhebungen bzw. Waldberichten auch heute noch
zu Aufmerksamkeit in der medialen Berichterstattung führt.
Forstpolitisch hohe Bedeutung haben die Schutzwälder im
Gebirge – am 5. Juni 1984 verabschiedete der Bayerische
Landtag den sog. Bergwaldbeschluss (Drs. 10/3978), der dem
„Grundsatz Geltung“ verschaffen soll, „daß der Schutz des
Bergwaldes grundsätzlich Vorrang vor allen anderen Nut-
zungsansprüchen hat.“
Inzwischen konzentriert sich die wissenschaftliche und ge-
sellschaftliche Diskussion auf den Klimawandel und die not-
wendige Anpassung daran. So wurde von der Staatsregie-
rung im Zuge der Klimaanpassungsstrategie 2009 der Um-
bau der bayerischen Wälder in klimatolerante Mischwälder
vermehrt gefördert. Fokus legt die Forstverwaltung auf sog.
Brennpunktprojekte verteilt über Bayern und auf das Gebir-
ge mit der „Bergwaldoffensive“. Nach dem Gewittersturm
„Kolle“ im August 2017 verkündete der Ministerrat, diese Be-
mühungen nun in ganz Bayern erheblich auszuweiten.
Bis zum Jahr 2030 sollen in Bayern 200 000 Hektar in einer
„Waldumbauoffensive 2030“ zu klimastabilen Mischwäldern
umgebaut werden.
aa Das Tannensterben war Ende der 1970er Jahre in aller Munde.
Die Folge war ein neues umweltpolitisches Denken, das u. a. zu mo-
dernen emissionsärmeren Kraftwerken führte. Foto: Archiv LWF1.2
WALD UND FORSTWIRTSCHAFT IM KLIMAWANDEL
Die Wälder und die rund 700 000 Waldbesitzer in Bayern sind Hauptbetroffene des Klima-
wandels. Gleichzeitig erbringt der Wald beträchtliche Leistungen für den K limaschutz
durch die Umwandlung von klimaschädlichem CO2 in Sauerstoff und Kohlenstoff. In Holz-
produkten ist dieser Kohlenstoff auch langfristig der Atmosphäre entzogen. Der Forstsek-
tor hat daher ein hohes Interesse an weltweit erfolgreichem Klimaschutz und an der Ver-
wendung von Holzprodukten.
WIE TRÄGT DER CLUSTER FORST UND HOLZ ZUM Parkett, Möbel usw.) ist gegenüber Vergleichsprodukten aus
KLIMASCHUTZ BEI anderen Materialien fast immer mit deutlich geringerem
Um den Beitrag zum Klimaschutz umfassend bewerten zu Energieaufwand und damit geringeren CO2-Emissionen ver-
können, ist eine ganzheitliche Betrachtung der Forst- und bunden. Stünde das Holz nicht zur Verfügung, müsste es
Holzwirtschaft nötig. Dazu müssen zwei Effekte berücksich- durch andere Materialien ersetzt („substituiert“) werden, wo-
tigt werden: durch die Atmosphäre stärker mit Treibhausgasen belastet
würde.
1. BINDUNG VON CO2 AUS DER ATMOSPHÄRE
Über die Fotosynthese entziehen Bäume der Atmosphäre Das gilt analog auch für die Nutzung von Holz als Brenn-
Kohlendioxid (CO2) und speichern den Kohlenstoff vor allem stoff: Dabei wird zwar der im Holz gespeicherte Kohlenstoff
in der verholzten, lebenden Biomasse. Durch absterbende freigesetzt, aber in einem Kreislauf im nachhaltig bewirt-
Blätter, Wurzeln, Äste oder ganze Bäume werden die weite- schafteten Wald von wachsenden Bäumen wieder gebun-
ren Speicher des Waldes (Totholz, Streuauflage und Humus den. Durch Holzenergie werden zum Beispiel Erdöl oder
des Mineralbodens) gespeist. In Holzprodukten (zum Bei- Erdgas ersetzt, deren Verbrennung heute zum anthropoge-
spiel Bauholz, Möbel, Papier) bleibt der Kohlenstoff für ihre nen Treibhauseffekt führt. Über 30 Prozent des in Bayern
jeweilige Lebensdauer gebunden. Solange diese Speicher eingeschlagenen Holzes wird direkt energetisch verwendet,
per Saldo größer werden, wird der Atmosphäre das Treib- weitere 20 Prozent kommen aus Produktionsresten (vor al-
hausgas CO2 entzogen. lem Sägespäne) bei der Herstellung von Holzprodukten hin-
zu. Stünde dieses Holz nicht für die energetische Nutzung
2. VERMEIDUNG VON CO2 -EMISSIONEN zur Verfügung, müssten mehr fossile Brennstoffe verwendet
Im Vergleich zu anderen Materialien wird der Rohstoff Holz werden und die Atmosphäre würde erheblich mit CO2 be-
mit extrem geringem Energieaufwand und sehr geringen lastet.
CO2-Emissionen bereitgestellt (vgl. Grafik). Auch die Weiter- In der Clusterstudie Forst und Holz 2015 wurden die vier re-
verarbeitung von Holz zu Endprodukten (Wände, Fenster, levanten Bereiche des Klimaschutzes untersucht (Tabelle 1).
CARBON FOOTPRINT DER ROHHOLZBEREITSTELLUNG
Bestandesbegründung (0 bei Naturverjüngung
Dargestellt sind die Werte für Fichten-Stammholz von bzw. 0,17 kg CO2-Äquiv. bei manueller Pflanzung)
einem guten Standort. Die in einem Festmeter Fichten- Bestandespflege (0,12 kg CO2-Äquiv.)
holz gespeicherte Kohlenstoff-Menge (großer Kreis) ist 1 Festmeter Wegepflege/Instandhaltung (1,69 kg CO2-Äquiv.)
um ein Vielfaches größer als die Treibhausgas-Emissio- Fichte Stammholz
Ernte Biomasse (1,39 kg CO2-Äquiv. bei Motorsäge
nen (in kg CO2-Äquivalent je Festmeter), die durch Ma- ( 695 kg CO2)
bzw. 3,0 kg CO2-Äquiv. bei Harvester)
schineneinsatz (Motorsäge, Forstschlepper, usw.) in den Kohlenstoff-Ratio
(fossil zu biogen): Vorliefern zur Forststraße (1,85 kg CO2-Äquiv. bei
verschiedenen Prozessen freigesetzt werden (kleine Krei- 1,3 – 3,7 % Forwarder bzw. 2,42 kg CO2-Äquiv. beim Schlepper)
se). Die dunklen Kreise zeigen Minimalwerte, die hell- Aufladen auf LKW (1,33 kg CO2-Äquiv.)
blauen Kreise Maximalwerte. Insgesamt werden zwi- Transport zum Werk (2,58 kg CO2-Äquiv.
schen 1,3 und 3,7 Prozent des in einem Festmeter enthal- bei 50 km einfacher Fahrt bzw. 25,82 CO2-Äquiv.
tenen Kohlenstoffs bei der Bereitstellung emittiert (maß- bei 500 km einfacher Fahrt)
stabsgerechte Darstellung; aus dem Projekt ExpRessBio).
aa Abbildung 1: Carbon Footprint der RohholzbereitstellungBayerische Forstverwaltung a Waldbericht 2017 a Seite 12 – 13
Im Jahr 2014 konnten 17,7 Millionen Tonnen CO2 durch den
Zuwachs im Wald oder die Nutzung von Holz gespeichert UMRECHNUNG HOLZ – KOHLENSTOFF – CO2
bzw. vermieden werden. Ohne Wald und Holzwirtschaft
würden die Emissionen Bayerns von etwa 80 Millionen Ton- Holz besteht zur Hälfte aus Kohlenstoff. Somit hat jede
nen um rund 20 Prozent höher, bei circa 96 Millionen Ton- Tonne Holz 0,5 Tonnen Kohlenstoff gebunden. Wird
nen CO2, liegen. eine Tonne Kohlenstoff durch Verbrennung freigesetzt,
dann bilden sich daraus 3,67 Tonnen CO2. In einem Fest-
Gespeicherte und substituierte Kohlenstoff-Emissionen
meter Buchenholz ist umgerechnet rund eine Tonne
in Millionen Tonnen CO2 Äquivalenten CO2 gebunden, in einem Festmeter Fichtenholz rund
(positive Zahlen = Quelle, negative Zahlen=Senkenwirkung) 700 kg.
Jahr Ände- Ände- Stoff Energe- Summe
rung rung liche tische
Wald- Holz- Substi- Substi-
speicher pro- tution tution
dukte- WAS TUN WIR?
speicher Die Klimaschutzpolitik hat seit dem Pariser Abkommen 2015
2010 -1,7 -1,6 -6,4 -7,0 -16,7 auf vielen Ebenen Fahrt aufgenommen. Die damit verbun-
2012 -1,7 -1,8 -6,9 -7,6 -18,0
dene, veränderte Wertschätzung für die Forst- und Holzwirt-
2014 -1,7 -2,0 -6,7 -7,3 -17,7
schaft und ihre natürlichen Kohlenstoff-Speicher darf nicht
aa Tabelle 1: Klimaschutzbeitrag des Clusters Forst und Holz in Bayern in den
dazu führen, dass zum Beispiel bestimmte Emissionsberei-
Jahren 2010, 2012 und 2014 im Vergleich.
che ungerechtfertigt entlastet werden. Auf EU-Ebene spielt
Die Klimaschutzleistung kann zum einen durch Ausweitung hier die vorgesehene Einbeziehung der Forstwirtschaft in
der Waldfläche, aber auch durch eine verstärkte Kaskaden- die Klimagesetzgebung (sog. LULUCF-Verordnung) eine Rol-
nutzung, d. h. eine mehrfache stoffliche Holzverwendung le. Auf Bundesebene wurden im Klimaschutzplan 2050 die
mit abschließender energetischer Verwertung, erhöht wer- Bedeutung der nachhaltigen Waldbewirtschaftung und
den. Wird Holz dabei in langlebigen Produkten wie Häusern einer intelligenten Holzverwendung verankert. Die ur-
oder langlebigen Möbeln eingesetzt, wird der Effekt der Kas- sprünglich vorgesehenen und umfangreichen Stilllegungs-
kadennutzung verlängert. Bei stofflicher Wiederverwen- vorstellungen konnten abgewendet werden.
dung (zum Beispiel Altpapier als Dämmstoff) verlängert sich
die Speicherdauer entsprechend.
Die Zahlen machen deutlich, dass die Verwendung des Roh-
stoffs Holz einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leistet.
Wenn Wälder der natürlichen Entwicklung überlassen wer-
den, fällt dieser Beitrag weg und es vergrößert sich der Wald-
speicher, bis ein Gleichgewichtszustand von Auf- und Abbau
an Biomasse erreicht ist. Der Klimaschutzeffekt von Stillle-
gungen ist immer geringer als der nachhaltiger Waldbewirt-
schaftung und intelligenter Verwendung des nachwachsen-
den Rohstoffs Holz.Klimakonzept
der Bayerischen Forstverwaltung
(z.B. Vertreter der bayerischen Forstwirtschaft,
Erhalt von Waldfunktionen Minderung von Treibhausgasen
(Anpassung) (Klimaschutz)
Klimaschutzprogramm Bayern 2050
Bayer. Klimaanpassungsstrategie
Allianzen und Kommunikation
Projekte
Bayerische Klimaallianz)
Bergwald-
offensive Klima-
Klimaschutz Klimaschutz
Waldinitiative forschung
Waldumbau durch Wald und durch Holz-
Ostbayern Wald – Forst
Waldmoore verwendung
Initiative Holz
Zukunftswald
Bayern
Nachhaltige naturnahe Forstwirtschaft
Risiken Chancen
für Wälder, Forstbetriebe Klimawandel für
und Bevölkerung Holz
Emissionen von Treibhausgasen
aa Abbildung 2: Klimakonzept der Bayerischen Forstverwaltung.
BEGONNENE MASSNAHMEN:
aa Allein im Privat- und Körperschaftswald sollen rund
260 000 Hektar akut gefährdete Fichten- und Fichten-Kie-
fern-Wälder umgebaut werden, davon rund 200 000 Hekt-
ar im Rahmen der Waldumbauoffensive 2030 bis zum Jahr
2030. Auf mehr als 55 000 Hektar ist das seit 2008 bis Ende
2016 mit Unterstützung durch staatliche Fördermittel be-
reits gelungen. Die „Initiative Zukunftswald Bayern“ bündelt
die Projektansätze.
aa Die Bayerischen Staatsforsten (BaySF) haben in den Ge-
schäftsjahren 2008 bis 2016 rund 60 000 Hektar in klimatole-
rantere Mischwälder umgebaut. Bis 2035 sollen weitere rund
110 000 Hektar dazukommen. Besonderer Handlungsbedarf
besteht im Alpenraum. Die partizipativ angelegte Bergwald-
offensive (BWO) verläuft weiter sehr erfolgreich und wurde
auf die ostbayerischen Mittelgebirge (WIO, Wald-Initiative
Ostbayern) ausgeweitet. Die Forschungsvorhaben wurden
konsequent auf hohen Nutzen für die Bewirtschaftung und
raschen Transfer in die Praxis ausgerichtet.
aa Das neu entwickelte und bundesweit bisher einmalige
Bayerische Standortinformationssystem (BaSIS) gibt den
Waldbesitzern eine Vorstellung vom Wald der Zukunft in
ihrer Region. Die hoch auflösenden Daten bieten eine
aa Die Renaturierung wertvoller Hochmoorkomplexe ist ein vor-
wichtige Entscheidungshilfe zum Aufbau klimatoleranter dringliches Ziel der Bayerischen Forstverwaltung.
Waldbestände. Foto: Stefan Müller-Kroehling, LWFBayerische Forstverwaltung a Waldbericht 2017 a Seite 14 – 15
aa Hochmoore im Staatswald werden durch die Bayeri- moore mit mittlerer bis hoher Priorität weitgehend
schen Staatsforsten und die Forstverwaltung sukzessive renaturiert werden.
renaturiert. Auf der Grundlage eines 2016 abgeschlosse-
nen Forschungsprojekts sollen bis 2030 sämtliche Hoch
wb2017-1.2_ANBAURISIKO AM ÖSTLICHEN VORDEREN BAYERISCHEN WALD
ANBAURISIKO AM ÖSTLICHEN VORDEREN BAYERISCHEN WALD
Fichte 2000 Buche 2000 Eiche 2000
Fichte 2100 Buche 2100 Eiche 2100
Anbaurisiko
sehr geringes Risiko, als führende Baumart möglich
geringes Risiko, als führende Baumart mit hohen Mischbaumanteilen möglich
erhöhtes Risiko, als Mischbaumart in mäßigen Anteilen möglich
hohes Risiko, als Mischbaumart in geringen Anteilen möglich
sehr hohes Risiko, als Mischbaumart in sehr geringen Anteilen möglich
aa Abbildung 3: Anbaurisiko am östlichen vorderen Bayerischen Wald (östlich von Deggendorf). (Auszug aus BaSIS)
AUSBLICK IN DIE ZUKUNFT
In den nächsten Jahren ist vor allem bei der Klimaschutzpoli- tenten erleiden. Ziel ist es Unterstützung für den weiteren
tik auf EU- und nationaler Ebene sehr darauf zu achten, dass Umbau der Wälder in klimatolerante Zukunftswälder zu er-
die Waldbesitzer und Förster keine Nachteile, zum Beispiel halten. Dazu zählen auch Initiativen zur verstärkten Holzver-
durch neue Auflagen aus der Klimaschutz-Bürokratie (Nach- wendung im Bauwesen (Charta für Holz).
haltigkeitskriterien, Kontrollregime) oder durch Klimaschutz-
pflichten zur Entlastung der eigentlichen Treibhausgas-Emit-1.3
WALDUMBAUOFFENSIVE 2030 „ZUKUNFTSWALD SCHAFFEN –
HEIMAT SICHERN!“
Das Sturmtief „Kolle“ am 18. August 2017, das Trockenjahr 2015 und die nachfolgende
Massenvermehrung der Borkenkäfer oder zahlreiche lokale Gewitterstürme und andere
Wetterextreme der letzten Jahre zeigen in aller Deutlichkeit, dass der Klimawandel Wald
und Forstwirtschaft und dabei die besonders anfälligen Nadelholzreinbestände nicht erst
im Laufe der kommenden Jahrzehnte, sondern bereits heute massiv bedroht. Der Umbau
dieser stark gefährdeten Bestände in klimatolerantere, stabile, naturnahe und damit vitale
und leistungsfähige Mischbestände ist deshalb schon jetzt eine der wichtigsten gesell-
schaftlichen Herausforderungen. Nach dem Grundsatz „Eigenverantwortung und Solidari-
tät“ hat Bayern daher die neue Waldumbauoffensive 2030 gestartet, die Waldbesitzer
beim Aufbau zukunftsfähiger Wälder durch finanzielle Förderung und forstfachliche
Beratung verstärkt unterstützt.
Der Wald ist vom Klimawandel in ganz besonderer Weise be- VERSTÄRKTE BERATUNG UND FORTBILDUNG
troffen. Anders als in der Landwirtschaft können die Kultu- In den nächsten Jahren sollen nach und nach allen Waldbe-
ren nicht jährlich an veränderte Bedingungen angepasst sitzern, die dies wünschen, kurze prägnante Waldumbauplä-
werden. Waldbestände, die heute begründet werden, müs- ne für ihre konkreten Waldflächen zur Verfügung gestellt
sen viele Jahrzehnte überdauern können. Waldumbau ist da- werden. In begrenzten Projektgebieten wurden mit diesen
her eine weit vorausschauende Aufgabe und echte Zu- schriftlich festgehaltenen Beratungsergebnissen sehr gute
kunftsvorsorge. Nach aktuellem Stand müssen in den kom- Erfahrungen gesammelt. Waldumbaupläne werden von den
menden Jahrzehnten im Privat- und Körperschaftswald in Waldbesitzern sehr gut angenommen, da sie keine abstrak-
Bayern rd. 260 000 Hektar Reinbestände in Mischbestände ten Klimawandelinformationen, sondern den konkreten
umgebaut werden. Dabei handelt es sich vor allem um nicht Handlungsbedarf des einzelnen Waldbesitzers auf seinen
klimatolerante Nadelholzbestände aus Fichte und Kiefer. Flächen beschreiben.
Durch das klimawandelbedingt verstärkte Auftreten von Zur verstärkten Fortbildung der Waldbesitzer sollen über die
Schädlingen sind zunehmend auch Laubbaumarten wie die bestehende Waldbauernschule in Kelheim hinaus im Rah-
Esche (durch das sog. Eschentriebsterben) und die Eiche men sog. Regionaler Waldakademien Fortbildungstage und
(durch Raupenfraß von verschiedenen Schmetterlingsarten) Kurse insbesondere zur Waldpflege, Waldverjüngung durch
vom Klimawandel gravierend betroffen. Pflanzung, Borkenkäferbekämpfung und weiteren Themen
Bayern hat auf diese Herausforderung früh reagiert und sich angeboten werden. Die deutliche Intensivierung der Fortbil-
bereits im Jahr 2008 im Rahmen des Klimaprogramms 2020 dung ist auch deshalb notwendig, da vor allem die Wald-
ein erstes Zwischenziel von 100 000 Hektar Umbaufläche bis erben oft nicht mehr ausreichende Kenntnisse von der Wald-
zum Jahr 2020 gesetzt. Mit der Waldumbauoffensive 2030 bewirtschaftung haben. Die Waldbesitzer in Bayern sind im
soll der bisherige jährliche Umbaufortschritt von durch- Durchschnitt über 60 Jahre alt. In den nächsten 20 – 40 Jah-
schnittlich 6 000 Hektar auf 10 000 Hektar im Jahr steigen, ren steht eine massive Welle an Erbgängen bevor. Alleine bis
um bis zum Jahr 2030 auf rund 200 000 Hektar den Waldum- 2030 werden voraussichtlich rund 40 Prozent der Waldflä-
bau erreicht zu haben. Es gilt jetzt die durch die Schadereig- chen durch Erbgang den Besitzer wechseln. Diese Erben
nisse der letzten Jahre zunehmende Bereitschaft der Wald- sind deutlich jünger und können mit neuen Medien, die
besitzer offensiv zu nutzen. Die Waldbesitzer brauchen da- internetbasiert sind, besser angesprochen werden. Bereits
bei die breite Unterstützung der gesamten Gesellschaft. Da- jetzt besteht mit dem Waldbesitzerportal (www.waldbesit-
her ist es auch wichtig, dass durch flankierende Maßnahmen zerportal.bayern.de) eine Online-Informationsplattform. Die-
die Bedeutung des Waldumbaus in der Mitte der Gesell- se wird u. a. durch zusätzliche kurze Informationsclips zu ak-
schaft verankert wird. tuellen forstlichen Themen und Waldumbaumaßnahmen er-
gänzt sowie insgesamt aktualisiert und ausgebaut. Eine In-
tensivierung in den sozialen Medien ist angedacht. Auch
weitere Zielgruppen wie Forstunternehmer, kommunaleBayerische Forstverwaltung a Waldbericht 2017 a Seite 16 – 17
Entscheidungsträger und freiberufliche Forstsachverständi- langwierig. Sie muss deswegen bereits heute intensiviert
ge können mit diesen Angeboten angesprochen werden. werden, um in einigen Jahrzehnten Ergebnisse und ggf.
neue Optionen für den Aufbau unserer Wälder zu erhalten.
PFLEGE UND SICHERUNG JUNGER MISCHBESTÄNDE
Seit über 40 Jahren werden in Bayern zunehmend Mischbe- ENTWICKLUNG VON REGIONALEN
stände aus mehreren Baumarten begründet. Besonders die GEFÄHRDUNGSANALYSEN
nach den Jahrhundert-Orkanen Vivian und Wiebke 1990, Die Bayerische Forstverwaltung hat mit den Klimarisikokar-
nach Lothar 1999 und Kyrill 2007 gepflanzten Bestände sind ten und dem Standortinformationssystem BaSIS Beratungs-
nun in einem Alter, in dem die Anteile aller Mischbaumarten grundlagen für die Waldbesitzer geschaffen, die bis heute in
konsequent gesichert werden müssen. Aufbauend auf eine Deutschland einmalig sind (s. Abbildung 3). Diese Grundla-
flächendeckende Überprüfung und Analyse der Pflege- gen gilt es nun, durch weitergehende regionalisierte Gefähr-
dringlichkeit muss, um die erreichten Erfolge zu sichern, eine dungsanalysen zu verfeinern.
Pflegeinitiative gestartet werden.
INFORMATIONSOFFENSIVE
SONDERPROGRAMME BERGWALDOFFENSIVE, WALD Die Waldbesitzer brauchen dauerhaft Verständnis und Ak-
INITIATIVE OSTBAYERN UND INITIATIVE ZUKUNFTSWALD zeptanz der Bevölkerung für den Waldumbau und die Be-
Mit einem projektorientierten Ansatz in klar umgrenzten wirtschaftung ihres Waldes. Dies sicherzustellen bedingt
Projektgebieten wurden in den letzten Jahren im Rahmen gute Informationen und einen steten Dialog mit der Gesell-
der Bergwaldoffensive (BWO), der Waldinitiative Ostbayern schaft. Gelingen kann dies zum Beispiel durch ein Heranfüh-
(WIO) und der Initiative Zukunftswald (IZW) sehr gute Erfah- ren von Kindern und Jugendlichen im Rahmen der Waldpäd-
rungen gesammelt, wie die Waldbesitzer bestmöglich ange- agogik an das Thema Natur und Wald mit seinen vielfältigen
sprochen und zum Waldumbau motiviert werden können. Facetten. Aber auch den Bürgerinnen und Bürger soll lau-
Die beschränkte Mittelausstattung der Programme und der fend dieser gegenseitige Dialog angeboten werden, um die
Einsatz von lediglich befristet einstellbarem Personal erlaubt gewaltige gesellschaftspolitische Aufgabe „Waldumbau“ im
eine bayernweite Ausdehnung bisher nicht. Daher sollen gegenseitigen Einvernehmen angehen und bewältigen zu
künftig Projekte der BWO, WIO oder IZW in allen Amtsgebie- können. Waldführungen mit dem Förster, Walderlebniszent-
ten der ÄELF kontinuierlich mit fest angestelltem Personal ren und Waldattraktionen, bis hin zum Einsatz neuer sozialer
durchgeführt werden. Medien sind notwendig um die Menschen mit Wald und
Waldbewirtschaftung vertraut zu machen und einer noch
WALDSCHUTZ weiter gehenderen Entfremdung in künftigen Jahrzehnten
Mit dem Klimawandel und vor allem den steigenden Durch- entgegenzuwirken. Dazu bedarf es einer Intensivierung der
schnittstemperaturen geht eine bereits deutlich erkennbare bisherigen Öffentlichkeitsarbeit, einer Verstärkung der Wald-
Ausweitung von bekannten (z. B. Borkenkäfer oder Eichen- pädagogik sowie neuer, innovativer Ansätze.
prozessionsspinner), aber auch von neuen Schadorganismen
(insb. Pilzen, wie z. B. dem Eschentriebsterben oder auch
Quarantäneschädlingen, wie dem Asiatischen Laubholz-
bock) einher. Die wissenschaftliche Analyse neuer Schädlin-
ge, das Monitoring bekannter Schadinsekten unter verän-
derten Witterungsbedingungen sowie die Ausarbeitung
von Bekämpfungsstrategien durch die Landesanstalt für
Wald und Forstwirtschaft müssen ausgeweitet und intensi-
viert werden.
VERSTÄRKTE FORSCHUNG ZUR BAUMARTENEIGNUNG
Die sich ändernden Umweltbedingungen und zunehmen-
den Bedrohungen durch neue Schadorganismen machen
eine verstärkte Forschung auch zu bisher weniger verwen-
deten heimischen Baumarten und Herkünften sowie zu
Baumarten aus anderen Regionen notwendig. Solche For-
schung ist durch lange Untersuchungszeiträume, bis z. B.
Versuchsanbauten von Bäumen Erkenntnisse liefern, sehr1.4 BERGWALD UND SCHUTZWALDSANIERUNG Nur gesunde und stabile Schutzwälder können die bayerischen Alpentäler vor Muren, Steinschlag und Lawinen schützen. Schon im Jahr 1986 hatte der Bayerische Landtag ein- stimmig beschlossen, den Zustand der Schutzwälder zu erfassen, das Gefährdungspoten- zial zu ermitteln und erforderlichenfalls festgestellte Defizite zu beheben. Im Berichtszeit- raum jährte sich dieser Beschluss zur Sanierung der Schutzwälder zum 30. Mal. Aus diesem Anlass hat die Bayerische Forstverwaltung eine Broschüre über den Berg- und Schutzwald in den bayerischen Alpen und seinen Zustand und seine Funktionen herausgegeben (www.stmelf.bayern.de/wald/waldfunktionen/schutzwald/index.php). SCHUTZWALDSANIERUNG Voraussetzung, um Rutschungen und Muren zu vermeiden Über 13 Millionen junger Laub- und Nadelbäume wurden und Hochwasser abzumildern. seit 1986 gepflanzt und, wo nötig, durch Stützbauten vor Die aufwändige Sanierung muss deshalb unbedingt durch Gleitschnee geschützt. Inklusive der Verbauungen und aller eine vorbeugende Schutzwaldpflege ergänzt werden. Ziel anderen Arbeiten wurden für die Schutzwaldsanierung bis- ist, durch Förderung der Naturverjüngung, Ergänzungspflan- her insgesamt etwa 86 Millionen Euro investiert. Wo früher zungen, strukturverbessernde Maßnahmen oder Borkenkä- extrem teure Schutzbauwerke zur Sicherung steiler Hänge ferbekämpfung zu verhindern, dass neue Sanierungsflächen notwendig waren, kann auf den sanierten Flächen künftig entstehen. Eine entscheidende Voraussetzung für die Siche- der Bergwald diese Aufgabe wieder übernehmen. Ein Hektar rung der Schutzfunktionen der Bergwälder ist, dass die jun- Pflanzung kostet bis zu 30.000 Euro, ein Hektar Gleitschnee- gen Bäume möglichst rasch und unbehelligt wachsen kön- verbauung bis zu 500.000 Euro. Diese Zahlen zeigen, wie nen. Das erfordert, dass im Bergwald die Schalenwildbestän- wertvoll ein intakter Schutzwald ist. de auf ein waldverträgliches Niveau angepasst werden. Auf zwei Drittel der bearbeiteten Flächen wird derzeit das Sanierungsziel erreicht: mehrere Baumarten haben sich eta- bliert und können ohne größere Beeinträchtigungen, etwa durch Wildverbiss, wachsen. Für die Schutzwaldsanierung ist allerdings ein langer Atem notwendig. Wenn man bedenkt, dass es 20 bis 40 Jahre dau- ert, bis die kleinen Bäume im rauen Gebirgsklima manns- hoch gewachsen sind und die vielfältigen Schutzfunktionen langsam übernehmen können, wird klar, welch lange Zeit- räume eine erfolgreiche Schutzwaldsanierung im Bergwald benötigt. Rund 14 000 Hektar Schutzwald in den bayerischen Alpen können derzeit ihre Schutzfunktionen nicht oder nur teilwei- se erfüllen und müssen saniert werden. Vor allem durch Sturm und Borkenkäfer sind seit der ersten Planung rund 1 200 Hektar Sanierungsflächen hinzugekommen. Der Klimawandel steigert die Bedeutung intakter Schutzwäl- der. Im Alpenraum erwarten Experten weitaus spürbarere Auswirkungen der Klimaveränderungen als im übrigen Bay- ern. Vor allem die Erwärmung schreitet dort voraussichtlich schneller voran und wird vermutlich höher als im Mittel aus- fallen. Gleichzeitig stellen vorhergesagte häufigere Starknie- derschläge hohe Anforderungen an die Bergwälder. Die Sta- bilisierung der Wälder und die natürliche Regulierung des aa Temporäre Verbauungen in der Schutzwaldsanierung mit Holz- Wasserabflusses werden an Bedeutung gewinnen. Sie sind bauwerken. Foto: Paul Dimke, LWF
Bayerische Forstverwaltung a Waldbericht 2017 a Seite 18 – 19
BERGWALDOFFENSIVE (BWO) Ein Grundsatz der Bergwaldoffensive ist es, die Betroffenen
Mit der Bergwaldoffensive wurde 2008 ein Programm zur zu Beteiligten zu machen. Waldbesitzer, Jäger, Naturschüt-
Entwicklung zukunftsfähiger Berg- und Schutzwälder im zer, Almbauern, Tourismusverbände und Kommunen er-
Privat- und Körperschaftswald geschaffen. Nach dem Motto arbeiten gemeinsam vor Ort angepasste Lösungsansätze,
„Vorbeugen ist besser und billiger als heilen“ streben die insbesondere in den Bereichen Waldpflege, Wegebau, Jagd-
Waldbesitzer mit Unterstützung der BWO standortgerechte, management, Biotoppflege und Trennung von Wald und
strukturreiche Mischwälder aus Fichte, Tanne, Buche und Weide. Die Einbeziehung der Beteiligten bereits bei der Aus-
Bergahorn an. Dies gelingt nur durch vorausschauende wahl der Projektgebiete und in Form von BWO-Beiräten hat
P flege und rechtzeitige Waldverjüngung. So werden die
sich als besonders hilfreich erwiesen.
Schutzfunktion der Bergwälder nachhaltig gestärkt und teu- Im Rahmen der Bergwaldoffensive wurden in über 2.800 Ein-
re Schutzwaldsanierungsmaßnahmen vermieden. zelmaßnahmen in den vergangenen acht Jahren 535.000
Handlungsbedarf besteht besonders in Fichtenreinbestän- junge Bäumchen gepflanzt und so zusammen mit natürlich
den, die hohen Risiken durch Borkenkäfer, Stürme und verjüngten Baumarten auf rund 750 Hektar gefährdete Na-
Schneebruch ausgesetzt sind. Historisch bedingt gibt es in delwälder in klimatolerante Mischwälder umgewandelt. Auf
den bayerischen Alpen eine Vielzahl solcher Fichtenreinbe- weiteren 935 Hektar wurden durch Pflegemaßnahmen die
stände. Diese müssen dringend umgebaut werden. Über Voraussetzungen für Naturverjüngung geschaffen. Zudem
Waldumbaumaßnahmen hinaus fördert die BWO auch den wurden in den 47 Projektgebieten naturverträglich 160 Kilo-
Erhalt gefährdeter Arten, wie zum Beispiel von Auerwild meter Waldwege angelegt, um die Voraussetzungen zu
oder Fledermäusen, durch Konzepte zur Besucherlenkung schaffen, dass in den nächsten Jahren weitere Waldbestände
oder Verbesserung ihrer Habitate. im Alpenraum gepflegt und auf den Klimawandel vorberei-
tet werden können. 17 Millionen Euro hat der Freistaat bis-
lang für die Bergwaldoffensive aus dem „Klimaprogramm
Bayern 2050“ bereitgestellt, davon drei Millionen Euro im Be-
richtszeitraum.
aa Im Schutz von Dreibeinböcken und Schneerechen wächst eine
neue Waldgeneration heran. Foto: Paul Dimke, LWF1.5
AKTIONSJAHR WALDNATURSCHUTZ
Staatsminister Helmut Brunner hat in seiner Regierungs- Mit dem Aktionsjahr entstanden vielfältige Kooperationen
erklärung vom Juli 2014 für das Jahr 2015 ein Aktionsjahr vor Ort. Jede dritte Veranstaltung fand zusammen mit Wald-
„Waldnaturschutz“ ausgerufen. „Ich meine wir müssen unse- besitzern statt, jede vierte Veranstaltung gemeinsam mit Ak-
re Leistungen und Pläne zum Schutz der Wälder der Gesell- teuren aus anderen Verwaltungen und der Politik. Jede sieb-
schaft noch transparenter vermitteln.“ So fanden im Jahr te Veranstaltung vor Ort lief als Kooperation mit einem Na-
2015 zahlreiche Aktionen statt, die besonders vom direkten turschutzverband (Roth, 2015). Dabei entstanden auch völlig
Dialog mit den Menschen geprägt waren. Um das Aktions- neue Formen der Kooperation, wie zum Beispiel ein Waldca-
jahr bekannt zu machen, wurden neue Wege der Werbung, fe 60+ oder eine Kunst/Ausstellung im Wald „Kultur in der
zum Beispiel in den Bahnhöfen und der U-Bahn in München, Natur – DenkMal im Wald“.
erprobt. Neben der Bayerischen Forstverwaltung und den
Bayerischen Staatsforsten beteiligten sich über die Koopera- BEACHTUNG IN DEN MEDIEN
tionsplattform „Forstwirtschaft schafft Leben“ weitere Part- aa Printmedien
ner wie der Bayerische Waldbesitzerverband, der Bayerische Die Berichterstattung in den Zeitungen zum Waldnatur-
Bauernverband, der Bayerische Grundbesitzerverband und schutzjahr erfolgte vorrangig auf regionaler Ebene. Eine
die Forstwirtschaftlichen Zusammenschlüsse. Auswertung einer Stichprobe von knapp 200 Zeitungs-
Das Aktionsjahr wurde mit verschiedenen Ansätzen evalu- artikeln ergab, dass sehr positiv berichtet wurde.
iert, um für Folgeaktionen Erfahrungen gewinnen zu kön- aa Radio – Spots
nen. Insgesamt zeigten sich sehr erfreuliche Ergebnisse bei Die in einem Münchner Regionalradio gesendeten Spots
der Auswertung der Zahl der erreichten Menschen. Die Akti- erreichten rund 520 000 Nutzer mindestens einmal. Mit
vitäten der Partnerorganisationen sind nicht ausgewertet geringem finanziellen Aufwand wurden zahlreiche Men-
worden und in den nachfolgenden Zahlen daher nicht ent- schen angesprochen.
halten. Würden diese mit beinhaltet sein, würde der Erfolg aa Youtube
des Aktionsjahres noch deutlich größer aufscheinend. Die im Rahmen des Waldnaturschutzjahres geschaffenen
Kurzfilme wurden nicht nur für Veranstaltungen genutzt,
ERGEBNISSE sondern auch im Internet (Youtube) eingestellt.
aa Die Bayerische Forstverwaltung – insbesondere mit aa Bahnhöfe und U-Bahnen
ihren Ämtern für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Mit Videospots für Infoscreens und Fahrgastfernsehen
(AELF) – und die Bayerischen Staatsforsten (BaySF) er- wurde in den größeren Städten Bayerns sowie in der U-
reichten mit über 1.000 Veranstaltungen rund 120.000 Bahn unter dem Slogan „Unser Wald – deine Heimat“ für
Menschen (Roth, 2015). ein besseres Verständnis für die Waldbesitzer geworben.
aa Auch die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forst- Die Zahl der Blickkontakte ist schwer anzuschätzen, aber
wirtschaft (LWF) unterstützte das Aktionsjahr mit 58 Bei- aus den Mediadaten des beauftragten Unternehmens
trägen – von Fachveröffentlichungen, Vorträgen, Tagun- ergaben sich Blickkontakte im Millionenbereich.
gen und Führungen bis hin zu Ausstelllungen und Inter-
netprojekten (Roth, 2015). RESÜMEE
aa Laien- und Fachpublikum besuchten ein vielfältiges An- Mit dem Aktionsjahr wurden neue und dem Wald nicht nahe-
gebot mit klassischen und innovativen Informations-, stehende Gruppen angesprochen. Ziel war es, den integrati-
Dialog- und Erlebnisveranstaltungen. Dabei dominierten ven Ansatz, mit dem die bayerischen Waldbesitzer auf der
Waldbegehungen (jede dritte Veranstaltung), Infoveran- gesamten Waldfläche nachhaltige Waldbewirtschaftung und
staltungen (jede vierte) und waldpädagogische Ange- vielfältige Naturschutzleistungen vereinen, den bayerischen
bote (jede fünfte). An einer Exkursion nahmen im Schnitt Weg des „Schützen und Nutzen“ konkret vor Ort darzustellen,
42 Besucher teil (Roth, 2015). verständlich zu machen und mit Leben zu erfüllen. Aus dem
aa Auch andere Institutionen und Verbände führten Veran- Dialog mit vielen Menschen konnten neue Kontakte gewon-
staltungen zu dem Thema durch, häufig war daran die nen und Netzwerke aus- oder neu aufgebaut werden.
Forstverwaltung mitbeteiligt. Insgesamt hatten die Äm-
ter für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bei fast
80 Prozent aller Kooperationen die Federführung.Sie können auch lesen