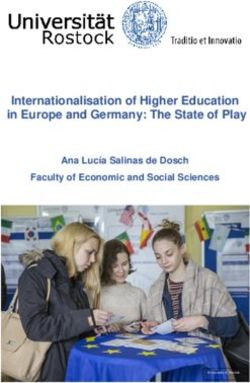Wo die Drachen wohnen Here Be Dragons - Philipp Blom Gedanken zur Kartografi e der Zukunft Thoughts About Mapping the Future - BMEIA
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Philipp Blom
Wo
die Drachen
wohnen
Here
Be
Dragons
Gedanken zur Kartografie der Zukunft
Thoughts About Mapping the Future
1Philipp Blom Wo die Drachen wohnen Here Be Dragons Gedanken zur Kartografie der Zukunft Thoughts About Mapping the Future
Philipp Blom Wo die Drachen wohnen Gedanken zur Kartografie der Zukunft
6
Wo die Drachen wohnen
Gedanken zur Kartografie der Zukunft
Ich sitze an meinem Schreibtisch. Durch das Fenster sehe
ich das Wiener Hochnebelgrau am Ende dieses gespensti-
schen Jahres 2020 und schreibe Ihnen einen Brief, nicht
wissend (und das ist in Zeiten wie diesen keine Plattitüde)
wo und in welcher Situation Sie diese Zeilen erreichen
werden.
Unter normalen Umständen hätte ich eine Rede vor Ihnen
gehalten, eine Reflexion eines Autors über Kultur in Öster-
reich und darüber hinaus, aber diese Umstände sind eben
nicht normal und deswegen kehren wir in vorige Jahrhun-
derte zurück, in denen Gedanken schriftlich fixiert und
dann gedruckt wurden, auf Papier, sodass die Leserinnen
und Leser ihre Zeilen im eigenen Tempo, und so oft sie
wollten, genießen konnten – eine Gefahr für Autoren in
einer Zeit, in der Prosa normalerweise mit Lichtgeschwin-
digkeit vorbeiflitzt.
Ich sage es gleich: Der geordnete Schein der gedruckten
Seite trügt. Dies ist eine Zeit, in der es schwer, wenn nicht
unmöglich ist, einen Überblick zu haben, die eigenen Ge-
danken in einem Organigramm antreten oder in Reih’ und
Glied an allfälligen Leserinnen und Lesern vorbeidefilieren
zu lassen. Es ist eine Zeit für tastendes Denken und den-
7kendes Erkunden, für den Rückzug in größere Muster oder den Vorstoß ins Erklären des Unerklärten, aber es ist keine Zeit, in der irgendwer erklären könnte, was dieses letzte Jahr einmal bedeutet haben wird. Hic sunt dracones Tatsächlich lässt die so objektiv und autoritativ erscheinende, bedruckte Seite mich wünschen, dass Bücher aus kluger Selbsterkenntnis eine Tradition übernehmen würden, die es unter den Kartografen früherer Jahrhunderte gab. Die ersten Karten, die größere Gebiete beschrieben, waren Seekarten. Das Landesinnere außereuropäischer Kontinente war noch kaum erforscht – soweit auch nur die Küsten über- haupt schon bereist und kartografiert worden waren. Die meisten dieser Karten zeigten die Umrisse Europas, gelegent- lich verblüffend detailreich. Je weiter es aber in den offenen Ozean, nach Süden oder in den hohen Norden geht, desto unsicherer wurden die Karten- zeichner. Sie arbeiteten mit Messungen von Seefahrern, mit Beobachtungen und Berichten, Anekdoten und Seemanns- garn, ohne jemals genau zu wissen, wo Fakt und Fiktion zu scheiden waren. Anstatt sich aber durch diese Einsicht niederdrücken zu las- sen, bezogen sie die Fiktion gleich mit Überzeugung in ihre Werke. Seeungeheuer tummeln sich in den fernen Regionen 8
der Meere, erstaunliche, furchterregende Monster aus anti-
ken Quellen und Matrosengeschichten, aus noch älteren
Atlanten und mittelalterlichen Bestiarien, aus Berichten
von Märkten anderer Kontinente und mithilfe der getrock-
neten Überreste exotischer Tiere.
Ein ganzer imaginärer Zoo ergießt sich über diese Seiten:
Elefanten mit Fischschwänzen und walartige Biester, die
aus zwei Schornsteinen Wasserfontänen speien, giganti-
sche Seeschweine und Leviathane, Schlangen aller Arten
und Größen, See-Einhörner und Meerjungfrauen; endlose
Mutationen, erzeugt von fieberhaften menschlichen Geis-
tern.
Diese Monster wurden nicht als lästige Ablenkung von der
objektiven Wiedergabe wichtiger Inhalte gesehen. Die
Kundschaft musste für sie sogar extra zahlen. Eine Karte
mit Seemonstern – möglicherweise noch handkoloriert –
war nicht nur ein Navigationsinstrument, sondern auch
ein Kunstwerk, ein Ornament auf jedem Tisch und an jeder
Wand. Vielleicht halfen sie auch so manchem Kapitän
durch die Monotonie ihrer Seereisen und bevölkerten
gleichzeitig das Reich des Unbekannten mit erkennbaren
Kreaturen.
Die Kartenzeichner fügten aber nicht nur Ungeheuer ein.
Gelegentlich, in einem ganz besonders obskuren Winkel,
über den sich nur aus Legenden überhaupt etwas in Erfah-
rung bringen ließ, artikulierten sie eine Warnung. Auf einem
Globus aus 1504, dem Hunt-Lenox Globe, findet sich vor
9der Küste eines imaginären asiatischen Landes die Inschrift hic sunt dracones – hier sind Drachen. Diese Drachen beschrieben die Grenze dessen, was Menschen wissen können, die Ausnahme in ihrem Universum, die ferne, aber hartnäckige Wirklichkeit, über die ihre Kartografie nichts zu sagen hat. Das ist es, was ich mir für gedruckte Werke wie dieses wün- schen würde: einen obligatorischen Warnhinweis am Fuß der Seite – hic sunt dracones. Karten im Kopf Überhaupt lässt es sich gut denken anhand von Landkarten; gerade jetzt, wo es scheint, als könnten die mental maps der Nachkriegszeit das Terrain der Gegenwart nicht mehr abbil- den. Sie sind nicht auf aktuelle Verhältnisse eingenordet, zu viel ist passiert, nachdem sie erstellt wurden, Dinge, für die solche Karten keine Symbole haben. In der Zwischenzeit ent- standen ganze historische Flussläufe und Kontinente, die sie nicht abbilden können – ganz zu schweigen von den realen geografischen Veränderungen von Küstenlinien und Polar- kappen, Permafrost und Steppe, gerodeten Regenwäldern und künstlichen Inseln. Aber langsam. Welche mental maps haben wir da gerade in Bausch und Bogen weggeworfen? Es sind im Wesentlichen die, die eine Welt nach 1945 beschreiben, aber auch die vori- gen Versionen müssen gleich mit entsorgt werden. Ein ganzer 10
Stoß von Karten wartet darauf, ins Altpapier einer Zivilisa-
tion zu wandern, oder ins Museum.
In der Welt, die nach 1945 errichtet und festgezurrt wurde,
war es zumindest im westlichen Teil selbstverständlich,
dass es um Freiheit ging (auch wenn die sehr unterschied-
lich ausgelegt wurde), um Wirtschaftswachstum und die
gesellschaftlichen, politischen Dividenden, die es brachte,
um das Zerstören alter, ineffizienter, undemokratischer und
hegemonischer Strukturen durch die Kraft des Wettbe-
werbs und den Markt selbst.
Die Apotheose dieser Denkweise war das von Francis
Fukuyama nach dem Fall des Eisernen Vorhangs bekann-
terweise vorausgesagte „Ende der Geschichte“. Was für
eine Ironie also, dass die Geschichte sich nicht nur gewei-
gert hat, zu einem anständigen Ende zu finden, sondern, im
Gegenteil, auch jene Teile der Welt, die sich von ihr befreit
wähnten, mit ungeahnter Macht wieder beim Genick
gepackt hat.
Der Drang nach Freiheit und Wohlstand, den die westli-
che Welt dem Rest des Planeten vorlebte, war zumindest
von einfachen Gemütern durchaus exemplarisch gedacht.
Man war stolz darauf, dem Rest der Welt zu zeigen, was
man erreichen kann, wenn man demokratisch ist, nicht
korrupt, gebildet, fleißig, pünktlich, ehrlich, der wissen-
schaftlichen Objektivität verpflichtet. Es half auch, dass
die Ressourcen von drei Jahrhunderten kolonialer Herr-
schaft und ihren marktwirtschaftlichen Äquivalenten dieses
11Florieren finanziell ermöglicht hatten, aber dieser Aspekt wurde erst ganz allmählich Teil des Narrativs – und ist es in vielen Fällen noch heute nicht. Der Weg zu Wachstum und Wohlstand, zu liberaler Demokra- tie im liberalen Markt, schien vorgezeichnet. Die Landkarte, die diesen Pfad erklärte und darstellte, führte scheinbar un- ausweichlich zu Erfolgen von noch nie dagewesenen Ausma- ßen. Sie zeigte die Verbindungslinie zwischen Demokratie und Wohlstand, zwischen harter Arbeit und dem ersten Paar Jeans oder dem ersten Auto – bis hin zu der flauschigen Auslegeware in den Flagship Stores der globalen Designer Brands, die versprechen, ihre Kundinnen und Kunden für die auf der Reise hierher durchlittenen Demütigungen und Ängste durch den Erwerb einer begehrenswerten Identität zu kompensieren. Diese gesegnete Welt des endlosen Wachstums mit ihren Märkten war etwas, was es auf dem Planeten so noch nie ge- geben hatte, mit ihren Institutionen und politischen Parteien, ihrem Gleichgewicht der Mächte und ihrer Jugendrebellion, ihren kolossalen Wirtschaftsräumen und ihren erstaunlich egalitären Gesellschaften, eine Welt, die vor Zukunft aus allen Nähten zu platzen schien, mit ihrer Science Fiction und ihren realen wissenschaftlichen Revolutionen, Pille, Popmu- sik und Mondlandung, Plastik-Wegwerf-Einweg-Alles, mit Autos wie Festungen und Atombomben – ein unaufhaltsamer Fortschritt. 12
Diese Welt ist vorbei. Wir bewohnen ihre Ruinen, auch
wenn viele davon noch so gut in Schuss sind, dass die
Bewohner es nicht merken.
Wir kauen noch immer hart daran, dass dieses Evangelium
des endlosen Wachstums und der liberalen Prinzipien nicht
nur darin versagt hat, die Welt zu erobern und alle Men-
schen des Planeten von seiner Überlegenheit zu überzeu-
gen, sondern dass es den Samen seiner Zerstörung immer
schon in sich trägt.
Es ist die Herrschaftsperspektive, aus der diese Zerstörung
resultiert, die Idee, dass die Zukunft zu oft nach rein öko-
nomischen Kriterien gedacht wird. In der klassischen
Wirtschaftslehre geht es um Kapital und Rohstoffe, Pro-
duktionsprozesse und Logistik, Angebot und Nachfrage.
Sauberes Wasser und Luft zum Atmen, ausreichende Arten-
vielfalt und sozialer Friede sind laut diesem Modell Exter-
nalitäten, die nicht in die Kalkulation einbezogen werden
müssen. Der Wirtschaftskreislauf ist getrennt von natür-
lichen Prozessen. Unendliches Wachstum aber verlangt
unendliche Ressourcen und ignoriert, dass so viel Produk-
tivität und so viel Abfallprodukte auf einer globalen Skala
natürliche Systeme und Prozesse verändern.
Das unendliche Wachstum, das in der Nachkriegszeit wohl
ein kluger Gedanke war, ist längst zur tödlichen Gefahr
geworden, denn wir ersticken buchstäblich an den Neben-
wirkungen unseres historisch beispiellosen Erfolgs.
13Anstatt die Dialektik der historischen Veränderung endgültig in einem liberalen Nirwana aufgehoben zu haben, scheint die heutige Welt eher eine riesige Version des Balkan, von dem ein britischer Diplomat einmal sagte, er produziere mehr Geschichte, als vor Ort konsumiert werden könne. Ein ganzes Arsenal von wahrhaft apokalyptischen Bedrohungen von der Klimakatastrophe zu einer wirklich letalen Pandemie, von Bioengineering bis hin zu langsam vor sich hin rostenden nuklearen Arsenalen, von der Entwicklung der künstlichen Intelligenz bis hin zum Kollaps der Biodiversität: Die Ge- schichte zeigt keinerlei Anzeichen der Erlahmung. Nichts von alledem war in der Karte verzeichnet, die nach 1945 zur road map des westlichen Erfolgs wurde und doch führte sie an so viele schreckliche Orte, dass sie längst hätte ersetzt werden müssen, aber genau hier liegt das Problem. Zerstückelte Ruinen Mindestens so problematisch wie CO2 und Methan in der Atmosphäre ist die Fantasielosigkeit. Es gelingt noch immer nicht, die alberne Illusion zu durchbrechen, dass unsere Gesellschaften und ihre politischen und ökonomischen Ord- nungsprinzipien so sind, weil sie notwendig so sein müssen, weil sie die besten aller möglichen Prinzipien sind, weil es außer diesem Weg keinen anderen gibt, weil sie das Resultat von Aufklärung, Fleiß und Fortschritt sind. Wir schaffen es nicht, Landkarten zu gebrauchen, die das Territorium neu vermessen und neue Ziele darstellen. 14
Unser ängstliches Festhalten an veralteten Karten in unse-
ren Köpfen mag auch damit zusammenhängen, dass unsere
Gegenwart so besonders laut danach schreit, mit ruhiger
Autorität beschrieben zu werden, klare Koordinaten und
Orientierungspunkte zu bekommen. Mehr denn je scheint
es, als wäre alles, was fest war, flüssig geworden und würde
sich jeder Eindämmung, jeder Begrenzung entziehen und
alle Hindernisse einfach umfließen.
Der vor kurzer Zeit verstorbene polnisch-britische Politik-
wissenschaftler Zygmunt Bauman nannte dieses Phänomen
die „flüssige Moderne“: Nichts hat mehr eine feste Form,
alles fließt unbezähmbar weiter: Klimagase und ozeanische
Tiefenströmungen, Kapital und Migranten, Waren und
Viren, Fake News und globale Märkte, Internet-Memes
und Terror, Moralvorstellungen und Gletschereis.
Nichts ist in dieser Zeit so nötig wie Orientierungspunkte,
aber inmitten der strömenden Wirklichkeit sind die alten
Sicherheiten längst unter der glitzernden Oberfläche ver-
schwunden.
Eine neue Art Landkarte müsste so beschaffen sein, dass
sie auch die dauernde Veränderung reflektiert, denn Karten
sind ein trügerisches Antidot zum anarchischen Pulsieren
der Wirklichkeit. Sie abstrahieren so weit, dass die Verände-
rungen im Detail nicht weiter ins Gewicht fallen, aber wenn
es diese Details sind, nach denen man sucht, dann werden
sie schlimmer als nutzlos.
15Landkarten sind nur dann nützlich, wenn sie die Welt nicht
so abbilden, wie sie ist. Was sonst geschehen würde, be-
schreibt Jorge Luis Borges mit der ihm eigenen, unwider-
stehlichen Logik in seiner Kurzgeschichte „Von der Strenge
der Wissenschaft“.
In einem alten Reich, schreibt Borges, hatte die Kunst der
Kartografie eine solche Vollkommenheit erreicht, dass die
Hüter dieser Kunst schließlich eine Karte produzierten, „die
genau die Größe des Reiches hatte und sich mit ihm an je-
dem Punkte deckte“. Das aber lässt die Wissenschaft der Kar-
tografie zusammenbrechen, denn sie hat sich selbst überflüs-
sig gemacht: Die Welt selbst gibt es schließlich bereits vorher,
die Karte ist als Kopie und Fiktion entlarvt. Das große Werk
kommt deswegen zu einem unrühmlichen Ende:
„Die nachfolgenden Geschlechter, die dem Studium der
Kartographie nicht mehr so ergeben waren, waren der
Ansicht, dass diese ausgedehnte Karte überflüssig sei
und überließen sie, nicht ohne Verstoß gegen die Pietät,
den Unbilden der Sonne und der Winter. In den Wüsten
des Westens haben sich bis heute zerstückelte Ruinen
der Karte erhalten, von Tieren behaust und von Bettlern;
im ganzen Land gibt es sonst keinen Überrest der geo-
graphischen Lehrwissenschaften.“
Eine Karte, die zu detailliert ist, zu gut und ihrer Sache zu
sicher, muss bald veraltet sein, offenbart als Objekt zweiter
Klasse.
16Eine klug konzipierte Landkarte geht den entgegengesetz-
ten Weg. Sie lässt aus, vereinfacht, schematisiert, verzerrt,
um die Elemente zu betonen, die den Erwartungen der
Benutzerinnen entsprechen und sie zu ihren vorgefassten
Zielen führen, ohne der Komplexität in der Umgebung
Aufmerksamkeit zu schenken und sich von ihr ablenken zu
lassen. Das wohl beste Beispiel dafür ist die vielleicht meist
benützte Karte der Welt, die ikonische London Tube Map,
die zum ersten Mal 1931 erschien, mit modernistischem
Flair konzipiert von dem damals 29-jährigen Grafiker Harry
Beck.
Die Tube Map reorganisiert das scheinbare Chaos der
U-Bahnlinien und Stationen in ein klar geordnetes Gitter-
werk von geraden und diagonalen Linien in verschiedenen,
klar erkennbaren Farben. Das Design ist so effektiv, dass
kaum eine Nutzerin und ein Nutzer des London Under-
ground ohne es zurechtkommen könnte.
Während die Karte aber im unterirdischen London unent-
behrlich ist, ist sie zu ebener Erde nicht nur nutzlos, son-
dern grotesk und irreführend. Die Entfernungen zwischen
den Stationen haben nichts mit der geografischen Wirklich-
keit zu tun, Distanzen und Orte wurden so manipuliert,
dass die Karte nur für einen einzigen Zweck zu gebrauchen
ist, wie ein Tier, das von der Evolution für eine einzige,
hoch spezialisierte biologische Nische konditioniert wurde.
Einen Vorteil aber hat eine Karte, die so stark stilisiert ist,
wie die London Tube Map: Sie hat die Drachen der alten
17Seekarten gewissermaßen in den abstrakten Entwurf assimi- liert. Die Karte als abstrakte Grafik kommuniziert deutlich, dass sie die Welt da draußen gerade nicht objektiv abbildet, sondern durch kreative Verzerrung erst navigierbar macht, dass sie eine nützliche Fiktion ist. Erst wenn eine Karte von sich behauptet, ein objektives Bild der Wirklichkeit zu vermitteln, wird sie zur Erkenntnisfalle, denn wo die Kartografen vergangener Jahrhunderte als ein kleines Ritual ihrer professionellen Bescheidenheit vor Dra- chen warnten, um die Grenzen ihres eigenen Wissens anzu- zeigen, hat die zunehmende Selbstsicherheit einer unerhört erfolgreichen Zivilisation diese Bescheidenheit bald unter den Tisch fallen lassen. Wahrheit mit Goldschnitt Ich besitze eine Ausgabe von „Meyer’s Konversationslexikon“ aus 1908, eine seltsame, würdige, wenn auch nach mehr als 100 Jahren deutlich mitgenommene Ausgabe in mehr als zwanzig Bänden mit Lederrücken und Goldschnitt, die büh- nenwirksam Platz einnimmt in meinem Regal. Dies waren die Zeiten, bevor man mehr oder weniger wichtige Fakten auf seinem Handy nachsehen konnte. Ein Konversationslexikon sollte bei der gebildeten Konversation helfen; mehr noch, es sollte unumstößliche Fakten liefern. Genau das tut dieses Lexikon als Ausdruck einer immensen, fast schon majestätischen Klassifizierungswut. In tausenden 18
von Artikeln und auf prächtigen, farbenfrohen Lithografien
und Landkarten wird die Welt in eine Linnésche Hierarchie
gezwängt, die keinen Widerspruch duldet. Eine Karte Euro-
pas zeigt die „wertvollen“ blonden und die „minderwertigen“
dunkelhaarigen Bevölkerungsgruppen verschiedener Län-
der. Es proklamiert dieses Wissen nicht als Hypothese, son-
dern als etablierte Tatsache, geheiligt durch ihre Aufnahme
in das Nachschlagewerk und die Professorentitel der zitier-
ten Kapazitäten (ganz zu schweigen von ihren Propheten-
bärten).
Diese schon fast biblische Autorität ist besonders ironisch,
weil die bloße Existenz dieses Lexikons nicht nur auf
zeitlosem Wissen beruhte, sondern auf technologischem
Fortschritt, auf neuen, billigeren Methoden zur Papierer-
zeugung, auf elektrischen Druckerpressen und bislang
unbekannten Techniken im industriellen Vierfarbendruck,
im mechanisierten Buchbinden, effizienten Transportnetz-
werken und der wirkungsvollen Werbung und Verwaltung.
All diese Elemente sollten in den folgenden Jahrzehnten
bewirken, dass die Welt, die auf diesen Seiten in gotischen
Lettern beschrieben wird, über ihre Ufer treten würde in ei-
nem immensen Strom der Moderne. Die grabsteingleichen
Bände mit ihrem Goldschnitt und ihrem würdigen Gehabe
beschrieben eine Welt, deren Totengräber sie gleichzeitig
waren. Die hier so wirkungsvoll als unterworfen, systemati-
siert und beherrscht dargestellte Welt sollte sich sehr bald
gegen ihre Unterwerfung erheben.
19Dies ist der Fluch der Sicherheit: die drohende Veralterung, die eigene Irrelevanz. Um ihr zu begegnen, um die Darstel- lung so flexibel zu halten, dass sie sich den Veränderungen anpassen oder sie antizipieren kann, müssen die Drachen ihren Platz im Ganzen erhalten, die Platzhalter des letzten produktiven Zweifels. Dieser Riss zwischen Projektion und Realität, den der Drache bewohnt, gibt den Fiktionen eine Chance, Wurzeln zu schla- gen. Er reicht in die Brüche des Selbstbilds, erkundet die Lügen, die wir uns erzählen, um das Gesicht zu wahren, ent- hält die Entscheidungen, die aus vorgeschobenen oder irrigen Gründen getroffen werden, registriert das sich entfaltende Desaster der zerbrochenen oder erblindeten Illusionen, die wie alte Spiegel jede Fähigkeit verloren haben, ein erkenn- bares Bild von der Welt zu reflektieren. Dieser Riss, der sich in der scheinbaren Sicherheit der Pro- jektion auftut, bietet so eine einzigartige Chance. Hier kommt mein Handwerk ins Spiel, das des Erzählens. Als Autor von historischen Sachbüchern und von Romanen, in Reden und im Radio bewege ich mich immer auf diesem Riss, auch wenn ich höchsten Wert darauf lege, das eine vom anderen klar zu unterscheiden. Diese Unterscheidung aber ist sus- pekt, denn es geht stets auch um die zerfließenden Ränder des Wissens, den Treibsand historischer Moralvorstellungen, um Ängste und Demütigung und die anderen Ungeheuer der Vorstellung. Als Erzähler bin ich immer auf der Suche nach den Drachen. 20
In diesen Rissen kann ich sie finden, diese Drachen, sie
dazu provozieren, sich zu zeigen. Es ist wichtig, mit den
Drachen zu tanzen, denn nur, wenn sie aus ihrem Versteck
kommen, lässt sich erkennen, dass die Version der Welt, in
der wir uns bewegen, dass unsere mental maps nichts weiter
sind als Projektionen, die menschliches Geschick über die
Welt gelegt hat, ein Muster, das die Welt navigierbar macht,
das aber auch durch andere Muster ersetzt werden kann,
wenn es seine Funktion nicht mehr erfüllt, sondern zum
geistigen Gefängnis wird.
Dies ist, scheint mir, eine zentrale Herausforderung für all
das, was man gemeinhin „Kultur“ nennt: Die Projektion, die
über der Wirklichkeit liegt, als solche zu entlarven und zu
erkunden und gleichzeitig mögliche andere Projektionen
auszuprobieren, vorzuschlagen, aufzubauen, zu vertiefen,
zu variieren und erlebbar zu machen, damit sie den Weg
von der Bühne auf die Straße und sogar in die Köpfe gehen
können.
Perspektivenwechsel
Seeungeheuer und Drachen sind sowohl ästhetische als
auch philosophische Akzente, die auf alten Karten für das
Wunderbare, das Unentdeckte und Bedrohliche standen,
hinter dem eigenen Wissenshorizont, immer einen Schritt
weit voraus. So ist eine Karte zugleich praktisches Instru-
ment und ästhetisches Objekt, bestenfalls ein Kunstwerk
an sich. Die Erforschung der Karte und ihrer Projektion ist
21immer gleichzeitig wissenschaftlich und künstlerisch, Analyse und ästhetisches Ereignis. Setzen wir also einen Drachen – oder einen warnenden Hin- weis darauf, in einen Winkel unseres Geistes – und spielen wir mit den Konturen einer mentalen Landkarte der Zukunft. Wie könnte sie sich von den mental maps der Nachkriegswelt und der liberalen Märkte unterscheiden? Um zu verstehen, wie wir uns in dem unendlich komplexen Mobile der Welt bewegen können, in dem jedes Teil mit je- dem anderen verknüpft ist und jede Bewegung immense Kon- stellationen verschieben kann, werden wir Karten brauchen, die mehr auf Verbindungen und Verbundenheiten hinweisen als auf Grenzen, auf Vernetzung und Verstrickung aller kultu- rellen Schöpfungen, aller Konsumentscheidungen, Atemluft, aller natürlichen Systeme. Nur die Grenzen darzustellen, macht denkfaul. Eine Karte, die in der unmittelbaren Zukunft nützlich sein soll, müsste aber noch etwas abbilden können. Der tschechi- sche Kulturphilosoph Vilém Flusser verglich die Wirklichkeit einer Mediengesellschaft mit einer Suppe mit Fettaugen darauf. Die Fettaugen ziehen die Aufmerksamkeit auf sich, formen eine glänzende, immer wechselnde Oberfläche, die leicht mit der eigentlichen Suppe zu verwechseln ist. Eine Landkarte der Zukunft könnte dazu verwendet werden, die horizontale Perspektive auf Fettaugenniveau aufzuwei- chen und auch die Verbindungen in die Tiefe mitzudenken. 22
Es ist unmöglich, eine Landschaft zu verstehen, indem man
ausschließlich ihre Oberfläche beschreibt. Erst in der Tiefe
stößt man auf das wimmelnde Leben der Dunkelheit, die
Schichten und die Geschichten, durch welche die Wirk-
lichkeit ihre Form bekommen hat und die bestimmen, wie
sie weiter wachsen kann und auf die mikrobiellen und kul-
turellen Wurzelsysteme, die erst Leben ermöglichen.
Das ist der größte Unterschied: ein Perspektivenwechsel,
ohne den der Homo sapiens nur ein kurzes Gastspiel auf
diesem Planeten geben wird. Eine mentale Landkarte der
Zukunft wird den Homo sapiens mitten in der Natur ver-
orten, nicht als erhaben über sie.
Instrumente der Eroberung
Die Landkarten früherer Epochen waren immer auch In-
strumente der Eroberung. Sie dienten Seefahrern und Feld-
herren dabei, ihren Herrschern und ihren Handelshäusern
und Korporationen neue Territorien, neue Rohstoffe, neue
Märkte, neue Untertanen und Sklaven, Arbeiter und Kun-
den zu sichern. Sie waren Werkzeuge in dem großen Feld-
zug, der seine Inspiration schon im Buch Genesis findet,
in dem Gott Adam und Eva aufträgt: „Macht euch die Erde
untertan.“
Mit diesem Satz macht die Bibel aus der animierten Natur
anderer Mythen ein totes Territorium, das besiedelt, ge-
pflügt, verkauft, penetriert und vermessen werden kann.
23Wenn Sie, wie ich, in einer westlichen Gesellschaft aufge- wachsen sind, dann haben Sie diesen Satz gewissermaßen mit der Muttermilch aufgesogen. Er scheint so normal, so natürlich, dass es schwer ist, den Drachen im Winkel dieses Gedankens zu sehen und auch diese Idee als Projektion zu erkennen, als möglicherweise nützliche Selbstüberschät- zung einer Kultur der Bronzezeit, die aus dieser Herrschafts- perspektive heraus vergessen machen konnte, dass sie auch den kleinsten Launen der Natur hilflos ausgeliefert war. In diesem einfachen Satz steckt das historische Erfolgsre- zept einer Kultur, die nicht nur territorial und expansiv dachte und auf Unterwerfung ihrer Peripherie aus war – das taten andere Kulturen auch – sondern die durch eine Serie von Zufällen früher als andere fossile Brennstoffe für sich nutzbar machte und es so schaffte, Produktivität von Mus- kelkraft abzukoppeln und immer mehr Arbeit an Maschinen zu delegieren. Wissenschaft, Menschenrechte, Philosophie und liberale Demokratien waren die positiven Resultate einer beispiellosen Unterwerfungskampagne, die von den Hofchronisten der neuen Mächtigen dementsprechend gewürdigt und gepriesen wurden. Eine Ambition der Bronzezeit dient noch immer als Leit- prinzip für Tugend und Laster im 21. Jahrhundert. Von der wissenschaftlichen Naturbeherrschung der Aufklärung bis zur Herrschaft der liberalen Weltordnung fußt die Entwick- lung einer globalen, immer stärker vernetzten Zivilisation auf einem Weltbild, das vor 3000 Jahren vielleicht nützlich war, in Verbindung mit den Technologien der Gegenwart 24
aber zur existenziellen Bedrohung geworden ist. „Wir ha-
ben einfach nicht genug Erde für so viel Fortschritt“, wie
der französische Denker Bruno Latour lakonisch bemerkt.
Die Landkarte als Mittel der Unterwerfung kartografiert
den Weg zur Zerstörung, weist den Lemmingen den Weg
über die Klippe. Gleichzeitig aber wird Orientierung wich-
tiger denn je, denn während die Ambition der Weltherr-
schaft langsam und obszön in sich zusammenbricht,
werden schon andere Karten gezeichnet und angeboten,
Projektionen und Küstenlinien sehr unterschiedlicher
Arten von Zukunft.
Diese Karten denken den Zweifel und ihre eigene Künst-
lichkeit nicht mit, verleugnen sie sogar. Sie verkünden die
Wahrheit mit Goldschnitt und Lederrücken, weisen den
Weg zur Herrschaft der Märkte oder der Allahs, zur mili-
tärischen Supermacht und zum Wirtschaftsstandort, zur
Wahrheit und zum Recht, zu Männlichkeit und geneti-
scher Überlegenheit.
Solche Karten verzeichnen auch nicht die Friedhöfe, die
Sklavenplantagen, die KZs und Gulags, die entlang der
Straße zum Fortschritt und zum Neuen Jerusalem liegen.
Sie zeigen Ziele, keine Kollateralschäden. Bei einer neuen
Generation von Karten, die noch geschaffen werden muss,
wird man nicht umhinkommen, sich damit auseinanderzu-
setzen, was die Aufnahme verdient, welche Tiefenschärfe
notwendig ist, welche Vereinfachung unabdingbar, welche
symbolischen Ziele dargestellt und erschlossen werden.
25Noch ist nicht entschieden, welche Karten den Weg durch die nächsten Jahrzehnte projizieren, wohin die Reise geht, welche Ziele und welche Gefahren auf ihnen verzeichnet sind. Die am häufigsten verwendete Projektion, die so viel Macht entwickelt, dass sie gar nicht mehr als solche wahr- genommen wird, ist nicht notwendigerweise eine, die Pfade zur Nachhaltigkeit zeigt, zu Humanismus, Menschenrech- ten oder Minderheitenschutz. Die Karte der Zukunft könnte eine Welt beschreiben, die aus Schutzwällen, Mauern, Grenzen und tiefen Gräben be- steht, eine Geografie der Angst und der Demütigung. Des- wegen wird es wichtig sein, als Kontrapunkt zur politischen Instrumentalisierung mentaler Landkarten immer wieder neue Räume zu erkunden, andere Ziele sichtbar zu machen, neue Wege zu finden, aus einer Perspektive der Verstrickt- heit heraus. Das ist übrigens, warum Pluralismus ein so wichtiges kultu- relles und gesellschaftliches Kapital darstellt. Verschiedene Erfahrungshorizonte und Standpunkte resultieren in unter- schiedlichen Perspektiven auf dasselbe, immer wandelbare Ganze. Plurale Perspektiven bieten Chancen, aus diversen Sichtweisen unterschiedliche Arten von Information zu ge- winnen, ein schmutziges Wissen, das nicht aus der Sterilität des Labors kommt, sondern aus der Reibung mehrerer Arten von Verständnis, aus den genetischen Zufällen der gegenseiti- gen Befruchtung, aus der viralen Übertragung durch kulturel- le Praxis. 26
Landkarten, die auf diese Weise entstehen, sind oft inoffizi-
ell und werden unter dem Tisch gehandelt. Ihre Konturen
sind dauernder Veränderung unterworfen, denn sie spiegeln
die tektonischen Verschiebungen, die neuen Inseln und
schroffen Küsten einer in rasches Fließen geratenen Wirk-
lichkeit.
Trampelpfade
Hic sunt dracones! warnt eine kleine Inschrift auf der Karte
einer möglichen und menschlichen Zukunft. Dieser letzte
Ort des Zweifels hält die Erkenntnis wach, dass Homo
sapiens die Erde nie unterwerfen wird, dass er aber dabei
ist, sich bei dem Versuch selbst umzubringen. Das fiktionale
Element in der realistischen Projektion erinnert daran, dass
es sich dabei nicht um ein naturgetreues, wahrhaftiges
Abbild der Wirklichkeit handelt, sondern um eine nützliche
Reduktion von Komplexität, einer Verzerrung der Proportio-
nen, einer übergestülpten Ordnung, einer Zensur der anarchi-
schen Realität.
Es ist wichtig, welche Landkarten wir in unseren Köpfen
haben, denn die Wege, die sie vorzeichnen, werden nach-
gelaufen und schaffen neue Trampelpfade, neue neuronale
Schnellstraßen durch das Chaos der Erfahrung. Sie beginnen
als Linien auf Papier und werden zu Backstein und Mörtel,
zu Beton und Stacheldraht, zu einem Schulgebäude für Mäd-
chen, oder einem Gedenkstein auf einem Massengrab. Es ist
27wichtig, wo diese Linien verlaufen, welche Wege sie erschlie- ßen, welche Zusammenhänge sie schaffen oder verbergen. Der Wiener Hochnebel hat sich nicht gelichtet. Instinktiv warte ich noch immer darauf, dass der Tag endlich anfängt, obwohl es schon Nachmittag ist. Ich sehe aus dem Fenster und denke an David Mitchell’s Roman „Cloud Atlas“, der sich trotz seines poetischen Titels gar nicht mit Wolkenkarten beschäftigt. Aber so eine Landkarte wäre jetzt von Not; eine, die die Verän- derungen der Formen festhalten kann, ohne die Substanz aus dem Blick zu verlieren, oder die Auswirkungen, die diverse Wolken innerhalb des Netzwerks Erde haben. Solch eine Karte würde eine rein poetische Wirklichkeit artiku- lieren, aber sie würde so wenig gebraucht, wie die von Borges. Nützliche Karten müssen ihre Fantasie an den Konturen einer Wirklichkeit ausrichten, die sie selbst mit erschaffen. Gerade jetzt bricht der Himmel tatsächlich ein wenig auf und durch fünf Schattierungen Hellgrau scheint zaghaft ein fernes Blau. Wien, am 14. Dezember 2020 28
29
Philipp Blom Here Be Dragons Thoughts About Mapping the Future
32
Here Be Dragons
Thoughts About Mapping the Future
I am sitting at my desk. Through the window I can see the typi-
cal grey Viennese winter sky stretching desolately over the end
of this eerie year 2020. I am writing a letter to you, not know-
ing (and this is no platitude in times such as these) where and
in which situation these lines will find you.
Under normal circumstances, I would have given a speech to
you, some reflections about culture in Austria and beyond. But
circumstances are not normal, and I therefore have to resort to
the almost antiquated means of putting my thoughts on paper
and having them printed, so that my readers can absorb these
lines at their leisure and can reread them as often as they like –
a dangerous business for authors in a time when prose usually
zips by through inboxes and brains at the speed of light.
Let me say it straightaway: the orderly appearance of the print-
ed page is misleading. As the pandemic events and their multi-
ple consequences unfold in unpredictable lurches, it is diffi-
cult if not impossible to gain perspective and to let one’s own
thoughts parade in front of the reader in orderly rows. It is a
moment for tentative thinking and thoughtful exploration, for
retreat to greater patterns. This is not yet the time for explana-
tions, let alone for speculation about how this time will be
remembered, how significant it will be seen to have been.
33Hic sunt dracones The layout of the printed page with its authoritative order and its suggestion of neat objectivity makes me wish that books would adopt a wise old tradition observed by cartographers of centuries past. The first maps to describe large areas of the globe with any degree of accuracy were sea charts, which showed mainly the contours of coastlines, while their vast inland areas were still mostly unknown to European explorers and cartographers. Only the coasts of Europe were drawn with any degree of accu- racy – at times with an amazing amount of detail, considering the technologies of the time. The further these maps reached into the fathomless oceans, however, the further they reached to the south or north, the less certain the map makers became. They were forced to rely on the measurements of sailors, on observations and reports, anecdotes and seafarers’ tales, without knowing where the facts ended and fiction began. Instead of being discouraged by this fact, however, many map makers simply incorporated these fictions into their handiwork. Where known facts ended, the imagination was allowed to fill in the gaps. Sea monsters frolic in these distant seas: aston- ishing and frightening freaks and fantastical beings born of tales told in taverns, copied from even older maps or medieval bestiaries, exotic animals glimpsed in markets on other con- 34
tinents or reconstructed, tenuously and imaginatively, from
the dried and pickled remnants carried back to Europe.
An entire fantastical zoo spills out over these pages: elephants
with fish tails and whale-like beasts spouting water from twin
funnels, gigantic sea pigs and leviathans, snakes of all kinds
and sizes, unicorns and mermaids in endless mutations, crea-
tures of feverish, even fetid imagination.
But these creatures were not perceived as amusing or annoying
distractions from the objective rendering of crucial informa-
tion. Clients were even willing to pay extra for them. A map
decorated with mysterious maritime monsters and perhaps
even coloured in by hand was not only a crucial aid to naviga-
tion, but a work of art, an ornament for the study table or the
library wall. Perhaps they even helped a weary captain or two
through the monotony of the windless doldrums with re-
minders of the dangers and the wonder inherent in his long
travels.
For the map makers themselves, the illustration of sea mon-
sters was more than artistic embellishment. The abodes of
monsters marked the border between what could be known
and what could not, indicating the existence of realities about
which no map could offer certainty. Painted along an Asian
coast of the Hunt-Lenox Globe of 1504 is the famous inscrip-
tion hic sunt dracones – here be dragons – at once a warning
to would-be adventurers and a euphemistic admission of
ignorance.
35Printed books might do well to adopt a similar warning to read- ers in search of certainties and absolutes: at the bottom of the first page – hic sunt dracones. Mental Maps Geographical maps, of course, are useful, but not just in terms of geography. Especially now, when it seems the assured mental maps of the post-war era can no longer meaningfully depict the terrain of our 21st-century present. Their compass is at odds with current developments. Too much has happened since they were drawn, too many things for which they have no symbols, and of which the map makers had no conception. Since they were designed, rivers of historical events have changed the metaphorical landscape, and entire continents have emerged – to say nothing of the real geographical changes to coastlines and polar ice caps, to the permafrost and the steppes, to the rainfor- ests and islands, built up artificially, or vanished beneath rising seas. The maps being discarded now, those that describe the world as it might have looked from a Western vantage point in 1945, belong, like their medieval predecessors, consigned to in history books or even museums. The world erected after 1945 by the victors of World War II was built in the name of freedom, even if this freedom was defined very differently in different places. Centered on economic growth and its political and social dividends, it was intended 36
to sweep away existing structures regarded as outdated, ineffi-
cient, undemocratic, or hegemonic. The power of competition,
at first guided by the state, was in due course to be liberated
entirely by the machinery of the almighty market.
The apotheosis of this way of thinking was the now infamous
“end of history” augured by Francis Fukuyama directly after
the fall of the Iron Curtain in 1989. As it turned out, there was
no neat historical denouement; on the contrary, even those so-
cieties most certain of their winning values were soon shaken
by different forces, from without but also, more alarmingly,
from within.
To those living in the industrialized West, freedom and wealth,
or the pursuit of them, had been more than a way of life. Even
to many not personally enjoying those benefits, they represent-
ed part of a historical mission: societies like theirs, delivering
or at least promising freedom and wealth, were the prize to be
won by respecting democracy and fighting corruption in a pop-
ulation of educated, industrious, punctual, honest people,
guided by the objective truths of science and carried along by
the dynamism of free markets – by what Francis Fukuyama
would later summarize as ‘getting to Denmark’. One crucial
aspect of the official narrative of the already free and wealthy
societies was generally sidelined: that this present flourishing
largely rested on the resources accrued during three centuries
of colonial rule, resources now managed by international
organizations controlled by the same actors. This narrative is
still frequently kept out of view.
37The globalized path to growth and prosperity, to liberal democ- racies and liberal markets, was deemed to have become in- evitable. The new map depicting it promised success of unprec- edented proportions to those who dutifully followed the path. It portrayed the purportedly automatic connections between democracy and wealth, between hard work and a first pair of imported jeans or a first car, between the freedom to buy a grad- ual accumulation of consumer goods, right up to the threshold of the thickly-carpeted flagship stores of global luxury brands. The implicit bargain was a supposed compensation for the anxiety, the many humiliations, and the sheer drudgery endured by so many along that same path. This promised land with its markets of endless growth, limitless consumption, and sacred liberties, its political parties and insti- tutions of all kinds, its balance of power, rebellious youth, colos- sal economic spaces and surprisingly egalitarian societies was something the planet had never seen before. It was a world that seemed to burst at the seams for the sake of a future full of science fiction, garnished with real scientific breakthroughs, the pill, pop music, the landing on the moon, plastic-disposable- everything, cars like fortresses and nuclear bombs – a progress that could not and would not be stopped. And yet, this promised land is gone, no longer held out to us as the inevitable destination of hard-working, democracy-loving consumers. Despite any still impressive edifices, its gospel of liberalism and endless growth has not conquered the world; it has not 38
convinced every society around the globe of its own superiori-
ty. Worse, it has shown that it carries within itself the seeds
of its own destruction. The idea that, in order to fuel endless
economic growth, human societies can and must exploit all
available resources to the fullest extent, is an idea that has
already led us to a point of crisis. If followed dutifully further,
it can only lead us to a place of catastrophe.
During the twentieth century, the bulk of economic thinking
dealt with capital and raw materials, with production process-
es and work streams, with efficiency and market forces, prod-
ucts, logistics, and competition. Clean water and breathable
air, biodiversity, a stabile climate and social peace were regard-
ed as “externalities” with no bearing on economic calculations.
The economic cycle was thought of as divorced from the natu-
ral world, or at the very least as purely extractive. Limitless
growth, however, demands limitless resources. It is by its very
nature short-term, ignoring the accumulating side-effects
of the vast systems of extraction and production which are
changing not only human societies, but also natural ecosys-
tems, and this on a global scale. Even the most fortunately
placed of us have by now grown familiar with the conse-
quences – or some of the consequences – of these changes.
In the years immediately after World War II, with so many
economies destroyed and so many millions living in poor or
abject conditions, the centrality of economic growth might
have been an appropriate and even necessary idea. But that
was three quarters of a century ago. That once appropriate
idea has since then mutated into a lethal threat to us all, and
39we are already literally choking, in major world cities, on the side-effects of our economic success. Far from the liberal nirvana of the ‘end of history’ or a globe- spanning Denmark, we are today closer to a globalized Balkans, that fractious region which, in the words of a British diplomat, “produces more history than it can consume”. We are confront- ed – all of us – by an arsenal of truly apocalyptic man-made threats, from lethal pandemics to the climate crisis, from the old, rusting nuclear arsenals to the new, unprecedentedly pow- erful technology of bio-engineering, from the rise of artificial intelligence to the collapse of biodiversity. ‘History’ shows no sign of slowing down. None of this was documented in the map plotting the path to success after 1945. Along that path, we have encountered many places of terror. There is a rapidly growing consensus that the old map should have been replaced long ago. But better maps, more suited to the path on which we now find ourselves, have proved extraordinarily hard to come by. Fragmented Ruins While the constant rise of CO2 in the earth’s atmosphere has become a desperate threat to us, the lack of imagination with which we are currently meeting this threat is no less desperate. It still seems well-nigh impossible to break with the childish il- lusion that our industrial societies have evolved through a kind of teleological inevitability, that they are what they are because 40
of some historical necessity, that they must be as they are,
that they represent the best of all possible worlds, the natural
result of Enlightenment, inventiveness, effort and progress.
We seem unable to draw new maps to plot out new territo-
ries, replacing outdated and destructive fictions with new
goals.
Perhaps we are particularly reluctant to throw away the old
maps because we feel almost overwhelmed by the uncertain-
ty of the unfolding new world: we feel we need an objective
explanation of things, quiet authority, clear coordinates and
points of orientation. What was once stable – pathways, val-
ues, identities – seems to be melting. Events and facts resist
being fixed; they avoid containment by simply flowing around
whatever obstacles of objective truth are put in their way.
The late Polish-British political scientist Zygmunt Bauman
christened this phenomenon “liquid modernity”. Nothing is
described by a fixed form anymore, everything is in flow: at-
mospheric gases and deep ocean currents as much as capital
and migrants, goods and viruses, fake news and global mar-
kets, internet memes and terror, moral ideas and glacial ice.
We in our time yearn for a clear orientation amid the lique-
fied reality in which we now live, in which all certainties are
vanishing beneath an often glittering surface.
A new map would have to be able to reflect this constant
change, for maps are a deceptive antidote to the anarchic
pulsations of reality. They abstract so much that fickle details
41cease to be important, but if it is these details that one is looking
for, the maps are worse than useless.
Maps, in fact, are only useful if they do not depict the world as
it is. What would happen otherwise is described by Jorge Luis
Borges in his wonderful story “On the Exactitude of Science”, in
which he describes a long-vanished empire in which cartography
has reached such a degree of perfection that the guardians of
this art finally produce a map as big as the empire itself. This
masterstroke precipitates the end of the art of cartography, be-
cause it has rendered itself redundant. The world, after all, was
already there, and the map will always only be a copy and a fic-
tion. In the end, the great enterprise is quite literally in tatters:
“Less addicted to the study of cartography, succeeding gen-
erations understood that this extended map was useless,
and without compassion, they abandoned it to the in-
clemency of the sun and of the winters. In the deserts
of the west, there remain tattered fragments of the map,
inhabited by animals and beggars; in the whole country,
there are no other relics of the geographical disciplines.”
A map that is too detailed, too good and too certain of itself must
soon be obsolete. In order to be useful, it must simplify, schema-
tise, leave out, distort, and emphasise only those elements,
which meet the expectations and needs of its users, allowing
them to find their goal with ease, without being distracted by
the complexity of reality.
Perhaps the best example of this kind of map is one that has had
42countless users and imitators: the iconic London Tube Map,
published for the first time in 1931 and conceived with mod-
ernist flair by the then 29-year-old graphic artist Harry Beck.
The London Tube Map reorganises the apparent chaos of
underground lines and stations intersecting at different levels
into a clear grid of straight and diagonal lines in different,
clearly recognisable colours. The design is so effective that
hardly any user of the London Underground could travel its
vast network without its help.
While this map is irreplaceable underground, it is worse than
useless above ground. The indicated distances between
stations bear no relation to geographical reality; scales and
locations have been manipulated so that the map can be used
for one purpose only, like an animal, which has been honed by
evolution to inhabit just one biological niche.
There is one surprising advantage to a map that has been
stylised as rigorously as the London Tube map: it has incorpo-
rated the dragons of the old nautical charts into its very design.
As an abstract representation, it communicates clearly that
the world out there is not objectively depicted by it, but that
it becomes navigable only through creative distortion, that it
is at best a useful fiction.
As soon as a map claims to be a true image of reality, it be-
comes a trap for knowledge about the world. Where the map
makers of centuries gone by included sea monsters as small
rituals of professional humility and warned of dragons to indi-
43cate the limits of their own knowledge, the increasing certainty of an incredibly successful civilisation has let this modesty slip. A Gilt-Edged Truth In my bookcase, I keep a copy of “Meyers Conversationslexikon” from 1908, a kind of German “Encyclopaedia Britannica” in 23 fat volumes. More than a hundred years of use have left their traces on these dignified, leather-bound tomes with their gold embossing, designed to claim centre stage among all the other books. These were the days before one could look up useful facts on a smart phone. This kind of dictionary was conceived of as an aid to polite conversation, and what is more, it was charged with providing incontrovertible facts. The articles contained in these volumes bear witness to an immense, manic desire to classify, define, and describe. Tens of thousands of entries, with colourful plates and maps of the world, create a rigid, Linnaean hierarchy. A map of Europe shows where the “valuable” blond and the “inferior” dark-haired population groups are prevalent in different countries. It pro- claims this knowledge not as a hypothesis, but as established fact, sanctified by its inclusion in the encyclopaedia itself and by the titles and eminence of the authorities quoted, men of science whom one can hardly imagine without the beards of biblical prophets. This claim to absolute authority is particularly ironic, since the mere existence of this lexicon was based not on timeless truths 44
or pure science, but on technological advances in the produc-
tion of cheap paper, electric printing presses and new tech-
nologies enabling colour printing, automated bookbinding,
efficient transport networks, and effective advertising and
administration.
During the following decades, these very elements would con-
spire to destroy the world described here in Gothic letters, as
modernity would burst its banks. These tombstones of estab-
lished knowledge were describing an immutable world, which
they were also engaged in destroying. The reality that was por-
trayed here, a reality supposedly subject to the laws of science,
would soon rise up against its creators.
This is the curse of too much certainty: the threat of obsoles-
cence, of irrelevance. In order to avoid it, all depictions must
be kept flexible in order to meet or even anticipate the changes
in the world depicted. Somewhere in every one of these maps,
a dragon must be inserted to mark the possibility of productive
doubt.
The rift between projection and reality, in which the dragons
have their secret lairs, also provides a chance for other fictions
to take root. It reaches deep into the fissures of established
self-images, it explores the lies we tell in order to save face, it
contains decisions built on spurious or erroneous grounds,
and registers the unfolding disasters of shattered or blinded
illusions.
This rift offers a singular chance for my own craft, that of
45telling stories. As an author of works of history and fiction, as a public speaker and radio presenter, I am always trying to locate such tears in the smooth fabric of official reality, even while tak- ing care to distinguish fact from fiction, and making clear which is which. But this distinction itself grows suspect, because the edges of knowledge bleed into one another and the sands of historical ideas of morality are always drifting; they do not allow neat classi- fications to remain in one place. In the end, the search for the truth must always take note of the monsters in the deep. As a storyteller, I am always looking out for dragons. It is important to provoke these dragons to leave their secret hiding places, in order to see clearly that the version of the world through which we move and the mental maps we make are noth- ing but projections cast by human ingenuity to make the world navigable. They are projections that can be replaced by others if they no longer fulfil their function, but they can also mutate into mental prisons if they are not recognised for the contingent things they are. This, it seems to me, is the central challenge of what we usually call culture, of artistic work: to unmask the projection we take for reality, to explore it and its characteristics and to experiment with alternatives. It is a call to test, imagine, and understand, to pro- pose different perspectives, to build up a repertoire of viewpoints, to deepen our understanding and to develop new variations of use- ful knowledge that may be able to make the transition from the stage to the street, as it were, and into the heads of those con- fronted with them. 46
A Change of Perspective
Maritime monsters and dragons reminded the makers and
readers of maps used for exploration that they had more than
just an aesthetic dimension. They ensured that a map was
more than a practical instrument or even a work of art: it was
also a philosophical manifesto. Reading a map is always simul-
taneously an analytical and an artistic experience, scientific
and aesthetic.
So, let us use these dragons, and play with the contours of the
mental maps of the future. How could they differ from those
of the old era with which most of us grew up, and all of us are
familiar?
To understand how we might navigate the infinitely complex
fabric of this new reality, in which every element is somehow
linked to every other, like the vast mobile of some giant’s child,
where touching one piece moves entire constellations of oth-
ers, we need maps less concerned with borders than with con-
nectedness. We need projections which draw our attention to
the networks and entanglements at work in all human cultural
creations, all consumer decisions, in the very air we breathe,
and not least, in all parts of nature. Simple maps, which em-
phasize borders, may create in us a sense of mastery of the
territory, but they can also stop us from thinking further than
the very subjective projection of the maps themselves.
But the maps which might be useful for navigating this near
future must be able to accomplish another feat as well. Vilém
47Flusser, a Czech cultural philosopher, has compared the reality of a highly mediatised society with, perhaps surprisingly, a bowl of soup. The diner’s attention, says Flusser, is attracted by the grease drops floating on the surface, which form a glittering sur- face of unstable constellations and continents. This constantly changing surface distracts us from the more solid and nourishing soup underneath. A map of the future must be able to leave the horizontal per- spective of the ever-changing surface and help us think more deeply, down into interconnectedness below. It is impossible to understand a landscape by simply describing what lies on top. Only at greater depths does one find the immense wealth of life and the geological strata, which give the surface its form and appearance. Only by looking at this level can we see which microbial and cultural root systems allow life to flourish, and so understand how the landscape can continue. This is the greatest difference between the old maps and the new: the change of perspective without which Homo sapiens sapiens will have been no more than a brief inhabitant of this planet. A mental map of the future must locate humanity not just on the surface of the landscape, separate from all the deeper entanglements, but firmly inside nature, giving and taking, inseparable. 48
Sie können auch lesen