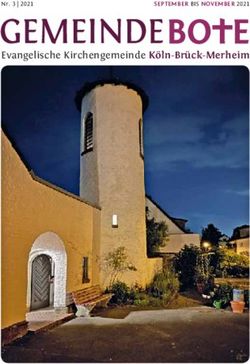Amor und Psyche. Attraktion, Liebe und Grenzüberschreitung in der pastoralpsychologischen Arbeit
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Amor und Psyche.
Attraktion, Liebe und Grenzüberschreitung
in der pastoralpsychologischen Arbeit
Prozessbeobachtungen
zum 42. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Pastoralpsychologie 2014
Klaus Kießling
Das Programm zum 42. Jahreskongress der Deutschen Gesellschaft für Pastoralpsychologie
studierend, fällt mir der Name Potifar ins Auge: Potifar? War das nicht jener Leibwächter des
ägyptischen Königs, an den Josef geriet, der Lieblingssohn Jakobs? Waren es nicht Josefs
Brüder, die ihn verkauften, so dass er nach Ägypten verschleppt wurde – aus Neid auf diese
väterliche Bevorzugung? Und weiter fällt mir – den Flyer in Händen haltend – ein, dass die
Ehefrau des königlichen Beamten Potifar Josef angesichts seiner schönen Gestalt verführen
wollte – vergeblich, so dass die Zurückgewiesene an ihm Rache nimmt, ihn gegenüber ihrem
Ehemann der versuchten Vergewaltigung bezichtigt und so ins Gefängnis bringt. Damit bin
ich mitten drin – in alledem, was der Kongresstitel mit den Stichworten Attraktion, Liebe und
Grenzüberschreitung ankündigt.
Zur Vorbereitungsgruppe gehören Christiane Burbach, Paul Geiß, Bernd Paulus, Anke Well
und Jörg Willenbockel. Sie begrüßen die 130 Teilnehmenden für die Zeit von 30. April –
3. Mai 2014 im Haus Villigst, der Tagungsstätte der Evangelischen Kirche von Westfalen, di‐
rekt an der Ruhr im Grünen gelegen. Schon in der Einstimmung wird deutlich spürbar, was
der Flyer ankündigt: jene heftigen Ambivalenzen, die sich zwischen erotischer Anziehung
und lustvoller Lebendigkeit einerseits und Grenzüberschreitungen, Übergriffen und Miss‐
brauch andererseits auftun. Attraktion und Lebensfülle, so formuliert die Vorbereitungs‐
gruppe ausdrücklich, „das wollen wir während der Tage hier nicht vergessen – trotz gesell‐
schaftlicher Vorgänge“, und dies gleich im doppelten Sinn: gesellschaftlich sowohl im Sinne
der Auseinandersetzung mit sexueller Gewalt an den Tatorten Elternhaus, Schulhaus und
Pfarrhaus, die im Jahr 2010 massiver als je zuvor einsetzte, als auch im Sinne der Gesellschaft
für Pastoralpsychologie, die Täter und Täterinnen nicht nur jenseits ihrer Grenzen wahr‐
nimmt.
Eine dunkle Begierde
Das Lernen des Umgangs mit dem allgegenwärtigen Eros rückt ins Zentrum unserer Auf‐
merksamkeit, zum Kongresstitel gehören auch Amor und Psyche: Amor, Sohn der Aphrodite,
und Psyche, die wegen ihrer Schönheit den Neid der Aphrodite weckt; dennoch besucht
Amor Psyche des Nachts, er heiratet sie, und ihr Kind heißt Voluptas, die Wollust. Dieses
Happy End ereignet sich unter den mythologischen Gestalten, leider nicht immer auf unserer
Erde. „Eine dunkle Begierde“ zeigt – ausschnittweise zu Beginn des Kongresses – der gleich‐
namige Film um Carl Gustav Jung und seine Analysandin Sabina Spielrein. Mit diesen Eindrü‐
cken machen wir uns jeweils mit einer vertrauten Person zu einem Paarspaziergang auf, be‐
vor wir uns zu einem World Café versammeln – nicht nur für mich ein gelungener Einstieg in
geschützten Räumen und Begegnungen.„Gesetzt, es nähme einer mich plötzlich ans Herz“
Diese Worte stammen von Rainer Maria Rilke und läuten den ersten Abend ein, der sich der
Ambivalenz von Sehnsucht und Perversion in kirchlichen Rollen und Organisationen widmet
– im Rahmen eines Vortrags, den Martin Weimer hält, Pastoralpsychologe und Lehrsupervi‐
sor (DGfP) sowie ehemaliger Leiter des Beratungszentrums Kiel.
Martin Weimer versetzt sein aufmerksames Publikum für eine Weile in die Welt der Psycho‐
analyse, um der Matrix sexueller Gewalt in kirchlichen Organisationen auf die Spur zu kom‐
men. Gruppenanalytisch fasst er als Matrix ein Kommunikations‐ und Beziehungsgewebe;
Szenen sexueller Gewalt lassen sich daher nicht allein denen zuschreiben, die als die Bösen
die Anderen oder als die Anderen die Bösen sind. Vielmehr stellt sich die Frage, „welche Tä‐
teraspekte und welche Opferaspekte wir alle projektiv in der jeweiligen Missbrauchsszene
unterbringen“, unbewusst jedenfalls. Und auch wenn ich unter den Hörenden nicht zu den
vorwiegend analytisch Geschulten gehöre, so kommt mir unter umgekehrtem Vorzeichen
meine Überzeugung in den Sinn, dass auch im Heil keine und keiner allein bleibt, jeder jeden
trägt, jede für jede verantwortlich ist und alle füreinander im Heil bedeutsam sind. Und im
Unheil auch.
Ein Triebgespräch
Alle verdanken wir unsere nackte Existenz einer Paarbildung, alle sind wir ein „Triebge‐
spräch“ (Norbert Elias), und Martin Weimer nimmt zugleich einen Impuls Joachim Scharfen‐
bergs auf, wenn er dem Zueinander von Religion und Perversion nachgeht – mit der These,
dass Kirche heute sich als Organisation perverser Paarbildung verstehen lasse: „… das per‐
verse innere Paar Anbieter – Kunde bildet die unbewusste Repräsentanz in der Matrix kirch‐
licher Organisationen“. Ich fremdle mit dieser These, bis einige Bilder diese zu erschließen
helfen, Bilder, die Martin Weimer wiederum paarweise zeichnet: einerseits von Polizisten,
die Befehle entgegennehmen und Grenzen sichern, auch wenn jeder neue Befehl, den sie
befolgen, ihrem Leib einen weiteren Stachel zufügt (Elias Canetti), und andererseits von
Grenzverletzungen, die auf Grenzverletzungen folgen (Gen 11); einerseits von Figuren erfro‐
rener oder abgetöteter Trauer und einer toten Mutter (Kirche) und andererseits – „Gesetzt,
es nähme einer mich plötzlich ans Herz“ – von Traumaopfern und der Erfahrung des Trostes.
Der bundesdeutsche Nachkriegsmohr
Wilfred Bion kennt Grundannahmen, gleichsam den emotionalen Kitt, der Gruppen zusam‐
menhält, und führt deren drei an: erstens die Abhängigkeit (dependency), auch Wünsche
nach Trost und Halt; zweitens Kampf, etwa um Grenzen wie bei den schon genannten Poli‐
zisten, und Flucht als die beiden Möglichkeiten des Gruppenerhalts (fight – flight); drittens
die Paarbildung (pairing). Während Kirchen in industriellen Gesellschaften Organisationen
von Abhängigkeit bilden, etwa wenn wir Gott für unsere Arbeit danken, anstatt auf uns sel‐
ber stolz zu sein, prägen uns in postindustriellen Zeiten andere unbewusste Gruppendyna‐
miken: eingefrorene und unbetrauerte, also traumatische Verlusterlebnisse. Ein jedes zieht
sich auf eine einsame Insel zurück, hält von anderen Abstand und vor allem den Kopf über
Wasser – ohne zu merken, dass die Inseln unter Wasser miteinander verbunden sind. In die‐
ser Isolierung (Earl Hopper) können Menschen ihr Bedürfnis nach Trost keiner Gruppe mehranvertrauen, es bleibt das versteinerte Gesicht – einer toten Mutter Kirche, erstarrt in
ungelebter Trauer über ihren verlorenen Glauben und mit vielen Stacheln im Leib, die auf
Befehle aus der Kriegszeit verweisen, der diejenigen zum Opfer fielen, die als Feinde ausge‐
macht waren, aber auch die Nächsten.
Es bleiben Kirchentage „als manisches Samenkorn, das im Rausch verglüht“, die Trauer aber
bleibt aus, vor ihr „bewahrte der im katholisch‐evangelischen Duopol abgesicherte Gegen‐
glaube im restaurativen Adenauer‐Deutschland“. Auch er tritt als Paar auf – und hat mit dem
Sterben der Täter‐ und Opfergenerationen „als bundesdeutscher Nachkriegsmohr“, so Mar‐
tin Weimer, seine Schuldigkeit getan.
Kunde und Anbieter – und Glaubensverlust
Der ungetröstete Verlust eines Glaubens kommt einem Trauma gleich, und die Paarbezie‐
hung, die alles beieinander halten soll, wehrt die Trauer ab. Sie entgleitet ins Unfruchtbare:
Pairing geschieht im Bild von Kunde und Anbieter, ökonomisiert alles Soziale und Religiöse,
berechnet das Humanum und vernichtet die Zeit und ihren wiegenden Rhythmus, ihre Diffe‐
renzen, auch das Heterogene, das Verletzliche und das Sakrale, das souveräne Nicht‐Handeln
(Georges Bataille), das einen Unterschied macht – gegenüber Zweckrationalem und Zielfüh‐
rendem. Wem nur grenzenloses Selbstmanagement bleibt und wer dieses 24 Stunden am
Tag betreibt, der vernichtet die Zeit – und brennt aus. Grenzen fallen, Menschen verhalten
sich missbräuchlich, auch sexuell. In zahllosen „Einzelfällen“ schreit gesellschaftlich Verges‐
senes um Hilfe. Make love, not war, hieß es einmal, aber liebe ich mein Gegenüber – oder
investiere ich in ein Paarprojekt?
Martin Weimer plädiert für Differenztoleranz. Abhängigkeitssehnsüchte finden beim Paar
Kunde – Anbieter keinen Platz mehr, sie sind (wie) gelähmt. Die Rede von Auferstehung am
offenen Grab „gleitet hinüber zur pervers mauschelnden Missrepräsentation von Wirklich‐
keit“, wenn sie Trauerabwehr begünstigt. Eine manisch‐fusionäre Matrix anerkennt Differen‐
zen innerhalb einer Gruppe und leugnet sie zugleich: „Komm Herr, segne uns, dass wir uns
nie trennen“, und es kommt zu einer funktionalen Reduktion des Zwischenmenschlichen,
„die Drohung mit dem Tod macht uns gefügig“.
Jenseits struktureller Perversion
Und jenseits dieser strukturellen Perversion? Hier deutet sich eine rêverie‐Kirche an, eine
Haltung, die aufblitzt, wenn eine keusche Telefonseelsorgerin den jugendlichen nächtlichen
Anrufer hört, wie er ins Telefon fragt: „Wie macht man das, Onanieren?“, und ihm spontan
rückmeldet: „Mein Junge, da hilft nur eins: üben, üben, üben!“ Zur Sprache kommt hier die
Haltung einer grenzschützenden Bejahung, einer Bejahung als Ersatz der Vereinung, als
Strukturmerkmal eines kreativen Paares, das Raum frei gäbe für Andere, nicht zielführend,
aber fundamental wirksam; nicht zielführend wie eine funktionierende Kirche, die nicht trös‐
ten kann, aber wirksam wie in der Schöpfungsgeschichte, in der Gott sich (in uns) als Paar
spiegelt – und ich denke an theologische Diskussionen, die nicht nur um eine creatio ex
nihilo kreisen, sondern nach einer creatio ex amore fragen.
Da mag der oder die Alleinerziehende sein – in nachvollziehbarer Sorge um das eigene Kind,
das sich leicht fürsorglich belagert fühlt, und da mögen jene Kinder sein, deren Eltern sich
paaren, so dass den Kindern Zeit bleibt, um ungehindert zu spielen – oder gar in der Nase zupulen. Und unsere Kirchen? Räume Träumender, die unter Wasser wie Inseln miteinander
verbunden sind, wie wir mit den Opfern und den Tätern sexueller Gewalt in unseren Kirchen
verbunden sind?
DGfP – oder TGfP?
Die Diskussion setzt tastend ein – mit etlichen Fragen: Geht es Martin Weimer wohl darum,
mehr als bisher zu trauern über all das, was kaputt gegangen ist an Leben und Glauben? Und
können Trauernde gleichzeitig lieben? Überhaupt: wie können wir sinnvoll leben? Wie genau
verhalten sich das Bild des kreativen Paares und die Kirche(n) zueinander?
Kreativität kommt allemal extra nos, da ist nichts zu „machen“. Martin Weimer erscheint es
als „Wahn“ zu glauben, es gebe keine Differenzen, etwa zwischen Ost und West. Auch wenn
zusammenwächst, was zusammengehört, dann war und ist da zunächst eine Differenz. Und
es bleibt die Frage: Was gibt es zu betrauern, vielleicht auch öffentlich?
Diese tastenden Bewegungen setzen sich in meiner sektionellen Homegroup fort. Mit ver‐
einten Kräften setzen wir Mosaiksteine zusammen, ohne dass uns ein ganzes Bild entstünde,
das uns Orientierung verschaffen könnte. Aber vielleicht liegt genau darin die Herausforde‐
rung, eben nicht auf ein Gesamtbild zu drängen, das Differenzen zu schnell oder überhaupt
unbefugt einebnen könnte? Offen bleibt auch die Frage nach dem „Sinn“ von Missbrauch,
wenn Gewaltszenen in einer Matrix und aus einer solchen heraus gelesen und in ihrem
„Sinn“ erschlossen werden wollen. Traueraufgaben nehmen im Gespräch viel Raum ein,
Schweres macht sich breit, und Stunde für Stunde wird mir an diesem Abend – bis tief in die
Nacht – deutlicher, wie eng Mosaiksteine und Ideen, die wir aufnehmen, miteinander ver‐
woben sind – eben wie Inseln, die zunächst vereinzelt auftauchen und nicht zusammenge‐
schoben werden dürfen.
Der steile analytische Einstieg in die Vortragsreihe unseres Kongresses lässt die Abkürzung
„TGfP“ kursieren, die einen Wandel von der Deutschen zur Tiefenpsychologischen Gesell‐
schaft für Pastoralpsychologie markiert. Eine Nachlese des Vortrags empfiehlt sich gewiss,
und viele von denen, die nicht zur Sektion T gehören, tappen nach eigenem Bekunden ohne
klare Ausrichtung in der Welt umher, die sich mit dem Vortrag auftat; doch in jedem Fall
bewegen sie sich, nicht auf Befehl mit einem Stachel im Leib, aber doch angestachelt durch
die Ideen und die Sprache des Vortragenden. Schließlich rührt mich auch die Empathie einer
Kollegin, die mich nicht beneidet um „die Aufgabe, das Gehörte zusammenzufassen“ – und
mich zugleich bei meinem Versuch beflügelt!
„Wo die Liebe wohnt, blüht das Leben auf …“
Innocentia Pieters und Annette Marzinzik‐Boness tragen mit ihren Morgenandachten dazu
bei, dass das Tagungspendel zwischen lebensfroher Lust und Leben zerstörendem Miss‐
brauch nicht nur zur gewaltsamen Seite hin ausschlägt: „Welch hohe Lust, welch heller
Schein wird wohl in Christi Garten sein!“
Tagsüber bleiben mir Morgenlieder im Ohr und besungene Bilder vor Augen, und auch die in
der Kapelle vorgebrachte Bitte um eine wertschätzende Haltung untereinander soll in Erfül‐
lung gehen.Sexuelle Grenzverletzungen im professionellen Kontext
Monika Holzbecher, selbständige Psychotherapeutin in Essen und Sprecherin des Ausschus‐
ses für ethische Angelegenheiten und Beschwerden in der Gesellschaft für personzentrierte
Psychotherapie und Beratung, macht sexuelle Grenzverletzungen in ihrer breiten Palette
anschaulich. Ihr geht es in ihrem Vortrag nicht allein um sexuellen Missbrauch, dem Kinder
zum Opfer fallen, sondern auch darum, dass jede dritte Frau, befragt nach dem Zeitraum ab
ihrem 15. Lebensjahr, von körperlicher und sexueller Belästigung berichtet. Monika Holzbe‐
cher spricht vorrangig von männlichen Tätern und weiblichen Opfern, von gleichgeschlechtli‐
chen Übergriffen vor allem unter Männern.
Eine breite und facettenreiche Palette sexueller Grenzverletzungen setzt bei scheinbar harm‐
losen Gesten und scheinbar zufälligen Berührungen ein, bei anzüglichen Witzen, taxierenden
und „ausziehenden“ Blicken, also bei Handlungen, die offenbar nicht alle Frauen als belästi‐
gend empfinden. Als nicht mehr ignorierbar und eindeutig grenzverletzend erfahren Frauen
hingegen unerwünschte anzügliche Bemerkungen, Berührungen an intimen Körperzonen,
die Äußerung sexueller Wünsche und die Konfrontation mit sexuellen Inhalten, etwa durch
Mails. Zu berufstypischen Grenzverletzungen zählen Details aus dem Intimleben der Profes‐
sionellen, voyeuristisches Interesse, Liebesbriefe und Telefongespräche, private Verabre‐
dungen, getarnte körperliche Annäherung, Wertungen (wenn etwa Elektroschocks einge‐
setzt wurden, um Homosexualität auszutreiben) und Diskriminierungen. Kommt es zum se‐
xuellen Kontakt, leitet der Täter aus seiner Wahrnehmung – „sie hat sich nicht gewehrt“ –
gern ein beidseitiges Einverständnis mit der Affäre oder gar ein Eigeninteresse des Opfers
ab. Suchtstrukturen zeichnen sich ab, wenn ein Täter das Gefühl der Macht über sein Opfer
als Reiz erlebt und die Angst des Opfers gar sexuell stimulierend wirkt.
Feuerwehr und Brandschutz
Dabei geht es nicht nur um Feuerwehr, sondern um Brandschutz, um Prävention, insbeson‐
dere durch die Verankerung der damit zusammenhängenden Fragen in der Ausbildung, um
vor allem unter Berufsanfängern verbreiteten niederschwelligen Grenzverletzungen vorzu‐
beugen und für die Macht des Wortes zu sensibilisieren, wenn eine Autorität die Äußerung
elterlicher Übergriffe als schmutzige Phantasie des Kindes abtut und ihm empfiehlt, Vater
und Mutter zu ehren. Dieser fatale Mechanismus der Schuldzuweisung macht Opfer (erneut)
mundtot.
Um die Relationen der Geschlechter auszumalen, zitiert Monika Holzbecher einen Dozenten,
der eine Studentin nach ihrem Vortrag auffordert, an der Tafel zu verbleiben: „… so ein
schöner Anblick“. Würde eine Lehrerin so über einen Schüler sprechen? Eine Würdigung der
studentischen Leistung entfällt, stattdessen heften sich die Blicke der Gruppe an den Körper
der Studentin. Und wenn sie sich zur Wehr setzt, riskiert sie, als empfindlich, humorlos, lust‐
feindlich und verklemmt zu gelten: „Eine andere hätte sich gefreut! Überlegen Sie doch mal,
ob das Problem nicht auf Ihrer Seite liegt.“ Solche Machtdemonstration wiederholt die Er‐
niedrigung, die der Schülerin schon angetan wurde, die es als Schwäche empfinden würde,
sich verletzt zu zeigen, nicht für sich eintreten kann und Dritte braucht, die das Unrecht, das
ihr widerfuhr, beim Namen nennen.Machtgefälle unter Erwachsenen
Auch professionelle Beratung unter Erwachsenen darf nicht über das Machtgefälle hinweg‐
täuschen, wie es zwischen einem idealisierten Experten und seiner Klientin oder seiner Aus‐
bildungskandidatin auftritt. Mangels Empathie bleibt es unerkannt, so dass der Täter seinem
Gegenüber dessen Einverständnis mit dieser sogenannten Liebesbeziehung unterstellt. Kind‐
liche Opfer übernehmen Gefühle, die eigentlich dem Täter gelten, entwickeln etwa einen
Waschzwang, um den Ekel, der sich gegen den Täter richtet, abzuwaschen. Konzepte zum
Umgang mit Konflikten in professionellen Zusammenhängen müssen weiterentwickelt wer‐
den – auch auf dem Wege der Mediation, auf dem ein Therapeut als Täter den Schaden an‐
erkennt, den er angerichtet hat, die damit verbundene Schuld eingesteht und eine Folgethe‐
rapie finanziert.
Monika Holzbecher bringt auch Drastisches unaufgeregt vor, sie trägt zu einer rezeptions‐
freundlichen Atmosphäre und zur Diskussionsfreude bei: Männer als Opfer? Auch wenn die
Referentin auf Stalking und die Trophäenjagd anspielt, die junge Frauen mit dem Ziel unter‐
nehmen, den begehrten Mann, Pfarrer oder Lehrer „rumzukriegen“, erscheint vielen Kolle‐
ginnen und Kollegen die Auseinandersetzung mit Missbrauch, der Jungen und Männern an‐
getan wird, nach wie vor als Tabu. Männliche Opfer, so führt sie aus, müssen stark sein, sie
spalten Missbrauchserfahrungen ab und bleiben daher unsensibel, und als Täter sind sie
nicht die bösen Fremden, die sich hinterm Busch verstecken, sondern im nächsten Umfeld
ihrer Opfer präsent.
Mit Sex an die Macht – oder mit Macht zum Sex?
Geht es bei Grenzverletzungen vorrangig um Macht, deren Ausübung sich der Sexualität als
Instrument bedient, wie Monika Holzbecher betont, oder wird Macht eingesetzt, um Sex zu
bekommen?
Welche Rolle spielen in diesem Zusammenhang das Motiv der Jungfrauengeburt, das Bild
der Gottesmutter und eine marianisch geprägte Spiritualität? Angesichts dieser Frage muss
ich an einen Täter denken, dessen Frauenbild klar zweigeteilt ist: auf der einen Seite jene
Frauen, die engelsgleich erscheinen, ihn an die Gottesmutter und an seine eigene Mutter
denken lassen, und auf der anderen Seite jene Frauen, „Flittchen“, die sowieso „verdorben“
sind und „sich mit jedem einlassen“.
Wie mit gemischten Gefühlen umgehen, die bei Fragen des Schadensersatzes und des
Schmerzensgeldes entstehen? Einerseits soll dem Täter „auch was weh tun“ – vielleicht nicht
im Sinne eines seelischen, aber doch eines empfindlichen finanziellen Schadens –, anderer‐
seits riecht Geld nach Prostitution und kann neue Abhängigkeiten schaffen.
Ein Kachelmanneffekt?
Lässt sich ein Kachelmanneffekt ausmachen, also ein Zurückgehen von Anzeigen, bei denen
ich als Frau womöglich nicht Recht bekomme? Monika Holzbecher bringt in der Diskussion
ihre Überzeugung zum Ausdruck, dass Frauen Männern nur in Einzelfällen unberechtigter‐
weise Fehlverhalten anhängen. Stattdessen verweist sie auf ein massives Hindernis, Grenz‐
verletzungen in der Kirche zur Anzeige zu bringen, wenn dafür keine unabhängigen Anlauf‐stellen eingerichtet wurden, sondern Kirchenmänner als Ansprechpersonen benannt wur‐
den, die sich in genau jenen Strukturen bewegen, die sexuelle Gewalt begünstigt haben.
Und wie lässt sich der Schutz von Ausbildungskandidatinnen in Psychotherapie und Seelsor‐
ge verbessern?
Variationen zu Potifar
Nun geht es um Potifar, an den ich schon vor dem Kongress dachte, „exegetisch nicht rein,
aber ziemlich fein“, wie Bernd Paulus ankündigt. In dieser biblisch inspirierten Szene kommt
ein Mann als Opfer ins Spiel, Josef, einst Papa Jakobs Liebling und schön wie seine Mutter
Rachel, mit narzisstischen Zügen: „Ich bin ein Geliebter und ein Gewaltopfer zugleich.“ –
„Nicht nur mein Vater mochte mich, auch Gott.“ – „Eigentlich bin ich glücklich …, aber ihr
merkt, ich rede noch immer nicht.“ Er kennt Abgründe und kann darum Verantwortung
übernehmen. Als Junge will er Potifar gefallen, als Mann geht er nicht auf die Verführung
durch die Frau seines Herrn ein. Doch sie verwirrt ihn, er bringt verschiedene Strebungen
vor: „Ich bin ja noch jünglich, da bleib ich Opfer“, ist das eine, „Josef, du hättest sie nehmen
sollen“, das andere. Entkommt man(n) nur mit standhafter Männlichkeit? Sein väterliches
Vorbild Jakob, der alternde Jüngling, hilft ihm nicht.
Potifars Frau, gekränkt, behauptet, Josef habe seinen Mutwillen mit ihr treiben wollen. Als
sie sich gegen ihn zur Wehr gesetzt haben will, lässt er sein Gewand bei ihr und flieht, wie sie
behauptet. Die musikalische Rahmung durch Rosenstolz unterstreicht ihr Begehren: „… ich
will dich ohne Mantel“.
Josef kommt ins Gefängnis, „aber der Herr ließ ihn Gnade finden“, auch Potifars Frau wird
nicht beschädigt – auf diesem schmalen Grat zwischen nacktem Begehren und Gewalt, Sex
und Aggression. Hier blitzt lebendig auf, was jene grenzschützende Bejahung umfasst, die
mich schon am Vorabend berührte – „anerkennend, was los ist, und anerkennend, was sein
soll“.
Mit Bravour gelingen Anke Well, Pastorin und Pastoralpsychologin, und Bernd Paulus, Religi‐
onspädagoge, Supervisor (DGfP) und Psychodramaleiter, Schritte auf einem ebenfalls schma‐
len Grat, zu dessen Begehung das Kongressprogramm herausfordert – zwischen erotischer
Anziehung, die nicht immer Grenzen kennt, und Grenzverletzungen. Der starke Applaus
zeigt, wie spürbare Lust und hintergründiger Humor, seinerseits „ziemlich fein“, nicht nur die
beiden verbinden, die die Variationen zu Potifar in Szene setzen, sondern auch das Publikum
erfassen.
Intersektionelle Gruppen
Zwischen den Plenarsitzungen kommen die Teilnehmenden in intersektionellen Gruppen
zusammen, um sich folgenden Fragen zu stellen: Welche Resonanz finden das Vorgetragene
und das Diskutierte? Entsteht dabei eher Zustimmung – oder eher ein Dissens? Werden Kon‐
sense und Dissense zwischen den Sektionen spürbar und erkennbar? Welche Ideen resultie‐
ren daraus, welche Konsequenzen lassen sich ziehen – während des Kongresses, in der DGfP
und darüber hinaus?
Es folgen zwei Vorträge zu Grenzüberschreitungen, zunächst aus der Opfer‐, dann aus der
Täterperspektive.Jenseits der Grenze:
Grenzüberschreitungen aus der Opferperspektive
Christiane Burbach, Professorin an der Fachhochschule Hannover und Lehrsupervisorin
(DGfP), wird als „eher evangelisch“ vorgestellt, sie dankt für die ökumenische Begrüßung
und macht Grenzüberschreitungen aus der Opferperspektive zum Thema.
Ein Drama, das ein Lustspiel werden sollte
Sie skizziert ein Fallbeispiel – und den Wunsch einer Analysandin, umarmt zu werden. Als der
Analytiker diesem Wunsch nachkommt, erstarrt sie, entwickelt Angst vor Kontrollverlust und
das Gefühl von Verbotenem. Aber der Analytiker nimmt diese Erstarrung nicht wahr und will
seinerseits umarmt werden – ein Drama, das ein Lustspiel werden sollte, nimmt seinen Lauf.
Therapie als Verführung, als Werbung fürs Leben? Seelsorge als Verführung?
Missbrauch in professionellen Beziehungen
Sexueller Missbrauch in professionellen Abhängigkeitsverhältnissen, etwa zwischen Seelsor‐
ger und Gemeindemitglied oder zwischen Ausbilder und Ausbildungskandidatin, kann auch
dann, wenn er unter Erwachsenen geschieht, nicht darüber hinweg täuschen, dass die Zu‐
ständigkeit für Grenzüberschreitungen und ihre Verhinderung allemal beim Professionellen
liegt. Er darf sich das Wissen, das ihm anvertraut wird, nicht zunutze machen. Es bleibt eine
Asymmetrie des Beziehungsraums: auf der einen Seite die absolute Abstinenz des Professio‐
nellen, die auch über die Arbeitsbeziehung hinaus Bestand hat – nach Monika Holzbecher
fünf Jahre, vielleicht aber auch lebenslang –, und auf der anderen Seite das „Affidamento“,
das Sich‐anvertrauen der Seelsorgesuchenden.
Erweist sich der Weg zur Grenzüberschreitung, zum Vertrauensmissbrauch (Werner Tschan)
als ein schleichender Prozess, der sich unterwegs noch stoppen lässt, oder steckt ein mani‐
pulativer Plan dahinter, von langer Hand ausgeführt?
Grenzüberschreitungen im professionellen Kontext – wer fällt ihnen zum Opfer?
Ein zweites Fallbeispiel erzählt von Ursula. Ihr Therapeut wird zum ersten Mann, bei dem sie
sich angenommen fühlt. Sie verliebt sich in ihn, er seinerseits fühlt sich zugleich in einer se‐
xuell unerfüllten Ehebeziehung gefangen. Die außereheliche Beziehung zwischen dem The‐
rapeuten und seiner Patientin entsteht innerhalb und außerhalb der Psychotherapie und
währt nun schon zwanzig Jahre.
Christiane Burbach macht – entgegen einem verbreiteten Vorurteil – darauf aufmerksam,
dass Menschen mit Missbrauch in ihrer Biographie nicht häufiger zu Opfern sexueller Grenz‐
überschreitungen werden als Menschen mit „Normalbiographie“. Vielmehr wirkt eine nar‐
zisstische Bedürftigkeit (Mathias Hirsch) als Einfallstor für sexuelle Grenzüberschreitungen.
Ursulas Defizite im Anerkanntsein führen zur Verwechslung dessen, was sie braucht, mit
dem, was sie bekommt. Denn Ursula wird benutzt und degradiert, es kommt zur Verwechs‐
lung von sexuellem Interesse und Interesse an ihrer Person, die Wertschätzung erneut
schmerzlich vermisst.Wer wird zum Täter?
Hier kommt dem narzisstischen Charakter auch des Täters, seinem Machtbedürfnis eine
Schlüsselrolle zu. Als zuverlässigster Prädiktor gilt der Umstand, dass ein Seelsorger bereits
in früheren professionellen Beziehungen sexuelle Kontakte eingegangen ist. Im genannten
Fallbeispiel lassen Ursula und ihr „Begleiter“ ihre Rollen nicht nur hinter sich, es kommt so‐
gar zu deren Umkehrung, indem Ursula zur Eheberaterin ihres Therapeuten wird.
In diesen Zusammenhang gehört auch das Pygmalionsyndrom, demzufolge sich der Bildhau‐
er Pygmalion in der griechischen Mythologie seine schöne Galatea meißelt – und demzufolge
sich ein alternder Therapeut mit einer jungen bildsamen Klientin umgibt und eine grandiose
Problembewältigung betreibt, die ihn sein Alter leugnen lässt.
Folgen von Grenzüberschreitung
Pervertierte Ordnungen entstehen: Da ist eine Klientin, die dank ihrer weiblichen Sozialisati‐
on Gefährdungspotentiale mitbringt, die eine Mutation des Supervisors zum Elternersatz
begünstigen, und da ist ein Supervisor mit eigenen Bedürftigkeiten, die die Klientin in die
Mutterrolle drängen. Der potentielle therapeutische Raum, der sich in einer Arbeitsbezie‐
hung auftut, wird zerstört, eine Süchtigkeit nach Körperkontakt und eine unheilvolle Liebe
(Marga Löwer‐Hirsch) nehmen den ganzen Raum ein.
Beim Opfer kommt es zum Vertrauensverlust in jeder Beziehung, schließlich zu einer (Re‐)
Traumatisierung, die mit einem emotionalen Schockerlebnis einsetzt und zu sekundärer
Viktimisierung durch Institutionen führt (blaming the victim), bis im Zuge einer tertiären
Viktimisierung die Übernahme einer Opferidentität erfolgt. Das Opfer hegt Rachegedanken
und ‐pläne, setzt auf die Macht der Auserwählten, leidet aber zugleich heftig unter der
Ohnmacht der Ausgelieferten, das Suizidrisiko wächst.
Beim Täter liegt die Verantwortung für seinen Kunstfehler, die standesethische Verantwor‐
tung. Eine Verurteilung sexueller Handlungen unter Missbrauch eines Beratungs‐, Behand‐
lungs‐ oder Betreuungsverhältnisses nach §174c StGB kann zu Freiheitsstrafen von drei Mo‐
naten bis zu fünf Jahren führen und die medizinische und therapeutische Existenz kosten.
Auch der Versuch ist strafbar. Aber – so fragt die Vorsitzende der Standeskommission der
DGfP nicht ohne Grund – was gilt in Seelsorge und Supervision?
Konsequenzen der Missbrauchserfahrung
Drei Phasen lassen sich identifizieren: (1) eine Annäherung an die Auserwählte und ihre
Zweifel, (2) eine manifeste Phase von Heimlichtuerei um die verbotene Liebe, (3) eine Phase
der Einsicht in die Unwürdigkeit dieser Affäre, die zum Abbruch der Missbrauchsbeziehung
führen kann, aber auch zu ihrer (allemal schweren) Aufarbeitung – oder gar zur Heirat. Bei
Ursula aber unterbleibt die dritte Phase gänzlich, stattdessen chronifiziert sich die verbotene
Liebe.Priesterliche Täter als Henker ihres Herrn
Kirche – was für ein Verein? Diese Frage entsteht in der Diskussion, viele andere kommen
hinzu: Was folgt aus missbrauchtem Vertrauen für den Glauben? Inwiefern erweist er sich
als Ressource, inwiefern fällt auch er dem Missbrauch zum Opfer?
Mit anderen Katholikinnen und Katholiken meine ich: Einem Priester und einem Pater
kommt eine Vaterrolle zu, die der Ausübung sexueller Gewalt eine stark inzestuöse Note
verleiht. Wer einem Priester zum Opfer fällt, dem bleiben oft keine Vertrauensbeziehungen
mehr, nicht einmal die Gottesbeziehung, denn diese ist mit dem Täter, dem „Gottesmann“
verwoben. Das ohnehin Verbrecherische spitzt sich zu, wenn priesterliche Täter in persona
Christi Capitis handeln, also in der Person Christi des Hauptes, wie es im katholischen Kir‐
chenrecht (CIC can. 1009 §3) heißt. Denn wenn der Gekreuzigte und Auferstandene sich mit
allen Opfern solidarisiert hat, dann müssen sich die für diese Verbrechen Verantwortlichen
auch vorhalten lassen, dass sie sich mit dem Seelenmord, den sie verübt haben, zu Henkern
ihres Herrn gemacht haben.
Jenseits der Grenze:
Grenzüberschreitungen aus der Täterperspektive
Im Priesterseminar der Diözese Rottenburg‐Stuttgart arbeitet Joachim Schlör, Pastoralpsy‐
chologe und Supervisor (DGfP). Er bringt aber auch langjährige Erfahrungen mit Verhaltens‐
originellen mit und erinnert einleitend an einen 16jährigen: Der sexuelle Übergriff, den er an
jener Einrichtung verübte, die ihn zunächst beherbergte, wurde sowohl von dieser als auch
vom Jugendamt verschwiegen, so dass die aufnehmende Einrichtung, in der sexuelle Über‐
griffe als Ausschlusskriterium gelten, vor der Frage stand: wohin mit ihm?
Täterarbeit ist Opferschutz!
Täterarbeit ist Opferschutz – mit dieser Einsicht verwahrt sich Joachim Schlör gegen das blo‐
ße Verwahren von Tätern. Dabei umfasst sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendli‐
chen jeden versuchten oder vollendeten sexuellen Akt und Kontakt von Bezugspersonen mit
Heranwachsenden, aber auch sexuelle Handlungen ohne direkten Körperkontakt. Doch be‐
vor der Vortragende die Täterperspektive ins Zentrum seiner Ausführungen rückt, konfron‐
tiert er die Zuhörenden mit zwei Fragen zum Tatort Kirche: Für wie zustimmungsfähig halte
ich meine Klientinnen in der Seelsorge? Was passiert in mir, wenn der Gesetzgeber sagen
würde, sie seien nicht zustimmungsfähig?
In der Psychotherapie geben 10% der männlichen und 3% der weiblichen Professionellen
sexuelle Kontakte zu Klientinnen und Klienten zu.
Wissen über Täter und ihre Deliktkreisläufe
Was motiviert Täter zum sexuellen Missbrauch, wie überwinden sie innere und äußere
Hemmschwellen, wie den Widerstand ihres Opfers (David Finkelhor)? Zur Strategie der Tä‐
ter, zum Deliktkreislauf gehört das double face des Täters, der zugewandt und gewaltsam
zugleich wirkt: „Das hätte ich ihm nicht zugetraut“, „er versteht uns doch am besten“, undals Täter registriert er das „Bitte nicht!“ des bedrohten Opfers, das er nicht abspaltet; viel‐
mehr dient das eine (zugewandte) Gesicht dem anderen (gewaltsamen): Täter wissen, was
sie tun. Ihr geringes Selbstwertgefühl schürt die Angst vor Zurückweisung und Schwäche und
begünstigt einen Rückzug. Aber ihr Streben nach Macht und Kontrolle – durch einen Liebes‐
trank, Pfeile des Amor und Aphrodisiaka – setzt kompensatorische Phantasien und die Suche
nach Zielen frei: Mit wem wäre es möglich, für wen reichen die Mittel? Während Monika
Holzbecher auf Empathiedefizite abhebt, verweist Joachim Schlör auf eine Täterempathie –
gegenüber demjenigen oder derjenigen, der oder die am ehesten schweigt. Es folgt das
Grooming, also das Pflegen, Verwöhnen, Ruhigstellen des potentiellen Opfers, auch Versu‐
che, ihm zu schmeicheln. Mit dem Akt des Missbrauchs gehen schließlich Schuldgefühle ein‐
her, jedenfalls vorübergehend, zugleich entstehen kognitive Verzerrungen: „Es schadet
nicht“, „sie hat nicht nein gesagt“. Daraufhin wird der Deliktkreislauf womöglich enger, so
dass erneut kompensatorische Phantasien und die Suche nach Zielen einsetzen, oder es
kommt zum Vorsatz „Ich tue es nie wieder“, der wiederum das ohnehin schon geringe
Selbstwertgefühl drückt …
Spaltungstendenzen – bei Tätern und in Institutionen
Zur vielfach angefragten Opferthematik in Täterbiographien bemerkt Joachim Schlör: Der
Täter war oft ein Opfer, aber kaum ein Opfer wird zum Täter! Auch greift er die während des
Kongresses schon entfachte Diskussion darum auf, ob es um sexuelle Gewalt oder vielmehr
um sexuelle Gewalt gehe, um Sex oder Macht. In jedem Fall bleibt der Umgang mit der Spal‐
tungstendenz von Tätern, denen das genannte double face eigen ist, schwierig, denn dieses
bildet sich in Institutionen und Menschen ab: Je nach DGfP‐Sektion, zugehöriger Sprache und
psychologischer Provenienz spiegelt sich diese Struktur empathisch, überträgt sie sich auf
Kolleginnen und Kollegen und deren Institutionen, agiert sie in der Gruppe, spielt sie etwas
vor oder inszeniert sie ein äußeres Drama, dem sie selbst zuschaut.
Die Vorträge zur Opfer‐ und zur Täterperspektive regen die Diskussion an: Müssen wir uns
erneut mit Narzissmus befassen – und mit Triebschicksalen? Wie sorgen wir in der DGfP für
Kontrollsupervision? Warum kommen Täter oft so glimpflich davon?
Orientierung schafft der trotz allem nüchterne Blick der beiden Vortragenden – der (eher)
evangelischen Referentin, auch wenn sie es, wie sie ausdrücklich formuliert, sehr deprimie‐
rend findet, dass wir diese Auseinandersetzung führen müssen, und des katholischen Refe‐
renten, der Täterarbeit als Opferschutz fasst und die Verantwortung klar beim Täter belässt.
Baccantisch, erotisch: Szenen aus „Der Komet“
Es folgen wiederum intersektionelle Gruppen, die die Diskussion weiterführen, und am
Abend Szenen aus „Der Komet“ von Justine del Corte: Das Ensemble des freien Theaters Rü‐
Bühne Essen tritt auf – mit einer Hochzeitsgesellschaft, die die Feier auf Wunsch der Braut
nach zehn Jahren zu wiederholen sucht und auf diese Weise Aberwitziges inszeniert – in der
Auseinandersetzung mit Liebe, Sex und Verrat, Leben und Tod.
Am nächsten Morgen erklingt das Halleluja, und es klingt noch lange nach. Mit ihm bleibt die
Haltung der Andacht auch noch unter der Kongressüberschrift „Bilanz und Perspektiven“
erhalten. Hier kommen nochmals zwei Referenten zu Wort.Prävention in Aus‐ und Fortbildung
sowie in der Personalentwicklung
Dieter Wentzek, Direktor des Evangelischen Zentralinstituts für Familienberatung (EZI) Ber‐
lin, ruft die lange, viel zu lange vorherrschende Sorge um das Image von Institutionen und
das Einklagen von Loyalität ihnen gegenüber – auch unter schwer erträglichen Bedingungen
– in Erinnerung, bevor er zu einer Bestandsaufnahme für die evangelische Kirche anhebt. Er
sieht sie derzeit im Übergang von der Skandalisierung zur Versachlichung; professionelle
Angebote für Prävention und Intervention, auch Arbeitshilfen für durch Missbrauch trauma‐
tisierte Kirchengemeinden liegen nunmehr vor. Zudem wirft er einen Blick auf die katholi‐
sche Kirche.
Neben dem Profil des Missbrauchenden sieht Dieter Wentzek den Anteil der Institutionen
am Missbrauch vergleichsweise wenig im Fokus der Aufmerksamkeit. Doch sie begünstigen
Kartelle des Schweigens, bewusst und unbewusst, aufgrund des Wunsches nach Gruppenzu‐
gehörigkeit und der Übertragung eigener Ideale auf Institutionen, an deren Bild festgehalten
werden soll und aus denen niemand ausgeschlossen werden will. Wie also steht es um die
Glaubwürdigkeit unserer Kirche(n)? Gesellt sich zum Amtsbonus für idealisierte Experten des
Heiligen auch ein Amtsmalus?
Übergriffe begünstigen zum einen überstrukturierte Einrichtungen, die von Beziehungskälte
ge(kenn)zeichnet sind, zum anderen aber auch unterstrukturierte Einrichtungen mit bloß
informeller Leitung. So oder so sind Aus‐ und Fortbildung sowie Personalentwicklung massiv
herausgefordert, Unsagbares sagbar zu machen und eine Fehlerkultur zu entwickeln, also ein
Beschwerdemanagement zu entwickeln, das nicht auf Denunziation beruht. Eine Selbstver‐
ständlichkeit ist das in meinen Augen noch lange nicht, denn das Denunziantentum blüht
nach wie vor.
Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung
Stefan Wutzke, Evangelische Kirche Westfalen, Lippische Landeskirche, leitet die Fachstelle
für den Umgang mit Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung (FUVSS). Diese ist zu‐
nächst für drei Jahre eingerichtet – mit einer Zuständigkeit für Kirche und Diakonie und den
drei Aufgaben von Prävention, Intervention und Anerkennung von Leid.
Zur Intervention – mit der Backoffice‐Funktion der Schützenhilfe – gehört die Verdachtsbe‐
arbeitung. Intervention zielt auf den Schutz möglicher Betroffener, auf Aufklärung und Prü‐
fung, auf Hilfe, Ahndung von Fehlverhalten und Nachsorge. Bei einem Vorwurf von oder ei‐
nem Verdacht auf Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung spielt sich der Umgang damit
nicht nur in einem Sanktionsraum, sondern zunächst in einem Reaktionsraum ab, in dem ein
Vorwurf oder ein Verdacht seinen Lauf nimmt: Dazu zählen die Institution, Ansprechstellen,
Medien und Öffentlichkeit, Polizei und Gericht, Aufsichtsbehörden wie Jugendämter und
Schulaufsicht, kirchliche Aufsicht und Beratungsangebote.
Auf Anerkennung von Leid zielen „Genugtuungsleistungen“ bei heute nicht mehr justiziablen
Fällen, vor allem in der Heilerziehung, etwa bei schon toten Tätern.
In der Diskussion kommt die Frage nach dem Umgang mit Verdachtsfällen auf, die aus der
Supervision stammen. Zudem zeigt sich, dass die innerkirchliche Rezeption einschlägiger
Konzepte und Curricula regional offenbar sehr unterschiedlich erfolgt: Hier und da solltenLeuchttürme der Entwicklung auf andere Gegenden abstrahlen, in denen dunkle Begierden
noch im Dunkeln verharren.
Agora
Die Teilnehmenden versammeln sich zum Kongressfeedback. In erster Linie artikulieren sie
ihre Dankbarkeit – gegenüber einem mutigen und kompetenten Vorbereitungsteam, das
sich schon dadurch als höchst couragiert erweist, dass es nicht nur einschlägige Expertinnen
und Experten für den Kongress gewinnt, sondern mehrere eigene Referentinnen und Refe‐
renten stellt, wohlwissend, dass die DGfP mit „eigenen“ Vortragenden einen traditionell kri‐
tischeren, ja harscheren Umgang pflegt als mit Gästen; gegenüber den Gastgeberinnen und
Gastgebern des World Café, die in aller Offenheit ganz einladend für geschützte Räume sorg‐
ten; gegenüber den Moderatorinnen und Moderatoren der intersektionellen Begegnungen,
bei denen psychologische Referenzrahmen aufeinandertreffen, die oft stärkere und greifba‐
rere Unterschiede machen als divergierende konfessionelle Herkünfte; gegenüber den An‐
dachtsgestalterinnen und Theaterleuten, die auf ganz eigene Weise dafür sorgten, dass At‐
traktion, Eros und Liebe trotz der unerlässlichen Auseinandersetzung mit Missbrauch und
vielfältigen Grenzverletzungen – zumal in den eigenen Reihen – nicht gänzlich verloren gin‐
gen.
Auch die Variationen zu Potifar boten nicht nur in meiner Wahrnehmung eine gekonnte Mi‐
schung aus Liebevollem und Anziehendem einerseits sowie Tief‐ und Abgründigem anderer‐
seits; in diesen Szenen war das Tagungspendel wohl von Augenblick zu Augenblick in Bewe‐
gung, im Rückblick aber ausbalanciert.
Manchen kam der Eros trotz alledem zu kurz – vielleicht hätten wir schlicht einen Kongress
zu sexueller Gewalt ankündigen sollen, zumal sich aufgrund eigener Betroffenheit eine mit‐
unter spürbare Schwere über das Plenum legte und ihrerseits Fragen provozierte: Versucht
die DGfP mit dieser Tagung, mit ihrer eigenen Traumatisierung umzugehen? Stehen die Täter
denn alle draußen? Braucht die DGfP als traumatisierte Organisation nicht noch viel mehr
Selbstreflexion? Vermag ein Kongress mehr, als den Deckel des Topfes, in dem Tabuthemen
kochen, ein wenig zu verschieben? Hätten mehr auswärtige Referentinnen und Referenten
es geschafft, mehr Luft in diesen Topf zu bringen?
Die Antwort weiß ich nicht, aber die mitunter aufkommende Schwere hatte für mich nichts
Lähmendes, nichts Erdrückendes, sondern vielmehr etwas Realistisches und Echtes, und so‐
wohl bei Kolleginnen und Kollegen als auch bei mir habe ich viel innere und äußere Bewe‐
gung wahrgenommen – und all dies in einer sehr unaufgeregten und verhaltenen Stimmung,
die für unsere DGfP nicht immer selbstverständlich, aber dem Thema höchst angemessen
war und ist. Martin Weimers Thesen, Monika Holzbechers Grundlegungen, die Szenen mit
Anke Well und Bernd Paulus, die paarweise gestalteten Vorträge von Christiane Burbach und
Joachim Schlör, schließlich von Dieter Wentzek und Stefan Wutzke haben angesichts je eige‐
ner Sprachlosigkeit Sprachfindungsversuche erleichtert, und sie haben das uns Pastoralpsy‐
chologinnen und Pastoralpsychologen eigene Zusammenspiel von Institution und Person und
deren (Selbst‐) Erfahrung begünstigt.
Und selbst wenn die Auseinandersetzung mit Amor und Psyche sich auf Grenzverletzungen
und Missbrauch hin zuspitzte, so lässt sich auch noch nach anderen Gleich‐ oder Ungleich‐
gewichten fragen: Selbst wenn die Zahl der Täter diejenigen der Täterinnen bei weitem
übertrifft, kamen die Täterinnen – jenseits der biblischen Szenerie um Potifars Frau – nichtzu kurz? Und auch wenn weibliche Opfer alle Aufmerksamkeit verdienen, sind männliche
Opfer nicht immer noch schier verschwiegen?
Und waren wir in Gelnhausen nicht manchmal spielerischer unterwegs, auch einmal im Park
auf einer Bank gelegen, während wir heute disziplinierter tagen, obwohl auch das gast‐
freundliche Haus Villigst zu Mußestunden einlädt? Nicht nur mit dieser Frage nehme ich
auch Prozessbeobachtungen anderer Teilnehmender auf, auch einiger Kolleginnen und Kol‐
legen, die nach etlichen Jahren des Pausierens zur Freude vieler zu einem DGfP‐Kongress
zurückfanden. Gleichwohl habe ich diesmal manche und manchen vermisst.
„Gut war’s, ond jetz‘ isch au gut!“
Sitzungen der einzelnen Sektionen, die Mitgliederversammlung und ein Abend mit Musik –
Live: „Still in Progress“ (BluesSoul&Rock) Own productions and coversongs –, Dance und
kulinarischen Genüssen schließen sich an.
Die DGfP lebt vom Engagement zahlreicher Frauen und Männer, auch im Vorstand, aus dem
sich mehrere Kolleginnen und Kollegen nach vielen Jahren verabschiedeten und dem nun
andere Personen angehören. Rückblickend auf seine eigenen Amtszeiten formuliert Joachim
Schlör gut schwäbisch, was gewiss auch diejenigen, die in anderen Gegenden der Republik
zuhause sind, gut verstehen können: „Gut war’s, ond jetz‘ isch au gut!“ Ein passender
Schlusssatz auch für diese Prozessbeobachtungen; gleichwohl muss und wird die Auseinan‐
dersetzung mit dunklen Begierden weitergehen.Sie können auch lesen