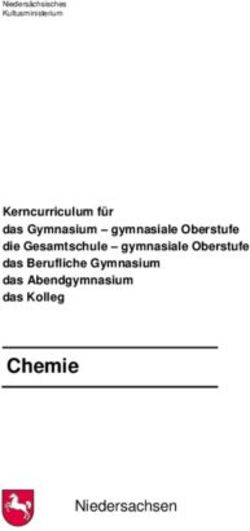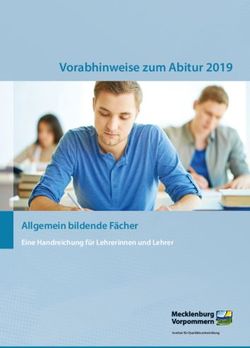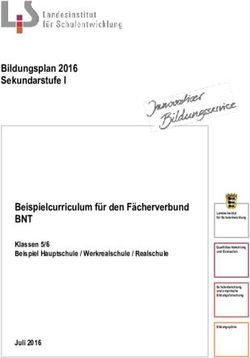Chemie Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe - Bertha-von-Suttner Gymnasium Oberhausen
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Schulinterner Lehrplan zum Kernlehrplan für die gymnasiale Oberstufe Chemie
Inhalt
Seite
1 Die Fachgruppe Chemie des Bertha-von-Suttner-Gymnasi-
ums 3
2.1 Unterrichtsvorhaben 5
2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben 7
2.1.2 Einführungsphase – Unterrichtsvorhaben I 10
2.1.3 Einführungsphase - Unterrichtsvorhaben II 13
2.1.4 Einführungsphase - Unterrichtsvorhaben III 18
2.1.5 Einführungsphase - Unterrichtsvorhaben IV 22
2.1.6 Grundkurs Qualifikationsphase Q 1 – Unterrichtsvorhaben V 29
2.1.7 Grundkurs Qualifikationsphase Q 1 – Unterrichtsvorhaben VI 36
2.1.8 Grundkurs Qualifikationsphase Q1 – Unterrichtsvorhaben VII 39
2.1.9 Grundkurs Qualifikationsphase Q1 – Unterrichtsvorhaben VIII 45
2.1.10 Grundkurs Qualifikationsphase Q2 –Unterrichtsvorhaben IX 50
2.1.11 Grundkurs Qualifikationsphase Q2 – Unterrichtsvorhaben X 56
2.2 Grundsätze der fachmethodischen und fachdidaktischen Arbeit 61
2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung 63
2.4 Lehr- und Lernmittel 65
3 Entscheidungen zu fach- und unterrichtsübergreifenden
Fragen 66
4 Qualitätssicherung und Evaluation 67
5 Leistungsbewertung 68
21 Die Fachgruppe Chemie des Bertha-von-Suttner-
Gymnasiums
Das Bertha-von-Suttner-Gymnasium wird derzeit von ca. 1000 Schülerin-
nen und Schülern besucht und befindet sich im Zentrum von Oberhausen.
In unmittelbarer Nähe zur Schule befindet sich das Fraunhofer-Institut für
Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik, zu dem auch eine Kooperation,
vor allem für externe Facharbeiten, besteht. Des Weiteren besteht eine
Kooperation mit der Universität Duisburg-Essen, welche die Möglichkeit
bietet unterschiedliche Praktika in den Laboren der Universität durchzu-
führen. Im Umfeld der Schule befinden sich zwei weitere Gymnasien, zu
denen in einigen Fächern bereits Kooperationen bestehen.
Die Lehrerbesetzung der Schule ermöglicht einen ordnungsgemäßen
Fachunterricht in der Sekundarstufe I, ein NW-AG-Angebot und Wahl-
pflichtkurse mit naturwissenschaftlichem Schwerpunkt. In der Sekundar-
stufe I wird in den Jahrgangsstufen 7,8, und 9 Chemieunterricht im Um-
fang der vorgesehenen 6 Wochenstunden laut Stundentafel erteilt.
Diese Ausgangssituationen ermöglichte dem Bertha-von-Suttner-Gymna-
sium den Status einer Mintfreundlichen Schule zu erlangen. In Zukunft
wird der Status der Mitgliedschaft im MINT-EC-Verein angestrebt. Dieser
MINT-Schwerpunkt soll sich ebenfalls im Schulprogramm niederschlagen.
Die Schule ist seit 2012 im offenen Ganztag.
In der Oberstufe sind durchschnittlich ca. 140 Schülerinnen und Schüler
pro Stufe. Das Fach Chemie ist in der Regel in der Einführungsphase mit
2-3 Grundkursen, in der Qualifikationsphase je Jahrgangsstufe mit 1-2
Grundkursen vertreten.
In der Schule sind die Unterrichtseinheiten bevorzugt in Doppelstunden or-
ganisiert, in der Oberstufe gibt es im Grundkurs eine Doppel- und eine
Einzelstunde.
Dem Fach Chemie stehen 3 Fachräume zur Verfügung in denen in Schü-
lerübungen auch experimentell gearbeitet werden kann. Zudem besteht in
einem der Räume die Möglichkeit des computerunterstützen Arbeitens.
Die Ausstattung der Chemiesammlung mit Geräten und Materialien für
Demonstrations- und für Schülerexperimente reichen für das Erforderliche
aus. Die Schule hat sich vorgenommen, das Experimentieren in allen
Jahrgangsstufen besonders zu fördern.
3In nahezu allen Unterrichtsvorhaben wird den Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit gegeben, Schülerexperimente durchzuführen; damit wird eine Unterrichtspraxis aus der Sekundarstufe I fortgeführt. Insgesamt wer- den überwiegend kooperative, die Selbstständigkeit des Lerners fördernde Unterrichtsformen genutzt, sodass ein individualisiertes Lernen in der Se- kundarstufe II kontinuierlich unterstützt wird. Schülerinnen und Schüler der Schule nehmen häufig am Wettbewerb „Chemie entdecken“ und „Jugend forscht/Schüler experimentieren“ teil und sind vor allem in der Juniorsparte recht erfolgreich. Der Chemieunterricht soll Interesse an naturwissenschaftlichen Fragestel- lungen wecken und die Grundlage für das Lernen in Studium und Beruf in diesem Bereich vermitteln. Dabei werden fachlich und methodisch fundier- te Kenntnisse die Voraussetzung für einen eigenen Standpunkt und für verantwortliches Handeln gefordert und gefördert. Dies soll sich jedoch nicht nur auf ein Studium beschränken, sondern für den Alltag eines mün- digen Bürgers gelten. 4
2 Entscheidungen zum Unterricht
2.1 Unterrichtsvorhaben
Die Darstellung der Unterrichtsvorhaben im schulinternen Lehrplan besitzt
den Anspruch, die im Kernlehrplan angeführten Kompetenzen abzude-
cken. Dies entspricht der Verpflichtung jeder Lehrkraft, alle Kompetenzer-
wartungen des Kernlehrplans bei den Lernenden auszubilden und zu ent-
wickeln.
Die entsprechende Umsetzung erfolgt auf zwei Ebenen: der Übersichts-
und der Konkretisierungsebene.
Im „Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.1.1) wird die für alle
Lehrerinnen und Lehrer gemäß Fachkonferenzbeschluss verbindliche Ver-
teilung der Unterrichtsvorhaben dargestellt. Das Übersichtsraster dient
dazu, den Kolleginnen und Kollegen einen schnellen Überblick über die
Zuordnung der Unterrichtsvorhaben zu den einzelnen Jahrgangsstufen so-
wie den im Kernlehrplan genannten Kompetenzen, Inhaltsfeldern und in-
haltlichen Schwerpunkten zu verschaffen. Um Klarheit für die Lehrkräfte
herzustellen und die Übersichtlichkeit zu gewährleisten, werden in der Ka-
tegorie „Kompetenzen“ an dieser Stelle nur die übergeordneten Kompe-
tenzerwartungen ausgewiesen bzw. hervorgehoben, während die konkreti-
sierten Kompetenzerwartungen erst auf der Ebene konkretisierter Unter-
richtsvorhaben Berücksichtigung finden. Der ausgewiesene Zeitbedarf
versteht sich als grobe Orientierungsgröße, die nach Bedarf über- oder
unterschritten werden kann. Um Spielraum für Vertiefungen, besondere
Schülerinteressen, aktuelle Themen bzw. die Erfordernisse anderer be-
sonderer Ereignisse (z.B. Praktika, Kursfahrten o.ä.) zu erhalten, wurden
im Rahmen dieses schulinternen Lehrplans nicht die gesamte Bruttounter-
richtszeit verplant.
Während der Fachkonferenzbeschluss zum „Übersichtsraster Unterrichts-
vorhaben“ zur Gewährleistung vergleichbarer Standards sowie zur Absi-
cherung von Lerngruppenübertritten und Lehrkraftwechseln für alle Mit-
glieder der Fachkonferenz Bindekraft entfalten soll, besitzt die exemplari-
sche Ausweisung „konkretisierter Unterrichtsvorhaben“ (Kapitel 2.1.2)
empfehlenden Charakter. Referendarinnen und Referendaren sowie neu-
en Kolleginnen und Kollegen dienen diese vor allem zur standardbezoge-
nen Orientierung in der neuen Schule, aber auch zur Verdeutlichung von
unterrichtsbezogenen fachgruppeninternen Absprachen zu didaktisch-me-
thodischen Zugängen, fächerübergreifenden Kooperationen, Lernmitteln
und -orten sowie vorgesehenen Leistungsüberprüfungen, die im Einzelnen
auch den Kapiteln 2.2 bis 2.4 zu entnehmen sind. Abweichungen von den
5vorgeschlagenen Vorgehensweisen bezüglich der konkretisierten Unter- richtsvorhaben sind im Rahmen der pädagogischen Freiheit der Lehrkräfte jederzeit möglich. Sicherzustellen bleibt allerdings auch hier, dass im Rah- men der Umsetzung der Unterrichtsvorhaben insgesamt alle Kompeten- zen des Kernlehrplans Berücksichtigung finden. Da am Bertha-von-Suttner-Gymnasium ausschließlich Grundkurse ange- boten werden, beschränken sich die nachfolgenden Ausführungen auf die- sen Bereich. 6
2.1.1 Übersichtsraster Unterrichtsvorhaben
Das folgende Raster stellt keine verbindliche Reihenfolge der Unterrichtsinhalte dar.
Einführungsphase
Unterrichtsvorhaben I: Unterrichtsvorhaben II:
Kontext: Nicht nur Graphit und Diamant – Kontext: Kohlenstoffdioxid und das Klima –
Erscheinungsformen des Kohlenstoffs Die Bedeutung der Ozeane
Schwerpunkte übergeordneter Kompe- Schwerpunkte übergeordneter Kompetenz-
tenzerwartungen: erwartungen:
UF4 Vernetzung E1 Probleme und Fragestellungen
E6 Modelle E4 Untersuchungen und Experimente
E7 Arbeits- und Denkweisen K4 Argumentation
K3 Präsentation B3 Werte und Normen
B4 Möglichkeiten und Grenzen
Inhaltsfeld: Kohlenstoffverbindungen und
Gleichgewichtsreaktionen Inhaltsfeld: Kohlenstoffverbindungen und
Gleichgewichtsreaktionen
Inhaltlicher Schwerpunkt:
Nanochemie des Kohlenstoffs Inhaltliche Schwerpunkte:
(Organische und) anorganische Kohlenstoff-
verbindungen
Zeitbedarf: ca. 8 Std. à 45min Gleichgewichtsreaktionen
Stoffkreislauf in der Natur
Zeitbedarf: ca. 22 Std. à 45 min
Unterrichtsvorhaben III: Unterrichtsvorhaben IV:
Kontext: Methoden der Kalkentfernung Kontext: Vom Alkohol zum Aromastoff
im Haushalt Schwerpunkte übergeordneter Kompetenz-
Schwerpunkte übergeordneter Kompe- erwartungen:
tenzerwartungen: UF2 Auswahl
UF3 Systematisierung
UF1 Wiedergabe
E2 Wahrnehmung und Messung
UF3 Systematisierung
E3 Hypothesen E4 Untersuchungen und Experimente
K 2 Recherche
E5 Auswertung
K3 Präsentation
K1 Dokumentation
B1 Kriterien
B2 Entscheidungen
Inhaltsfeld: Kohlenstoffverbindungen und
Gleichgewichtsreaktionen Inhaltsfeld: Kohlenstoffverbindungen und
Gleichgewichtsreaktionen
Inhaltlicher Schwerpunkt:
Gleichgewichtsreaktionen Inhaltlicher Schwerpunkt:
Organische (und anorganische) Kohlenstoff-
Zeitbedarf: ca. 18 Std. à 45 min verbindungen
Zeitbedarf: ca. 38 Std. à 45 min
Summe Einführungsphase: 86 Stunden
7Qualifikationsphase (Q1) – GRUNDKURS
Unterrichtvorhaben V Unterrichtsvorhaben VI:
Kontext: Strom für Taschenlampe und Mo- Kontext: Korrosion vernichtet Werte
biltelefon
Schwerpunkte übergeordneter Kompe-
Schwerpunkte übergeordneter Kompe- tenzerwartungen:
tenzerwartungen: UF1 Wiedergabe
UF3 Systematisierung UF3 Systematisierung
UF4 Vernetzung E6 Modelle
E2 Wahrnehmung und Messung B2 Entscheidungen
E4 Untersuchungen und Experimente
E6 Modelle Inhaltsfeld: Elektrochemie
K2 Recherche
B2 Entscheidungen Inhaltlicher Schwerpunkt:
Korrosion
Inhaltsfeld: Elektrochemie
Zeitbedarf: ca. 7 Stunden à 45 Minuten
Inhaltlicher Schwerpunkt:
Mobile Energiequellen
Zeitbedarf: ca. 36 Stunden à 45 Minuten
Unterrichtsvorhaben VII: Unterrichtsvorhaben VIII:
Kontext: Säuren und Basen in Alltagspro- Kontext: Vom fossilen Rohstoff zum An-
dukten: Starke und schwache Säuren und wendungsprodukt
Basen
Konzentrationsbestimmungen von Essig- Schwerpunkte übergeordneter Kompe-
säure in Lebensmitteln tenzerwartungen:
UF3 Systematisierung
Schwerpunkte übergeordneter Kompe- UF4 Vernetzung
tenzerwartungen: E3 Hypothesen
UF1 Wiedergabe E 4 Untersuchungen und Experimente
UF2 Auswahl K3 Präsentation
UF3 Systematisierung B3 Werte und Normen
E1 Probleme und Fragestellungen
E2 Wahrnehmung und Messung Inhaltsfeld: Organische Produkte – Werk-
E4 Untersuchungen und Experimente stoffe und Farbstoffe
E5 Auswertung
K1 Dokumentation Inhaltlicher Schwerpunkt:
K2 Recherche Organische Verbindungen und Reaktions-
B1 Kriterien wege
Inhaltsfeld: Säuren, Basen und analytische Zeitbedarf: ca. 13 Stunden à 45 Minuten
Verfahren
Inhaltliche Schwerpunkte:
Eigenschaften und Struktur von Säuren
und Basen
Konzentrationsbestimmungen von Säuren
und Basen
Zeitbedarf: 30 Std. à 45 Minuten
Summe Qualifikationsphase (Q1) – GRUNDKURS: 86 StundenQualifikationsphase (Q2) – GRUNDKURS
Unterrichtvorhaben IX Unterrichtsvorhaben X:
Kontext: Maßgeschneiderte Produkte Kontext: Farbstoffe im Alltag
Schwerpunkte übergeordneter Kompe- Schwerpunkte übergeordneter Kompe-
tenzerwartungen: tenzerwartungen:
UF1 Wiedergabe UF1 Wiedergabe
UF3 Systematisierung UF3 Systematisierung
E4 Untersuchungen und Experimente E6 Modelle
E5 Auswertung K3 Präsentation
E7 Arbeits- und Denkweisen B4 Möglichkeiten und Grenzen
K3 Präsentation
B3 Werte und Normen Inhaltsfeld: Organische Produkte – Werk-
stoffe und Farbstoffe
Inhaltsfeld: Organische Produkte – Werk-
stoffe und Farbstoffe
Inhaltlicher Schwerpunkt:
Inhaltlicher Schwerpunkt:
Farbstoffe
Werkstoffe
Zeitbedarf: ca. 34 Stunden à 45 Minuten Zeitbedarf: ca. 20 Stunden à 45 Minuten
Summe Qualifikationsphase (Q2) – GRUNDKURS: 54 Stunden
92.1.2 Einführungsphase – Unterrichtsvorhaben I Kontext: Nicht nur Graphit und Diamant – Erscheinungsformen des Kohlenstoffs Basiskonzepte (Schwerpunkt): Basiskonzept Struktur – Eigenschaft Schwerpunkte übergeordneter Kompetenzerwartungen: Kompetenzbereich Umgang mit Fachwissen: bestehendes Wissen aufgrund neuer chemischer Erfahrungen und Erkenntnisse modifizieren und reorganisieren (UF4). Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung: Modelle begründet auswählen und zur Beschreibung, Erklärung und Vorhersage chemischer Vorgänge verwenden, auch in einfacher formalisierter oder mathema- tischer Form (E6). an ausgewählten Beispielen die Bedeutung, aber auch die Vorläufigkeit naturwis- senschaftlicher Regeln, Gesetze und Theorien beschreiben (E7). Kompetenzbereich Kommunikation: chemische Sachverhalte, Arbeitsergebnisse und Erkenntnisse adressatengerecht sowie formal, sprachlich und fachlich korrekt in Kurzvorträgen oder kurzen Fach- texten darstellen (K3). Inhaltsfeld: Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen Inhaltlicher Schwerpunkt: Nanochemie des Kohlenstoffs Zeitbedarf: ca. 8 Std. à 45 Minuten
2.1.2 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben
Einführungsphase
Unterrichtsvorhaben I
Kontext: Nicht nur Graphit und Diamant – Erscheinungsformen des Kohlenstoffs
Inhaltsfeld: Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen
Inhaltliche Schwerpunkte: Schwerpunkte übergeordneter Kompetenzerwartungen:
Nanochemie des Kohlenstoffs UF4 Vernetzung
E6 Modelle
E7 Arbeits- und Denkweisen
K3 Präsentation
Zeitbedarf: 8 Std. à 45 Minuten Basiskonzept (Schwerpunkt):
Basiskonzept Struktur – Eigenschaft
Sequenzierung inhaltli- Konkretisierte Kompetenzerwartungen Lehrmittel/ Materialien/ Methoden Verbindliche Ab-
cher Aspekte des Kernlehrplans sprachen
Didaktisch-metho-
Die Schülerinnen und Schüler ... dische Anmerkun-
gen
Graphit, Diamant und nutzen bekannte Atom- und Bindungsmo- 1. Diagnose des aktuellen Wissensstandes, z.B. Der Einstieg dient
mehr delle zur Beschreibung organischer Mole- durch schriftliche Überprüfung oder alternati- zur Angleichung der
- Modifikation küle und Kohlenstoffmodifikationen (E6). ves Verfahren Kenntnisse zur Bin-
- Elektronenpaar- Atombau, Bindungslehre, dungslehre, ggf.
bindung stellen anhand von Strukturformeln Ver- Kohlenstoffatom, Periodensystem muss Zusatzmateri-
- Strukturformeln mutungen zu Eigenschaften ausgewählter al zur Verfügung ge-
Stoffe auf und schlagen geeignete Experi- stellt werden.
mente zur Überprüfung vor (E3).
Beim Graphit und
erläutern Grenzen der ihnen bekannten beim Fulleren wer-
Bindungsmodelle (E7). 2. Erarbeitung, z.B. in Form von Gruppenarbeit, den die Grenzen
PTS, etc. unter Vewendung entsprechender Ar- der einfachen Bin-
beschreiben die Strukturen von Diamant beitsmaterialien: „Graphit, Diamant und Fullerene“ dungsmodelle deut-
und Graphit und vergleichen diese mit lich. (Achtung: ohne
neuen Materialien aus Kohlenstoff (u.a. Hybridisierung)
11Fullerene) (UF4).
Nanomaterialien recherchieren angeleitet und unter vorge- 3. Anwendung: Weiteführende Recherche, Prä- Unter vorgegebe-
- Nanotechnologie gebenen Fragestellungen Eigenschaften sentation oder Ähnliches zu neuen Materialien nen Rechercheauf-
- Neue Materialien und Verwendungen ausgewählter Stoffe aus Kohlenstoff und Problemen der Nanotechnolo- trägen können die
- Anwendungen und präsentieren die Rechercheergebnis- gie Schülerinnen und
- Risiken se adressatengerecht (K2, K3). (z.B. Kohlenstoff-Nanotubes in Verbundmaterialien Schüler selbststän-
zur Verbesserung der elektrischen Leitfähigkeit in dig Fragestellungen
stellen neue Materialien aus Kohlenstoff Kunststoffen) entwickeln. (Niveau-
vor und beschreiben deren Eigenschaften - Aufbau differenzierung, indi-
(K3). - Herstellung viduelle Förderung)
- Verwendung
bewerten an einem Beispiel Chancen und - Risiken Die Schülerinnen
Risiken der Nanotechnologie (B4). - Besonderheiten und Schüler entwi-
ckeln Präsentations-
möglichkeiten (Lern-
plakate, Vorberei-
tung eines Muse-
umsganges, Kurzre-
ferat,
Rollenspiel,etc. )
Leistungsbewertung:
Siehe Punkt
Beispielhafte Hinweise zu weiterführenden Informationen:
Eine Gruppenarbeit zu Diamant, Graphit und Fullerene findet man auf den Internetseiten der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich:
http://www.educ.ethz.ch/unt/um/che/ab/graphit_diamant,
Zum Thema Nanotechnologie sind zahlreiche Materialien und Informationen veröffentlicht worden, z.B.:
FCI, Informationsserie Wunderwelt der Nanomaterialien (inkl. DVD und Experimente)
Klaus Müllen, Graphen aus dem Chemielabor, in: Spektrum der Wissenschaft 8/12
Sebastian Witte, Die magische Substanz, GEO kompakt Nr. 31
http://www.nanopartikel.info/cms
http://www.wissenschaft-online.de/artikel/855091
http://www.wissenschaft-schulen.de/alias/material/nanotechnologie/11917712.1.3 Einführungsphase - Unterrichtsvorhaben II
Kontext: Kohlenstoffdioxid und das Klima – Die Bedeutung der Ozeane
Basiskonzepte (Schwerpunkt):
Basiskonzept Struktur – Eigenschaft
Basiskonzept Chemisches Gleichgewicht
Schwerpunkte übergeordneter Kompetenzerwartungen:
Die Schülerinnen und Schüler können
Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung:
in vorgegebenen Situationen chemische Probleme beschreiben, in Teilprobleme
zerlegen und dazu Fragestellungen angeben (E1).
unter Beachtung von Sicherheitsvorschriften einfache Experimente zielgerichtet
planen und durchführen und dabei mögliche Fehler betrachten (E4).
Kompetenzbereich Kommunikation:
chemische Aussagen und Behauptungen mit sachlich fundierten und überzeu-
genden Argumenten begründen bzw. kritisieren (K4).
Kompetenzbereich Bewertung:
in bekannten Zusammenhängen ethische Konflikte bei Auseinandersetzungen mit
chemischen Fragestellungen darstellen sowie mögliche Konfliktlösungen aufzei-
gen (B3).
Möglichkeiten und Grenzen chemischer und anwendungsbezogener Problemlö-
sungen und Sichtweisen mit Bezug auf die Zielsetzungen der Naturwissenschaf-
ten darstellen (B4).
Inhaltsfeld: Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen
Inhaltliche Schwerpunkte:
(Organische und) anorganische Kohlenstoffverbindungen
Gleichgewichtsreaktionen
Stoffkreislauf in der Natur
Zeitbedarf: ca. 22 Std. à 45 Minuten
132.1.3 Konkretisierte Unterrichtsvorhaben
Einführungsphase
Unterrichtsvorhaben II
Kontext: Kohlenstoffdioxid und das Klima – Die Bedeutung für die Ozeane
Inhaltsfeld: Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen
Inhaltliche Schwerpunkte: Schwerpunkte übergeordneter Kompetenzerwartungen:
Stoffkreislauf in der Natur E1 Probleme und Fragestellungen
Gleichgewichtsreaktionen E4 Untersuchungen und Experimente
K4 Argumentation
B3 Werte und Normen
B4 Möglichkeiten und Grenzen
Zeitbedarf: 22 Std. à 45 Minuten
Basiskonzepte (Schwerpunkt):
Basiskonzept Struktur – Eigenschaft
Basiskonzept Chemisches Gleichgewicht
Sequenzierung inhaltli- Konkretisierte Kompetenzerwartungen Lehrmittel/ Materialien/ Methoden Verbindliche Ab-
cher Aspekte des Kernlehrplans sprachen
Didaktisch-methodi-
Die Schülerinnen und Schüler ... sche Anmerkungen
Kohlenstoffdioxid unterscheiden zwischen dem natürlichen 1. Diagnose des aktuellen Wissensstandes, Der Einstieg dient zur
- Eigenschaften und dem anthropogen erzeugten Treib- z.B. durch Kartenabfrage, Mind-Map, Anknüpfung an die
- Treibhauseffekt hauseffekt und beschreiben ausgewählte Selbststest, etc.: Begriffe zum Thema Kohlen- Vorkenntnisse aus
- Anthropogene Ursachen und ihre Folgen (E1). stoffdioxid der SI und anderen
Emissionen Fächern
- Reaktionsglei- Erarbeitung Eigenschaften / Treibhauseffekt
chungen z.B. Zeitungsartikel, Sachtext Implizite Wiederho-
- Umgang mit Grö- Berechnungen zur Bildung von CO2 aus Kohle lung: Stoffmenge n,
ßengleichungen und Treibstoffen (Alkane) Masse m und molare
- Aufstellen von Reaktionsgleichungen Masse M
- Berechnung des gebildeten CO2s
- Vergleich mit rechtlichen Vorgaben
- weltweite CO2-EmissionenInformation Aufnahme von CO2 u.a. durch die
Ozeane
Löslichkeit von CO2 in führen qualitative Versuche unter vorgege- Diverse Experimente oder entsprechende Ar- Wiederholung der
Wasser bener Fragestellung durch und protokollie- beitsmaterialien: Löslichkeit von CO2 in Wasser Stoffmengenkonzen-
- qualitativ ren die Beobachtungen (u.a. zur Untersu- (qualitativ) tration c
- Bildung einer chung der Eigenschaften organischer Ver-
sauren Lösung bindungen) (E2, E4). Wiederholung: Kriteri-
- quantitativ Aufstellen von Reaktionsgleichungen en für Versuchsproto-
- Unvollständigkeit dokumentieren Experimente in angemes- kolle
der Reaktion sener Fachsprache (u.a. zur Untersu- Löslichkeit von CO2 (quantitativ):
- Umkehrbarkeit chung der Eigenschaften organischer Ver- - Löslichkeit von CO2 in g/l
bindungen, zur Einstellung einer Gleichge- - Nutzung einer Tabelle zum erwarteten pH- Vorgabe einer Tabel-
wichtsreaktion, zu Stoffen und Reaktionen Wert le zur pH-Abhängig-
eines natürlichen Kreislaufes) (K1). - Vergleich mit dem tatsächlichen pH-Wert keit der Löslichkeit
- Löslichkeit von CO2 bei Zugabe von Salz-
nutzen angeleitet und selbstständig che- säure bzw. Natronlauge
miespezifische Tabellen und Nachschla-
gewerke zur Planung und Auswertung von Ergebnis:
Experimenten und zur Ermittlung von Unvollständigkeit der ablaufenden Reaktion :
Stoffeigenschaften (K2). Umkehrbarkeit / Reversibilität der Reaktion
Chemisches Gleichge-
wicht Erarbeitung einer Definition des chemischen
- Definition erläutern die Merkmale eines chemischen Gleichgewichtes als allgemeines Prinzip vieler
- Beschreibung auf Gleichgewichtszustands an ausgewählten chemischer Reaktionen, Übertragung auf Teil-
Teilchenebene Beispielen (UF1). chenebene mit Hilfe diverser Lehrmaterialien, Mo-
- Modellvorstellun- dellexperimente, Simulationen, etc.
gen
beschreiben und erläutern das chemische
Gleichgewicht mithilfe von Modellen (E6).
Ozean und Gleichge- formulieren Hypothesen zur Beeinflussung 3. Anwendung: CO2- Aufnahme in den Meeren Prinzip von Le Chate-
15wichte natürlicher Stoffkreisläufe (u.a. Kohlen- lier ggf.MWG
- Aufnahme CO2 stoffdioxid-Carbonat-Kreislauf) (E3).
- Einfluss der
Bedingungen der erläutern an ausgewählten Reaktionen die Experimentelle Untersuchung oder entspre-
Ozeane auf die Beeinflussung der Gleichgewichtslage chendes Arbeitsmaterial: Einfluss von Druck
Löslichkeit von durch eine Konzentrationsänderung (bzw. und Temperatur auf die Löslichkeit von CO2
CO2 Stoffmengenänderung), Temperatur- ggf. Einfluss des Salzgehalts auf die Löslichkeit
- Prinzip von Le änderung (bzw. Zufuhr oder Entzug von
Chatelier Wärme) und Druckänderung (bzw. Volu- Beeinflussung von chemischen Gleichgewich-
- Kreisläufe menänderung) (UF3). ten (Verallgemeinerung) Fakultativ:
Einfluss von Druck, Temperatur und Konzentrati- Mögliche Ergänzun-
formulieren Fragestellungen zum Problem on auf Gleichgewichte, Vorhersagen gen (auch zur indivi-
des Verbleibs und des Einflusses anthro- duellen Förderung):
pogen erzeugten Kohlenstoffdioxids (u.a. - Tropfsteinhöhlen
im Meer) unter Einbezug von Gleichge- - Kalkkreislauf
wichten (E1). - Korallen
veranschaulichen chemische Reaktionen
zum Kohlenstoffdioxid-Carbonat-Kreislauf
grafisch oder durch Symbole (K3).
Klimawandel recherchieren Informationen (u.a. zum Weitere Anwendung
- Informationen in Kohlenstoffdioxid-Carbonat-Kreislauf) aus - aktuelle Entwicklungen
den Medien unterschiedlichen Quellen und strukturie- - Versauerung der Meere
- Möglichkeiten zur ren und hinterfragen die Aussagen der In- - Einfluss auf den Golfstrom/Nordatlantik-
Lösung des formationen (K2, K4). strom
CO2-Problems
beschreiben die Vorläufigkeit der Aussa-
gen von Prognosen zum Klimawandel
(E7).
beschreiben und bewerten die gesell-
schaftliche Relevanz prognostizierter Fol-
gen des anthropogenen Treibhauseffektes
(B3).zeigen Möglichkeiten und Chancen der
Verminderung des Kohlenstoffdioxid-
ausstoßes und der Speicherung des Koh-
lenstoffdioxids auf und beziehen politische
und gesellschaftliche Argumente und ethi-
sche Maßstäbe in ihre Bewertung ein (B3,
B4).
Leistungsbewertung:
Siehe Punkt
Beispielhafte Hinweise zu weiterführenden Informationen:
Ausführliche Hintergrundinformationen und experimentelle Vorschläge zur Aufnahme von CO2 in den Ozeanen findet man z.B. unter:
http://systemerde.ipn.uni-kiel.de/materialien_Sek2_2.html
ftp://ftp.rz.uni-kiel.de/pub/ipn/SystemErde/09_Begleittext_oL.pdf
Die Max-Planck-Gesellschaft stellt in einigen Heften aktuelle Forschung zum Thema Kohlenstoffdioxid und Klima vor:
http://www.maxwissen.de/Fachwissen/show/0/Heft/Kohlenstoffkreislauf.html
http://www.maxwissen.de//Fachwissen/show/0/Heft/Klimarekonstruktion
http://www.maxwissen.de/Fachwissen/show/0/Heft/Klimamodelle.html
Informationen zum Film „Treibhaus Erde“:
http://www.planet-schule.de/wissenspool/total-phaenomenal/inhalt/sendungen/treibhaus-erde.html
172.1.4 Einführungsphase - Unterrichtsvorhaben III
Kontext: Methoden der Kalkentfernung im Haushalt
Basiskonzepte (Schwerpunkt):
Basiskonzept Chemisches Gleichgewicht
Basiskonzept Energie
Schwerpunkte übergeordneter Kompetenzerwartungen:
Die Schülerinnen und Schüler können
Kompetenzbereich Umgang mit Fachwissen:
ausgewählte Phänomene und Zusammenhänge erläutern und dabei Bezüge
zu übergeordneten Prinzipien, Gesetzen und Basiskonzepten der Chemie her-
stellen (UF1).
die Einordnung chemischer Sachverhalte und Erkenntnisse in gegebene fach-
liche Strukturen begründen (UF3).
Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung:
zur Klärung chemischer Fragestellungen begründete Hypothesen formulieren
und Möglichkeiten zu ihrer Überprüfung angeben (E3).
Daten bezüglich einer Fragestellung interpretieren, da- raus qualitative und
quantitative Zusammenhänge ab- leiten und diese in Form einfacher funktio-
naler Beziehungen beschreiben (E5).
Kompetenzbereich Kommunikation:
Fragestellungen, Untersuchungen, Experimente und Daten nach gegebenen
Strukturen dokumentieren und stimmig rekonstruieren, auch mit Unterstützung
digitaler Werkzeuge (K1).
Inhaltsfeld: Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen
Inhaltliche Schwerpunkte:
Gleichgewichtsreaktionen
Zeitbedarf: ca. 18 Std. à 45 MinutenEinführungsphase - Unterrichtsvorhaben III
Kontext: Methoden der Kalkentfernung im Haushalt
Inhaltsfeld: Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen
Inhaltliche Schwerpunkte: Schwerpunkte übergeordneter Kompetenzerwartungen:
Gleichgewichtsreaktionen/Reaktionsgeschwindigkeit UF1 – Wiedergabe
Zeitbedarf: 18 Std. a 45 Minuten UF3 – Systematisierung
E3 – Hypothesen
E5 – Auswertung
K1 – Dokumentation
Basiskonzepte:
Basiskonzept Chemisches Gleichgewicht
Basiskonzept Energie
Sequenzierung inhaltli- Konkretisierte Kompetenzerwartungen Lehrmittel/ Materialien/ Methoden Verbindliche Ab-
cher Aspekte des Kernlehrplans sprachen
Didaktisch-methodi-
sche Anmerkungen
Kalkentfernung planen quantitative Versuche (u.a. zur Diagnose Vorkenntnisse Kalkentfernung im Anbindung an CO2-
- Reaktion von Kalk mit Untersuchung des zeitlichen Ablaufs Haushalt Kreislauf: Sedimenta-
Säuren einer chemischen Reaktion), führen tion
- Beobachtungen eines diese zielgerichtet durch und dokumentie- Erarbeitung: Wiederholung Stoff-
Reaktionsverlaufs ren 1. Reaktionsgeschwindigkeit menge
- Reaktionsge- die Ergebnisse (E2, E4). S. berechnen die Re-
schwindigkeit be- stellen für Reaktionen zur Untersuchung Diverse Experimente und Arbeitsmaterialien zur aktionsgeschwindig-
rechnen der Reaktionsgeschwindigkeit Reaktionsgeschwindigkeit und deren Beeinflus- keiten
den Stoffumsatz in Abhängigkeit von sung für verschiedene
der Zeit tabellarisch und graphisch dar Zeitintervalle im
(K1). Verlauf der Reaktion
erläutern den Ablauf einer chemischen
Reaktion unter dem Aspekt der Geschwin-
digkeit
und definieren die Reaktionsgeschwindig-
keit
als Differenzenquotienten c/t (UF1).
Einfluss auf die Reakti- formulieren Hypothesen zum Einfluss
19onsgeschwindigkeit verschiedener Faktoren auf die Reaktions-
- Einflussmöglichkeiten geschwindigkeit
- Parameter (Konzentra- und entwickeln
tion, Versuche zu deren Überprüfung (E3).
Temperatur, Zerteilungs- interpretieren den zeitlichen Ablauf
grad) chemischer Reaktionen in Abhängigkeit ggf. Simulation
- Kollisionshypothese von verschiedenen Parametern (u.a.
-Geschwindigkeitsgesetz Oberfläche, Konzentration, Temperatur)
für bimolekulare Reakti- (E5).
on erklären den zeitlichen Ablauf chemischer
- RGT-Regel Reaktionen auf der Basis einfacher
Modelle auf molekularer Ebene
(u.a. Stoßtheorie nur für Gase) (E6).
beschreiben und beurteilen Chancen
und Grenzen der Beeinflussung der
Reaktionsgeschwindigkeit und des
chemischen Gleichgewichts (B1).
Einfluss der Tempera- 2. Energie bei chemischen Reaktionen Empfohlen wird der
tur interpretieren ein einfaches Energie- Film:
- Ergänzung Kollisions- Reaktionsweg-Diagramm (E5, K3). Einführung der Aktivierungsenergie Wilhelm Ostwald und
hypothese beschreiben und erläutern den Einfluss die
- Aktivierungsenergie eines Katalysators auf die Reaktionsge- Katalysatoren, Katalyse (Meilenstei-
- Katalyse schwindigkeit ne der
mithilfe vorgegebener Naturwissenschaft
graphischer Darstellungen (UF1, UF3). und
Technik)
Chemisches Gleichge- formulieren 3. Massenwirkungsgesetz
wicht für ausgewählte Gleichgewichtsreaktionen Von der Reaktionsgeschwindigkeit
quantitativ das Massenwirkungsgesetz zum chemischen Gleichgewicht
- Wiederholung Gleich- (UF3).
gewicht interpretieren Gleichgewichtskonstanten Einführung des Massenwirkungsgesetzes
- Hin- und Rückreaktion in Bezug auf die Gleichgewichtslage
- Massenwirkungsgesetz (UF4). Anwendung: Übungsaufgaben
- - Beispielreaktio- dokumentieren Experimente in angemes-
nen senerFachsprache (u.a. zur Untersuchung
der Eigenschaften organischer
Verbindungen, zur Einstellung einer
Gleichgewichtsreaktion, zu Stoffen und
Reaktionen eines natürlichen Kreislaufes)
( K1).
beschreiben und beurteilen Chancen
und Grenzen der Beeinflussung der
Reaktionsgeschwindigkeit und des
chemischen Gleichgewichts (B1).
Leistungsbewertung:
siehe Punkt 2.3
212.1.5 Einführungsphase - Unterrichtsvorhaben IV Kontext: Vom Alkohol zum Aromastoff Basiskonzepte (Schwerpunkt): Basiskonzept Struktur – Eigenschaft, Basiskonzept Donator - Akzeptor Schwerpunkte übergeordneter Kompetenzerwartungen: Die Schülerinnen und Schüler können Kompetenzbereich Umgang mit Fachwissen: zur Lösung von Problemen in eingegrenzten Bereichen chemische Konzepte auswählen und anwenden und dabei Wesentliches von Unwesentlichem unterscheiden (UF2). die Einordnung chemischer Sachverhalte und Erkenntnisse in gegebene fachliche Strukturen begründen (UF3). Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung: Kriteriengeleitet beobachten und erfassen und gewonnene Ergebnisse frei von eigenen Deutungen beschreiben (E2). unter Beachtung von Sicherheitsvorschriften einfache Experimente zielgerichtet planen und durchführen und dabei mögliche Fehler betrachten (E4). Kompetenzbereich Kommunikation: in vorgegebenen Zusammenhängen selbstständig chemische und anwendungsbe- zogene Fragestellungen mithilfe von Fachbüchern und anderen Quellen bearbeiten (K 2). chemische Sachverhalte, Arbeitsergebnisse und Erkenntnisse adressatengerecht sowie formal, sprachlich und fachlich korrekt in Kurzvorträgen oder kurzen Fachtexten darstellen (K3). Kompetenzbereich Bewertung: bei Bewertungen in naturwissenschaftlich-technischen Zusammenhängen Bewertungskriterien angeben und begründet gewichten (B 1). für Bewertungen in chemischen und anwendungsbezogenen Zusammenhängen kriteriengeleitet Argumente abwägen und einen begründeten Standpunkt beziehen (B 2). Inhaltsfeld: Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen Inhaltliche Schwerpunkte: Organische (und anorganische) Kohlenstoffverbindungen Zeitbedarf: ca. 38 Std. à 45 Minuten
Einführungsphase – Unterrichtsvorhaben IV
Kontext: Vom Alkohol zum Aromastoff
Inhaltsfeld: Kohlenstoffverbindungen und Gleichgewichtsreaktionen
Inhaltliche Schwerpunkte: Schwerpunkte übergeordneter Kompetenzerwartungen:
Organische (und anorganische) Kohlenstoffverbindungen UF1 – Wiedergabe
Zeitbedarf: UF2 – Auswahl
36 Std. a 45 Minuten UF3 – Systematisierung
E2 – Wahrnehmung und Messung
E4 – Untersuchungen und Experimente
K2 – Recherche
K3 – Präsentation
B1 – Kriterien
B2 – Entscheidungen
Basiskonzepte (Schwerpunkte):
Basiskonzept Struktur-Eigenschaft
Basiskonzept Donator-Akzeptor
Sequenzierung inhaltli- Konkretisierte Kompetenzerwartungen Lehrmittel/ Materialien/ Methoden Verbindliche Abspra-
cher Aspekte des Kernlehrplans chen
Die Schülerinnen und Schüler... Didaktisch-methodische
Anmerkungen
Wenn Wein umkippt erklären die Oxidationsreihen der Alkohole Diagnose: Anknüpfung an Vorwissen, Inter- Diagnose: Begriffe, die
Oxidation von Ethanol auf molekularer Ebene und ordnen den essen und persönlichen Erfahrungen mit Al- aus der S I
zu Atomen Oxidationszahlen zu (UF2). kohol und alkoholischen Getränken, evtl. un- bekannt sein müssten:
Ethansäure beschreiben Beobachtungen von ter Einbeziehung ext. Fachleute funktionelle
Aufstellung des Experimenten zu Oxidationsreihen der Gruppen, Hydroxylgruppe,
Redoxschemas unter Alkohole und interpretieren diese unter Erarbeitung: intermolekulare Wechsel-
Verwendung von dem Aspekt des Donator-Akzeptor- 1.Alkanole: wirkungen,
Oxidationszahlen Prinzips (E2, E6). - Erarbeitung der Oxidationsreihe anhand ex- Redoxreaktionen, Elektro-
Regeln zum Aufstellen perimenteller Beispiele oder entsprechender nendonator
von Redoxschemata Arbeitsmaterialien / -akzeptor, Elektronegati-
- Weitere Eigenschaften vität,
- Nomenklatur Säure, saure Lösung.
Alkohol im menschli- dokumentieren Experimente in Wirkung von Alkohol Wiederholung: Redoxre-
chen angemessener Fachsprache (u.a. zur aktionen
23Körper Untersuchung der Eigenschaften organi- Ethanal als scher Zwischenprodukt der Verbindungen, zur Einstellung Oxidation einer Gleichgewichtsreaktion, zu Stoffen Nachweis der Alkanale und Reaktionen eines natürlichen Vertiefung möglich: Es- Biologische Wirkungen Kreislaufs). (K1) sigsäure oder des Alkohols zeigen Vor- und Nachteile ausgewählter Milchsäuregärung. Berechnung des Produkte des Alltags (u.a. Aromastoffe, Blutalkoholgehaltes Alkohole) und ihrer Anwendung auf, Alkotest mit dem gewichten diese und beziehen begründet Drägerröhrchen Stellung zu deren Einsatz (B1, B2). (fakultativ) Ordnung schaffen: nutzen bekannte Atom- und Bindungsmo- Wiederholung: Elektro- Einteilung organischer delle negativität, Verbindungen in zur Beschreibung organischer Moleküle Atombau, Bindungslehre, Stoffklassen und Kohlenstoffmodifikationen (E6). intermolekulare Wechsel- Alkane und Alkohole wirkungen als benennen ausgewählte organische Ver- Lösemittel bindungen Löslichkeit mithilfe der Regeln der systematischen funktionelle Gruppe Nomenklatur (IUPAC) (UF3). intermolekulare Wechselwirkungen: van- ordnen organische Verbindungen der- aufgrund ihrer funktionellen Gruppen in Waals Ww. und Stoffklassen ein (UF3). Wasserstoffbrücken homologe Reihe und erklären an Verbindungen aus den physikalische Stoffklassen der Alkane und Alkene das Eigenschaften C-C-Verknüpfungsprinzip (UF2). Nomenklatur nach IU- PAC beschreiben den Aufbau einer homologen Formelschreibweise: Reihe und die Strukturisomerie (Gerüstiso- Verhältnis-, Summen-, merie und Positionsisomerie) am Beispiel Strukturformel der Alkane und Alkohole.(UF1, UF3)
Verwendung erläutern ausgewählte Eigenschaften
ausgewählter Alkohole organischer Verbindungen mit Wechsel-
wirkungen
zwischen den Molekülen (u.a.
Wasserstoffbrücken, van-der-Waals-
Kräfte) (UF1, UF3).
beschreiben und visualisieren anhand 2. Oxidationsprodukte der Alkanole
Alkanale, Alkanone geeigneter Anschauungsmodelle die ggf. Wiederholung: Säu-
und Strukturen organischer Verbindungen z.B. Gruppenarbeit: ren und saure
Carbonsäuren – (K3). Darstellung von Isomeren mit Lösungen.
Oxidationsprodukte Molekülbaukästen.
der wählen bei der Darstellung chemischer
Alkanole Sachverhalte die jeweils angemessene z.B S-Exp./AB:
Oxidation von Propanol Formelschreibweise aus (Verhältnisformel, Lernzirkel Carbonsäuren.
Unterscheidung primä- Summenformel, Strukturformel) (K3).
rer,
sekundärer und tertiärer beschreiben den Aufbau einer homologen
Alkanole durch ihre Reihe und die Strukturisomerie (Gerüstiso-
Oxidierbarkeit merie
Gerüst- und und Positionsisomerie) am Beispiel
Positionsisomerie am der Alkane und Alkohole.(UF1, UF3)
Bsp. der Propanole
Molekülmodelle
Homologe Reihen der
Alkanale, Alkanone und
Carbonsäuren
Nomenklatur der
Stoffklassen und
funktionellen Gruppen
Eigenschaften und
Verwendungen
Gaschromatographie erläutern die Grundlagen der Entstehung 4. Gaschromatographie:
zum eines Gaschromatogramms und
Nachweis organischer entnehmen diesem Informationen zur Animation
25Stoffe Identifizierung eines Stoffes (E5). Virtueller Gaschromatograph.
Aufbau und Funktion
eines Gaschromatogra- nutzen angeleitet und selbständig Arbeitsblatt:
phen chemiespezifische Tabellen und Grundprinzip eines
Identifikation der In- Nachschlagewerke zur Planung und Aus- Gaschromatopraphen: Aufbau
haltstoffe alkolischerGe- wertung von Experimenten und zur und Arbeitsweise
tränke durch Ermittlung von Stoffeigenschaften. (K2). Gaschromatogramme von
Auswertung von Weinaromen.
Gaschromatogrammen beschreiben Zusammenhänge zwischen
Vorkommen, Verwendung und
Synthese von Eigenschaften wichtiger Vertreter der 4.Stoffklasse der Ester
Aromastoffen und Vor- Stoffklassen der Alkohole, Aldehyde,
und Nachteile Ketone, Carbonsäuren und Ester (UF2).
künstlicher Aromastof- Anwendung:
fe: ordnen Veresterungsreaktionen dem
Beurteilung der Verwen- Reaktionstyp der Kondensationsreaktion Synthese von Aromastoffen
dung begründet zu (UF1). Vor- und Nachteile künstlicher
von Aromastoffen, z.B. Obstaromen in Joghurt,
von führen qualitative Versuche unter künstlicher Käseersatz auf
künstlichen Aromen in vorgegebener Fragestellung durch und Pizza, etc..
Joghurt oder Käseersatz protokollieren die Beobachtungen (u.a.
zur Untersuchung der Eigenschaften
organischer Verbindungen) (E2, E4).
Stoffklassen der Ester:
funktionelle Gruppen stellen anhand von Strukturformeln
Stoffeigenschaften Vermutungen zu Eigenschaften
- Struktur-Eigen- ausgewählter Stoffe auf und schlagen ge-
schaftsbeziehun- eignete Experimente zur Überprüfung
gen vor (E3).
erklären an Verbindungen aus den
Stoffklassen der Alkane und Alkene das
C-C-Verknüpfungsprinzip (UF2).
analysieren Aussagen zu Produkten derorganischen Chemie (u.a. aus der Wer-
bung)
im Hinblick auf ihren chemischen
Sachverhalt und korrigieren unzutreffende
Aussagen sachlich fundiert (K4).
zeigen Vor- und Nachteile ausgewählter
Produkte des Alltags (u.a. Aromastoffe,
Alkohole) und ihrer Anwendung auf,
gewichten diese und beziehen begründet
Stellung zu deren Einsatz (B1, B2).
Eigenschaften, Struk- recherchieren angeleitet und unter Anwendung: Bei den Ausarbeitungen
turen vorgegebenen Fragestellungen die Recherche und Präsentation soll die
und Verwendungen Eigenschaften und Verwendungen (z.B. als Poster oder Vielfalt der Verwendungs-
organischer Stoffe ausgewählter Stoffe und präsentieren die Kurzvortrag): möglichkeiten
Rechercheergebnisse adressatengerecht Eigenschaften und Verwendung von organischen Stoffen
(K2,K3). organischer Stoffe. unter
Bezugnahme auf deren
beschreiben Zusammenhänge zwischen funktionelle
Vorkommen, Verwendung und Gruppen und Stoffeigen-
Eigenschaften wichtiger Vertreter der schaften
Stoffklassen der Alkohole, Aldehyde, dargestellt werden.
Ketone, Carbonsäuren und Ester (UF2). Mögliche Themen:
Ester als Lösemittel für
Klebstoffe
und Lacke.
Aromastoffe (Aldehyde
und
Alkohole) und Riechvor-
gang;
Carbonsäuren: Antioxi-
dantien
(Konservierungsstoffe)
Weinaromen: Abhängig-
keit von
27Rebsorte oder Anbauge-
biet.
Terpene (Alkene) als se-
kundäre Pflanzenstoffe
Fakultativ: führen qualitative Versuche unter z.B. S-Exp. zur Extraktion von Ggf. Exkursion ins Duftla-
Herstellung eines Parf- vorgegebener Fragestellung durch und Aromastoffen bor
ums protokollieren die Beobachtungen (u.a.
Duftpyramide zur Untersuchung der Eigenschaften
Duftkreis organischer Verbindungen) (E2, E4).
Extraktionsverfahren
Leitungsbewertung:
Siehe Punkt
Hinweise:
Internetquelle zum Download von frei erhältlichen Programmen zur Erstellung von Mind- und Concept Mapps:
http://www.lehrer-online.de/mindmanager-smart.php
http://cmap.ihmc.us/download/
Material zur Wirkung von Alkohol auf den menschlichen Körper: www.suchtschweiz.ch/fileadmin/user_upload/.../alkohol_koerper.pdf
Film zum historischen Alkotest der Polizei (Drägerröhrchen):
http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/16/oc/alkoholtest/alkoholtest.vlu/Page/vsc/de/ch/16/oc/alkoholtest/02_kaliumdichromatoxidati-
on.
vscml.html
Film zur künstlichen Herstellung von Wein und zur Verwendung künstlich hergestellter Aromen in Lebensmitteln, z.B. in Fruchtjoghurt:
http://medien.wdr.de/m/1257883200/quarks/wdr_fernsehen_quarks_und_co_20091110.mp4
Animation zur Handhabung eines Gaschromotographen: Virtueller Gaschromatograph:
http://www.chemgapedia.de/vsengine/vlu/vsc/de/ch/3/anc/croma/virtuell_gc1.vlu.html
Gaschromatogramme von Weinaromen und weitere Informationen zu Aromastoffen in Wein:
http://www.forschung-frankfurt.uni-frankfurt.de/36050169/Aromaforschung_8-15.pdf
http://www.analytik-news.de/Fachartikel/Volltext/shimadzu12.pdf
http://www.lwg.bayern.de/analytik/wein_getraenke/32962/linkurl_2.pdf2.1.6 Grundkurs Qualifikationsphase Q 1 – Unterrichtsvorhaben V
Kontext: Strom für Taschenlampe und Mobiltelefon
Basiskonzepte (Schwerpunkt):
Chemisches Gleichgewicht
Donator-Akzeptor
Energie
Schwerpunkte übergeordneter Kompetenzerwartungen:
Die Schülerinnen und Schüler können
Kompetenzbereich Umgang mit Fachwissen:
Phänomene und Sachverhalte im Zusammenhang mit Theorien, übergeordneten
Prinzipien und Gesetzen der Chemie beschreiben und erläutern (UF1)
zur Lösung chemischer Probleme zielführende Definitionen, Konzepte so-
wie funktionale Beziehungen zwischen chemischen Größen angemessen
und begründet auswählen (UF2)
chemische Sachverhalte und Erkenntnisse nach fachlichen Kriterien ordnen und
strukturieren (UF3)
Zusammenhänge zwischen unterschiedlichen natürlichen bzw. technischen
Vorgängen auf der Grundlage eines gut vernetzten chemischen Wissens er-
schließen und aufzeigen (UF4).
Kompetenzbereich Erkenntnisgewinnung:
selbstständig in unterschiedlichen Kontexten chemische Probleme identifi-
zieren, analysieren und in Form chemischer Fragestellungen präzisieren
(E1)
komplexe Apparaturen für Beobachtungen und Messungen erläutern und sachge-
recht verwenden(E2)
mit Bezug auf Theorien, Konzepte, Modelle und Gesetzmäßigkeiten auf deduktive
Weise Hypothesen generieren sowie Verfahren zu ihrer Überprüfung ableiten(E3)
Experimente mit Bezug auf ihre Zielsetzungen erläutern und diese zielbezogen
unter Beachtung fachlicher Qualitätskriterien einschließlich der Sicherheitsvor-
schriften durchführen oder deren Durchführung beschreiben (E4)
Daten/Messwerte qualitativ und quantitativ im Hinblick auf Zusammenhän-
ge, Regeln oder auch mathematisch zu formulierende Gesetzmäßigkeiten
analysieren und Ergebnisse verallgemeinern (E5)
Modelle entwickeln sowie mithilfe von theoretischen Mo-dellen, mathematischen
Modellierungen, Gedankenexperimenten und Simulationen chemische Prozesse
erklären oder vorhersagen, (E6).
bedeutende naturwissenschaftliche Prinzipien reflektieren sowie Veränderungen
in Denk- und Arbeitsweisen in ihrer historischen und kulturellen Entwicklung dar-
stellen (E7)
Kompetenzbereich Kommunikation:
bei der Dokumentation von Untersuchungen, Experi-menten, theoretischen
Überlegungen und Problemlö-sungen eine korrekte Fachsprache und fachübliche
Darstellungsweisen verwenden (K1),
zu chemischen und anwendungsbezogenen Fragestellungen relevante
Informationen und Daten in verschiedenen Quellen, auch in ausgewählten
29wissenschaftlichen Publikationen, recherchieren, auswerten und
vergleichend beurteilen (K2)
chemische Sachverhalte und Arbeitsergebnisse unter Verwendung
situationsangemessener Medien und Dar-stellungsformen adressatengerecht
präsentieren (K3)
sich mit anderen über chemische Sachverhalte und Erkenntnisse kritisch-
konstruktiv austauschen und dabei Behauptungen oder Beurteilungen
durch Argumente belegen bzw. widerlegen (K4).
Kompetenzbereich Bewertung:
fachliche, wirtschaftlich-politische und ethische Maßstäbe bei Bewertungen
von naturwissenschaftlich-technischen Sachverhalten unterscheiden und
angeben (B1).
Auseinandersetzungen und Kontroversen zu chemischen und anwendungsbezo-
genen Problemen differenziert aus verschiedenen Perspektiven darstellen und ei-
gene Standpunkte auf der Basis von Sachargumenten vertreten (B2)
an Beispielen von Konfliktsituationen mit chemischen Hintergründen kontroverse
Ziele und Interessen sowie die Folgen wissenschaftlicher Forschung aufzeigen
und ethisch bewerten(B3),
begründet die Möglichkeiten und Grenzen chemischer und anwendungsbe-
zogener Problemlösungen und Sichtweisen bei innerfachlichen, naturwis-
senschaftlichen und gesellschaftlichen Fragestellungen bewerten (B4).
Inhaltsfeld: Elektrochemie
Inhaltliche Schwerpunkte:
Mobile Energiequellen
Elektrochemische Gewinnung von Stoffen
Quantitative Aspekte elektrochemischer Prozesse
Zeitbedarf: ca. 36 Std. à 45 MinutenQ1 Grundkurs – Unterrichtsvorhaben V
Kontext: Elektroautos – Fortbewegung mithilfe elektrochemischer Prozesse
Inhaltsfeld: Elektrochemie
Inhaltliche Schwerpunkte: Schwerpunkte übergeordneter Kompetenzerwartungen:
Mobile Energiequellen UF2 Auswahl
Elektrochemische Gewinnung von Stoffen UF4 Vernetzung
Quantitative Aspekte elektrochemischer Prozesse E1 Probleme und Fragestellungen
E5 Auswertung
K2 Recherche
K4 Argumentation
Zeitbedarf: ca. 36 Stunden à 45 Minuten B1 Kriterien
B4 Möglichkeiten und Grenzen
Basiskonzepte (Schwerpunkte):
Chemisches Gleichgewicht
Donator-Akzeptor,
Energie
Sequenzierung inhaltli- Konkretisierte Kompetenzerwartungen Lehrmittel/ Materialien/ Methoden Verbindliche Absprachen
cher Aspekte des Kernlehrplans Didaktisch-methodische
Die Schülerinnen und Schüler … Anmerkungen
Mobile Energiequellen für Bilder, Texte oder Filme zur mobilen Aufriss der Unterrichtsreihe
Mobiltelefon und Co. erklären den Aufbau und die Funktions- Energieversorgung oder aktuelle As- Internetrecherche oder Aus-
Daniell –Element weise einer galvanischen Zelle (u.a. Dani- pekte wertung vorgegebener Mate-
Akkumulatoren ell-Element) (UF1, UF3), rialien der Lehrkraft
Brennstoffzelle
beschreiben den Aufbau einer Standard- Beschreibung und Auswertung ei- Beschreibung der Teile und
Wasserstoff-Halbzelle (UF1), ner schematischen Darstellung zum des Aufbaus eines Akkumu-
Aufbau eines Daniell-Elementes lators (z.B. Bleiakkumulator);
(möglicherweise experimentell) Vermutungen über die Funk-
berechnen Potentialdifferenzen unter Nut-
tion der Teile
zung der Standardelektrodenpotentiale
(Exp.) Ermittlung der elektrochemi-
und schließen auf die möglichen Redox- schen Spannungsreihe (Metalle / Aufgreifen und Vertiefen der
reaktionen (UF2, UF3), Nichtmetalle) Begriffe: Anode, Kathode,
31erweitern die Vorstellung von Redoxreak- galvanisches Element, Re-
tionen, indem sie Oxidatio-nen/Reduktio- Beschreibung des Aufbaus einer aus- doxreaktion; Elektrolyse
nen auf der Teilchenebene als Elektro- gewählten Batterie und Identifizierung Selbstständige Partnerarbeit
nen-Donator-Akzeptor-Reaktionen inter- der Elemente einer Galvanischen Zel- oder Gruppenarbeit, Vorstel-
pretieren (E6, E7), le. len der Ergebnisse in Kurz-
vorträgen
entwickeln Hypothesen zum Auftreten Experiment: Der Lade/ Entladevor-
von Redoxreaktionen zwischen Metallato- gang am Beispiel des Zinkiod-Akku-
men und Metallionen (E3), mulators
Umkehrbarkeit von Redoxreaktionen
Alltagsbezug deutlich ma-
stellen Oxidation und Reduktion als Teil- Recherche zum schematischen Auf- chen.
reaktionen und die Redoxreaktion als Ge- bau und Prinzip der Reaktionsabläufe
samtreaktion übersichtlich dar und be- beim Laden und Entladen eines Akku-
schreiben und erläutern die Reaktionen mulators (z.B Lithium-Ionen-Akkumu-
fachsprachlich korrekt (K3), lator) in Partnerarbeit/Gruppenarbeit
im Internet oder mithilfe von der Lehr-
erklären Aufbau und Funktion elektroche- kraft bereitgestellten Materialien
mischer Spannungsquellen aus Alltag
und Technik (Batterie, Akkumulator, Diskussion der Vorzüge und Nachtei-
Brennstoffzelle) unter Zuhilfenahme le der gewählten Akkumulatoren
grundlegender Aspekte galvanischer Zel-
len (u.a. Zuordnung der Pole, elektroche- Erarbeitung des Aufbaus einer Brenn-
mische Redoxreaktion, Trennung der stoffzelle mit entsprechenden Informa- Alternative Energiequellen
Halbzellen) (UF4), tionsmaterial (Einsatz eines Modells aufzeigen
möglich/ ggf. Exp. Elektrolyse von an-
gesäuertem Wasser) im Hinblick auf
recherchieren Informationen zum Aufbau Aufbau und Reaktionsabläufe
mobiler Energiequellen und präsentieren
mithilfe adressatengerechter Skizzen die
Funktion wesentlicher Teile sowie Lade-
und Entladevorgänge (K2, K3), Aufnahme /Betrachtung einer Strom-
stärke-Spannungskurve, Grafische Er-
planen Experimente zum Aufbau galvani- mittlung der Zersetzungsspannung
scher Zellen, ziehen Schluss-folgerungen Anlage einer übersichtlichenaus den Messergebnissen und leiten dar- Lehrerdemonstrationsexperiment Wertetabelle, grafische Aus-
aus eine Spannungsreihe ab (E1, E2, E4, oder entsprechendes Material : wertung, Schüler- oder Leh-
E5), Geeignetes Beispiel zur Bestimmung rerexperiment
der Faraday-Konstante
dokumentieren Versuche zum Aufbau
von galvanischen Zellen und Elektrolyse- Lehrervortrag / Selbstständige Erar- Sammeln und Bewerten von
beitung mithilfe von Informations- Argumenten
zellen übersichtlich und nachvollziehbar
material
(K1),
Formulierung der Faraday-Gesetze
Rechnerische Übungen mit ausge-
beschreiben und erklären Vorgänge bei wählten Aufgaben zu Faraday- Geset-
einer Elektrolyse (u.a. von Elektrolyten in zen
wässrigen Lösungen) (UF1, UF3),
Diskussion
deuten die Reaktionen einer Elektrolyse In wie weit können Akkumulator und
als Umkehr der Reaktionen eines galvani- Brennstoffzelle zur zukünftigen und
schen Elements (UF4), nachhaltigen Energieversorgung bei-
tragen?
erläutern die Umwandlung von chemi-
scher Energie in elektrische Energie und
deren Umkehrung (E6),
erläutern die bei der Elektrolyse notwen-
dige Zersetzungsspannung unter Berück-
sichtigung des Phänomens der Über-
spannung (UF2),
analysieren und vergleichen galvanische
Zellen bzw. Elektrolysen unter energeti-
schen und stofflichen Aspekten (E1, E5).
argumentieren fachlich korrekt und folge-
richtig über Vorzüge und Nachteile unter-
schiedlicher mobiler Energiequellen und
33wählen dazu gezielt Informationen aus (K4). erläutern und beurteilen die elektrolyti- sche Gewinnung eines Stoffes aus öko- nomischer und ökologischer Perspektive (B1, B3), erläutern den Aufbau und die Funktionswei- se einer Wasserstoff-Brennstoffzelle (UF1, UF3). vergleichen und bewerten innovative und herkömmliche elektrochemische Energie- quellen (u.a. Wasserstoff-Brennstoffzelle) (B1), diskutieren die gesellschaftliche Relevanz und Bedeutung der Gewinnung, Speiche- rung und Nutzung elektrischer Energie in der Chemie (B4), erläutern und berechnen mit den Fara- day-Gesetzen Stoff- und Ener-gieumsät- ze bei elektrochemischen Prozessen (UF2), schließen aus experimentellen Daten auf elektrochemische Gesetzmäßigkeiten (u.a. Faraday-Gesetze) (E6). werten Daten elektrochemischer Untersu- chungen mithilfe der Faraday-Gesetze aus (E5).
Sie können auch lesen