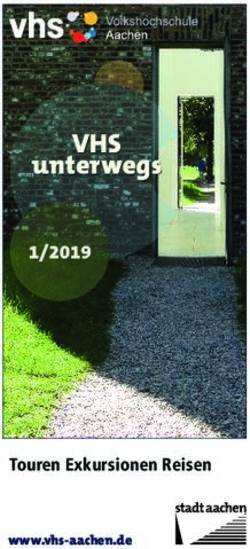Der Ruf nach Gerechtigkeit - 23 MÄRZ - 24 JUNI 2018 - Hof van Busleyden
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
KUNST UND RECHTSPRECHU NG IN DE N N IEDERL A N DEN (14 5 0 -1 6 5 0) Recht und Unrecht sind ein häufig vorkommendes Motiv in der Blütezeit der niederländischen Kunst im 15., 16. und 17. Jahrhundert. Die Herzöge von Burgund wollten aus ihren Besitztümern in den Niederlanden eine politische Einheit machen, was tiefgreifende Veränderungen im Rechtssystem zur Folge hatte. Es wurden zentrale Gerichte wie der Große Rat von Mechelen eingerichtet, die die Autorität der lokalen Gerichte einschränkten. Die Rechtsprechung wurde professioneller, aber auch umständlicher und weniger zugänglich. Die Entdeckung der Neuen Welt, der Aufstand der Niederlande und die Spanische Inquisition gingen mit schrecklichen Gräueltaten einher. Andere und Andersdenkende wurden hart bestraft. So gut wie alle bedeutenden Maler aus dieser Zeit - von Rogier van der Weyden bis Antoon van Dyck und Rembrandt - befassten sich auf ihren Werken mit Themen wie Recht, Unrecht und Rechtsprechung. Sie verwendeten dazu inspirierende Beispiele gerechten Verhaltens aus Geschichten der Bibel, sowie aus Allegorien, der Mythologie und der Geschichte. Ihre Kunstwerke zeigen, wie Verbrechen bestraft wurden und schenken Trost bei Unrecht. Zeitgenössischer Missbrauch wird verspottet und angeklagt. Die Kunstwerke über Recht und Unrecht schmückten Rathäuser und Kirchen, drangen aber vor allem über Bücher und Kupferstiche auch in die Privatsphäre ein.
1. Maarten de Vos
Das Gericht der Brabanter Münze
1594 – KBC Snijders&Rockoxhuis, Antwerpen
© KBC Antwerpen Snijders&Rockoxhuis
F R AU J US T I T I A Dieses Gemälde kann buchstäblich als Einleitung in die Rechtsikonografie des 16.
Jahrhunderts betrachtet werden. In der Mitte steht Frau Justitia, links sehen wir Moses und
den byzantinischen Kaiser Justinianus, rechts den römischen König Numa Pompilius und
Kein einziges Bild ist so eng mit der Idee der Gerechtigkeit verbunden wie Frau Justitia. Sie neben ihm möglicherweise Plinius den Älteren. Moses, Justinianus und Numa spielten eine
wurde auf dem Gemälde von Maarten de Vos, sicher nicht rein zufällig sehr prominent in der wichtige Rolle bei der schriftlichen Niederlegung des Rechts. Der Schriftsteller Plinius schrieb
Mitte dargestellt. Justitia ist bereits seit der Antike eine wichtige Tugend, die als Inspirations- über die Entstehung des Geldes. Seine Werke galten als Musterbeispiel für die Herren im Hin-
quelle des menschlichen Handelns dient. Ab dem 16. Jahrhundert verkörpert sie auch die tergrund: die Mitglieder des Gerichtes der Brabanter Münze, die die finanziellen Angelegen-
Rechtsprechung an sich. Bis heute prangen Skulpturen der Justitia auf Gerichtsgebäuden in heiten in Brabant überwachten. Das Gemälde hing in ihrem Gerichtssaal.
der ganzen westlichen Welt.
Detail:
Justitia ist eine allegorische Figur. An ihrem Aussehen und ihren Attributen lässt sich ablesen,
Moses hält die Steintafeln mit den 10 Geboten. Der Text auf den Tafeln wurde auf Hebräisch,
was man unter Rechtsprechung versteht. Die Waage verweist auf das sorgfältige gegeneinan-
der ursprünglichen Sprache des Alten Testaments, verfasst. Zu lesen ist hier übrigens wirklich
der Abwägen von Argumenten für und wider etwas. Das Schwert symbolisiert die Entschlos- fehlerfreies Hebräisch. De Vos ließ sich dabei wahrscheinlich von Ludovicus Nonnius, einem
senheit. Die Augenbinde verdeutlicht, dass Justitia ohne Ansehen der Person urteilt. sephardischen Juden aus Antwerpen helfen, der sich zum Katholizismus bekehrt hatte.
Diese Attribute findet man jedoch nicht nur bei Justitia, sondern auch bei christlichen Figuren
wie Judith, Synagoge oder dem Erzengel Michael. Auch die Bedeutung der Justitia steht nicht
genau fest. Die Augenbinde galt ursprünglich sogar als Symbol der Verhinderung der Rechts-
rechung.2. Robert Péril
Stammbaum des Hauses Habsburg: die vier
Kardinaltugenden
1540 – Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett
In den Zweigen eines Baumes sitzen die vier Kardinaltugenden. Justitia (Gerechtigkeit) sitzt
links oben und ist an ihrem Schwert und der Waage zu erkennen. Prudentia (Weisheit) hält
rechts oben ihr Buch und ihren Spiegel in der Hand. Links unten sehen Sie Fortitudo
(Tapferkeit) mit dem Löwen und rechts unten Temperantia (Mäßigung) erkennbar an den
miteinander verschlungenen Schlangen. Es handelt sich hier um das oberste Blatt des 21 Seiten
zählenden Stammbaums des Hauses Habsburg. Deshalb prangt sein Wappen auch in der Mitte
des Baumwipfels. Fürstenhäuser legitimierten sich oft, indem sie ihre Herkunft soweit wie
möglich in die Vergangenheit zurückverfolgten, oft bis hin zu einem legendären Herrscher.
In diesem Fall ist es der fränkische König Pharamond.
3.
Justitia
In: Gregorius Reisch, Margerita philosophica, fol. 312v
1505 – Universitätsbibliothek Gent
© Universiteitsbibliotheek Gent, BHSL.HS.0007
Auf einem Thron sitzt eine Frau, die ein Schwert und ein Buch in den Händen hält. Der Über-
schrift zufolge handelt es sich dabei um Justitia, die hier jedoch noch ohne die typische Augen-
binde dargestellt wird. Zwei sogenannte exempla justitiae bzw. Beispiele der Gerechtigkeit
flankieren sie: Links erkennt man Salomons Urteil und rechts das Urteil des Trajanus. Beide
Geschichten werden Ihnen im Verlauf der Ausstellung noch begegnen. Sie sehen hier eine
Abbildung aus der Margerita Philosophica, einem Handbuch der Philosophie. Diese Fassung
des Buchs ist aufgrund der seitengroßen Illustrationen besonders schön. Sie stellen u. a. die
Kardinaltugenden dar. Dabei darf natürlich auch Justitia nicht fehlen.
Detail:
Der Künstler erzeugt auf subtile Weise eine Einheit zwischen den verschiedenen Szenen auf
diesem Blatt. So trägt beispielsweise Salomon genau wie Frau Justitia ein goldfarbenes, mit
Hermelin abgesetztes Gewand. Auch den roten Baldachin über Justitias Thron findet man in der
Szene mit der Geschichte Salomons wieder, der dadurch auf diesem Stich direkt mit der Tugend
Justitia in Verbindung gebracht wird.4. Manselmeester und Simon Marmion 6.
Meister des Jean Mansel und Simon Marmion Justitia und Prudentia
In: Jean Mansel, La fleur des histoires, 1454 en 1467, fol. 448v In: Leonardus Lessius, De justitia et jure. Leuven: Jan Maes, 1605, Titelseite
Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel KU Leuven Bibliotheken - Maurits Sabbebibliotheek, Leuven
Jean Mansel war ein Funktionär am burgundischen Hof. Er fasste unter dem Titel La fleur des Im 16. und 17. Jahrhundert stellten immer mehr Intellektuelle die jahrhundertealte Tugend-
histoires verschiedene Texte zu einer Weltgeschichte zusammen. Das Buch war sehr beliebt. lehre der mittelalterlichen Scholastik in Frage, die auf strikter Treue gegenüber maßgeblichen
Dieses reich illustrierte Exemplar gehörte dem burgundischen Herzog Philipp dem Guten. Schriften beruhte. In De justitia et jure (Über die Gerechtigkeit und Recht) fragt sich der
Auf dieser Miniatur sitzen die vier Kardinaltugenden jeweils unter einem Baldachin. Von links Jesuit Leonardus Lessius, wie die traditionelle kirchliche Lehre mit einem blühenden Handel
nach rechts sehen Sie: Justitia mit Waage und Schwert, Temperantia mit einen Sieb und einem zu vereinbaren sei. Er betont dabei die Vernünftigkeit und Ausgewogenheit von Handels-
Sack Geld, Prudentia, die ein Kästchen bewacht, und Fortitudo mit Turm, die einen Drachen transaktionen. Deshalb schaut Justitia auf dieser Titelseite auf ihre Waage. Außerdem mahnt
in Schach hält. Die Miniaturen in dieser Luxushandschrift stammen von dem berühmten Lessius zu Vorsicht und Weisheit. Die Prudentia mit dem Spiegel erhält deshalb einen ebenso
Simon Marmion und einem Miniaturmaler, der als Mansel-Meister bezeichnet wird. prominenten Platz wie die Justitia. Die anderen Kardinaltugenden (Tapferkeit und Mäßigung)
werden kleiner dargestellt.
5. Jacob Matham (zugeschrieben), Hendrick Goltzius (nach)
Die sieben Tugenden
1588 – Rijksmuseum, Amsterdam
Diese eleganten Frauen verkörpern die sieben Tugenden und wurden mit ihren symbolischen
Attributen dargestellt. Wir sehen von links nach rechts: die Hoffnung (Spes) mit Fesseln, die
Weisheit (Prudentia) mit Spiegel und Schlange, den Glauben (Fides) mit Kreuz und Kelch,
die Nächstenliebe (Caritas) mit zwei kleinen Kindern, die Gerechtigkeit (Justitia) mit Waage
und Schwert, die Tapferkeit (Fortitudo) mit einer Säule und die Mäßigung (Temperantia),
die Wasser in den Wein gießt. Hoffnung, Glaube und Nächstenliebe sind die theologischen
Tugenden. Weisheit, Tapferkeit, Mäßigung und Gerechtigkeit die Kardinaltugenden. Justitia,
die bereits seit Aristoteles oft als wichtigste Tugend betrachtet wird, ragt ein wenig über die
anderen hinaus.7. Peter Paul Rubens 8.
Astraea, Prudentia und Cornucopia Judith enthauptet Holofernes
In: Leonardus Lessius, De justitia et jure. Antwerpen: Officina Plantiniana, 17. Jahrhundert – Grootseminarie, Mechelen
1621, Titelseite
Eine mit Juwelen geschmückte junge Frau in verführerischen Gewändern hält in der rechten
KU Leuven Bibliotheken - Maurits Sabbebibliotheek, Leuven
Hand ein Schwert und in der linken einen abgeschlagenen Kopf. Es handelt sich hier um eine
© KU Leuven Bibliotheken – Maurits Sabbebibliotheek, 2-002654/D
Szene aus dem Alten Testament: Die israelitische Judith hat den assyrischen Oberbefehlsha-
In 1617 entwarf Rubens eine neue Titelseite für Lessius Werk De justitia et jure und stellte ber Holofernes verführt und in seinem Zelt enthauptet. Er muss für die harte Belagerung von
darauf die Justitia als Astraea dar. Sie ist die griechische Göttin der Gerechtigkeit und wird Judiths Heimatstadt Betulis büßen. Judith hat hier eine gewisse Ähnlichkeit mit Justitia. Beide
mit dem Sternzeichen Jungfrau assoziiert. Hier steht sie zwischen den Sternzeichen Löwe und werden immer wieder mit einem Schwert als Attribut dargestellt. Die Frage, ob die blutige Tat
Waage, die auch das Recht symbolisieren. Der Löwe verweist auf die tatkräftige Justitia. Links Judiths ein gerechtes Urteil ist, kann als Diskussionsstoff dienen.
erkennt man die Vorsicht, Prudentia, mit einer Schlange. Die vielbrüstige Cornucopia, die Ver-
körperung des Überflusses, trägt ein Füllhorn.
9. Maarten van Heemskerck
Detail: Justitia
Lessius zufolge sollte der Mensch versuchen, seine Triebe zu beherrschen. Deshalb findet man 1556 – Städel Museum, Frankfurt am Main
hier unter den Tugenden zwei gefesselte Personifikationen. Links sitzt die Blinde Gewalt und
rechts die Wollust, dargestellt als Satyr. Bei der Blinden Gewalt fällt auf, dass die Augenbinde Diese weibliche Personifikation mit einem Schwert, einer Waage und einer Augenbinde lässt
genau wie bei einigen frühen Darstellungen der Justitia eine negative Bedeutung erhält. Diese sich unschwer als Justitia identifizieren. Mit der Augenbinde stimmt jedoch etwas nicht. Sie
Personifikation finden wir auch auf dem Gemälde von Maarten de Vos für die Brabanter Münze. ist halb durchsichtig, sodass man die Konturen von Justitias Augen durch den Stoff erkennen
kann. Die Augenbinde der Justitia hat sich im Laufe der Zeit von einem negativen zu einem
positiven Symbol entwickelt, scheint hier aber noch eine doppelte Bedeutung zu haben. Boten
Zweideutigkeiten wie diese etwa Stoff für interessante Gespräche?10. Meester van de (Brugse) Legende van de heilige Ursula 13 – 14.
Die Synagoge Allegorie der Gerechtigkeit
1482 – Groeningemuseum, Brügge 17. Jahrhundert – Musée départemental de Flandre, Kassel
Diese Dame mit einer Augenbinde erinnert zwar an die Frau Justitia, ist es aber nicht. Die Szenen mit der Gerechtigkeit waren oft Bestandteil größerer dekorativer Darstellungen, die
Figur ist eine Personifikation der Synagoge - des Gebetshauses der Juden - und des Alten im Laufe der Zeit jedoch oft verschwunden sind. Diese beiden kleinen Tafelbilder befanden
Testaments. Sie hält in der einen Hand einen zerbrochenen Speer mit einer Fahne und in der sich im Holzwerk des Kasselrijhuis in Kassel, Frankreich. Das eine Bild zeigt eine dynamische
anderen die Steintafeln, die ihr fast entgleiten. Den Gegenpol zu dieser Synagoge bildet Justitia mit einer schmalen Augenbinde, einer Waage und einem Schwert. Auf dem anderen
Ecclesia, das Symbol der christlichen Kirche und des Neuen Testaments. Sie schaut meist mit Bild umarmt Justitia Pax (Frieden), die an ihrem Palmenzweig zu erkennen ist. Ihr Schwert
einem klaren Blick nach vorn, während die Synagoge in der Vergangenheit lebt, eine Augen- hat Justitia auf den Boden geworfen. Dort, wo Gerechtigkeit zu Frieden geführt hat, braucht
binde trägt und den Kopf nach unten senkt. In diesem Zusammenhang hat die Augenbinde man keine Waffen mehr.
somit eine negative Bedeutung.
15. Albrecht Dürer (zugeschrieben)
11.
Ein Narr bindet Justitia die Augenbinde um
Der heilige Michael als Seelenwäger In: Sebastian Brandt, Navis stultorum, oft, der sotten schip. Antwerpen
16. Jahrhundert – Privatsammlung, Niederlande Jan van Gelen, 1584, p. 144
Museum Plantin-Moretus, Antwerpen
Die Attribute der Frau Justitia sind nicht ohne Grund entstanden. Bei der Waage und dem
Schwert diente die traditionelle Darstellung des Erzengels Michael sicher als Inspirations- Justitia, die an ihrer Waage und dem Schwert zu erkennen ist, erhält von einem Narren, dem
quelle. Er wiegt beim Jüngsten Gericht mit seiner Waage die guten und die schlechten Taten Symbol der Torheit, eine Augenbinde. Es handelt sich hier um eine der ältesten Darstellungen
eines Menschen gegeneinander ab. Wenn die schlechten Taten zu schwer wiegen, muss dessen der Justitia mit einer Augenbinde, die hier noch eine deutlich negative Bedeutung hat. In Das
Seele sofort in die Hölle. Michael scheidet mit seinem Schwert die Seelen oder rückt Satan Narrenschiff nimmt Sebastian Brandt die Missstände seiner Zeit aufs Korn. Dieser Kupferstich
damit zu Leibe. In dieser Skulpturengruppe erscheint der Teufel in der Gestalt eines ist eine Illustration seiner Kritik auf endlose, unnütze und teure Prozesse. Auf dem Boden lie-
schrecklichen Drachen, der vom Erzengel Michael zerschmettert wird. gen Hecheln (niederl. hekels). Die kammartigen Geräte wurden für die Bearbeitung von Wolle
oder Flachs verwendet. Sie verweisen auf die niederländische Redewendung: „Iemand over de
hekel halen”, was soviel bedeutet wie: schlecht über jemanden sprechen.
12.
Allegorie von Frieden und Gerechtigkeit
um 1580 – Privatsammlung, Belgien
Die Darstellung von Justitia und Pax (Frieden), die einander küssen, ist auf Psalm 85 (Vers
11) zurückzuführen: „Es begegnen einander Huld und Treue; Gerechtigkeit und Friede küssen
sich.” Wir erkennen Justitias Schwert und den Olivenzweig des Friedens (Pax), die beiden
Attribute befinden sich jedoch bei der Frau links. Daher stellt sich die Frage, welche Figur nun
die Personifikation der Gerechtigkeit ist und welche den Frieden symbolisiert?
Ein beeindruckendes Thema für faszinierende Gespräche. Gemälde wie dieses waren deshalb
in gebildeten, humanistischen Kreisen sehr beliebt.16. Johann Theodor de Bry, Maarten van Heemskerck (nach) Justitia fällt von einem sich aufbäumenden Pferd 1611 – Rijksmuseum, Amsterdam Frau Justitia mit Schwert und Waage sitzt verkehrt herum auf einem sich aufbäumenden Pferd und droht herabzufallen. Es handelt sich hier um ein sogenanntes Emblem: einen Kupferstich, der mit einem Wahlspruch oder Lemma und einem Epigramm bzw. einem kurzen Gedicht versehen ist. Wie immer bei einem Emblem ist auch hier die Botschaft sehr moralisierend. In dem Epigramm, das hier verschwunden ist, wird die Welt mit einem sich aufbäumenden Pferd verglichen, das sich nicht darum kümmert, was sich ihm in den Weg stellt. In einer Welt, in der jeder nur die eigenen Interessen verfolgt und nach grenzenloser Freiheit strebt, geraten Gesetze und Gerechtigkeit in Bedrängnis. 17. Hermann tom Ring (zugeschrieben) Allegorie der Treulosigkeit 16. Jahrhundert - Museum van de stad Brussel - Broodhuis, Brüssel © Museum van de stad Brussel - Broodhuis Ab dem 16. Jahrhundert tauchten allerlei Variationen der traditionellen Darstellung der Jus- titia auf. Im vorliegenden Fall erscheint sie als attraktive Frau in verführerischen Gewändern, geschmückt mit kostbaren Juwelen. In der linken Hand hält sie eine Waage. Sie schaut den Betrachter direkt an, als wolle sie ihn mit einem dringenden Problem konfrontieren. Das Brüsseler Rathaus erhielt das Gemälde im 19. Jahrhundert als Geschenk. Nachdem es Jahrzehnte lang Hubert Goltzius zugeschrieben worden war, hält man es zurzeit für ein Werk des westfälischen Meisters Hermann tom Ring. Detail: Die Gegenstände auf der Waage können zur Entschlüsselung dieser Allegorie beitragen. Die kleinen Händchen in der rechten Waagschale haben die Form eines Händedrucks, eine der ältesten Formen der Besiegelung einer Vereinbarung. Eine kleine leichte Feder in der ande- ren Waagschale wiegt jedoch mehr als die Händchen. Der Maler prangert auf diese Weise die Leichtsinnigkeit an, mit der Menschen sich nicht an geschlossene Verträge und Vereinbarungen halten. Die Symbolik beruht auf einem Emblem des französischen Humanisten Guillaume de la Perrière.
18.
Chormantel mit dem Jüngsten Gericht
1. Hälfte des 16. Jahrhunderts – Sint-Amanduskerk, Hooglede
Auf die Vorderseite dieses liturgischen Gewands wurde eine Reihe von Szenen aus der
Genesis, dem ersten Buch der Bibel gestickt. Sie erzählen die Geschichte der ersten
BE I SPI E L E AUS DE R BI BE L Menschen: Adam und Eva und ihrer Söhne Kain und Abel. Die Geschichte handelt von der
Ungehorsamkeit gegenüber Gott und der Strafe, die man dafür erhält. Wir sehen u. a. Gott,
U N D DER A N TIK E der Adam und Eva verbietet, vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse zu essen; Eva,
die es trotzdem tut; die Vertreibung aus dem Paradies und Kains Mord an Abel.
Was ist Gerechtigkeit? Diese Frage beschäftigt die Philosophen bereits seit der Antike. Die Rückseite des Gewands zeigt in Großformat das Jüngste Gericht, das letzte Ereignis in
Bildende Künstler erhielten den Auftrag, das Konzept der Gerechtigkeit auf verständnisvolle der Bibel. Das Gewand hebt auf diese Weise die Rolle Gottes als Gesetzgeber und Richter
Weise darzustellen. Sie griffen zu diesem Zweck gern auf die Bibel oder die alte griechische im Verlauf der Menschheitsgeschichte hervor.
und römische Kultur zurück. Dort fanden sie einen Schatz an treffenden Beispielen wie u. a. die
Urteile des jüdischen Königs Salomon oder des römischen Kaisers Trajanus.
Es besteht ein gravierender Unterschied zwischen dem alten und dem neuen Gesetz.
Man vergleiche nur einmal Moses mit den Gesetzestafeln von Philippe de Champaigne mit
Christus und die Ehebrecherin nach Pieter Bruegel dem Älteren. Das erste Bild zeigt die in
Stein gemeißelten, unumstößlichen Gebote Gottes aus dem Alten Testament. Gesetz ist
Gesetz. Bei Bruegel sieht man, wie Christus sein Gesetz in den Sand auf dem Boden schreibt
und auf diese Weise Platz für Mitleid und Auslegung schafft.
Machthaber haben sich schon immer gern mit gerechten Figuren aus der Vergangenheit ver-
glichen. Auf dem Gemälde Christus am Kreuz zwischen Maria und Johannes von Bernard van
Orley erkennt man Margarete von Österreich als Tugend Caritas bzw. Nächstenliebe. Auf dem
Bild Salomon und die Königin von Saba von Lucas de Heere trägt Salomon die Gesichtszüge
von Philipp II.19. Peter Paul Rubens und Atelier Salomons Urteil um 1613-1614 – Musea Nacional del Prado, Madrid © Museo Nacional del Prado Die Geschichte aus dem Alten Testament (1 Kon. 3:16-28), die Rubens hier darstellt, gehört zu den beliebtesten Beispielen - exempla justitiae - der Gerechtigkeit. Zwei Frauen, die in einem Haus zusammenwohnen, behaupten, die Mutter ein und desselben Kindes zu sein. Ein zweites Kind ist gestorben. Die Frauen bringen ihren Streit vor den König und Richter Salomon. Er befiehlt, das Kind in zwei Stücke zu teilen und jeder Frau eine Hälfte davon zu geben. Die Frau, die ihn bittet, es nicht zu tun, wird als richtige Mutter anerkannt. Rubens hebt hier besonders den muskulösen Henker hervor, der Salomons grausamen Befehl durchzuführen droht. Detail: Rubens richtet den Fokus dieses Gemäldes auf das Drama, das sich hier abzuspielen droht. Besonders hervorgehoben werden dabei die Interaktionen zwischen den Figuren und die Gefühle, die sie mit ihren Gesichtern zum Ausdruck bringen. Vor allem bei den beiden selbsterklärten Müttern ist das deutlich zu erkennen. Bittere Tränen rollen über die Wangen der richtigen Mutter. Die andere Frau schaut sie verärgert an.
20. Lucas de Heere Salomon und die Königin von Saba 1559 – St. Bavokathedrale, Gent Sint-Baafskathedraal Gent © www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, foto Dominique Provost Dieses Gemälde stellt eine bemerkenswerte Aktualisierung der biblischen Geschichte über den Besuch der Königin von Saba bei König Salomon dar. Die Königin war damals sehr von Salomons Weisheit beeindruckt. Letzterer trägt hier deutlich die Gesichtszüge von König Phillip II.. Der Maler und Dichter Lucas de Heere fertigte das Gemälde anlässlich des 23. Kapitels des Goldenen Vlieses an, das 1559 in Gent stattfand. Die Königin von Saba verweist hier möglicherweise auf die Niederlande, die Philipp ihren Reichtum in der Hoffnung anboten, er würde als Gegenleistung eine gerechte Regierung einsetzen. Detail: Bei der Figur ganz links auf dem Gemälde handelt es sich um ein Porträt von Viglius Aytta (1507-1577), der ab 1543 Mitglied des Großen Rates von Mechelen war. 1549 wurde er zum Vorsitzenden des Geheimen Rates und fünf Jahre später zum Vorsitzenden des Staatsrates ernannt. 21. Bernard van Orley (Entwurf) Allegorische Kreuzigung mit Misericordia und Justitia um 1523 – Colecciones Reales, Patrimonio Nacional, Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial Neben Johannes und Maria rechts neben dem Kreuz erkennt man auf dieser Kreuzigungsszene auch zwei weniger häufig vorkommende Figuren: Misericordia (die Barmherzigkeit) kniet, um das Blut Jesu in einem Kelch aufzufangen. Justitia ist an ihrem Schwert zu erkennen, das sie in die Scheide steckt. Auch sie wird ihre Aufgabe barmherzig erfüllen. Diese Tapisserie war Bestandteil des Thronbaldachins der Margarete von Österreich. Sie wollte mit dieser ungewöhnlichen Ikonografie die Kernwerte ihrer Politik hervorheben.
22. Bernard van Orley 24. Philippe de Champaigne
Christus am Kreuz zwischen Maria und Johannes Moses mit den Gesetzestafeln
um 1525 – Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam um 1640-1648 – The Schorr Collection, London
Ein bärtiger Mann in einem prunkvollen blauen Mantel schaut den Betrachter eindringlich
Margarete von Österreich erteilte ihrem Hofmaler Bernard van Orley den Auftrag für diese
und mitleidsvoll an. Es ist Moses mit den Steintafeln, auf denen die zehn Gebote stehen, in
Kreuzigungsszene. Genau wie auf dem Thronbaldachin betont Margarete auch hier die
denen Gott den Menschen vorschreibt, wie sie zu leben haben. Moses hält die Tafeln wie einen
Tugenden, denen sie bei ihrer Politik nachstrebte. Am Himmel sehen wir links, wie die
Codex oder ein aufgeschlagenes Gesetzbuch neben sich. Die zehn Gebote sind in der Volks-
Nächstenliebe (Caritas) sich einiger Kinder annimmt. Justitia hingegen zeigt möglicherweise
sprache, d. h. auf Französisch verfasst. Moses’ Hand und die linke Tafel reichen etwas über die
große Ähnlichkeit mit Margaretes Nichte Isabella von Österreich: ein Muster unmissverständ-
steinerne Brüstung hinaus. Auf diese Weise wird die illusionistische Kraft des Gemäldes ver-
licher Propaganda.
stärkt. Das Werk lädt zum Lesen und zur Besinnung ein. Der Künstler Philippe de Champaig-
ne wurde in Brüssel geboren und ausgebildet, arbeitete aber hauptsächlich in Frankreich.
23. Adriaen Collaert, Maarten de Vos (Entwurf)
Opfer unter den Gesetzen der Natur, das Gesetz des Moses
und das Gesetz des Evangeliums
1588 – Koninklijke Bibliotheek van België, Brüssel
© Koninklijke Bibliotheek van België, EST P° XVI NL - Collaert Dynasty - NHD 1068 - S.IV 86279
(Magazijn - Prentenkabinet)
Im linken Oval sehen Sie drei alttestamentarische Opfer, die aus der Zeit vor Moses’ Gesetzen
stammen. Links stehen Noah und seine Familie, rechts Abraham und Isaak und im Hinter-
grund Kain und Abel. Im Hintergrund des mittleren Bildes erhält Moses von Gott das Gesetz.
Im Vordergrund werden detaillierten Regeln entsprechend Opfertiere für das Opfer von Moses
und Aron zerteilt. Auf dem rechten Oval erkennt man ein Gesetz Christi: das katholische
Sakrament der Eucharistie, das bei der Messe erteilt wird. Dieser Kupferstich enthält eine
deutliche Botschaft der Gegenreformation: Die katholische Eucharistie beruht auf alttesta-
mentarischen Vorbildern.25. Jan Brueghel der Ältere, Pieter Bruegel der Ältere (nach) Christus und die Ehebrecherin um 1593-1597 – Privatsammlung, Belgien © Museum Hof van Busleyden, Mechelen, foto Dries Van den Brande Christus und die Ehebrecherin ist eines der wenigen Gemälde, die Pieter Bruegel der Ältere sei- nen Kindern hinterließ, die ihn kaum gekannt haben. Wahrscheinlich hat dieses preziöse Werk seinem Sohn Jan viel bedeutet. Er fertigte mehrere Kopien davon an. Das Bild beruht auf einer Passage aus dem Johannesevangelium (7:53-8:11). In der Mitte steht eine elegant gekleidete Dame, die lieblich nach unten schaut. Sie wird des Ehebruchs beschuldigt. Die Schriftgelehrten und Pharisäer wollen sie steinigen, aber Christus widersetzt sich ihnen. Er kniet vorne links. Detail: Überraschte Zuschauer weisen auf Jesus, der mit einem Finger in den Sand schreibt: „Wer ohne Sünde ist…”. Man will sogleich antworten, „der werfe den ersten Stein.” Natürlich liegen schon einige Steine auf dem Boden bereit. Sie werden dort liegen bleiben, denn Christus wird nicht zulassen, dass die Schriftgelehrten Moses’ Gesetze so streng anwenden. Das Gemälde von de Champaigne, das Sie in dieser Ausstellung bereits gesehen haben, zeigt das alte in Stein gemeißelte Gesetz. Christus stellt diesem Gesetz hier ein neues Gesetz gegenüber, das vernünftig, anpassungsfähig und veränderlich ist. Die Umstehenden ziehen sich schuldbewusst zurück. 26. Moses erhält die Gesetzestafeln um 1475-1525 – Museum Hof van Busleyden, Mechelen Diese Konsole aus Sandstein stammt aus dem Refugium des Mechelner St. Hubertusklosters. Ein Refugium war ein Fluchthaus, in dem sich die Mönche bei Gefahr verstecken konnten. Das Ornament, das Sie hier sehen, ist eine Kopfstrebe. Mit Stücken dieser Art wurde die Decke gestützt. Moses hält triumphierend die Steintafeln mit Gottes Wort hoch. Sie sind traditions- gemäß oben abgerundet. Moses wird hier mit kleinen Hörnern dargestellt, was auf eine Jahrhunderte alte, falsche Übersetzung des hebräischen Wortes „karan“ zurückzuführen ist. Es konnte sowohl „gehörnt”, als auch „strahlend” bedeuten. Die eckigen Falten in Moses Gewand verweisen auf die Expressivität der Gotik.
27. Hubert und Jan van Eyck (Kopie nach) Die Ritter Christi und Die gerechten Richter Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Sie sehen hier eine Kopie von zwei Tafeln des Polyptychons Die Anbetung des Lamm Gottes (1432) von Hubert und Jan van Eyck aus der St. Bavokathedrale in Gent. Links werden die sogenannten gerechten Richter und rechts die Ritter Christi dargestellt. Die beiden Gruppen vertreten die weltlichen Mächte, die Christus anbeten. Die „Richter” sind hier die Politiker, die auch Recht sprachen. In den Gesichtern der Richter wurden gelegentlich zeitgenössische Machthaber wie der burgundische Herzog Philipp der Gute erkannt. Nachdem diese Tafel 1934 gestohlen worden war, fertigte der Maler Jef Van der Veken in den 1940er Jahren eine Kopie an und verlieh darin einem der Richter die Gesichtszüge des belgischen Königs Leopold III. 28. Jan van der Straet (alias Joannes Stradanus) Die Gerechtigkeit des Trajanus um 1563 – Privatsammlung, Belgien Der Brügger Jan van der Straet wanderte nach Italien aus, lateinisierte seinen Namen zu Stradanus und machte sich am Hof der Medici in Florenz einen Namen. Diese Zeichnung zeigt ein in der christlichen Welt sehr beliebtes Exemplum. Das dargestellte Ereignis stammt aus der römischen Geschichte. Ein Kind wird nahezu achtlos von einem Reiter des Heeres von Traja- nus niedergetrampelt. Unten auf der Zeichnung sehen Sie die Mutter neben dem Leichnam ihres kleinen Sohnes. Trajanus lässt daraufhin den Täter hinrichten, der verschiedenen Quellen zufolge sogar sein eigener Sohn gewesen sein soll.
29. Maarten de Vos Die Laster des Apelles Letztes Viertel des 16. Jahrhunderts – Privatsammlung, Luxemburg Der römische Dichter Lucianus beschrieb ein kompliziertes, allegorisches Gemälde des griechi- schen Künstlers Apelles. Das Werk ist verschwunden. Maler haben jedoch Jahrhunderte lang versucht es nachzuahmen. Maarten de Vos ist der einzige Maler aus den Niederlanden, der sich an eine großformatige, gemalte Fassung wagte. Die Unwissenheit und die Hinterlist beraten einen Fürsten mit Eselsohren. Das Laster nähert sich ihm mit einer brennenden Fackel und schleift den Beschuldigten fort, der noch ein Kind ist. Das Laster wird von Verrat, Betrug und Neid in Form eines alten Mannes mit einer Maske begleitet. Die Reue trägt ein schwarzes Kleid und trauert. Detail: Ein alter Mann mit Bart und Flügeln hält eine nackte Frau vor sich. Der alte Mann ist die Zeit, eine Sanduhr schwebt über seinem Kopf. Er zeigt uns seine Tochter, die Wahrheit. Man denke dabei nur einmal an die Redewendung „die nackte Wahrheit”. Die Zeit hat Maarten de Vos hinzu- gefügt, im Text von Lucianus war nicht die Rede davon. Ein gebildetes humanistisches Publikum verstand wahrscheinlich, dass De Vos dieser Szene über das Unrecht zusätzlich eine hoff- nungsvolle Dimension verleihen wollte: Im Laufe der Zeit kommt die Wahrheit doch ans Licht. 30. Pieter Bruegel der Ältere Die Laster des Apelles 1565 – The British Museum, London Auch Pieter Bruegel wagte sich ausgehend von Lucianus’ Beschreibung an eine Fassung von Apelles’ Werk. Er blieb aber näher an dem lateinischen Text als Maarten De Vos. Die Figur der Zeit fehlt. Die Wahrzeit sitzt hilflos in einer Ecke und wird von der Reue traurig angesehen. Die Kulisse ist schlichter und die Figuren sind weniger reich herausgeputzt. Bruegel hat außerdem die Namen der Personifikationen hinzugefügt und liefert somit eine lesbare und originalgetreue Fassung des Motivs. Bruegels Fassung ist einige Jahrzehnte älter als die von Maarten de Vos.
31. Quinten Massijs
Passionstriptychon: Ecce Homo
1517 – Museu Nacional de Machado de Castro, Coimbra
© Museu Nacional Machade de Castro, Coimbra - Ecce Homo, Quentin Metsys - Photo:
José Pessoa - Direção-Geral do Património Cultural / Arquivo de Documentação Fotográfica
E C C E HOMO – S E H T, (DGPC/ADF)
DA IST DE R M E NS CH Der oberste Richter Pontius Pilatus ist hier gut an seinem Hermelinmantel zu erkennen. Er
präsentiert Christus in einen Mantel gehüllt und mit einer Dornenkrone auf dem Kopf der
johlenden Menge. Sie sehen hier den rechten Flügel des Passionstriptychons („Passieretabel”)
Für die christliche Gemeinschaft gab es lange Zeit einen Justizirrtum, der alle anderen in den
von Quinten Massijs, das er für das Kloster Santa Clara in der portugiesischen Stadt Coimbra
Schatten stellte: Die Verurteilung und Hinrichtung Christi durch die Römer gilt als offenkun-
schuf. Die Szene spielt sich im 16. Jahrhundert ab. Das erkennt man gut an der Kleidung der
digstes Unrecht der Geschichte.
Figuren und dem Kirchturm im Hintergrund. Der Künstler verlegt die Leidensgeschichte
Christi in die Zeit des Betrachters und hebt dadurch die zeitgenössische Relevanz des Unrechts
Darstellungen vom Leiden und Tod Christi haben in der bildenden Kunst oft eine zeitgenössi-
hervor, das Christus angetan wurde.
sche Bedeutung. Christus gilt als Sinnbild aller Menschen, die ungerecht behandelt werden,
während die römischen Soldaten alle ungerechten Herrscher und die jüdischen Hohepriester
Detail:
alle unglaubwürdigen Geistlichen symbolisieren. Die biblische Geschichte wurde deshalb in
Hinter diesem Werk verbirgt sich eine deutliche antisemitistische Botschaft. Die spitzen Hüte
eine zeitgenössische Kulisse übertragen. Achten Sie nur einmal auf den Kirchturm aus dem 16.
und vor allem die langen Nasen sollten darauf hinweisen, dass die Umstehenden und Pilatus
Jahrhundert auf dem Bild Ecce homo von Quinten Massijs oder auf die Fassade aus dem 17.
Juden waren. Im 16. Jahrhundert war die Meinung, die Juden seien für die Verurteilung, das
Jahrhundert auf Rembrandts Christus wird dem Volk vorgestellt. Leiden und den Tod Christi verantwortlich, weit verbreitet. Groteske, karikaturistische Darstel-
lungen verstärkten noch diese Auffassung, die das Misstrauen und den Rassismus gegenüber
Vor allem in den ersten Jahrhunderten nach dem Tod Christi wurden viele seiner Anhänger den Juden legitimieren sollte. Das ging noch viele Jahrhunderte so weiter.
aufgrund ihres Glaubens auf eine ähnliche Weise zum Tode verurteilt. Wir bezeichnen sie als
Märtyrer. Sie wurden auch Jahrhunderte später noch regelmäßig in der bildenden Kunst dar-
gestellt. Wer selbst mit Unrecht konfrontiert wurde, fand darin Kraft und Unterstützung. Auf
diesen Kunstwerken wird aber auch das Sterben für den wahren Glauben verherrlicht, wodurch
sie auf uns seltsam aktuell wirken.32. Nicolas van der Veken (zugeschrieben) Christus auf dem kalten Stein 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts – Katelijnekerk Mechelen Dieser Christus erscheint uns aufgrund der detaillierten Ausarbeitung und der Polychromie ergreifend realistisch. Viele Blutstropfen rollen wie Perlen über seinen Körper. Die Darstellung von Christus auf dem kalten Stein beruht auf einer apokryphen Episode, die der Passions- geschichte später hinzugefügt wurde. Nachdem Christus sein Kreuz den Berg hinauf getragen hatte und entkleidet worden war, ruhte er sich aus und dachte über sein Schicksal nach. Das Bild soll den Betrachter dazu anregen, über das Unrecht nachzudenken, dass Christus angetan wurde. Die Skulptur wird dem Mechelner Bildhauer Nicolas van der Veken zugeschrieben. 33. Rembrandt Harmensz. van Rijn Christus wird dem Volk präsentiert 1655 – Koninklijke Bibliotheek van België, Brüssel © Koninklijke Bibliotheek van België, S.II 5793 Eine Menschenmenge drängelt sich vor einer Bühne, auf der Pilatus mit Turban und Gerichts- stab Jesus dem Volk präsentiert. Die Szene wurde bewusst in Rembrandts Zeit verlegt. Die Fassade des Gebäudes, vor dem sich die Szene abspielt, erinnert eher an ein typisch holländi- sches Rathaus als an einen Palast im alten Jerusalem. Die Menschenmenge repräsentiert eine durchschnittliche Bevölkerung reichend von Kindern bis hin zu alten Menschen, vom jungen Edelmann bis zum verkrüppelten Bettler. Detail: Das Portal des Gebäudes wird von zwei Karyatiden oder Hermen, d. h. von Frauenskulpturen flankiert, die als Pfeiler verwendet wurden. Die linke Karyatide stellt Justitia dar. Sie trägt eine Augenbinde und eine Waage, sowie etwas, das einem Schwert oder einem Gerichtsstab ähnelt. Rechts sieht man die Tapferkeit, die sich auf eine Säule stützt. Die Löwenkappe und die Keule erinnern an Herkules, der damals mit der Niederländischen Republik assoziiert wurde. Es heißt, Rembrandt habe mit den beiden Karyatiden eine starke Justiz, bzw. eine viel zu starke Justiz darstellen wollen. Hier wird schließlich bedenkenlos ein Unschuldiger verurteilt.
34. Peter Paul Rubens 36. Jan Provoost
Die Geißelung Christi (Modell) Der Märtyrertod der heiligen Katharina von Alexandrien
um 1614 – Museum voor Schone Kunsten, Gent um 1500-1510 – Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Blut strömt über den Rücken des vornüber gebeugten Christus, der bei jedem Schlag mehr zu- Die sprachgewandte Katharina von Alexandrien wurde zum Tod verurteilt, weil sie es gewagt
sammenzuzucken scheint. Der gemeine Henker tritt gegen sein Bein. Diese Szene wurde durch hatte, die Christenverfolgung beim römischen Kaiser Maxentius anzuklagen. Im Hintergrund
ein dynamisches Spiel von Pinselstrichen virtuos dargestellt. Weiße Akzente verleihen dem sieht man, wie das Rad, auf dem sie getötet werden sollte, durch das Einschreiten Gottes zer-
Bild Tiefe. Man spürt buchstäblich das Unrecht, das Christus hier angetan wird. Rubens schuf stört wird. Daraufhin beschloss der Kaiser, der an seinem Gerichtsstab zu erkennen ist, die
diese Skizze in Öl zur Vorbereitung eines monumentalen Gemäldes für die St. Pauluskirche in Heilige enthaupten zu lassen. Provoost beruft sich hier auf einen Holzschnitt von Albrecht
Antwerpen, das übrigens auch heute noch dort hängt. Es ist Bestandteil einer Gemälde-Serie Dürer, rückt aber den Henker und sein Opfer weiter in den Vordergrund und hebt auf diese
über die 15 Mysterien des Rosenkranzes. Sage und schreibe 11 Antwerpener Künstler haben Weise das grausame Ergebnis des ungerechten Urteils noch stärker hervor.
daran mitgearbeitet.
37 – 44.
35. Simon de Vos
Die Legende vom heiligen Viktor
Der Märtyrertod des heiligen Philippus um 1510-1520 – Museum Hof van Busleyden, Mechelen
1645 oder 1648 – Palais des Beaux-Arts, Lille
Diese 8 kleinen Tafelbilder stammen aus einer Serie von 16 Bildern über das Martyrium des
© Photo RMN-GP - Jacques Quecq d’Henripret
heiligen Viktor von Marseilles (gestorben um 290). Er war Offizier in der römischen Armee.
Nachdem er den örtlichen heidnischen Glauben kritisiert hatte, wurde der Apostel Philippus Bei einem Besuch des Kaisers Maximianus rief er öffentlich zur Ausübung des christlichen
in der Stadt Hierapolis in der heutigen Türkei zum Tod am Kreuz verurteilt. Philippus betet Glaubens auf. Der Kaiser ließ ihn gefangen nehmen, aber Viktor bekehrte seine Wärter. Als er
zu Gott und verursacht ein Erdbeben. Die Zuschauer links blicken erschrocken und schuld- ein Götzenbild umstieß, hackte man ihm den Fuß ab. Schließlich wurde er zum Tod verurteilt.
bewusst auf. Die Henker versuchen, Philippus mit Knüppeln zum Schweigen zu bringen. Nach Er sollte zwischen zwei Mühlsteinen zerquetscht werden, aber die Steine zerbrachen. Deshalb
Rubens’ Tod spezialisierte sich Simon de Vos auf Kabinettstücke im Stil des großen Meisters. wurde Viktor enthauptet. Nach seinem Tod geschahen rund um sein Grab allerlei Wunder.
Kabinettstücke waren kleine Gemälde, die sich vor allem bei Privatsammlern großer Beliebt- Diese kleinen Gemälde wurden wahrscheinlich für den Mechelner Orden der Victorinnen
heit erfreuten. Dieses Werk wurde auf Kupfer gemalt und erhält dadurch einen ganz beson- angefertigt.
deren Glanz. Die Geschichte des heiligen Philippus zeigt, dass der Apostel irrtümlich und zu
Unrecht verurteilt wurde.45. Frans Hogenberg
Die Hinrichtung von Egmond und Horne
2. Hälfte des 16. Jahrhunderts – Universitätsbibliothek Gent
Dieser Kupferstich ist Bestandteil einer Serie von Historienstichen über die Ereignisse im 16.
U N RECHT IN DER Jahrhundert, die sich hauptsächlich in den Niederlanden abspielten. Die Stiche wurden von
dem Mechelner Frans Hogenberg entworfen. Zwei Männer werden, umringt von einer Menge
EIGEN EN ZEIT Soldaten, auf einem Schafott grausam hingerichtet. Einer der beiden ist bereits gestorben.
Über ihm prangt der Name „Egmondt”. „Horn” ist im Begriff, das gleiche Schicksal zu erleiden.
Der spanische Herzog Alba ließ kurz nach seiner Ankunft in den Niederlanden die Grafen
Das 16. Jahrhundert gilt als Beginn der modernen Zeit. Unser Unrechtsempfinden wurzelt in
Egmond und Horne enthaupten. Die beiden Statthalter wurden zum Symbol des Unrechts, das
dieser Periode. Zwei Aspekte sind besonders dafür verantwortlich: Die Gewalt zwischen den
die Niederlande unter der Herrschaft der Spanier erdulden mussten.
Protestanten und den Katholiken in der Zeit der Reformation und die Gräueltaten der
„Conquistadores“ in der Neuen Welt. Es sind Musterbeispiele des Unrechts, das aufgrund
von Religions- oder Rassenunterschieden angerichtet wurde. 46.
Dass diese Missstände allgemein bekannt wurden, ist vor allem der Entwicklung der Buch- Die Soldaten von Wilhelm von Oranien fallen in das
druckerkunst zu verdanken. Gedruckte Bücher und Kupferstiche konnten schnell und billig Kartäuserkloster in Roermond ein
hergestellt und – oft in verschiedenen Sprachen - weit verbreitet werden. Der Aufstand der In: Richard Verstegan, Théâtre des cruautez des héréticques de nostre temps.
Niederlande wurde auf diese Weise zu einem Nachrichtenevent von europäischem Format, Anvers: Adrien Hubert, 1588, p. 61
während der spanische Missionar Bartolomé de las Casas über das Unrecht berichtete, das Universitätsbibliothek Gent
den Indianern auf der anderen Seite der Welt angetan wurde. Der Schriftsteller Richard Verstegan bekehrte sich während seines Studiums in Oxford zum
Katholizismus. Er floh aus England und ließ sich 1586 in Antwerpen nieder. Sie sehen hier
Vor allem die oft grausamen Kupferstiche im Druckwerk hinterließen bleibende Eindrücke.
die französische Übersetzung seines Buches Theatrum Crudelitatum haereticorum. Verstegan
Genau wie in den zeitgenössischen Medien spielte auch dort die Kraft des Bildes eine wichtige
beschreibt darin die Grausamkeiten, die von – meist protestantischen – „Ketzern” überall in
Rolle bei der Bewusstwerdung von Unrecht.
Europa begangen wurden. Auf dieser Abbildung ist ein Mord zu sehen, den die Geusen auf der
Suche nach Geld in der Kirche des Kartäuserklosters in Roermond begehen. Verstegans ein-
seitiger Blick auf die Religionsstreitigkeiten seiner Zeit diente als willkommenes Propaganda-
mittel: Das Unrecht, das von den Protestanten begangen wurde, musste bekämpft werden.47. Jan Luyken Anneken Hendriks in Amsterdam verbrannt im Jahr in 1571 In: Tielemans Jansz. van Braght, Het bloedig tooneel, of, Martelaers spiegel der doops-gesinde of weereloose Christenen. Amsterdam: H. Sweerts, 1685, p. 539 Universitätsbibliothek Gent Hier sehen Sie, wie Anneken Hendriks, eine mennonitische Protestantin, ins Feuer geworfen wird. Sie ist an eine Leiter gefesselt. Katholische Priester und Mönche haben sie zum Tod verurteilen lassen. Jan Lyuken stellte sie und 103 weitere Märtyrer für den zweiten Druck des Buches Het Bloedig Tooneel, of Martelaers Spiegel von Tieleman Jansz. van Braght dar. Dabei handelte es sich um ein sogenanntes „Märtyrerbuch”, d. h. um eine Sammlung von Geschich- ten über den grausamen Tod christlicher Märtyrer. Solche Bücher waren bei mennonitischen Protestanten sehr beliebt. Man setzte ihre Verfolgung den frühchristlichen Martyrien gleich, die mit dem Tod Jesu selbst begonnen hatten. 48. Dirck van Delen Allegorie über die Tyrannei Albas um 1630 – Museum Catharijneconvent, Utrecht ©Museum Catharijneconvent, Utrecht, foto Ruben de Heer Herzog Alba sitzt in einer klassischen Halle unter einem roten Baldachin. Der schein- heilige Kardinal Granvelle berät ihn, während ihm der Papst und der Teufel dabei den Rücken stützen. Die Siebzehn Provinzen - dargestellt durch Frauen mit Wappen - knien flehend vor seinem Thron. Dokumente mit den Rechten und Titeln der niederländischen Adeligen wurden zerrissen. Auf dem Blatt unter Albas Fuß steht: „Religie wert vervolgt” (Religion wird verfolgt). Das bedeutet nichts Gutes. Diese Bildkomposition - eine Anklage Albas - war sehr beliebt. Es bestehen deshalb viele Fassungen davon. Detail: Ein aufmerksamer Betrachter wird im Hintergrund eine kleine bedrohliche Szene erkennen. Eine Menge hat sich um ein Schafott versammelt, auf dem zwei Männer hingerichtet werden. Wer sich damals das Gemälde ansah, erkannte sofort ein aktuelles Ereignis: die Enthauptung von Egmond und Horne. Ihr Tod gilt als Sinnbild des Terrors, den Alba und der „Raad van beroer- ten” - der sogenannte Blutrat -, den der Herzog angestellt hatte, verbreiteten. Es sieht so aus, als würden die Bitten der Siebzehn Provinzen bei dem grausamen Despoten auf taube Ohren stoßen.
49. Theodor de Bry, Joos van Winghe (Entwurf) Spanische Eroberer begehen Gräueltaten an Indianern In: Bartolomé de las Casas, Narratio regionum Indicarum per Hispanos devastatarum. Frankfurt am Main: Theodor de Bry, 1598, p. 10 Koninklijke Bibliotheek van België, Brüssel © Koninklijke Bibliotheek van België, VB 11.396 A 1 RP Spanische Soldaten führen eine grausame Massenhinrichtung durch. Sogar Kinder werden nicht verschont. Der Dominikaner Bartolomé de las Casas klagt in seinem Buch Brevísima relación de la destrucción de las Indias die spanischen Gräueltaten an den Ureinwohnern Amerikas an und gilt deshalb als Vater des Verbots der Sklaverei. Leider wird dabei oft ver- gessen, dass de las Casas der Meinung war, afrikanische Sklaven sollten die Indianer ersetzen. Trotzdem bedeuteten seine Ideen einen großen Fortschritt gegenüber der gängigen Meinung, die Spanier seien den „barbarischen Indianern” weit überlegen. Detail: Hier sehen Sie die lateinische Übersetzung von de las Casas’ Buch. Es wurde von den beiden niederländischen Künstlern Joos van Winghe und Théodore de Bry illustriert. Wenn ein Nieder- länder dieses Buch im 17. Jahrhundert las und darin die spanischen Soldaten an ihrer Kleidung erkannte, zog er sofort den Vergleich zu den Grausamkeiten der spanischen Besatzer während das 80-jährigen Krieges. Es dürfte deshalb kaum überraschen, dass de las Casas’ Buch in den aufständischen Niederlanden sehr beliebt war.
50. Theodor de Bry und Söhne Ein Konquistador wird von Indianern gefoltert In: Girolamo Benzoni, Americae pars quarta. Frankfurt am Main: Johann Feyerabend, 1594, p. 20 Koninklijke Bibliotheek van België, Brüssel © Koninklijke Bibliotheek van België, II 14.250 C 4 Girolamo Benzoni, ein italienischer Kaufmann und Entdeckungsreisender, beschrieb seine Reisen durch Amerika in seinem Buch Historia del Mondo Nuovo. Kennzeichnend für das Werk ist ein ausgesprochener Hass gegenüber den Spaniern. Das Buch beruht teilweise auf den Schriften von Bartolomé de las Casas und wurde mit Stichen von De Bry illustriert. Auf den meisten Bildern werden die Grausamkeiten der Spanier angeklagt, nicht jedoch auf diesem Stich. Hier sieht man, wie die Indianer ihre Kolonialherren grausam behandeln. Obwohl De Bry Westeuropa nie verlassen hat, erntete er viel Erfolg mit Kupferstichen, auf denen er die Neue Welt darstellte. Dabei nahm er es manchmal – bewusst oder unbewusst – mit der Wahr- heit nicht so genau. Detail: Im Hintergrund dieses Bildes sehen Sie grausame kannibalistische Szenen. Trotzdem weckt vor allem ein bizarres Ritual im Vordergrund die Aufmerksamkeit. Indianer gießen geschmolzenes Gold in den Mund eines Spaniers. In Europa waren in dieser Zeit sogenannten „Spiegelstrafen” sehr beliebt: Die Art der Strafe wurde durch das begangene Verbrechen bestimmt. Deshalb hackte man beispielsweise einem Dieb die Hand ab. Etwas Ähnliches sieht man auch auf die- sem Stich: Die Spanier müssen für ihre Goldgier büßen. Das protestantische Publikum, für das dieses Buch bestimmt war, wird bei dieser Szene hämisch gelacht haben.
51. Philips Galle, Pieter Bruegel der Ältere (Entwurf)
Justitia
um 1559 – Koninklijke Bibliotheek van België, Brüssel
© Koninklijke Bibliotheek van België, S.II 135128
DIE RECHTSPRECHU NG Dieser Kupferstich von Bruegel ist Bestandteil einer Serie über die sieben Tugenden. In dem
Gewimmel rund um die Justitia mit Waage, Schwert und Augenbinde sehen Sie die verschie-
IM BILD denen Schritte des Strafprozesses. Rechts unten erscheinen zwei Verdächtige mit einem Kreuz
in den Händen vor der „Vierschaar” - dem Gericht. Links unten wird jemand gefoltert. Der
Protokollführer und der Schultheiß notieren sein Geständnis. Im Hintergrund wird eine Strafe
Auf seinem bekannten Stich von der Justitia stellte Pieter Bruegel der Ältere äußerst detailliert ausgeführt. Links hebt der Henker sein Schwert, um jemanden zu enthaupten, dahinter be-
die verschiedenen Etappen eines Gerichtsverfahrens im 16. Jahrhundert dar. Zu sehen sind u. staunt eine Menschenmenge eine Geißelung. In dem Gebäude rechts wird jemandem die Hand
a. der Prozess, die Folter, die Körperstrafen und die Todesstrafe. abgehackt.
Es ist sehr außergewöhnlich, dass bildende Künstler uns einen Einblick in die Rechtspraktiken Die lateinische Unterschrift lautet: „Scopus legis est, aut eum quem punit emendet, aut poena
dieser Zeit bieten. Diesbezüglich müssen wir uns vor allem an schriftliche Traktate halten, die eius caeteros meliores reddet aut sublatis malis caeteri securiores vivant” („Es ist Ziel des Ge-
manchmal auch illustriert wurden wie beispielsweise die Schriften des Brügger Juristen Joost setzes, entweder den zu verbessern, den es bestraft, oder den anderen ein sichereres Leben zu
de Damhoudere. Künstler wie Peter Paul Rubens schienen eher an der Anatomie der bestraften verschaffen, nachdem das Böse aus dem Weg geräumt wurde”).
menschlichen Körper interessiert zu sein.
Detail:
Rechtsanwälte, Staatsanwälte und Notare tauchen regelmäßig in der bildenden Kunst auf
Am Stadtrand oder direkt außerhalb der Stadt befand sich das Galgenfeld. Auf dem Stich ist es
und werden dort oft nicht besonders schmeichelhaft dargestellt. Sie sind geldgierig und lassen
links im Hintergrund zu erkennen. Verurteilte wurden am Galgen aufgehängt oder ans Rad ge-
sich leicht bestechen. Sie missbrauchen die Unwissenheit ihrer Klienten und die Langsamkeit
fesselt und ihre Leichen den hungrigen Vögeln überlassen. Eine Menschenmenge wohnt einer
des Systems. Seltsamerweise hängen viele dieser Werke ausgerechnet in den Kanzleien von Verbrennung bei. Ganz klein in der linken oberen Ecke sieht man eine Kreuzigung als subtile Er-
Juristen. Die Botschaft ist einfach: Die Kollegen mögen vielleicht so sein, aber man selbst ist es innerung an den Tod Jesu. Sie soll eine Warnung für die Rechtsvertreter sein: Dieses historische
auf keinen Fall. Unrecht darf nicht wiederholt werden.52. Marinus van Reymerswale Das Kabinett eines Rechtsanwalts 1545 – New Orleans Museum of Art Museum Purchase through the Ella West Freeman Foundation Matching Fund Diese gnadenlose Satire bietet uns einen Einblick in das Büro eines Rechtsanwalts aus dem 16. Jahrhundert. Ein steinalter Klient steckt seinem faulen Rechtsanwalt einen Geldbeutel zu, während ein Schreiber Notizen nimmt. Die drei Männer rechts auf dem Gemälde verkörpern die drei Lebensalter des Menschen und sollen mit einem Augenzwinkern auf Verfahren hin- deuten, die ein ganzes Leben lang dauern können. Die dargestellten Prozessakten sind lesbar und verweisen auf ein konkretes Gerichtsverfahren aus dem Dörfchen Reimerswaal, dem Geburtsort des Malers. Das Verfahren dauerte sage und schreibe 12 Jahre und kam schließlich vor den Großen Rat in Mechelen. Es wurde wohl schon immer unendlich lange prozessiert. 53. Pieter Brueghel der Jüngere Der Bauernanwalt 1620 – Groeningemuseum, Brügge © www.lukasweb.be - Art in Flanders vzw, foto Hugo Maertens Dieses Gemälde wird meistens als „Der Dorfanwalt” bezeichnet, obwohl man des Öfteren be- hauptete, hier werde eigentlich ein Procureur, d. h. ein Amtsanwalt dargestellt. In Brueghels Zeit vertrat er die Interessen einer Partei und brachte allerlei Formalitäten in Ordnung. Er hatte im Gegensatz zu einem Rechtsanwalt jedoch kein Universitätsdiplom. Der Unterschied zwischen diesen beiden Berufen war vor allem auf dem Land sehr vage. Brueghel hat hier ein gnadenloses Bild der Rechtssprechung gemalt. Die Dorfbewohner schleppen allerlei Waren an, um den Rechtspfleger in natura zu bezahlen. Wo eigentlich Ordnung herrschen sollte, trium- phiert das Chaos. Detail: Ein auffallendes Element auf diesem Gemälde sind die Säcke an der Wand: die sogenannten „Gerichtssäcke”. Darin wurden alle Prozessakten sorgfältig aufbewahrt. An jedem Sack war ein Zettel befestigt, auf dem man lesen konnte, um welches Verfahren es ging. Daher stammt auch der Ausdruck, das „ein Verfahren anhängig“ ist. Der Rechtsanwalt auf diesem Gemälde ist kei- neswegs ordentlich. Zerrissene Dokumente auf dem Fußboden werfen Fragen über die Qualität seiner Arbeit auf.
54. Aegidius Dickmann, Pieter Brueghel der Jüngere (nach) 57.
Bauern besuchen einen Rechtsanwalt Zwei Arten der Vorladung
1618 – Rijksmuseum, Amsterdam In: Joost de Damhoudere, Practycke in civile saecken. Den Haag: weduwe
Hillebrant Jacobsz van Wouw, 1626, p. 117
Ein aufmerksamer Betrachter wird merken, dass Dickmann Brueghels „Dorfanwalt” spiegel-
Universitätsbibliothek Gent
verkehrt dargestellt hat, wie es bei Kupferstichen üblich ist. Dieser Kupferstich wurde rund
drei Jahre nach Brueghels Gemälde angefertigt. Dickmann fügte eine lateinische und eine Auf den Kupferstichen zu dem Buch Practycke in Civile Saecken von Joost de Damhoudere
deutsche Unterschrift hinzu. Beide nehmen die Welt der Juristen aufs Korn. Der Stich und sehen Sie die Schritte eines Zivilverfahrens im 16. Jahrhundert. Das Bild zeigt die beiden mög-
die Unterschriften zeigen, wie schnell Brueghels scharfe Satire international verbreitet wurde. lichen Formen der Vorladung. Im Vordergrund erkennt man den Gerichtsvollzieher an seinem
Unsorgfältige und windige Rechtsanwälte trieben anscheinend nicht nur in den Niederlanden kurzen Gerichtsstab. Er überreicht dem Vorgeladenen ein versiegeltes Dokument. Ein würziges
ihr Unwesen. Detail: Letzterer befindet sich in dem Lokal „De Zwaan”, das damals als Synonym für ein
Freudenhaus galt. Sollte der Vorgeladene unauffindbar sein, dann kann er einen „öffentlichen
Aufruf ” erhalten oder „durch Erlass” vorgeladen werden. Das sehen Sie im Hintergrund.
55. Cornelis Saftleven
Satire auf die Prozesssucht der Bauern
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam
© Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, Photographer: Studio Tromp, Rotterdam
Der Rotterdamer Saftleven malte nicht nur gerne Bauerszenen, sondern auch Tiersatiren.
Mit viel Sinn fürs Detail nahm er Menschen aufs Korn, indem er sie als Tiere darstellte. Der
Rechtsanwalt ist hier an seinem Barett und dem Pelzkragen zu erkennen. Er wird als Eule mit
einer Brille abgebildet und ist halbblind. Das bedeutet nichts Gutes für seine Klienten wie das
Schwein, das ihm ein Goldstück zusteckt. Über dem Rechtsanwalt prangt der Spruch: „Die wil
regten om een koe, die blijft vrij tuys en brengt er nog een toe.“ (Wer für eine Kuh vor Gericht
gehen will, geht ohne nach Hause und gibt noch eine hinzu.) Er soll vor endlosem Prozessieren
warnen.
56. Pieter Coecke van Aelst (Umfeld)
Allegorie der gerechten Rechtsprechung
2. Viertel des 16. Jahrhunderts – STAM, Gent
Der Richter auf diesem Glasfenster ist an seinem Gerichtsstab zu erkennen. Ein reich ausge-
statteter Herr und ein in Lumpen gekleideter Bettler richten sich an ihn. Der Richter wendet
sich an den Armen und lässt sich von dem Geldbeutel, den der Reiche ihm zusteckt, nicht
erweichen. Groteske Dekorationen rahmen die Szene ein. Das mittlere Bild und die Verse mah-
nen zur Unparteilichkeit. Da die Richter oft von den streitenden Parteien bezahlt wurden, war
Bestechung ein großes Problem.Sie können auch lesen