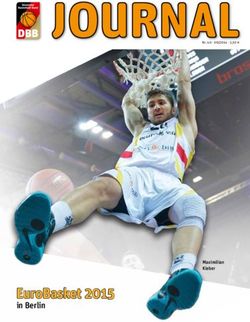Die Katzendreckgestank-Affäre - Bodo Mrozek und Doubravka Olšáková
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Bodo Mrozek und Doubravka Olšáková | Die Katzendreckgestank-Affäre 311
Bodo Mrozek und Doubravka Olšáková
Die Katzendreckgestank-Affäre
Grenzüberschreitende Geruchskonflikte zwischen der Bundesrepublik,
der ČSSR und der DDR 1976 bis 1989
I. Verwehte Geschichte: Von der Desodorierung zur Reodorierung
Im Herbst 1976 zog ein feinstoffliches Gemisch unbekannter Zusammenset-
Aufsätze
zung durch Nordostbayern. Es legte sich über Stadt und Land, kroch durch
Spalten und Luken, drang in Ställe und Häuser und stieg den Menschen als
Geruch in die Nasen. Erste Meldungen kamen aus den Regierungsbezirken
Oberfranken und Oberpfalz, dem Sechsämterland und dem Fichtelgebirge. Sie
kündeten von drastischen körperlichen Reaktionen: Kopfschmerzen, Übel-
keit, Erbrechen. Fenster mussten geschlossen bleiben; so mancher bedeckte
sogar sein Gesicht. Bei der Beschreibung des Geruchs einigte man sich bald auf
einen Begriff, der im Juni 1977 prominent Verwendung fand, als der Bayeri-
sche Rundfunk mit der Fernsehsendung „Jetzt red i“ in Wunsiedel Station
machte. Moderiert von dem bekannten Journalisten Franz Schönhuber, bot
diese Sendung Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre Sorgen und
VfZ 71 (2023) | H.2 | © Walter de Gruyter GmbH 2023 | DOI 10.1515/vfzg-2023-0016
Probleme Mitgliedern der Staatsregierung zu Gehör zu bringen, die dazu ins
Studio gekommen waren. Dabei machte der Leiter der örtlichen Umweltini-
tiative seinem Ärger unter Beifall Luft: „A ganz a aktuelles Thema, Herr
Schönhuber, bei uns stinkt’s und uns stinkt es! [. . .] Und zwar ganz ordinär
nach Katzendreck.“1 Ein Hotelier aus Fuchsmühl führte das Wort „Katzen-
1 Bayerischer Rundfunk (künftig: BR), Hauptabteilung Archive, Dokumentation, Recherche, „Jetzt
red i – Wunsiedel“ am 27.7.1977 (TC 00:22:30–00:23:49). – Die Forschungen, die diesem Aufsatz zu-
grunde liegen, wurden von der Czech Science Foundation (GAČR), Research Grant GA22-01953S, und von der
Deutschen Forschungsgemeinschaft, Projekt 446388013, unterstützt.312 Bodo Mrozek und Doubravka Olšáková | Die Katzendreckgestank-Affäre
dreck“ ebenfalls im Munde, und auch dem lokalen Sechsämterboten diente es
als Überschrift.2
Auf den ersten Blick scheint es sich um eine Marginalie zu handeln, zumal
ein „Katzendreck“ umgangssprachlich auch für eine zu vernachlässigende
Kleinigkeit steht. Doch das, was als Katzendreckgestank-Affäre bald in den
Amtssprachgebrauch einging, sollte sich zu einem Konflikt von landesweiter,
nationaler, interregionaler und sogar trans- und internationaler Dimension
auswachsen. Mehr als zehn Jahre lang beschäftigte er Ämter, Lokalpolitik,
Medien, Wissenschaft, Ministerien, das Parlament, die Diplomatie und schließ-
lich auch Staatsoberhäupter. „Katzendreck“ prangt als Titel auf zahlreichen
Aktendeckeln, die heute Archivboxen füllen: In Landratsämtern, Landes- und
Staatsarchiven, den Stasi-Unterlagen, Nationalarchiven sowie in denen der Au-
ßenministerien sind Überlieferungen erhalten. Bislang aber hat die Affäre mit
dem einprägsamen Namen kaum Beachtung in der Geschichtswissenschaft ge-
funden.3 Auch in den einschlägigen Editionen tauchen die verstreuten Akten,
die hier erstmals zusammengeführt und ausgewertet werden, nur als Fußnote
auf.4
Was für die Affäre im Besonderen gilt, gilt für Geruchskonflikte im Allgemei-
nen, jedenfalls in der Zeitgeschichte.5 In älteren Epochen sind sie ein integraler
Bestandteil der Stadt-, Medizin- und Kulturgeschichte.6 Der Kampf gegen Übel-
gerüche wurde dort mit unterschiedlichsten Mitteln geführt: mit Parfums im
alten Ägypten oder an Höfen französischer Könige zur Zeit des Absolutismus,
mit dem Ausräuchern mittelalterlicher Seuchen, den Reinigungs- und Lüftungs-
geboten preußischer Reformer, der Einführung städtischer Müllabfuhren und
2 Vgl. Sechsämterbote (Ausgabe Wunsiedel) vom 23.6.1977: „Katzendreckgestank“, und Hofer Anzei-
ger/Frankenpost vom 15./16.4.1978: „Fuchsmühler Hotelier beschwerte sich bei Chnoupek über Katzen-
dreckgestank“.
3 Vgl. Tobias Huff, Natur und Industrie im Sozialismus. Eine Umweltgeschichte der DDR, Göttingen
2015, S. 219–241, und Astrid M. Eckert, West Germany and the Iron Curtain. Environment, Economy,
and Culture in the Borderlands, New York 2019, S. 143–158.
4 Vgl. Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland 1983, Bd. I/1: 1. Januar bis 30. Juni
1983, bearb. von Tim Geiger/Matthias Peter/Mechthild Lindemann, München 2014, S. 151, Anm. 26, und
S. 162, Anm. 28, sowie Dokumente zur Deutschlandpolitik, VII. Reihe, Bd. 1: 1. Oktober 1982 bis 31. De-
zember 1984, bearb. von Annette Mertens, Berlin/Boston 2018, S. 360, Anm. 6.
5 Vgl. explorativ Camille Grapa, Une histoire de l’Allemagne de l’Est par l’olfaction, in: Regards sur la
RDA et l’Allemagne de l’Est. Un carnet des germanistes du CEREG, Université Paris Nanterre et Univer-
sité Sorbonne Nouvelle, 1.4.2023; allemagnest.hypotheses.org/3170#more-3170 [3.2.2023].
6 Vgl. etwa Constance Classen/David Howes/Anthony Synnott, Aroma. The Cultural History of Smell,
London/New York 1994; Jonathan Reinarz, Past Scents. Historical Perspectives on Smell, Urbana/Chica-
go/Springfield 2014; Érika Wicky, History of Smell: What Is yet to Be Studied, in: The Senses and Society
11 (2016), S. 363–365, und Mark M. Smith, Smell and History. A Reader, Morgantown 2019.
VfZ 2 / 2023Bodo Mrozek und Doubravka Olšáková | Die Katzendreckgestank-Affäre 313
Abwassersysteme im 19. Jahrhundert.7 Mit diesen Maßnahmen einer umfassen-
den désodorisation, so die große These, verschwanden starke Gerüche weitgehend
aus der Welt.8 Für Alain Corbin etwa vollendete sich die Desodorierung der alten
Zeit an der Schwelle zum 20. Jahrhundert, auch wenn er in seiner Pionierstudie
über Paris ausblickend einräumt, dass die Industrialisierung neue Geruchspro-
bleme hervorbrachte.9 In der Industriegeschichte des 19. Jahrhunderts finden sie
denn auch Erwähnung, spielen aber ebenso wenig wie in der Umweltgeschichte
eine zentrale Rolle.10 Das 20. Jahrhundert firmiert als weitgehend geruchsneu-
tral, ja sogar als das Säkulum einer wohlriechenden „Reodorierung“.11
Anhand der Katzendreckgestank-Affäre lässt sich das sensorische Epochen-
verdikt in Frage stellen, da sie exemplarisch belegt, dass Übelgerüche auch im
späten 20. Jahrhundert durchaus noch eine gewichtige Rolle spielen konnten.
Mit diesem Beispiel lassen sich bekannte Fragen der Umweltgeschichte, der
transnationalen Geschichte und der internationalen Beziehungen um solche der
jüngeren Sinnesgeschichte erweitern.12 Wie wurden Gerüche sensorisch wahr-
genommen, sprachlich beschrieben, technisch und medizinisch vermessen und
schließlich praktisch bekämpft? Und wie wurden sie zeithistorisch kontextua-
lisiert – unter Bedingungen von Teilung, Kaltem Krieg, internationaler Koope-
ration und einer wachsenden Sensibilität für die Regulierung anthropogener
Immissionen?13 Die Kombination von Selbstzeugnissen, Medienberichten und
den Beständen lokaler Überlieferungen mit denen nationaler und internatio-
7 Vgl. Stephen Halliday, The Great Stink of London. Sir Joseph Bazalgette and the Cleansing of the
Victorian Metropolis, Stroud 1999; Constance Classen u. a. (Hrsg.), A Cultural History of the Senses,
6 Bde., London/New York 2014; William Tullett, Smell in Eighteenth-Century England. A Social Sense,
Oxford/New York 2019, und Melanie A. Kiechle, Smell Detectives. An Olfactory History of Nineteenth-
Century Urban America, Seattle 2019.
8 Vgl. Bodo Mrozek, Die achtzehn Sinne, in: Merkur 74 (2020) H. 852, S. 59–66, hier S. 65.
9 Vgl. Alain Corbin, Pesthauch und Blütenduft. Eine Geschichte des Geruchs, Berlin 22005, S. 173 und
S. 299.
10 Vgl. etwa Franz-Josef Brüggemeier/Thomas Rommelspacher, Blauer Himmel über der Ruhr. Ge-
schichte der Umwelt im Ruhrgebiet 1840–1990, Essen 1992, S. 19, und Frank Uekoetter, The Age of
Smoke. Environmental Policy in Germany and the United States, 1880–1970, Pittsburgh 2009, S. 67–
112.
11 So in Bezug auf Konsumdüfte durchaus zutreffend die Ausführungen von Robert Jütte, Geschichte der
Sinne. Von der Antike bis zum Cyberspace, München 2000, S. 284–299.
12 Vgl. Mark M. Smith, A Sensory History Manifesto, University Park 2021, und Jan-Friedrich Miss-
felder, Ganzkörpergeschichte. Sinne, Sinn und Sinnlichkeit für eine Historische Anthropologie, in: Inter-
nationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur 39 (2014), S. 457–475.
13 Als Emissionen werden feste, gasförmige, flüssige oder geruchsverbreitende Stoffe, Wellen- oder
Teilchenstrahlungen bezeichnet; als Immissionen die Einwirkungen durch Erstere. Vgl. Michael Olsson/
Dirk Piekenbrock, Kompakt-Lexikon Umwelt- und Wirtschaftspolitik, Bonn 1993, S. 91 f. und S. 156.
VfZ 2 / 2023314 Bodo Mrozek und Doubravka Olšáková | Die Katzendreckgestank-Affäre
naler Politik in der für transnationale Geschichte zwingenden Erschließung von
Quellen in allen relevanten Sprachen erlaubt es zudem,14 Zusammenhänge
zwischen Mikro- und Makrogeschichte en détail aufzuzeigen. Im Zentrum der
Affäre steht die Formierung dessen, was der Kulturwissenschaftler J. Douglas
Porteous als „smellscape“ definiert hat: eine durch zeitlich und räumlich auftre-
tende „smell events“ formierte volatile, temporär aber durchaus persistente Ge-
ruchslandschaft.15
II. Lokale Anfänge: „geheimnisvolle ‚Duftwellen‘“ im Grenzland
Frühe Beschwerden über den „Katzendreckgestank“ gingen im Herbst 1976 in
die Amtsakten der bayerischen Grenzpolizeidirektionen Selb und Rehau ein.16
Demnach trat das Phänomen um den 10. Oktober 1976 dort an drei Tagen in
Folge jeweils in den Morgen- und Abendstunden auf, zudem in der Umgebung
von Schönwald, Schirnding und Arzberg; außerdem in Marktredwitz und
Hohenberg an der Eger. Weitere Klagen kamen aus den Gemeinden Kirchen-
lamitz, Töpen, Tirschenreuth, Waldsassen und Schwarzenbach an der Saale.
Im Februar 1977 war in der Lokalpresse daher bereits von einer „ostbayerische
[n] Beschwerdenschwemme“ aus Anlass der „geheimnisvolle[n] Duftwellen“
die Rede.17 Und auch außerhalb Bayerns wurde alsbald berichtet, etwa über den
Bauern Rudolf Brenner, dem es so sehr den Atem verschlug, dass er die Flucht
von seinem kleinen Gehöft im Fichtelgebirge erwogen habe: „Und das, obwohl
Bauer Brenner nun schon von Berufs wegen kein verwöhntes Geruchsorgan
mitbringt.“18 In dieser saloppen Bemerkung schwang einerseits eine gewisse
Geringschätzung für das Problem mit, die in der medialen Berichterstattung
bald weichen sollte, andererseits aber auch ein Alltagsverständnis dessen, was
auch die histoire sensible als ernsthaftes Problem beschäftigt: die Verteilung kol-
14 Vgl. Margit Pernau, Global history. Wegbereiter für einen neuen Kolonialismus?; hsozkult.
geschichte.hu-berlin.de/index.asp?id=572&view=pdf&pn=forum&type=artikel [3.2.2023].
15 J. Douglas Porteous, Smellscape, in: Jim Drobnick (Hrsg.), The Smell Culture Reader, Oxford/New
York 2006, S. 89–106, hier S. 92.
16 Am 10.10. und am 19.10.1976. Hierzu und zum Folgenden Bundesarchiv Koblenz (künftig: BArchK),
B 295/7434, Dokumentation des bayerischen Landesamts für Umweltschutz über die im nordostbayeri-
schen Grenzgebiet auftretenden und als „Katzendreckgestank“ bezeichneten Geruchsbelästigungen.
17 Vgl. Der Neue Tag/Oberpfälzischer Kurier vom 8.2.1977: „‚Stinkt wie Katzendreck‘. Landesamt un-
tersucht geheimnisvolle ‚Duftwellen‘“.
18 Mannheimer Morgen vom 22.5.1979: „Mief über den Eisernen Vorhang stinkt Grenzbewohnern ge-
waltig“.
VfZ 2 / 2023Bodo Mrozek und Doubravka Olšáková | Die Katzendreckgestank-Affäre 315
lektiv unterschiedlich ausgeprägter Empfindlichkeiten, die topografischen, kul-
turellen, geschlechts- oder schichtspezifischen Grenzen folgen können.19
Im Falle des „Katzendreckgestanks“ wurden Beschwerden aus allen Bevölke-
rungsteilen, aus Stadt und Land laut, was auf die Intensität hindeutet. Er trat
bei einer bestimmten Witterungslage auf: Winde trugen ihn bei neblig-trübem
Himmel aus östlichen bis südöstlichen Richtungen heran. Schon frühzeitig wur-
den die Quellen des Übelgeruchs daher nicht im Inland, sondern in den benach-
barten Volksrepubliken vermutet: in der Deutschen Demokratischen Republik
(DDR) und der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik (ČSSR).
Da der mit Haustieren assoziierte Übelgeruch freilich nicht von solchen ver-
ursacht wurde, wurden Reisende an den Grenzübergängen befragt, um Anhalts-
punkte über Dimension und Ursprung des Problems zu gewinnen.20 Tatsäch-
lich wurden nicht nur in Bayern die Nasen gerümpft. Eine Lehrerin aus Nová
Role, die in der Bundesrepublik Asyl suchte, und ein flüchtiger Forstingenieur
berichteten von Kopfschmerzen und Übelkeit, über die sich Anwohnende bei
den Behörden der ČSSR beklagten.21 Und auch in der DDR litten Menschen
unter dem transnationalen Gestank, wie ein Rentner zu Protokoll gab, der re-
gelmäßig das sächsische Plauen besuchte. Das Ost-Berliner Gesundheitsminis-
terium erreichten ebenfalls Beschwerden über den „unheimliche[n] Gestank
aus der ČSSR“, der zu Angstzuständen und Schlafmangel und zu einer „eigen-
artigen Hautstraffheit“ geführt habe.22 Es handelte sich also um eine grenz-
überschreitende „smellscape“ von beträchtlichen Ausmaßen.
19 Vgl. Bodo Mrozek, Sensed Communities, in: Merkur 76 (2022) H. 879, S. 43–53.
20 Befragungen erfolgten u. a. am Grenzübergang Schirnding. BayHStA, Präsidium der Grenzpolizei
631, Mitteilungen von Reisenden am 8.3.1979; Politisches Archiv des Auswärtigen Amts (künftig: PA/
AA), B 42/ZA 139674, Typoskript: „Bundesrepublik Deutschland. Schwefeldioxidbelastung im nordost-
bayerischen Grenzgebiet“, undatiert.
21 Ebenda. Vgl. auch Miroslav Vaněk, Nedalo se tady dýchat: Ekologie v českých zemích v letech 1968 až
1989, Prag 1996; ders., Porobení přírody, in: Toman Brod u. a., Proč jsme v listopadu vyšli do ulic, Brünn
1999, S. 133–154; Eagle Glassheim, Cleansing the Czechoslowak Borderlands. Migration, Environment,
and Health in the Former Sudetenland, Pittsburgh 2016, S. 164 und S. 170; BayHStA, Präsidium der
Grenzpolizei 631, Informations- und Befragungsbericht der Grenzpolizei Selb: Angaben eines am
24.6.1981 im Raum Rehau in die Bundesrepublik Deutschland geflüchteten uniformierten Forstinge-
nieurs; das Folgende nach diesem Dokument.
22 Zit. nach Huff, Natur und Industrie, S. 219. In der Übersichtskarte auf der folgenden Seite sind vor
allem Orte und Messstationen eingezeichnet, die im vorliegenden Aufsatz Erwähnung finden.
VfZ 2 / 2023316 Bodo Mrozek und Doubravka Olšáková | Die Katzendreckgestank-Affäre
Doch nicht nur der Mensch war gefährdet. Einer Beschwerde zufolge hatten
auch Pferde „nach Aufnahme von immissionsbeaufschlagtem Gras“ Verätzun-
gen der Nüstern und Mäuler erlitten.23 Bayerische Kommunalpolitiker be-
klagten zudem, das Problem bedrohe den „zukunftsträchtigen Entwicklungs-
zweig“ Tourismus und könne durch Waldschäden auch die Holzwirtschaft in
Mitleidenschaft ziehen, wie es in einem Beschwerdebrief aus Kulmbach an ver-
23 BayHStA, StK 19664, Vorläufiger Bericht des bayerischen Landesamts für Umweltschutz über Er-
gebnisse von Immissionsmessungen und Bioindikatoruntersuchungen im Raum Lichtenberg, 12.3.1980.
Zu den Folgen für Nutztiere vgl. auch Eckert, West Germany, S. 143.
VfZ 2 / 2023Bodo Mrozek und Doubravka Olšáková | Die Katzendreckgestank-Affäre 317
schiedene Bundesministerien hieß, in dem dringend um „Abhilfe der Geruchs-
immissionen“ gebeten wurde.24
Grenzüberschreitende Geruchskonflikte waren nicht präzedenzlos. So hat-
ten West-Berliner Behörden im Winter 1974 bereits einen großräumigen „Ge-
ruchskeil“ von mehreren Kilometern Länge kartografiert, der sich aus der DDR
kommend in den Süden des amerikanischen Sektors geschoben und ähnliche
Symptome ausgelöst hatte wie einige Jahre darauf der „Katzendreckgestank“ –
wobei die Geruchsbelästigung von den Berlinern mit anderen Attributen belegt
wurde: Die Assoziationen variierten zwischen „kochendem Leim“ und „ver-
branntem Kohl“. Ende der 1970er Jahre traten diese Belästigungen erneut auf
und trübten das deutsch-deutsche Verhältnis für längere Zeit.25
Auch im deutsch-tschechischen Grenzraum, jener „umwelthistorisch kon-
turierten Geschichtsregion Ostmitteleuropa“, kannte man Geruchsprobleme.26
Nordböhmen war seit dem 19. Jahrhundert aufgrund seiner Braunkohlevor-
kommen rapide industrialisiert worden und galt in den 1970er Jahren als „die
am stärksten devastierte Kulturlandschaft Mitteleuropas“.27 Bereits in der
ersten Hälfte der 1970er Jahre schätzte man das von übelriechenden Abgasen
betroffene Gebiet auf 20 800 Hektar. Und schon aus dem Jahr 1922 ist die
erzgebirgische Redensart überliefert: „In Böhmen kochen sie Kaffee.“28 Mitte
bis Ende der 1970er Jahre aber verschärfte sich das Problem dramatisch;
allein zwischen 1976 und 1978 zählte die Abteilung Umweltschutz des Mi-
nisteriums für Umweltschutz und Wasserwirtschaft der DDR rund 1460 Ge-
ruchsbeschwerden.
24 PA/AA, B 42/ZA 139674, Vermerk Hans Werner Lautenschlagers über Geruchsbelästigungen im
nordostbayerischen Grenzraum, 6.3.1979, und Hans Köstner an Hans-Dietrich Genscher, 17.3.1982.
25 Vgl. Bodo Mrozek, The Smell of the Berlin Wall: Olfactory Border Management at the Inner-Euro-
pean Frontier, in: Ders. (Hrsg.), Sensory Warfare in the Global Cold War. Partition, Propaganda, Covert
Operations (in Vorbereitung).
26 Horst Förster/Julia Herzberg/Martin Zückert, Umweltgeschichte(n) Ostmitteleuropas. Eine Einfüh-
rung, in: Dies. (Hrsg.), Umweltgeschichte(n). Ostmitteleuropa von der Industrialisierung bis zum Post-
sozialismus, Göttingen 2013, S. 1–5, hier S. 3; im selben Sammelband, S. 7–30, findet sich der Aufsatz von
Julia Herzberg, Ostmitteleuropa im Blick. Umweltgeschichte zwischen Global- und Regionalgeschichte.
27 Horst Förster, Raumbewertung und Kulturlandschaftswandel. Das Beispiel Nordböhmen, in: Ders./
Herzberg/Zückert (Hrsg.), Umweltgeschichte(n), S. 83–103, hier S. 84; vgl. auch Jana Piňosová, Inspira-
tion Natur. Naturschutz in den böhmischen Ländern bis 1933, Marburg 2017.
28 Zit. nach Huff, Natur und Industrie, S. 81; zu den Zahlen aus den 1970er Jahren vgl. ebenda, S. 221 f.
VfZ 2 / 2023318 Bodo Mrozek und Doubravka Olšáková | Die Katzendreckgestank-Affäre
III. Olfaktorische Boden-Luft-Aufklärung: Die Vermessung des Gestanks
Auch in der Bundesrepublik wurde die Politik zu dieser Zeit für Gerüche sensi-
bilisiert. Im März 1978 ging dem – seit 1969 für Umweltschutz zuständigen –
Innenministerium eine vom Bundesminister für Forschung und Technologie in
Auftrag gegebene, großangelegte Studie über die „Erfassung und Verminderung
von Geruchsemissionen“ zu. Die Studie war unter Mitwirkung der Universitä-
ten Bochum und Düsseldorf unter Leitung des Hanauer Unternehmens NUKEM
durchgeführt worden und verfolgte das Ziel, „die mit dem Auftreten von beläs-
tigenden Geruchsemissionen verbundenen Probleme auf breiter Basis zu erfas-
sen, um die [. . .] Vermeidung und Reduzierung von Belästigungen der Bevölke-
rung vorzubereiten“.29 Motiviert war die Untersuchung durch die neuere
Umweltschutzgesetzgebung der Bundesrepublik, die „belästigenden Geruchs-
emissionen“ eine „erhöhte Beachtung“ schenkte.30 In diesem Zusammenhang
sollte Grundsätzliches über die Funktion des Geruchssinns und Spezifisches
über die Wirkung von Übelgerüchen ermittelt werden. Dabei räumten die
Autoren der Studie gleich eingangs die Schwierigkeit einer „fast vollständig“
fehlenden Systematik ein, da „der Mensch in der Geruchswahrnehmung und
-empfindung“ und infolgedessen auch in deren Beurteilung komplex und sub-
jektiv sei.31 Besondere Bedeutung kam daher dem sogenannten Geruchsschwel-
lenwert zu – eine Konzentration von Duftmolekülen in der Luft, die von allen
Versuchspersonen wahrgenommen wird.32
Die technische Erfassung olfaktorischer Phänomene war äußerst schwierig.
Zwar konnte man mithilfe verschiedener Verfahren wie der Odorimetrie und
der Gaschromatografie messen, in welcher Konzentration bestimmte Stoffe in
der Luft vorhanden waren, doch fehlte dieser quantitativen Analyse die qualita-
tive Dimension. Man sei „letztlich zur Geruchsbeurteilung auf das sehr subjek-
tiv wirkende menschliche Riechsystem als Detektor angewiesen“, räumten die
Autoren der Studie ein.33 Ihr Ziel war eine olfaktorische Prognostik: „die in Zu-
kunft zu erwartenden Geruchsbeschwerden aus der Bevölkerung abzuschätzen“
und „Anhaltspunkte für die Größenordnung der betroffenen Bevölkerung und
29 BArchK, B 228/12124, P. G. Maurer u. a., NUKEM – 315: Erfassung und Verminderung von belästi-
genden Geruchsemissionen, 2 Teile, Hanau 1978; zitiert wird die nicht paginierte Präambel.
30 Ebenda, Teil I, Zusammenfassung, nicht paginiert.
31 Ebenda, Teil II, S. 34.
32 Vgl. ebenda, Teil I, S. 24.
33 Ebenda, Teil II, S. 51.
VfZ 2 / 2023Bodo Mrozek und Doubravka Olšáková | Die Katzendreckgestank-Affäre 319
für die Größe der Belästigung zu bekommen“.34 Geruchsforschung war hier Zu-
kunftspolitik.
Der „Katzendreckgestank“, der in Ausdehnung, Intensität und Persistenz in
einer beachtlichen Größenordnung auftrat, traf die Politik also nicht völlig un-
erwartet, auch wenn die Autoren der NUKEM-Studie sich auf das Inland kon-
zentriert hatten. Musste sich zunächst vorwiegend die Kommunalpolitik mit
diesem Problem herumschlagen, so waren nach zahlreichen Eingaben von Be-
troffenen, Bürgermeistern und Landräten an Landtagsabgeordnete in München
und das Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen auch die
Landesbehörden alarmiert. Das Ministerium musste sich allerdings einige Kri-
tik gefallen lassen, reagierte es doch erst, nachdem „der Gestank in der Zeitung
gestanden“ hatte.35
Unter dem Druck dieser Proteste schritt das Landesamt für Umweltschutz
zur Tat. Um Quantität und Qualität des penetranten Odeurs zu ermitteln, ließ
es mehrere aerologische Emissionsmessungen durchführen und leitete die ol-
faktorische Luftaufklärung ein: Beim Auftreten des „Katzendreckgestanks“ flog
ein Flugzeug die bayerisch-tschechoslowakische Grenze ab, um „durch Messun-
gen der Schwefeldioxid- und Stickstoffkonzentration die räumliche Ausdeh-
nung der Belastung zu ermitteln“.36 Auch kamen Laborwagen und Messsta-
tionen auf dem wenig bebauten Tröstauer Talgrund zum Einsatz. Da diese
technischen Verfahren zwar stoffliche Konzentrationen, nicht aber deren
Wahrnehmung durch den Menschen ermitteln konnten, wurden subjektive be-
ziehungsweise kollektive Geruchseindrücke mit Hilfe von Fragebögen in betrof-
fenen Gemeinden und Landkreisen erhoben und im Landesamt zentral aus-
gewertet.
Die Ergebnisse der Messdaten verzeichneten Beamte auf Landkarten, indem
sie die räumliche „Verteilung der als Katzendreckgestank bezeichneten Ge-
ruchsbelästigung“ in Form topografischer Marker örtlich spezifizierten und im
Tagesverlauf als zweidimensionale Diagramme auf Millimeterpapier mit Uhr-
zeiten auf der X-Achse und den Tröstauer Schwefeldioxidwerten (SO2 in mg/
m3) auf der Y-Achse von Hand notierten. Damit wurden zeitlich definierte Ge-
ruchsereignisse als „smellscapes“ kartografiert und somit visualisiert. Dies war
eine übliche Vorgehensweise, da bildgebende Verfahren als Wissensressource
34 Ebenda, Teil II, Zusammenfassung, nicht paginiert.
35 BR, Hauptabteilung Archive, Dokumentation, Recherche, „Jetzt red i – Wunsiedel“ am 27.7.1977
(TC 23:00–24:31).
36 Im Oktober 1977 in Tröstau und im April 1978 in Hohenberg an der Eger; BArchK, B 295/7434, Do-
kumentation des bayerischen Landesamts für Umweltschutz, S. 11 und Tabellenanhang.
VfZ 2 / 2023320 Bodo Mrozek und Doubravka Olšáková | Die Katzendreckgestank-Affäre
Karten des bayerischen Landesamts für Umweltschutz über Lufthygiene, April/Mai 1978
© BArch, B 295/7435, Abbildungen 141 und 5
seit Jahrhunderten etabliert waren – im Unterschied zu Geruchseindrücken, die
zum Zwecke der Objektivierung zunächst ins Register des Sehens transformiert
werden mussten.37
Die Messungen belegten eine teils drastisch erhöhte Belastung der Luft durch
SO2-Immissionen. Auch war das Gebiet von Fichtenbeständen mit signifikant
erhöhten Schwefel-Ablagerungen, dort, wo der „Katzendreckgestank“ auftrat,
mehr als doppelt so groß wie in den bislang bekannten, ohnehin schon durch
inländische Immissionen belasteten Wäldern an anderer Stelle.38 Zudem wur-
den Schwefelkohlenstoff und Kohlendioxidsulfid in der Atmosphäre nachge-
37 Zu Geschichte und Kritik dieses Verfahrens vgl. Claudia Godau/Robert Gaschler, Wahrnehmung von
Datengrafiken. Ein verzerrter Eindruck?, in: Horst Bredekamp/Wolfgang Schäffner (Hrsg.), Haare hören
– Strukturen wissen – Räume agieren. Berichte aus dem Interdisziplinären Labor Bild Wissen Gestaltung,
Berlin 2015, S. 79–85. Zum Visualprimat bzw. Okularzentrismus in der Sinneshierarchie vgl. Mark
M. Smith, Sensory History, Oxford 2007, S. 9–11.
38 BArchK, B 295/7434, Dokumentation des bayerischen Landesamts für Umweltschutz, S. 14. Auf ei-
ner Fläche von circa 1000 m2 betrug die Schwefelkonzentration mehr als 2000 parts per million (ppm),
während vergleichbare Höchstbelastungen sich über lediglich 400 m2 erstreckten. Die Abkürzung ppm
war bis 1992 üblich. Vgl. Irene Mueller-Harvey/Richard M. Baker, Chemical Analysis in the Laboratory:
A Basic Guide, Cambridge 2002, S. 41.
VfZ 2 / 2023Bodo Mrozek und Doubravka Olšáková | Die Katzendreckgestank-Affäre 321
wiesen – „typische Begleitsubstanzen zusammen mit noch geruchsaktiveren
flüchtigen Schwefelverbindungen“, wie sie bei der Braunkohleverkokung ent-
standen.39 Wenn nähere Untersuchungen auch noch ausstanden, so vermutete
man die Ursprünge im Braunkohlekraftwerk Tisová im Industriegebiet von
Sokolov, in Chemiewerken in Vřesová,40 beide etwa 30 Kilometer östlich der
bayerisch-tschechischen Grenze, sowie in einer grenznahen Fabrik in der DDR.
Um die mutmaßlichen Emittenten damit zu konfrontieren, mussten zunächst
Ausmaß und Wirkung der Geruchsplage näher bestimmt werden.
Räumlich erstreckten sich die Beschwerden den Messungen zufolge allein in
Bayern über ein etwa 100 mal 30 km großes Gebiet, in dem rund 100 000 Men-
schen lebten.41 Nach einem Aufruf der Christlich-Sozialen Union (CSU) in Arz-
berg meldeten sich 175 Betroffene und gaben Symptome wie Schlaflosigkeit,
Luftmangel, Herzklopfen oder Entzündung der Atemwege zu Protokoll.42 Um
die Auswirkungen des „Katzendreckgestanks“ genauer zu analysieren, verfügte
der Ministerrat im Januar 1980 eine medizinische Untersuchung: Toxikologen
des Münchner Universitätsklinikums rechts der Isar gingen der Frage nach,
ob nicht nur subjektive, sondern auch „objektivierbare gesundheitliche Beein-
trächtigungen“ zu konstatieren seien. Das im Februar 1983 vorgelegte Gut-
achten bejahte diese Frage, da es bei betroffenen Personen zu physiologischen
Symptomen von Reizungen der Atemwege bis zur „Besiedlung mit pathogenen
Keimen“ gekommen war.43 In der übelriechenden Luft machten die Toxikolo-
gen neben der „leicht messbaren Leitsubstanz“ SO2 eine Mischung verschie-
39 Hierzu und zum Folgenden BArchK, B 295/7434, Dokumentation des bayerischen Landesamts für
Umweltschutz.
40 PA/AA, B 42/ZA 139674, Bundesinnenministerium (BMI), gez. Dr. Pettelkau, an das Auswärtige
Amt (AA), Referat 414, betr. Geruchsbelästigungen im nordostbayerischen Grenzraum, 20.2.1980, und
BMI, gez. Dr. Pettelkau, an AA, betr. Geruchsbelästigung im nordostbayerischen Grenzraum, 7.3.1980.
Das Werk Barvy a Laky (Farben und Lacke) stellte Druckfarben, Zinkweiß, Sprühputze, PVC-Beläge und
Aerosole her; die Chemischen Werke Sokolov produzierten Kalkstickstoff, Borax, Soda, Ferrochrom, Na-
triumchlorat und verschiedene Säuren.
41 BayHStA, Minn 111158, Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen (künftig:
StMLU): Geruchsbelästigungen im nordostbayerischen Raum, hier: Vollzug des Ministerratsbeschlusses
vom 15.1.1980 – Medizinische Untersuchungen, 29.1.1980.
42 BayHStA, Minn 111158, Aufruf der CSU Arzberg zur Meldung von Personen, die sich durch „katzen-
dreckartig“ riechende Luftverschmutzung gesundheitlich geschädigt oder beeinträchtigt fühlen, Februar
1980.
43 Bayerisches Staatsministerium für Landesentwicklung und Umweltfragen: Medizinische Unter-
suchungen über die Zusammenhänge von Immissionsbelastungen und gesundheitliche Beeinträchtigun-
gen im nordostbayerischen Raum. Toxikologische Abteilung der II. Medizinischen Klinik und Poliklinik
rechts der Isar der Technischen Universität München, Leitender Arzt: Priv. Doz. Dr. med. Max von Clar-
mann, München 1983, S. 58.
VfZ 2 / 2023322 Bodo Mrozek und Doubravka Olšáková | Die Katzendreckgestank-Affäre
dener Gifte in unterschiedlichen Konzentrationen aus.44 Bestünde auch keine
akute Gefahr, so könnten doch „langfristig wirksame chronische toxische Ein-
wirkungen“ nicht ausgeschlossen werden.
Ergänzt wurde die Studie von dem „nervenärztlichen Gutachten“ einer
psychiatrischen Klinik, in der 44 geruchsbeeinträchtigte Menschen unter-
sucht wurden, zu deren Symptomen neben vegetativen Störungen „Abgeschla-
genheit, mißmutig-depressive Verstimmungen“ sowie ein „Gefühl der Ver-
zweiflung“ gehörten, das sich dadurch verstärkte, dass die Beschwerden nicht
ernst genommen wurden. Mindestens eine Patientin habe im „Katzendreck-
gestank“ sogar „eine echte Depression mit Lebensunlust und Selbsttötungsten-
denzen“ entwickelt.45 Die abschließende psychiatrische Diagnose fiel ähnlich
vage aus wie die toxikologische, hielt aber einen Zusammenhang der Beschwer-
den mit der Geruchsbelästigung für „immerhin möglich“. Beide Gutachten gin-
gen weiter als die allgemein gehaltene NUKEM-Studie, denn sie untersuchten
die Auswirkungen von Übelgerüchen an einem konkreten Fall.
Durch diese gutachterliche Vermessung des menschlichen Sensoriums such-
ten sich Regierungen regelhafte Handlungsspielräume – oder gegebenenfalls
solche für Nicht-Handeln – zu verschaffen, die auch im zwischenstaatlichen
Konflikt noch eine Rolle spielen sollten. Mit ihrem wiederholten Verweis auf
die Subjektivität von Wahrnehmungen wiesen die Expertisen jedoch die Nor-
malisierbarkeit des Geruchssinns in die Schranken: Sensiblen Nasen war mit
dem Verweis auf die Nichtüberschreitung von Richtwerten nicht gedient.46
Gleichzeitig erfassten die Gutachten die Wirkung von Übelgerüchen über das
rein sensorische Nasenriechen hinaus auch in seinen Langzeitwirkungen auf
den gesamten Menschen – und trugen so zur Etablierung eines erweiterten Ver-
ständnisses von Geruch bei.
IV. „Bedrohlicher als Atomkrieg“: Der „Katzendreckgestank“ im
Bundestag
Im März 1982 wurde das Problem auch auf Bundesebene prominent diskutiert.
Mit einer Kleinen Anfrage brachte eine Gruppe von 32 Bundestagsabgeordneten
44 U. a. Dimethylnaphthalin, Halogenkohlenwasserstoff, Kohlendioxidsulfid, Monomethylnaphthalin
und verschiedene Schwefelverbindungen.
45 BayHStA, Minn 111158, Psychiatrische Klinik und Poliklinik rechts der Isar der Technischen Uni-
versität München, Direktor Prof. Dr. Hans Lauter: Nervenärztliches Gutachten, 26.11.1982.
46 Vgl. Jürgen Link, Versuch über den Normalismus. Wie Normalität produziert wird, Göttingen 52013.
VfZ 2 / 2023Bodo Mrozek und Doubravka Olšáková | Die Katzendreckgestank-Affäre 323
der Unionsfraktion den „Katzendreckgestank“ ins Parlament.47 Vier Punkte der
Anfrage galten der DDR: Seit wann und wie die Bundesregierung – gleichsam
geruchspolitisch – gegen sie vorgehe, ob das „Verursacherprinzip“ zur Geltung
gebracht worden sei, ob über die Frage der Verlängerung zinsloser Überziehungs-
kredite Druck ausgeübt werden könne oder der DDR nur hohe Geldzahlungen
angeboten würden. Letzteres lehnten die Unterzeichneten mit deutlichen Wor-
ten ab: Es gehe „nicht an, daß die Bundesrepublik Deutschland auch hierbei er-
neut nur als großzügiger Finanzier auftritt, der durch hohe Geldzuwendungen
den notorisch ineffizient arbeitenden sozialistischen Zentralverwaltungswirt-
schaften die Erfüllung ihrer Verpflichtungen finanziert“. Auch gegen das „völ-
kerrechtswidrige Verhalten“ der ČSSR forderte die Fraktion ein entschlossenes
Vorgehen. Dringlich empfohlen wurden „über den Rahmen von Experten-
gesprächen hinausgehende, am Grundgedanken des Verursacherprinzips orien-
tierte, nachdrücklich und politisch hochrangig geführte Verhandlungen“ mit
den Regierungen beider sozialistischer Nachbarstaaten. Mit anderen Worten:
Die Unionsfraktion plädierte dafür, die Katzendreckgestank-Affäre auf diploma-
tisches Parkett bringen. Die grenzüberschreitende Geruchsbelästigung wurde
damit im Kontext des Kalten Kriegs in doppelter Weise instrumentalisiert:
Außenpolitisch unterstrichen Christdemokraten und Christsoziale ihre Forde-
rung nach einer härteren Gangart gegenüber den Ostblockstaaten, innenpoli-
tisch übten sie Kritik an der sozialliberalen Entspannungspolitik. Auch die Presse
griff das Geruchsproblem auf und dramatisierte es sogar, wie die Überschrift „Be-
drohlicher als Atomkrieg – Arzt warnt vor Lungenpest“ verdeutlicht.48
In ihrer Entgegnung gab die Bundesregierung an, sie sei über den Fall aus Bay-
ern hinlänglich informiert. Die „Verursacher der als ‚Katzendreckgestank‘ be-
zeichneten Geruchsbelästigung“ seien demnach in der ČSSR zu suchen, während
die SO2-Immissionen „hauptsächlich aus der CSSR und der DDR hervorgerufen“
würden.49 Identifiziert wurde der Volkseigene Betrieb (VEB) Zellstoff- und Pa-
pierfabrik Rosenthal in Blankenstein an der Saale, wo auf Drängen der Bundes-
regierung Ende 1980 bereits Filter in die Schornsteine eingebracht worden sei-
en. Die Bundesregierung wolle sich aber weiterhin um die Durchsetzung des
47 Deutscher Bundestag, Drucksache 9/1527 vom 30.3.1982: Grenzüberschreitende Luftverunreini-
gungen aus DDR und CSSR. Kleine Anfrage der CDU/CSU-Fraktion; die Zitate finden sich auf S. 1–3;
dserver.bundestag.de/btd/09/015/0901527.pdf [28.1.2023].
48 Zitieren ließ sich damit der Bad Stebener Kurarzt Dr. med. Hans Fersch; Frankenpost vom
2.12.1982: „Bedrohlicher als Atomkrieg – Arzt warnt vor Lungenpest“.
49 Deutscher Bundestag, Drucksache 9/1569 vom 13.4.1982: Antwort der Bundesregierung – Grenz-
überschreitende Luftverunreinigungen aus DDR und CSSR; dserver.bundestag.de/btd/09/015/0901569.
pdf [30.1.2023].
VfZ 2 / 2023324 Bodo Mrozek und Doubravka Olšáková | Die Katzendreckgestank-Affäre
Verursacherprinzips bemühen, was „im zwischenstaatlichen Bereich generell –
nicht nur im Verhältnis zur DDR – jedoch nur begrenzt möglich“ und „nur in
zähen und geduldigen Anstrengungen aller Beteiligten“ zu erreichen sei. Zudem
gab man zu bedenken, dass auch vom Bundesgebiet grenzüberschreitende Belas-
tungen ausgingen und die vorherrschende Windrichtung von Westen nach Os-
ten gehe. Mit Blick auf die ČSSR zeigte sich die Bundesregierung aber bereit, die
Gespräche über den „Katzendreckgestank“ auf ministerielle Ebene zu heben.
Besonders in Bayern drängten Landespolitiker zur Aufnahme diplomatischer
Geruchsverhandlungen.50 Im Februar 1979 hatte Umweltminister Alfred Dick
(CSU) den Außenminister über „extrem starke Geruchsbelästigungen infor-
miert, die teilweise zu erheblichen physiologischen Reaktionen wie Erbrechen
und Atembeschwerden bei der betroffenen Bevölkerung“ geführt hätten, und
deswegen „dringend“ um Verhandlungen mit der ČSSR ersucht.51 Hans-Diet-
rich Genscher von der Freien Demokratischen Partei (FDP) antwortete umge-
hend, man habe vertraulich erfahren, die ČSSR habe sich bereits entschlossen,
„die bestehenden Anlagen mit modernen Vorkehrungen gegen weissen Rauch“
auszustatten.52 Er beschwichtigte mit der Hoffnung, es werde „eine gewisse
Entlastung in der Geruchsbelästigung in Bayern schon bald eintreten und das
Problem bis 1980 gelöst sein“.53 Dies war eine optimistische Prognose, die sich
so nicht erfüllen sollte. Auch der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vor-
sitzende Franz Josef Strauß schaltete sich in die Affäre ein. Er forderte Bundes-
kanzler Helmut Schmidt und Außenminister Genscher auf, „persönlich“ auf die
Regierung der ČSSR einzuwirken, zumal der Unmut in der Bevölkerung signifi-
kant zugenommen habe. Beamte des Umweltministeriums würden mittlerweile
sogar „in nächtlichen Anrufen mit beleidigenden Vorwürfen angegriffen“.54
Schmidt antwortete zurückhaltend, was einen finanziellen Beitrag der Bundes-
republik und eine gemeinsame Grenzkommission anging, war aber bereit, auf
Expertengespräche zu drängen.55
50 PA/AA, B 42/ZA 139674, Landtagsabgeordneter Peter Jacobi (FDP), an Hans-Dietrich Genscher,
14.2. und 27.3.1979.
51 PA/AA, B 42/ZA 139674, Telex aus dem StMLU an Hans-Dietrich Genscher, 20.2.1979.
52 Dies hatten den Grenzbehörden zuvor vertraulich auch bundesdeutsche Bergbauspezialisten berich-
tet, die in der ČSSR ein Verfahren zur Rauchgasentschwefelung vorgeführt hatten. BayHStA, Präsidium
der Grenzpolizei 631, Mitteilungen von Reisenden am 8.3.1979.
53 PA/AA, B 42/ZA 139674, Hans-Dietrich Genscher an Alfred Dick, undatiert.
54 PA/AA, B 42/ZA 139674, Franz Josef Strauß an Helmut Schmidt, 25.1.1980, und an Hans-Dietrich
Genscher, 27.3.1979 und 30.1.1980.
55 BArchK, B 136/30460, Helmut Schmidt an Franz Josef Strauß, 14.3.1980.
VfZ 2 / 2023Bodo Mrozek und Doubravka Olšáková | Die Katzendreckgestank-Affäre 325
Tatsächlich boten sich vor dem Hintergrund des Kalten Kriegs nur wenige
Druckmittel, und blockübergreifende Rechtsnormen oder gar Verträge waren
kaum vorhanden. Auch national war die Gesetzgebung zum Immissionsschutz
noch jung: In der Bundesrepublik war 1974 das Bundes-Immissionsschutzgesetz
in Kraft getreten.56 In der DDR galten bereits seit 1966 Maßnahmen zur Rein-
haltung der Luft,57 die jedoch unverbindlich waren und in der Praxis kaum Kon-
sequenzen hatten. In der ČSSR bestanden ein Gesetz zum Schutz der Atmosphä-
re von 1967, Wasserschutzgesetze von 1973 und ein Forstgesetz von 1977,58 die
nach Einschätzung „kompetenter“ – also nachrichtendienstlicher – Quellen je-
doch „nichts bewirkt“ hatten.59 Ob sich die Tschechoslowakei auf die völker-
rechtliche Verpflichtung zur gegenseitigen Rücksichtnahme festlegen lasse,
wurde daher bezweifelt.60 Zwischen der DDR und der ČSSR gab es verschiede-
ne Kooperationen zur Reinhaltung der Luft im Rahmen des Komplexpro-
gramms des Rats für gegenseitige Wirtschaftshilfe (RGW).61 Zwischen der
Bundesrepublik und der DDR wiederum bestand immerhin der Grundlagenver-
trag von 1972, in dessen Zusatzprotokoll „schadensverhütende Vereinbarun-
gen“ vorgesehen waren. International galten ein der Umwelt gewidmetes Kapi-
tel der Schlussakte der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in
Europa (KSZE) von 1975 und das multilaterale Genfer Übereinkommen über
weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreinigung von 1979, das jedoch
erst 1983 in Kraft trat und ebenfalls nur schwer durchsetzbar war.62
56 Bundesgesetzblatt (künftig: BGBl.) 1974, Teil I, S. 721–743: Gesetz zum Schutz vor schädlichen
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge
(Bundes-Immissionsschutzgesetz) vom 15.3.1974.
57 Bundesarchiv Berlin (künftig: BArchB), DC 20/I/4/1412, Bl. 196, Beschluß über Maßnahmen zur
Reinhaltung der Luft – Auszug, 1.10.1966, sowie Gesetzblatt der DDR 1973, Teil I, S. 157–162: Fünfte
Durchführungsverordnung zum Landeskulturgesetz – Reinhaltung der Luft vom 17.1.1973.
58 Vgl. Zdeněk Madar, Právo socialistických států a péče o životní prostředí, Prag 1983, und Barbara
Rhode (Hrsg.), Air Pollution in Europe. A Collection of Country Reports on Air Pollution and National
Policies, Bd. 2: Socialist Countries, Wien 1988.
59 BArchK, B 295/7436, Verschlusssache Aufzeichnung der Unterabteilung Technik und Wissenschaft
(TWI) des Bundesnachrichtendiensts, nur für den Dienstgebrauch: Umweltsituation in der ČSSR. Ver-
such einer Zusammenfassung von Fakten und Eindrücken, 8.3.1982.
60 BArchK, B 295/7433, Ministerialrat a. D. Jäger an Ministerialdirektor Buchner, betr. Geruchsbelästi-
gung aus der ČSSR im nordostbayerischen Grenzgebiet, 1.2.1982.
61 PA/AA, B 42/ZA 109272, Der Umweltschutz der DDR im Rahmen des RGW, VS – Nur für den
Dienstgebrauch, 16.10.1971, S. 12. Vgl. Huff, Natur und Industrie, S. 225–241, und A. V. Leont’eva, New
Aspects in the Structure and Jurisdiction of the COMECON regarding the Protection of the Environment,
in: Environmental Law Review 7 (1989), S. 179–183.
62 Vgl. Europa-Archiv 1972, D 68–76: Zusatzprotokoll zum Vertrag über die Grundlagen der Beziehun-
gen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik, 21.12.1972.
VfZ 2 / 2023326 Bodo Mrozek und Doubravka Olšáková | Die Katzendreckgestank-Affäre
V. Geruchsdiplomatie – das Amt und der „Katzendreckgestank“
Dennoch hatte das Auswärtige Amt (AA) bereits im März 1978 die „geruchs-
intensiven Emissionen“ über die Botschaft in Prag sowie bei einem Treffen Gen-
schers mit Staatpräsident Gustáv Husák zur Sprache gebracht.63 Diese frühen
Interventionen waren jedoch auf Widerstand gestoßen. Daher erwog man,
„wegen der Bedeutung der Angelegenheit“ den Botschafter der ČSSR einzube-
stellen, um ihm „den deutschen Standpunkt zu verdeutlichen“; auch demar-
chierte der deutsche Botschafter in Prag beim Vize-Außenminister.64 Staats-
sekretär Peter Hermes machte dem Prager Botschafter Jiří Götz im April 1979
„eindringlich“ die „politische Bedeutung des Immissionsproblems für das
deutsch-tschechoslowakische Verhältnis“ deutlich.65 Botschafter Götz, ein Jä-
ger, der „nach anfänglichem Zögern“ zu erkennen gab, mit dem Problem aus
eigener waidmännischer Erfahrung aus den Wäldern um Karlovy Vary vertraut
zu sein, sprach sich schließlich für Expertengespräche aus. Und auch der sozi-
aldemokratische Staatsminister Klaus von Dohnanyi regte im August beim Mi-
nisterpräsidenten der Tschechischen Sozialistischen Teilrepublik, Josef Korčák,
noch einmal „eilbedürftig“ eine Expertenkommission an, weil der bevorstehen-
de Herbst die Bevölkerung wieder verstärkte Belastungen befürchten ließ.66
Die Schlussakte von Helsinki regelte in Punkt 5 u. a. die „Bekämpfung der Luftverschmutzung, Entschwe-
felung von fossilen Brennstoffen und von Abgasen; Bekämpfung der Verschmutzung durch Schwerme-
talle, Partikel, Aerosole, Stickstoffoxyde, insbesondere solche, die von Verkehrsmitteln sowie Kraft-
werken und sonstigen Industrieanlagen ausgeschieden werden [. . .] einschließlich der Verbreitung von
luftverschmutzenden Stoffen über weite Entfernungen“; www.osce.org/files/f/documents/6/e/39503.
pdf [30.1.2023]. Das Genfer „Übereinkommen über weiträumige grenzüberschreitende Luftverunreini-
gung“ wurde im Rahmen der United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) unterzeichnet und
trat am 16.3.1983 in Kraft; Protokolltext in Updated Handbook for the 1979 Convention on Long-
range Transboundary Air Pollution and its Protocols, hrsg. von der UNECE, New York/Genf 2015,
S. 15–21.
63 Vgl. Hofer Anzeiger/Frankenpost vom 24.4.1978: „Minister Dr. Dohnanyi beantwortet Anfrage we-
gen Katzendreck-Geruchs“. Erste Kontaktaufnahmen erfolgten schon 1976; PA/AA, B 38/ZA 139248,
Umweltzusammenarbeit mit ČSSR, hier: Chronologie der bisherigen Bemühungen zum Problem der Luft-
verschmutzung in Nordostbayern, 19.3.1986.
64 PA/AA, B 42/ZA 139674, Abt. 4, Vermerk des Vortragenden Legationsrats Dr. Hoffmann für den
Staatssekretär, betr. Geruchsbelästigung im nordostbayerischen Grenzraum, April 1979, sowie Sprech-
zettel, Gesprächsziel: Vereinbarung von Expertengesprächen oder tschechoslowakische Zusage über Be-
endigung der Geruchsemissionen, 7.3.1979.
65 PA/AA, B 42/ZA 139674, Vermerk, 27.4.1979, betr. Gespräch Staatssekretär Hermes mit Botschaf-
ter Götz über Geruchsbelästigung im bayerischen Grenzraum am 26.4.1979.
66 PA/AA, B 42/ZA 139674, Klaus von Dohnanyi an Josef Korčák, August 1979.
VfZ 2 / 2023Bodo Mrozek und Doubravka Olšáková | Die Katzendreckgestank-Affäre 327
Doch noch bei einer Sitzung der Umweltberater der Wirtschaftskommission
der Vereinten Nationen für Europa67 im November 1979 in Genf verwahrten
sich ČSSR-Umweltexperten gegen den Vorwurf, der „Katzendreckgestank“
habe seinen Ursprung auf ihrem Gebiet.68 Die Einrichtung einer gemeinsamen
Grenzkommission hingegen wurde von Seiten der ČSSR durchaus gewünscht.
Hier bremste das Auswärtige Amt, auch weil grenzüberschreitende Emissionen
„eine durchaus zweischneidige Angelegenheit“ darstellten. Schließlich hatte
die tschechoslowakische Seite wiederholt die Einleitung von Giftstoffen wie
Quecksilber in gen Osten fließende Gewässer wie Röslau/Reslava oder Eger/
Ohře moniert. Daher mahnte man im AA zu bilateraler Vorsicht.69
Die von Bundesinnenminister Gerhart Baum (FDP) vorgeschlagene Aufnah-
me des Geruchsproblems in den Aufgabenkatalog einer Grenzkommission hiel-
ten die Diplomaten für „weder wünschenswert noch realisierbar“, da bestehen-
de bayerisch-tschechische Einrichtungen wie die Grenzgewässerkommission
und die Grenzpolizeibeauftragten nur äußerst beschränkte Kompetenzen hat-
ten und die tschechoslowakische Seite auf eine Ausweitung äußert sensibel rea-
gieren könnte.70 Gespräche über transnationale Probleme berührten den
Grenzverlauf, der jedoch gerade zwischen Bayern und der ČSSR umstritten
war.71 Die Einrichtung einer gemeinsamen Grenzkommission war bereits Jahre
zuvor gescheitert, weil die Bundesrepublik aus deutschlandpolitischen Gründen
auf einer West-Berlin-Klausel beharrt hatte. Das hatte die ČSSR jedoch mit dem
Hinweis verweigert, über keine Grenze mit Berlin zu verfügen.72
67 Vgl. dazu Sophie Lange, Die Genfer Konvention der UN ECE von 1979 über weiträumige Luftver-
schmutzung, in: Themenportal Europäische Geschichte, 2022; www.europa.clio-online.de/essay/id/
fdae-98763 [18.2.2022].
68 PA/AA, B 42/ZA 139674, Fernschreiben (verschlüsselt) betr. Geruchsbelästigungen im nordostbaye-
rischen Grenzraum, 13.11.1979.
69 PA/AA, B 42/ZA 139674, AA (intern) an das Referat 414, 31.10.1980.
70 Die zuständige Referatsleiterin im AA, Renate Finke-Osiander, befürchtete, eine Kompetenzerwei-
terung dieser von Seiten der ČSSR nur „mit Skepsis geduldet[en]“ Kommission könnte „deren Existenz in
Frage stellen“. PA/AA, B 42/ZA 139674, AA (intern) an Referat 414, betr. Behandlung des Problems in
bestehender bayrisch-tschechischer Grenzgewässerkommission, 3.12.1979.
71 Archiv des Außenministeriums der Tschechischen Republik (künftig: AMZV), Territorial-Depart-
ment (TO-T) 1980–89, Land: Bundesrepublik Deutschland, Inv. Nr. 016 812/80-4, Tajné – NSR –
Návštěva ministra zahraničí H.-D. Genschera v ČSSR/návrh do P ÚV KSČ [Besuch von Außenminister
H.-D. Genscher in der ČSSR/Vorschlag an das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Tschecho-
slowakei], 14.11.1980.
72 Unterlagen vom Januar 1978 finden sich in: Národní archiv (Tschechisches Nationalarchiv, künftig:
NAČR), Zentralkomitee der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei (künftig: PÚVKSČ), Ordner
Gustáv Husák, Box 1245 (415), Inv. Nr. 11615; dazu auch NAČR, PÚVKSČ, Akte P27/81, Inv. Nr. 19,
Úprava spolupráce na státních hranicích mezi ČSSR a NSR [Modalitäten der Zusammenarbeit an der
VfZ 2 / 2023328 Bodo Mrozek und Doubravka Olšáková | Die Katzendreckgestank-Affäre
Der „Katzendreckgestank“ bot nun die Gelegenheit, doch noch eine Grenz-
kommission – diesmal freilich ohne Anerkennung West-Berlins – einzurichten,
die sich die Diplomaten der ČSSR nicht entgehen ließen.73 Ihre beharrliche
Weigerung, das Geruchsproblem an anderer Stelle als in einer gemeinsamen
Grenzkommission zu besprechen, war also nicht alleine durch ein Herunter-
spielen der eigenen Immissionen motiviert, sondern folgte größeren außenpoli-
tischen Linien – und zeitigte Erfolg: Im Bundesaußenministerium willigte man
Ende 1981 in die Ernennung von Grenzbevollmächtigten ein.74 Offiziell gab es
damit zwar noch immer keine gemeinsame Grenzkommission, da kein Staats-
vertrag bestand, der ein solches Gremium festgeschrieben hätte, aber die Er-
nennung Bevollmächtigter bot die Möglichkeit, ohne Abkommen in Verhand-
lungen einzutreten.
Bei den ersten Treffen der deutsch-tschechoslowakischen Grenzbevollmäch-
tigten im März 1982 in Cheb und im Juni in Regensburg überreichte der zum
Bevollmächtigten für Grenzangelegenheiten ernannte Ministerialrat Gerhard
Köhler eine mit Geruchskarten illustrierte Dokumentation.75 Die Experten der
ČSSR unter Leitung des Unterhändlers Emanuel Havlík gaben sich „erstaunt
über die deutschen Probleme“. Sie hätten selbst nicht über ausreichende Mess-
ergebnisse verfügt, nach dem Hinweis auf die „strengen“ eigenen Umweltge-
setze jedoch eingeräumt, dass brennende Tagebaue, speziell ein Kombinat in
Vřesová, „theoretisch in Frage“ kämen. Wegen der Ressourcenknappheit sei
jedoch keine schnelle Lösung zu erwarten – ein Fingerzeig auf angestrebte De-
visentransfers oder Kredite aus dem Westen.76 Köhler mahnte deswegen ein
„behutsames Vorgehen“ an.77
Staatsgrenze zwischen der ČSSR und der BRD], 8.12.1981; PA/AA, B 42/ZA 139674, Sachstand Geruchs-
belästigung im nordostbayerischen Grenzraum, 7.3.1979, sowie Einschätzung Dietrich von Brühls im Auf-
trag des Bundesaußenministers, 19.1.1981.
73 NAČR, PÚVKSČ, Akte P27/81, Inv. Nr. 19, Úprava spolupráce na státních hranicích mezi
Československou socialistickou republikou a Německou spolkovou republikou [Modalitäten der Zusam-
menarbeit an der Staatsgrenze zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Bun-
desrepublik Deutschland], 8.12.1981.
74 PA/AA, B 42/ZA 139674, Vermerk betr. Geruchsbelästigung im nordostbayerisch-tschechoslowaki-
schen Grenzbereich, hier: Behandlung des Problems durch die Grenzbevollmächtigten, 22.12.1981.
75 BArchK, B 295/7435, Referat P II 1 (Gerhard Köhler), 15.11.1982, betr. Deutsch-tschechoslowakische
Grenzbevollmächtigte; hier: drittes Zusammentreffen am 23./24.11.1982.
76 BArchK, B 295/7434, Bericht Dr. Pettelkaus über die Dienstreise vom 24.–25.6.1982 nach Regens-
burg.
77 BArchK, B 295/7434, Gerhard Köhler an „Herrn Minister“, betr. Deutsch-tschechoslowakische
Grenzbevollmächtigte, 15.7.1982.
VfZ 2 / 2023Bodo Mrozek und Doubravka Olšáková | Die Katzendreckgestank-Affäre 329
Unterdessen hatte die Frankenpost über „politisches Taktieren“ der Tsche-
choslowaken in der Kommission berichtet.78 Hintergrund war die Verweige-
rung gemeinsamer Messungen; „für eine solche Maßnahme“ sei der „Abschluß
einer Regierungsvereinbarung“ erforderlich, „ähnlich wie es z. B. in der Bezie-
hung zwischen der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik und der Pol-
nischen Volksrepublik ist“.79 Immerhin besuchte ein bayerischer Staatssekre-
tär im Januar 1982 Sokolov, wo er zwar „zwölf Schlote qualmen“ sah, es aber
„nicht gestunken“ habe, vermutlich aufgrund der Höhe der Schornsteine, die
ihre Emissionen weit ins Land transportierten.80
Auf ein Schreiben des bayerischen Landtagsabgeordneten Josef Grünbeck
(FDP) hin, der aus dem Bezirk Dux/Duchcov stammte, schaltete sich die Staats-
ministerin im AA Hildegard Hamm-Brücher (FDP) in die Affäre ein.81 Sie hielt
das Genfer Übereinkommen von 1979 für „das geeignete Instrument“ und
verwies auf die Stockholmer Umweltkonferenz von 1972, die allerdings von
allen Warschauer-Pakt-Staaten boykottiert worden war, weil eine Teilnahme
der DDR nicht vorgesehen war.82 Innenminister Baum wandte sich an den
zuständigen Minister für Technische und Investitionsentwicklung der ČSSR,
Ladislav Šupka, und berief sich auf einen Artikel der tschechoslowakischen
Wochenzeitung Tribuna,83 da auch die tschechischsprachige Presse über das Ge-
ruchsproblem berichtet hatte.84 Baum ergänzte sein detailliertes Angebot um
das eines „technisch-wissenschaftlichen Erfahrungsaustausch[s]“, versäumte
aber auch nicht den mahnenden Hinweis auf den notwendigen „Beitrag zur Er-
78 Frankenpost vom 6./7.3.1982: „Hart in der Sache“.
79 PA/AA, B 42/ZA 139674, Emanuel Havlík an Gerhard Köhler, 29.9.1982 (Übersetzung aus dem
Tschechischen).
80 Frankenpost vom 22.1.1982: „Staatssekretär Fischer vom bayerischen Umweltministerium: Thema
Katzendreckgestank wird Völkerrechtsfrage“.
81 BArchK, B 295/7434, Hildegard Hamm-Brücher an Josef Grünbeck, Bonn, 11.8. (o.J.).
82 Vgl. Jiří Janáč/Doubravka Olšáková, On the Road to Stockholm: A Case Study of the Failure of Cold
War International Environmental Initiatives (Prague Symposium, 1971), in: Centaurus 63 (2021), S. 132–
149; Astrid Mignon Kirchhof, East Germany’s Fight for Recognition as a Sovereign State. Environmental
Diplomacy as Strategy in Cold War Politics, in: Dies./J. R. McNeill (Hrsg.), Nature and the Iron Curtain.
Environment Policy and Social Movements in Communist and Capitalist Countries 1945–1990, Pitts-
burgh 2019, S. 219–232, hier S. 230, und Thorsten Schulz-Walden, Anfänge globaler Umweltpolitik. Um-
weltsicherheit in der internationalen Politik (1969–1975), München 2013, S. 177–186.
83 BArchK, B 295/7435, Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, Prag, an das Auswärtige Amt, betr.
Umweltbelastung in der ČSSR, 27.4.1983.
84 Darunter sogar das Zentralorgan der Kommunistischen Partei; vgl. Rudé Právo vom 1.6.1983: „Der
Schutz der Reinheit der Luft. Geldstrafen sind nur eine nachträgliche Lösung“. Eine Übersetzung findet
sich im BArchK, B 295/7436.
VfZ 2 / 2023Sie können auch lesen