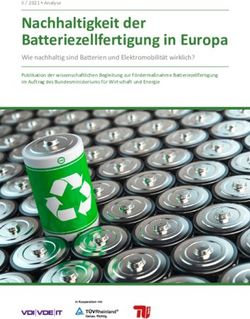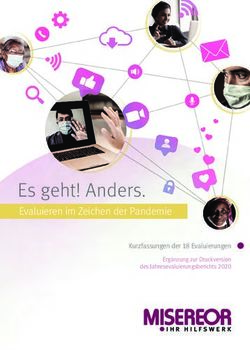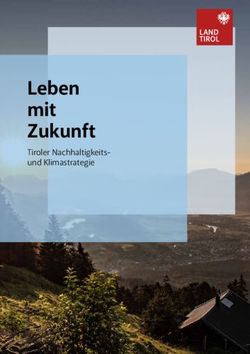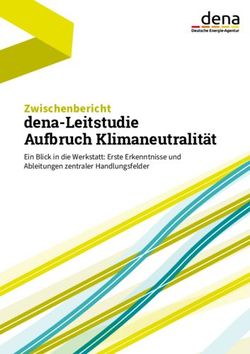Europapolitische Positionen 2023 - der IHK-Organisation GemeinsamEuropaGestalten
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
2 | E UR O PA P OLITISCH E P OS I TI O NEN 2 02 3 D ER I HK-O RGAN I S ATI ON
Impressum
Ansprechpartner im DIHK:
Christopher Gosau
Leiter des Referats Europäische Wirtschaftspolitik
gosau.christopher@dihk.de
+32 2 286-1661
Herausgeber und Copyright
© Deutsche Industrie- und Handelskammer
Berlin | Brüssel
Fachbereich Europa
Alle Rechte liegen beim Herausgeber. Ein Nachdruck – auch auszugsweise –
ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.
DIHK Berlin
Postanschrift: 11052 Berlin | Hausanschrift: Breite Straße 29 | Berlin-Mitte
Telefon: 030 20308-0 | Telefax: 030 20308-100
DIHK Brüssel
Vertretung der Deutschen Industrie- und Handelskammer bei der Europäischen Union
19 A-D, Avenue des Arts | B-1000 Bruxelles
Telefon: +32 2 286-1611 | Telefax: +32 2 286-1605
info@dihk.de
www.dihk.de
Grafik
Friedemann Encke, DIHK
Bildnachweis
© Getty Images
Stand
März 2023E UROPAPOLI TI S C HE POS I TI ON E N 2 02 3 DE R I HK -ORGA N I SAT I O N | 3 Inhalt Binnenmarkt: Europas Herzstück verwirklichen, offene Grenzen bewahren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 International: Märkte öffnen, Barrieren abbauen, Lieferketten absichern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Corporate Social Responsibility: Nachhaltiges Wirtschaften unterstützen, Gestaltungsspielräume bewahren . . . . . . . . . . . 9 Sustainable Finance: Finanzierung der Transformation fördern statt erschweren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 EU-Haushalt, NGEU, Wirtschafts- und Währungsunion: Wettbewerbsfähigkeit stärken, Staatsschulden reduzieren . . . . . . . . . 14 Unternehmensfnanzierung und Finanzmärkte: Angemessen regulieren, Finanzierung ermöglichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Steuern: Standortwettbewerb annehmen, Steuern vereinfachen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Industrie und Innovation: Technologische Souveränität Europas stärken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Mittelstandspolitik: KMU als Basis für Wachstum stärken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Energie und Klima: Europäischen Energiemarkt vollenden, Klimaschutz international vorantreiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Umwelt: Effektiver Umweltschutz erfordert Augenmaß . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Verkehr und Mobilität: Wettbewerbsfähigkeit steigern, Integration vorantreiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Regional- und Strukturpolitik: Förderung auf Wirtschaftswachstum in den Regionen konzentrieren . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Digitaler Binnenmarkt: Verlässliche Voraussetzungen für eine wettbewerbsfähige Wirtschaft 4.0 schaffen . . . . . . . . . . 35 Fachkräftesicherung I: Alle Bildungspotenziale für die Betriebe nutzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Fachkräftesicherung II: Beschäftigung und Integration – Erwerbsbeteiligung steigern, Integration unterstützen . . . . . . . . . 42 Besseres Recht: Rechtsetzung und Rechtsdurchsetzung an den Grundsätzen von Klarheit, Einheitlichkeit und Praxisnähe ausrichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Europäisches Wirtschaftsrecht: Regulierung nicht als Selbstzweck, sondern zielorientiert und verhältnismäßig einsetzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Datenschutz: Umsetzung vereinfachen, Durchsetzung vereinheitlichen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Wettbewerbsrecht: Wettbewerb stärken, Fairness fördern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Medien und Kommunikation: Informationen gewährleisten, Monopole verhindern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
4 | E UR O PA P OLITISCH E P OS I TI O NEN 2 02 3 D ER I HK-O RGAN I S ATI ON
Ansprechpartner in der DIHK: Der Binnenmarkt wird auch durch Harmonisierungsmaßnah-
Dr. Julia Schmidt (Schmidt.julia@dihk.de) men verwirklicht. Harmonisierung ist aber kein Selbstzweck:
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten allein begründen
Binnenmarkt: Europas Herzstück keine Eingriffe in die nationalen Rechts- und Wirtschaftssyste-
verwirklichen, offene Grenzen me. Vielmehr sind diese Interventionen auf die streng erforder-
lichen Maßnahmen der Verwirklichung des Binnenmarktes zu
bewahren beschränken, insbesondere sollten Vorgaben für rein nationale
wirtschaftliche Sachverhalte – auch indirekter Art – vermieden
Der Europäische Binnenmarkt ist Herzstück und Antrieb für werden: das Subsidiaritätsprinzip bindet die EU und muss mehr
die europäische Wirtschaft. Er fördert Zusammenarbeit und Beachtung finden (vgl. Position Besseres Recht).
Wohlstand im Inneren der EU und stärkt ihre Souveränität und
Wettbewerbsfähigkeit nach außen. Ihn zu verwirklichen muss Wirtschaftskrisen können die Mitgliedstaaten in unterschiedli-
daher weiter das primäre Ziel der EU bleiben – auch und gerade cher Weise treffen und unter Umständen Maßnahmen erfor-
in Krisenzeiten, in denen wichtige Errungenschaften auf dem dern, die für die Verwirklichung des Binnenmarktes einen Rück-
Weg zum EU-Binnenmarkt wieder in Frage gestellt werden. schritt bedeuten. Solche den Binnenmarkt einschränkenden
Maßnahmen sollten nur als ultima ratio und zeitlich befristet
Folgende Leitlinien sollten das wirtschaftspolitische erfolgen dürfen.
Handeln bestimmen:
Ein Single Market Emergency Instrument (SMEI) kann die
• Offene Grenzen wahren; Einschränkungen des Binnenmark- Lehren und erfolgreichen Lösungsansätze aus der Pandemiezeit
tes vermeiden, verlässliche Krisenmechanismen entwickeln in permanente Mechanismen überführen, die bei neuen Krisen
– das Subsidiaritätsprinzip stärken kurzfristig helfen können. Grundsätzlich sollte gelten, dass ein
solcher Krisenmechanismus nur in extremen, klar zu definieren-
• Bürokratieabbau und Harmonisierung technischer Standards den Krisenfällen aktiviert wird. Ein präventives Monitoring von
für einen Dienstleistungs- und Warenverkehr ohne Beschrän- Lieferketten sollte aufgrund des damit für die Unternehmen
kungen vorantreiben verbundenen zusätzlichen Aufwandes auf wenige, strategisch
besonders wichtige Produkte begrenzt werden und die Anfor-
• Die digitale Verknüpfung von Verwaltungsverfahren vorantreiben derungen an die Datenlieferungen der Unternehmen möglichst
eng definiert und einfach zu erfassen sein. Soweit möglich,
• Effektiver Investitionsschutz stärkt den Binnenmarkt und sollte dabei auf Freiwilligkeit der Unternehmen gesetzt werden.
nutzt der Nachhaltigkeit Der Schutz von Geschäftsgeheimnissen ist in jedem Fall sicher-
zustellen. Die Anwendung des SMEI darf nicht zu Verwerfungen
Offene Grenzen wahren; Unvermeidliche Einschränkungen in der eigentlichen Lieferkette der betroffenen Unternehmen
des Binnenmarktes minimieren, verlässliche Krisenmecha- sowie zu einer Verschlechterung der Kunden-Lieferanten-Be-
nismen entwickeln – das Subsidiaritätsprinzip stärken ziehung führen, denen die Unternehmen auf Grund rechtlicher
bzw. vertraglicher Verpflichtungen nachzukommen haben. Hier
Offene Grenzen innerhalb der Europäischen Union bleiben müssen klare rechtliche Regularien bis hin zu Entschädigungs-
wichtigste Voraussetzung für die Vollendung des Binnenmarkts. zahlungen normiert werden, wenn Unternehmen aufgrund des
Ausnahmsweise notwendige Grenzkontrollen im Schengen- SMEI finanzielle Schäden entstehen.
Raum sollten den grenzüberschreitenden Verkehr von Unter-
nehmen möglichst wenig einschränken. Eine komplette Grenz- Bürokratieabbau und Harmonisierung technischer Stan-
schließung, wie zu Beginn der Corona-Pandemie im Frühjahr dards für einen Dienstleistungs- und Warenverkehr ohne
2020, darf sich nicht wiederholen. Gemeinsames Ziel von Union Beschränkungen vorantreiben
und Mitgliedstaaten sollte es sein, Diskriminierungen und
Beschränkungen für den freien Waren-, Dienstleistungs-, Per- Der wachsende Umfang an Anzeige-, Melde-, Statistik- und
sonen- und Kapitalverkehr abzubauen. Die hierfür eingesetzte Nachweispflichten kann den Warenverkehr stark einschränken
Single Market Enforcement Taskforce (SMET) sollte ergebniso- und ist daher gering zu halten (siehe auch Position EU-Wirt-
rientiert, transparent und unter Einbindung von Stakeholdern schaftsrecht). Vorgaben für Dienstleistungserbringer, z. B. in
aus der Wirtschaft arbeiten. Bezug auf Sprachkenntnisse, müssen reduziert werden, sofern
sie nicht aus zwingenden Gründen gerechtfertigt sind. Adminis-
Die EU ist eine Rechtsunion – der Binnenmarkt kann sich nur trative Anforderungen bei der Arbeitnehmerentsendung gilt es
durch klare rechtliche Maßgaben entfalten. Die Überfrachtung abzubauen und innerhalb der Europäischen Union zu vereinheit-
der wirtschaftlichen Grundfreiheiten mit gesellschaftlichen lichen. Die A1-Bescheinigung, welche bei den Mitgliedstaaten
Zielen wird in der Wirtschaft ganz überwiegend sehr kritisch unterschiedliche, vielfach überflüssige bürokratische Anforde-
gesehen. Denn auch die bedeutsamen und unstrittigen politi- rungen und Prozesse aufstellt, sei hier beispielhaft genannt.
schen Ziele der Union gehen der Verwirklichung des Binnen-
marktes nicht automatisch vor, sondern sind mit diesen zum Zur Förderung des freien Warenverkehrs sollten technische
Ausgleich zu bringen. Standards möglichst EU-weit harmonisiert werden. Um denE UROPAPOLI TI S C HE POS I TI ON E N 2 02 3 DE R I HK -ORGA N I SAT I O N | 5
grenzüberschreitenden Versandhandel nicht zu hemmen, Effektiver Investitionsschutz stärkt den Binnenmarkt und
müssen europäische Verpackungsvorschriften im B2C (Business nutzt der Nachhaltigkeit
to Consumer) – Bereich durch die Mitgliedstaaten einheitlich
umgesetzt werden. Die Belastung von Unternehmen durch Vielen gilt der Binnenmarkt durch die Grundfreiheiten und die
immer neue nationale Registrierungsvorschriften und Pflichten Rechtskontrolle durch den Europäischen Gerichtshof formal als
zur Benennung von Bevollmächtigten im Ausland sollten mini- vollständig. De facto ist der Binnenmarkt aus Sicht der Wirt-
miert werden. Informationen und Verwaltungsverfahren sollten schaft jedoch erst vollendet, wenn Geschäfte mit Kunden in
zukünftig online und neben der jeweiligen Landessprache anderen EU-Mitgliedsstaaten so einfach sind, wie mit Kunden
zumindest auch in englischer Sprache zur Verfügung zu stellen. innerhalb des eigenen Mitgliedstaates. Immer noch sind einzel-
ne Unternehmen durch Eingriffe u.a.in ihren Eigentumsrechten
Die Anpassungen bei der Intrahandelsstatistik haben für oder der Berufsausübung betroffen – ohne hinreichenden nati-
Unternehmen bislang nur einen erheblichen Mehraufwand onalen Rechtsschutz. Dies betrifft besonders die Rechtssicher-
durch zusätzliche Datenfelder in den Versendungsmeldungen heit von Investitionen in innovative, langfristige und mit hohen
verursacht. Die versprochene Vereinfachung des sogenannten Risiken behaftete Projekte, z.B. auch bei regenerativen Energien.
„Einstromverfahrens“ muss zügig umgesetzt werden. Melde- Die erzwungene Beendigung der innereuropäischen Investi-
schwellen müssen, auch unter Berücksichtigung der Inflation, tionsschutzverträge droht zu einer Investitionszurückhaltung
angehoben werden. auch in für den Green Deal zentralen Projekten zu führen. Die
EU sollte rasch alternative – und auch für KMU nutzbare –
Die digitale Verknüpfung von Verwaltungsverfahren Schutzmechanismen schaffen und Investitionsschutz allgemein
vorantreiben wieder als effektives Instrument der Investitionsförderung im
Binnenmarkt wie auch international anerkennen. Dazu gehört
Der Einheitliche Ansprechpartner (EA) sollte europaweit gleich es, Schiedsverfahren auch im Investitionsschutz als Teil der für
ausgestaltet und beworben werden; Verfahren müssen in erster Unternehmen notwendigen Rechtssicherheit anzuerkennen,
Linie auf digitalem Wege vereinfacht werden. Außerdem muss auch gerade um den aktuellen Wegfall der bilateralen Investiti-
er rechtlich so ausgestattet sein, dass er alle unternehmensre- onsschutzabkommen innerhalb der EU zu kompensieren.
levanten Prozesse anstoßen und begleiten kann. Der EA sollte
ferner die Gewerbeanmeldung durchführen können. Das Single
Digital Gateway ist ein Anfang, wobei sein Nutzen von der
Mitarbeit und konsequenten Umsetzung in den Mitgliedstaaten
abhängt. In der Zukunft sollten möglichst alle Verwaltungsver-
fahren, die beim grenzüberschreitenden Wirtschaften relevant
sind, online durchgeführt werden können, um so Aufwand
und Bürokratiekosten zu reduzieren. Voraussetzung hierfür ist
eine verlässliche, datenschutzkonforme und den Persönlich-
keitsschutz wahrende digitale Identität für natürliche Personen
und für Unternehmen. Auch für die Arbeitnehmerentsendung
sollten einheitliche, selbsterklärende und barrierefreie Melde-
portale zu Verfügung stehen, die auch auf Englisch ausgefüllt
werden können und Schritt-für-Schritt durch den Prozess
führen. Sie könnten zudem auch digitale Verfahren zur Über-
prüfung von anwendbaren Entlohnungsvorgaben und Mindest-
arbeitsbedingungen im jeweiligen Einsatzland vorsehen. Ein
digitaler Lohnrechner wäre wünschenswert. Die Vorgaben der
Richtlinie zur Durchsetzung der EU-Entsenderichtlinie sollten
von den einzelnen Mitgliedstaaten durch die praxistaugliche
Zurverfügungstellung von relevanten Informationen erfüllt
werden. Wichtig ist zudem ein Ansprechpartner im Heimat-
land, welcher auf Englisch kommunizieren kann und der bei
der Dienstleistungserbringung im Ausland unterstützt. Neben
digitalen Lösungen sollte für Unternehmen überdies möglichst
auch zusätzlich eine schriftliche, telefonische oder persönliche
Verfahrensabwicklung zur Verfügung stehen. Dennoch sollte
der digitale Prozess der führende sein. Hierzu sind konsequen-
tes Denken in End-to-End-Prozessen sowie Softwarearchitek-
turen entsprechend SaaS (Software as a Service) notwendig.
Jeder Service muss konsequent auf Automatisierungspotenziale
untersucht werden. Diese Vorgaben sollte der Gesetzgeber für
die öffentlichen Verwaltung formulieren.6 | E UR O PA P OLITISCH E P OS I TI O NEN 2 02 3 D ER I HK-O RGAN I S ATI ON
Ansprechpartner in der DIHK: beziehungen auszubauen. Änderungen von Lieferketten sollten
Klemens Kober (kober.klemens@dihk.de), in erster Linie unternehmerische Entscheidungen bleiben.
Carolin Herweg (herweg.carolin@dihk.de)
Bei Handelsschutzmaßnahmen gilt es das Interesse der Wirt-
International: Märkte öffnen, schaftszweige, die von den importierten Waren abhängen, mit
Barrieren abbauen, Lieferketten dem berechtigten Schutzinteresse gegen wettbewerbswidrige
Praktiken internationaler Handelspartner, die EU-Herstellern
absichern schaden, abzuwägen. Grundsätzlich sollten Schutzmaßnahmen
daher mit Augenmaß angewandt werden. Wichtig ist bei allen
Offene Märkte und regelbasierter internationaler Handel sind Maßnahmen eine frühzeitige und umfassende Einbeziehung
ein entscheidender Motor für Wohlstand und Beschäftigung der Wirtschaft. In diesem Rahmen könnte ein neues WTO-
in Deutschland, Europa und in der Welt. Die EU-Handelspolitik konformes EU-Instrument wirtschaftliche Zwangsmaßnahmen
sollte daher Unternehmen beim Ausbau ihrer Wettbewerbs- von Drittstaaten unterbinden bzw. abschrecken. Das 2022 in
position auf den Weltmärkten unterstützen, Protektionismus Kraft getretene EU-Instrument für das internationale Beschaf-
entgegentreten, Lieferketten durch möglichst multilaterale fungswesen (IPI) sollte in einer Weise genutzt werden, dass es
Regeln absichern und EU-Wirtschaftsinteressen souveräner deutschen und EU-Unternehmen den Zugang zu öffentlichen
verteidigen. Die Integration aller Länder in die Weltwirtschaft Aufträgen in wichtigen Drittländern tatsächlich ermöglicht.
und der Abbau von Handelshemmnissen sind vertragliche Ziele Dabei sollte durch den im IPI eingebauten Dialogprozess mit
der Union: Sie müssen Teil der EU-Handelspolitik bleiben. Handelspartnern eskalierende Handelskonflikte vermieden
werden. Zudem sollte die EU-Marktzugangsstrategie, also die
Folgende Leitlinien sollten das wirtschaftspolitische Bekämpfung der Handelshemmnisse bei Handelspartnern,
Handeln bestimmen: eine Priorität in der EU-Wirtschaftspolitik erfahren. Dies sollte
auch insbesondere nicht tarifäre Handelshemmnisse wie etwa
• Protektionismus entgegentreten, wirtschaftliche Resilienz Local-Content-Vorgaben, Bevorzugung in der staatlichen
stärken Auftragsvergabe, bürokratische Zulassungsverfahren oder
technische Normen umfassen.
• Globale Handelsregeln gestalten und stärken
Globale Handelsregeln gestalten und stärken
• Märkte durch EU-Abkommen öffnen und absichern
Zwei Drittel der außereuropäischen Exporte deutscher Unter-
• Handelsabkommen mittelstandsfreundlich umsetzen nehmen beruhen einzig auf WTO-Regeln. Die EU sollte sich
daher gegen die Erosion der WTO stark machen. Hierfür ist
• Doppelstrukturen in der Außenwirtschaftsförderung vermeiden die rasche Neubesetzung des Berufungsgremiums der WTO-
Streitbeilegung und eine WTO-Modernisierung für zeitgemäße
• EU-Zollrecht modernisieren und entbürokratisieren und aus Sicht vieler Betriebe faire Subventionsregeln (Klarere
Regeln zu Industriesubventionen, Subventionen für fossile
• Internationale Abstimmung bei Sanktionen Energieträger sowie Fischerei) nötig. Ebenfalls rasch sollte ein
WTO-Abkommen zur Beseitigung von Hemmnissen für den
Protektionismus entgegentreten, wirtschaftliche Resilienz Gesundheitsgüterhandel vereinbart werden, um die Corona-
stärken Krise und gegebenenfalls kommende Gesundheitskrisen
global zu bewältigen. Auch eine WTO-Mittelstandsagenda und
Die hoch internationalisierte deutsche Wirtschaft ist ange- Abkommen zu E-Commerce, Investitionserleichterungen und
wiesen auf ein wirtschaftlich souveränes Europa, das inter- Umweltgütern sowie die Ausweitung der Abkommen zur Öf-
national für offene Märkte sowie in der Praxis umsetzbare fentlichen Beschaffung und Informationstechnologie können
Regeln für Handel und Investitionen eintritt und den eigenen den Außenhandel deutscher Unternehmen erleichtern.
Markt offenhält. Die Stärkung der Handlungsfähigkeit der
EU zur Abwehr exterritorialer Maßnahmen anderer Länder Märkte durch EU-Abkommen öffnen und absichern
sollte nach Ansicht der Mehrzahl der Betriebe vorangetrie-
ben werden. Auch gilt es, die digitale Souveränität der EU zu Eine souveräne EU benötigt enge Wirtschaftspartner. Zur
stärken. Eine Abschottung der EU und ihrer Handelspartner Diversifizierung und Absicherung der Lieferketten der deut-
sowie eine globale wirtschaftliche Entkopplung schränken schen Wirtschaft sollten aus Sicht vieler Unternehmen neue
den deutschen Außenhandel und damit die Geschäftsmög- Handelsabkommen weltweit angestrebt werden, die Abkom-
lichkeiten der Unternehmen ein. Dazu ist es aus Sicht der men mit Mercosur und Mexiko baldmöglichst ratifiziert und
großen Mehrheit der Wirtschaft essenziell, protektionistischen mit Indonesien und Indien rasch fertig verhandelt werden.
Tendenzen entschlossen entgegenzutreten, die WTO und die Auch weitere Abkommen mit Südostasien, Lateinamerika, im
Nachbarschaftsbeziehungen der EU zu stärken, Investitionen arabischen Raum und Afrika bieten für viele Unternehmen
und Logistikketten („Global Gateway“) abzusichern und mit bedeutende Geschäftschancen. Angesichts der gesteigerten
weiteren Handelsabkommen die Diversifizierung der Handels- Bedeutung des Indopazifiks für die Diversifizierung des deut-E UROPAPOLI TI S C HE POS I TI ON E N 2 02 3 DE R I HK -ORGA N I SAT I O N | 7
schen Außenhandels ist ein handelspolitisches Engagement Handelsabkommen erfolgreich sind, muss die Umsetzung in
in dieser wirtschaftlich starken Region entscheidend. Anstatt den jeweiligen Ländern und der EU gelingen. Klare Implemen-
Abkommen wie der Transpazifischen Partnerschaft CPTPP oder tierungszeitpläne aller Seiten unter Einbindung von KMU-
der Regionalen Umfassenden Partnerschaft RCEP beizutre- Vertretern wie dem Kammernetzwerk sind nötig. Politisches
ten und damit Standards konkurrierender Wirtschaftsräume Ziel sollte eine Nutzungsrate der Freihandelsabkommen von
zu übernehmen, sollte die EU durch eigene Abkommen die mindestens 85 % sein. Der EU-Ursprungsrechner (ROSA) sollte
Beziehungen zu den beteiligten Staaten vertiefen und die Be- weiter ausgebaut, gerade um kleine und mittelständische Un-
deutung europäischer Standards vor Ort stärken. Der Transat- ternehmen bei der Berechnung des präferenziellen Ursprungs
lantische Handels- und Technologierat TTC der EU mit den USA zu unterstützen. Um moderne und zukunftssichere Abkom-
kann globale Zukunftsstandards setzen. Auch darüber hinaus men zu schließen, sollten auch wichtige Themen wie digitaler
sollten aus Sicht der Mehrheit der Wirtschaft transatlantische Handel oder vorteilhafte Zollregeln für Güter mit hohem
Handelshemmnisse wie Zölle oder verbleibende Handelsstrei- Dienstleistungsanteil in die Verhandlungen eingebracht wer-
tigkeiten abgebaut werden. Ebenso sollte protektionistischen den. Der grenzüberschreitende Fluss von Datenströmen muss
Maßnahmen wie Teilen des US Inflation Reduction Acts (IRA), gewährleistet sein, Daten und geistiges Eigentum von Unter-
die europäische Unternehmen diskriminieren und eine Heraus- nehmen sollten geschützt sein und europäische Rechtsstan-
forderung für den Industriestandort Deutschland darstellen, dards im Digitalbereich müssen gesichert werden. Häufig sorgt
entgegen gewirkt werden. Auch sollte sich die EU gegenüber die Verunsicherung über Datensicherheit für das Brachliegen
Deutschlands wichtigstem Handelspartner China weiterhin für von Geschäftsideen. Gleichzeitig sollten Handelsabkommen
mehr Reziprozität in den Handelsbeziehungen einsetzen, um nicht von handelsfernen Themen überlagert werden. Auch ein
für die Wirtschaft nötige Fortschritte beim Marktzugang und effektiver Investitionsschutz trägt wesentlich zum Erfolg von
bei Wirtschaftsreformen zu erzielen. Handelsabkommen bei. Wichtige Themen wie Nachhaltigkeit,
Umweltschutz oder Menschenrechte sollten möglichst global
Die EU-UK Wirtschaftsbeziehungen werden nach dem Brexit verankert werden (WTO, OECD, G20, G7) um wirksam zu sein
durch ein wiederkehrendes Infragestellen von bilateralen und neue Handelskonflikte zu vermeiden. Hierbei ist insbe-
Vereinbarungen, inklusive des Nordirlandprotokolls und fort- sondere mit Blick auf den beschlossenen CO2-Grenzausgleich
schreitenden Auseinanderdriftens bei Standards und Normen, der EU internationale Zusammenarbeit in der WTO oder einem
zu Lasten auch vieler deutscher Unternehmen beschädigt. Klimaclub relevant. Auch die Reform des Allgemeinen Präfe-
Nicht zuletzt angesichts gemeinsamer Wirtschaftsinteressen renzsystems der EU sollte den Handel mit Entwicklungsländern
ist eine positive EU-UK-Zukunftsagenda gefragt: Das Handels- erleichtern, statt ihn zu erschweren.
abkommen der EU mit dem Vereinigten Königreich (UK) samt
Nordirlandprotokoll sollte erhalten, der freie Dienstleistungs- Doppelstrukturen in der Außenwirtschaftsförderung
verkehr ermöglicht und im Bereich Außenpolitik (Sanktionen, vermeiden
Investitions- und Exportkontrollen) ausgebaut, sowie der
Beitritt des UK zum Regionalen Übereinkommen (Paneuropa- Das Netzwerk der Auslandshandelskammern mit 150 Stand-
Mittelmeer-Kumulierung) forciert werden. Hemmnisse für orten in 93 Ländern weltweit sowie die regional verankerten
die Anwendung der seit 2021 möglichen, deutlich verbesser- 79 Industrie- und Handelskammern in Deutschland schaffen
ten Regeln des Regionalen Übereinkommens müssen weiter internationale Verbindungen und sind kompetente Anknüp-
beseitigt werden. Ebenfalls ist eine engere institutionelle fungspunkte für die Wirtschaft vor Ort. Neue EU-Strukturen
EU-Schweiz-Kooperation, etwa im Rahmen des Europäischen und Instrumente zur Unterstützung von KMU bei der Interna-
Wirtschaftsraums, wirtschaftsstrategisch bedeutsam. Mit Blick tionalisierung wie European Chambers of Commerce müssen
auf die gesamte EU-Nachbarschaft gilt – so viele Staaten wie eine sinnvolle Ergänzung zu den erprobten Instrumenten und
möglich sollten eng an den europäischen Binnenmarkt heran- Institutionen der nationalen Außenwirtschaftsförderung sein.
geführt werden. Zudem sollten Rohstoff- und Konnektivitäts- Europäische Wirtschaftsdiplomatie kann zur weltweiten Durch-
partnerschaften gerade zur digitalen und grünen Transforma- setzung europäischer Wirtschaftsinteressen einen wichtigen
tion ausgebaut werden. Beitrag leisten. Dabei dürfen aber bewährte Strukturen wie die
Auslandshandelskammern nicht durch mit EU-Fördergeldern
Handelsabkommen mittelstandsfreundlich ausgestalten finanzierte Konkurrenz verdrängt werden. Generell gilt: Die
und umsetzen EU-Kommission muss das Subsidiaritätsprinzip wahren und
die nationalen Institutionen der Außenwirtschaftsförderung
Handelsabkommen müssen grundsätzlich mittelstandsfreund- frühzeitig und transparent in ihre Vorhaben einbinden. Insbe-
lich ausgestaltet sein, etwa durch KMU-Kapitel, einfache und sondere neue Projekte der EU sollten bestehende Strukturen
in allen Abkommen gleichlautende Ursprungsregeln und Vor- ergänzen und ggf. erweitern, nicht jedoch duplizieren.
gaben zur Wahlfreiheit beim Nachweis des Präferenzursprungs
durch eine Warenverkehrsbescheinigung oder den Erwerb Unternehmen bei der Ausgestaltung und Umsetzung des
eines Zollstatus (REX o.ä.). Sie sollten zudem mit tragfähigen EU-Zollrechts nicht überfordern
Vereinbarungen zu Themen wie Visaerleichterungen ergänzt
werden. Viele Unternehmen sehen ansonsten sehr große Die wichtigsten Ziele des Unionszollkodex (UZK), zollrecht-
bürokratische Hindernisse beim Nutzen der Zollvorteile. Damit liche Verfahrensvereinfachungen zu realisieren und einen8 | E UR O PA P OLITISCH E P OS I TI O NEN 2 02 3 D ER I HK-O RGAN I S ATI ON
EU-weit einheitlichen und wettbewerbsfähigen Rechtsrahmen ist es, wenn Drittstaaten ihre Sanktionsregime mit extraterri-
zu gewährleisten, wurden nach den Erfahrungen der Betrie- torial wirkenden Elementen versehen.
be bislang nur unzureichend verwirklicht. Auch die auf die
Reduzierung der Zollbürokratie bezogenen Vorgaben des Trade Bevor es zu legislativen Maßnahmen wie dem Rückgriff auf
Facilitation Agreements werden nicht hinreichend umgesetzt. Sanktionen kommt, sollten bei der Entscheidungsfindung
So können etwa besonders vertrauenswürdige Unternehmen, explizit die Folgen für die deutsche Wirtschaft berücksichtigt
so genannte „Authorised Economic Operator (AEO), wichtige werden. Die Regelungen selbst sollten zudem ausgewogen,
Erleichterungen, die bereits seit 2016 im UZK rechtlich veran- präzise formuliert und für die zuständigen Behörden wie auch
kert sind, weiterhin nicht nutzen. Beispiele hierfür sind u.a. die für die Unternehmen praktisch umsetzbar sein. Weiterhin soll-
Zentrale Zollabwicklung bei der Einfuhr oder die Hinterlegung ten die von der EU verhängten Sanktionen regelmäßig auf ihre
einer einzigen Bürgschaft für die finanzielle Absicherung ver- Wirksamkeit, aber auch auf ihre Verhältnismäßigkeit überprüft
schiedener Zollverfahren in verschiedenen EU-Mitgliedsstaa- werden. Auf internationaler Ebene sollten sich die EU und die
ten. Gleichzeitig steigt die Zahl der gesetzlichen Vorschriften Bundesregierung um eine enge Abstimmung in Foren wie der
mit Einfluss auf den Außenhandel stetig. UN sowie mit wichtigen Partnern, wie z.B. den USA, bemü-
hen und sich zudem verstärkt gegen extraterritorial wirkende
Die Ausgestaltung des UZK sollte sich rechtlich, zeitlich und Sanktionsmaßnahmen einsetzen, auch um widersprüchliche
mit Blick auf IT-Fragen in erster Linie an den Bedürfnissen Maßgaben und Wettbewerbsnachteile für die deutsche Wirt-
der Unternehmen und den Erfordernissen des Warenverkehrs schaft zu vermeiden. Eine unterschiedliche Auslegung von EU-
orientieren. Die von der EU-Kommission erlassenen Zollbe- Sanktionen durch die einzelnen EU-Mitgliedstaaten darf nicht
stimmungen müssen deshalb regelmäßig und konsequent auf zu Wettbewerbsnachteilen für die deutsche Wirtschaft führen.
Möglichkeiten zur Digitalisierung und Entbürokratisierung Deutsche Unternehmen müssen auch durch eine souveräne
überprüft werden. Das bedeutet z.B. konkret bei IT-Anpassun- EU-Außenwirtschaftspolitik vor der rechtlichen, wie wirt-
gen, dass die zuständigen Behörden für Zollverfahren stärker schaftspolitischen Einflussnahme durch Drittstaaten geschützt
auf bereits existierende Daten zurückgreifen sollten, anstatt werden. Für Exporte und Importe, die nach deutschem und
immer neue zusätzliche Daten allein für Zollzwecke bei den europäischem Recht weiterhin erlaubt sind, muss insbeson-
Unternehmen abzufragen. Auch das sogenannte „Single- dere die Abwicklung der Beförderung, des Zahlungsverkehrs
Window“ zur einmaligen elektronischen Eingabe von Zolldaten und anderer Dienstleistungen nicht nur möglich, sondern auch
und Dokumenten an einem zentralen Ort muss zügig voran- praktikabel bleiben.
gebracht werden. Außerdem sollten die Kontrollen zollrele-
vanter Risiken und Zollabgaben nicht mehr bei jeder einzel-
nen Sendung ansetzen. Anstelle einer solchen kleinteiligen
Einzelfallbetrachtung können diese Vorgänge im Sinne eines
prozessorientierten Ansatzes periodisch zusammengefasst in
regelmäßigen Zeitabständen erfolgen. Auch die Vereinfachung
des EU-Zolltarifs muss dringend angegangen werden, um
Unternehmen und Zoll gleichermaßen zu entlasten. Schließlich
braucht die Wirtschaft nach Ansicht der Mehrzahl der Unter-
nehmen auch an der Stelle eine Modernisierung der Handels-
regeln, wo (digitale) Dienstleistungen in die Herstellung physi-
scher Produkte einfließen und mit hohen Zollsätzen besteuert
werden („Modus 5“). Mit Blick auf strategische Abhängigkeiten
der EU ist eine Modernisierung des EU-Zolltarifs sowie des EU-
Mechanismus zur Aussetzung wirtschaftsschädlicher Zollhür-
den etwa im Rohstoffbereich nötig. Auch die Digitalisierung
von Zollverfahren und Dokumenten sollte nach Ansicht der
betroffenen Unternehmen stärker vorangetrieben werden.
Internationale Abstimmung bei Sanktionen
In internationalen politischen Konflikten und Kriegen – wie
beispielsweise der russischen Invasion in der Ukraine – sind
Sanktionen Teil des außenpolitischen Instrumentariums
der EU. Hier gilt für die deutsche Wirtschaft das Primat der
Politik. EU-Verordnungen und das deutsche Außenwirt-
schaftsrecht legen den gesetzlichen Rahmen fest. Die Zahl
der weltweit bestehenden Wirtschaftssanktionen hat in den
vergangenen Jahren zugenommen. Dabei laufen Sanktionen
international nur selten im Gleichklang. Besonders schwierigE UROPAPOLI TI S C HE POS I TI ON E N 2 02 3 DE R I HK -ORGA N I SAT I O N | 9
Ansprechpartner in der DIHK: Folgende Leitlinien sollten das wirtschaftspolitische
Cornelia Upmeier (upmeier.cornelia@dihk.de), Handeln bestimmen:
Daniela Seller (seller.daniela@dihk.de)
• Für Menschenrechte und Umweltstandards weltweit werben
Corporate Social Responsibility:
Nachhaltiges Wirtschaften unter- • Mehr Unterstützung anbieten, CSR-Kompetenzen fördern
statt Überregulierung und Bürokratie
stützen, Gestaltungsspielräume
bewahren • Komplexität und Aufwand der Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung kompatibel gestalten und begrenzen
In einer globalisierten Welt und vor dem Hintergrund großer
gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Herausforderungen • Freiwillige Umweltmanagementsysteme anerkennen
ist verantwortungsvolles und nachhaltiges Wirtschaften in
der Tradition des Leitbilds der Ehrbaren Kaufleute aktueller • Transparenz im Rohstoffsektor durch praktikable Instrumente
denn je. Deutsche Unternehmen üben ihre unternehmerische schaffen
Verantwortung (Corporate Social Responsibility – CSR) auf
vielfältige Weise aus und verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit • Chancen der Digitalisierung für eine nachhaltige Entwicklung
der Berücksichtigung ökologischer, sozialer und gesellschaftli- einsetzen
cher Aspekte. In einer zunehmend digitalen Welt und Gesell-
schaft gehört hierzu auch der verantwortungsvolle Umgang • Öffentliches Auftragswesen nicht überfordern
mit Daten von Mitarbeitenden, Lieferanten oder Kunden sowie
mit den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderun- Für Menschenrechte und Umweltstandards weltweit werben
gen, die sich durch die Digitalisierung ergeben, die Corporate
Digital Responsibility (CDR). Auch im Ausland tragen deut- Die deutsche Wirtschaft unterstützt das Ziel der EU-Strategie
sche Unternehmen zu höheren Sozial- und Umweltstandards, zur Förderung menschenwürdiger Arbeit weltweit. Die gemein-
besserer Bildung und damit zu Wachstum und Wohlstand bei. same Anstrengung vieler gesellschaftlicher Akteure für die
Viele Unternehmen leisten durch dieses Engagement sowie die verantwortungsvolle Gestaltung von Liefer- und Wertschöp-
Entwicklung von innovativen Produkten und Dienstleistun- fungsketten kann einen wesentlichen Beitrag zur Vermeidung
gen zusätzlich einen Beitrag zur Erreichung der Nachhaltigen von Zwangs- und Kinderarbeit sowie zur nachhaltigen Ent-
Entwicklungsziele der Vereinten Nationen[1]. wicklung leisten. CSR-Strategien und die Art des Engagements
von Unternehmen sind dabei jedoch unterschiedlich. Gelebte
Grundsätzlich sollte die Politik die Wirtschaft als Partner Unternehmensverantwortung kann ein Treiber für Innovation
verstehen, da sich die Herausforderungen der Transformation sein, Wettbewerbsvorteile schaffen und die Unternehmens-
zu einer nachhaltigen und klimaneutralen Gesellschaft nur marke stärken. Zudem erwarten Mitarbeiter, Kunden, Lieferan-
gemeinsam mit der Wirtschaft lösen lassen. Dabei wird die ten, Investoren, Politik und Gesellschaft, dass Unternehmen
Transformation nur gelingen, wenn die Regeln praxistauglich gesellschaftliche Veränderungen verantwortungsvoll mitge-
sind und den Wirtschaftsstandort langfristig stärken. Dafür stalten und sich für gemeinsame rechtsstaatliche Grundsätze
sollten die Europäischen Institutionen einheitliche, verlässliche einsetzen. Lieferkettenmanagement, menschen- und um-
Rahmenbedingungen für unternehmerische Tätigkeit in Europa weltrechtliche Sorgfaltsprozesse sowie die Verhinderung von
schaffen und die notwendigen Freiräume für die Wahrneh- Zwangsarbeit stehen stark im Vordergrund der Diskussion. Die
mung und Ausgestaltung unternehmensspezifischer Verant- tatsächlichen Möglichkeiten der Einflussnahme von Unterneh-
wortung lassen. Ein koordiniertes Vorgehen auf EU-Ebene ist men auf die Zulieferkette variieren jedoch stark, je nach Unter-
für die Investitions- und Planungssicherheit der Wirtschaft nehmensgröße, -struktur und Marktposition. Insbesondere
essentiell. Bei grenzüberschreitenden Themen sollte sie über kleine und mittlere Unternehmen haben oft nur begrenzten
internationale Ordnungspolitik möglichst gleiche Wettbe- Einfluss und geringe Kontrollmöglichkeiten bei der Einhaltung
werbsbedingungen auf globaler Ebene herstellen – mit Blick der Standards vor Ort. Dennoch ist die Einführung menschen-
auf einige Auslandsmärkte entstehen bereits Benachteiligun- rechtlicher Sorgfaltspflichten und eine Lieferkettenhaftung für
gen für deutsche Unternehmen durch EU-Regelungen. Bei der Unternehmen, verbunden mit Klagerechten, auf EU-Ebene in
Umsetzung von EU-Richtlinien in nationales Recht sollten die Arbeit. Dies würde jedoch auch wegen der vielfachen unbe-
gesetzten EU-Standards gewahrt werden und keine weiteren stimmten Rechtsbegriffe zu erheblicher Rechtsunsicherheit
Verschärfungen zum Nachteil der deutschen Wirtschaft im und kaum begrenzbaren Haftungsrisiken führen. Dadurch
nationalen Recht erfolgen. könnte auch die von der EU unterstützte Internationalisierung
von KMU gefährdet werden. Ein großer Teil der Unternehmen
lehnt eine Regulierung auf EU-Ebene daher ab. Einige Unter-
[1] Die Perspektive der Wirtschaft zur Erreichung der VN-Nachhaltigkeitsziele hat die DIHK in ihrem Positionspapier „Die VN-Nachhaltig-
keitsziele erreichen – Perspektive der Wirtschaft“ dargestellt, welches im März 2022 vom Vorstand verabschiedet wurde.10 | E UR O PA P OLITISCH E P OS I TI O NEN 2 02 3 D ER I HK-O RGAN I S ATI ON
nehmen befürworten eine EU-Regelung, vor allem, um eine Berichtspflichten, die mit erheblichem zusätzlichen Aufwand
Fragmentierung nationaler Gesetzgebung innerhalb der EU zu für Dokumentation und Information sowie Kosten für die
verhindern, wobei eine EU-Richtlinie nicht über das nationale Erstellung und ggf. Prüfung einherginge, ist aus Sicht des
deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz hinaus gehen Großteils der Betriebe nicht zielführend und wird nur von
sollte. Eine Beschränkung auf direkte Zulieferer ist geboten, wenigen Unternehmen befürwortet. Insbesondere sollte eine
da Unternehmen keinen Zugriff auf die mittelbaren Zulie- Kompatibilität, ggfs. auch Vereinheitlichung der verschiedens-
ferer entlang der Wertschöpfungskette haben. Ebenso ist ten Pflichten und Standards sichergestellt werden. Bei der Ent-
sicherzustellen, dass es zu keinen doppelten Berichtspflichten wicklung der Europäischen Nachhaltigkeitsstandards (ESRS)
kommt, die bereits z.B. von der CSRD gedeckt sind. Im Sinne sind dabei klare, verlässliche und der Unternehmensgröße an-
einer Verantwortungspartnerschaft müssen nach Ansicht der gemessene Rahmenbedingungen und praktikable Umsetzungs-
Unternehmen die Staaten ihre Aufgabe wahrnehmen, Sozial- möglichkeiten von Bedeutung. Insbesondere die spezifischen
und Umweltstandards durchzusetzen und Menschenrechte zu Herausforderungen von kleinen und mittleren Unternehmen,
schützen, auch in Entwicklungs- und Schwellenländern. Diese die als Zulieferbetriebe zur Offenlegung von Nachhaltigkeits-
staatliche Verantwortung darf weder in den Gaststaaten noch informationen aufgefordert werden, gilt es zu berücksichtigen.
von Europa aus auf die Unternehmen übertragen werden. Grundsätzlich sollte auch ein Abbau von Dokumentationsvor-
Europäische Standards können dabei nicht eins zu eins auf schriften durchgeführt werden, insbesondere, wenn identische
Entwicklungs- und Schwellenländer übertragen werden, da Inhalte verlangt werden. Hier sollte auf bestehende Berichte
nationale und interkulturelle Besonderheiten Berücksichtigung verwiesen werden können und eine Doppelbelastung dadurch
finden müssen. vermieden werden.
Mehr Unterstützung anbieten, CSR-Kompetenzen fördern, Freiwillige Umweltmanagementsysteme anerkennen
statt Regulierung und Bürokratie
Freiwillige Umweltmanagementsysteme befördern einen indi-
Durch die Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) viduellen, verantwortungsbewussten Ressourceneinsatz. Teil-
und die Taxonomie müssen bereits künftig deutlich mehr Un- nehmer des europäischen Umweltmanagementsystems EMAS
ternehmen unmittelbar über ihre Nachhaltigkeit berichten. Der beispielsweise verpflichten sich, die Einhaltung aller umwelt-
Fokus sollte verstärkt auf Unterstützungsangeboten und der rechtlichen Vorgaben prüfen zu lassen und ihre Umweltleistung
Förderung von CSR-Kompetenzen liegen. Unternehmen sollten kontinuierlich zu verbessern. EMAS ist so für Unternehmen ein
durch Informationen sowie Angebote zur Kapazitätsentwick- Gütesiegel und öffentliches Bekenntnis für eine an Umwelt und
lung und zum Aufbau von Know-how unterstützt werden, auch Nachhaltigkeit ausgerichtete Unternehmenskultur.
um die Akzeptanz von Regulierungen zu erhöhen. Regionale
Kompetenzzentren können mit Unterstützung von Stakehol- Das freiwillige, über die gesetzlichen Anforderungen hinaus-
dern wie den Kammern Anlaufzentren für Nachhaltigkeit und gehende Engagement der Unternehmen z.B. durch Manage-
CSR sein. Auch Initiativen im Rahmen der Vereinten Nationen mentsysteme wie ISO-Zertifizierungen, sollte außerhalb des
sollten darauf ausgerichtet sein, Unternehmen einerseits öffentlichen Auftragswesens höhere Anerkennung finden, u.
unverbindliche Hilfestellung zu geben und andererseits Staaten a. in Form von Erleichterungen bei Dokumentationspflichten.
anzuhalten selbst, bestehende völkerrechtliche Vereinbarun- Dann fänden diese Instrumente noch mehr Anklang bei den
gen zu implementieren und durchzusetzen. Dies sollte die EU Unternehmen.
auch auf UN-Ebene bei der Verhandlung des Entwurfs für ein
internationales Abkommen (UN-Treaty) im Bereich Wirtschaft Transparenz im Rohstoffsektor durch praktikable
und Menschenrechte berücksichtigen. Im Rahmen von multi- Instrumente
lateralen Foren und internationalen Organisationen sollte sich
die Europäische Union für eine Angleichung der Wettbewerbs- Pflichten zur Offenlegung der Herkunft von Rohstoffen, wie
bedingungen für Unternehmen einsetzen, um Nachhaltigkeit in sie in den USA bestehen (Dodd-Frank-Act) und in der EU dis-
Liefer- und Wertschöpfungsketten zu fördern. kutiert werden (EU-Chips Act, Due Diligence), bedeuten häufig
eine enorme zeitliche und finanzielle Belastung für betroffene
Komplexität und Aufwand der Nachhaltigkeitsberichter- Unternehmen und damit in der Lieferkette. Die Erfahrungen
stattung kompatibel gestalten und begrenzen mit der EU-Verordnung über Konfliktmineralien zeigen, dass
die Berichts- und Prüfpflichten den Rohstoffhandel verkom-
Mit der Verabschiedung der CSRD, der Taxonomie und dem ge- plizieren und für Rechtsunsicherheiten beim Import sowie
planten EU-Lieferkettengesetz nehmen die Anforderungen an praktische Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Regelungen
Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeitsberichterstattung innerhalb der Lieferkette zur Folge haben. Unternehmen tragen
und der Anwendungsbereich zu. Von den Berichtspflichten Verantwortung beim Bezug ihrer Rohstoffe. Sie unterstützen
sind nicht nur große Unternehmen betroffen, sondern durch Initiativen zur Verhinderung von Korruption und leisten durch
den Kaskadeneffekt auch kleine und mittlere Unternehmen, freiwillige Zertifizierungen einen Beitrag zum konfliktfreien
die als Zulieferbetriebe zur Erhebung von nicht-finanziellen Handel mit Rohstoffen. Freiwilligen Zertifizierungen durch
Informationen – oftmals nach unterschiedlichen Standards Unternehmen zur verantwortungsvollen Rohstoffbeschaffung
und Formaten – aufgefordert werden. Eine Ausweitung der sollte generell Vorzug vor bürokratischen NachweispflichtenE UROPAPOLI TI S C HE POS I TI ON E N 2 02 3 DE R I HK -ORGA N I SAT I O N | 11
über die Rohstoffherkunft gegeben werden. Eine Minderheit Ansprechpartner in der DIHK:
von Unternehmen sieht in der freiwilligen Zertifizierung nur Dr. Jan Greitens (greitens.jan@dihk.de)
eine schwache Wirkung und bewertet diese kritisch.
Sustainable Finance: Finanzierung
Chancen der Digitalisierung für eine nachhaltige Entwick-
lung einsetzen
der Transformation fördern statt
erschweren
Ein Ziel des EU-Aktionsplan 2020-24 ist es, die EU an die Spit-
ze der datengesteuerten Wirtschaft zu bringen. Die Wirtschaft „Sustainable Finance“ ist, ergänzend zur CO2-Bepreisung, ein
unterstützt dieses Ziel, auch mit Blick darauf, dass digitale wesentlicher Eckpfeiler des European Green Deal. Die Um-
Technologien einen Beitrag zur Bewältigung struktureller und setzung umfasst (1) die Finanzierung selbst, aber auch (2)
ökologischer Herausforderungen in der Wirtschaft leisten umfangreiche Offenlegungs- und Nachweispflichten. Zu diesen
können. Die Potentiale, die durch die Vernetzung von Digi- europäischen Regelungen kommen noch (3) globale Initiativen
talisierung und Nachhaltigkeit ermöglicht werden, sollten in zu Offenlegungsstandards.
neuen Gesetzen abwägend mit einbezogen, aber nicht zu einer
zwingenden Voraussetzung gemacht werden. Unternehmen Mit der EU-Taxonomie wird der Versuch unternommen,
sind sich ihrer Corporate Digital Responsibility (CDR) bewusst, wirtschaftliche Aktivitäten danach einzuteilen, ob sie zu einer
die sich aus der Digitalisierung und den damit einhergehenden nachhaltigen Entwicklung beitragen oder nicht. Alle gemäß
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen ergibt. Taxonomie bewerteten wirtschaftlichen Aktivitäten fließen in
die Ermittlung der sogenannten Green Asset Ratio (GAR) ein,
Öffentliches Auftragswesen nicht überfordern anhand derer Banken den nachhaltigen Anteil ihrer Finanzie-
rungsaktivitäten ausweisen sollen. Allein die durch die GAR
Öffentliche Auftragsvergabe wird zunehmend an nachhaltiges hergestellte öffentliche Transparenz soll dann die Finanzierung
Wirtschaften der Auftraggeber geknüpft: Öffentliche Aufträge in eine nachhaltige Richtung lenken, ohne dass für die GAR
sind mit ihrem Volumen von 15 Prozent des BIP (OECD 2019) derzeit konkrete Zielgrößen vorgeschrieben werden.
in Deutschland ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Mit Beschaf-
fungen kann die öffentliche Hand Innovationen und Nach- Die Berichts- und Offenlegungspflichten werden auf EU-Ebene
haltigkeitsaspekte als strategische Ziele umsetzen. Allerdings anhand von drei Instrumenten ausgestaltet:
wird so die Auftragsvergabe mit zusätzlichen Anforderungen
überfrachtet, was gerade KMU benachteiligt. Ein solcher • Durch die Corporate Sustainability Reporting Directive
Ansatz ist nach Ansicht der Mehrheit der Unternehmen nur (CSRD) müssen künftig deutlich mehr Unternehmen unmit-
dann mit Wirtschaftlichkeit und Wettbewerb vereinbar, wenn telbar über ihre Nachhaltigkeit berichten.
er auftragsbezogen ist und wenn er vom öffentlichen Auf-
traggeber auch kontrolliert werden kann. Auch Vergabestellen • Finanzmarktteilnehmer, insbesondere Banken, müssen gemäß
können die Einhaltung umfassender Bedingungen an den der Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) Anga-
Produktionsprozess und die Zulieferkette bei globalen Wert- ben zur Nachhaltigkeit ihrer Geschäfte machen.
schöpfungsketten nicht ausreichend kontrollieren. Nach dem
„Think small first“-Prinzip der EU dürfen strategische Ziele • Zusammen mit den Offenlegungspflichten aus Artikel 8 der
nicht dazu führen, KMU praktisch von vielen Vergabeverfahren EU-Taxonomie-Verordnung ergeben sich damit direkt, aber
auszuschließen. auch indirekt umfangreiche Offenlegungspflichten auch für
weite Teile des Mittelstands.
In den vergangenen Jahren hat es international eine Vielzahl
an Initiativen zur Nachhaltigkeitsberichterstattung gegeben
und es wurde eine Fülle von Rahmensystemen, Methoden und
Kennzahlen für die Nachhaltigkeitsberichterstattung entwickelt.
Unternehmen, die Teil internationaler Wertschöpfungsketten
sind, sehen sich deshalb inzwischen einer Vielzahl verschiede-
ner Anforderungen gegenüber.
Folgende Leitlinien sollten das wirtschaftspolitische Han-
deln bestimmen:
• EU-Taxonomie vereinfachen – dann dynamisch und in der
Praxis handhabbar umsetzen
• Verhältnismäßigkeit für die Breite der Wirtschaft wahren12 | E UR O PA P OLITISCH E P OS I TI O NEN 2 02 3 D ER I HK-O RGAN I S ATI ON
• Globale Standards unterstützen Letztlich muss vermieden werden, dass Unternehmen ohne eine
angemessene Zeit für Anpassungen gezwungen werden, ihren
EU-Taxonomie vereinfachen – dynamisch und in der Praxis Produktionsstandort in ein Land außerhalb der EU zu verlagern.
handhabbar umsetzen Wenn dort keine den EU-Regelungen entsprechenden Anforde-
rungen an die Nachhaltigkeit existieren, haben solche Verlage-
Wichtigstes Ziel der EU-Taxonomie-Verordnung sollte sein, die rungen keine positiven Auswirkungen auf Umwelt und Klima.
Transformation der Wirtschaft und vor allem den Übergang Zudem schwächen sie den Wirtschaftsstandort Europa.
der Unternehmen hin zu mehr nachhaltigem Wirtschaften zu
fördern und die Finanzierung der Transformation zu sichern. Die IHK-Organisation fordert deshalb auch für die Ausarbeitung
Benötigt wird eine Transformations-Taxonomie. der sogenannten „erweiterten Taxonomie“, die den Übergang
von einer fossilen in eine ökologisch nachhaltige Wirtschaft
Viele Unternehmen bezweifeln, inwieweit sich mithilfe der zum Gegenstand hat, die Orientierung an allgemeinen Leitlinien,
Taxonomie die angestrebte klima- und umweltpolitische um der Heterogenität der Wertschöpfung Rechnung zu tragen.
Transformation erreichen lässt. In der Praxis sind betriebliche
Wertschöpfungsketten nicht eindeutig zuzuordnen. Geschäfts- Verhältnismäßigkeit für die Breite der Wirtschaft wahren
modelle ändern sich im Zeitablauf. Unternehmen kombinieren
wirtschaftliche Tätigkeiten, die in der Taxonomie als „braune“ Berichtspflichtige große, kapitalmarktorientierte Unternehmen
oder „grüne“ Produktion bewertet werden. Einzelne Aktivitäten sowie Finanzmarktakteure fordern Informationen in der Regel
können oft nicht trennscharf in nachhaltig oder nicht-nach- bereits heute von ihren Kunden und Zulieferern ein. Denn um
haltig eingeteilt werden. Eine sich anpassende und kontinu- Bewertungen in Form eines Nachhaltigkeits-Scorings berech-
ierlich in Kooperation mit der Wirtschaft weiterentwickelte nen oder die eigene Taxonomiekonformität umfassend beur-
Regulierung würde daher der Transformation besser dienen als teilen zu können, benötigen die Finanzmarktakteure Daten und
kleinteilige und statische Vorgaben. Gleichzeitig dürfen sich Informationen anderer Unternehmen. Deshalb sind bereits jetzt
die Bedingungen nicht zu oft und schnell verändern, um die viele kleine und mittelgroße Betriebe erheblich damit belastet,
notwendigen Investitionen der Unternehmen zu ermöglichen. zur Bewertung von Nachhaltigkeitsaspekten nicht standardi-
sierte Informationen zu liefern.
Unternehmen, die in ihren Betriebsabläufen heute noch viel
CO2 emittieren müssen, machen sich vielfach auf den Weg, ihre Aus Sicht der Breite der Wirtschaft ist es daher dringend
Produktionsverfahren und Energieversorgung umzustellen. Die- erforderlich, einen einfachen und proportionalen Berichtsstan-
ser Wandel hin zur Klimaneutralität sollte aus Sicht der Mehr- dard für KMU zu entwickeln. Vor jeder Berichtspflicht sollte der
heit der Betriebe nicht ausgebremst werden, indem der Zugang Nutzen der geforderten Information für die Transformation
zu Finanzierungen für die notwendigen Investitionen durch zu belegt sein. Eine Standardisierung sollte zudem deutliche Diffe-
hohe Anforderungen erschwert wird. Zudem tragen zahlreiche, renzierungen der Anforderungen im Hinblick auf den Zweck der
heute noch emissionsintensive Branchen zur Herstellung von verlangten offenzulegenden Daten vornehmen und Redundan-
Klimaschutztechnologien bei; beispielsweise werden in jeder zen vermeiden. Dafür ist eine Priorisierung der Informationen
Windkraftanlage große Mengen Stahl oder Kupfer verbaut. Das im Hinblick auf die Nachhaltigkeitsziele erforderlich.
Angebot an „grün“ produziertem Stahl ist hingegen aufgrund
der hohen technischen Komplexität des Produktionsprozesses Dabei sind die unterschiedlichen Interessen von und Erwar-
weltweit sehr begrenzt. tungen an kapitalmarktorientierte und nicht-kapitalmarktori-
entierte Unternehmen zu berücksichtigen. Ein klar definierter,
Aktuelle Entwicklungen, wie etwa die neue Bedeutung der eng begrenzter und möglichst standardisierter Fragenkatalog
Energie- und Versorgungssicherheit sowie mehr Investitio- („Basisdatenset“), der die Anforderungen der berichtspflichtigen
nen in sicherheitsrelevante Bereiche wie die Herstellung von Unternehmen gegenüber ihren Geschäftspartnern strukturiert,
Rüstungsgütern, können zwar in der EU-Taxonomie als einem würde die Vielzahl an Informationsbegehren eindämmen und
Regelwerk, das kontinuierlich ausgeweitet werden soll, abgebil- die Unternehmen so entlasten.
det werden. Die bereits heute hohe Komplexität wird allerdings
dann noch zunehmen. Außerdem ist es wichtig, Bereiche zu definieren und grundsätz-
lich von der Anwendung der Taxonomie-Verordnung auszuneh-
Der Gesetzgeber sollte davon Abstand nehmen, einzelne Wirt- men, die nachweislich keine Auswirkung auf Umwelt und Klima
schaftsbereiche von vornherein als nicht-taxonomiekonform haben. Die EU-Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung
einzustufen. Die EU-Taxonomie-Verordnung sollte stattdessen (CSRD) sieht richtigerweise vor, dass in Ausnahmesituationen
so ausgestaltet werden, dass alle Unternehmen die Chance nicht vollumfänglich berichtet werden muss; insofern sieht
haben, einen Transformationsprozess hin zu einer stärkeren auch der Entwurf des Nachhaltigkeitsberichtsstandards z.B.
Nachhaltigkeit einzuleiten und finanziert zu bekommen. Zu in Bezug auf Knowhow-Schutz und Geschäftsgeheimnisse
strenge Vorgaben können auch dazu führen, dass sich die Un- Ausnahmen vor. Ferner sollten grundsätzlich Selbstverpflich-
ternehmen im „grauen Kapitalmarkt“ ihre Finanzierung suchen. tungen möglich sein, die im Vergleich zu gesetzlichen Offenle-
Die Regulierung der Banken und die Anforderungen an die gungspflichten ein deutlich weniger aufwändiges Mittel sind.
Unternehmen müssen synchronisiert sein. Informations- und Offenlegungspflichten sollten zielgerichtetSie können auch lesen