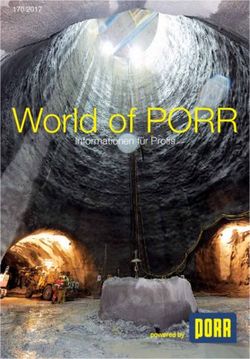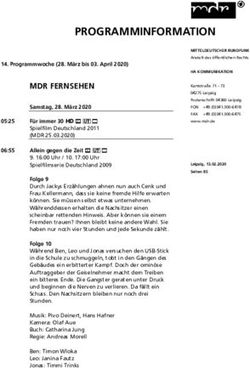"Fremdbestände" im Archiv - opus4.kobv.de
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
„Fremdbestände“ im Archiv
Überlegungen zu Struktur und Zuständigkeiten in Archiven der katho-
lischen Kirche am Beispiel überdiözesaner (Verbands-)Bestände
Masterarbeit
zur Erlangung des
akademischen Grades
Master of Arts – Archivwissenschaft
im Weiterbildungs-Masterstudiengang Archivwissenschaft
am Fachbereich Informationswissenschaft
der Fachhochschule Potsdam
eingereicht von
Oliver Göbel
Matr.-Nr.: s16914
am 24. Oktober 2020
Erstgutachter: Prof. Dr. Michael Scholz, Potsdam
Zweitgutachterin: Prof. Dr. Susanne Freund, PotsdamInhaltsverzeichnis
1. Einleitung ....................................................................................................................................3
1.1. Problemstellung ............................................................................................................................. 3
1.2. Bestimmung des Begriffs „Fremdbestand“ ......................................................................... 4
1.2.1. Der Begriff „Fremdbestand“: Allgemeine Hinführung ........................................... 4
1.2.2. Was ist „fremd“ am Katholischen Filmwerk Rottenburg? .................................... 9
1.2.3. „Fremdbestände“ im Sinne dieser Arbeit .................................................................. 11
1.3. Gang der Untersuchung ............................................................................................................ 12
1.4. Forschungsstand und Literatur ............................................................................................. 12
2. Zuständigkeiten und Überlieferungsbildung in Archiven der katholischen
Kirche................................................................................................................................................. 15
2.1. Normative Grundlagen der Zuständigkeiten .................................................................... 15
2.1.1. Einordnung kirchlicher Archive in die deutsche Archivlandschaft ................ 15
2.1.2. Der Codex Iuris Canonici (CIC) ...................................................................................... 17
2.1.3. Die Kirchliche Archivordnung (KAO) ......................................................................... 18
2.1.4. Die Päpstliche Kommission für die Kulturgüter der Kirche .............................. 21
2.1.5. Leitlinien der DBK .............................................................................................................. 21
2.1.6. Zwischenfazit I ..................................................................................................................... 22
2.2. Überlieferung(-sbildung) ......................................................................................................... 23
2.2.1. Überlieferungsbildung als archivfachliche Kompetenz ....................................... 23
2.2.2. Der CIC und die KAO .......................................................................................................... 26
2.2.3. Die Päpstliche Kommission für die Kulturgüter der Kirche .............................. 27
2.2.4. Archivfachliche Diskussion ............................................................................................. 29
2.2.5. Zwischenfazit II ................................................................................................................... 32
3. Verwahrung von überdiözesanen Beständen ............................................................. 34
3.1. Die Situation bei den Bestandsbildnern ............................................................................. 34
3.2. Die Situation in den Diözesanarchiven ............................................................................... 41
3.3. Kritische Reflexion des Status quo ....................................................................................... 47
3.3.1. Perspektive der Bestandsbildner und der (Diözesan-)Archive........................ 47
3.3.2. Nutzerperspektive.............................................................................................................. 59
4. Lösungsvorschläge ................................................................................................................ 62
4.1. Die „kleine(n)“ Lösungen ......................................................................................................... 62
4.1.1. Anpassung der KAO ........................................................................................................... 62
4.1.2. Professionalisierung und Institutionalisierung der AGAUE .............................. 64
4.1.3. Weiterentwicklung der Online-Präsenzen ............................................................... 65
14.2. Die „große(n)“ Lösung(en) ...................................................................................................... 66
4.2.1. Einrichtung eines Zentralarchivs ................................................................................. 66
4.2.2. Einrichtung mehrerer Verbundarchive ..................................................................... 69
5. Umgang mit dem Bestand KFW im DAR......................................................................... 72
5.1. Bestandsgenese und Inhalt...................................................................................................... 72
5.2. Archivischer Umgang ................................................................................................................. 73
6. Schlussbetrachtung und Ausblick.................................................................................... 79
Quellen- und Literaturverzeichnis .......................................................................................... 81
Archivische Quellen ................................................................................................................................. 81
Gesetzestexte, Anordnungen und sonstige rechtliche Normen ............................................. 81
Literatur ....................................................................................................................................................... 82
Internetpräsenzen.................................................................................................................................... 86
Abkürzungsverzeichnis ............................................................................................................... 88
Anlage I: Ausweis der geführten Gespräche und Korrespondenzen ........................... 89
Überdiözesane Verbände ...................................................................................................................... 89
Diözesanarchive ........................................................................................................................................ 89
Anlage II: Eidesstattliche Erklärung ....................................................................................... 92
21. Einleitung
1.1. Problemstellung
Im Januar 2020 wurde ich bei einem Magazinrundgang im Diözesanarchiv Rottenburg (im
Folgenden: DAR) auf Filmrollen aufmerksam, die mit einem Etikett „Katholisches Film-
werk“ gekennzeichnet waren. Auf meine Frage, was denn genau das Katholische Filmwerk
sei, erhielt ich von der Leiterin des DAR die Antwort, dass es sich bei dem Bestand (im
Folgenden: KFW) um einen „Fremdbestand“ handele, der bisher noch unbearbeitet sei.
Der Grund: Das KFW sei eine überdiözesane Einrichtung mit einer inhaltlich überdiöze-
sanen Überlieferung, weswegen die Archivleitung gar nicht genau wisse, ob der Bestands-
bildner überhaupt in die archivische Zuständigkeit des DAR falle und/oder die Überliefe-
rung zum „Überlieferungsprofil“ des DAR passe. Darüber hinaus liege mit der Filmüber-
lieferung eine Überlieferungsform bzw. Archivaliengattung vor, mit der das DAR bislang
kaum Erfahrung gesammelt habe. Es sei daher fraglich sei, ob das DAR diesen Bestand
adäquat zu erschließen vermag.
Diese Aussagen waren die Initialzündung für die vorliegende Arbeit. Das KFW soll dabei
nur beispielhaft stehen für Bestände in Diözesanarchiven1, die nicht unmittelbar in die
Zuständigkeit eines bestimmten Archivs fallen, somit einerseits in gewisser Weise einem
unbestimmten „Graubereich“ angehören und daher als „fremd“ angesehen werden kön-
nen, andererseits aber inhaltlich-thematisch der Überlieferung des eigenen Archivs nicht
völlig fernstehen.
Der Hintergrund für diese Überlieferungsformen ist die ausgeprägte überdiözesane Gre-
mien-, Vereins- und Verbandsstruktur der Katholischen Kirche in Deutschland und ein
weit verzweigtes Netz kirchlicher oder kirchennaher Organisationen und Institutionen.
Darüber hinaus ist das Diözesanarchiv Rottenburg wie jedes andere Diözesanarchiv ein-
gebettet in die Tektonik der Archive der katholischen Kirche in Deutschlands, die dezent-
ral aufgebaut ist: Jede Diözese und damit jedes Diözesanarchiv ist – so viel darf vorweg-
genommen werden – zunächst und primär für die Überlieferung in ihrem eigenen Spren-
gel verantwortlich und zuständig.
Hieraus ergeben sich folgende Fragen:
1Die Begriffe Diözese und Bistum sowie daraus gebildete Komposita werden im Weiteren synonym ver-
wendet.
3 Wie sind archivische Zuständigkeiten im Bereich der kirchlichen Archive grund-
sätzlich geregelt? Gibt es eine gesonderte Regelung für die oben genannten Be-
stände?
Liegen Überlieferungsprofile für die kirchlichen Archive vor, mit denen die über-
diözesanen Bestände abgeglichen werden könnten?
Wie wird in der Praxis mit den oben genannten Beständen verfahren?
Welche Vorteile bzw. Chancen, aber auch welche Nachteile bzw. Risiken birgt die-
ser Status quo für die einzelnen Archive oder auch für die gesamte kirchliche Ar-
chivlandschaft?
Welche alternativen Möglichkeiten im archivischen Umgang mit solchen Bestän-
den sind vorstellbar?
Schließlich stellt sich die Frage nach dem Umgang mit dem Bestand KFW im DAR:
Ist seine Verwahrung vertretbar, wenn man die Spezifika dieses Bestands im Zu-
sammenhang mit der Aufbewahrung, Erschließung und Nutzung berücksichtigt?
Und wenn ja, unter welchen Prämissen? Und auch hier: Wie könnte eine Alterna-
tive aussehen?
Hinter allen Überlegungen soll die Frage stehen, ob die derzeit geltenden Strukturen und
Zuständigkeiten in Archiven der katholischen Kirche förderlich für eine aus Archiv- und
Nutzersicht angemessene Zugänglichmachung sind.
Zunächst, also vor der eigentlichen Untersuchung, soll der Begriff „Fremdbestand“, der
Ausgangspunkt der Arbeit, aufgegriffen und näher erläutert werden; insbesondere soll,
ausgehend vom KFW, definiert werden, wie er im Rahmen dieser Untersuchung Verwen-
dung findet.
1.2. Bestimmung des Begriffs „Fremdbestand“
1.2.1. Der Begriff „Fremdbestand“: Allgemeine Hinführung
Bereits für den Wortbestandteil „Bestand“ finden sich in der Literatur unterschiedliche
Definitionen. Kurz und prägnant wird in der „Praktischen Archivkunde“ ein Bestand als
„Komplex von Archivgut, der die Überlieferung eines oder mehrerer Registraturbildner
4vereinigt“, beschrieben.2 Weitergefasst ist die Definition in der Terminologie der Archiv-
wissenschaft der Archivschule Marburg: Ein „Bestand bezeichnet eine Gruppe von Unter-
lagen, die nach logisch nachvollziehbaren Gesichtspunkten wie ihrer Herkunft, ihrem Ent-
stehungszusammenhang (Provenienzprinzip), ihrem Sachinhalt (Pertinenzprinzip), for-
malen oder materiellen Merkmalen (Sammlungsgut, Selekt) zu einer Einheit zusammen-
gefasst werden. Bestände fungieren als zentrale Gliederungsebene der Tektonik eines Ar-
chivs.3 Sicherlich ist mit diesen Definitionen die terminologische Diskussion um den Be-
stands- oder Beständebegriff noch nicht erschöpft, gerade wenn man sich die von Johan-
nes Papritz aufgeführten Unterscheidungen (Archivbestand, Bestand, Archivabteilung,
Fonds etc.) vor Augen führt.4 Doch dürfte für die vorliegende Untersuchung genügen,
wenn man den Begriff im oben genannten Sinne versteht, nämlich als Archivgut, das die
Überlieferung eines Registraturbildners darstellt.
Noch wesentlich komplexer ist die Annäherung an den Begriff Fremdbestand. In den ein-
schlägigen Publikationen zur Archivterminologie wird er nicht ausgewiesen, die für die
Archivwissenschaft in Deutschland maßgeblichen (Standard-)Werke führen den Begriff
nicht.5
Gleichwohl zeigt eine schlichte Google-Suche mit dem Suchbegriff „Fremdbestände Ar-
chiv“: Nicht wenige Archive verwenden in ihren Beständeübersichten bzw. Tektoniken
den Begriff in dieser oder in ähnlicher Form sehr wohl. Einige Beispiele sollen dies ver-
deutlichen, zugleich aber vor Augen führen, wie disparat seine Verwendung ist:
Beispiel 1: Das Archiv der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien weist in
seiner Beständeübersicht einen Punkt „Fremdbestand“ aus (Signatur: AT-MDWA 6), des-
sen Provenienzstelle mit „Österreichischer Musikrat (Bestand Gottfried Scholz) und
HochschülerInnenschaft der mdw – Universität für Musik und darstellende Kunst Wien“
angegeben ist. Dabei werden Fremdbestände definiert als „dem Archiv überlassene oder
2 Ohne Verfasser, Fachbegriffe des Archivwesens, in: Markus Stumpf (Hg.), Praktische Archivkunde. Ein
Leitfaden für Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste. Fachrichtung Archiv, 4. Aufl., Münster
2018, S. 348-360, hier S. 351.
3 Niklas Konze, Barbara Trosse, Bestand, in: Terminologie der Archivwissenschaft, Stand 21. September
2015 (erstellt am 21. September 2015), abrufbar auf der Homepage der Archivschule Marburg unter:
https://www.archivschule.de/uploads/Forschung/ArchivwissenschaftlicheTerminologie/Terminolo-
gie.html [letzter Zugriff am 30.9.2020].
4 Vgl. Johannes Papritz, Archivwissenschaft, Bd. 1, Marburg 1976, S. 99-113.
5 Vgl. Johannes Papritz, Archivwissenschaft, Bd. 1; Staatliche Archivverwaltung im Ministerium des Innern
der Deutschen Demokratischen Republik (Hg.), Ordnungs- und Verzeichnungsgrundsätze für die staatli-
chen Archive der Deutschen Demokratischen Republik, Berlin 1964.
5zur Betreuung übergebene Bestände (z.B. Dauerleihgaben externer Einrichtungen) uni-
versitätsverwandter bzw. der Universität nahestehender Organisationen“.6
Beispiel 2: Das Staatsarchiv Sigmaringen beschreibt seine Bestände wie folgt: „Den [...]
Kern der [...] Abteilung bildet die Überlieferung der bis zum Jahre 1850 souveränen Fürs-
tentümer Hohenzollern-Hechingen und Hohenzollern-Sigmaringen sowie des bis 1945
bestehenden preußischen Regierungsbezirks Sigmaringen.“7 Ferner würden die Be-
stände ergänzt durch hinterlegte Archive, die [...] für die Geschichte Hohenzollerns und
Oberschwabens von großer Bedeutung“ seien.8 Gerade diese „hinterlegten Archive“, wel-
che die Bestände „ergänzen“, lassen in Richtung Fremdbestände denken; doch sind hier-
mit vielmehr die Abteilungen Dep. (Deposita), N (Nachlässe, Partei-, Verbands- und Ver-
einsarchive) sowie Sa (Sammlungen) gemeint. Der Begriff „Fremdbestände“ findet sich
erst unterhalb der Abteilung „FAS Fürstlich Hohenzollernsches Haus- und Domänenar-
chiv“, das seinerseits ein Depositum ist (Dep. 39). Hier sind es die Bestände mit der Sig-
natur FAS F (F 1 bis F 45), die als Fremdbestände bezeichnet und als „Archivalien anderer
Provenienzen“ beschrieben werden. Beispielhaft seien genannt die Bestände FAS F 2 T 1
Museumsgesellschaft Sigmaringen und FAS F 5 T 1 Fürstlich Hohenzollerischer Beamten-
verein e.V.9 Wodurch sich diese Bestände von deponierten Archiven oder auch von Be-
ständen der Abteilung N dezidiert unterscheiden, bleibt unklar; die Irritation steigt damit,
dass unterhalb der Abteilung FAS auf gleicher Gliederungsebene wie die Fremdbestände
eine Bestandsgruppe FAS H (Hinterlegungen) ausgewiesen wird.
Beispiel 3: Das Universitätsarchiv Dresden verwahrt die „Aktenüberlieferungen […] der
TU Dresden und deren Vorgängerinstitutionen seit 1800“.10 Es weist Fremdbestände in
der Bestandsübersicht unter „X 02“ aus, darunter die Bestände „X02 – Fachschule für
Forstwirtschaft Tharandt 1946 – 1955“ oder auch „X04 – Institut zur Förderung und
6 Vgl. Beständeübersicht des Archivs der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien, abrufbar unter
https://www.mdw.ac.at/arc/?PageId=2997 [letzter Zugriff am 30.9.2020].
7 Vgl. Beschreibung der Zuständigkeiten des Staatsarchivs Sigmaringen, abrufbar unter https://www.lan-
desarchiv-bw.de/de/landesarchiv/standorte/staatsarchiv-sigmaringen/47267 [letzter Zugriff am
30.9.2020].
8 Vgl. Beschreibung der Zuständigkeiten des Staatsarchivs Sigmaringen, abrufbar unter https://www.lan-
desarchiv-bw.de/de/landesarchiv/standorte/staatsarchiv-sigmaringen/47267 [letzter Zugriff am
30.9.2020].
9 Vgl. Beständeübersicht des Staatsarchivs Sigmaringen, abrufbar unter https://www2.landesarchiv-
bw.de/ofs21/olb/struktur.php?archiv=6&klassi=6.02.005.001.022&anzeigeKlassi=6.02.005&zeigehaupt-
frame=1 [letzter Zugriff am 30.9.2020].
10 Vgl. Beständeübersicht des Archivs der Technischen Universität Dresden, abrufbar unter https://tu-dres-
den.de/ua/archiv-bestaende [letzter Zugriff am 30.9.2020].
6Integration des Tourismus in Europa e.V.“, ohne die Bestandsgruppe bzw. die einzelnen
Bestände näher zu erläutern.
Beispiel 4: Das Universitätsarchiv Freiburg „ist als zentrale Einrichtung für die Unterlagen
der gesamten Universität und Universitätskliniken zuständig. Das Archiv erfaßt, bewertet
und übernimmt Schriftgut von bleibendem Wert aus allen Einrichtungen der Universität.
Darüber hinaus sammelt das Archiv als Ergänzung Materialien von der Universität nahe-
stehenden Einrichtungen, von Vereinen, Nachlässe von Universitätsangehörigen und legt
Sammlungen zur Universitätsgeschichte an.“11 Der Begriff „Fremd“ findet sich in der Be-
ständeübersicht gleich an zwei Stellen: Unter Abteilung „3. Fremdprovenienzen“ werden
Institutionen (3.1), Körperschaften und Vereine (3.2), Nachlässe (3.3) und sonstige Pro-
venienzen ausgewiesen (3.4). Beispiele für entsprechende Institutionen sind die Bestände
„C0028 Oberbadischer Forschungsring (1950-1955)“ und „C0052 Studentenwerk Frei-
burg (1922-1982)“, für Körperschaften und Vereine die Bestände „C0011 Freiburger Wis-
senschaftliche Gesellschaft (1912-1945)“ und „C0174 Studentische Gemeinschaft Al-
berto-Ludoviciana (1946-1953)“, für sonstige Provenienzen die Bestände „C0112 Bildar-
chiv für Zoologie Freiburg, Hans Spemann (1920-1940)“ und „C0160 Handakten zur Frei-
burger Studentenzeitung, Werner Müller (1959-1960)“. Darüber hinaus gibt es unter der
Abteilung „4. Sammlungen, Selekte“ eine Bestandsgruppe „Bestandergänzungen aus
fremden Archiven“, darunter den Bestand „D0106 Tiroler Landesarchiv Innsbruck
(1998)“ und den Bestand „D0088 Vatikanischen Archiv (um 1451)“.12
Beispiel 5: In eine noch andere Richtung zielt die Definition des Landeskirchenarchivs Ei-
senach, das unter Punkt 8. der Beständeübersicht „Virtuelle und fremde Bestände“ aus-
weist. Fremde Bestände werden dabei beschrieben als „Unterlagen, die physisch in ande-
ren Archiven vorhanden und dort einsehbar sind, die inhaltlich aber für die Orts- und Kir-
chengeschichte unserer Region interessant sein können, weshalb wir diese Findmittel
hier zur Information einstellen“.13
In der Literatur hingegen findet sich das Wort „fremd“ äußerst selten. Die Stichwort-Re-
cherche „fremd“ über die Fachbibliografie der Archivschule Marburg zeigt nur einen Fall,
11 Vgl. Aufgaben des Universitätsarchivs Freiburg, abrufbar unter https://www.uniarchiv.uni-frei-
burg.de/universitaetsarchiv [letzter Zugriff am 30.9.2020].
12 Vgl. Beständeübersicht des Universitätsarchivs Freiburg, abrufbar unter https://www.uniarchiv.uni-frei-
burg.de/bestaende/sammlungen/copy_of_fremdarchive [letzter Zugriff am 29.9.2020].
13 Vgl. Beständeübersicht des Landeskirchlichen Archivs Eisenach, abrufbar unter http://www.landeskir-
chenarchiv-eisenach.de/bestaende-und-recherche/gesamtuebersicht-bestaende/8-virtuelle-bestaende/
[letzter Zugriff am 30.9.2020].
7in dem der Terminus „fremd“ in Bezug auf Bestände bzw. Archivgut verwendet wird:
Mark Steinert überschreibt einen Aufsatz mit „Rechtliche Fragen und Probleme bei der
Übernahme fremden Archivguts“ und versteht unter fremdem Archivgut solches „aus Pri-
vateigentum und Privatbesitz“, das dem Archiv entweder in Form eines Depositums oder
in Form einer Eigentumsübertragung überlassen wird.14
Vor allem im staatlichen und kommunalen Archivwesen hat sich aber eine Unterschei-
dung durchgesetzt, die zwar nicht explizit den Begriff „Fremdbestand“ oder „fremd“ ver-
wendet, doch für die weitere Diskussion nützlich sein kann: die Unterscheidung zwischen
amtlichem und nichtamtlichem Schriftgut bzw. Archivgut. Dabei ist amtliches Archivgut
das, was aus den amtlichen Registraturen des Archivträgers erwachsen ist, nichtamtliches
Archivgut in Analogie dazu das, was nicht aus den amtlichen Registraturen erwachsen ist.
Anders ausgedrückt heißt das: Amtliches Archivgut „fällt“ dem Archiv durch Anbietung in
gewissem Sinne automatisch zu, nichtamtliches Schriftgut wird vom Archiv entweder ak-
tiv eingeworben, kommt ihm in Form von Schenkungen zu oder wird von dem Eigentümer
bzw. Produzenten als Depositum im Archiv gelagert.15 Heinrich Otto Meisner verwendet
für nichtamtliches Archivgut denn auch tatsächlich die Wendung „Sammlungsgut aus re-
gistraturfremdem Material“.16
Zusammenfassend lässt sich sagen: Am nächsten an der wortwörtlichen Bedeutung des
Begriffs „fremd“ ist sicherlich die Definition des Landeskirchenarchivs Eisenach, doch
dürfte sie für die weitere Begriffseingrenzung wenig hilfreich sein, da es um Bestände ge-
hen soll, die physisch im eigenen Archiv verwahrt werden. Allen anderen Definitionen ist
gemeinsam, dass sie mit den Bezeichnungen „fremdes Archivgut“, „Fremdbestände“,
„fremde Provenienz“ und „registraturfremdes Material“ jeweils solches Archivgut in den
Blick nehmen, das nicht oder nicht unmittelbar aus den Registraturen entstammt, die in
die Zuständigkeit des eigenen Archivs fallen, und somit der „eigenen“ Überlieferung ent-
gegensteht und diese (möglicherweise) ergänzt.
14 Vgl. Mark Steinert, Rechtliche Fragen und Probleme bei der Übernahme fremden Archivguts, in: Alles was
Recht ist. Archivische Fragen – juristische Antworten. 81. Deutscher Archivtag in Bremen, Redaktion: Hei-
ner Schmitt, Fulda 2012, S. 179-187, hier S. 179.
15 Vgl. Marcus Stumpf, Nichtamtliche Überlieferung in Kommunalarchiven zwischen archivwissenschaftli-
cher Theoriebildung und Archivierungspraxis, in: Archivpflege in Westfalen-Lippe 75 (2011), S. 9-15, hier
S. 9 [bei weiteren Nennungen abgekürzt: Marcus Stumpf, Nichtamtliche Überlieferung].
16 Heinrich Otto Meisner, Archivalienkunde vom 16. Jahrhundert bis 1918, 3. Aufl., Leipzig 1969, S. 86.
81.2.2. Was ist „fremd“ am Katholischen Filmwerk Rottenburg?
Um die Frage der Überschrift zu beantworten, bedarf es zunächst eines kurzen histori-
schen Einstiegs. Katholische Filmarbeit war eine moderne Ausdrucksform des katholi-
schen Milieus des frühen 20. Jahrhunderts, das auf gemeinsamen Wertvorstellungen be-
ruhte und durch die im Milieu verankerten Institutionen zusammengehalten wurde. Vor
allem die Filmarbeit half dabei, die katholische Weltanschauung zu verbreiten und die
Abgrenzung gegen anders gerichtete sozio-kulturelle Strömungen zu stärken.17
Die Gründung des KFW war maßgeblich mit dem Rottenburger Diözesanpriester Eugen
Semle (*1896 in Friedrichshafen, 1965 in Horb am Neckar) verbunden, der sich der Film-
arbeit bereits in den 1920er-Jahren verschrieb und moderne Kommunikationsmittel in
der praktischen Seelsorge einsetzte. Zunächst Diözesanpräses des Borromäusvereins,
wurde er Leiter des Bildungswerks für die Diözese Rottenburg, in dem er besonderes Au-
genmerk auf die Bildmedien legte. So richtete er 1932 eine eigene Abteilung „IV – Filmar-
beit“ ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg warb er für die Gründung eines katholischen Fil-
minstituts, das dann 1953 mit dem KFW geschaffen wurde.18
Auf der Tagung der Katholischen Filmarbeit 1952 in Friedrichshafen legte Eugen Semle
ein Konzept vor, das die Gründung eines Katholischen Filminstituts für das deutsche
Sprachgebiet zum Ziel hatte. Das Konzept bezog sich sowohl auf das Medium (Kino-)Film
als auch auf das kurz vor seiner Einführung in der Bundesrepublik stehende Medium (öf-
fentliches) Fernsehen und ruhte auf drei Säulen: Die erste Säule war die Filmkritik, die
17 Zunächst jedoch stand der Katholizismus dem Medium Film ablehnend gegenüber. Man sah eine sittliche
Gefährdung für die Jugend und man hatte moralische Vorbehalte wegen „Schmutz und Schund“. Aber be-
reits ab 1912 kam es zu einem Wandel in der Bewertung: Es wurde die Chance des Einsatzes von Filmen
für die religiös-konfessionelle Volksbildung erkannt. Rasch folgten Gründungen in den Bereichen Filmpro-
duktion und Filmdistribution, die in die bereits bestehende katholische Vereins- und Verbandsstruktur ein-
gegliedert wurden mit dem Ziel der Versorgung der Katholiken mit alternativen Kinoprogrammen. In der
Weimarer Republik entwickelten sich dann Dachorganisationen mit Geistlichen an der Spitze, welche die
einzelnen Tätigkeitsfelder zusammenfassten bzw. koordinierten. Durch die nationalsozialistische Herr-
schaft kam es im Zuge der Gleichschaltung faktisch zu einer Unterbindung jeglicher kirchlicher Filmarbeit.
Nach dem Zweiten Weltkrieg nutzte die katholische Kirche das Medium Film sodann in besonderer Weise,
gewannen die Kirchen insgesamt doch großen Einfluss auf Kultur und Politik. Bereits 1946 initiierte die
Fuldaer Bischofskonferenz die Gründung der Kirchlichen Hauptstelle für Bild- und Filmarbeit als überdiö-
zesane Dachorganisation. Es folgten weitere überdiözesane Organisationen, aber auch diözesane Instituti-
onen. Die diözesane Filmarbeit wurde dabei entscheidend geprägt und gefördert durch die von den in den
einzelnen Diözesen tätigen Filmstellen initiierte Errichtung des KFW. Vgl. Peter Hasenberg, Katholische
Filmarbeit als Teil der nationalen Filmkultur, in: Hermann-Josef Braun, Johannes Horstmann (Hg.), Katho-
lische Filmarbeit in Deutschland seit den Anfängen des Films. Probleme der Forschung und der Geschichts-
schreibung (= Beiträ ge zum Archivwesen der Katholischen Kirche Deutschlands, Bd. 6), Mainz 1998, S. 11-
42, hier S. 13-15 [bei weiteren Nennungen abgekürzt: Peter Hasenberg, Katholische Filmarbeit].
18 Vgl. Wilhelm Bettecken, Bilder, Bildung und Bilanzen. 40 Jahre Katholisches Filmwerk 1953-1993, Erz-
hausen 1993 [bei weiteren Nennungen abgekürzt: Wilhelm Bettecken, Katholisches Filmwerk].
9zweite Säule die Filmbildungsarbeit; die dritte Säule sollte ein neues Institut sein, das die
praktische Filmarbeit durchführen sollte: Filmproduktion und -distribution.
Produziert wurden Spiel-, aber auch Dokumentationsfilme v.a. von (kirchlichen) Großer-
eignissen wie Katholikentage, Synoden etc. oder Nachrichtenfilme, die das Zeitgeschehen
einfingen und transportierten. Das Markenzeichen des KFW wurde eine monatliche Ak-
tualitäten- und Nachrichtenschau, die unter dem Namen „Zeitschau“ (ab 1956 „Spiegel
der Zeit“) erschien.19
Der Fokus der Berichterstattung lag am Anfang v.a. aus Gründen der geringeren Produk-
tionskosten im Bereich des Bistums Rottenburg bzw. im bundesdeutschen Südwesten.
Schnell weitete sich die Berichterstattung aber auf das ganze katholische Deutschland
aus, selbst das in der DDR gelegene Eichsfelds wurde miteinbezogen. Darüber hinaus wur-
den nicht nur kirchliche, sondern auch rein säkulare, gesamtgesellschaftlich relevante
Themen aufgegriffen.20
Da die Tätigkeitsbereiche recht komplex und teilweise auch wirtschaftlich riskant waren,
wurden unter (Mehrheits-)Beteiligung des KFW unterschiedliche privatwirtschaftliche
Einrichtungen gegründet, auf die das KFW bestimmte Geschäftsfelder auslagerte: 1956
die Materna GmbH als eigener Filmverleih, 1960 die TELLUX-Film-GmbH als eigene Pro-
duktionsgesellschaft, die überwiegend Fernsehsendungen produzierte.21
Um die Ausgangsfrage zu beantworten, ist es unerlässlich zu erhellen, wie das KFW in die
organisatorischen Strukturen der Rottenburger Bistumsverwaltung eingegliedert war.
Die Gründung erfolgte am 29. April 1953 durch Eintragung in das Vereinsregister beim
Amtsgericht Rottenburg, der Sitz war Rottenburg.22 Dafür waren zwei Personalien aus-
schlaggebend: Erstens war der Rottenburger Bischof Carl Joseph Leiprecht Referent für
das Filmwesen und das Filmapostolat der Fuldaer Bischofskonferenz. Zweitens über-
nahm Eugen Semle die Leitung des KFW. Und schließlich verfügte Rottenburg bereits
über ein gut ausgestattetes Filmstudio zur Herstellung eigener Filme.23
19 Vgl. Wilhelm Bettecken, Katholisches Filmwerk, S. 8-9.
20 Vgl. Wilhelm Bettecken, Katholisches Filmwerk, S. 10-11. Über die
weiteren Tätigkeitsfelder des KFW gibt
eine im DAR überlieferte Broschüre Auskunft: „1. Beratung und Hilfe bei der Anschaffung von Filmprojek-
toren und Zubehör. 2. Einen eigenen Kundendienst. […] 3. Eingehende Beratung bei der Gestaltung von
Filmprogrammen. 4. Vermittlung von Filmen […].“ DAR, G 1.1, D 2.4d (KFW), Quadrangel 28: Prospekt Film-
vorführgeräte, 1957
21 Vgl. Peter Hasenberg, Katholische Filmarbeit, S. 17-18.
22 Vgl. Wilhelm Bettecken, Katholisches Filmwerk, S. 7.
23 DAR, G 1.1, D 2.4d (KFW), Quadrangel21: Bericht, Rückblick und Ausblick vom 10.5.1957 über den tech-
nischen Stand des Filmstudios im KFW.
10Organisatorisch war das KFW in die Bistumsverwaltung eingegliedert, darüber hinaus fi-
nanziell und juristisch abhängig vom Bistum Rottenburg. Zum einen wurde es aus Mitteln
des Bildungswerks finanziert, zum anderen legte die Satzung fest, dass die Aufsicht dem
Bischof von Rottenburg oblag. Dieser hatte Einsicht in die Geschäftsführung und musste
Satzungsänderungen zustimmen. Andere Bistümer waren lediglich Mitglieder, die wie in
jedem anderen Verein Mitgliedsbeiträge zu entrichten hatten.24 In Summe spricht diese
Organisation nicht für einen „Fremdbestand“.
„Fremd“ hingegen ist in großen Teilen der Inhalt der Überlieferung, der nicht auf die Diö-
zese Rottenburg beschränkt blieb, sollte die inhaltliche Ausrichtung doch das gesamte ka-
tholische Deutschland umfassen. Insofern kann man sagen: „Die Satzung des Filmwerks
ist ausgerichtet, wie wenn es eine diözesane Einrichtung wäre, während die Zwecke […]
doch überdiözesane sind.“25
1.2.3. „Fremdbestände“ im Sinne dieser Arbeit
Wie eingangs formuliert, soll nicht das KFW im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen, es war
nur der Ausgangspunkt für die weiteren Überlegungen. Es ist – das zeigte der vorige Ab-
schnitt – nur hinsichtlich des Inhalts seiner Überlieferung als dem DAR teilweise fremde
Überlieferung anzusehen, nicht hinsichtlich seiner Struktur bzw. Organisation. Zwar wird
auch die inhaltliche Komponente von Überlieferungen mitberücksichtigt; primär soll es
in der Untersuchung aber um die organisatorische Komponente gehen, Bestandsbildner,
die eben nicht in die Organisation einer Bistumsverwaltung eingegliedert sind und des-
halb auch inhaltlich eine überdiözesane Überlieferung aufweisen. Mit anderen Worten:
Beide „Fremd“-Komponenten sollen gegeben sein.
Als Untersuchungsgegenstand besonders geeignet erscheinen hier die rechtlich selbstän-
digen, nicht der Jurisdiktion einer einzelnen Diözese unterstehenden überdiözesanen
Gremien, Vereine, Organisationen und v.a. Verbände, die ein wesentliches Element des
katholisch-konfessionellen Lebens in Deutschland darstellen.
24 DAR, G 1.1, D 2.4d (Kath. Filmwerk Rottenburg), Quadrangel 5: Satzung des KFW vom 29.4.1953.
25 DAR, G 1.1, D 2.4d (Kath. Filmwerk Rottenburg), Quadrangel 5: Satzung des KFW vom 29.4.1953.
111.3. Gang der Untersuchung
In einem ersten Schritt soll geprüft werden, ob in den einschlägigen normativen Grundla-
gen für das kirchliche Archivwesen Regelungen getroffen sind, die auf den archivischen
Umgang mit überdiözesanen Beständen eingehen.
In einem zweiten Schritt soll begutachtet werden, ob es in den normativen Grundlagen
und in der Literatur Hinweise gibt, wie mit einer Überlieferung umzugehen ist, die sich
inhaltlich nicht nur auf den eigenen Archivsprengel beschränkt und nicht in die unmittel-
bare Zuständigkeit eines Diözesanarchivs fällt. Hier stellt sich die Frage, ob überhaupt
Aussagen darüber getroffen sind, was kirchliche Archive überliefern und dokumentieren
sollen.
In einem dritten Schritt soll der in der Praxis vorgefundene Status quo analysiert werden.
Dabei wird sowohl die Seite der Bestandsbildner also auch die Seite der Diözesanarchive
betrachtet: Wo werden Fremdbestände im oben formulierten Sinne verwahrt? Dazu wer-
den die Ergebnisse zweier Erhebungen vorgestellt: eine bei ausgewählten überdiözesa-
nen Verbänden und eine bei den 27 Diözesanarchiven vorgestellt. Bei ersterer wurde ab-
gefragt, wie die eigene Verbandsüberlieferung verwahrt wird, bei letzterer wurde gefragt,
wie mit Beständen überdiözesaner Organisationen umgegangen wird und welche Bedeu-
tung solche Bestände bisher haben und in Zukunft haben werden.
Daran anknüpfend soll eine Bewertung des Status quo vorgenommen werden: einerseits
aus der Perspektive der kirchlichen Archive, andererseits aus der Perspektive der Nutzer.
In einem letzten Schritt sollen – abgeleitet aus den Befunden des vorigen Abschnitts –
Verbesserungsvorschläge präsentiert werden, wie kirchliche Archive künftig Fremdbe-
stände archivieren können.
Ein ergänzendes Kapitel wird – kursorisch und um auf die Ausgangssituation zurückzu-
kommen – auf den Umgang mit der Überlieferung des KFW im DAR eingehen.
1.4. Forschungsstand und Literatur
Das zu behandelnde Thema ist in der Literatur zum kirchlichen Archivwesen bislang noch
nicht Untersuchungsgegenstand gewesen. Erschwerend kommt hinzu, dass insgesamt
wenig Literatur zum Archivwesen der katholischen Kirche vorliegt. Ein Grund ist das ak-
tuelle Fehlen einer eigenen archivfachlichen Publikation(-sreihe). Die von der Bundes-
12konferenz der kirchlichen Archive in Deutschland26 (im Folgenden: BuKo) herausgegebe-
nen „Beiträge zum Archivwesen der katholischen Kirche Deutschlands“ wurden 2003 mit
dem siebten Themenband aufgegeben. Diese Bände repräsentieren die Schwerpunkte,
mit denen sich die katholischen Archive beschäftigt haben und teilweise noch immer be-
schäftigen: kirchenarchivspezifische Themen wie der Umgang mit Pfarrarchiven und
Pfarrmatrikeln (Kirchenbüchern), die Bedeutung von Nachlässen und Sammlungen, fer-
ner zum Auftrag kirchlicher Archive und zur Überlieferungsbildung (von Pfarrarchiven)
sowie zur Filmüberlieferung. Auf die einschlägigen und in dieser Arbeit verwendeten
Publikationen wird an gegebener Stelle verwiesen.
Eine wichtige Stütze für jegliche Beschäftigung mit dem kirchlichen Archivwesen ist der
von Toni Diederich verfasste und von der BuKo herausgegebene „Führer durch die Bis-
tumsarchive der Katholischen Kirche in Deutschland“, der sogenannte „Gelbe Führer“, der
einen Überblick über die historische Entwicklung der deutschen Bistumsarchive gibt und
die einzelnen Archive vorstellt.27 Als (digitalen) Nachfolger und zeitgemäße Fortschrei-
bung des „Gelben Führers“ bauten die katholischen Archive auf Initiative der Deutschen
Bischofskonferenz (im Folgenden DBK) 2009-2010 die Präsenz „www.katholische-ar-
chive.de“ auf, die einen einheitlichen Einstieg und Anlaufpunkt zum katholischen Archiv-
wesen bietet und auch Informationen zu den Archiven der Klöster und Kongregationen
sowie der sonstigen kirchlichen Organisationen einschließt.28
26 Die Bundeskonferenz der kirchlichen Archive in Deutschland ist die „Dachorganisation“ des katholischen
Archivwesens in Deutschland. Sie besteht in ihrer heutigen Form seit 1983 und geht auf die 1953 gegrün-
dete Arbeitsgemeinschaft der Bistumsarchive zurück. Die Bundeskonferenz ist der Kommission VIII (Wis-
senschaft und Kultur) der Deutschen Bischofskonferenz zugeordnet und hat die Aufgabe, die Diözesanbi-
schöfe bei der Verwaltung und Erhaltung kirchlichen Schriftgutes fachlich zu beraten. Sie dient dem In-for-
mationsaustausch zwischen den kirchlichen Archiven, erarbeitet Leitlinien zu wichtigen archivrechtlichen
und -praktischen Fragen und führt Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für Archivmitarbeiter durch. Mit-
glieder der Bundeskonferenz sind die Leiter der 27 Diözesanarchive sowie Vertreter der Arbeitsgemein-
schaften der Ordensarchive und der Archive überdiözesaner Einrichtungen und Verbände. Ihren Vorsitzen-
den wählen die Mitglieder der Bundeskonferenz jeweils für eine Amtszeit von vier Jahren; vgl. die Vorstel-
lung der BuKo auf der Präsenz www.kirchliche-archive.de, abrufbar unter http://www.katholische-ar-
chive.de/Bundeskonferenz/tabid/61/Default.aspx [letzter Zugriff am 30.9.2020].
27 Bundeskonferenz der Kirchlichen Archive in Deutschland (Hg.), Führer durch die Bistumsarchive der Ka-
tholischen Kirche in Deutschland, 2. überarb. und erweiterte Aufl., Siegburg 1991.
28 Startseite der Präsenz, abrufbar unter http://www.katholische-archive.de/Home/tabid/38/Default.aspx
[letzter Zugriff am 30.9.2020]; vgl. auch Ulrich Helbach, Stefan Plettendorff, www.kirchliche-archive.de on-
line, in: Archivar 63 (2010), Heft 2, S. 184-186 [bei weiteren Nennungen abgekürzt: Ulrich Helbach, Stefan
Plettendorff, www.kirchliche-archive.de].
13Zumindest Berührungspunkte mit der vorliegenden Arbeit haben Aufsätze von Ulrich
Helbach29 und Johannes März30 sowie ein umfangreicher Beitrag jüngeren Datums von
Tobias Schröter-Karin31, da sie alle auf die grundsätzliche Struktur, Zuständigkeiten und
Überlieferungsbildung der kirchlichen Archive eingehen.
Die Arbeit stützt sich zu einem Gutteil auf die normativen Grundlagen des Archivwesens
der katholischen Kirche. Diese sind in einer vom Sekretariat der DBK herausgegebenen
Arbeitshilfe „Die pastorale Funktion der kirchlichen Archive“ zusammengefasst, die ne-
ben dem titelgebenden Schreiben der Päpstlichen Kommission für die Kulturgüter der
Kirche weitere wichtige Dokumente enthält (katholisches Kirchenrecht, der Codex Iuris
Canonici, das kirchliche Archivgesetz, die Kirchliche Archivordnung – KAO, sowie weitere
Anordnungen und Empfehlungen).32 Auf die einzelnen Regelungen wird an anderer Stelle
ausführlich verwiesen.
29 Ulrich Helbach, Katholisch-kirchliche Archive in der rheinischen Archivlandschaft, in: Claudia Kauertz
(Red.), Archivlandschaft Rheinland. 49. Rheinischer Archivtag 18.-19. Juni 2015 in Pulheim-Brauweiler (=
Landschaftsverband Rheinland, LVR-Archivberatungs- und Fortbildungszentrum, Archivhefte Bd. 46), S.
76-85 [bei weiteren Nennungen abgekürzt: Ulrich Helbach, Rheinische Archivlandschaft].
30 Johannes Merz, Zum Sammlungsprofil katholischer Kirchenarchive am Beispiel des Diözesanarchivs
Würzburg, in: Archive in Bayern 8 (2014), S. 183-189 [bei weiteren Nennungen abgekürzt: Johannes Merz,
Sammlungsprofil].
31 Schröter-Karin, Tobias, Muss guter Rat teuer sein? – Eine Untersuchung zum Sinn einer katholischen Ar-
chivberatungsstelle in Deutschland (= Masterarbeit an der Fachhoch-schule Potsdam, eingereicht am 20.
Februar 2019), online abrufbar unter https://opus4.kobv.de/opus4-fhpots-dam/frontdoor/index/in-
dex/searchtype/collection/id/15997/rows/10/doctypefq/masterthe-
sis/start/2/yearfq/2019/docId/2363 [letzter Zugriff am 30.9.2020], [bei weiteren Nennungen abgekürzt:
Tobias Schröter-Karin, Archivberatungsstelle].
32 Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Die Päpstliche Kommission für die Kulturgüter der
Kirche: Die pastorale Funktion der kirchlichen Archive (= Arbeitshilfen Nr. 142), Bonn 2016.
142. Zuständigkeiten und Überlieferungsbildung in Archiven der ka-
tholischen Kirche
Im Folgenden soll versucht werden, eine gewisse Ordnung in die kirchliche Archivland-
schaft zu bringen.
2.1. Normative Grundlagen der Zuständigkeiten
2.1.1. Einordnung kirchlicher Archive in die deutsche Archivlandschaft
Die Komplexität der Archivlandschaft in Deutschland und die der Archive der katholi-
schen Kirche beschreiben zwei Zitate äußerst treffend: „Jedes Archiv besitzt […] eine ei-
gene Individualität, es unterscheidet sich erheblich von anderen selbst innerhalb dersel-
ben Archiv-Gattung. Diese in den unterschiedlichen Trägern, Traditionen, Regionen, in
der finanziellen Ausstattung und weiteren Faktoren mehr begründete Vielfalt der deut-
schen Archivlandschaft macht es unmöglich, eine simple Schablone für den Aufbau und
die Nutzung einer solchen Einrichtung zu entwerfen.“33 Dieses von Martin Burkhardt skiz-
zierte Bild, das erste der oben angekündigten Zitate, mag im Grundsatz stimmen, trotz-
dem nennt Martin Burkhardt selbst bereits wichtige Unterscheidungsmerkmale von Ar-
chiven und verwendet auch den Begriff der Archivgattung. Eine maßgebliche Untertei-
lung ist die in öffentliche und nichtöffentliche Archive. Nichtöffentliche Archive archivie-
ren Archivgut aus privater Hand und unterliegen keiner Archivgesetzgebung; zu dieser
Kategorie zählen etwa Unternehmens- oder Adelsarchive.34 Öffentliche Archive hingegen
unterstehen der Archivgesetzgebung des Bundes oder der Länder. Zu ihnen gehören die
staatlichen Archive, darunter das Bundesarchiv und die Staats- bzw. Landesarchive, die
Archive der kommunalen Gebietskörperschaften (v.a. Kreisarchive, Stadt- und Gemeinde-
archive), sowie Archive sonstiger juristischer Personen (Körperschaften) des öffentlichen
Rechts (Hochschulen, Verbände, Kammern etc.).35 Weiterhin sind öffentliche Archive im
33 Martin Burkhardt, Arbeiten im Archiv. Praktischer Leitfaden für Historiker und andere Nutzer, Pader-
born, München, Wien, Zürich 2006, S. 19 [bei weiteren Nennungen abgekürzt: Martin Burkhardt, Arbeiten
im Archiv].
34 Vgl. Jost Hausmann, Archivrecht. Ein Leitfaden, Frankfurt am Main 2016, S. 19.
35 Vgl. Irmgard Christa Becker, Staatsaufbau und Archivwesen, in: Dies., Clemens Rehm (Hg.), Archivrecht
für die Praxis. Ein Handbuch (= Berliner Bibliothek zum Urheberrecht, Bd. 10), München 2017, S. 13-18,
hier S. 14 ff.; ähnlich Jost Hausmann, Archivrecht, S. 20 ff.
15Gegensatz zu nichtöffentlichen Archiven verpflichtet, Archivgut allgemein zugänglich zu
machen.36
Diese Unterteilung entspricht gleich mehreren Prinzipien: Zum einen ist das Provenienz-
prinzip nicht nur maßgebend für die Struktur von Archivtektoniken, sondern für die ge-
samte Organisation des Archivwesens. Archivgut wird danach in demjenigen Archiv ver-
wahrt, das mit der Behörde, in der das Schriftgut angefallen ist, verbunden ist. Dies spie-
gelt zudem den föderalistischen Staatsaufbau mit der Kulturhoheit der Länder wider. Das
in Behörden des Bundes (und seiner Vorgängerinstitutionen) entstandene Schriftgut wird
im Bundesarchiv verwahrt, das der Länderbehörden (und ihrer Vorgänger) in den Staats-
bzw. Landesarchiven. Schließlich zeigt sich auch der Grundsatz der kommunalen Selbst-
verwaltung: Schriftgut aus Kommunen wird in Kreis-, Stadt- und Gemeindearchiven ver-
wahrt, und zwar in deren eigener Verantwortung.37
Das zweite Zitat bezieht sich auf die Archive der katholischen Kirche: „Es ist in der Tat
unmöglich, die Geographie der kirchlichen Archive insgesamt zu beschreiben, die zwar
die kirchenrechtlichen Vorschriften einhalten müssen, in ihrem Reglement aber autonom,
in ihrer Organisation sehr verschieden und auf jede der in der zweitausendjährigen
Geschichte der Kirche entstandenen Einrichtungen eigens abgestimmt sind.“38 Kirchliche
Archive wurden bisher noch nicht genannt, genießen sie doch einen Sonderstatus:
Kirchen sind zwar Körperschaften des öffentlichen Rechts, aber sie unterliegen nicht der
(staatlichen) Archivgesetzgebung. Vielmehr regeln die verfassten Kirchen in Deutschland
und damit auch die römisch-katholische Kirche nach dem Grundgesetz „ihre
Angelegenheiten selbstständig“ (Art. 140 GG). Dies geht auf Art. 137 Abs. 3 der Weimarer
Reichsverfassung (WRV) zurück. In ihr wurde die Trennung von Kirche und Staat fixiert,
den Kirchen wurde der Status öffentlich-rechtlicher Körperschaften zuerkannt. Das
Grundgesetz hat diese Bestimmungen mit Art. 140 im Wortlaut übernommen. Für das
kirchliche Archivwesen heißt dies grundsätzlich, dass es von den Kirchen ebenfalls in
36 Vgl. Marcus Stumpf, Zur „Artenvielfalt“ kommunaler Archive: Traditionen und neue Strategien, Organisa-
tions-, Rechts- und Betriebsformen, in: Mario Glauert und Hartwig Walberg (Hg.), Archivmanagement in der
Praxis (= Veröffentlichungen der Landesfachstelle für Archive und öffentliche Bibliotheken im Brandenbur-
gischen Landeshauptarchiv, Bd. 9), Potsdam 2011, S. 247-272, hier: S. 249
37 Martin Burkhardt, Arbeiten im Archiv, S. 19.
38 Päpstliche Kommission für die Kulturgüter der Kirche, Die pastorale Funktion für die Kulturgüter der
Kirche, vom 2.2.1997, in: Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Die Päpstliche Kommission
für die Kulturgüter der Kirche: Die pastorale Funktion der kirchlichen Archive (= Arbeitshilfen Nr. 142),
Bonn 2016, S. 11-47, hier S. 19-20 [bei weiteren Nennungen abgekürzt: Päpstliche Kommission, Pastorale
Funktion].
16eigener Verantwortung geregelt wird.39
2.1.2. Der Codex Iuris Canonici (CIC)
Der Codex Iuris Canonici (CIC) ist das Gesetzbuch der römisch-katholischen Kirche für die
lateinische Kirche in der Fassung von 1983. Die mit der katholischen Kirche unierten Ost-
kirchen haben mit dem Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (CCEO) ein eigenes Ge-
setzbuch. Vor 1917, als die erste Fassung des CIC in Kraft trat, war das kanonische Recht
nicht kodifiziert gewesen, es beruhte auf einer unverbundenen Sammlung von Einzelge-
setzen vor allem aus dem Hochmittelalter, dem sogenannten Corpus Iuris Canonici. Der
CIC regelt alle Bereiche des kirchlichen Lebens: die Kirchenverfassung, die Rechtsstellung
der Teilglieder, das Verwaltungshandeln, den Verkündigungs- und den Heiligungsdienst,
das Vermögen und das kirchliche Straf- und Prozessrecht.40
Auch für das Archivwesen ist der CIC die übergeordnete Rechtsordnung, entsprechende
Regelungen finden sich im Abschnitt über die „Innere Ordnung der Teilkirchenverbände“
(cc. 460-572 CIC).41 Wie das kirchliche Archivwesen aufgebaut sein soll, welche Arten von
kirchlichen Archiven es gibt und welches Archiv für welche Bestandsbildner oder für wel-
che Überlieferung(en) zuständig ist, wird jedoch nicht geregelt, wie gleich noch zu sehen
ist. Can. 486 § 1 CIC besagt lediglich, dass alle „Dokumente, die sich auf die Diözese oder
auf die Pfarreien beziehen“, sorgfältig aufzubewahren sind. Besonderer Stellenwert
kommt dabei den Diözesanarchiven zu, denn § 2 fordert für jede Diözesankurie, also jede
Bistumsverwaltung, die Einrichtung eines zentralen Diözesanarchivs, in dem Dokumente
„in bestimmter Weise geordnet und sorgfältig verschlossen aufbewahrt“ werden. Diese
Diözesanarchive werden dann in can. 491 § 2 CIC in Abgrenzung zu Verwaltungsarchi-
ven/Registraturen als „historische Archive“ definiert.
39 Verband der Diözesen Deutschlands, Anordnung über die Sicherung und Nutzung der Archive der katho-
lischen Kirche (Kirchliche Archivordnung – KAO) vom 18.11.2013 i.d.F. vom 22.6.2015, in: Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Die Päpstliche Kommission für die Kulturgüter der Kirche: Die pasto-
rale Funktion der kirchlichen Archive (= Arbeitshilfen Nr. 142), Bonn 2016, S. 57-70, hier S. 57-58 (Präam-
bel). Für die Diözese Rottenburg-Stuttgart wurde die KAO mit Erlass des Bischöflichen Ordinariats Nr. 782
vom 7.2.2014 von Generalvikar Clemens Stroppel am 13.2.2014 in Kraft gesetzt. Ihre Gültigkeit erhielt sie
durch Bekanntmachung im Kirchlichen Amtsblatt der Diözese Rottenburg-Stuttgart 2014 Nr. 4 vom
15.3.2014, S. 3-14.
40 Vgl. Karl-Theodor Geringer, Codex Iuris Canonici, in: Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 2, 1994, Sp.
1243-1245.
41 Zitiert nach: Bestimmungen des Codex Iuris Canonici (CIC) zum kirchlichen Archivwesen (Auszug), in:
Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz (Hg.), Die Päpstliche Kommission für die Kulturgüter der Kir-
che: Die pastorale Funktion der kirchlichen Archive (= Arbeitshilfen Nr. 142), Bonn 2016, S. 51-56.
17Can. 491 § 1 CIC fordert darüber hinaus von den Diözesanbischöfen die Sorge um die „Ak-
ten und Dokumente auch der Archive der Kathedral-, Kollegiat- und Pfarrkirchen sowie
der anderen in seinem Gebiet befindlichen Kirchen“.
Auf die Errichtung von Pfarrarchiven wird in can. 535 § 4 CIC Bezug genommen: In jeder
Pfarrei muss ein „Archiv vorhanden sein, in dem die pfarrlichen Bücher aufzubewahren
sind zusammen mit den Briefen der Bischöfe und anderen Dokumenten, die notwendiger-
oder zweckmäßigerweise aufzuheben sind.“
Allein der Blick in den CIC reicht zur Beantwortung der Frage nach Zuständigkeiten kirch-
licher Archive nicht aus. Hiernach fallen unter den Begriff Archiv nur die für die Überlie-
ferung der Diözesankurie verantwortlichen Diözesanarchive sowie die Pfarrarchive bzw.
im weiteren Sinne die Archive der einzelnen Teilkirchen(-stellen); kirchliche Archive be-
ziehen sich somit ausschließlich auf kirchliche Stellen in einem ekklesiologisch-instituti-
onellen Sinne, Archive anderer kirchlicher Organisationsformen bleiben außen vor. Wel-
che Anforderungen an die einzelnen Archive gestellt werden, wird nicht erläutert. Zumin-
dest wird deutlich, dass der Diözesanbischof eine gewisse Aufsichtspflicht über die Ar-
chive in seinem Sprengel zu haben scheint, die er über das Diözesanarchiv ausübt (vgl.
can. 491 § 1 CIC).
2.1.3. Die Kirchliche Archivordnung (KAO)
Auf die Diözesen in Deutschland heruntergebrochen und konkretisiert werden die Best-
immungen des CIC für die Archive der katholischen Kirche in Deutschland in der soge-
nannten Kirchlichen Archivordnung (KAO). Sie wurde erstmals 1988 von der Vollver-
sammlung der DBK nach Vorlage der BuKo beschlossen. 2014/2015 wurde die KAO no-
velliert und von allen deutschen Diözesen in diözesanes Recht umgesetzt. Zwar trägt die
KAO nicht den Terminus „Gesetz“ in ihrem Titel, trotzdem kommt ihr nach herrschender
Meinung die gleiche Bedeutung zu wie im staatlichen und kommunalen Archivbereich
dem Bundesarchivgesetz bzw. den Landesarchivgesetzen.42
Hinweise auf die Tektonik der kirchlichen Archive und die archivischen Zuständigkeiten
finden sich in den nachstehend wiedergegebenen Paragrafen. In § 3 (= „Begriffsbestim-
42Vgl. Hermann-Josef Braun, Schriftgutüberlieferung zur katholischen Filmarbeit in den Diözesanarchiven,
in: Ders. mit Johannes Horstmann (Red.), Katholische Filmarbeit in Deutschland seit den Anfängen des Films
– Probleme der Forschung und der Geschichtsschreibung (= Beiträge zum Archivwesen der katholischen
Kirche Deutschlands 6), Mainz 1998, S. 81-98, hier S. 83.
18mungen“) Abs. 1 KAO heißt es: „Kirchliche Archive im Sinne dieser Anordnung sind alle
Archive, die von den in § 1 Abs. 1 genannten Stellen unterhalten werden und die mit der
Archivierung von in erster Linie dort entstandenen Unterlagen sowie der Unterlagen ih-
rer Rechtsvorgänger betraut sind.“ Zu den in § 1 KAO (= „Geltungsbereich“) genannten
Stellen zählen explizit alle kirchlichen Rechtsträger und deren Einrichtungen, unabhängig
von ihrer Rechtsform, im Gebiet der (Erz-)Diözesen. Dazu zählen Pfarreien, Kirchenge-
meinden, Kirchenstiftungen, Verbände von Pfarreien und Kirchengemeinden, aber auch
kirchliche Verbände und Vereine sowie Ordens- sowie Säkularinstitute und Gesellschaf-
ten des apostolischen Lebens, sofern sie diözesanen Rechts sind und keine eigene Ar-
chivordnung in Kraft gesetzt haben (§ 1 Abs. 2 KAO).
§ 4 (= „Archivierungspflicht“) Abs. 1 KAO verpflichtet alle oben genannten Stellen zur Ar-
chivierung ihrer Unterlagen, § 4 Abs. 2 KAO stellt die Optionen der Archivierung dar, näm-
lich: 1. Errichtung und Unterhaltung eigener Archive oder Übertragung auf eine für Archi-
vierungszweck geschaffene Gemeinschaftseinrichtung, oder 2. Übergabe des Archivguts
zur Archivierung an das jeweilige Diözesanarchiv oder an ein anderes kirchliches Ar-
chiv.43 Zu den Aufgaben der kirchlichen Archive heißt es in § 5 Abs. 1 KAO, dass sie Unter-
lagen aus ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich archivieren.
In § 12 KAO (= „Das Diözesanarchiv“) wird die exponierte Stellung der Diözesanarchive
hervorgehoben. Nach § 12 Abs. 1 KAO hat das Diözesanarchiv das Archivgut der (Erz-)Bi-
schöflichen Kurie sowie der in § 1 genannten Stellen, die ihr Archivgut abgegeben haben,
zu archivieren. Dazu nimmt das Diözesanarchiv die Aufsicht des Diözesanbischofs über
alle gemäß § 1 Abs. 1 zugeordneten kirchlichen Archive wahr (§ 12 Abs. 2 KAO).44
Schließlich definiert § 13 KAO die „anderen kirchlichen Archive“, und zwar als Archive
der in § 1 Abs. 1 genannten Stellen mit Ausnahme des Diözesanarchivs. Sie archivieren ihr
Archivgut in eigener Zuständigkeit.45
In Bezug auf die Ausgangsfrage ergibt sich damit folgendes Bild:
Im Grundsatz folgt die KAO dem Jurisdiktionsbereich des Diözesanbischofs bzw.
dem Territorialprinzip: Der jeweilige Ortsbischof nimmt das Recht der Archivauf-
sicht nicht nur für sich und seine verfasste (Teil-)Kirche in Anspruch, sondern auch
43 Diese Stelle wird im weiteren Verlauf der Untersuchung noch eine zentrale Bedeutung bekommen.
44 Dies greift die oben genannte Verlautbarung im CIC auf und konkretisiert die Aufsichtsfunktion des Bi-
schofs bzw. der Diözesanarchive.
45 Auch diese Regelung wird im weiteren Verlauf der Arbeit noch einmal explizit aufzugreifen sein.
19Sie können auch lesen