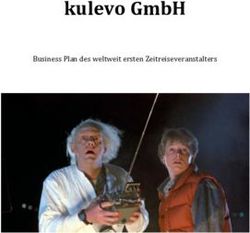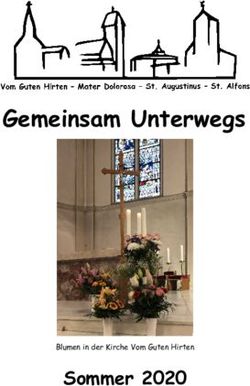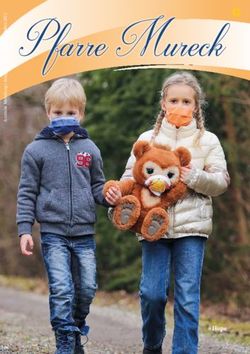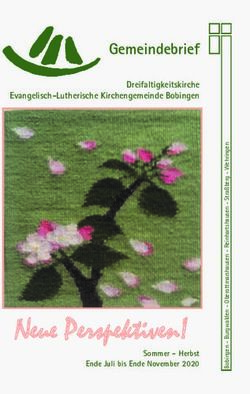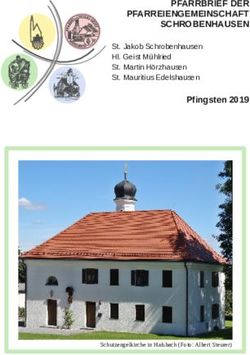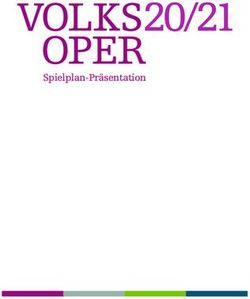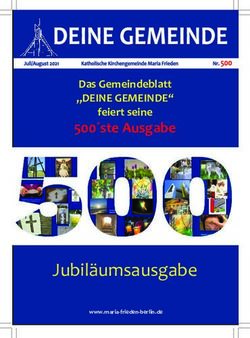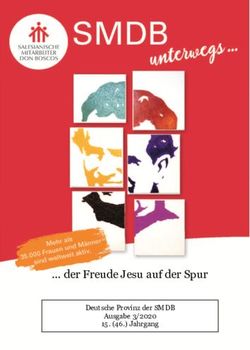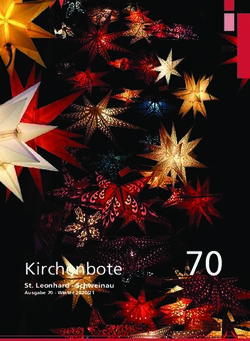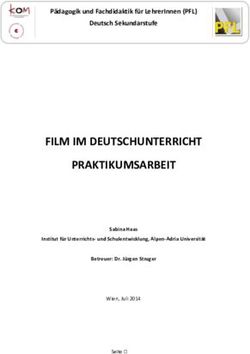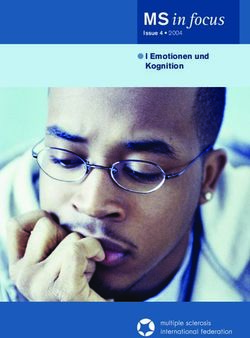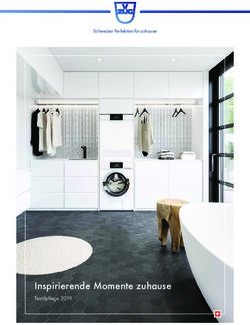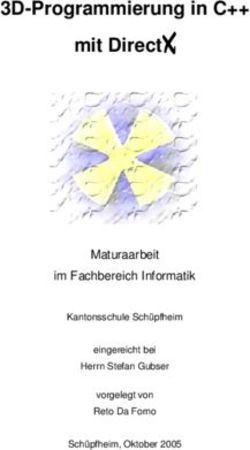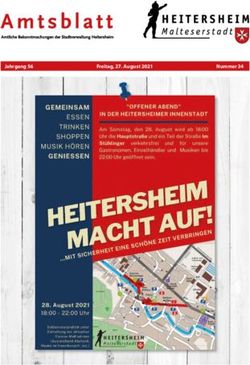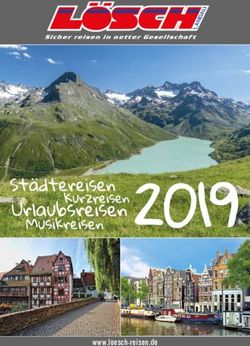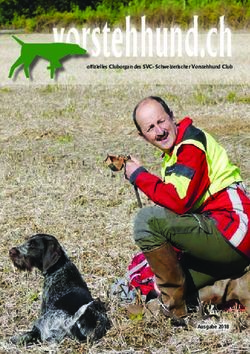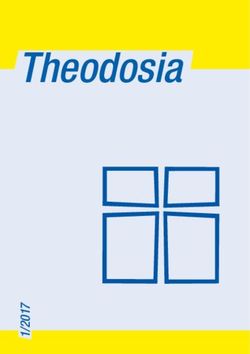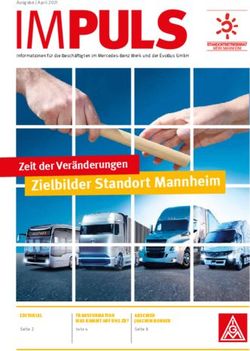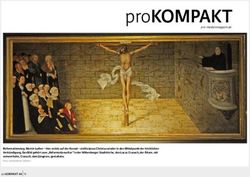Gedenktafel für Dr. Emil Lehmann 1872 1942 - Von Katja Fambach weitere aufsichtführende Richterin - Richterbund ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Amtsgericht Frankfurt am Main
Außenstelle Höchst
Gedenktafel
für
Dr. Emil Lehmann
1872 - 1942
Von Katja Fambach
weitere aufsichtführende
RichterinDR. EMIL LEHMANN
1872 – 1942
25 JAHRE RICHTER AN DIESEM
AMTSGERICHT
–
EIN AKTIVER DEMOKRAT
–
FÖRDERER DER VOLKSBILDUNG
–
ENGAGIERT FÜR
HILFSBEDÜRFTIGE KINDER
–
TRAT KÄMPFERISCH FÜR DIE
WEIMARER REPUBLIK EIN
–
1933 ALS »POLITISCH
UNZUVERLÄSSIG« ENTLASSEN
–
ALS JUDE 1942 DEPORTIERT
IN DAS KONZENTRATIONSLAGER
THERESIENSTADT
–
DORT NACH DREI MONATEN
UMGEKOMMEN
–Eine Gedenktafel für Dr. Emil Lehmann
(1872 – 1942)
von Katja Fambach
weitere aufsichtführende Richterin am Amtsgericht Frankfurt am Main,
Außenstelle Höchst
»Die Jungen sind nicht verantwortlich für das, was damals geschah.
Aber sie sind verantwortlich für das, was in der Geschichte daraus wird.«
(Richard Freiherr von Weizsäcker)
Dr. Emil Lehmann, weiterer aufsichtführender Richter am Amtsgericht Frankfurt am Main,
steht für die Geschichte eines Richters am Amtsgericht Frankfurt am Main, konkret der
heutigen Außenstelle Höchst. Er ist Opfer und teilt sein Schicksal mit hunderten jüdischen
Richtern und Staatsanwälten des Deutschen Reiches nach der Machtergreifung Hitlers.
Als Frau Beck und Herr Weick von der Arbeitsgemeinschaft für Geschichte und Erinnerung
im Februar 2019 mit dem Wunsch der Anbringung einer Gedenktafel für Dr. Emil Lehmann
am Gebäude der Außenstelle Höchst des Amtsgerichts Frankfurt am Main an mich
herantraten, ging ich davon aus, dass es zum Leben und beruflichen Werdegang des
Kollegen ohne weiteres Anhaltspunkte bei dem Amtsgericht Frankfurt geben müsste.
Dass dem nicht so war, ist umso bedauerlicher, wenn man berücksichtigt, dass gerade in
Frankfurt am Main die Entrechtung der nichtarischen Richter und Staatsanwälte im Jahr
1933 mit erschreckender Zielstrebigkeit und begleitet von „inszenierten“ gewalttätigen
Übergriffen erfolgte.“ 1 . Tatsächlich hat die Forschungsliteratur zur Justizpolitik und
Judenverfolgung im Nationalsozialismus bis zum Beginn des 21. Jahrhunderts ihr
Augenmerk nicht auf das Schicksal der während des Nationalsozialismus verfolgten
Richter gelegt2. Mit der von dem Bundesjustizministerium in Auftrag gegebenen und im
Jahr 2004 erschienenen Dokumentation „Richter und Staatsanwälte jüdischer Herkunft in
1
H. Bergemann, S. Ladwig-Winters, Richter und Staatsanwälte jüdischer Herkunft in Preußen im
Nationalsozialismus, S. 47 sowie j. Niemöller, „Justiz unter dem Regiment des Unrechts“ in „Ein
Jahrhundert Frankfurter Geschichte, S. 104 ff. und H. Fischer, „Die Entlassung mißliebiger Richter“ in
„Ein Jahrhundert Frankfurter Geschichte, S. 110 ff.
2
H. Bergemann, S. Ladwig-Winters, Richter und Staatsanwälte jüdischer Herkunft in Preußen im
Nationalsozialismus, Bundesanzeiger, Jahrgang 56, Nummer 82a, vom 30. April 2004, S. 9.
1Preußen im Nationalsozialismus“ von Hans Bergemann und Simone Ladwig-Winters
wurde durch die Darstellung der Kurzbiografien von 536 Richtern und Staatsanwälten ein
wichtiger Schritt gegen das Vergessen unternommen.3.
Im täglichen Leben gibt es jedoch bis heute an oder in den Justizgebäuden des
Amtsgerichts Frankfurt keinen konkreten Hinweis auf das Schicksal der im
Nationalsozialismus entrechteten, verfolgten und ermordeten Richter. Insofern drohen die
Biografien dieser Kollegen in Vergessenheit zu geraten. An das Leben Emil Lehmanns
erinnert lediglich ein an seinem letzten frei gewählten Wohnort „Am Mainberg 13“ im
Frankfurter Stadtteil Höchst verlegter Stolperstein.
Eine Gedenktafel für den Amtsrichter Emil Lehmann an dem Gebäude der gerichtlichen
Außenstelle Höchst soll im Alltag den Besuchern, Rechtssuchenden und Mitarbeitern des
Amtsgerichts Frankfurt am Main ein Zeichen gegen das Vergessen sein.
Im Sinne dieses Anliegens stand der diesjährige Betriebsausflug der Außenstelle Höchst
am 29. Mai 2019: Eine zweistündige Stadtführung durch den Stadtteil Höchst beginnend
am Gebäude des Amtsgerichts in der Zuckschwerdtstraße 58 und endend an dem vor der
letzten Wohnung Dr. Lehmanns im Stadtteil Höchst verlegten Stolperstein am Mainberg
13 gab den Bediensteten der Außenstelle des Amtsgerichts Frankfurt Höchst die
Möglichkeit, einen Einblick in die Geschichte des Stadtteils und die Geschichte eines
Bediensteten „ihres Gerichts“ zu nehmen.4
Eingangsbereich der Außenstelle Höchst Stolperstein
Am Mainberg 13, Frankfurt Höchst
3
Zur Kurzbiografie Dr. Emil Lehmanns: H. Bergemann, S. Ladwig-Winters, Richter und Staatsanwälte
jüdischer Herkunft in Preußen im Nationalsozialismus, Bundesanzeiger, Jahrgang 56, Nummer 82a,
vom 30. April 2004, S. 234.
4
Die nachfolgende Darstellung orientiert sich an dem Wortlaut der geplanten Gedenktafel.
225 Jahre Richter an diesem Amtsgericht
Emil Lehmann trat im Alter von 35 Jahren am 1. April 1908 seinen Dienst als
Gerichtsassessor am Amtsgericht Frankfurt Höchst an. 25 Jahre später, am 1. April 1933,
wurde er – zu diesem Zeitpunkt weiterer aufsichtführender Richter am Amtsgericht
Frankfurt-Höchst - im Alter von 60 Jahren als einer der ersten Richter des Amtsgerichts
Frankfurt am Main vom Dienst suspendiert.
Emil Lehmanns juristische Laufbahn kann als typisch für die Generation der im
ausgehenden 19. Jahrhundert geborenen und als Richter tätigen Juristen bezeichnet
werden. Man kann die Lebens- und Arbeitsleistung eines im jüdischen Glauben geborenen
Richters dieser Juristengeneration nicht losgelöst betrachten von den Umbrüchen, die von
den gesellschaftlichen und politischen Veränderungen in Deutschland im ausgehenden
20. Jahrhundert und den sich anschließenden vier Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts
ausgingen. Im wilhelminischen Zeitalter geboren und juristisch ausgebildet, im 1. Weltkrieg
dem Kaiser verpflichtet und als Frontkämpfer geehrt, in der Weimarer Republik mit einer
neuen demokratischen Gesellschaftsordnung konfrontiert, wurden diese Richter nach
Jahrzehnten der dienstlichen Treue und teilweise am Ende einer erfolgreichen beruflichen
Laufbahn mit der Machtergreifung Hitlers entrechtet und verfolgt.
Die Biografie Emil Lehmanns, die aus heutiger Sicht über Lebensdaten und
Aktenvermerke nur den Versuch einer Rekonstruktion seiner Persönlichkeit darstellen
kann, vermittelt die Geschichte eines treuen, aufrechten und würdevollen Staatsdieners
unter wechselnder Obrigkeit. Es ist davon auszugehen, dass sich Emil Lehmann aufgrund
seiner Biografie und vor seinem juristischen Hintergrund nicht vorstellen konnte, dass die
von dem nationalsozialistischen Unrechtsregime betriebene Entrechtung und Vernichtung
auch ihm persönlich galt. Die Beschäftigung mit seiner Biografie lässt aber unabhängig
von der Lebensbedrohung, die für ihn mit der Machtergreifung Hitlers einherging, erahnen,
welch schmerzliche Fassungslosigkeit das Hinwegfegen der staatlichen Grund- und
Werteordnung durch die nationalsozialistische Herrschaft bei Emil Lehmann ausgelöst
haben muss.
Emil Lehmann wurde am 22. Januar 1872 in Frankfurt am Main geboren. Er stammte aus
einem wohlhabenden Elternhaus. Der früh verstorbene Vater Issak Lehmann war
Kaufmann. Seine Mutter, Dolce Lehmann, dürfte bei ihrem Sohn das Interesse für Kunst,
Kultur und Musik geweckt haben. Die Familie gehörte der oberen Mittelschicht des
3Frankfurter Bürgertums an und konnte aufgrund ihres Wohlstands dem Sohn Emil ein
Studium der Rechtswissenschaft an der Universität in Straßburg finanzieren.
Vielleicht kann man Emil Lehmanns Wahl des Studienfachs der Rechtswissenschaft auch
als Ausdruck der „jüdischen Emanzipationsgeschichte des 19. Jahrhunderts“5 verstehen,
wonach die Rechtswissenschaft als Berufszweig „die Tür zur Gleichberechtigung [öffnete]“
und als „Garant für bürgerliche Sicherheit und Ordnung [schien]“6. Im Hausstandsbuch
seines Wohnsitzes am Mainberg 13 in Frankfurt am Main wird er im Jahr 1920 als „diss“
für Dissident geführt. Hieraus lässt sich schließen, dass Emil Lehmann den jüdischen
Glauben nicht (mehr) praktizierte. Die weitere Biografie Emil Lehmanns belegt im Sinne
einer Vorstellung des Rechts als „Garant für die Sicherheit und Ordnung“ die hohe
Identifikation Emil Lehmanns für rechtsstaatliche Grundwerte, für soziale Gerechtigkeit
und die Aufrechterhaltung einer verfassungsstaatlichen Ordnung.
Das erste juristische Staatsexamen legte Emil Lehmann am 15. Juni 1894 bei dem
Oberlandesgericht Colmar ab. Am 24. Juli 1894 wurde Emil Lehmann ausweislich des
Protokollbuchs der Juristischen Fakultät Jena mit dem Prädikat „magna cum laude“
promoviert. Das Thema seiner Dissertation lautete: „Über den Spekulationskauf und die
Lieferungsübernahme“7.
Die gute finanzielle Ausstattung der Familie erlaubte Emil Lehmann die Aufnahme des
Referendariats ebenso wie die spätere Laufbahn im Richterdienst. Hier ist zu
berücksichtigen, dass im ausgehenden 19. Jahrhundert weder das Referendariat noch
eine Tätigkeit als Hilfsrichter entlohnt wurden.8 Zum Referendar am 23. August 1894 bei
dem Königlichen Amtsgericht Usingen vereidigt, absolvierte Emil Lehmann ab 1894 das
Referendariat im Bezirk der Landgerichte Wiesbaden und Limburg. 1894 war er zunächst
am Königlichen Amtsgericht Usingen tätig. In der Zeit vom 1. Oktober 1894 bis 1. Oktober
1895 erfolgte eine einjährige Freistellung Emil Lehmanns zum Zweck der Ableistung eines
freiwilligen einjährigen Militärdienstes. In dem Zeugnis des aufsichtführenden Amtsrichters
am Königlichen Amtsgericht Usingen Ball vom 2. Juni 1896 heißt es: „Lehmann ist gut
beanlagt, er besitzt tüchtige Rechtskenntnisse und ist von guter und rascher Auffassung.
Derselbe hat stets mit lobenswertsamen Fleiße und Eifer gearbeitet. Die von ihm
gefertigten Arbeiten waren praktisch brauchbar. Lehmann ist als gut ausgebildet zu
5
Irmtraud Wojak, Fritz Bauer, Eine Biografie, S. 95.
6
Irmtraud Wojak, Fritz Bauer, Eine Biografie, S. 95.
7
Protokollbuch der Juristischen Fakultät Jena, Universitätsarchiv.
8
Braun/Falk „Die deutschen Richter im Jahr 1933“ in: Form/Schiller/Seitz (Hrsg:), NS-Justiz in Hessen S.
28 m.w.N.
4bezeichnen. Sein dienstliches und außerdienstliches Verhalten war tadellos“. 9 Der
Tätigkeit beim Amtsgericht Usingen, die eine Ausbildung in Straf- und Zivil- und
Nachlasssachen beinhaltete, folgte 1896 ein durch eine Militärübung aufgeschobener
Einsatz als Referendar am Landgericht Limburg. Sein Einsatz in der dortigen Strafkammer
wurde durchgängig von allen ausbildenden Richtern mit „genügend“ bewertet. 10 . Es
schlossen sich zahlreiche weitere Unterbrechungen des Referendariats, teils
urlaubsbedingt, größtenteils aber zur Ableistung militärischer Übungen an, die sich im Jahr
1897 immerhin auf insgesamt 208 Tage addierten. Im Rahmen der Verlängerung des
Referendariats beim Landgericht Limburg bis 27. Oktober 189711 war Emil Lehmann der
ersten und zweiten Zivilkammer des Landgerichts zugewiesen. Auch die dortigen
Ausbilder bewerteten indes die Leistungen des Referendars lediglich mit der
zweitschlechtesten Note: Ausweislich der Zeugnisbögen wurde die Leistung des
Referendars durchgehend (nur) als „genügend“ angesehen.12 Ab Ende Oktober 1897 war
Emil Lehmann bei der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main eingesetzt. Zu diesem
Ausbildungsabschnitt findet sich der Vermerk: „[...] .zurückgesandt mit dem Hinweis, dass
die Leistungen des [...] Referendars Lehmann nach allen Richtungen in dem Maße genügt
haben, dass sein Vorbereitungsdienst hier […] für völlig abgeschlossen [betrachtet]
werden kann“. 13 Weitere Stationen während des Referendariats waren im Jahr 1898
Hospitationen bei Anwälten und Notaren.
Am 22. März 1899 erhielt Emil Lehmann die Bezeichnung Gerichtsassessor mit dem
Prädikat „gut“. Die „Große Staatsprüfung“, vergleichbar dem heutigen 2. Staatsexamen,
legte E. Lehmann am 30. März 1900 mit der Note „gut“ ab.
Ab dem 19. April 1900 war Emil Lehmann bei dem damaligen „Königlichen“ Amtsgericht
Frankfurt am Main unentgeltlich als Gerichtsassessor beschäftigt.14 Es folgte 1902 eine
Beschäftigung als kommunaler Richter bei dem Amtsgericht Ehringshausen und eine
Hilfsrichtertätigkeit in den Jahren 1903 bis 1908 beim Amtsgericht Königstein. Von
September 1902 bis April 1903 war Emil Lehmann in einer Filiale der Deutschen Bank in
Frankfurt am Main beschäftigt. Ab 1900 nahm Emil Lehmann regelmäßig an
Wehrübungen des 2. Chevaulegers-Regiment „Taxis“ in Dillingen/Donau teil. Ausweislich
der Personalakte war seine richterliche Tätigkeit bis 1914 von wiederkehrenden
Wehrübungen geprägt, die sich über mehrere Tage und Wochen erstreckten.
9
HHStA 460, P 162, S. 15.
10
HHStA 460, P 162, S. 28.
11
HHStA 460, P 162, S. 38; die Bewertung sah fünf Beurteilungen vor: „nicht genügend“, „genügend“,
„vollkommen genügend“, „gut“ und „ausgezeichnet“.
12
HHStA 460, P 162, S. 41, 42.
13
HHStA 460, P 162, S. 46.
14
HHStA 460, P 162, „Rotulus actorum“.
5Im Februar 1908 bewarb sich der bis zu diesem Zeitpunkt als Hilfsrichter am Amtsgericht
Königstein tätige Emil Lehmann um eine Richterstelle. Dabei zog es den zum damaligen
Zeitpunkt 35jährige Emil Lehmann ausweislich eines Vermerks vom 10. Februar 1906
unter anderem nach Berlin, nämlich an die Amtsgerichte „zu Berlin-Schöneberg, Groß-
Lichtenfelde, Berlin-Mitte, Charlottenburg, Potsdam“. Daneben werden von ihm als
mögliche Einsatzstellen die Amtsgerichte „Kiel, Kassel, Homburg v.d.H., Wiesbaden,
Wetzlar, Höchst/M. sowie Frankfurt/M“ genannt.15 Stand ausweislich einer Verfügung vom
13.Februar 1908 noch eine Zuweisung Emil Lehmanns an die Amtsgerichte Rixdorf und
Frankfurt am Main sowie das Landgericht Koblenz im Raum16, erfolgte schließlich am 31.
März 1908 die Zuweisung des Gerichtsassessors an das zu diesem Zeitpunkt
selbständige Amtsgericht Höchst/Main, wo Emil Lehmann am 01. April 1908 seine Arbeit
aufnahm.
Bereits ab 1908 wurden an dem damaligen Amtsgericht Höchst erstinstanzlich Zivil- und
Strafsachen gegen Erwachsene, später auch gegen Jugendliche geführt. Die
Vollstreckungsleitung für die angegliederte Justizvollzugsanstalt oblag einem Richter des
Amtsgerichts-Höchst. 17 Ferner waren bei dem Amtsgerichts-Höchst die
Nachlassabteilung, die Vormundschaftsabteilung und das Grundbuch angesiedelt. Im Jahr
1933 waren an dem dann als „Amtsgericht Frankfurt- Höchst“ bezeichneten Gericht fünf
Richter tätig18.
Am 05. Juni 1913 wurde Emil Lehmann zum Amtsgerichtsrat ernannt. Sein
Diensteinkommen betrug im Jahr 1915 4.200 Reichsmark, zzgl. einer jährlichen Zulage
von 600 Reichsmark. 1918 belief sich die Besoldung auf 4.800 Reichsmark zzgl. einer
jährlichen Zulage von 600 Reichsmark.19
15
HHStA 460, P 162, S. 149 R.
16
HHStA 460, P 162, S. 150.
17
Das Gebäude des Amtsgerichts in der Außenstelle Höchst, Hausanschrift Zuckschwerdtstraße 58 im
Stadtteil Höchst wurde 1867 erbaut. Als selbständiges Gericht existiert das „Amtsgericht Höchst“ seit dem 1.
September 1867. Das Amtsgericht Höchst unterstand dem Kreisgericht, ab 1879 dem Landgericht
Wiesbaden. Es umfasste das ehemalige Amt Höchst (Abt. 228). Am 1. Oktober 1879 erfolgte eine
Neugliederung, bei der die Gemeinde Heddernheim dem Amtsgericht Frankfurt (Abt. 469/6) zugewiesen
wurde und das Amtsgericht Höchst vom Amtsgericht Königstein (Abt. 469/16) die Gemeinde Lorsbach und
vom Amtsgericht Hochheim (Abt. 469/10) die Gemeinden Langenhain und Marxheim erhielt. Am 1. April
1928 folgte nach der Eingemeindung von Höchst, Griesheim, Nied, Schwanheim und Sossenheim in die Stadt
Frankfurt eine Namensänderung des Gerichts: Das Gericht führte fortan den Namen Amtsgericht Frankfurt-
Höchst. Am 1. Januar 1930 wurde das Amtsgericht Frankfurt-Höchst aus dem ursprünglichen Bezirk des
Landgerichts Wiesbaden in den des Landgerichts Frankfurt am Main überführt. Das Gebäude des
Amtsgerichts in Höchst wurde während des zweiten Weltkriegs nicht zerstört, so dass man nach der
aufwändigen Innensanierung des Gebäudes heute noch eine Vorstellung davon haben kann, wie Emil
Lehmann täglich seiner Arbeit in den Räumlichkeiten, insbesondere in den erhaltenen Strafrechtssälen,
nachging.
18
HHStA 469/34 Nr. 225 S. 83.
19
HHStA 460, P 162, „Rotulus actorum“.
6Nach der Besetzung einer „Aufrückungsstelle im Jahr 1922 erfolgte 1925 eine
Beförderung von Emil Lehmann zum „weiteren aufsichtführenden Richter“. Diese
Bezeichnung führten und führen auch heute noch Richter und Richterinnen am
Amtsgericht – zu den Lebzeiten Emil Lehmanns waren bei dem Amtsgericht Höchst nur
männliche Richter beschäftigt - die auf einer Beförderungsstelle neben ihrer Tätigkeit in
unterschiedlichen Rechtsgebieten als Spruchrichter mit Verwaltungsaufgaben betraut
waren und sind.
Emil Lehmann war bis 1933 als Leiter der Gefängnisverwaltung des an das Gebäude des
Amtsgericht Höchst angrenzenden Gefängnisses und als Jugendrichter am Amtsgericht
Frankfurt-Höchst tätig. Will man sich von seinem Tätigkeitsfeld der Persönlichkeit Emil
Lehmanns nähern, dürften sowohl das Jugendstrafrecht als auch die Leitung des
Gefängnisses Aufgaben gewesen sein, die er gerne und mit großem Engagement
wahrnahm, entsprachen sie doch seinen sozialen Gerechtigkeitsvorstellungen. Hierbei ist
zu berücksichtigen, dass es sich bei dem Jugendstrafrecht um eine vergleichsweise
„junge“, progressive Rechtsmaterie handelt. Erstmals zum 1. Januar 1908 - und damit
lange vor dem Inkrafttreten des ersten Jugendgerichtsgesetzes im Jahr 1923 - fasste das
Präsidium des Königlich Preußischen Landgerichts Frankfurt am Main den Beschluss, ein
erstes Jugendgericht beim Amtsgericht Frankfurt am Main mit der strafrechtlichen
Verfolgung von Minderjährigen zu befassen.20
Dem lag der in der Jugendgerichtsbewegung des beginnenden 20. Jahrhunderts
vorherrschende Gedanke einer „Ablösung des Vergeltungs- durch den
Erziehungsgedanken“ im Sinne einer „Unterdrückung antisozialen Verhaltens und
Erziehung zu brauchbaren Gliedern der Gesellschaft“ zugrunde. Der Jugendrichter war
gleichzeitig Vormundschaftsrichter und führte bereits vor dem eigentlichen
Hauptverhandlungstermin Verhandlungen mit verschiedenen am Verfahren beteiligten
Stellen, etwa amtlichen Organen der Stadt, beispielsweise dem Waisen- und Armenamt
sowie mit privaten Jugendfürsorgeorganisationen bzw. dem Verein Kinderschutz.21
Unter Berücksichtigung des privaten Engagements Emil Lehmanns - etwa im Bereich der
Volksbildung - ist davon auszugehen, dass gerade der in die Zukunft gerichtete
erzieherische Gedanke und die Vorstellung einer Wiedereingliederung eines Straftäters in
20
Helga Müller, „Das erste Jugendgericht in Deutschland“ in „Ein Jahrhundert Frankfurter Geschichte, S.
92.
21
Helga Müller, „Das erste Jugendgericht in Deutschland“ in „Ein Jahrhundert Frankfurter Geschichte, S. 93
sowie zur Ausgestaltung im Einzelnen HHStA, General-Achten betreffend Geschäftsverteilung 458 Nr.
832, S. 72, 72 R.
7die Gesellschaft sowie die Zusammenarbeit 22 des Gerichts mit Einrichtungen der
Fürsorge seinen Wertevorstellungen entsprachen. In der Personalakte Emil Lehmanns
findet sich ein Antrag vom 7. November 1925, mit dem Emil Lehmann in seiner
„Eigenschaft als Jugendrichter und Vorsteher des Gerichtsgefängnisses“ um die Erteilung
von zwei Tagen Urlaub für die Teilnahme „an dem zweitägigen Lehrgang der
Stadtgemeinde Frankfurt a. M. in Verbindung mit der Justizbehörde daselbst über die
Zusammenarbeit von Fürsorge und Rechtspflege insbesondere die sociale Gerichtshilfe
und die Strafentlassungsfürsorge am 4. und 5 Dezember [..]. “ bittet.23
Aufgrund einer Änderung der Geschäftsverteilung wurden Emil Lehmann zum 1. Mai 1928
auch die in die Zuständigkeit der Amtsgerichte bzw. des Schöffengerichts fallenden
Strafsachen gegen über 18jährige Minderjährige übertragen, wobei von einer Fallzahl von
30 bis 40 Verfahren im Jahr ausgegangen wurde.24 Durch die Geschäftsverteilung des
Jahres 1930 erfolgte sodann die Bildung ausdrücklicher Schöffengerichtsabteilungen im
Sinne des damaligen § 28 GVG, die für Strafsachen für über 18jährige Minderjährige „die
unter Leitung des Jugendrichters“ stehen, zuständig waren. Auch diese Verfahren wurden
bei dem Amtsgericht Frankfurt-Höchst von Emil Lehmann bearbeitet.25
Einen weiteren persönlichen Blick auf den Richter und die Führungskraft Emil Lehmanns
erlaubt darüber hinaus ein Zeugnis aus dem Jahr 1931. Bereits zur Zeit der Tätigkeit von
Dr. Emil Lehmann am Amtsgericht Frankfurt waren offenkundig die Anforderungen an die
Amtsgerichte kontinuierlich gestiegen. In seiner Funktion als Führungskraft zeigte sich Dr.
Lehmann ausweislich der Beurteilung vom 5. Januar 1931 26 „als aufsichtführender
Amtsgerichtsrat des Amtsgerichts a.M. - Höchst […] den Anforderungen dieses Amtes,
dessen Bedeutung mit der zunehmenden Bevölkerung des Bezirks und der wachsenden
Arbeitslast des Amtsgerichts ständig gestiegen ist, wohl gewachsen“. Weiter heißt es:
„Über den Gang der Geschäfte des Gerichts ist er gut unterrichtet und er versteht es,
richtig und mit Geschick einzugreifen, wo es gerade nottut“. Daneben werden Dr. Lehmann
„wohlbefriedigende Rechtskenntnisse“, Fleiß, großes Dienstinteresse,
Gewissenhaftigkeit, Pünktlichkeit, erheblich über dem Durchschnitt stehende Fähigkeiten
und Leistungen und schließlich eine „tadellose Führung“ bescheinigt.
22
HHStA, General-Acten betreffend Geschäftsverteilung 458 Nr. 832, S. 108.
23
Personalakte HStA 460, P 162,S. 224.
24
HHStA, General-Acten betreffend Geschäftsverteilung 458 Nr. 832, S. 108 R.
25
HHStA, General-Acten betreffend Geschäftsverteilung 458 Nr. 832, S. 107 R.
26
Personalakte HHStA 460, P 162,S. 233.
8Ein aktiver Demokrat -
trat kämpferisch für die Weimarer Republik ein
Wie sich die politische Einstellung Emil Lehmanns entwickelte, kann nur vermutet werden.
Der im Kaiserreich geborene, bildungsbürgerlich aufgewachsene und ausgebildete Emil
Lehmann fühlte sich sicherlich – wie viele Männer des Adels und des Bildungsbürgertums
– in der Zeit bis 1914 dem Kaiser und dem Vaterland verpflichtet. Dies lässt sich aus seiner
freiwilligen Karriere in der kaiserlichen Armee ableiten.
Emil Lehmann leistete vom 1. Oktober 1894 bis 1. Oktober 1985 seinen Militärdienst bei
dem 2. Chevaulegers-Regiment „Taxis“ in Dillingen/Donau ab und erwarb den Rang eines
Offiziers. Sein Referendariat war geprägt von Freistellungen für Militärübungen.
Hinsichtlich der umfassenden Ableistung seines Militärdienstes und auch der Karriere in
der kaiserlichen Armee, der er ausweislich seiner Personalakte zunächst als
Reserveoffizier des 2. Chevaulegers-Regiment „Taxis“ und später als Leutnant diente27,
gleicht der Lebenslauf Emil Lehmanns bis zum Ende des Ersten Weltkriegs einer Reihe
von Biografien von Justizjuristen seiner Generation.28
Im ersten Weltkrieg von 1914 bis 1918 war Emil Lehmann Frontkämpfer. Er kämpfte in
mehreren Schlachten. Dokumentiert 29 sind seine Einsätze in der Schlacht von Naney-
Epinal (in der Zeit vom 22. August bis 14. September 1914), in den Winterkämpfen bei
Badonville (in der Zeit vom 27. Februar bis 8. März 1915), in der Schlacht vor Verdun (in
der Zeit vom 3. Mai bis 13. Juni 1916) und bei den Stellungskämpfen am oberen Styr-
Stodsod (in der Zeit vom 16. September bis 1. Dezember 1917). 30 Ferner ist in der
Personalakte vermerkt, dass Emil Lehmann „sich aus dienstlichem Anlass mindestens 2
Monate im Kriegsgebiet (Russland) aufgehalten“ hat.31 Im März 1915 erhielt Emil Lehmann
den bayrischen Militärverdienstorden IV. Klasse und am 15. November 1915 das Eiserne
Kreuz II. Klasse.
27
HHStA (Personalakte) 460, S. 116, die Offizierspersonalakte Emil Lehmanns ist in der Abteilung IV des
Bayrischen Hauptstaatsarchivs archiviert: BayHstA ,OP 43759.
28
So für die Richterschaft am Oberlandesgericht Frankfurt am Main 1933 – 1945: Gruenewaldt, Die
Richterschaft des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main in der Zeit des Nationalsozialismus, S. 290 ff.
29
Es liegen sechs Einträge in fünf Kriegsstammrollen des Ersten Weltkriegs vor: BayHST, KrStR 3603,
19173 und 19217.
30
HHStA 469/34 Nr. 225 S. 83.
31
HHStA 469/34 Nr. 225 S. 83.
9Wie bei allen Männern seiner Generation ist davon auszugehen, dass Emil Lehmann von
seinen Erfahrungen im Ersten Weltkrieg erheblich geprägt wurde. Zu der Frage, inwiefern
sich seine politische Einstellung durch die Erfahrungen des Ersten Weltkriegs änderte,
kann man nur Vermutungen anstellen. Bei Kriegsende war Emil Lehmann 46 Jahre alt.
Unterstellt man, dass „je älter jemand bei Kriegsende war, desto mehr [….] die statistische
Wahrscheinlichkeit [wuchs], dass er nicht mehr mit [politischen] Positionen brechen würde,
die er vor 1914 bezogen hatte“32, spricht einiges dafür, dass Emil Lehmann bereits vor
Ausbruch des Ersten Weltkriegs Sozialdemokrat war.
Nach dem Ende des ersten Weltkriegs stand Emil Lehmann der SPD nahe, wenn er auch
nie Mitglied wurde. Gut befreundet war Emil Lehmann mit einem bekannten Höchster SPD
Mitglied, dem Höchster Bürgermeister (1923 bis 1925) und Frankfurter Stadtkämmerer
(1925 bis 1930) Bruno Asch.33 In dem zum damaligen Zeitpunkt Französisch besetzten
Höchst wurde Bruno Asch 1923 durch ein französisches Militärgericht zu drei Monaten
Gefängnis verurteilt. Diese Gefängnisstrafe saß Bruno Asch in dem Höchster
Gerichtsgefängnis ab, dessen Leiter bereits zum damaligen Zeitpunkt Emil Lehmann war.
Mit Bruno Asch verband Emil Lehmann eine besondere Freundschaft. Humorvoll brachte
er diese Freundschaft in einer Rede, die er im Jahr 1925 zur Verabschiedung Bruno Aschs
hielt, als dieser Stadtkämmerer in Frankfurt wurde, zum Ausdruck: „Nicht nur als Vertreter
des Amtsgerichts, sondern auch als Leiter der Gefängnisverwaltung bin ich hierher
gekommen. Sie haben heute Abend wiederholt gehört, daß wir das große Glück gehabt
haben, Herrn Bürgermeister Asch drei Monate lang in unseren Mauern behalten zu dürfen.
Das ist doch etwas, was entschieden nicht der Vergessenheit anheimfallen darf. Es ist mir
in meiner Amtszeit noch nicht vorgekommen, daß ein Bürgermeister drei Monate in
meinem Gefängnis war und daß ich mich nachher noch an seiner Abschiedsfeier beteilige.
Das besagt zumindest, daß seine Beziehungen zu dem Gefängnis außerordentlich gute
waren. Ich kann auch bestätigen, daß die drei Monate gar nicht so schlimm waren, ja daß
es ihm sogar leid getan hat, uns wieder verlassen zu müssen […]. Auch die
Gefängnisverwaltung wünscht ihm alles Gute, insbesondere, daß er als zukünftiger
Stadtkämmerer von Frankfurt nicht die Gelegenheit wahrnimmt, mit dem Frankfurter
Gefängnis Bekanntschaft zu machen, daß er aber zumindest, wenn es sich nicht
32
H. Winkler, 1918 – 1933, Die Geschichte der ersten deutschen Demokratie, 1993, S. 298.
33
Der am 23. Juli 1890 geborene Bruno Asch war ebenfalls im Ersten Weltkrieg Frontsoldat und schloss
sich nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zunächst der USPD an, bevor er 1921 in die SPD eintrat.
Bruno Asch wurde 1930 Stadtkämmerer von Berlin. 1933 ebenfalls entlassen, emigrierte er mit seiner
Familie in die Niederlande. Bei Einmarsch der deutschen Wehrmacht, nahm er sich das Leben. Seine
Frau und zwei Töchter wurden deportiert und im Konzentrationslager umgebracht. Nur die älteste
Tochter, Mirjam, die 1939 nach Palästina ging, konnte überleben.
10vermeiden lassen sollte, dann seine Freundschaft mit dem Höchster Gefängnis nicht
vergisst.“34
Emil Lehmanns durchaus als „kämpferisch“ zu bezeichnendes Eintreten für die
Demokratie der Weimarer Republik lässt sich aus seinen Mitgliedschaften bei der
Organisation „Reichsbanner“ und dem Republikanischen Richterbund ableiten.
Emil Lehmann schloss sich dem 1924 gegründeten „Reichsbanner“ an. Diese
Mitgliedschaft belegt eine Identifikation mit den demokratischen Werten der Revolution
von 1848 und der parlamentarischen Verfassung der Weimarer Republik. Bei dem
„Reichsbanner Schwarz Rot Gold“ handelte es sich um eine offiziell überparteiliche, von
Mitgliedern der SPD, der Deutschen Zentrumspartei und der Deutschen Demokratischen
Partei, gegründete Gegenorganisation zu anderen sich in der Weimarer Republik
entwickelnden paramilitärischen Organisationen. Der „Reichsbanner“ wählte in seiner
Organisationsstruktur die Mittel anderer Verbände, wie insbesondere des rechten
paramilitärischen „Stahlhelms“, indem man sich derer „kämpferischer“ Instrumente von
Formationen, Uniformen, Fahnen und Aufmärschen bediente. 35 Viele Mitglieder des
Reichsbanners waren wie Emil Lehmann Kriegsveteranen des Ersten Weltkrieges. Das
Verständnis des „Reichsbanners“ stand allerdings im Gegensatz zu anderen sich
radikalisierenden paramilitärischen Organisationen wie dem „Stahlhelm“, aber auch dem
„Roten Frontkämpferbund“. Während es den zuletzt genannten Organisationen um die
Überwindung des Parteienstaates und die Umwandlung der Weimarer Republik entweder
in eine militärisch-autoritäre Gesellschaft (so der „Stahlhelm“) oder eine klassenlose
Gesellschaft im marxistischen Sinne (so der „Rote Frontkämpferbund“) ging, verstanden
sich die Mitglieder des „Reichsbanners“ als Hüter der Paulskirchenverfassung von 1848
und den Reichsbanner als Instrument zur Verteidigung des parlamentarischen Systems
der Weimarer Verfassung. Insoweit ging es den Mitgliedern des Reichsbanners trotz der
durchaus nach außen getragenen soldatischen und militärischen Symbolik um die
Verteidigung des parlamentarischen Systems.36
Auch Emil Lehmanns Mitgliedschaft im „Republikanischen Richterbund“ belegt sein
Eintreten für die Weimarer Verfassung. Der im Jahr 1921 gegründete „Republikanische
Richterbund“ trat für eine unabhängige Justiz und ein Richtertum, das sich vorbehaltlos
34
Höchster Kreisblatt 24.10.1925.
35
I. Wojak, Fritz Bauer, Eine Biografie, S. 108.
36
Politisch überwog der Anteil der sozialdemokratischen Mitglieder im “Reichsbanner“ weit den der übrigen
Parteien. Bekannte SPD-Mitglieder des „Reichsbanners“ waren u.a. Kurt Schumacher und Philipp
Scheidemann. Auch Fritz Bauer, der spätere Ankläger in den Auschwitz-Prozessen, zählte zu den Mitgliedern
des „Reichsbanners“.
11zur demokratischen Weimarer Republik und zur sozialen Gerechtigkeit bekennt, ein.37 Mit
dieser Einstellung bildeten die ca. 500 Mitglieder des „Republikanischen Richterbundes“
nicht nur eine Minderheit gegenüber den etwa 12.000 Mitgliedern des Deutschen
Richterbundes. Der überparteilich organisierte „Republikanische Richterbund“, dem viele
Mitglieder der SPD, aber auch des Zentrums angehörten, unterschied sich auch in seinem
Verständnis erheblich von den Vorstellungen des die große nahezu absolute Mehrheit der
Deutschen Richterschaft repräsentierenden Deutschen Richterbundes. Man verstand sich
bewusst als Standesorganisation der Minderheit der deutschen Richterschaft in der
Weimarer Republik, die nicht konservativ und nicht national-liberal dachte.38 Die seit 1925
erschienene Zeitschrift des Republikanischen Richterbundes „Die Justiz, Zeitschrift für die
Erneuerung des deutschen Rechtswesens“ befasste sich so mit der republikfeindlichen
Strafjustiz, der Reform des Strafrechts und der Juristenausbildung. Dass Emil Lehmanns
als Jugendstrafrichter tätig war, entspricht dem Bild eines im „Republikanischen
Richterbund“ organisierten Richters der Weimarer Republik. Über die Zeitschrift „Die
Justiz“ erklärte Fritz Bauer später in einer Rückschau: „Die Zeitschrift warnt immer wieder
vor einer Überschätzung der technischen Jurisprudenz und einer Unterschätzung der
menschlichen Seite der Rechtspflege. Sie wünscht sich nicht äußerliche Korrektheit
sondern „Dienst an der Pflege von Menschengut“. In dem Mangel an gebildeten,
gerechten Menschen, an Menschlichkeit liege eine große Gefahr“39
Förderer der Volksbildung -
engagiert für hilfsbedürftige Kinder
Akten geben wenig Auskunft über die Persönlichkeit eines Menschen. Emil Lehmann war
kamerascheu, ein offizielles Foto existiert nicht. Allerdings lässt sich auf der Grundlage
der Berichte von Zeitzeugen und dem Inhalt der Personalakte von dem Privatmann Emil
Lehmann das Bild eines großzügigen und sozial engagierten Menschen zeichnen.
Im Mai 1900 heiratete Emil Lehmann Kathinka/„Kati“ geb. Kahn, die Tochter des
Fabrikanten Moritz Kahn und dessen Ehefrau Charlotte Kahn, geb. Mai. Das Paar wohnte
in der Mendelsohnstraße 55 in Frankfurt am Main.1902 wurde der Sohn Hans-Joachim
geboren. Die Ehe Emil Lehmanns war nur von kurzer Dauer. Mit Urteil des Landgerichts
37
Vgl. Gründungsaufruf, veröffentlicht am 30. Dezember 1921 in der sozialdemokratischen Tageszeitung
„Vorwärts“, Ausgabe A vom 30. Dezember 1921, zit. nach Schulz, Der Republikanische Richterbund
(1921–1933), 1982, S. 18 f.
38
R. M.W. Kemper, „Der Republikanische Richterbund. Eine Kampforganisation für die Weimarer
Republik“ in Recht und Politik, Jg. 3 (1967), H. 4 S. 129 – 139 zitiert nach I. Wojak, Fritz Bauer, Eine
Biografie, S. 109.
39
Fritz Bauer, die „Ungesühnte Nazijustiz“, S 134 zitiert nach I. Wojak, „Fritz Bauer, eine Biografie“.
12Wiesbaden (Az. 3 R 34/05) vom 2. Juni 1906 wurde die Ehe „schuldlos“ für Emil Lehmann
geschieden. Der Sohn Hans blieb beim Vater. Emil Lehmann heiratete nicht wieder. Er war
alleinerziehend, wobei die Betreuung und Pflege des Sohnes von einer „Pflegerin“ 40
übernommen wurde. Tatsächlich lebte Emil Lehmann in Höchst zunächst seit 1909 in der
Brüningstraße 5, später in einer repräsentativen Wohnung Am Mainberg 13 mit seiner
Cousine, Emma Hainebach, zusammen, die den Haushalt führte.
Emil Lehmann war sehr musikalisch. Er spielte Geige und man traf sich regelmäßig zum
gemeinsamen Musizieren mit Freunden in der Wohnung Am Mainberg. Emil Lehmann war
sehr belesen und verfügte über eine große Bibliothek. In Höchst hatte er einen großen
Freundes- und Bekanntenkreis.
Sicherlich waren es auch diese Liebe zu Literatur und Musik, vor allem aber seine soziale
Einstellung, die ihn bewogen, sich sowohl im Bund für Volksbildung als auch in der
Volksbücherei, deren Leiter er war, zu engagieren. Bildung stellte für Emil Lehmann ein
hohes Gut dar.
Eine Zeitzeugin, mit deren Vater Emil Lehmann im Bund für Volksbildung tätig war,
berichtet: „Er beriet immer alt und jung bei der Ausleihe von Büchern. Er war sehr gebildet
und belesen und ich erinnere mich fast jedes Mal mit ihm längere Gespräche über Literatur
geführt zu haben.“41 Im Rahmen seines Engagements muss Emil Lehmann auch ein 1911
in Frankfurt Nied geborenes Mädchen aus bescheidenen Verhältnissen aufgefallen sein.
Eine Zeitzeugin berichtet, dass Emil Lehmann diesem Mädchen, das bereits vor Ausbruch
des 2. Weltkriegs eine wissenschaftliche Karriere einschlug und später in der
Bundesrepublik Deutschland als Professorin tätig war, den Zugang zu einer höheren
Bildung verschaffte. Die Zeitzeugin berichtet: „Sie fiel Dr. Lehmann auf und er bezahlte die
höhere Schule und Studium für sie solange es ihm wohl möglich war […]. E. heiratete […].
In die Familie […]. Kam sie durch Vermittlung von Dr. Lehmann, der mit den […] gut
befreundet war.“42 Über sein soziales Engagement berichtet ein weiterer Zeitzeuge: „Wie
es zu den engen sozialen Kontakten [Anm. 1922/1923] kam, kann ich nicht sagen, glaube
aber bestimmt, dass es über die soziale Tätigkeit meiner Mutter zum Kontakt kam. Sie
hatte einen „Verein für private Fürsorge“ gegründet, der sich zur Aufgabe gemacht hatte,
vor allem „verschämte“ Arme, wie es damals hieß, aufzusuchen oder ganz privat zu
unterstützen. […] Emil Lehmann war wohl weniger Geldgeber als vielmehr Berater,
40
Dies ergibt sich aus einer Stellungnahme E. Lehmanns zu der Frage seines Wohnsitzes aus Mai 1909, wo
Lehmann darauf hinweist, dass es ihm gelungen ist „eine Wohnung zu mieten, in welcher ich auch
meinen Sohn und seine Pflegerin nehmen kann“, Personalakte HStA 460, P 162, S. 170 R.
41
Aus den Aufzeichnungen von Elisabeth König, Retz/Österreich.
42
Aus den Aufzeichnungen von Elisabeth König, Retz/Österreich.
13besonders bei Fragen, die Kinder betrafen (meine Mutter arbeitete auch in einem
„Kinderschutzbund“ mit). Ich weiß, daß oft Einzelfälle mit Herrn L. besprochen wurden“.43
Mit Beginn der Schikane gegen die jüdische Bevölkerung nutzte Emil Lehmann seine
bestehenden Kontakte. Ein Zeitzeuge berichtet: „Herr und Frau Levy wurden von
Amtsgerichtsrat Lehmann, der uns gut kannte, empfohlen. Sie wurden 1932 vielleicht
gekündigt oder auch nur schikaniert. Ich hörte wie mein Vater zu ihnen sagte: „Ziehen Sie
nur zu uns. Bei uns können Sie sich sicher fühlen und werden nicht gekündigt“. Familie
Levy konnte rechtzeitig nach London fliehen“.44
Belegt ist auch, dass Emil Lehmann nach seiner Entlassung aus dem Justizdienst im Jahr
1933 für jüdische Kinder, deren Eltern die sogenannte „elterliche Gewalt“ - nach heutiger
Begrifflichkeit das elterliche Sorgerecht - nicht ausüben konnten, Vormundschaften
übernahm. Insofern ist zu berücksichtigen, dass in Frankfurt am Main in der Zeit von 1933
bis 1942 zahlreiche jüdische Kinder ohne ihre Eltern lebten. Viele dieser Kinder waren im
Frankfurter Kinderhaus der Weiblichen Fürsorge e. V., Hans-Thoma-Straße 24
untergebracht45. Für diese Kinder musste, soweit sie nicht unter elterlicher Verantwortung
standen, etwa weil die Eltern verstorben, emigriert oder die Mütter unverheiratet und selbst
minderjährig waren, ein Vormund bestellt werden. Das Bürgerliche Gesetzbuch enthielt
bereits in seiner Erstfassung vom 18. August 1896 in
§ 1773 BGB die Regelung, dass ein Minderjähriger einen Vormund erhält, „wenn er nicht
unter elterlicher Gewalt steht oder wenn die Eltern weder in den die Person noch in den
das Vermögen betreffenden Angelegenheiten zur Vertretung des Minderjährigen
berechtigt sind“46
Grundsätzlich oblag die Organisation der Fürsorge für die in Kinderheimen
untergebrachten jüdischen Kinder der Jüdischen Wohlfahrtspflege47, die ab 1933 von der
Reichsvertretung der Juden in Deutschland48, später der Reichsvereinigung der Juden in
Deutschland wahrgenommen wurde. Es ist davon auszugehen, dass auch die Regelung
der Übernahme von Vormundschaften und Pflegschaften für im oben genannten Sinne
„elternlose“ jüdische Kinder von der Abteilung „Allgemeine Fürsorge“ der Reichsvertretung
bzw. Reichsvereinigung der Juden wahrgenommen wurde. Emil Lehmann dürfte seitens
43
Aus den Aufzeichnungen von Helmut Brunner, Tübingen.
44
Aus den Aufzeichnungen von Werner Schulze, Paderborn.
45
Vgl. Volker Mahnkopp, Dokumentation zu vom NS-Staat verfolgten Personen im Frankfurter Kinderhaus
der Weiblichen Fürsorge e. V. Hans-Thoma-Straße 24.
46
Vgl. Gesetzestexte unter http://www.koeblergerhard.de/Fontes/BGB/BGB1896_RGBl_S.195.htm
47
Volker Mahnkopp, Dokumentation zu vom NS-Staat verfolgten Personen im Frankfurter Kinderhaus der
Weiblichen Fürsorge e. V. Hans-Thoma-Straße 24, S. 23.
48
Beate Grohl, Jüdische Wohlfahrtspflege im Nationalsozialismus, Frankfurt am Main1933 – 1943, S. 12,
19, 44f.
14der Reichsvertretung bzw. der Reichsvereinigung der Juden als Vormund für jüdische
Kinder vorgeschlagen worden sein. Jedenfalls ergibt sich aus einer von Emil Lehmann
angefertigten Aufschlüsselung seiner Kosten vom 19. August 1942 gegenüber der
Devisenstelle „S“ in Frankfurt am Main zur Erläuterung der Position „Porti, Telefonate und
andere Ausgaben in m. Sozialarbeit f. d. Gemeinde 20 [Reichsmark]: „Zur Erläuterung
bemerke ich zu Posten Porti: Ich führe im Auftrage der jüdischen Gemeinde sowie der
Bezirksstelle Hessen-Nassau der Reichsvereinigung d. Juden in Deutschland eine grosse
Anzahl Vormund- und Pflegschaften, welche größere Ausgaben bedingen“.
1933 als „politisch unzuverlässig“ entlassen
Zur Situation der „nichtarischen“ Richter am Amtsgericht Frankfurt
Die Situation für jüdische Richter hatte sich mit der Machtergreifung Hitlers und dessen
Ernennung zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 verschärft. Bereits vor Inkrafttreten
des Gesetzes „zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums“ (BBG) am 7. April 1933
begann die „Säuberung“ der Richterschaft nicht nur in der Frankfurter Justiz aus
rassistischen und politischen Gründen.49
Bergemann und Ladwig-Winters beschreiben die Vorgänge in Frankfurt am Main im
Hinblick auf die Durchführung des BBG im Vergleich mit anderen preußischen Gerichten
wegen der zielstrebigen Vorgehensweise und den „inszenierten“ gewalttätigen Übergriffen
als „aus dem Rahmen“ fallend.50.
Im Frühjahr 1933 waren neben Emil Lehmann am Amtsgericht Frankfurt-Höchst am
Amtsgericht, Landgericht und Oberlandesgericht Frankfurt am Main weitere 24 Richter
und eine Richterin tätig, die als „nichtarisch“ galten.51
Auch wenn aus Höchst selbst keine Berichte über ein Vorgehen gegen die am Amtsgericht
Frankfurt-Höchst tätigen Beschäftigten bekannt sind, lässt sich aus Aktenvermerken und
Zeitzeugenberichten die Stimmung in dem in der Frankfurter Innenstadt liegenden
Gerichtsgebäude wiedergeben:
49
Bergemann, S. Ladwig-Winters, Richter und Staatsanwälte jüdischer Herkunft in Preußen im
Nationalsozialismus, Bundeanzeiger, S. 15.
50
Bergemann, S. Ladwig-Winters, Richter und Staatsanwälte jüdischer Herkunft in Preußen im
Nationalsozialismus, S. 47.
51
Bergemann, S. Ladwig-Winters, Richter und Staatsanwälte jüdischer Herkunft in Preußen im
Nationalsozialismus, S. 47, Fußnote 112).
15Am 17. März 1933 teilte ein der NSDAP angehörender Justizinspektors des Landgerichts
Frankfurt am Main in einem an den Landgerichtspräsidenten gerichteten Aktenvermerk
mit, dass am 18. März 1933 eine Sturmmannschaft der NSDAP bei dem Landgericht
erscheinen werde, um die Entfernung der im Gebäude des Landgerichts Frankfurt am
Main aufgehängten Bilder des ehemaligen Reichspräsidenten Ebert zu verlangen 52 .
Hierauf reagierte der Landgerichtspräsident unverzüglich, indem er anordnete, in dem
Dienstgebäude des Landgerichts die Bilder des früheren Reichspräsidenten Ebert „nach
Dienstschluss“ zu entfernen und „verschlossen aufzubewahren. 53 In der Erklärung des
Landgerichtspräsidenten an den Oberlandesgerichtspräsidenten heißt es weiter: „Der
Herr Amtsgerichtsdirektor hat für seinen Dienstbereich die gleiche Anordnung getroffen“.54
Der Frankfurter Landgerichtsrat Ernst E. Hirsch berichtete: „Am 30. März, d.h. bereits zwei
Tage vor diesem „Judenboykott“, wurde ich telefonisch gebeten, mich noch am Nachmittag
im Dienstzimmer des Oberlandesgerichtspräsidenten Doktor Hempen einzufinden […]. Er
teilte mir mit, dass er mich auf die Weisung des damaligen Reichskommissars für die
ehemalige Provinz Hessen – Nassau Dr. Roland Freisler bitten müsse, bis auf weiteres
auf die Ausübung meines Richteramtes zu verzichten. Als ich – im Gegensatz zu den
meisten anderen durch die gleiche Maßnahme betroffenen Kollegen – diese Zumutung
ablehnte, fragte der Präsident, ob ich ihm Schwierigkeiten machen wollte. Darum gehe es
nicht, erwiderte ich, sondern um die richterliche Unabhängigkeit und die Erfüllung des von
uns beiden abgelegten Richtereides. „Dann eröffne ich Ihnen hiermit dienstlich, dass Sie
bis auf weiteres beurlaubt sind“.55
Der Frankfurter Rechtsanwalt und Notar Wolfgang Tiffert, geboren am 11.12.1907
schilderte aus seiner Zeit als Referendar bei dem Landgericht Frankfurt am Main: „Als ich
am 1. April 1933 wie immer das Justizgebäude betreten hatte, um meine
Referendarausbildung fortzusetzen, musste ich erleben, wie SA-Leute durch das Haus
gingen und alle jüdischen Richter aufforderten, sofort ihren Arbeitsplatz zu verlassen. Wer
nicht freiwillig wegging, wurde mit Gewalt entfernt“.56
52
Jan Niemöller „Erinnerungen aus der Justiz während der NS-Zeit“ in „Studien zur Frankfurter
Geschichte“ S. 104 mit Verweis auf HHStA, Abt. 460/Nr. 793.
53
HHStA Abt. 460/Nr.793.
54
HHStA Abt. 460/Nr.793.
55
Hirsch, Als Rechtsgelehrter im Lande Atatürks, S. 20 f. zitiert nach A. v. Gruenewaldt, Die Richterschaft
des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main in der Zeit des Nationalsozialismus, S 91.
56
Wolfgang Tiffert in Inge Rieger, „Erinnerungen aus der Justiz während der NS-Zeit“ in „Studien zur
Frankfurter Geschichte“ a.a.O. S. 119.
16Der nationalsozialistische Oberbürgermeister von Frankfurt und Gauobmann Krebs
erklärte in einem Schreiben vom 1. Juni 1933 an das Justizministerium: „Nach dem Gesetz
über die Wiederherstellung des Berufsbeamtentums werden an den Frankfurter Gerichten
über 18 jüdische Richter verbleiben, wenn nicht von der Befugnis, sie zu versetzen,
Gebrauch gemacht wird. Bei der außerordentlichen Spannung, die gerade in Frankfurt a.
M. in der gesamten Bevölkerung durch die übermäßige Besetzung von Richterstellen mit
Juden entstanden ist, muss mit allem Nachdruck und in voller Erkenntnis der
Verantwortung für die Besetzung der Frankfurter Richterstellen darauf hingewiesen
werden, dass Zusammenstöße von deutschen Volksgenossen mit jüdischen Richtern sich
nicht vermeiden lassen. [...] Die jüdischen Richter haben auch zu einem großen Teil durch
ihr Auftreten und ihrem deutschem Rechtsempfinden fremden Judikate bis zu einem
solchen Grade die Wertschätzung des deutschen Volkes verscherzt, dass man es
verstehen kann, wenn der Deutsche sie als Richter ablehnt und diese Ablehnung allen
geschriebenen Gesetzen zum Trotz in urwüchsige Art Ausdruck verleiht. Es muss
zwangsläufig zu Zusammenstößen kommen, die im Interesse der straffen Staatsführung
möglichst zu vermeiden sein dürften. Es wird daher angeregt, die im Amt zu belassenden
jüdischen Richter von Frankfurt a. M. zu versetzen. Die besonders gearteten Frankfurter
Verhältnisse machen es jedenfalls zur unabweisbaren Pflicht, auf die sehr großen
Gefahren, die beim Belassen der jüdischen Richter in Frankfurt a. M. entstehen,
hinzuweisen. Heil Hitler!“57
Am 28. Juni 1933 notierte der Frankfurter Landgerichtsrat Karl Tomforde: „Gestern morgen
… ein wüster Tumult im Gericht. Nationalsozialistische Studenten in großer Zahl zogen
pfeifend und grölend „Juden raus“ durch die Gänge und zerrten die durchs Reichsgesetz
wieder zugelassenen jüdischen Rechtsanwälte aus den Sitzungszimmern, mißhandelten
sie und führten Sie ab – eine Schmach – die hinzugezogene Polizei leistete keinen
ernstlichen Widerstand“.58
Schließlich heißt es in einem Bericht, der nach Gegenzeichnung durch den
Generalstaatsanwalt am 30. Juli 1933 im Justizministerium in Berlin einging: „Am
17.7.1933 gegen 9 Uhr 25 Uhr drangen etwa 100-200 Demonstranten in die
Gerichtsgebäude ein. Die Demonstration richtete sich gegen die Wiedereinstellung der
jüdischen Richter, die an jenem Tag erfolgte. Die Rufe der Demonstranten lauteten 'die
jüdischen Richter raus!' 'Wir dulden keine jüdischen Richter', 'Wir ruhen nicht eher, bis kein
jüdischer Richter mehr da ist' [.…] Nachdem sich die Menge etwa 20 Minuten im
57
GstA, Rep. 84A, Nr. 22.973, Bl. 3 – 4 zitiert nach Bergemann, S. Ladwig-Winters, Richter und
Staatsanwälte jüdischer Herkunft in Preußen im Nationalsozialismus, S. 47, Fn. 115).
58
Aus: „Eine dienstliche Erklärung von Karl Tomforde“ mitgeteilt von Thomas-Michael Seibert in „Studien
zur Frankfurter Geschichte“ a.a.O. S. 115.
17Gerichtsgebäude aufgehalten hatte, verließ sie das Gebäude und stellte sich auf der
Straße vor der Eingangstür in Reihen auf. Einer der Demonstranten soll hier eine kurze
Ansprache an seine Kameraden gehalten haben, worin er bemerkte, es sei die
Wiedereinstellung der jüdischen Richter angeordnet, eine solche müsste unbedingt
verhütet werden, man werde so lange vor dem Gericht bleiben, bis die im Gericht
anwesenden jüdischen Richter entfernt seien […] Die Angaben meines Berichts beruhen
auf mir zuteil gewordenen Berichten des Landgerichtspräsidenten und
Amtsgerichtsdirektors. Ein Ermittlungsverfahren beabsichtige ich nicht einzuleiten, weil es
aussichtslos wäre“59
Zwangsbeurlaubung - Zwangsversetzung
So verstörend die Vorgänge an und in den Frankfurter Gerichtsgebäuden noch heute sind,
so „bedrückend und zermürbend“ 60 gestaltete sich die „Entfernung“ der betroffenen
„nichtarischen“ Richter aus dem Justizdienst.
Emil Lehmann gehörte mit seiner Zwangsbeurlaubung am 01. April 1933 – einem Samstag
und zugleich das Datum, an dem Emil Lehmann 25 Jahre zuvor seinen Dienst beim dem
damaligen Amtsgericht Höchst angetreten hatte - mit zu den ersten Opfern der von den
Nationalsozialisten betriebenen Entlassungs- und Versetzungswelle jüdischer und
politisch missliebiger Richter bei dem Amtsgericht Frankfurt am Main.
Die Anordnung der Zwangsbeurlaubung beruhte formell auf dem „Kerrlschen Erlass“, den
der amtierende Oberlandesgerichtspräsidenten Dr. Hempen am 31. März 1933 per
Funkspruch erhalten hatte: „ […] Die Erregung des Volkes über das anmaßende Auftreten
amtierender jüdischer Rechtsanwälte und jüdischer Richter hat Ausmaße erreicht, die
dazu zwingen mit der Möglichkeit zu rechnen, dass besonders in der Zeit des berechtigten
Abwehrkampfes des deutschen Volkes gegen die alte jüdische Gräuelpropaganda, das
Volk zur Selbsthilfe schreitet. […] Ich ersuche deshalb umgehend alle amtierenden
jüdischen Richter nahezulegen, sofort ihr Urlaubsgesuch einzureichen und diesem sofort
stattzugeben. […] In allen Fällen, in denen jüdische Richter sich weigern, ihr
59
Zitiert nach Bergemann, S. Ladwig-Winters, Richter und Staatsanwälte jüdischer Herkunft in Preußen im
Nationalsozialismus, S. 48 f.
60
Bergemann, S. Ladwig-Winters, Richter und Staatsanwälte jüdischer Herkunft in Preußen im
Nationalsozialismus, S. 58.
18Urlaubsgesuch einzureichen, ersuche ich, diesen kraft Hausrecht das Betreten des
Gerichtsgebäudes zu untersagen“61
Dass Emil Lehmann als einen der ersten Richter des Amtsgerichts Frankfurt die
nationalsozialistischen Repressalien trafen, hat mehrere Gründe:
Es ist zu berücksichtigen, dass trotz der bestehenden Vorstellung, jüdische Richter nicht
weiter beschäftigen zu „können“, deren Entrechtung auch im Bezirk des
Oberlandesgerichts Frankfurt am Main nicht am 1. April 1933 auf einen Schlag erfolgte.
Neben der Vorstellung, die Justiz von jüdischen Richtern zu „säubern“, brachte die
Notwendigkeit der Aufrechterhaltung des Gerichtsbetriebes mit sich, dass „kurzfristig“
jüdische Richter jedenfalls nicht mehr „öffentlichkeitswirksam“ ihren Dienst verrichten
können sollten. In einer Stellungnahme des Frankfurter Oberlandesgerichtspräsident O.
Stadelmann vom 14. Juni 1933 an den Reichsjustizminister heißt es insoweit: „Die
Verwendung der sämtlichen übrigen nicht arischen Richter beim AG und LG in Frankfurt
am Main ist wegen der besonderen Verhältnisse nicht durchführbar. Frankfurt am Main ist
jahrzehntelang ein Sammelpunkt jüdischer Richter gewesen. Dieser Umstand hat in
erheblichem Umfang dazu beigetragen, daß das Ansehen der Rechtspflege stark
erschüttert worden ist. Es erscheint dringend geboten, die sich jetzt bietende Gelegenheit
zur Versetzung jüdischer Richter von Frankfurt am Main nicht ungenutzt vorübergehen zu
lassen. Die Rechtspflege und das Vertrauen der Justiz können hierdurch nur gewinnen.
Es ist zudem auch unmöglich, die nicht arischen Richter in einer Tätigkeit unterzubringen,
in der Reibungsmöglichkeiten mit der rechtsuchenden Bevölkerung tunlichst
ausgeschaltet sind. Eine genaue Prüfung der Unterbringungsmöglichkeiten, die in
gemeinsamer Besprechung mit dem LG-Präs. und dem AG-Dir. und dem RA Dr. Weber
[Anm. Vertreter der Gauleitung der NSDAP], dem Vertreter der Gauleitung, erfolgt ist, hat
ergeben, daß äußerstenfalls beim AG in Frankfurt am Main 5 [....] jüdische Richter
beschäftigt werden können, ohne daß ernsthafte Schwierigkeiten zu erwarten sind. In
Aussicht genommen sind für die Unterbringung der jüdischen Richter beim AG eine
Abteilung für Rechtshilfeersuchen in Zivilsachen, die Handelsregisterabteilung, die
Abteilung für Zwangsvollstreckung ins bewegliche Vermögen und zwei
Grundbuchabteilungen.... Weitere Unterbringungsmöglichkeiten bestünden beim AG
Frankfurt am Main nur dann, wenn jüdische Richter auch in einer der 30
Zivilprozeßabteilungen des Amtsgerichts beschäftigt würden. Wenn auch nach dem Erlaß
vom 31. Mai 1933 – I 9843 – eine solche Beschäftigung nicht ausgeschlossen ist, so hat
sich doch der Vertreter der Gauleitung [Anm.: Dr. Weber] mündlich ganz entschieden, und
61
GstA PK, I. HA Rep. 84a, Nr. 22973, Bl. 2, GstA PK, I. HA Rep. 84a, Nr. 4542 Bl., 177 zitiert nach A. v.
Gruenewaldt, Die Richterschaft des Oberlandesgerichts Frankfurt am Main in der Zeit des
Nationalsozialismus, S 211.
19Sie können auch lesen