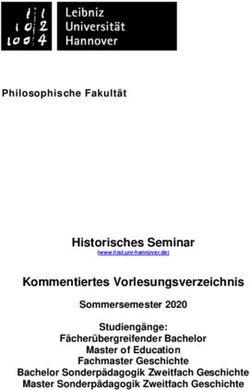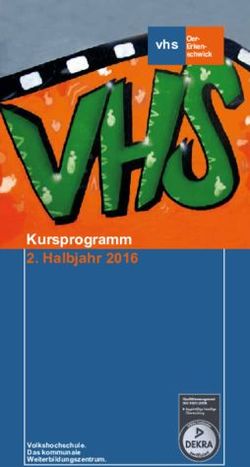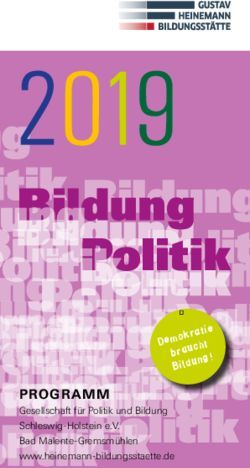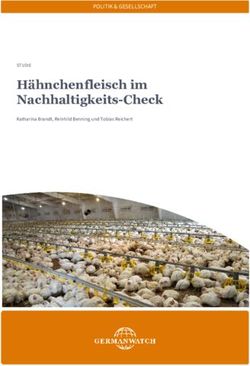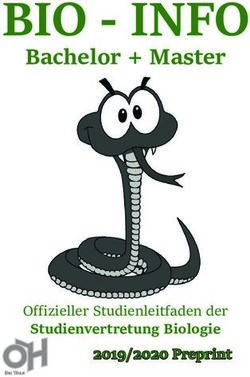Kompetenz wasser - Stadtentwässerungsbetriebe Köln
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
2
Editorial Inhalt
4 Lebenswerte Quartiere — Wasserwirtschaftliche Klima-
folgenanpassung durch partizipative Prozesse und ver-
änderte Funktionselemente
9 Von Anpassung, Vermeidung und Wandel —
Ein Gespräch mit Professorin Claudia Kemfert (DIW
Berlin)
12 Gefahr Starkregen — Die Weiterentwicklung von
Simulationssoftware und Berechnungsverfahren
16 Die wassersensible Stadt — Erfahrungen in der Ana-
Liebe Leserinnen und Leser, lyse potenzieller multifunktionaler Flächen
19 Blau, Grün, Grau — Klimafolgenangepasste Quartiers-
die Wetterereignisse des Juli 2021 und ihre dramatischen entwicklung im Bestand
Folgen haben gezeigt: Der Klimawandel ist vor unserer 22 Neues Tool liefert neue Erkenntnisse — Die Messung
eigenen Haustüre angekommen. Studien belegen, dass der Hochwasser-Resilienz in Kölner Überflutungsgebie-
sich die Wahrscheinlichkeit für derart extreme Regenfälle ten
durch den menschengemachten Temperaturanstieg um das 25 Und wie geht es weiter? — Der aktuelle Stand und
1,2- bis 9-fache erhöht hat. Das führt dazu, dass aus kleinen die Planungen zum urbanen Hochwasserschutz in Köln
Flüssen und Bächen reißende Ströme werden können, die 28 Die BIM-Strategie wächst — Neue Einsatzmöglichkei-
ganze Ortschaften zerstören. Es wird deutlich, warum selbst ten in der Bauwerksprüfung und -sanierung
Industrieländer nicht vor den schweren Auswirkungen sol- 30 Ein Jahrhundertprojekt — Der Neubau des Rheindü-
cher Extremwetter geschützt sind. kers im Kölner Stadtteil Niehl
Als Vorständin der StEB Köln sehe ich eine besondere 34 Das papierlose Büro — Digitale Ausschreibung und
Herausforderung darin, die Auswirkungen der globalen elektronische Vergabe bei den StEB Köln
Klimaveränderungen zu begrenzen und im Dialog mit Part- 36 Blackout — Was passiert, wenn in Köln die Lichter aus-
nern innovative und zukunftsweisende Wege hinsichtlich gehen?
der Folgen des Klimawandels und der daraus resultierenden 39 Mehr erneuerbare Energien — Die Optimierung des
Anforderungen zu finden. Dazu müssen in den kommenden Klärwerkbetriebs durch energetische Flexibilisierung
Jahren und Jahrzehnten Maßnahmen auf allen Ebenen ge- 42 Klärgas für die Zukunft — Co-Fermentation auf dem
tätigt werden: vom präventiven Hochwasserschutz über die Großklärwerk Köln-Stammheim
Resilienz im Hochwasser- und Starkregenmanagement bis 44 Maschinelles Lernen in der Abwasserwirtschaft —
zur Verbesserung von Prognose- und Warnsystemen sowie Optimierte Prozesssteuerung im Kanalnetz und auf
zur Sensibilisierung der Bevölkerung. Zugleich gewinnen Kläranlagen
Aspekte wie die wassersensible Stadtplanung sowie das Frei- 46 Keine Wünsche offen — Die neue Elektro-Ausbil-
halten und die reduzierte Inanspruchnahme von Flächen an dungsstätte im Klärwerk Köln-Weiden
Bedeutung. Wie dies in der Praxis aussehen kann, erfahren 48 Aktuelle Meldungen
Sie in den Beiträgen der aktuellen kompetenz wasser, die
sich darüber hinaus mit weiteren spannenden Fragen der
Wasserwirtschaft auseinandersetzt.
Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre und viele
interessante Anregungen.
Ihre Ulrike Franzke
Vorständin der StEB Köln3
Um die Auswirkungen des Klimawandels einzudämmen, bedarf es Die Wirtschaftswissenschaftlerin und Professorin Claudia Kemfert gilt
neuer und angepasster Verfahren und Konzepte. Wie diese aussehen als ausgewiesene Expertin in Energie- und Klimafragen. Wir sprachen
können und welche Bereiche sie betreffen, lesen Sie in den Beiträgen mit ihr über Herausforderungen der Zukunft und entsprechende Strate-
auf den Seiten 4 bis 27. gien (Seite 9).
Was passiert, wenn in Köln die Lichter ausgehen? Auf Seite 36 ff. Die Transformation unseres Energiesystems wird ohne Paradigmen-
erfahren Sie, wie die StEB Köln als Unternehmen der kritischen Infra- wechsel in der Anlagen- und Betriebsführung von Klärwerken kaum
struktur die Sicherung der Abwasserentsorgung bei möglichen Strom- gelingen. Was das bedeutet und wie die StEB Köln darauf vorbereitet
ausfällen gewährleisten. sind, lesen Sie auf Seite 39 ff.
Auch in der Wasserwirtschaft gewinnt die Digitalisierung mehr und
mehr an Bedeutung. Dabei geht es um eine optimierte Prozesssteue-
rung im Kanalnetz und auf Kläranlagen — zum Beispiel mit Hilfe von
maschinellem Lernen. Lesen Sie mehr auf Seite 44 ff.Lebenswerte Quartiere Foto: Fotomontage StEB Köln/must-Städtebau Wasserwirtschaftliche Klimafolgenanpassung durch partizipative Pro- zesse und veränderte Funktionselemente Von Dr. Maria Ceylan, Christine Linnartz und Ingo Schwerdorf Überflutungen durch Starkregen und Hitzesommer haben Die Städte stehen also am Scheideweg: Der Klimawandel ist es gezeigt: Die Auswirkungen des Klimawandels sind da. Realität, das urbane Umfeld muss entsprechend angepasst Damit einher gehen große Herausforderungen, gerade für werden. Doch keiner der Akteur*innen vor Ort kann dies die Kommunen. Aufgrund des vor allem in den Innenstäd- allein realisieren. Gefragt sind neue Formen der Kooperation ten hohen Versiegelungsgrades ist der Hitzeinseleffekt dort für die Entwicklung lebenswerter Quartiere. am stärksten spürbar. Die Folge sind eine extreme Hitzebe- Genau hier setzt das durch das Bundesministerium für lastung am Tag sowie sogenannte ›Tropennächte‹. Zugleich Bildung und Forschung (BMBF) in der Leitinitiative Zu- trägt der hohe Versiegelungsgrad auch dazu bei, dass Re- kunftsstadt geförderte Forschungsprojekt ›iResilience‹ an. genwasser nicht versickern kann. Im Fall eines Starkregener- Entlang der Frage, wie Städte anpassungs- und widerstands- eignisses werden Straßen, Plätze und Höfe zu Überlauf- und fähiger gegenüber dem Klimawandel, also klimaresilienter, Retentionsräumen für die städtische Kanalisation. werden können, erprobt es neue Kooperationsformate. Dabei erfüllen die öffentlichen und privaten (Frei-)Räume Der Fokus liegt hierbei nicht nur auf der Entwicklung von vor unserer Haustüre weit mehr als eine rein technische widerstandsfähigen urbanen Räumen, sondern auch auf Funktion. Ihre Bedeutung als erweitertes Wohnzimmer und der Schaffung anpassungsfähiger Strukturen sowie dem sozialer Begegnungsraum für die innerstädtischen Quartiere Voneinander-Lernen. Dazu bringt das Forschungsteam die wurde nicht zuletzt in Zeiten der Corona-Pandemie deutlich. zuständigen und betroffenen Akteur*innen ›an einen Tisch‹.
5 Sie kommen sowohl von den StEB Köln und dem Umwelt- Rahmenbedingungen, Voraussetzungen und Ziele als auch amt der Stadt Köln als auch von der Sozialforschungsstelle der Weg zum gewünschten Optimalzustand. der Technischen Universität Dortmund (sfs), dem Deutschen Um den beschriebenen Austausch zu erleichtern, wurde Institut für Urbanistik (Difu), dem Forschungsinstitut für als Schnittstelle zwischen den Bürger*innen, den Kolleg*in- Wasser- und Abfallwirtschaft an der RWTH Aachen (FiW) nen der Stadt und den StEB Köln sowie anderen Akteur*in- e.V., den Landschaftsarchitekt*innen der HafenCity Uni- nen eine Stelle geschaffen, die je zur Hälfte bei den StEB versität Hamburg (HCU) und dem Ingenieurbüro Dr. Pecher. Köln und beim Umweltamt der Stadt Köln angesiedelt ist. Neben der zielgruppengerechten Aufbereitung der Aus- Ihre Aufgabe ist es, im Rahmen der neu konzipierten Koope- wirkungen von Klimafolgen im Allgemeinen sollen gemein- rationsformate Themen, Orte und Wissen zusammenzubrin- schaftliche Lösungen erarbeitet und diskutiert, abgewogen gen und so Prozesse zu initiieren und zu moderieren. und zum Teil prototypisch umgesetzet werden. Der themati- Dies geschieht auf drei Ebenen und mit Hilfe unter- sche Fokus liegt zum einen auf der Starkregen- und Überflu- schiedlicher Kooperationsformate: So tauschen sich in den tungsprävention, zum anderen aber auch auf der Vorsorge Plenen alle Akteur*innen über alle Themen von iResilience gegenüber Hitze und der Förderung von klimawirksamem aus. Daraus sollen eine Roadmap als Fahrplan zu einem kli- urbanen Grün, um so die alltägliche Lebensqualität vor Ort marobusten Quartier sowie eine grafische Ideensammlung zu verbessern. Räumlich konzentrieren sich die Aktivitäten aller Klimaanpassungs-Maßnahmen entstehen (Zukunfts- auf drei Reallabore in Köln-Deutz, in der Dortmunder Nord- bild, siehe Abb. 1). Parallel wird in thematischen Arbeits- stadt und in Dortmund-Jungferntal. Charakteristisch für die gruppen (Them. AGs) gezielt über Aspekte wie Starkregen, Arbeit in Reallaboren ist, dass Menschen durch das Teilen Hitze oder urbanes Grün gesprochen. Hier stehen das und Vernetzen von unterschiedlichem Wissen und die ge- Vernetzen von vorhandenem Wissen sowie die Suche nach meinsame Arbeit an Lösungen ins Handeln kommen. Dabei Räumen und Themen, die einer Intervention bedürfen, im wird zwischen System-, Ziel- und Transformationswissen Vordergrund. Das können konkrete Orte, aber auch konkrete unterschieden (Schaepke, 2017). Betrachtet werden sowohl Herausforderungen sein. Für derartige Orte oder Themen Abb. 1: Das Zukunftsbild zeigt die Ideen zur Entwicklung des Quartiers.
6
entwickeln die zuständigen Akteur*innen dann in Lokalen
Aktionsgruppen (LAG) eine Lösung. Grundannahme dabei
ist, dass durch den Austausch und gemeinsamen Erwerb
von Wissen ein Lernprozess angestoßen wird. Aus diesem
sollen beispielsweise ein Konzept für Verhaltensänderungen
bei Hitze, ein neues Kommunikationsformat oder auch die
klimaresiliente Umgestaltung einer Straße resultieren. Die
konkrete Ausgestaltung aller LAGs erfolgte individuell und
wurde an die jeweiligen Fragestellungen angepasst.
Im Prozess werden alle Ebenen durchlaufen: von den
Plenen über die thematische AG bis zur LAG. Dabei werden
Themen, Orte, Akteure und Wissen vernetzt sowie gemein-
same Lösungen erarbeitet. Diese werden anschließend in
die höheren Ebenen zurückgespiegelt, wobei sich zu allen
drei Themenbereichen (Starkregen, Hitze & Gesundheit und
urbanes Grün) lokale Aktionsgruppen bilden können. Sie er-
arbeiten vielfältige Projekte, zum Beispiel einen Hitzespick-
zettel als zielgruppenspezifisches Kommunikationsformat, Abb. 3: Simulation der Hitzebelastung im Quartier
um insbesondere Senior*innen über Unterstützungsan-
gebote zu informieren. Zudem wurden für insgesamt sechs Starkregen hat sich in Köln-Deutz unter anderem die Gruppe
Wochen temporäre Begrünungen durch Wanderbäume und Kasemattenstraße für Morgen! gebildet, deren Aktivitäten
Pflanzaktionen ins Quartier geholt. Dazu wurden auch Info- zur wassersensiblen Umgestaltung des Straßenraumes in
abende für die Bevölkerung durchgeführt. Für das Thema diesem Artikel näher beleuchtet werden.
Abb. 2: Ausschnitt aus der Starkregengefahrenkarte der StEB Köln7
Gemeinsam für die Kasemattenstraße sich auf die Erarbeitung eines ausgearbeiteten Vorschlags,
der verschiedene Ideen miteinander kombiniert und hin-
Die Starkregengefahrenkarten der StEB Köln zeigen für die sichtlich ihrer Machbarkeit einschätzt. Die Informationen
Kasemattenstraße im Stadtteil Deutz einen Überflutungs- dazu wurden von den Kolleg*innen der Fachämter der
hotspot (siehe Abb. 2). Darüber hinaus liegt im Sommer hier Stadt Köln bereitgestellt. Nachdem alle Beteiligten in einer
aufgrund des hohen Versiegelungsgrades auch eine hohe Videokonferenz ihre Einschätzung zum erarbeiteten Entwurf
Hitzebelastung vor (siehe Abb. 3). Die Kombination aus vorgenommen hatten, wurde dieser nochmals ins Quartier
baulicher Dichte, wenigen öffentlichen Grünflächen sowie kommuniziert und durch eine Online-Umfrage bislang Un-
der Barrierewirkung bestehender Straßen und Infrastruktur- beteiligter ergänzt. Dabei zeigten vor allem die Bürger*in-
trassen sorgt dafür, dass vorhandene wohnungsnahe Ent- nen großes Interesse, die entwickelte Lösung in politischen
lastungsräume nur eingeschränkt wirksam und schlecht zu Gremien vorzustellen. Im Nachgang wurde darüber hinaus
erreichen sind. ein Antrag über ein Bundesförderprogramm gestellt, um die
Als zuständige und betroffene Akteure wurden die Fach- Finanzierung der Ideen zu unterstützen.
Kolleg*innen der Stadt Köln und der StEB Köln sowie die Die entwickelte Lösung umfasst eine grundlegende Um-
Anwohnenden des Bereichs identifiziert. Um sie alle an gestaltung der Kasemattenstraße, wobei der Straßenraum
einen Tisch zu bringen, wurden verschiedene Möglichkeiten zwischen Kasemattenstraße, Graf-Geßler-Straße und Von-
der Ansprache genutzt. Während die Fach-Kolleg*innen Sandt-Platz inklusive der Lehrerparkplätze des Hans-Böckler-
in bilateralen Gesprächen informiert und zu den Terminen Berufskollegs im Fokus steht. Sie sieht vor, die bestehenden
eingeladen wurden, stellte die Motivation der Bürger*innen Nutzungen aufzugeben, der Bereich der Parkplätze soll
eine Herausforderung dar. So wurde mit Flyern und Plakaten entsiegelt und als grüne Mulde ausgeformt werden. Hier
auf die geplanten Veranstaltungen hingewiesen, der gefähr- kann sich das Regenwasser schadlos sammeln. Aufgrund
dete Bereich wurde zudem mit Farbe markiert. Insbesondere der beengten Platzverhältnisse und der begrenzten Kapazi-
über die persönliche Ansprache gelang es dem Forschungs- täten soll der grüne Stauraum mit einer Rigole oder Zisterne
projekt, das Interesse der Anwohnenden zu wecken. kombiniert werden. So kann ein Teil des Regenwassers ver-
Die Arbeit der LAG in diesem Bereich basiert auf Einzel- sickern und ein anderer Teil für die zukünftige Bewässerung
veranstaltungen, wobei die konzeptionellen Schritte zwi- der neugeschaffenen Vegetationsflächen genutzt werden.
schen den Terminen relativ groß waren. Begonnen wurde Die begrünte Mulde lädt als multifunktionale Fläche zum
die Arbeit im Sommer 2020, also zu Beginn der Corona-Pan- Verweilen ein, das vorhandene Wegesystem für Fußgän-
demie. Dies erschwerte die Interaktion der Beteiligten in ger*innen und Radfahrende bleibt bestehen. Derweil wird
Präsenzveranstaltungen, daher wurden digitale und hybride der motorisierte Verkehr künftig über die nördliche Seite des
Formate in den Prozess integriert. Inhaltlich wurden erste Von-Sandt-Platzes geleitet.
Skizzen zu potenziellen Lösungsansätzen entworfen und Zusammenfassend kann gesagt werden, dass es den Teil-
visualisiert. Die Visualisierungen dienten als Arbeitsgrund- nehmenden der LAG Kasemattenstraße für Morgen! gelun-
lage für weitere Treffen. gen ist, vom Wissen ins Handeln zu kommen. Dabei wurde
In diesen wurde ausführlich auf die Starkregenproble- deutlich, dass eine Diskussion auf Augenhöhe nur möglich
matik vor Ort eingegangen, beispielsweise bezüglich der ist, wenn alle Beteiligten über das gleiche Wissen verfügen
Zwischenspeicherung und Wiederverwendung des Nieder- und sich auf gemeinsame Ziele verständigen. Ein Beispiel:
schlagsabflusses. Die Teilnehmer*innen der LAG einigten Während die StEB Köln die Entschärfung eines überflutungs-
gefährdeten Bereiches als Hauptziel ansahen, stand für
die Bürger*innen die Aufwertung des öffentlichen Raumes
im Fokus. Die Lösung vereint beide Aspekte: Der Raum
wird gestalterisch aufgewertet und fungiert gleichermaßen
als Retentionsraum im Falle eines Starkregenereignisses.
Getragen wurde der Prozess vom großen Interesse der be-
teiligten Akteuer*innen sowie der Bereitschaft zum Einblick
in andere Denkweisen und zur Erweiterung des eigenen
Wissens. Inwieweit das Format der LAG dabei einen nach-
haltigen Beitrag zur Schaffung von Klimaresilienz hat, wird
aktuell über vertiefende Interviews evaluiert. Das Vorhaben
Abb. 4: Übersicht aller durchgeführten Treffen iResilience wurde verlängert und endet am 30. Juni 2022.8
Geplant ist, die Methodik so aufzubereiten, dass sie auch in
anderen Kölner Stadtteilen zum Einsatz kommen kann.
Quellen
Schäpke, N., Stelzer, F., Bergmann, M., Singer-Brodowski, M., Wanner,
M., Caniglia, G., Lang, D.J. (2017): Reallabore im Kontext transforma-
tiver Forschung. Ansatzpunkte zur Konzeption und Einbettung in den
internationalen Forschungsstand. (No. 1/2017) Leuphana Universität
Lüneburg, Institut für Ethik und Transdisziplinäre Nachhaltigkeitsfor-
schung
Weitere Informationen zum Thema unter http://iresilience-klima.de/
und https://www.instagram.com/iresilience_klima/
Das Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Bildung
und Forschung (BMBF) unter dem Förderkennzeichen 01LR1701 ge-
fördert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung liegt
bei den Autor*innen.
Abb. 5: Aktuelles Luftbild des Bereiches Kasemattenstraße
Abb. 6: Der ausgearbeitete EntwurfVon Anpassung,
Vermeidung und Wandel
Ein Gespräch mit der Wirtschaftwissenschaftlerin und Professorin Claudia
Kemfert zu den klima- und energiepolitischen Herausforderungen
Interview: Manfred Kasper
Frau Professorin Kemfert, ist der Klimawandel noch aufzu- abläuft. Zusammenfassend: Ja, wir können den Klimawan-
halten? del noch aufhalten, zumindest seine schlimmsten Auswir-
kungen. Das gelingt aber nur, wenn wir endlich ins Handeln
Wir sind wahnsinnig spät dran, da wir mehrere Jahrzehnte kommen!
untätig vergeudet haben. Und nun läuft uns die Zeit davon.
Doch je länger wir warten, desto schwieriger wird es. Um Was heißt das für unsere Gesellschaft und die Frage, wie
deutlich unter zwei Grad globale Erderwärmung zu bleiben, wir die Folgen der angesprochenen Entwicklung bewälti-
müssen wir so schnell wie möglich umsteuern. Wir dürfen gen können?
nur noch in erneuerbare Energien und Energiesparen inves-
tieren und keinerlei Investitionen in fossile Energien mehr Ein ungebremster Klimawandel hat für die Gesellschaft un-
zulassen. Oder andersherum: Wir haben noch sieben Jahre geahnte Folgen. Klimaereignisse wie Überschwemmungen,
»Weiter so«-Zeit. Dann ist das maximale CO2-Budget von Dürren, extreme Hitze oder Wasserknappheit werden zuneh-
etwa 420 Gigatonnen aufgebraucht. Das zeigt: Die CO2- men und damit auch die volkswirtschaftlichen Schäden. Ei-
Schuldenuhr tickt, und zwar unaufhaltsam. Wer sie einmal nen ersten Vorgeschmack haben wir leider auch in Deutsch-
in Realität sehen will: Am EUREF-Center in Berlin-Schöne- land zuletzt mit den Überflutungen im Ahrtal bekommen.
berg hängt eine globale CO2-Uhr, die gerade gnadenlos Derartige Ereignisse müssen wir zukünftig vermeiden. Wir10
müssen alles dafür tun, dass die Emissionen deutlich schnel- Die eine Frage ist, wie wir uns schützen können — die an-
ler sinken. Und wir müssen uns vorbereiten auf den Klima- dere, welchen Beitrag wir selbst zur Reduzierung von CO2
wandel, indem wir Vorsorge- und Präventionsmaßnahmen und damit zur ›Eindämmung‹ des Klimawandels leisten
einführen. In reichen Staaten wie Deutschland und einem können? Wo sehen Sie diesbezüglich wichtige Ansatzpunk-
Kontinent wie Europa kann dies gelingen, in ärmeren Staa- te?
ten hingegen kaum. Deswegen ist es so wichtig, dass man
auch den ärmeren Staaten auf der Welt hilft, sich besser auf Es muss alles getan werden, um Emissionen zu vermeiden.
den Klimawandel vorzubereiten und entsprechend anzu- Sprich: Wir müssen weg von den fossilen Energien und hin
passen. Denn last but not least schafft kluger Klimaschutz zu erneuerbaren Energien. Das kann nur gelingen, indem
auch soziale Gerechtigkeit. Er hilft damit den Gesellschaften wir ab heute ausschließlich in das Energiesparen, den effizi-
insgesamt. enten Umgang mit Energie und den Ausbau der erneuerba-
ren Energien investieren.
Stehen die Akteur*innen der kritischen Infrastruktur — Der hergestellte Ökostrom muss effizient genutzt werden,
beispielsweise die StEB Köln — diesbezüglich vor besonde- zum Beispiel durch den Einsatz von Elektromobilität auf
ren Herausforderungen? der Schiene oder Straße, die Nutzung von Wärmepumpen
im Gebäude und in der Industrie oder zur Herstellung von
Die Akteur*innen der kritischen Infrastruktur haben eine be- grünem Wasserstoff. All dies schafft enorme volkswirtschaft-
sondere Verantwortung: Sie müssen alles dafür tun, dass die liche Potenziale, aus denen wiederum Wertschöpfungen und
Sicherheit gewährleistet ist und sich zudem entsprechend Arbeitsplätze entstehen. Nur durch eine konsequente Ener-
vorbereiten auf extreme Wetterereignisse wie Hochwasser, gie-, Verkehrs- und Wärmewende sowie eine Transformation
aber auch auf Wasserknappheit durch Dürren. Hintergrund der Industrie werden die notwendigen Emissionssenkungen
ist, dass extreme Klimaereignisse zu Versorgungsengpässen erreicht werden können.
und Qualitätsverlusten führen können. Neben der Versor-
gungssicherheit ist auch die Anpassung an den Klimawan- Der aktuelle Weltklimabericht prognostiziert, dass der
del ein zentrales Thema. Die große Herausforderung besteht Klimawandel noch schneller als befürchtet kommt. Inwie-
künftig darin, Prävention und Anpassungsmaßnahmen nicht fern reichen die aktuellen Zielwerte zur Begrenzung der
nur rechtzeitig vorzubereiten, sondern auch konsequent Temperaturerhöhung vor diesem Hintergrund noch aus?
durchzudeklinieren. Es kommen völlig neue Klimawandel-
Zeiten auf uns zu. Das bringt auch neue Herausforderungen Die aktuellen Zielwerte müssen nachgeschärft werden, des-
mit sich, insbesondere auf dem Gebiet der Stadtentwässe- wegen ist es ja so wichtig, dass wir so schnell wie möglich
rung. die Emissionen senken. Bis allerspätestens 2050 müssen wir
sie auf Null gebracht haben. Das schaffen wir nur, indem
Die Wasserwirtschaft — gerade auch die StEB Köln — hat wir heute handeln, entsprechend investieren und nichts
in den letzten Jahren bereits sehr viel Verantwortung in mehr auf die lange Bank schieben. Übrigens: Ein Urteil
Sachen Nachhaltigkeit übernommen, zum Beispiel wenn des Bundesverfassungsgerichts hat uns in Deutschland ins
es um den Hochwasserschutz, die Energiebilanz auf Klär- Pflichtenheft geschrieben, die Ziele zur Emissionsminderung
anlagen oder um die naturnahe Gewässerentwicklung und noch einmal zu verschärfen. Es ist also überfällig, dass diese
Renaturierung geht. Wie bewerten Sie das und wo sehen Anpassungen endlich erfolgen.
Sie hier künftigen Handlungsbedarf?
Sie sprachen eben bereits vom Prozess der Transformation.
Das alles sind Schritte in die richtige Richtung. Durch den Um unsere Gesellschaft nachhaltig für die Zukunft zu
fortschreitenden Klimawandel werden aber weitere Maßnah- wappnen und die schlimmsten Folgen des Klimawandels
men notwendig sein. Insbesondere in Nordrhein-Westfalen zu begrenzen, braucht es einen konsequenten Umbau
ist der Hochwasserschutz ein besonders wichtiges Thema. unserer Wirtschaft, der auf Nachhaltigkeit und Klimaneu-
In Zeiten extremer Hitze ist zudem jedoch auch die Gewähr- tralität abzielt. Wo stehen wir in diesem Prozess?
leistung der Versorgungssicherheit und der Wasserqualität
entscheidend. Hier gilt es, einen klugen Ausgleich zu finden Aus meiner Sicht sind wir diesbezüglich leider noch nicht
zwischen den Anforderungen der Wasserversorgung insge- weit genug. So ist der Ausbau der erneuerbaren Energien
samt, den Anpassungen an den Klimawandel, der Gefahren- in 20 Jahren zwar ganz gut vorangekommen, wir erreichen
prävention sowie dem Umweltschutz und der Renaturierung. heute einen Anteil von erneuerbaren Energien an der11
Stromproduktion von etwa 50 Prozent. Aber es muss mehr Zur Person
passieren: Der Ökostrom muss weiter ausgebaut werden,
wir brauchen mindestens eine Verdreifachung des Ausbau- Die Wirtschaftswissenschaftlerin und Professorin Claudia
tempos der erneuerbaren Energien. Zudem müsste Ökostrom Kemfert leitet seit April 2004 die Abteilung Energie, Ver-
in allen Bereichen effizient zum Einsatz kommen, Stichwort kehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsfor-
Sektorenkopplung, also der verstärkte Einsatz von erneuer- schung (DIW Berlin) und ist Professorin für Energiewirt-
barem Strom in den Sektoren Verkehr, Wärme und Industrie. schaft und Energiepolitik an der Leuphana Universität,
Insbesondere bei der Verkehrswende standen wir bisher Lüneburg. Die mehrfach ausgezeichnete Spitzenforscherin
vollständig auf der Bremse. Das muss sich dringend ändern, und Expertin für Politik und Medien ist Ko-Vorsitzende des
sonst erreichen wir weder eine Energiewende noch die an- Sachverständigenrats für Umweltfragen SRU und Mitglied
gestrebten Klimaziele. im Präsidium der deutschen Gesellschaft des Club of Rome
(DGCOR) sowie im Klimabeirat der Städte Hamburg und
Auf welche Art und Weise können die Unternehmen — zum Dresden. Im Murmann Verlag erschien zuletzt ihr Buch
Beispiel die StEB Köln — zu diesem Wandel beitragen? Mondays for Future.
Alle Unternehmen sind gefordert, ihren Beitrag zum Klima- Das Foto auf Seite 9 wurde von Dr. Andreas Pohlmann
schutz zu leisten. Es geht dabei um Emissionsvermeidung, im Rahmen eines rund 100 Persönlichkeiten umfassen-
aber auch um Versorgungssicherheit und die Sicherstellung den künstlerischen Fotoprojektes über Klimaforscher-
von Wasserqualität. All diese Komponenten haben im Zuge *innen und Klimakommunikator*innen im deutschsprachi-
des Umbaus und der Transformation der Wirtschaft eine gen Raum aufgenommen (www.pohlmann714.de). Es zeigt
enorme Bedeutung. Die StEB Köln tun schon sehr viel im Professorin Claudia Kemfert am 8. September 2020 auf
Bereich Überflutungsschutz. Sie betreiben aktiven Umwelt- der Dachterrasse des ›Berlin Cube‹.
schutz, zum Beispiel durch die Sicherung von Bächen und
Weihern. Damit sorgen sie zum einen für einen effektiven
Klimaschutz, zum anderen aber auch für eine effektive An-
passung an den Klimawandel.
Eines Ihrer Bücher trägt den Titel »Die andere Klima-Zu-
kunft — Innovation statt Depression«. Wie optimistisch
sind Sie, dass Ihre Vision noch realisiert werden kann?
Ich bin sehr optimistisch! Mein neuestes Buch heißt übri-
gens Mondays for future und sprüht nur so vor Optimismus.
Es geht darum, die wichtigsten Fragen im Bereich Klima-
schutz und Nachhaltigkeit zu beantworten, aber auch sehr
viele Tipps und Umsetzungsschritte für einen echten Klima-
schutz zu geben — für die Gesellschaft, die Politik, aber auch
für die Bürger*innen in diesem Land. Der Wandel ist meiner
Ansicht nach eine enorme Chance für Gesellschaft, Umwelt
und Klima. Wenn wir alle beherzt anpacken, können wir es
schaffen!
Frau Professorin Kemfert, vielen Dank für das Gespräch.Gefahr Starkregen Die Weiterentwicklung von Simulationssoftware und Berechnungsverfah- ren verbessert die Darstellung in Starkregengefahrenkarten Von Dr. Andreas Buttinger-Kreuzhuber, Dr. Jürgen Waser, Frank Rüsing und Ingo Schwerdorf Starkregenereignisse sind in den letzten Jahren häufiger und renkarten werden eingesetzt, damit Überflutungs-Hotspots intensiver geworden. Dieser Trend wird sich durch den fort- lokalisiert und zukünftige Maßnahmen der wassersensiblen schreitenden Klimawandel weiter fortsetzen. Die katastro- Stadtgestaltung effizient eingesetzt werden können. Zudem phalen Ereignisse in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfa- zeigen sie den Bürger*innen, ob ihr Grundstück gefährdet len vom Juli 2021 zeigen die Zerstörungskraft von extre- ist und bieten ihnen die Möglichkeit, vorzusorgen. So kön- men Niederschlägen. Insbesondere in urban geprägten nen zum Beispiel im Rahmen des Kölner Wasser-Risiko- Großstädten, wie zum Beispiel Köln, haben Starkregenereig- Checks auf Basis der Gefahrenkarten das individuelle Risiko nisse aufgrund der hohen Dichte an Sachwerten ein großes eingeschätzt und geeignete Maßnahmen auf den Weg Schadenspotenzial. Die hohe Versiegelung von Böden im gebracht werden. urbanen Raum führt zu enormen Abflussmengen, die bei Die StEB Köln veröffentlichten bereits im März 2017 extremen Ereignissen nicht alleine durch Abwasseranlagen durch Computersimulationen berechnete Starkregengefah- bewältigt werden können. renkarten online. Köln war damit die erste deutsche Groß- Um die Gefahren von Starkregen und Hochwasser aufzu- stadt, in der dies erfolgte. Die erste Starkregengefahrenkar- zeigen, sind Gefahrenkarten ein wichtiges Informations- und te berücksichtigte die Oberflächenstruktur nur rudimentär, Planungswerkzeug. Genaue und aktuelle Starkregengefah- die Sickerfähigkeit des Bodens wurde vollständig vernach-
13
lässigt. Dies lag unter anderem am Simulationsprogramm, Hinsichtlich der Interzeption werden die Niederschlagsraten
den extremen Datenmengen und der damaligen Computer- aktuell in Abhängigkeit von der Landnutzung vermindert.
technologie. Die Genauigkeit der Berechnungsergebnisse Die Vegetation reduziert am Anfang eines Ereignisses
war dennoch ausreichend, um Gefährdungen darzustellen den effektiv wirksamen Niederschlag. Betrachtet man die
und die Bürger*innen zu informieren und zu sensibilisieren. Außeneinflüsse, so wurden auch Einzugsgebiete außerhalb
Dabei handelte es sich bei den Veröffentlichungen von der Kölner Stadtgrenzen inkludiert. Das zeigt unter anderem
2017 um Worst-Case-Darstellungen. den Einfluss von Hangwasser auf Areale im Stadtgebiet. Es
ermöglicht vor allem in Nähe der Stadtgrenze eine bessere
Abbildung der tatsächlichen Gefährdungslage.
Weiterentwicklung der Berechnungsverfahren und der Zur Berechnung des Niederschlags dienen im aktuellen
Simulationssoftware Modell verschiedene Regenszenarien. Als Beregnungsdauer
wurde eine Stunde angenommen, die Stärke des Regens
Seit 2017 haben sich die Simulationstechnologie und die wurde entsprechend eines 30-jährlichen über einen 50- und
Genauigkeit der erhobenen Daten erheblich verbessert, so 100-jährlichen bis zu einem 200-jährlichen Starkregen ge-
dass auch die Starkregengefahrenkarten weiterentwickelt setzt. Die Abbildung des 200-jährlichen Starkregens basiert
werden konnten. In Zusammenarbeit mit dem Forschungs- auf einer Empfehlung des Hochwasser- und Starkregenau-
zentrum VRVis aus Wien wurde im Mai 2021 eine Stark- dits aus dem Jahr 2020.
regengefahrenkarte erarbeitet und online gestellt, die das
Fließgeschehen an der Oberfläche realitätsnah abbildet.
Während 2017 noch knapp drei Wochen für die Berechnung Visualisierung durch VISDOM
von Starkregengefahrenkarten mit vereinfachten Ansätzen
Standard waren, können nunmehr mit Hilfe der Simulations- Das den dargestellten Entwicklungen zugrunde liegende
software VISDOM komplexe Berechnungen stadtgebietsweit Modell ist als interaktives Projekt in der Software VISDOM
in ein paar Stunden durchgeführt werden. aufgesetzt. Es umfasst die Datenaufnahme einschließlich
Für eine realitätsnahe Abbildung im Modell ist es er- Verarbeitung, Simulation und Visualisierung der Berech-
forderlich, den Weg eines Wassertropfens an der Oberfläche nungsergebnisse und kann fortlaufend um zusätzliche
möglichst genau nachzubilden. Ein vom Himmel fallender Details erweitert werden. In unterschiedlichen Szenarien
Tropfen kann von Bäumen, Sträuchern oder anderer Vege- können Rahmenbedingungen verändert, Eingangsdaten
tation beim Auftreffen auf die Erdoberfläche aufgehalten aktualisiert oder Maßnahmen abgebildet werden. Dabei
werden. Dieser Rückhalt wird als Interzeption bezeichnet. können beispielsweise oberirdische Retentionsbecken erfasst
Die Regentropfen, die es auf die Erdoberfläche schaffen, und deren Effektivität analysiert werden. Hydrologische
sammeln sich und fließen als Regenwasser ab. Dabei wird Randbedingungen können verändert werden, um zurück-
die Fließrichtung des Oberflächenwassers maßgeblich vom liegende Ereignisse nachbilden und deren Auswirkungen
Gelände bestimmt. Ist die Erdoberfläche nicht versiegelt, besser nachvollziehen zu können. Darüber hinaus lassen sich
wird ein Teil des Regenwassers vom Erdboden aufgenom- auch historische Niederschlagsdaten einspeisen und Durch-
men, es infiltriert ins Grundwasser. flüsse an Pegeln abgleichen. Die Oberfläche des Programms
In VISDOM werden die genannten hydrologischen Prozes- bietet eine 3D-Visualisierung der entscheidungsrelevanten
se Niederschlag, Interzeption und Infiltration einbezogen. Fließeigenschaften des Wassers. Mit VISDOM können die
Konkret wurde das Modell seit 2017 sowohl in punkto Versi- Starkregengefahrenkarten perspektivisch noch weiter opti-
ckerung als auch hinsichtlich der Interzeption, der Außenein- miert werden. Zeigen sie derzeit den Oberflächenabfluss
flüsse und der Niederschlagsberechnung verbessert. So wird ohne Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit der Kanalisa-
die Versickerung von Oberflächenwasser aktuell nach dem tion, so sollen künftig stadtgebietsweit mit dem Kanalnetz
Modell von Green-Ampt infiltriert. Dabei hängen die Infilt- gekoppelte Berechnungen durchgeführt werden.
rationsparameter von der Bodenbeschaffenheit ab, sie sind
daher räumlich variabel. Gesetzt wurden sie auf Basis der
Bodenkarten BK50 und der ALKIS Landnutzung. Auffallend Mehr Sicherheit durch mehr Szenarien
ist, dass es keine Versickerung auf versiegelten Flächen gibt.
Zu Beginn eines Ereignisses hängt die Versickerungsrate im Ein kritischer Punkt bei der Berechnung und Erstellung von
Wesentlichen von der Vorfeuchte des Bodens ab. Starkregengefahrenkarten sind die zugrunde liegenden Para-
meter in den hydrologischen Randbedingungen. Starkregen-Abb. 1: 3D-Visualisierung eines simulierten Starkregenereignisses. Die Einfärbung der Dächer gibt die Gefährdung der einzelnen Gebäude an. Quelle: StEB Köln/VRvis Wien ereignisse können in ihrer Dauer beträchtlich variieren: von ne flächendeckend gemessenen Daten in Bezug auf die Ver- deutlich weniger als einer Stunde bis zu mehreren Tagen. sickerungsraten und die Vorfeuchte im Boden. Diese hängen Auch der genaue Niederschlagsverlauf während eines Er- stark vom Wetter der vorherigen Tage ab. Im aktuellen Mo- eignisses sowie dessen räumliche Ausdehnung spielen eine dell basieren die Infiltrationsparameter auf der Bodenkarte nicht unwesentliche Rolle. In der Gefährdungsanalyse wird des Landes Nordrhein-Westfalen, sie wurden für die der dies nur approximativ angesetzt. Das Berechnungsmodell, Starkregengefahrenkarte zugrunde liegenden Berechnungen das für die aktuelle Erstellung der Starkregengefahrenkarte sogar noch um einen Sicherheitsfaktor reduziert. Dieses herangezogen wurde, legt den Fokus auf kürzere Starkregen- Vorgehen wurde gewählt, um die Versickerungsleistung des ereignisse. Bodens nicht zu überschätzen. Die Infiltrationsparameter Im Ergebnis führt die unterschiedliche Dynamik von bedürfen unbedingt einer kontinuierlichen Überprüfung und kurzen und langen Regenereignissen zu unterschiedlichen Adjustierung, um die Konsistenz der Simulation mit tatsäch- Gefährdungen. Während kurze, intensive Niederschläge lichen Beobachtungen langfristig sicherstellen zu können. vor allem bei stark versiegelten Flächen extreme Abflüsse Perspektivisch ist geplant, Ensemblesimulationen einzu- mit sich bringen, spielen bei länger andauerndem Stark- setzen, um die hohe Variabilität in den Randbedingungen regen die Versickerung und die Sättigung des Bodens eine noch genauer erfassen und abbilden zu können. Diese be- wichtige Rolle. Vor allem in den grünen Außenbezirken mit stehen aus einer Vielzahl von Simulationen mit unterschied- einem geringen Versiegelungsgrad hat die Versickerung sehr lichen Eingangsparametern. Im Ergebnis zeigen sie die am großen Einfluss. Hier kann es auch zu einem vermehrten wahrscheinlichsten auftretende Überflutungsgefährdung Wiederaustritt von Sickerwasser an Quellen und Bächen und einen Schwankungsbereich, der es ermöglicht, auch Un- kommen. Vor diesem Hintergrund soll in Zukunft auch der sicherheiten zu benennen. Rückfluss von Grundwasser an der Oberfläche modelliert werden können. Die Auswahl der konkreten Infiltrationsparameter kann nur näherungsweise abgeschätzt werden. Meist gibt es kei-
15
Ein gutes Werkzeug zur Unterstützung, Information und Hauses und an den Grundstücksgrenzen abgerufen werden,
Sensibilisierung so dass die Bürger*innen sich rasch ein Bild über eventuelle
Gefahren machen und gegebenenfalls Gegenmaßnahmen
Seit der Bereitstellung der Starkregengefahrenkarten im einleiten können. Die Anzeige von Wasserständen an der
Jahr 2017 und der Hochwasserkatastrophe des Sommers Fassade des Hauses rundet das Angebot ab.
2021 wächst bei den Nutzer*innen der Anspruch an die
Genauigkeit entsprechender Instrumente. Die Frage ist, wie
künftig eine Gefährdung durch Starkregen dargestellt wer- Auf dem Weg zu einer wassersensiblen Stadtgestaltung
den soll. Dabei reicht es sicherlich nicht aus, Gefährdungen
für Wiederkehrzeiten von 30, 50, 100 oder gar 200 Jahren Der Einsatz von VISDOM erfolgt bislang ausschließlich bei
mit jeweils einer Stunde Regendauer online bereitzustellen, VRVis in Wien. Anfang 2022 wurde ein Server bei den StEB
wenn die Natur uns immer wieder mit einer neuen Varianz Köln installiert. Derzeit werden die Mitarbeitenden geschult,
tatsächlicher Starkregen konfrontiert. Hierzu bedarf es einer um künftig großräumig Überflutungssimulationen erstellen,
klaren Kommunikation, was die Karten darstellen und wie Maßnahmen an der Oberfläche planen und deren Wirksam-
sie erstellt wurden. Durch den Einsatz von VISDOM ergeben keit prüfen zu können. Mit dem Einsatz von VISDOM wird
sich zusätzliche, vor allem visuelle Möglichkeiten, die einen eine weitere planerische Grundlage zur wasserwirtschaftli-
wichtigen Beitrag zur Information und Sensibilisierung der chen Klimafolgenanpassung für Köln geschaffen.
Zielgruppen leisten. Der Vergleich der berechneten Starkregenszenarien mit
Dabei sollen Simulationsensembles mit variierenden tatsächlichen Ereignissen wie dem Starkregen vom Juli
Intensitäten und Regendauern einem eingeschränkten 2021 bietet eine Vielzahl von Chancen und Möglichkeiten.
Nutzerkreis zur Verfügung gestellt werden. So könnte zum Einerseits kann festgestellt werden, ob sich die Annahmen
Beispiel die Feuerwehr die Wettervorhersage mit den vorab bezüglich der gewählten Niederschlags- und Infiltrations-
berechneten Simulationsresultaten vergleichen, die Be- parameter in den tatsächlichen Ereignissen wiederfinden
rechnungsergebnisse könnten zur Vorhersage einer voraus- oder die Ansätze verändert werden müssen. Reale Ereignisse
können auf Trends hinsichtlich räumlicher Ausdehnung,
Niederschlagsdauer oder Intensität untersucht werden.
Andererseits können problematische Regionen, in denen es
zu einer Über- oder Unterschätzung der Gefährdung im
Vergleich zur Simulation kommt, im Detail betrachtet und
genauer analysiert werden. Variable Parameter und Rah-
menbedingungen können in einer Vielzahl von Szenarien
getestet werden, um die Genauigkeit des Modells in Zukunft
weiter zu erhöhen.
Abb. 2: 3D-Visualisierung von Wasserständen eines simulierten Stark-
regenereignisses, Quelle: StEB Köln/VRvis Wien
sichtlichen und näherungsweise entstehenden Lage genutzt
werden. Langfristig ist es sinnvoll, Vorhersageszenarien auf
der Grundlage von Starkregenberechnungen zu erstellen,
um rechtzeitig vor nahenden Gefahren warnen zu können.
Darüber hinaus wird an einer öffentlich zugänglichen On-
line-Plattform gearbeitet, um den Bürger*innen eine objekt-
zentrierte 3D-Darstellung anbieten zu können. In dieser
werden relevante Informationen personalisiert angezeigt.
So kann nach Eingabe einer Adresse auf das entsprechen-
de Haus und Grundstück gezoomt werden. Hierzu können
Informationen über die relevanten Fließwege in Nähe desDie wassersensible Stadt Erfahrungen in der Analyse potenzieller multifunktionaler Flächen Von Dr. Maria Ceylan und Lea Steyer Welche Zerstörungskraft heftige Niederschläge und die Prinzip multifunktionaler Flächen zur Überflutungsvorsorge daraus resultierenden, wild abfließenden Wassermassen sieht vor, vor allem öffentliche Freiflächen — beispielsweise entwickeln können, zeigte sich im Sommer 2021 in bis- Plätze, Parkflächen, Grünanlagen oder Straßen — neben lang beispiellosem Ausmaß. Auch wenn die Dimension des ihrer eigentlichen Hauptfunktion bei Starkregen temporär Starkregenereignisses vom 14. Juli in Köln vergleichsweise und gezielt als (Not-)Speicherraum oder Ableitungselement gering war, kam es auch hier vielerorts zu Überflutungen, zu nutzen. Die ersten multifunktionalen Flächen werden von denen zahlreiche Anwohner*innen und Einrichtungen von den StEB Köln 2022 in Köln-Porz gemeinsam mit dem betroffen waren. Somit wurde erneut deutlich, mit welchen Stadtplanungsamt sowie den städtischen Ämtern für Stra- Auswirkungen und Schäden durch Starkregen in dicht ßen- und Verkehrsentwicklung, Kinder, Jugend und Familie, besiedelten und teilweise stark versiegelten Bereichen zu Stadtentwicklung und Statistik sowie Landschaftspflege und rechnen ist. Grünflächen errichtet. Dabei muss der Um- und Neubau ent- Um Überflutungen und damit verbundene Schäden zu sprechender öffentlicher Flächen gemeinsam erfolgen, um minimieren, müssen insbesondere in urbanen Gebieten, in Köln resilienter gegenüber Starkregen zu machen. denen Regenwasser vornehmlich über die Kanalisation der Vor diesem Hintergrund ist es notwendig, überflutungs- Kläranlage zugeleitet wird und Versickerungsprozesse nur gefährdete Bereiche mit geeigneten Flächen zur multifunk- eine untergeordnete Rolle spielen, gezielt Freiräume zur tionalen Nutzung zusammenzuführen. Konkret stellt sich Speicherung von Regenwasser vorgehalten werden. Das die Frage, wo derartige Flächen durch gezielte Zuleitung
17
Abb. 1: Exemplarische Darstellung der Ergebnisse der GIS-Analyse
oder Speicherung oberflächiger Abflüsse Überflutungs- eine Überflutungstiefe von mindestens 30 Zentimetern auf,
schwerpunkte im Siedlungsbereich entschärfen können. Um wobei kein ausreichender Abstand zu Gebäuden und sensib-
diese Potenziale für die Starkregenvorsorge zu identifizieren, len Objekten vorhanden ist.
haben die StEB Köln eine stadtgebietsweite Flächenanalyse Insgesamt wurden 253 Überflutungsflächen identifiziert.
zur Ermittlung multifunktionaler Potenzialflächen durchge- Zur Ermittlung multifunktional nutzbarer Areale wurden
führt. nachfolgend die Auswahlkriterien der Arbeitshilfe des
interdisziplinären Forschungs- und Entwicklungsprojektes
MURIEL (Multifunktionale urbane Retentionsräume — von
Die Ergebnisse der Flächenanalyse der Idee zur Realisierung) herangezogen. Demnach gelten
öffentliche Flächen beziehungsweise Grundstücke im Eigen-
Eine wichtige Grundlage ist dabei die Identifizierung kriti- tum der Stadt Köln aus administrativer Sicht als grund-
scher Überflutungsschwerpunkte. Die Starkregengefahren- sätzlich geeignet. Hinsichtlich der funktionalen Aspekte
karte der StEB Köln (s. auch Beitrag auf S. 4 ff.) gibt Aus- kommen insbesondere Sport- und Quartiersplätze sowie
kunft über die Starkregengefährdung und damit über die Freiflächen, Grünflächen und Parks in Frage. Kategorisch
Lage und die Ausdehnung von Überflutungsflächen auf wurden Friedhöfe, Gewässer oder Gebäude, die keine multi-
dem Kölner Stadtgebiet. Besonderes Augenmerk gilt hier funktionale Nutzung erlauben, aus dem Flächenpool ent-
Überflutungsflächen, die durch ihre Flächenausdehnung fernt. Die gesammelten Daten wurden so aufbereitet, dass
und Überflutungstiefe einen großen Bereich der angren- jedes Flächenelement eindeutige Eigentumsverhältnisse
zenden Siedlungsstruktur tangieren, sogenannte ›Überflu- und Nutzungsarten aufweist. Flächen im städtischen Eigen-
tungshotspots‹. Die Ermittlung derartiger Flächen erfolgte tum und mit zutreffender Nutzung gemäß MURIEL wurden
automatisiert mittels einer GIS-basierten Abfrage anhand weiter untersucht. Neben den oben genannten Kriterien
folgender Parameter: Es handelt sich um eine städtische spielte dabei auch die räumliche Nähe der multifunktional
Fläche, die größer als 2000 Quadratmeter ist. Diese weist nutzbaren Potenzialflächen zu den im ersten Schritt ermittel-18
ten Überflutungsflächen eine Rolle. Als potenziell geeignet
gelten Flächen mit einem Abstand im Radius von weniger
als 100 Metern.
Die 253 Flächen wurden anschließend im GIS auf ihre
Plausibilität untersucht, um etwaige Fehler der automati-
siert generierten Ergebnisse zu korrigieren. Unter Betrach-
tung der Topographie und der Fließwege wurde eine erste
qualitative Bewertung vorgenommen und in Steckbriefe
überführt. Das Ergebnis der GIS-Analyse ist exemplarisch in
Abbildung 1 dargestellt. Im Hintergrund veranschaulicht die
Starkregengefahrenkarte durch unterschiedliche Blautöne
die maximalen Überflutungstiefen für ein 100-jährliches Er-
eignis. Die türkis eingefärbten Flächenumrandungen zeigen
die Überflutungsflächen mit besonderer Gefährdung, die
städtischen Flächen sind in rot gekennzeichnet. Die schraf-
fierten Flächen eignen sich als potenzielle Flächen für eine
multifunktionale Nutzung.
Dabei können die Überflutungsflächen in drei Hand- Abb. 2: Integration der Ergebnisse in das stadtinterne GIS
lungsgruppen unterteilt werden.
• Gruppe 1 umfasst Überflutungsflächen auf einem
Areal, das aktuell bereits als mögliche Retentionsfläche nutzbaren Flächen die Überflutungsgefährdung in Köln
ausgewiesen ist. Diese sollten im Sinne einer ganzheit- zu reduzieren. Auf diese Art und Weise sollen gleichzeitig
lichen Überflutungsvorsorge in ihrer derzeitigen Nutzung Elemente der wassersensiblen Stadtgestaltung etabliert und
erhalten werden. Zusätzlich gilt es zu prüfen, ob eine die Möglichkeiten der wasserwirtschaftlichen Klimafolgen-
Erweiterung der Retentionsfläche zu einer Optimierung anpassung verbessert werden.
der Überflutungssituation beitragen kann. Gemäß ihres Namens sind multifunktionale Flächen mit
• Zur zweiten Gruppe zählen Überflutungsflächen, die unterschiedlichen Funktionen belegt. Das bedeutet, dass
nicht direkt auf einer potenziell geeigneten Retentions- ein Abstimmungsprozess mit den beteiligten Akteur*innen
fläche liegen. Sie verfügen im Umkreis von 500 Metern notwendig ist, um individuelle Fragestellungen zur Flächen-
aber über Flächen, die durch eine topographische An- nutzung und -gestaltung sowie Vereinbarungen zu Themen
passung und der damit einhergehenden Veränderung wie Unterhaltung und Verkehrssicherung zu diskutieren.
oberirdischer Fließwege die Überflutungsgefahr vermin- Der Prozess der Stadtentwicklung sowie die Planung und
dern könnten. Sanierung von Infrastrukturen bieten eine gute Gelegenheit,
• Gruppe 3 beinhaltet Flächen, auf denen keine Retention um das Thema Starkregenrisikomanagement mitzudenken
oberirdischer Abflüsse möglich ist. Hier sollten jedoch und voranzubringen. Die GIS-basierte Analyse zu potenziel-
andere Maßnahmen zur Minderung der Überflutungs- len Flächen dient dabei als erstes Screening. Eine Konkreti-
gefahr in Betracht gezogen werden, vor allem in punkto sierung durch Vor-Ort-Begehungen und weitere technische
Objektschutz. Analysen ist unabdingbar. Da sich beispielsweise die Bebau-
ung mit der Zeit verändern kann, sollten die durchgeführten
Analysen mittelfristig mit aktualisierten Daten wiederholt
Beitrag zur wassersensiblen Stadtgestaltung werden.
Aktuell werden die Potenzialkarten zum Teil bereits in
Die Ergebnisse der Flächenanalyse wurden in das stadt- den Planungen der städtischen Fachämter berücksichtigt.
interne GIS implementiert (siehe Abb. 2). Mit Hilfe dieser In einigen Bereichen bedarf es jedoch noch der entspre-
Information kann eine Einschätzung vorgenommen werden, chenden Sensibilisierung. Darüber hinaus dienen die Karten
inwieweit die Integration einer multifunktionalen Fläche auch als Grundlage für die Planungen der StEB Köln zur
für ein bestimmtes Planungsgebiet in Frage kommt oder Reduzierung des Überflutungsrisikos. Für die nächsten Jahre
ob eine zu erhaltende Retentionsfläche innerhalb eines ist der Ausbau weiterer öffentlicher Flächen als multifunktio-
Planungsgebietes liegt. Ziel ist es, durch die Bereitstellung nales Areal geplant.
von Planungsinformationen zu potenziell multifunktionellBlau, Grün, Grau! Klimafolgenangepasste Quartiersentwicklung im Bestand — Planungs- prozesse in Kölner Klimahotspots Von Dr. Maria Ceylan, Ingo Schwerdorf und Lea Steyer Die Bewältigung der prognostizierten klimatischen Verän- die den natürlichen Wasserhaushalt fördern und das lokale derungen und daraus resultierender Wetterextreme ist eine Klima begünstigen. gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Daraus ergibt Um dies zu leisten, ist die Verknüpfung von blauen, sich die Notwendigkeit einer umfassenden, konzeptionellen grünen und grauen Infrastrukturen erforderlich, die Wasser Herangehensweise, die im urbanen Umfeld den Prozessen verdunsten, nutzen, versickern, reinigen oder zwischenspei- und Funktionen des natürlichen Wasserkreislaufs ausrei- chern. Eine Stadt, die sich in ihrer strategischen Ausrichtung chend Platz einräumt. an diesem Leitgedanken orientiert, bezeichnet man als Die Wege des Regenwassers in unseren Städten lassen »Schwammstadt«. Die StEB Köln haben 2020 ein Strategie- sich vielfältig und bereits frühzeitig auf verschiedenen Ebe- konzept zur Wasserwirtschaftlichen Klimafolgenanpassung nen abkoppeln. Wichtig dabei ist: Regenwasser darf nicht für Köln erarbeitet. Damit wird Köln zur »Schwammstadt«. länger nur unterirdisch kanalisiert und abgeleitet werden. Nunmehr gilt es, blau-grün-graue Infrastrukturen umzuset- Den befestigten und unbefestigten Oberflächen im urba- zen, um eine Resistenz gegenüber den Auswirkungen der nen Raum müssen neue Funktionen zugewiesen werden, Klimafolgen zu schaffen. sie müssen mit Nutzungsansprüchen kombiniert werden,
20
Blaue, grüne und graue Infrastrukturen gelaufen und umfasste Konzepte zur urbanen Regenwasser-
bewirtschaftung sowie Abwassersysteme. Aktuell wurde
• »Blaue Infrastrukturen« sind Wasserinfrastrukturen mit ein zwei- bis dreistufiges, interdisziplinäres Workshopver-
sichtbarem Blau. Dies können neben natürlichen Ge- fahren erarbeitet, durch das für die beiden Fokusgebiete
wässern auch künstliche, neu angelegte Teiche, Gerinne umsetzbare Bausteine der »Schwammstadt« gefunden und
oder Wasserspiele sein. ausgearbeitet werden sollen. Dabei geht es auch darum, die
• Als »Grüne Infrastrukturen« gelten Maßnahmen der benötigte Akzeptanz zu erreichen. Für die Durchführung der
Wasserinfrastruktur mit sichtbarem Grün — zum Beispiel Workshops war es daher von großer Bedeutung, Akteur*in-
unversiegelte und begrünte Freiflächen, Bauwerksbegrü- nen aus allen beteiligten Fachdienststellen zusammenzu-
nungen und Versickerungsmulden. bringen. So nahmen Mitarbeiter*innen des städtischen
• »Graue Infrastrukturen« umfassen technische Wasser- Grünflächenamtes, des Stadtplanungsamtes und der Ämter
infrastrukturen sowie stauraumschaffende und reinigen- für Straßen und Verkehrsentwicklung, Kinderinteressen und
de Anlagen der Abwasserentsorgung — zum Beispiel Jugendförderung sowie Umwelt und Verbraucherschutz teil.
Stauraumkanäle oder Retentionsbodenfilter, Systeme der Hinzu kamen Vertreter*innen der RheinEnergie AG, der
Betriebswassernutzung und unterirdische Versickerungs- GAG Immobilien AG und der StEB Köln. Sie alle verstehen
systeme. die Grundlagensammlung als kontinuierlichen Prozess. So
Eine Maßnahme des Strategiekonzeptes zur Wasserwirt- wurde hinsichtlich der Überflutungssicherheit beispiels-
schaftlichen Klimafolgenanpassung ist die Schaffung von weise die aus dem Hochwasserschutz bekannte Risiko- und
resistenten und resilienten Quartieren im Neubau und im Schadenspotenzialanalyse angewendet, deren Ergebnisse
Bestand. Bei neuen Bauvorhaben, insbesondere neuen Bau- die normativen Überstau- und Überflutungsnachweise für
gebieten, können bereits sehr frühzeitig sinnvolle Maßnah- Extremereignisse ergänzen.
men gefunden werden. Deutlich anspruchsvoller ist die Um- Der erste Workshop diente dazu, grundsätzliche Ideen,
setzung in Bestandsbebauungen. Hier müssen gemeinsam Wünsche und Bedürfnisse zum Schwammstadtkonzept auf-
mit kommunalen Akteur*innen wassersensible Maßnahmen zunehmen sowie die Pilotgebiete kennenzulernen. Corona-
eruiert werden. Diese werden in einem partizipativen Pro- bedingt wurde er digital durchgeführt. In einer interdiszi-
zess erarbeitet, wobei ihre Akzeptanz, Machbarkeit und plinären und interaktiven Arbeitsgruppe erarbeiteten die
Genehmigungsfähigkeit abgewogen und bewertet werden Teilnehmenden Anregungen und Konzepte sowie erste
muss. Prinzipiell sollen sowohl öffentliche als auch private Skizzen und Varianten. Anschließend wurden Potenziale und
Grundstücke und vorhandene Infrastrukturen in die Maß- Defizite direkt auf digitalen Plänen verortet, wobei zugleich
nahmen der wassersensiblen Stadt (blau-grüne Infrastruk- bereits über Maßnahmen und mögliche Hemmnisse disku-
tur) einbezogen werden. Anhand von zwei besonders durch tiert wurde.
Starkregen und Hitze gefährdeten Quartieren, sogenannten Auf dieser Basis wurden Planungsziele für eine nachhal-
Fokusgebieten, wird die Vorgehensweise im Folgenden er- tige und klimaangepasste Quartiersanpassung festgelegt.
läutert. Sie dienen der Entwicklung eines gemeinsamen und von
den relevanten Akteur*innen getragenen Orientierungsrah-
mens, der sowohl übergeordnete städtische als auch lokale
Die Situation in den Fokusgebieten Anforderungen miteinander verbindet und daraus Lösungs-
ansätze ableitet. Zugleich wurde das Potenzial des Standort-
Als Fokusgebiete wurden der Bereich um die Vietorstraße in konzeptes hinsichtlich der festgelegten Ziele abgeschätzt, es
Köln-Kalk und das Pantaleonsviertel in der Kölner Innen- wurden Empfehlungen formuliert, welche Anpassungen zur
stadt definiert. Zur fachlichen Unterstützung erfolgte die Optimierung des Entwurfs noch notwendig sind.
Beauftragung des Planungsbüros Ramboll-Dreiseitl. Im Die sieben Planungsziele unterscheiden nicht-monetäre,
Anschluss an die Grundlagenermittlung und den Aufbau monetäre und prozessorientierte Aspekte. Handelt es sich
eines 3D-Oberflächenmodels für die jeweiligen Fokusgebiete bei nicht-monetären Zielen um die Schaffung multifunktio-
wurden zwei Workshops sowie mehrere bilaterale Abstim- nal nutzbarer Flächen, die Verbesserung der Lebens- und
mungsrunden durchgeführt. Aufenthaltsqualität und die Realisierung einer wassersensi-
Eine am BMBF-Forschungsprojekt KURAS orientierte blen Entwicklung, so geht es bei den monetären vor allem
Vorgehensweise diente der partizipativen Entwicklung darum, dass die Maßnahmen wirksam und umsetzungsfähig
von Gestaltungsoptionen gekoppelter blau-grün-grauer sind und die Kosten für Herstellung, Betrieb und Instand-
Infrastrukturen. KURAS war im Zeitraum 2013 bis 2016 haltung in einem akzeptablen Rahmen liegen. HinsichtlichSie können auch lesen