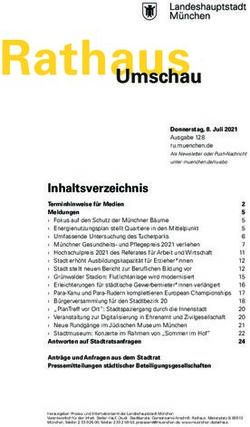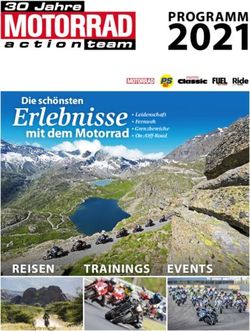Kurs Natur 2030 Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Schleswig-Holstein
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Kurs Natur 2030 Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt in Schleswig-Holstein Kurzfassung Schleswig-Holstein. Der echte Norden.
Abkürzungsverzeichnis
BIK Biologischer Klimaschutz
BNUR Bildungszentrum für Natur, Umwelt und länd-
liche Räume des Landes Schleswig-Holstein
CAU Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
DVL Deutscher Verband für Landschaftspflege
(eingetragener Verein)
EWKG Energiewende- und Klimaschutzgesetz
GAK Gemeinschaftsaufgabe Agrarstruktur und
Küstenschutz (BRD, Länder)
GAP Gemeinsame Agrarpolitik (EU)
GBI Grün-Blaue Infrastruktur
GMSH Gebäudemanagement Schleswig-Holstein
(Anstalt des öffentlichen Rechts)
HNV High nature value (hoher Naturwert)
IQSH Institut für Qualitätsentwicklung an Schulen
Schleswig-Holstein
KAR Kernaktionsräume
KOM Europäische Kommission
LBV Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr
Schleswig-Holstein
LEP Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein
LKN Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark
und Meeresschutz Schleswig-Holstein
LLUR Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und
ländliche Räume des Landes Schleswig-Holstein
MELUND Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft,
Umwelt, Natur und Digitalisierung des Landes
Schleswig-Holstein
MILIG Ministerium für Inneres, ländliche Räume,
Integration und Gleichstellung des Landes
Schleswig-Holstein
MWVATT Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus des Landes
Schleswig-Holstein
MSRL Europäische Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie
NSG Naturschutzgebiet
NUN Norddeutsch und nachhaltig
PSM Pflanzenschutzmittel
S+E Schutz und Entwicklung
SBVS Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem
SHLF Schleswig-Holsteinische Landesforsten
SNSH Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein
THG Treibhausgas
UNB Untere Naturschutzbehörde
VNS Vertragsnaturschutz
WRRL Europäische Wasserrahmenrichtlinie
WTSH Wirtschaftsförderung und Technologietransfer
Schleswig-Holstein GmbH
2Vorwort
Die biologische Vielfalt in Schleswig-Holstein ist über
wiegend in keinem guten Zustand.
Dies ist das Ergebnis nach Bewertung aller vorlie-
genden Daten und Unterlagen. Zwar gibt es im Land
lokale und regionale Ausnahmen dank der Wieder-
herstellung von naturnahen Lebensräumen in unserer
Kulturlandschaft, engagiertem Schutzgebietsmanage-
ment und erfolgreicher Artenschutzprojekte (Seeadler,
Fischotter etc.). Der landesweite negative Trend des
fortschreitenden Arten- und Lebensraumverlustes wird
dadurch jedoch nicht aufgehalten. Dieser Prozess hat
eine erodierende Wirkung auf die Vielfalt, Eigenart
und Schönheit der Natur in Schleswig-Holstein. Damit
verbunden ist zudem der Verlust von wertvollen Öko- Der integrative Prozess setzt weiterhin auf
systemleistungen wie Klima-, Wasser- und Bodenfunk- › eine gezielte Ausrichtung und Flankierung der euro
tionen, die für die zukünftige Entwicklung des Lebens päischen Agrarpolitik (GAP) für eine nachhaltige Land-
und für die gesellschaftlichen Systeme eine existenzielle nutzung und Honorierung ökologischer Leistungen,
Bedeutung haben. › die konsequente Nutzung von Synergien bei der
Die Definition der Biodiversität umfasst die Vielfalt Wiederherstellung von Ökosystemleistungen,
der Ökosysteme und Arten sowie die genetische Vielfalt › eine landesweite „Bildungsinitiative Biodiversität“,
innerhalb der Arten. Ein völkerrechtlicher Vertrag, unter- › auskömmliche Ressourcen für die Umsetzung und
zeichnet und ratifiziert von 196 Vertragsparteien, fixiert das Weiterentwicklung sowie
Übereinkommen über die biologische Vielfalt mit dem › die Etablierung eines Akteursnetzwerks zur Unter
Ziel, die Vielfalt des Lebens auf der Erde zu schützen, zu stützung und Begleitung der Strategie.
erhalten und deren nachhaltige Nutzung so zu organi
sieren, dass möglichst viele Menschen heute und auch Mit diesen Zielsetzungen kann kontinuierlich die
in Zukunft davon leben können. Diese grundlegende Lebensraumqualität für die Arten verbessert, der Biotop-
Zielsetzung ist auch Maßstab für das Handeln der Euro- verbund aktiviert und ein Grün-Blaues Netzwerk für eine
päischen Union, der Bundesrepublik Deutschland und gesicherte Zukunft der Gesellschaft im Einklang mit der
der Bundesländer. Natur in Schleswig-Holstein etabliert werden. Dafür ist
Für Schleswig-Holstein ist das Erreichen der europäi- es notwendig, dass alle gesellschaftlichen Akteur:innen
schen und nationalen Zielvorgaben angesichts des fest- ihre Handlungsoptionen identifizieren, ihre Aktivitäten
gestellten Zustands und der Entwicklung der Natur nicht bündeln und ihre Strategien zum Erhalt der Biodiver-
gesichert. Der notwendige Flächenanteil an natürlichen sität regelmäßig überprüfen. Zusätzlich müssen die
oder renaturierten und ökoeffizient genutzten Flächen zum Erreichen der Zielsetzungen notwendigen struk-
der für den Erhalt der Biodiversität besonders wichtigen turellen, finanziellen und personellen Voraussetzungen
Hauptlebensräume wird nicht erreicht. Darüber hinaus geschaffen werden.
fehlt ein landesweit systemischer Verbund naturnaher öko- Die vorliegende, integrative und sektorenübergreifende
logischer Schlüssellebensräume als Grundvoraussetzung Strategie ist der Schlüssel, mit dem ein Trendstopp und
für den langfristigen Erhalt der biologischen Vielfalt. eine Umkehr bis 2030 gelingen kann.
Die Strategie zum Erhalt der Biologischen Vielfalt in
Schleswig-Holstein – Kurs Natur 2030 – zielt deshalb darauf
ab, die Biodiversität durch einen ganzheitlichen Ansatz zu
erhalten, indem
› Flächenbedarfe erfüllt und deren ökologische Qualitäten
gesichert werden,
› die Fragmentierung der Lebensräume minimiert wird,
› Aufwertungs- und Renaturierungsmaßnahmen einge-
leitet werden und Jan Philipp Albrecht
› der Umkehrprozess mithilfe eines Artenschutzprogramms Minister für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur
flankiert wird. und Digitalisierung des Landes Schleswig-Holstein
3Inhalt 1 Grundlagen und Zielsetzung 5 1.1 Politischer Rahmen 5 1.2 Vision für Schleswig-Holstein 7 1.3 Ökologische Situationsanalyse 8 1.4 Treiber für die Gefährdung der Biodiversität 11 1.5 Biodiversität und Klimawandel 12 1.6 Biodiversität und Küstenschutz 13 2 Netzwerke(n) für den landesweiten Biodiversitätsschutz 14 2.1 Netzwerk Natur 15 2.2 Netzwerk Bildung 40 2.3 Netzwerk Akteur:innen 45 4
1 Grundlagen
und Zielsetzung
Schleswig-Holstein braucht eine umfassende Strategie
zum Erhalt seiner biologischen Vielfalt.
1.1 Politischer Rahmen
Bereits 1992 wurde vor dem Hintergrund des fort- die KOM zusammen mit der Konzeption „Vom Hof auf den
schreitenden Verlusts der biologischen Vielfalt auf dem Tisch“ (Farm to Fork – F2F) – eine Strategie für ein faires,
Umweltgipfel der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro gesundes und umweltfreundliches Lebensmittelsystem2
das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Con- – einen wichtigen Baustein ihres European Green Deals –
vention on Biological Diversity, CBD) verabschiedet. Wie vorgelegt. Wesentliche Inhalte der europäischen Biodiver-
die anderen Vertragsparteien hat sich auch Deutschland sitätsstrategie sind:
im Artikel 6 des Übereinkommens1 verpflichtet, nationale › Ausweisung von Schutzflächen: 30 Prozent der Land-
Strategien, Pläne oder Programme zum Erhalt und zur fläche und der Meeresgebiete sollen unter Schutz
nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt aufzu- gestellt werden, davon jeweils ein Drittel mit strengen
stellen. Im selben Jahr wurde auch die „Klimarahmenkon- Schutzvorschriften.
vention“ verabschiedet. Aufgrund der Synergien, die sich › Wiederherstellung und Renaturierung: Bis 2030 sollen
bei einer gemeinsamen Zielverfolgung ergeben, ist sie für bedeutende Gebiete mit geschädigten und kohlenstoff-
den Biodiversitätsschutz ebenfalls maßgeblich. reichen Ökosystemen wiederhergestellt werden. Lebens-
Das Grundgesetz (Artikel 20a) und die Landesverfas- räume und Arten sollen keine Verschlechterung der
sung Schleswig-Holsteins (Artikel 11) definieren den Schutz Erhaltungstendenzen und des Erhaltungszustands auf-
der natürlichen Lebensgrundlagen als staatliche und kom- weisen und mindestens 30 Prozent dieser Lebensräume
munale Aufgabe. Damit besteht neben einer ethischen und Arten, die sich derzeit nicht in einem günstigen
Verantwortung auch eine rechtliche Vorgabe, die biolo- Zustand befinden, sollen einen günstigen Erhaltungs-
gische Vielfalt zu schützen. Nach den deutlich verfehlten zustand erreichen oder zumindest einen positiven Trend
Zielen der EU-Biodiversitätsstrategie für das Jahr 2020 hat verzeichnen.
die Europäische Kommission (KOM) eine neue Strategie › Landnutzung und Wasserwirtschaft: Der Pflanzenschutz-
vorgelegt, die die Hauptgründe für den Biodiversitätsver- mitteleinsatz soll um 50 Prozent, der Düngemitteleinsatz
lust benennt und diese bis 2030 beseitigen will. Damit hat um 20 Prozent verringert werden. Es sollen Neuwald
5gebildet, Gewässer renaturiert sowie land-, wald- und von Grünland, Mooren und Anmooren werden wir weiter
fischereiwirtschaftliche Nutzungen extensiviert werden. fördern. Das Auenprogramm zur Renaturierung von Auen
› Städte: Bis Ende 2021 sollen Städte mit mehr als 20.000 entlang der prioritären Gewässer werden wir umsetzen.
Einwohner:innen Pläne zur Stadtbegrünung vorlegen. Wir wollen das fast erreichte Ziel von 15 Prozent Vorrang-
Für die Umsetzung des Netzwerkes Natura 2000 und der flächen (derzeit 14,6 Prozent der Landesfläche) in der
EU-weiten grünen Infrastruktur kalkuliert die Kommission kommenden Legislaturperiode einschließlich zwei Prozent
ein Budget von jährlich 20 Milliarden Euro ein. Damit Wildnisgebiete erreichen.“
unterstützt sie die auch vom Bundesrat bestätigte Auf-
fassung, dass der finanzielle Bedarf für einen effektiven Warum ist der Verlust an biologischer Vielfalt für uns
Naturschutz in Deutschland die bisher verfügbaren Mittel so bedeutsam?
um mindestens den Faktor drei übersteigt.3 Daher müssen Eine lebenswerte Umwelt mit einem funktions- und
jetzt sowohl die rechtlichen als auch die budgetären leistungsfähigen Naturhaushalt, sauberem Wasser,
Voraussetzungen geschaffen werden, um die geforderten produktiven Böden, einer guten Artenausstattung und
Maßnahmen für den notwendigen Biodiversitätsschutz zu „funktionierenden Ökosystemen“ ist die Grundlage für
ergreifen. das menschliche Leben, Wohlbefinden und die Erholung
2017 beschloss die Landesregierung Schleswig-Holstein, sowie für die dauerhafte Sicherstellung der Lebensgrund-
eine Strategie zum Erhalt der biologischen Vielfalt aufzu- lagen künftiger Generationen. Daher ist der Schutz der
stellen. Der politische Auftrag zur Umsetzung wurde im „natürlichen Lebensgrundlagen“ im Grundgesetz Deutsch-
Koalitionsvertrag „Das Ziel verbindet“ für die Jahre 2017 lands verankert (Artikel 20a). Der Schutz von Natur und
bis 2022 verankert. Darin fordern die Vertragspartner: Landschaft „auf Grund ihres eigenen Wertes“ ist darüber
innen einen ganzheitlichen und ressortübergreifenden hinaus von erheblicher Bedeutung und daher in Paragraph 1
Ansatz unter Einbindung relevanter Akteur:innen sowie BNatSchG festgelegt.
die Honorierung ökologischer Allgemeinleistungen: Von den natürlichen Prozessen profitiert der Mensch in
„Daher werden wir im Dialog mit relevanten Akteuren vielerlei Hinsicht. Zu diesen Prozessen gehören beispiels-
eine Landesstrategie zur Sicherung der biologischen weise die Reinigung des Niederschlagwassers bis zur
Vielfalt entwickeln. In dieser Strategie wollen wir die Trinkwasserqualität durch den Boden, die Speicherung klima-
bestehenden fachpolitischen Ziele und Maßnahmen zum schutzrelevanter Gase, die Abmilderung der negativen
Schutz der biologischen Vielfalt abteilungs- und ressort- Wirkungen durch den Klimawandel oder die Bestäubung
übergreifend zusammenführen und ergänzen. Den Schutz von Pflanzen durch Insekten. Arten- und Lebensraum-
Das Land Schleswig-Holstein hat bei der Umsetzung seiner Biodiversitätsstrategie „Kurs Natur 2030“ den Anspruch
1. die ressort- und disziplinübergreifende Zusam- 7. standortangepasste und biodiversitätskonforme
menarbeit für den Schutz der Natur im Land zu „ökoeffiziente“ Flächennutzungen zu befördern,
verbessern, 8. Wildnis zuzulassen,
2. querschnittsorientiertes Handeln zu befördern, 9. den gesamtgesellschaftlichen Bildungsauftrag für
bestehende Synergien für den Schutz natürlicher nachhaltige Entwicklung als Investition in die
Ressourcen auszubauen und neue Kooperationen Zukunft zu implementieren,
zu initiieren, 10. Akteur:innen dauerhaft einzubinden, zu vernetzen
3. die Vernetzung von Lebensräumen zu gewähr- und Verantwortung zu übertragen, um das Thema
leisten, indem es den Biotopverbund und die Biodiversität im Land zu verankern,
Grün-Blaue Infrastruktur als zentrale Säule ent- 11. qualitative und quantitative Zielsetzungen zu defi-
wickelt und damit die Basis für den Schutz der nieren und verbindliche Zielhorizonte festzulegen,
Artenvielfalt legt, Evaluierung und ein Berichtswesen einzuführen,
4. den weiteren Verlust an Arten und die Abnahme 12. dazu beizutragen, eine funktions- und leistungs-
von Populationen insbesondere gefährdeter Arten fähige Natur für die Gesundheit und die Erholung
zu stoppen, der Bevölkerung sicherzustellen,
5. Ökosystemfunktionen zu erhalten, wieder 13. die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand zur
herzustellen und dauerhaft zu sichern, um Öko Förderung der Biodiversität auszufüllen und über-
systemleistungen zu gewährleisten, tragbare Modelle zu schaffen,
6. Biodiversität und Klimawandel zusammen zu 14. unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen
„denken“, Synergien und Partnerschaften im Land Möglichkeiten strukturelle, personelle und finanzielle
zu ermitteln und zu bündeln, Voraussetzungen für die Umsetzung zu schaffen.
6vielfalt ermöglichen und stabilisieren dabei die Basis
Abbildung 1 (rechts): Mitwirkung an der Entwicklung der
leistungen der Ökosysteme.
Biodiversitätsstrategie (MELUND 2020)
Wo stehen wir?
Sowohl die für 2010 als auch die für 2020 vereinbarten
Biodiversitätsziele wurden europaweit deutlich verfehlt.
Absehbar werden die gesteckten Ziele bei einem „weiter
so“ auch für 2030 nicht erreicht. Untersuchungsergebnisse
zu Wasserqualitäten und die Folgen des Insektensterbens
zeigen eindrucksvoll die fortschreitenden erheblichen
Beeinträchtigungen der Ökosystemleistungen und
Ressourcen. Ein Umdenken sowie ein konsequentes und
innovatives Handeln von Politik und Gesellschaft sind
daher dringend erforderlich.
1.2 Vision für Schleswig-Holstein
Auf der Grundlage der beschriebenen internationalen
und nationalen Rahmenbedingungen verfolgt Kurs Natur
2030 einen ressortübergreifenden, querschnittsorien-
tierten und integrativen Ansatz.
Alle Inhalte wurden durch eine interdisziplinäre
Projektgruppe unter Beteiligung von derzeit 39 Akteur:-
innen verschiedener Bereiche erstellt und federführend
durch das MELUND entwickelt (Abbildung 1). Die
Strategie basiert auf den erarbeiteten Bausteinen
und leitet aus den Bestands- und Gefährdungs-
bewertungen Ziele, Maßnahmen und Umset-
zungsbedarfe für die übergeordneten Hand-
lungsfelder ab (Abbildung 2).
7Ein Monitoringsystem gewährleistet das Erreichen der Ziele Die in Abbildung 3 dargestellten Visionen, Leitbilder
und die Ableitung möglicher Anpassungsmaßnahmen. Über und Ziele verdeutlichen die angestrebte Situation der
dessen Ergebnisse wird 2026 und 2030 berichtet. biologischen Vielfalt in Schleswig-Holstein.
Abbildung 3: Grundsätze der Biodiversitätsstrategie (MELUND 2020)
1.3 Ökologische Situationsanalyse
1.3.1 Landestypische Lebensräume und
Landschaftswandel
Schleswig-Holstein gliedert sich in vier terrestrische Natur-
räume sowie die Nord- und die Ostsee (Abbildung 4). Es
gehört sowohl der atlantischen als auch der kontinentalen
Region an und bietet mehr als der Hälfte aller in Deutsch-
land lebenden Arten einen Lebensraum. Wie kein anderes
Bundesland ist es durch Wasser geprägt: Küstenlebens-
räume der Nordsee mit dem Wattenmeer und Ostsee
sowie Seen, Flüsse und Moore formen seine typische
Landschaft, die Artenvielfalt und das Klima. Salzwiesen,
Dünenlandschaften, Lagunen und Steilküsten gehören
mit einer kennzeichnenden Artenausstattung ebenso zu
den Landesspezifika wie Wattenmeer, Riffe und die Hoch-
seeinsel Helgoland. Herauszustellen ist der Nationalpark
„Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer“. Als größter Natio-
nalpark Mitteleuropas und Teil des Weltnaturerbes Watten-
Abbildung 4: Naturräume in Schleswig-Holstein (LLUR 2020);
meer ist er eines der wichtigsten Vogelrastgebiete welt- ⬛ Hügelland, ⬛ Vorgeest, ⬛ Geest, ⬛ Marsch, ⬛ Meer
weit. Unter anderem wegen seiner globalen Bedeutung für
8den Erhalt der Biodiversität nahm ihn die UNESCO als Teil Gleichzeitig ist Schleswig-Holstein stark durch die Land-
der „UNESCO-Welterbestätte Wattenmeer“ auf. nutzung geprägt. Zurzeit werden etwa 69 Prozent der ter-
Reste ehemals weitläufiger Moorlandschaften kenn- restrischen Landesfläche in landwirtschaftlich genutzt. Die
zeichnen die großen Niederungen der Geest, wie z. B. die aktuell für die Tier- und Pflanzenvielfalt wertgebenden
Eider-Treene-Sorge-Niederung. Mit etwa neun Prozent Lebensräume wie Knicks, Kleingewässer oder Wertgrün-
der Landesfläche gehört Schleswig-Holstein neben Nie- land sind letzte Überbleibsel einer historischen Land-
dersachen und Mecklenburg-Vorpommern zu den drei nutzung ohne mineralischen Dünger, die aber gleichwohl
moorreichsten Bundesländern. Nur elf Prozent der Landes- nach damaligen Notwendigkeiten und Möglichkeiten
fläche werden hingegen von Wald eingenommen. Da sie maximal betrieben wurde. Trotz der für damalige Verhält-
die Waldarmut Schleswig-Holsteins ein wenig relativieren, nisse starken Nutzung wiesen die großflächigen Heiden
stellen die oft landschaftsbildprägenden Knicks und Feld- und artenreichen Grünländer damals noch eine Vielzahl
hecken wichtige Strukturelemente dar. Das ca. 55.000 von Landschaftselementen wie Kleingewässer und Bruch-
Kilometer lange Knicknetz (einschließlich Feldhecken wälder auf.
ohne Wall) schafft besondere ökologische Standortbe-
dingungen (z. B. Ökotone, siehe Kapitel 2.1.8) und erhöht Schleswig-Holstein – Daten
die Vielfalt der Lebensräume für viele Tier- und Pflanzen- › terrestrische Landesfläche: 15.636 Quadratkilometer
arten in der Kulturlandschaft. Die Fließgewässer mit den › marine Landesfläche: 9.912 Quadratkilometer
anliegenden Auenlandschaften übernehmen Verbund- › Naturräume: (Wattenmeer,) Marsch, Vorgeest, Geest,
funktionen und bilden zusammen mit den zahlreichen Östliches Hügelland
Klein- und Binnengewässern Lebensraum für aquatische › höchste Erhebung: Bungsberg (Holsteinische Schweiz),
und amphibische Lebensgemeinschaften. 167 Meter über Normalnull
› tiefste Stelle (Deutschlands): Neuendorf (Wilster-
marsch), 3,5 Meter unter Normalnull
1.3.2 Zustand der Lebensräume und Arten
in Schleswig-Holstein
Die Auswertung der Monitoringdaten des Landes verdeut-
licht folgende Trends:
Europäisches Netzwerk Natura 2000 der Küstendünen und des Grünlands gekommen. Trotz
Anhand der FFH-Berichte ist eine Rückschau bis in das zum Teil erheblicher Schutzbemühungen und Maßnahmen
Jahr 2001 möglich (Abbildung 5). Aus ihnen ergibt sich, vor allem in den Europäischen Vogelschutzgebieten sind
dass sich der Erhaltungszustand nur bei einzelnen Lebens- viele Wiesenbrüter, wie Kiebitz und Uferschnepfe, aber
raumtypen wie z. B. bei atlantischen Salzwiesen, Strand- auch das Rebhuhn aus vielen Teilen des Landes weitge-
seen und eutrophen Seen verbessert hat. Befinden sich hend verschwunden. Positive Entwicklungen der Bestands-
Flächen bereits im günstigen Erhaltungszustand, stag- und Artenzahlen sind fast ausnahmslos auf Flächen im
nieren sie dort meist auf niedrigem Niveau. Zu Verschlech- Naturschutzeigentum, z. B. von Stiftungen, und auf Ver-
terungen ist es unter anderem bei den Lebensraumtypen tragsnaturschutzflächen zu verzeichnen.4
Abbildung 5: Erhaltungszustand der Lebensraumtypen zu den FFH-Berichtszeitpunkten 2007, 2013 und 2019 in der atlantischen
(ATL) und kontinentalen (KON) Region (LLUR, 2020); ⬛ günstiger Erhaltungszustand, ⬛ ungünstig-unzureichender Erhaltungszustand,
⬛ ungünstig-schlechter Erhaltungszustand, ⬛ keine Bewertung; Ziffern 1-43 = Anzahl Lebensraumtypen
9HNV-Agrar-Umweltindikator in Schleswig-Holstein Intensivierungsschub erfahren haben und die bisherigen
Der bundesweit erhobene High Nature Value (HNV)- Anstrengungen zum Erhalt der biologischen Vielfalt in
Farmland-Indikator zeigt den Anteil von Wertbiotopen der Landwirtschaft nicht ausreichen, um eine Trendwende
innerhalb der landwirtschaftlich genutzten Flächen an. Bis zu erreichen. Mit einem HNV-Anteil von 8,3 Prozent liegt
2015 sollte dieser auf 19 Prozent der Agrarflächen gestei- Schleswig-Holstein (Stand 2019) darüber hinaus deutlich
gert werden. Obwohl das Ziel weiterhin besteht, zeigen unter dem immer noch zu niedrigen Bundesdurchschnitt
die Kartierungsergebnisse in Schleswig-Holstein, dass von 11,6 Prozent (Abbildung 6).
die Nutzflächen stattdessen in den letzten Jahren einen
Abbildung 6: Anteil der Landwirtschaftsflächen mit hohem Naturwert an der Agrarlandschaftsfläche (LLUR/BfN 2020);
⬛ Wert I äußerst hoch, ⬛ Wert II sehr hoch, ⬛ Wert III mäßig hoch
Rote Listen Zielsetzungen
Knapp 1.000 Arten gelten in Schleswig-Holstein als aus- Biodiversitätsschutz braucht konkrete Zielsetzungen. Für
gestorben oder verschollen und fast die Hälfte der in die Entwicklung der Lebensräume wurden qualitative
den Roten Listen Schleswig-Holsteins bewerteten Taxa ist und quantitative Ziele ermittelt. Diese wurden im Rahmen
mittlerweile mindestens gefährdet. Besonders ausgeprägt der Landesstrategie auf Basis von FFH-Monitoring- und
sind die Rückgänge bei den Insekten und bei den Arten Berichtsdaten erarbeitet. Zunächst wurde festgestellt,
der Agrarlandschaft. Auch bei den heimischen Süß- welcher Defizitausgleich notwendig ist, um die von der EU
wasserfischarten zeichnet sich in Schleswig-Holstein ein geforderten Flächenanteile und günstigen Erhaltungszu-
negativer Trend ab. Von den 45 Süßwasserfischarten in den stände erreichen zu können. Es folgte eine fachgutachter-
schleswig-holsteinischen Seen, Flüssen und Bächen gelten liche Expertise, auf welchem Anteil dieser terrestrischen
gegenwärtig 24 Arten als mehr oder minder gefährdet. Im oder aquatischen Flächen bis 2030 durch Maßnahmen
marinen Bereich Schleswig-Holsteins sind ebenfalls ver- die Voraussetzungen für eine Zielerreichung geschaffen
schiedene Arten weitgehend verschwunden. Dies betrifft werden können. Die Ergebnisse, auf denen die weitere
z. B. riffbildende Arten wie den Borstenwurm Sabellaria, Maßnahmenplanung basiert, sind als lebensraumspezifi-
das Seemoos und die Europäische Auster (Abbildung 7). sche Ziele tabellarisch zusammengefasst (Kapitel 2.1.3 ff.).
Nach Auswertung der Monitoringdaten ist für den
Großteil der Arten und Lebensräume Schleswig-
Holsteins eine fortwährende sowie zum Teil erhebliche
und ungebremste Verschlechterung festzustellen.
10Abbildung 7: Übersicht über die Anteile der gefährdeten Arten (RL: 0,1,2,3 und „R“) in den für Schleswig-Holstein bewerteten
Artengruppen (insgesamt ca. 14.000 Arten, darunter endemische Brombeerarten5) (LLUR 2020)
1.4 Treiber für die Gefährdung der Biodiversität
Die Gründe für den Rückgang der Artenvielfalt sind multi- › Infolge fehlender Pufferflächen und Verbundstrukturen
kausal und in ihrer Wirkung häufig vielfältig. Dennoch mangelt es den Schutzgebieten an Wirkung. Mangelnde
lassen sich die maßgeblichen Ursachen für die Beeinträch- Pflege – auch infolge fehlender oder unzureichender
tigung der Biodiversität klar benennen. Umsetzung der Pflegemaßnahmen in den Schutz-
› Die Nutzungsintensivierung in der Landwirtschaft hat in gebieten – sowie die Nutzungsaufgabe (wirtschaftlich
den letzten Jahrzehnten zum Verlust vieler Lebensräume unattraktiver Flächen) verändern die vorkommenden
gefährdeter (ehemals zahlreicher) Arten geführt. Der Lebensräume.
Einsatz von Pflanzenschutzmitteln (PSM), insbesondere › Die Intensität der Meeresnutzung (z. B. grundberüh-
von Insektiziden, und die Störung der Stoffkreisläufe rende Fischerei, Schifffahrt, Gewinnung von Ressourcen,
(Stoffeinträge) in Form von überhöhten Nährstoffein- Tourismus), überhöhte Nährstoff-, Schadstoff- und Müll-
trägen vorwiegend in der Landnutzung, jedoch auch einträge, Unterwasserlärm, Verbau von Küsten, das Ein-
durch Privatpersonen und den Straßenverkehr, wirkt schleppen nicht heimischer Arten und nicht zuletzt der
negativ auf die dort lebenden Artengemeinschaften Klimawandel führen zu hohen Belastungen der Meere
(z. B. Insektensterben) und Ökosysteme. und ihrer Artengemeinschaften.
› Die Entwässerung, insbesondere organogener und › Regionale Klimaschwankungen, die über lange Zeit-
grundwassergeprägter Standorte, führt zu einer erhebli- räume stattfinden, sind Teil des natürlichen Erdsystems.
chen Veränderung des Landschaftswasserhaushaltes und Der seit der Industrialisierung anthropogen verursachte
Beeinträchtigung amphibischer Lebensraumtypen. Dazu Klimwandel führt jedoch global zu deutlich schnelleren
führen Veränderungen von Hydrologie und Morpho- und stärkeren Veränderungen, mit denen viele Öko
logie an Gewässern unter anderem zu Einschränkungen systeme und Artengruppen nicht Schritt halten können.
der Durchgängigkeit der Gewässer und damit zum Ver-
lust von speziellen Habitaten und den daran angepassten Der Erfolg der Biodiversitätsstrategie hängt
Arten. immanent von der gleichzeitigen Reduktion
› Die Versiegelung und Zerschneidung von Flächen in der maßgeblicher Belastungsfaktoren ab.
Landschaft führen zum Verlust der Bodenfunktionen, zu
einer erheblichen Beeinträchtigung zahlreicher Lebens-
räume und Ökosystemfunktionen sowie zur Verinselung
der Lebensräume.
111.5 Biodiversität und Klimawandel
Betrachtet man die vergangenen 30 Jahre, sind auch in Moore, Moorwälder, Sümpfe, nasses bis feuchtes Grün-
Schleswig-Holstein bereits sichtbare Folgen des Klima- land, Salzwiesen und Seegraswiesen, aber auch minera-
wandels eingetreten, die sich auf Tiere, Pflanzen und lisches Dauergrünland und naturnahe Wälder sowie die
Lebensräume auswirken. Ein Vergleich des aktuellen Meere stellen große Kohlenstoffdepots dar und dienen
Klimazustandes (1986 bis 2015) mit dem Vergleichs- als Senke für das Treibhausgas CO2. Durch Entwässerung
zeitraum 1961 bis 1990 zeigt in Schleswig-Holstein eine werden die gespeicherten Kohlenstoffvorräte in Mooren
Erwärmung um etwa 0,7 °C. freigesetzt und belasten das Klima. In Deutschland sind
Auf Grundlage regionaler Klimamodelle des Nord- mehr als 95 Prozent der ehemaligen Moorflächen entwässert
deutschen Klimabüros ist bis 2100 sogar mit einer mitt- und stellen damit signifikante Quellen für Treibhausgase
leren Erwärmung um 2,9 °C zu rechnen. Damit steigt die dar. Die entwässerten M oorböden in Schleswig-Holstein
Gefahr von Hitzewellen mit Tagestemperaturen von mehr emittieren jährlich schätzungsweise mehr als drei Millionen
als 30 °C und Tropennächten mit mehr als 20 °C signifikant. Tonnen CO2-Äquivalente.
Eis- und Frosttage werden im Winter weiter abnehmen.
Für Schleswig-Holstein als Land zwischen den Der Schutz funktions- und leistungsfähiger Moore,
Meeren sind auch die Veränderungen des Meeresspie- die Wiedervernässung von Moorböden und Feucht-
gels von großer Bedeutung. An der Ostseeküste stieg wäldern sowie die Neuwaldbildung sind effektive
der mittlere Meeresspiegel im letzten Jahrhundert um und volkswirtschaftlich effiziente Klimaschutzmaß-
etwa 15 Zentimeter, an der deutschen Nordseeküste um nahmen mit erheblichem CO2-Reduktionspotenzial für
etwa 20 Zentimeter an. Starkregenereignisse wie auch Schleswig-Holstein. Zugleich profitiert die Biodiversität!
andauernde Trockenperioden haben in den letzten
Jahren deutlich zugenommen. Weitere Ausführungen zu Klimafolgenanpassung der Natur
den bereits messbaren Auswirkungen des Klimawandels Im Zuge der Klimawandelanpassung gilt es vor allem,
und Prognosen für zukünftige klimatische Veränderungen einen möglichst natürlichen Landschaftswasserhaushalt
sind dem Klimareport Schleswig-Holstein6 zu entnehmen. mit seinen Pufferfunktionen wiederherzustellen. Mit
Diese direkten, aber auch die indirekten Folgen des steigendem Meeresspiegel, zunehmenden Winternieder-
Klimawandels erfordern die konsequente Förderung der schlägen und starker Sommertrockenheit spielt der Was-
Anpassungsfähigkeit aller biologischen Systeme. serrückhalt in der Fläche eine immer größere Rolle. Eine
Mit Blick auf die zu erwartenden Auswirkungen des Möglichkeit, die sowohl dem Hochwasserschutz als auch
Klimawandels ist die Anpassungsfähigkeit der Meeres- dem Naturschutz dient, besteht darin, den Flüssen und
und Küstenökosysteme zu steigern. Handlungsoptionen ihren Auen wieder mehr Raum zu geben und Hochwasser
für das vom Meeresspiegelanstieg potenziell besonders auf diese Weise dezentral abzupuffern.
betroffene Wattenmeer wurden in einer „Strategie für das Wälder sind in Schleswig-Holstein enorm wichtig für
Wattenmeer 2100“ aufgezeigt. das lokale und regionale Klima. Sie machen die Ober-
fläche rauer und verringern die Windgeschwindigkeit.
Arten und Lebensräume im Klimawandel Durch ihre kühlende Funktion sind Wälder, Knicks und
Naturnahe Ökosysteme sind komplexe und vernetzte sonstige Grünflächen besonders wertvoll für das Mikro-
Systeme. Die an sie angepassten Arten sind nur in aus- klima und damit für das menschliche Wohlbefinden. Insbe-
reichend großen Populationen und im Verbund über- sondere lange Dürreperioden und Stürme machen Wälder
lebensfähig. Komplette Anpassungen der Arten an sich anfälliger für Brände und Schadorganismen. Ein natürlicher
verändernde Lebensbedingungen erfolgen jedoch nor- Wasserhaushalt ist daher eine der wichtigsten Grundlagen
malerweise über lange Zeiträume. Diese sind im Kontext zur Verbesserung der Resilienz von Waldökosystemen. Ihre
eines Klimawandels, der voranschreitet wie bisher, nicht Anpassungsfähigkeit erhöht sich unter anderem durch die
mehr gegeben. Der Schutz von Ökosystemen kann dazu Möglichkeit des genetischen Austauschs und der natür-
beitragen, klimatische Veränderungen zu verlangsamen lichen Verjüngung.
und somit Arten die Möglichkeit geben, Schritt zu halten.
Ein System verbundener, naturnaher Lebensraum
Klimaschutzfunktionen der Natur komplexe von Wäldern, Mooren und Niederungen ist
Ökosysteme erfüllen eine Reihe wichtiger Funktionen zentrale Voraussetzung für den Erhalt der Anpassungs
im Wasser-, Boden- und Naturschutz. Gleichzeitig haben fähigkeit der Natur und somit für eine erfolgreiche
sie durch die Fähigkeit, Kohlenstoff zu speichern, eine Anpassung an den Klimawandel.
große Bedeutung für den Klimaschutz. Insbesondere
121.6 Biodiversität und Küstenschutz
Maßnahmen des Küstenschutzes führen, wie alle menschli- Ökosysteme können einen signifikanten Beitrag zu
chen Aktivitäten, zu Beeinträchtigungen von Ökosystemen den Zielen des Küstenschutzes leisten. So reduzieren
und damit der Biodiversität. Die Landesregierung strebt, vorgelagerte Salzwiesen die hydraulischen Belastungen
ungeachtet der Erheblichkeit, eine Minimierung möglicher auf den Deichen während Sturmfluten. Noch wichtiger im
negativer Auswirkungen an. Nicht vermeidbare Beein- Sinne eines Hochwasserrisikomanagements ist ihre Wirkung
trächtigungen werden auf Grundlage des Naturschutz- bei der Eingrenzung von Schäden nach einem Deich-
rechtes kompensiert. Im Generalplan Küstenschutz des bruch. Wenn eine Salzwiese vorhanden ist, gelangt deutlich
Landes Schleswig-Holstein werden dazu die naturschutz- weniger Wasser in die Niederung. Die Wassertiefen und
rechtlichen Bestimmungen eingehend dargestellt. die Schäden sind entsprechend geringer. Natürliche
Die menschliche Beeinflussung der Küstenökosysteme Steilufer erbringen ebenfalls eine Ökosystemleistung für
in Schleswig-Holstein begann bereits vor mehr als 2.000 den Küstenschutz. Das während Sturmfluten vom Steilufer
Jahren. Damals siedelten Menschen erstmals dauerhaft in erodierte Material lagert sich langfristig im Küstenbereich
den Küstenmarschen auf Wohnhügeln. Diese sogenannten ab und stabilisiert somit längerfristig die Küsten. Das Erfor-
Warften wurden zum Schutz vor Überflutungen angelegt. dernis von Sicherungsmaßnahmen in Bereichen mit hoher
Heute wird ein Viertel der Landesfläche Schleswig- sozioökonomischer Vulnerabilität wird dadurch erheblich
Holsteins durch Deiche und andere Anlagen vor Sturm- reduziert.
fluten geschützt und somit dem marinen Einfluss entzogen.
132 Netzwerke(n) für den landes-
weiten Biodiversitätsschutz
Die Grundlagen für die vorliegende Biodiversitätsstrategie
wurden unter Einbindung zahlreicher Akteur:innen und
Netzwerk Natur
Räumlich-funktional-konzeptionelle Planungen zur
Fachleute aus den Bereichen Natur, Umwelt und Land Sicherung der Arten- und Lebensraumvielfalt in Schleswig-
nutzung im Rahmen eines vorgeschalteten Diskussions- Holstein
prozesses entwickelt. Für dabei entworfene Visionen,
Leitbilder und Ziele wurden Handlungsfelder definiert Netzwerk Bildung
und zugeordnet. Daraus wurden die drei Netzwerke ent- Initiative zur kontinuierlichen Integration des Themas
wickelt (Abbildung 9): Biodiversität in den Bildungsweg
Netzwerk Akteur:innen
Aufbau eines Netzwerkes zur Verstetigung, Integration
und Entwicklung der Biodiversitätsmaßnahmen2.1 Netzwerk Natur
› Grün-Blaue Infrastruktur / Biotopverbund / Kernaktionsräume
› Lebensräume
› Artenschutz
› Biodiversität und Landwirtschaft
› Biodiversität und Klimawandel
› Personalinitiative / Umsetzungsstrukturen
2.1.1 Die Grün-Blaue Infrastruktur › Moore und Fließgewässer einschließlich ihrer Auen und
Niederungen sowie Seen,
Für Schleswig-Holstein als Land zwischen den Meeren mit › Schwerpunktbereiche und Verbundachsen des Schutz-
seinen typischen Küsten sowie ausgedehnten Seen- und gebiets- und Biotopverbundsystems (SBVS) sowie
Fließgewässerlandschaften wird der Begriff der grünen „grüne Netzwerke“ in urbanen Räumen (miteinander
Infrastruktur um die blaue Infrastruktur ergänzt. Zu dieser funktional vernetzte Landschaftselemente wie naturnahe
Grün-Blauen Infrastruktur gehören folgende, sich zum Teil Grünflächen, Parks und Gründächer/-fassaden),
überschneidende Elemente: › künstliche Verbindungselemente zur Vernetzung
› Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer, von Lebensräumen (z. B. Grünbrücken über Autobahnen).
› Biosphärenreservate, Der Fokus künftiger Bemühungen liegt auf der Sicherung
› HELCOM Marine Protected Areas (Ostsee) und OSPAR und Entwicklung von Verbundachsen zur Verbesserung des
Marine Protected Areas (Nordsee), SBVS. Dieser ist bislang nur in geringen Teilen ökologisch-
› arten- und lebensraumbezogene Schutzregelungen funktional ausreichend entwickelt.
der Binnen-und Küstenfischerei-Verordnungen SH,
› Natura 2000-Gebiete (FFH-Gebiete und EU-Vogel- Übergeordnete Ziele
schutzgebiete), › 30 Prozent Grün-Blaue Infrastruktur: Flächen im Umfang
› Naturschutzgebiete (NSG), von etwa 30 Prozent der marinen und terrestrischen Lan-
› dem Naturschutz gewidmete Flächenkomplexe desfläche inklusive Binnengewässer werden Bestandteil
z. B. im Besitz von Verbänden und Stiftungen oder einer funktional-wirksamen Grün-Blauen Infrastruktur, in
Ökokonten außerhalb der genannten Flächen-/ welcher die Biodiversität und der Erhalt bzw. die Wieder-
Schutzgebietskulissen, herstellung der Ökosystemfunktionen gefördert werden.
› strukturreiche Landschaftsausschnitte (z. B. historische › 15 Prozent Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem:
Knicklandschaften), Im Rahmen der Grün-Blauen Infrastruktur werden Flächen
› naturnahe und nutzungsfreie Wälder, im Umfang von mindestens 15 Prozent der Landfläche
15Abbildung 10: Wichtige Synergiepotenziale beim Erhalt und
der Entwicklung des SBVS (LLUR 2020)
als funktional wirksames SBVS hergestellt und dauerhaft Um Biodiversität zu schützen, müssen die natur-
gesichert. nahen Lebensräume und gewachsenen Kulturland-
› Zwei Prozent Wildnisgebiete: Innerhalb des SBVS werden schaften erhalten, Flächennutzungen extensiviert,
mindestens zwei Prozent der Landfläche sowie marine Lebensräume renaturiert und vernetzt sowie die
Lebensräume als Wildnisgebiete einer weitgehend eigen- anhaltende Flächeninanspruchnahme durch Sied-
dynamischen und ungestörten Entwicklung überlassen. lung und Verkehr reduziert werden.
16Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem (SBVS) Für die Umsetzung erfolgt eine Fokussierung auf insgesamt
Dem SBVS kommt eine zentrale Rolle als „Rückgrat“ der rund 50 KAR, die für den Erhalt und die Förderung der Bio-
Grün-Blauen Infrastruktur 7 zu. Räumlich und funktional diversität in Schleswig-Holstein von herausragender Bedeu-
zusammenhängende Lebensraumnetze bilden die Basis für tung sind. Ihre räumliche Abgrenzung erfolgt auf Grundlage
überlebenswichtige Austausch- und Migrationsprozesse von Geofachdaten (z. B. aktuelle landesweite Biotopkartie-
der Arten. Darüber hinaus bieten sie wichtige Ökosystem rung), Programmen und Konzepten (z. B. Bundeskonzept
leistungen und Synergiepotenziale (Abbildung 10). Grüne Infrastruktur) sowie fachgutachtlichen Empfehlungen
von Expert:innen des Landes hinsichtlich geeigneter und
Ein funktionierendes Netz naturnaher Lebensräume prioritärer Umsetzungsräume, d. h Räume, für die derzeit
ist ein Schlüsselfaktor für den Erhalt der heimischen ein hoher Handlungsbedarf besteht. Vor dem Hintergrund
Biodiversität. Die Funktionsfähigkeit ökologischer der landesweiten Ausrichtung der Strategie wird darüber
Wechselbeziehungen und Austauschprozesse in hinaus auch weiterhin die Aufwertung geeigneter Gebiete
diesem Netz ist die Basis für die Anpassungsfähigkeit außerhalb der KAR berücksichtigt. Die Umsetzung der KAR
der Natur an den Klimawandel. soll im Wesentlichen über Förderprogramme und freiwil-
lige Umsetzungsinstrumente des Naturschutzes, wie z. B.
Kernaktionsräume (KAR) für die biologische Vielfalt dem Vertragsnaturschutz, erfolgen. Eine Übernahme der
Die Kulisse der Gebiete mit besonderer Eignung zum KAR-Kulisse im Zuge der Fortschreibung der kommenden
Aufbau eines SBVS wird als Grundlage für die gezielte Landschaftsrahmenplanung (LRP) ist vorgesehen.
Umsetzung der in dieser Strategie herausgearbeiteten Das Konzept der integrativ wirkenden KAR wird im
Maßnahmen herangezogen. Folgenden anhand eines aktuellen Beispiels, der Modell-
KAR stellen innerhalb dieser Kulisse (inklusive einiger region Schlei – einem KAR, der sowohl terrestrische als
Puffer- und Verbindungsbereiche) ökologische Schlüssel auch marine Bereiche umfasst – verdeutlicht.
räume landesweiten Maßstabs dar, die aufgrund des
großen Handlungsbedarfs zum Erhalt unserer biologi- Beispiel: Modellregion Schlei
schen Vielfalt als notwendiges Umsetzungsinstrument zu Das Projekt „Modellregion Schlei“ wird künftig drei KAR
verstehen sind. Charakteristisch für KAR sind Räume, in darstellen. Es basiert auf einer Weiterentwicklung des
denen maßgebliche Synergieeffekte z. B. Ziele des Klima-, von den regionalen Akteur:innen erstellten „Integrierten
Gewässer-, Grundwasser- und Bodenschutzes gemeinsam Schleiprogramms“. Träger ist der Naturpark Schlei e. V., der
realisiert werden können. zugleich auch Träger der Lokalen Aktion Schlei ist. Gegen-
Ziel der KAR ist die Verbesserung und Weiterentwick- stand sind nicht nur die Ziele des Biodiversitäts-, Wasser-,
lung der ökologischen Funktionalität des Schutzgebiets- Klima- und Bodenschutzes sowie die damit in Verbindung
und Biotopverbundsystems zur Stärkung der Grün-Blauen stehenden regionalen und sozioökonomischen Belange,
Infrastruktur in Schleswig-Holstein. sondern auch verschiedene Ebenen internationaler, natio-
naler, landes- und regionsspezifischer Verpflichtungen
Kernaktionsräume und Interessen. Der besondere Fokus vor Ort liegt auf
› umfassen wichtige Schlüsselbereiche des SBVS und Synergieeffekten zwischen dem biologischen Klimaschutz
der Küstenmeere, die aufgrund ihrer Lebensraum- und und der Förderung der Biodiversität, unter anderem des
Artenausstattung zu den ökologisch besonders bedeut- Insektenschutzes, sowie der Verbesserung der Wasser
samen und prägenden Teilbereichen des Landes zählen; qualität der Schlei. Die Modellregion Schlei dient auch
› bilden Räume ab, in denen in einem hohen Maße Syn- als Best-Practice-Beispiel im Rahmen der HELCOM-
ergieeffekte beispielweise mit den Zielen des Klima- Zusammenarbeit der Ostseeanrainerstaaten.
schutzes, des Gewässer- und Grundwasserschutzes und
des Bodenschutzes realisiert werden können; KAR sind prioritäre Umsetzungsräume für Maß-
› weisen das Potenzial auf, durch gezielte Maßnahmen- nahmen, die nicht nur dem Erhalt der Biodiversität
umsetzung die ökologische Funktionalität des SBVS dienen, sondern weitere Synergieeffekte für das
(Lebensraumvernetzung) erheblich zu stärken, wodurch Land realisieren.
mit einem vergleichsweise geringen Flächenaufwand
ein erheblicher Beitrag zum Erhalt biologischer Vielfalt Ziele
geleistet werden kann und Die Umsetzung erforderlicher Maßnahmen zur Lebens-
› weisen – unbenommen der bisherigen Erfolge langjäh- raumaufwertung bzw. Renaturierung in den KAR ist eine
riger intensiver Naturschutzbemühungen in vielen Teil- mittel- bis langfristige Aufgabe für das Land und daher in
bereichen – weiteres Entwicklungspotenzial zur Förde- mehreren Tranchen vorgesehen. Die Zielfläche aller KAR
rung der biologischen Vielfalt auf. liegt bei insgesamt etwa zehn Prozent der Landfläche, also
bei rund 160.000 Hektar. Darüber hinaus sind marine KAR
vorgesehen.
17Abbildung 11: Übersichtskarte der für die erste Tranche ausgewählten Kernaktionsräume (LLUR 2020); ⬜ Kernaktionsräume,
⬛ Schutzgebiets- und Biotopverbundsystem (regionale Ebene), ⬛ Schutzgebiete (Natura 2000, Naturschutzgebiete),
Maßstab km
0 10 20 30 40
› Erste Tranche Maßnahmen
Im Rahmen der ersten Zieltranche (Abbildung 11, siehe Additiv zu vorhandenen Programmen wird für die Umset-
auch Kartenserie) werden bis Ende 2022 für 23 KAR, zung der Maßnahmenkonzepte in den KAR eine Förder-
davon 20 terrestrisch und drei marin, prioritäre Hand- priorität eingerichtet. Gegenwärtig bereits bestehende
lungserfordernisse erarbeitet. Bis Ende 2030 erfolgt die Förderprogramme/-kulissen erfahren durch die Ermittlung
Umsetzung bzw. Einleitung der Maßnahmen. und Darstellung der KAR keine Beeinträchtigung. Geför-
› Zweite Tranche dert werden:
Im Rahmen der zweiten Zieltranche erfolgt bis Ende 2025 › Träger-/Umsetzungsstruktur;
die Ermittlung und Lage weiterer etwa 27 KAR sowie › Grunderwerb (GE)/Flächensicherung (FS);
die Grobkonzeption entsprechender Maßnahmen für › Umsetzungs- und Planungsmanagement (Kernaktions-
die Umsetzung prioritärer Handlungserfordernisse. Die raumplanung);
Umsetzung bzw. Einleitung dieser Maßnahmen soll bis › Koordination und Begleitung der Umsetzung.
2040 erfolgt sein und wird analog zur ersten Tranche
durchgeführt.
18Wildnisnetzwerk „Wildes SH“ mittlung von Biodiversitätsprojekten und Maßnahmen
Um die heimische Biodiversität und insbesondere spe- (z. B. via S+E-Maßnahmen) wird schrittweise unter
ziell angepasste Arten langfristig zu erhalten, müssen der Nutzung von Synergien mit den Aktiven vor Ort eine
Natur Räume überlassen bzw. zurückgegeben werden, die Struktur hauptamtlicher Ranger:innen ggf. in Anbindung
frei von anthropogenen Nutzungen sind. Nur in diesen an die Integrierten Stationen des Landes aufgebaut, die
sogenannten Wildnisgebieten können natürliche Selbst folgende Aufgaben übernehmen:
organisationsprozesse der Natur weitgehend ungestört › Zusammenarbeit und Koordination des Ehrenamtes
und unbeeinflusst ablaufen. unter Einbindung von Freiwilligendiensten (BFD,
FÖJ) und Verbänden;
Ziel › Professionalisierung der Besucherlenkung und
Mindestens zwei Prozent der Landfläche, die innerhalb des -information;
Schutzgebiets- und Biotopverbundsystems liegen, werden › Planung, Akquise, Begleitung und Durchführung von
zu Wildnisgebieten entwickelt. Pflegemaßnahmen in Abstimmung mit den zustän-
digen Naturschutzbehörden;
Maßnahmen › Kooperation mit den Ordnungsbehörden.
› Bis 2030 werden auf 1,4 Prozent der Landfläche Wildnis- › In allen Meeresschutzgebieten sind auf Grundlage der
gebiete eingerichtet sein. besten verfügbaren wissenschaftlichen Gutachten und
› Bis 2030 wird der Wildnisansatz in einem überwiegenden klar definierter Erhaltungsziele bis 2030 die Fischerei-
Teil des Nationalparks Schleswig-Holsteinisches Watten- bewirtschaftungsmaßnahmen zu überprüfen und ggf.
meer umgesetzt sein. anzupassen.
› Bis 2035 werden ca. 70 weitere Wildnisgebiete realisiert › Zur Vernetzung der marinen Schutzgebiete unterein-
(ca. 0,6 Prozent der Landfläche) oder die dafür erforder- ander und mit terrestrischen/limnischen Schutzgebieten
lichen und vorbereitenden Maßnahmen weitgehend werden mittelfristig Verbundkorridore, deren Lage sich
durchgeführt sein. Das Wildnisziel von mindestens zwei am Verlauf von Wander- und Zugrouten relevanter Arten
Prozent ist damit erreicht. (z. B. Zugvögel, Schweinswale, Robben, Wanderfische)
orientiert, eingerichtet und gesichert. Auch ist der Schutz
2.1.2 Initiative für terrestrische und von Küstenvogelbrutgebieten vor Störungen und Prä-
aquatische Schutzgebiete dation unter besonderer Berücksichtigung der heraus-
ragenden Bedeutung der Hallligen und Inseln für diese
Schutzgebiete müssen einen hohen Qualitätsstandard Artengruppe von Bedeutung.
aufweisen, um ihrem Schutzzweck entsprechend auch › Ergänzend werden der Vollzug zum Schutz der Arten
anspruchsvollen Arten und deren Lebensräumen gerecht und geschützten Lebensräume gegen Beeinträchti-
werden zu können und ökologische Funktionen zu erfüllen. gungen gestärkt und der Bußgeldrahmen im Bußgeld-
katalog geprüft.
Ziel › In der Nordsee existiert mit dem Nationalpark Schleswig-
Bis 2030 wird das Land den Zustand der terrestrischen Holsteinisches Wattenmeer ein großflächiges Schutzge-
und aquatischen Schutzgebiete deutlich verbessern. biet, in dem gemäß Paragraph 24 Absatz 2 Bundesnatur
schutzgesetz in einem überwiegenden Teil des Gebietes
Maßnahmen der möglichst ungestörte Ablauf der Naturvorgänge in
› Der Flächenanteil der NSG im Biotopverbundsystem ihrer natürlichen Dynamik zu gewährleisten ist.
des Landes wird von derzeit 3,2 Prozent auf 3,6 Prozent › Weitgehend ungestörte Bereiche und natürliche Pro-
der Landfläche erhöht. Lücken im Biotopverbundsystem zesse wie die Morpho- und Hydrodynamik der Aus-
werden insbesondere durch die Ausweisung von NSG gleichsküste oder aktiver Steilhänge (Ostsee) werden
geschlossen. Zusätzlich ist ein Flächenerwerb oder erhalten oder wiederhergestellt.
-tausch ggf. im Rahmen einer Flurneuordnung möglich.
› Die Umsetzung und Planung von Schutz-, Pflege- und
Entwicklungsmaßnahmen (S+E) wird unter Berücksichti-
gung von Pufferflächen unter Einbeziehung der Rand-
flächen in die Schutzgebiete sowie eine entsprechende
Regelung der dort stattfindenden Nutzungen über Ver-
ordnungen und/oder freiwillige Instrumente intensiviert.
› Zur Ergänzung der wichtigen ehrenamtlichen Schutz-
gebietsbetreuung und zur Umsetzung, Planung und Ver-
19Lebensraumspezifische Ziele
Nordsee und Wattenmeer
Weite Teile der schleswig-holsteinischen Nordsee gehören
zum UNESCO-Weltnaturerbe Wattenmeer, der größten
zusammenhängenden Wattlandschaft der Welt. Dabei
umfasst der schleswig-holsteinische Anteil gut 4.350 Qua-
dratkilometer und damit mehr als ein Drittel der Welterbe-
stätte. Mit einer beeindruckenden Habitat- und Artenvielfalt
und der außerordentlichen Bedeutung als Drehscheibe
des internationalen Vogelzugs spielen das schleswig-
holsteinische Wattenmeer und die küstennahe Nordsee
beim Erhalt der Biodiversität eine herausragende Rolle.
Tabelle 1
Zusammenfassung der qualitativen und quantitativen Ziele
für die Nordsee
Qualitative Ziele
Abbildung 12: Quellerwatt (Foto: Dr. Henning Thiessen)
› Managementpläne und marine KAR umsetzen.
› Meeres- und Küstengewässer befinden sich in einem
2.1.3 Gewässerinitiative Biodiversität guten ökologischen und chemischen Zustand.
› Anthropogene Stoffeinträge (z. B. Nährstoffe, Pflanzen-
In Gewässern überlagern sich die Ziele der Natura schutzmittel, Medikamente) und Energieeinträge
2000-Richtlinie mit den Zielen der Wasserrahmenricht- (z. B. Unterwasserlärm, Licht, Wärme) begrenzen.
linie (WRRL) und der Meeresstrategie-Rahmenrichtlinie › Ausreichende natürliche Nahrungsgrundlage für die
(MSRL). Nur durch eine gemeinsame Umsetzung lassen marinen Arten und funktionstüchtige Nahrungsnetze
sich diese erreichen. Primäres Ziel der Gewässerinitiative sichern.
ist, als ressortübergreifende Aktivität des Gewässer- und › Nahrungs-, Aufzucht-, Mauser- und Rastgebiete sowie
Naturschutzes flächenhaft wirksame Belastungen wie zu marine und terrestrische Bereiche sind ausreichend
hohe Nährstoff- und Schadstoffeinträge aus diffusen und vorhanden und miteinander vernetzt.
punktuellen Quellen auf ein für den Gewässerschutz ver- › Ökologische Voraussetzungen für den Erhalt oder die
trägliches Maß zu reduzieren sowie die Strukturen am und Wiederansiedlung bestandsgefährdeter oder ausge-
im Gewässer zu verbessern. storbener Arten schaffen.
› Beifangereignisse (Vögel, Meeressäuger, Nichtzielarten)
Übergeordnete Ziele weiter reduzieren.
› Gegenüber dem aktuellen fünfjährigen mittleren Austrag
müssen die Phosphoreinträge in alle Gewässer landes- Quantitative Ziele
weit um ein Drittel (rund 269 Tonnen) verringert werden. › 50 Hektar Küstendünen aufwerten.
› Für den Meeresschutz ist es erforderlich, die Stickstoff- › Bis Ende 2024 prüfen, wo ungenutzte Rückzugs- und
frachten aus dem Binnenland um knapp 5.000 Tonnen Ruheräume für marine Arten gesichert werden können.
jährlich oder ein Drittel gegenüber dem aktuellen fünf- › Gesamtstickstoffeintrag am Übergangspunkt lim-
jährigen mittleren Austrag zu vermindern. nisch/marin auf weniger als 2,8 Milligramm pro Liter
› Um den Artenschutz in Fließgewässern zu berücksich- begrenzen.
tigen, ist es erforderlich, die Gewässerunterhaltung › Einschleppungsrate nicht heimischer Arten auf maximal
landesweit artenschutzgerecht und soweit möglich, eine Art pro MSRL-Berichtszyklus (6 Jahre) reduzieren.
schonend oder beobachtend durchzuführen.
› Struktur und Durchgängigkeit der Fließgewässer sind zu
verbessern.
› In den verschiedenen Regionen des Landes sind natur-
nahe Auen wiederherzustellen, die vielfältige Ökosystem-
leistungen übernehmen (Arten- und Biotopschutz, Boden-,
Hochwasser- und Klimaschutz, Nährstoffretention).
20Sie können auch lesen