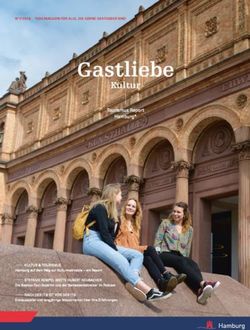Leben mit dem KLimawandeL - Hannover passt sicH an - LANDESHAUPTSTADT HANNOVER - Hannover.de
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
K Anpassungsstrategie und Maßnahmenprogramm 2012 – 2016 Leben mit dem Klimawandel – Hannover passt sich an Schriftenreihe kommunaler Umweltschutz – Heft 53 LANDESHAUPTSTADT HANNOVER
3
Inhalt
Vorwort .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1 Leben mit dem Klimawandel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.1 Der Klimawandel in Deutschland .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 Der Klimawandel in der Region Hannover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3 Das Stadtklima und künftige Veränderungen für die Stadt Hannover .. . . . . . . 9
2 Die Anpassungsstrategie für Hannover .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.1 Ziele der hannoverschen Anpassungsstrategie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.2 Das Entstehen der Strategie .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
2.3 Das Maßnahmenprogramm 2012 – 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3 Die Aktionsfelder und Beispiele erster Anpassungsmaßnahmen .. . 15
3.1 Hochwasserschutz .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.1.1 Baulicher Hochwasserschutz .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
3.1.2 Vorsorgender Hochwasserschutz .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
3.1.3 Fließgewässerrenaturierung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.2 Regenwassermanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
3.3 Vorsorgender Boden- und Grundwasserschutz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3.4 Dachbegrünung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
3.5 Klimaangepasste Vegetation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.6 Klimaangepasste Stadtplanung und klimaangepasstes Bauen .. . . . . . . . . . . . . 25
3.6.1 Maßnahmen für Gebäude . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
3.6.2 Maßnahmen für Freiräume und Stadtstruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
3.6.3 Hilligenwöhren – ein klimaangepasstes Wohnquartier .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.7. Fachkarte Klimaanpassung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
3.8 Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4 Forschung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.1 Klimauntersuchung eines urbanen Raumes
am Beispiel der Landeshauptstadt Hannover . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
4.2 Verdichtung des Grundwasser-Messnetzes .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.3 Auswirkungen des Klimawandels auf den Wasserhaushalt
und das Überflutungsverhalten in Siedlungsgebieten .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.4 Vorhersagen von urbanen Sturzfluten .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
5 Literatur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
6 Anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6.1 Umgesetzte Maßnahmen aus dem
„Programm zur Minimierung der Folgen der Klimaerwärmung“ .. . . . . . . . . . . 40
6.2 Verfahrenshinweis Sonnenschutz / Nachtlüftung .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
6.3 Klimawandel und Baumartenwahl in der Stadt .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 5
Vorwort 1 Leben mit dem Klimawandel
Der Klimawandel ist ein Thema, das immer häufiger in den Medien „Über den Klimawandel wird nicht mehr spekuliert, er Die Hauptaussagen des 5. Sachstandsberichtes zur Kli-
präsent ist, denn die Folgen des Klimawandels sind auch in Deutsch- ist real“. Das war das Ergebnis von Klimaforschern, die maänderung:
land schon spürbar. Die Anzahl der Hitzetage pro Jahr steigt stetig im Rahmen des UN-Klimarates zusammengearbeitet Seit Beginn der regelmäßigen instrumentellen Mes-
an und die Starkregenereignisse 2016 in Bayern haben gezeigt, dass und 2007 den vierten IPCC (Intergovernmental Panel sung der Lufttemperatur in Bodennähe im Jahr 1881
der Klimawandel ernst zu nehmen ist und wir gut beraten sind, uns on Climate Change)-Bericht veröffentlicht haben. 2013 gab es bisher kein Jahr, das wärmer gewesen wäre als
seinen Herausforderungen zu stellen und vorsorgend zu denken und ist der fünfte IPCC-Sachstandsbericht zum Klimawan- 2014. Doch schon das darauffolgende Jahr verwies
zu handeln. del erschienen. Er bestätigt: Der gegenwärtige Klima- das bisherige Rekordjahr auf den zweiten Platz. 2015
wandel ist Fakt und beruht vorwiegend auf menschli- war global das wärmste Jahr seit Beginn der Wetter-
Wir verfolgen in Hannover dabei zwei Handlungsstränge: Auf der chen Einflüssen (Quelle: Perspektive Erde). aufzeichnungen. Fast alle Monate des Jahres weisen
einen Seite arbeiten wir seit Gründung der Klimaschutzleitstelle im Höchstwerte der globalen Mitteltemperatur auf. Ledig-
Jahr 1994 gemeinsam mit vielen Akteuren daran, die für den Klima- In der Klimaforschung ist es heute Konsens, dass die lich ein zweitwärmster Januar und ein drittwärmster
wandel verantwortlichen Treibhausgas-Emissionen zu verringern steigenden Konzentrationen anthropogener, also men- April tanzen geringfügig aus der Reihe (Umweltbun-
und haben uns zum Ziel gesetzt, diese bis zum Jahr 2050 um 95 % schengemachter Treibhausgase (CO2, Methan u. a.), die desamt 2016).
gegenüber 1990 zu reduzieren. wichtigste Ursache der globalen Erwärmung sind. Der
IPCC, dessen Analysen den weltweiten Forschungs-
Auf der anderen Seite hat sich Hannover schon frühzeitig mit den Folgen des stand auf diesem Gebiet abdecken, spricht in seinem
Klimawandels auseinandergesetzt und bereits 2012 eine lokale Anpassungs- fünften Sachstandsbericht aus 2013 davon, dass dies
strategie erarbeitet. Wir haben uns darüber hinaus 2014 mit dem Beitritt in die „äußerst wahrscheinlich“ ist, was einer Wahrschein-
Mayors Adapt Initiative (Initiative des Konvent der Bürgermeister zur Anpas- lichkeit von 95-100 Prozent entspricht.
sung an den Klimawandel) verpflichtet, zum übergeordneten Ziel der EU-Strategie
zur Anpassung an den Klimawandel beizutragen und die Klimaresilienz Europas zu stär- Der IPCC-Bericht ist der „weltweit bedeutendste Sach-
ken. Dies bedeutet den Ausbau der Vorsorge durch die Kommune und die Erhöhung standsbericht zur Klimaforschung“. Seit 2010 arbei-
unseres Reaktionsvermögens in Bezug auf die Auswirkungen des Klimawandels durch: teten mehr als 3000 Experten aus mehr als 70 Län-
dern am Gesamtbericht mit, davon mehr als 100 aus
• die Entwicklung einer umfassenden (eigenständigen) lokalen Anpassungsstrategie Deutschland (Deutsches Zentrum für Luft und Raum-
für unsere Kommune und fahrt e. V. 2014). Die IPCC-Aussagen haben deshalb so
• die Einbindung der Anpassung an den Klimawandel in unsere bestehenden großes Gewicht, weil sie in einem einzigartigen, mehr-
einschlägigen Pläne. stufigen Verfahren geprüft werden und daher sehr ver-
lässlich und ausgewogen sind. Die 195 Mitgliedstaaten
Auch in dem Stadtentwicklungskonzept „Mein Hannover 2030“, das die Lan- des Weltklimarates verabschieden die wissenschaftli-
deshauptstadt Hannover im Februar 2016 veröffentlicht hat, wird die Anpas- chen Hauptaussagen der IPCC-Berichte und erkennen
sung an den Klimawandel thematisiert. Unter dem Oberziel, eine hohe Lebens- sie damit offiziell an.
und Freiraumqualität zu erhalten, heißt es konkret:
„Mein Hannover 2030 hat ein ausgeglichenes und gesundes Stadtklima, ist auf dem
Weg zur klimaneutralen Stadt, pflegt eine klimaangepasste Stadtentwicklung und för-
dert die Widerstandsfähigkeit (Resilienz).“
Die Erwärmung des Klimasystems ist eindeutig, und viele dieser seit den 1950er Jahren beobachteten
Veränderungen sind seit Jahrzehnten bis Jahrtausenden nie aufgetreten. Die Atmosphäre und der
Leben mit dem Klimawandel – Hannover passt sich an!
Ozean haben sich erwärmt, die Schnee- und Eismengen sind zurückgegangen, der Meeresspiegel ist
angestiegen und die Konzentrationen der Treibhausgase haben zugenommen.
Mit der vorliegenden Broschüre berichtet die Landeshauptstadt Hannover
Der menschliche Einfluss auf das Klimasystem ist klar. Das ist offensichtlich aufgrund der ansteigenden
darüber, wie wir uns dieser Herausforderung stellen. Es werden die Anpas-
Treibhausgaskonzentrationen in der Atmosphäre, dem positiven Strahlungsantrieb, der beobachteten
sungsstrategie an zukünftig veränderte Klimabedingungen in der Stadt und
Erwärmung und des Verständnisses des Klimasystems.
die ersten durchgeführten Maßnahmen vorgestellt. Dabei wird deutlich, wie
(IPPC 2013. Klimaänderung 2013: Wissenschaftliche Grundlagen.
vielfältig die Handlungsfelder sind, in denen Anpassungen an den Klimawandel Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger)
notwendig sind.
Selbst wenn die Auswirkungen des Klimawandels derzeit in Hannover noch
nicht als belastend empfunden werden, die durchgeführten Maßnahmen stei-
gern die Lebensqualität in unserer Stadt schon jetzt.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre!
Ihre
Sabine Tegtmeyer-Dette
Erste Stadträtin
Wirtschafts- und Umweltdezernentin6 7
Abb. 1: Abweichungen des globalen
Mittels der bodennahen Lufttemperatur
vom Mittelwert im Referenzzeitraum
1961 – 1990 (rote und blaue Balken),
die durchgezogene schwarze Linie Abb. 3: Ein Vergleich der Jahresdurchschnittstemperaturen
stellt den nichtlinearen Trend dar der 1970er Jahre mit denen, die für die 2070er Jahre in
(Quelle: Climate Research Unit, Deutschland erwartet werden, zeigt einen deutlichen
University of East Anglia, 2015) Anstieg – im Durchschnitt eine Zunahme von 3,5 °C
innerhalb von 100 Jahren.
(Quelle: KlimafolgenOnline.de)
Im Dezember 2008 hat die Bundesregierung die Deut- 1.1 Der Klimawandel
sche Anpassungsstrategie an den Klimawandel (DAS)
beschlossen. Zur Weiterentwicklung der Strategie hat in Deutschland
die Bundesregierung in 2011 einen mit den Bundes-
ländern und den kommunalen Spitzenverbänden ab- Aufgrund einer immer größeren Datenfülle, verfeiner-
gestimmten „Aktionsplan Anpassung“ vorgelegt. Der ter Klimamodelle und leistungsfähigerer Computer
nationale Strategieprozess zur Anpassung soll dazu sind inzwischen relativ verlässliche Aussagen über
beitragen, die Voraussetzungen für die Identifizierung künftige klimatische Verhältnisse (sogar für einzelne
von Anpassungsbedarfen und die Entwicklung von An- Regionen Deutschlands) möglich. Das Umweltbundes-
Abb. 2: Die atmosphärische passungskonzepten und -maßnahmen auf der lokalen amt fasst den Forschungsstand wie folgt zusammen:
CO2-Konzentration seit dem Jahr 1700.
Daten der NOAA (National Oceanic and
Ebene zu schaffen bzw. zu verbessern. Das Bundesmi- „Im Vergleich des möglichen Klimas der Jahre 2071
Atmospheric Administration) aus Hawaii nisterium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi- bis 2100 mit dem Zeitraum 1961 bis 1990 [Referenz-
seit 1958, davor Berechnung cherheit steht seit 2009 im Dialog mit den Kommunen. zeitraum] zeigen die Klimamodelle, dass
anhand von Eisbohrungen. Im Juli 2011 hat der Bundestag das Gesetz zur För-
(Copyright/Quelle: Scripps Institution
derung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den • die Temperaturen in Deutschland regional und
of Oceanography, UC San Diego)
Städten und Gemeinden und entsprechende Änderun- jahreszeitlich unterschiedlich im Mittelwert um
gen im Baugesetzbuch beschlossen (Bundesregierung etwa +3,5 Grad Celsius (Sommer: +1,5 Grad bis
2011). Damit wurde das Ziel, den Klimaschutz und die +5 Grad Celsius; Winter: +2 Grad bis +4,5 Grad
Klimaanpassung durch die Bauleitplanung zu fördern, Celsius) steigen,
in die Grundsätze des § 1 des Baugesetzbuches auf- • es weniger Frosttage, mehr heiße Tage und
genommen. Den Erfordernissen des Klimaschutzes mehr Tropennächte geben wird sowie die Zahl
Die 16 wärmsten Jahre liegen – bis auf eine Ausnahme Kosten zur Folge. Die Reduzierung von Treibhausgasen soll sowohl durch Maßnahmen, die dem Klimawandel und Dauer von Hitzewellen zunehmen werden,
– in den ersten 16 Jahren des neuen Jahrtausends. Die in allen Ländern ist daher das zentrale Ziel aller Klima- entgegenwirken, als auch durch solche, die der Anpas- • sich die sommerlichen Niederschläge um bis zu
globale Mitteltemperatur der bodennahen Luftschicht schutzmaßnahmen. Da das Klima auf äußere Einflüsse sung an den Klimawandel dienen, Rechnung getragen 30 Prozent verringern und gleichzeitig die
hat sich zwischen 1850 und 2012 um 0,85 °C erhöht (s. mit Verzögerungen von einigen Jahrzehnten reagiert, werden (§ 1 a (5) BauGB). Über die Instrumente der Häufigkeit von Starkniederschlägen zunimmt,
Abb. 1), 2015 betrug diese Abweichung bereits 0,9 °C. wird eine globale Erwärmung um 2 Grad bis Mitte oder Bauleitplanung besteht sowohl im Rahmen der vor- • für den Gesamtniederschlag im Winter in den
Der CO2-Gehalt der Atmosphäre ist im April 2014 an der spätestens Ende dieses Jahrhunderts trotz der bereits bereitenden Planung (Flächennutzungsplan) als auch meisten Regionen Deutschlands eher mit einer
weltweit ältesten Messstation Mauna Loa (Hawaii) auf eingeleiteten Klimaschutzmaßnahmen voraussichtlich durch die verbindliche Planung (Bebauungsplan) die Zunahme zu rechnen ist (circa minus vier Prozent
den in der Menschheitsgeschichte höchsten Wert von nicht mehr zu verhindern sein. Daher müssen neben Möglichkeit, die Belange des Klimaschutzes und der bis plus 20 Prozent). Die stärkste Zunahme ist
401 ppm (parts per million) gestiegen. Vor Beginn der den Maßnahmen zur Verringerung der globalen Erwär- Klimaanpassung über die zur Verfügung stehenden dabei für Norddeutschland zu erwarten. Für den
Industrialisierung betrug der CO2-Gehalt lediglich 280 mung und ihrer Folgen (Mitigation) zugleich Maßnah- Darstellungen und Festsetzungen zu berücksichtigen, äußersten Süden wird dagegen keine wesentliche
ppm (s. Abb.2). men zur Anpassung an den Klimawandel (Adaptation) zum Beispiel durch Schaffung und/oder Erhaltung Änderung, eher sogar eine leichte Abnahme,
erfolgen. von Freiräumen bzw. Grün- oder Frischluftzonen, Be- erwartet. Auch im Winter werden künftig
Die Klimaerwärmung wird – auch in Deutschland – pflanzungen, Umfang und Anordnung von Bebauung häufiger starke Regenfälle zu verzeichnen sein.
weitreichende Folgen für die Lebensbedingungen der einschließlich der Begrenzung/dem Ausschluss von • extreme Windgeschwindigkeiten zukünftig
Menschen haben. Unter WissenschaftlerInnen und „Es geht darum, das Unbeherrschbare zu ver bestimmten Nutzungen, Regelungen zur Ableitung, Be- ebenfalls verstärkt auftreten werden.
KlimaexpertInnen gelten die Folgen einer globalen meiden und das Unvermeidbare zu beherrschen.“ grenzung bzw. Versickerung von Niederschlagswasser • mit einem Rückgang der Gletscher und Schnee
(Prof. Hans Joachim Schellnhuber,
Erderwärmung bis 2 Grad Celsius über dem vorindus- etc.. Die Aspekte des Klimaschutzes und der Klimaan- bedeckung in den Alpen gerechnet werden muss,
Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und
triellen Niveau als gerade noch beherrschbar. Eine Klimaschutzbeauftragter der Bundesregierung) passung sind damit Teil der Abwägung öffentlicher und • der Meeresspiegel mit im Mittel 30 Zentimeter
Erwärmung darüber hinaus hätte erhebliche Schäden privater Belange, die bei Aufstellung der Bauleitpläne deutlich höher liegen könnte.“ (UBA 2013)
für Mensch und Natur und extrem hohe wirtschaftliche durchzuführen ist.8 9
1.2 Der Klimawandel Der Vergleich unterschiedlicher Zeitabschnitte der
Temperaturdatenreihe 1950 bis 2013 zeigt, dass die
in der Region Hannover Mitteltemperatur generell angestiegen ist. Beträgt die
Temperatur im Zeitraum 1951 bis 1970 im Mittel 8,6 °C,
An der Klimastation Hannover-Langenhagen des Deut- so liegt sie im Zeitraum 1981 bis 2010 bei 9,6 °C, eine
schen Wetterdienstes liegen langjährige Messreihen Erhöhung um 1 Grad Celsius. Der Klimawandel hat also
seit 1936 vor. Aufgrund der langen Datenreihe können bereits begonnen und er wird sich weiter fortsetzen.
Trends zur Klimaentwicklung abgeleitet werden. So
zeigen die Daten, dass Klimaänderungen in der Region Mit Hilfe von Modellen lassen sich Szenarien für zu-
Hannover bereits stattgefunden haben. Sowohl die An- künftige Klimaentwicklungen erstellen. Ausgehend
zahl der Sommertage (Temperaturmaximum ≥ 25 °C) vom internationalen Modell (ECHAM) und einer mitt-
als auch die Anzahl der Hitzetage (Temperaturmaxi- leren globalen Erwärmung von 2 Grad können künftige
mum ≥ 30 °C) zeigen seit 1950 einen Trend zur Zu- Veränderungen des Klimas infolge der globalen Erwär-
Abb. 6: Blick von der Auestraße zum
nahme. Tropennächte (Temperaturminimum ≥ 20 °C mung mit den nationalen Klimafolgen-Rechenmodel-
Schwarzen Bären in Hannovers Stadtteil
treten erst seit 1986 in einzelnen Jahren auf, scheinen len (CLM, REMO) auf die Region Hannover übertragen Linden. Ein hoch versiegelter Stadtraum,
seit 2007 aber häufiger zu werden. werden. Danach ist für die Region Hannover von rund dessen Klima deutlich von dem des
3 Grad mittlerer Temperaturerhöhung bis zum Ende grünen Umlandes abweicht.
dieses Jahrhunderts auszugehen (Meteoterra/GEO- (Foto: FB Umwelt und Stadtgrün, LHH)
NET 2015).
Der bereits in den Daten des Deutschen Wetterdiens-
tes festgestellte Trend hinsichtlich der Sommertage „Das Stadtklima ist das durch die Wechselwirkung
und Hitzetage wird sich verstärkt fortsetzen. Sie wer- mit der Bebauung und deren Auswirkungen
den – ebenso wie Tropennächte – immer häufiger. Hit- (einschließlich der Abwärme und Emission von
zesommer wie 2003 (56 Sommer- und 17 Hitzetage) luftverunreinigenden Stoffen) modifizierte Klima“.
werden ab 2050 mit großer Wahrscheinlichkeit den (Definition der Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL)
Normalfall darstellen. im VDI und DIN, 1988)
Auch wird sich die jährliche Niederschlagsverteilung Der Klimawandel wird in innerstädtischen Verdich-
verändern. So wird zum Beispiel die Auftrittshäufigkeit tungsräumen zu einer Erhöhung von Wärmebelastung
von trockenen (niederschlagsfreien) Tagen und mit und Hitzestress für die Bevölkerung führen. Nach der
ihr die Dauer von Trockenperioden im Laufe des 21. von der Landeshauptstadt in 2010 beauftragten Mo-
Jahrhunderts beständig zunehmen. Ebenfalls wird die dellierung von meteorologischen Kenngrößen zum
Anzahl von Tagen mit geringem bis mäßigem Nieder- Klimawandel für das Stadtgebiet von Hannover ist bis
Abb. 4: Anzahl von Sommertagen (gelb), schlag abnehmen. zum Ende dieses Jahrhunderts mit einem erheblichen
Hitzetagen (rot) und Tropennächten Anstieg der Zahl der heißen Tage mit einer Höchsttem-
(grün) in Hannover-Langenhagen in den peratur von mehr als 30 Grad und der Tropennächte
Jahren 1950 bis 2013 mit Lufttemperaturen nicht unter 20 Grad zu rechnen.
(Quelle: Meteoterra/GEO-NET, 2015)
1.3 Das Stadtklima In der dicht bebauten und stark versiegelten Innen-
stadt wird sich die durchschnittliche Zahl der Hitzeta-
und Klimaprognosen ge von 9,6 (Zeitraum 2001-2010) auf 21,9 im Zeitraum
2090 bis 2099 mehr als verdoppeln. Die durchschnitt-
für Hannover liche Anzahl der Tropennächte wird sich von 1,4 auf
9,8 Nächte deutlich steigern. Besonders in Stadtteilen
In dicht bebauten Siedlungsgebieten wird der Klima- mit Block- und Blockrandbebauung wird die Anzahl der
wandel überlagert von den Effekten des Stadtklimas. Hitzetage und Tropennächte deutlich zunehmen. Bei-
Je nach Versiegelungsgrad und Größe der verdichteten spielsweise wurde für den Stadtteil Vahrenwald eine
Bebauung ist das Klima in den Städten im Vergleich Steigerung der Hitzetage von durchschnittlich 8,7 auf
zum Umland u. a. geprägt durch höhere Temperatu- 19,1 und der Tropennächte von durchschnittlich 1,2 auf
ren („Wärmeinsel“), geringere relative Luftfeuchte, 9,2 für die o. g. Zeiträume berechnet (s. Abb. 5). Die Kli-
geringere mittlere Windgeschwindigkeiten, aber auch maprojektionen zeigen zudem, dass die Hitzeperioden
höhere Böigkeit des Windes. Die Stadtklimaeffekte mit länger andauern werden und ihr Beginn in das Frühjahr
Auswirkung auf die Gesundheit des Menschen werden verschoben wird, in eine Jahreszeit, in der der mensch-
durch den Klimawandel zusätzlich verstärkt werden. So liche Organismus noch nicht an die Hitze angepasst ist
bedeutet die mittlere globale Erwärmung um 0,85 Grad und deshalb sensibler auf Hitzebelastungen reagiert.
Abb. 5: Modellierte Anzahl von Som- Celsius zwischen 1850 und 2012 beispielsweise für die
mertagen (gelb), Hitzetagen (rot) und „Megacity“ Tokio eine Erwärmung um 3 Grad Celsius.
Tropennächten (grün) für Hannover-Lan-
genhagen im Zeitraum 1961 – 2100
(Datenbasis: WETTREG 2010, Szenario
A1B, Mittel über zehn Modelläufe)
(Quelle: Meteoterra/GEO-NET, 2015)10 11
2001 bis 2010
Abb. 7: Warme Sommertage
genießen viele Menschen gern
im Freien, z. B. im Straßencafé 2046 bis 2055
(Foto: FB Umwelt und Stadtgrün, LHH)
45 41.8
40
35
28.2
30
25 21.8 21.9
20
15 12.7
9.6 9.8
10
5 1.4 2.1
0
2001-2010
2046-2055
2090-2099
2001-2010
2046-2055
2090-2099
2001-2010
2046-2055
2090-2099
Referenzpunkte:
Abb. 8: Mittlere jährliche Häufigkeit 1) Innenstadt – Zentrumsbebauung
klimatologischer Ereignisse in der 2) Nordstadt – Block- und Blockrandbebauung
Innenstadt von Hannover für die 3) Kirchrode – lockere Einzel- und
Zeithorizonte 2001 bis 2010, 2046 Sommertag Hitzetag Tropennacht Reihenhausbebauung
bis 2055 und 2090 bis 2099 4) Georgengarten – Parkfläche
(Datenquelle: GEO-NET 2011) mit Bäumen und Gehölz
5) Kronsberg – landwirtschaftlich
2090 bis 2099 genutzte Freifläche
Die Referenzpunkte stehen für unterschiedliche
Baudichten bzw. Freiräume innerhalb der Stadt.
Die Art der Baustruktur (Dichte, Bauvolumen)
Betroffene des Hitzestresses werden vor allem ältere zum Ende des Jahrhunderts mit einer Erhöhung der To- und der Anteil städtischer Grünflächen haben
und geschwächte Menschen (aber auch Kleinkinder) desrate aufgrund gefäßbedingter Herzkrankheiten um einen großen Einfluss auf die Höhe der Wärme
sein. Vor dem Hintergrund des demographischen den Faktor 3 bis 5 gerechnet (DWD 2015). belastung im jeweiligen Stadtteil.
Wandels und dem zu beobachtenden Trend, dass äl-
tere Menschen aus dem Umland wieder in die Stadt Neben einer erhöhten Gesundheitsgefährdung bewir-
ziehen (kürzere Wege, hohes Dienstleistungsange- ken längere Hitzeperioden eine Beeinträchtigung des
bot), wird die Zahl der betroffenen (hitzesensiblen) Wohlbefindens (Lebensqualität) und der Leistungsfä-
Menschen noch zunehmen. Folgen des Hitzestresses higkeit der Stadtbevölkerung, wodurch die Produkti-
(insbesondere durch Tropennächte, da die nächtliche vität und somit auch die städtische Wirtschaft beein-
Erholungsphase nach einem Hitzetag fehlt) können ge- trächtigt werden können.
sundheitliche Beeinträchtigungen (z. B. Herz-Kreislauf- Mit der Klimaerwärmung kann auch einhergehen, Abb. 9: Sommerliche Wärmebelastung
Erkrankungen) sein, die unter Umständen auch zum dass Infektionskrankheiten zunehmen, die heute nur unter dem Einfluss des Klimawandels in der
Landeshauptstadt Hannover – Durchschnittliche
Tode führen können. Während des Hitzesommers 2003 in heißeren Klimaten vorkommen bzw. über in diesen Anzahl der Tage mit starker Wärmebelastung
sind in Europa 55.000 zusätzliche Todesfälle verzeich- heißeren Klimaten sich wohlfühlende Wirtstiere ver- (Quelle: GEO-NET 2011)
net worden, davon 7.000 in Deutschland. Nach einer breitet werden (z. B. Frühsommer-Meningoenzephalitis
Studie des Deutschen Wetterdienstes (2015) wird bis (FSME) und Lyme-Borreliose durch Zecken).12 13
2 Die Anpassungsstrategie für Hannover
K
„Die Zukunftsfähigkeit unserer Städte hängt
wesentlich von ihrer vorausschauenden Anpassung
an den Klimawandel ab.“
(Rainer Bomba, Staatssekretär im Bundesministerium
für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, 2010)
Obwohl die Klimasimulationen die schwerwiegends-
ten Veränderungen erst für die zweite Hälfte dieses
Jahrhunderts vorhersagen, müssen schon heute die
Weichen zu einer klimaangepassten, nachhaltigen Ent-
wicklung Hannovers gestellt werden. Denn die Folgen
des Klimawandels sind bereits spürbar, z. B. anhand von
Schäden durch Starkregenereignisse und sommerliche
Trockenperioden, die Gegenmaßnahmen erfordern.
Abb. 10: 1. Juni 2016: In Hannovers Innenstadt Die Anpassungsstrategie bezieht sich im Wesentlichen
flüchten Passanten vor Starkregen und Gewitter. auf die künftigen Probleme durch
(Bildrechte: dpa)
• Überwärmung der Stadt
(Hitzewellen, Tropennächte), Anpassungsstrategie und Maßnahmenprogramm 2012 – 2016
• verändertes Niederschlagsverhalten
lEBEN mIt DEm KlImAwANDEl –
(Starkniederschläge, Hochwassergefährdung),
HANNOVER PAsst sICH AN
Abb.11: • sommerliche Trockenperioden.
Sturzfluten machen das Autofahren Schriftenreihe kommunaler Umweltschutz – Heft 53
an diesem Tag zu einem Die von der Stadtverwaltung erarbeitete Anpassungs-
besonderen Erlebnis. strategie setzt den Schwerpunkt auf acht Aktionen,
(Bildrechte: dpa) LANDESHAUPTSTADT HANNOVER
die aus ihrer Sicht für die Stadt Hannover besonders
wichtig sind. Sie sind eng an das „Positionspapier zur
Anpassung an den Klimawandel“ der Fachkommission
LHH_Brosch_Klimawandel_v06_bb.indd 1 28.11.16 10:21
Umwelt des Deutschen Städtetages angelehnt, dass im
Juni 2012 veröffentlicht wurde. frühzeitig einkalkuliert werden. Die Anpassungsstrate-
gie soll dazu beitragen, dass rechtzeitig Maßnahmen
Eine weitere Folge des Klimawandels wird die Verschie- Bei der Auswahl von Maßnahmen sind die Vernetzungen zur Minimierung der negativen Folgen des Klimawan-
bung der jährlichen Niederschlagsverteilung sein. Im und Wechselwirkungen der (Teil-) Systeme in der Stadt dels in der Stadt getroffen werden. Dabei stellt die
Sommer werden die Niederschlagsmengen abneh- zu betrachten und mehrere positive Effekte zu koppeln. Machbarkeit und Finanzierbarkeit der Maßnahmen eine
men, länger anhaltende Trockenphasen mit negativen Ein besonders gutes Beispiel ist die Maßnahme „Dach- wichtige Voraussetzung für ihre Umsetzung dar. Je
Auswirkungen für die Stadtwälder, Grünflächen und begrünung“, die zahlreiche positive Effekte vereint: später eingegriffen wird, desto aufwändiger und teu-
die Gewässer werden häufiger auftreten. Durch Aus- Sie mindert die Aufheizung des Gebäudes, dient dem rer wird die Maßnahme bzw. die Schadensbeseitigung
trocknung des Oberbodens und höhere Erosionsgefahr Rückhalt von Niederschlagswasser, der Befeuchtung sein.
sind auch vermehrt Probleme durch Staub möglich. Im und Kühlung der Umgebungsluft und ist Lebensraum Die Anpassungsstrategie verfolgt nicht die Erstellung
Winter werden höhere Niederschläge erwartet, was die für Insekten und andere Tiere. Zudem verringert das eines vollständigen Anpassungsplanes, sondern gibt
Gefahr von Hochwasserereignissen steigen lässt. Au- begrünte Dach die Wärmeverluste des Gebäudes und Handlungshinweise und nennt wichtige Bausteine zur
ßerdem wird erwartet, dass die Häufigkeit und Inten- damit den Heizbedarf und die CO2-Emissionen (ist da- Anpassung. Da die Veränderungen durch den Klima-
sität lokaler Starkregenereignisse deutlich zunehmen mit nicht nur eine Maßnahme der Anpassung, sondern wandel nicht konkret vorhersagbar sind, muss die An-
wird (IPCC 2014). Für eine dicht bebaute und versiegel- auch des Klimaschutzes) und erhöht die Lebensdauer passungsstrategie flexibel auf Veränderungen und neue
te Stadtfläche bedeutet das eine erhöhte Vulnerabilität des Daches. Erkenntnisse reagieren können. Anpassungsmaßnah-
(Verwundbarkeit) gegenüber diesen Klimaänderungen, men haben in der Regel eine Vielzahl von positiven As-
z. B. durch Sturzfluten und Überflutungen mit entspre- pekten. Unabhängig von den zu erwartenden Klimaän-
chender Gefahr für die Gebäude und die dazugehörige derungen führen sie zur Schaffung von gesunden und
Infrastruktur wie Straßen und Kanalisation. Durch die 2.1 Ziele der hannoverschen angenehmen Lebensbedingungen und damit zu einer
Veränderung des Niederschlagsgeschehens können Steigerung der Lebensqualität in der Stadt Hannover.
auch Hochwassersituationen in den Fließgewässern Anpassungsstrategie
1 In einer Mischwasserkanalisation wird häus verschärft werden. Wenn während längerer Trocken-
liches, gewerbliches und industrielles Abwasser phasen mit entsprechend niedriger Wasserführung in Mit der Anpassungsstrategie sollen den Entscheidungs- „Ideales Stadtklima“ ist ein räumlich und zeitlich
gemeinsam mit dem Niederschlagswasser zur den Fließgewässern Starkregenereignisse auftreten, trägern die möglichen Folgen und Chancen des Klima- variabler Zustand der Atmosphäre in urbanen Be-
Kläranlage geleitet. Bei extremen Niederschlags-
kann durch Mischwasserentlastungen1 die Wasserqua- wandels sowie geeignete Anpassungsoptionen bekannt reichen, bei dem sich möglichst keine anthropogen
ereignissen, für die die Kanalisation und das
Klärwerk nicht bemessen wurden, reicht die
lität beeinträchtigt werden. gemacht werden, damit Anpassung in politischen und erzeugten Schadstoffe in der Luft befinden und den
Größe dieses Kanalnetzes und die Leistung des Des Weiteren sind stärkere Schwankungen des Grund- wirtschaftlichen Planungs- und Entscheidungspro- Stadtbewohnern in Gehnähe eine möglichst große
Klärwerkes nicht aus, um das gesamte Misch- wasserspiegels aufgrund der Verschiebung der jährli- zessen künftig verstärkt berücksichtigt werden kann. Vielfalt der urbanen Mikroklimate unter Vermei-
wasser zur Behandlung zuzuführen. Deshalb chen Niederschlagsverteilung zu erwarten. Auch wer- Insbesondere dort, wo es um mittel- bis langfristige dung von Extremen geboten wird.
wird ein Teil des mit Niederschlagswasser stark
verdünnten Abwassers über eine Mischwasser-
den die Sturmstärken zunehmen und – besonders in der Strukturentscheidungen (z. B. Raumnutzung) und In- (Fachausschuss Biometeorologie der Deutschen
entlastungsanlage in ein Fließgewässer geleitet Stadt mit Häufung von wertvollen Immobilien – ent- vestitionsentscheidungen (z. B. Infrastruktur, Forst- Meteorologischen Gesellschaft)
(Mischwasserentlastung). sprechende volkswirtschaftliche Schäden verursachen. wirtschaft) geht, müssen die Folgen des Klimawandels14 15
2.2 Das Entstehen der mögliche Anpassungsmaßnahmen zur Minderung der 3 Die Aktionsfelder und Beispiele
erster Anpassungsmaßnahmen
zu erwartenden Belastungen (z. B. Hitzewellen, Hoch-
Strategie wasser) vermittelt. Im Anschluss an diesen Workshop
wurden drei Arbeitsgruppen zu drei Aspekten des Kli-
Seit dem Frühjahr 2009 beschäftigt sich der Bereich mawandels gebildet:
Umweltschutz der Stadt Hannover intensiv mit dem
Thema „Klimawandel und Anpassung“. Anlass war u. • Hitzewellen, Tropennächte – Auswirkung
a. der Beschluss der Deutschen Anpassungsstrategie auf die menschliche Gesundheit
durch die Bundesregierung im Dezember 2008. Zu- • Änderung der Niederschlagsverteilung,
nächst wurde im November 2009 ein Thesenpapier Zunahme von Starkniederschlägen – Folgen
„Anpassungsstrategien zum Klimawandel“ fertigge- für die Stadtentwässerung, Umgang mit
stellt. Es beschäftigt sich mit den möglichen Verän- erhöhter Hochwassergefahr
derungen in Hannover durch den Klimawandel, nennt • Zunahme sommerlicher Trockenperioden –
Anpassungsmaßnahmen, die bereits Bestandteil des Auswirkung auf land- und forstwirtschaftliche
Verwaltungshandelns sind, und weitere Maßnahmen, Flächen sowie Naturschutz (insbesondere
die noch für notwendig erachtet werden. Als erste Gewässerschutz)
Schritte zu einer Anpassungsstrategie wurden vorge-
sehen: Einen Überblick über die beteiligten Fachressorts der
Arbeitsgruppen gibt nachfolgende Tabelle. Da das „Kli-
1. Erstellung eines Fachplans „Klima“ ma“ an der Stadtgrenze nicht endet, sind auch Fach-
als Grundlage für andere Planungen stellen der Region Hannover eingebunden worden. (Die
2. Durchführung eines Workshops zum Klimawandel Abkürzung FB bedeutet Fachbereich, die Ziffern benen-
und Anpassungsstrategien für Stadt- und nen die Organisationseinheiten.)
GrünplanerInnen und andere Beteiligte
3. Auflegen von städtischen Förderprogrammen, Die Ergebnisse der einzelnen Arbeitsgruppen waren
z. B. für Dach- und Fassadenbegrünung zentraler Bestandteil bei der Erarbeitung der Anpas- Abb. 12: Gründach in der
4. Bildung eines Netzwerkes von städtischen sungsstrategie für die Stadt Hannover. Mit der Bildung Innenstadt von Hannover
und externen Akteuren der Arbeitsgruppen entstand zugleich ein Netzwerk (Foto: FB Umwelt und Stadtgrün, LHH)
von städtischen und externen Akteuren, das im weite-
Die fachbereichsübergreifende Erarbeitung der Anpas- ren Verlauf der Entwicklung der Anpassungsstrategie
sungsstrategie für Hannover begann im Frühjahr 2010 noch erweitert wurde und sicherlich auch zukünftig
mit einem Einführungsseminar, an dem PlanerInnen noch erweitert werden wird.
der Stadtplanung, Grünflächenplanung und Stadtent-
wässerung sowie weiter interessierte MitarbeiterIn- Die „Anpassungsstrategie zum Klimawandel für die
nen der Stadtverwaltung teilnahmen. Bei dieser Fort- Landeshauptstadt Hannover“ wurde im April 2012 mit
bildung wurden Informationen über zu erwartende der Informationsdrucksache 0933/2012 der Öffent-
Klimaänderungen in Region und Stadt Hannover sowie lichkeit bekannt gemacht.
2.3 Das Maßnahmen Die Anpassungsstrategie unterteilt sich in acht Aktions notwendig erachtet und für die Zukunft geplant wird.
felder, die im Rahmen der Arbeitsgruppenphase (s. Pkt. Nicht alle Anpassungsmaßnahmen sind im Rahmen des
Landeshauptstadt Hannover programm 2012 2.2) als besonders bedeutend definiert wurden: Maßnahmenprogramms 2012 – 2016 finanziert und
durchgeführt worden, sondern wurden im Rahmen an-
FB Büro Oberbürgermeister 15.2 Grundsatzangelegenheiten bis 2016 Aktionsfeld 1: Hochwasserschutz dere Maßnahmen (z. B. Hochwasserschutz, Straßensa-
FB Gebäudemanagement 19.02 Zentrale Ingenieuraufgaben Aktionsfeld 2: Regenwassermanagement und nierung) finanziert.
FB Planen und Stadtentwicklung 61.1 Stadtplanung Im Januar 2012 wurde die Stadtverwaltung vom Rat Umgang mit Starkregenereignissen
61.4 Stadterneuerung und Wohnen der Landeshauptstadt Hannover beauftragt, ein auf Aktionsfeld 3: Vorsorgender Boden- und
fünf Jahre anzulegendes „Programm zur Minimierung Grundwasserschutz
FB Tiefbau
FB Umwelt und Stadtgrün
66.3 Straßenerhaltung, Wasser- und Brückenbau
67.1 Umweltschutz
der Folgen der Klimaerwärmung“ zu erarbeiten und Aktionsfeld 4: Dachbegrünung 3.1 Hochwasserschutz
umzusetzen mit dem Ziel, die Lebensqualität in der Aktionsfeld 5: Klimaangepasste Vegetation
67.2 Planung und Bau Stadt trotz der Klimaveränderung zu erhalten oder so- Aktionsfeld 6: Klimaangepasste Stadtplanung und 3.1.1 Baulicher Hochwasserschutz
67.3 Öffentliche Grünflächen gar zu verbessern. Zur Umsetzung erster Maßnahmen klimaangepasstes Bauen
67.7 Forsten, Landschaftsräume und Naturschutz wurde das Programm für den Zeitraum 2012 bis 2016 Aktionsfeld 7: Fachkarte Klimaanpassung Hochwasserereignisse – gemeint sind damit Überflu-
mit insgesamt 1.050.000 Euro ausgestattet. Aktionsfeld 8: Öffentlichkeits- und Bildungsarbeit tungen durch Flusshochwasser (Überflutungen in Fol-
Stadtentwässerung Hannover 68.1 Planung und Bau
Das daraufhin erarbeitete Maßnahmenprogramm wur- ge von Starkregenereignissen werden im Aktionsfeld 2:
de im Juli 2012 als Informationsdrucksache 1554/2012 Im Folgenden werden diese Aktionsfelder genauer vor- Regenwassermanagement behandelt) – treten in den
Region Hannover dem Rat und der Öffentlichkeit vorgestellt. gestellt, wobei zunächst jeweils auf die grundsätzliche letzten Jahren immer häufiger auf. Grund dafür können
FB Umwelt 36.02 Klimaschutz und Umweltmanagement Bedeutung eingegangen und im Anschluss der Umset- die klimatischen Veränderungen sein. Die Wahrschein-
zungsstand konkreter Maßnahmen erläutert wird. lichkeit ist groß, dass Extremwetterlagen, die bei-
36.09 Gewässerschutz (zentrale Aufgaben)
Einige Maßnahmen sind bereits umgesetzt worden, an- spielsweise zu einem hundertjährlichen Regenereignis
FB Gesundheit 53.06 Allg. Infektionsschutz und Umweltmedizin dere befinden sich in der Umsetzung oder ihre Umset- führen, zukünftig häufiger auftreten als bisher.
FB Planung und Raumordnung zung steht kurzfristig bevor (Planung abgeschlossen). In der Stadt Hannover gibt es Hochwasserschutz-
61.01 Regionalplanung
Teilweise war es erforderlich, einzelne Maßnahmen anlagen wie Deiche, allerdings würden große Sied-
durch Förderprogramme zu unterstützen (z. B. durch lungsflächen wie die Calenberger Neustadt und weite
das Dach- und Fassadenbegrünungsprogramm). Dane- Teile Ricklingens bei einem hundertjährlichen Hoch-
ben gibt es weitere Maßnahmen, deren Umsetzung als wasserereignis trotzdem überflutet werden. Die Stadt16 17
hat daher im Jahr 2006 beschlossen, große Teile des
Stadtgebietes vor einem hundertjährlichen Hochwas-
serereignis zu schützen (LHH 2006). Dazu wurde das
Maßnahmenprogramm Hochwasserschutz in Hannover
mit einem Investitionsvolumen von etwa 30 Millionen
Euro aufgestellt, das die Aufweitung des Abflussquer-
schnitts an der Ihme in der Calenberger Neustadt zwi-
schen Legionsbrücke und Leinertbrücke sowie die Ver-
längerung der Deichanlagen in Ricklingen zum Inhalt
hat. Teilmaßnahmen wie der Neubau der Benno-Oh-
nesorg-Brücke und die Neugestaltung des Ihmeufers
(incl. Sanierung des ehemaligen Gaswerkstandortes
an der Glocksee) zum neuen Ihmepark sind in 2012
abgeschlossen worden. Die Umsetzung der weiteren
Maßnahmen (die Verlängerung des vorhandenen Dei-
ches in Ricklingen sowie kleinere Verbesserungen an
der Leine im Bereich der Königsworther Straße und
in Linden-Nord) hat in 2012 begonnen und wird Ende
2016 abgeschlossen werden.
Abb. 15: Das naturnah gestaltete
Die Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahmen be- Gewässerbett des Roßbruchgrabens
deutet eine deutliche Verbesserung des technischen oberhalb der Hollerithallee im
Hochwasserschutzes und damit verbunden eine Erhö- Stadtteil Marienwerder
hung des Schutzniveaus für die Stadt Hannover. (Foto: FB Umwelt und Stadtgrün, LHH)
Abb. 13: Mit dem Neubau der Benno-Ohnesorg-Brücke
ist der Abflussquerschnitt um 21 Meter vergrößert worden.
(Foto: FB Umwelt und Stadtgrün, LHH)
3.1.2 Vorbeugender Hochwasserschutz 3.1.3 Fließgewässerrenaturierung
3.2 Regenwassermanage-
Der bauliche Hochwasserschutz stellt jedoch nur eine Durch Eingriffe des Menschen in das Einzugsgebiet
Komponente des Hochwasserschutzes dar, die Sensi- der Gewässer oder in die Gewässer selbst sind die ur- ment und Umgang mit
bilisierung und Bewusstseinsbildung der Bevölkerung sprünglich strukturreichen Fließgewässer stark verän-
hinsichtlich vorbeugenden Hochwasserschutzes ist dert worden. Mit der Begradigung der Gewässer und Starkregenereignissen
ebenso wichtig. der Nutzung der Auen gingen vor allem Überschwem-
2015 ist bei der Landeshauptstadt Hannover eine mungsflächen verloren. Bei Hochwasserereignissen
zentrale Hochwasserschutzkoordinationsstelle zur führt der Verlust dieser natürlichen Retentionsräume „Der Tiefausläufer eines Tiefs über der Nordsee
Auswertung vergangener Hochwasserereignisse, zur zu höheren Hochwasserspitzenabflüssen. Die Begradi- überquert Deutschland ostwärts und führt feuchte
Analyse von Schwachstellen, zur Optimierung des gung der Fließgewässer beschleunigt die Abflüsse und und zunächst noch milde Meeresluft heran. Dabei
hannoverschen Hochwasserschutzsystems und zur führt in den Unterläufen der Gewässer (und insbeson- kommt es zu teils schauerartigem oder gewittri-
Bevölkerungsinformation geschaffen worden. Durch dere in der Leine) zur Erhöhung des Hochwasserpegels. gem Regen. Besonders in der zweiten Tageshälfte
diese bei der Stadtentwässerung angesiedelte Stelle Zu den weiteren negativen Auswirkungen der mensch- können Schauer und GEWITTER auftreten die
werden die Planungen und Umsetzungen des Hoch- lichen Eingriffe gehören der Verlust von Tier- und auch heftig sind, so dass lokal unwetterartiger
wasserschutzes für Hannover im fachübergreifenden Pflanzenarten, die Verschlechterung der Wassergüte STARKREGEN, HAGEL und STURMBÖEN nicht
Dialog koordiniert. Ziel ist es, mit allen Beteiligten den und die Veränderung der Grundwasserneubildung. ausgeschlossen werden können. Auch in der Nacht
hannoverschen Hochwasserschutz an sich ändernde Seit 1996 besteht ein Ratsbeschluss, die hannover- zum Samstag bleibt das Wetter unbeständig mit
Rahmenbedingungen anzupassen und strategisch wei- schen Fließgewässer wieder naturnäher und struktur- Schauern und Gewittern, besonders im Süden
terzuentwickeln. reicher zu gestalten. Das dafür entwickelte „Programm und in der Mitte.“
BürgerInnen, die in überschwemmungsgefährdeten Ge- naturnahe Gewässergestaltung“ wird federführend (Wettervorhersage für Hannover vom 5.8.2011, DWD)
bieten wohnen, müssen sich dieser Tatsache bewusst durch die Stadtentwässerung umgesetzt. In das Pro-
sein, damit sie eigenverantwortlich Vorsorgemaßnah- gramm wurden insgesamt 37 Fließgewässer aufge-
men treffen können, z. B. durch die Sicherung von nommen. An der Mehrzahl der Gewässer wurden be- Auf unversiegelten, mit Vegetation bewachsenen Flä-
Kellerräumen vor Überflutung und hochwassersichere reits Maßnahmen durchgeführt. chen kann ein großer Teil des Niederschlagswassers
Lagerung von Wertgegenständen. Zum vorbeugenden Zu den Umgestaltungsmaßnahmen gehören unter (zwischen)gespeichert werden. Ein Teil des Wassers
Abb. 14: Der neue Deichkörper mit Deichverteidigungsweg
Hochwasserschutz gehört auch eine entsprechende anderem die Anlage von Hochwasserprofilen mit ab- versickert, ein Teil wird in der Vegetation zurückgehal-
im Stadtteil Ricklingen im Februar 2015. Architektur (bauliche Schutz- und Vorsorgemaßnah- wechslungsreich gestalteten Böschungsneigungen und ten und verdunstet (Evaporation) oder wird nach Auf-
(Foto: FB Umwelt und Stadtgrün, LHH) men). Umfangreiche Informationen dazu hat die Stadt- Bermen (horizontaler Absatz innerhalb einer Böschung) nahme durch die Pflanzen über die Blattoberflächen
entwässerung auf ihrer Internetseite (www.stadtent- in Mittelwasserhöhe, die Schaffung von Ersatzauen an die Atmosphäre abgegeben (Transpiration). Nur ein
waesserung-hannover.de) bereitgestellt. durch die Anlage strukturreicher Gewässerrandstreifen relativ kleiner Anteil des Niederschlagswassers fließt
Der Katastrophenschutz beinhaltet Hochwassermana und die Aufweitung der Abflussprofile sowie die Akti- zeitverzögert oberflächig ab.
gementpläne ebenso wie optimierte Frühwarnsysteme, vierung von Überschwemmungsflächen durch den Ab- Auf versiegelten Flächen, z. B. Straßen und Dächern,
automatisierte Pegelabfragen und Notfallübungen. trag von Deichen in der Leineaue, wie z. B. im Bereich verdunstet nur ein sehr geringer Teil des Regenwas-
Stöcken erfolgt. Eine Aufweitung der Gewässerprofile sers, eine Versickerung findet nicht statt. Daher wird
wurde beispielsweise bei der Renaturierung der Fösse, der größte Teil des Regenwassers ohne Zeitverzöge-
des Hirtenbaches, des Laher Grabens und der Wietze rung oberflächig abgeleitet.
umgesetzt. Diese Maßnahmen haben u. a. das Ziel, den
Abfluss in den Fließgewässern zu verzögern und Hoch-
wasserereignisse zu mildern.18 19
Im Normalfall gelangt dieser Oberflächenabfluss durch • Rückhalt des Regenwassers durch technische
die Kanalisation zur Kläranlage (Mischwasserkanali- Zwischenspeicher (Zisternen). Nutzung des Wassers Tipp: In einem 10minütigen Film informiert
sation) oder in die Fließgewässer (Trennkanalisation zur Bewässerung öffentlicher Flächen während die Stadtentwässerung Hannover interessierte
bzw. Abschlag aus der Mischwasserkanalisation). Bei Trockenwetterperioden. Grundstückseigentümerinnen und Grundstücks-
außergewöhnlich starken Niederschlägen, sogenann- • Entsiegelung befestigter Flächen, insbesondere in- eigentümer umfassend über Maßnahmen, um das
ten Starkregenereignissen, für die das Kanalnetz aus nerhalb hoch versiegelter Stadtteile und dauerhafte eigene Grundstück bzw. Haus vor Überflutungen
technischen und wirtschaftlichen Gründen nicht aus- Begrünung dieser Flächen. (Beispiele: Entsiege- durch extreme Regenereignisse zu schützen.
gelegt sein kann, können die Wassermengen jedoch lung nicht mehr benötigter/überdimensionierter Ein besonderes Thema ist dabei der Einbau
nicht vollständig von der Kanalisation aufgenommen Verkehrsflächen, Vergrößerung der Baumscheiben einer Rückstausicherung.
werden. Als Folge kann es zu Überstauungen des Ka- in der Innenstadt, Entsiegelung in Innenhöfen,
nalnetzes kommen. Reduzierung der Verkehrsfläche am Hohen Ufer
Zusätzlich kann sich die Oberflächenabflusssituation durch Anlage eines Grünzuges entsprechend dem
dadurch verschärfen, dass sich Straßeneinläufe durch Programm City 2020). Umsetzung des Maßnahmenprogramms
Treibgut (z. B. Laub) zusetzen bzw. dass das Fassungs- Abb. 16: Eingeschränkte Funktion des Straßeneinlaufes
vermögen des Straßeneinlaufquerschnitts für die an- durch Abschwemmungen von Pflanzenmaterial, Mit Hilfe des Maßnahmenprogramms sind erste Entsie-
fallenden Wassermengen zu gering ist, wodurch das hier auf dem Trammplatz vor dem Neuen Rathaus. „Darüber hinaus richten Starkniederschläge gelungsmaßnahmen finanziert worden. Nähere Erläu-
Regenwasser nicht aufgenommen werden kann und (Foto: FB Umwelt und Stadtgrün, LHH)
insbesondere in Städten große Schäden an. terungen dazu stehen in Kapitel 3.3 und 3.5.
somit darüber hinweg schießt. Dabei sind Anpassungsmaßnahmen, welche auf Daneben wurden Maßnahmen gefördert, die der Re-
eine „wassersensible“ Stadtgestaltung hinaus genwasserrückhaltung bei Starkregenereignissen
Um Oberflächenwasser zurückzuhalten und die Gefahr laufen, von großer Bedeutung. Wir empfehlen, dienen. So wurde durch die Wiederherrichtung von
von Überflutungen zu vermeiden, trifft die Stadt Han- Über sonstige Maßnahmen: dezentrale Regenwasserversickerung und Ober- verlandeten Gräben im Seelhorstwald neuer Retenti-
nover bisher folgende Gegenmaßnahmen (LHH, 2000): flächen so zu gestalten, dass sie unter normalen onsraum geschaffen, der eine gleichmäßigere Wasser-
• Nutzung von Regenwasser als Betriebswasser Wetterbedingungen für Freizeitaktivitäten genutzt führung des Dreibirkenbaches / Seelhorstbaches zur
• Indirekte Förderung der Entsiegelung privater werden können, im Ereignisfall aber dem Wasser- Folge hat (siehe Abb. 17). Hochwasserspitzen werden
Über die Bauleitplanung: Flächen durch Gebührensplitting rückhalt dienen.“ so verringert. Das hat sowohl für die Siedlungsgebiete
• Renaturierung von Fließgewässern (vgl. Pkt. 3.1.2) (Jochen Flasbarth, UBA, Statement zur Pressekonferenz: im Unterlauf als auch für die Gewässerökologie der Bä-
• Festsetzung von Regenwasserversickerung „Anpassung an extremere Wetterereignisse im Klima von che positive Auswirkungen. Die Rückhaltung von Ober-
• Festsetzung von technischen Zwischenspeichern Da aufgrund des Klimawandels zukünftig lokale Stark morgen“ am 15. Februar 2011 in Berlin) flächenwasser im Waldgebiet erspart zudem den Bau
zur Drosselung des Abflusses regenereignisse häufiger auftreten werden und wäh- eines Regenrückhaltebeckens.
• Anlage von Regenrückhaltebecken rend der Wintermonate höhere Niederschläge zu er-
• Festsetzung von Dachbegrünung (vgl. Pkt. 3.4) warten sind, werden weitere Maßnahmen/Strategien
notwendig. Um auf die Folgen des Klimawandels ange-
messen und vorbeugend reagieren zu können, ist eine
Seit 1993 ist die Regenwasserbewirtschaftung „wassersensible“ Planungskultur anzustreben. Inno-
fester Bestandteil der städtebaulichen Planung. vative Lösungen und neue Bilder von „Wasser in der
Im Bebauungsplanverfahren wird in einem Stadt“ sind gefragt. Dazu gehört auch die Akzeptanz
mehrstufigen Verfahren geprüft, ob und wie der des Wassers an Orten, an denen es gewöhnlich nicht zu
Untergrund für eine Regenwasserbewirtschaftung/ finden ist. Zur Vermeidung von Überflutungen und zur
Versickerung geeignet ist und welches Versicke- Entlastung der Kanalisation ist eine Regenwasserbe-
rungs-/Rückhaltesystem geeignet ist. wirtschaftung notwendig, die das Niederschlagswas-
Um eine Optimierung zu erreichen, sind ser möglichst lange (schadlos) an der Oberfläche zu-
folgende Prioritäten und Planungsvarianten rückhält. Folgende Maßnahmen werden daher geprüft:
(von „optimal“ – bei 1. – bis „sollte nach Mög-
lichkeit vermieden werden“ – bei 6. –) verbindlich • Stadtteile / Straßenbereiche (z. B. Senken)
einzuhalten und werden systematisch geprüft: identifizieren, die im Falle eines Starkregens
besonders überflutungsgefährdet sind.
1. (vollständige) Regenwasser-(RW) • Entlastung dieser Bereiche durch Abhängen
Versickerung in Mulden seitlicher (Kanal-)Zuläufe oder Anbindung dieser
2. (vollständige) RW-Versickerung Gebiete an geringer belastete Kanäle / Gebiete.
in Mulden-Rigolen • Schaffung zusätzlicher Versickerungsflächen
3. RW-Ableitung in Mulden und Rückhaltung (auch unabhängig von Bauleitplanverfahren).
in Regenrückhaltebecken (trocken/nass) • Gezielte Steuerung der Abflusswege des Regen-
4. RW-Ableitung über Mulden wassers einschließlich entsprechender Gestaltung
in Fließgewässer/Gräben dieser Flächen (Notwasserwege) durch Einbezie-
5. RW-Ableitung über Mulden hung der Starkregenereignisse in die Planung von
in RW-Kanalisation Straßen, Wegen und Plätzen; Ausbau von Verkehrs-
6. (möglichst nicht mehr) Ableitung flächen als Rückstauräume.
des Regenwassers von Straßen- und • Anpassung der Gestaltung von Straßenprofilen,
Dachflächen in die Regenwasserkanalisation. Hochborden und Hauseingängen an eine bei
Starkregenereignissen erforderliche Wasserabfuhr.
Auszug aus den ökologischen Standards, Landeshauptstadt • temporäre Nutzung von Flächen mit geringem
Hannover 2009 Schadenpotenzial wie Grünflächen, Parkplatzflä-
chen etc. als Notüberlaufflächen (Mehrfach- und
Zwischennutzung von Flächen).
Abb. 17 : Ausschnitt aus dem Lageplan „Retentionsmaßnahmen Seelhorstwald“
(Plan: Stadtentwässerung Hannover)20 21
Folgende weitere Maßnahmen werden geprüft: Neben diesen klimatischen Effekten können Dachbe-
• Erhalt von naturnahen Böden (und der auf ihnen grünungen auch die Luftqualität im Stadtgebiet ver-
wachsenden Vegetation) unter besonderer bessern, da sie Luftverunreinigungen (vor allem Fein-
Berücksichtigung ihrer klimawirksamen Funktionen. staub) binden und herausfiltern.
• Fortsetzung des Flächenrecycling: Ein weiterer positiver Effekt ist der Regenwasserrück-
Rückführung von ehemaligen Industrie- und halt, indem 70 (extensive Begrünung) bis 90 Prozent
Gewerbeflächen in die Nutzung und Revitalisierung (intensive Begrünung) der Niederschläge in der Ve-
von Flächen durch Altlastensanierung, getationsschicht aufgefangen und durch Verdunstung
Wiederherstellung bzw. Verbesserung wieder an die Stadtluft abgegeben werden (Sieker u. a.,
der Nutzungsfunktion (gute Beispiele sind 2002). Dies trägt zur Abkühlung der Luft in versiegel-
das Ahrbergviertel und das Pelikanviertel). ten Stadtteilen bei. Verbleibende Abflüsse werden in
• Entsiegelung von Flächen ohne Schadstoffbelastung der Substratschicht zwischengespeichert und zeitver-
und Wiederherstellung natürlicher Bodenfunktionen zögert an die Kanalisation abgegeben. Spitzenabflüsse
(vgl. Pkt. 3.2). (bei Starkregenereignissen) werden durch begrünte
• Humusmehrende Bewirtschaftung/Bearbeitung Dächer gegenüber unbegrünten Dachflächen um etwa
kommunaler Grün-, Park- und Forstflächen. 50 Prozent reduziert.
• Alternative Bewässerungskonzepte Zudem bieten Dachbegrünungen Lebensraum für zahl-
für innerstädtische Grünflächen, wenn diese reiche Pflanzen und Tiere und erhöhen somit die biolo-
zum Erhalt ihrer Funktion während längerer gische Vielfalt gerade in stark besiedelten städtischen
Trockenperioden bewässert werden müssen. Quartieren. Für den Menschen erzielen sie durch die
Trinkwasser und Grundwasser sollen so wenig Verbesserung des Arbeits- und Wohnumfeldes eine
Abb. 18: Die Busspur auf dem
wie möglich für die Bewässerung der Grünflächen nicht zu unterschätzende Wohlfahrtswirkung.
Friedrichswall wurde entsiegelt eingesetzt werden. Ein weiterer entscheidender Vorteil der Dachbegrü-
und in eine Rasenfläche verwandelt. nung liegt in der Verlängerung der Lebensdauer der
Zusätzlich wurden am Rand der Dachabdichtung. Sie ist wirksam geschützt vor UV-
Fläche einige Bäume neu gepflanzt. Umsetzung des Maßnahmenprogramms Strahlung, Hagelschlag, Hitze und Kälte. Temperatur-
(Foto: FB Umwelt und Stadtgrün, LHH)
bedingte Spannungen werden abgebaut.
2013 konnte eine Verkehrsfläche von rund 4000 m² Gründächer schließen die Installation von Photovoltaik
entsiegelt und anschließend begrünt werden. Es han- nicht aus. Ganz im Gegenteil: Durch eine Dachbegrü-
delt sich dabei um die Busspur auf dem Friedrichswall, nung wird der Wirkungsgrad der Anlage erhöht, denn
3.3 Vorsorgender Boden- zu steuern, dass die positiven klimatischen Auswirkun- die zwischen Willy-Brandt-Allee und Lavesallee am die Leistung der Module verringert sich um ca. 0,5 %
gen der Böden erhalten bleiben und die Klimaände- Neuen Rathaus vorbeiführte (siehe Abb. 18). pro Grad Celsius Aufheizung. Da auf begrünten Dach-
und Grundwasserschutz rungen sich möglichst geringfügig auf die natürlichen Weitere Entsiegelungen kleineren Umfangs erfolgten flächen in der Regel 35° C nicht überschritten werden,
Funktionen der Böden auswirken können. seit 2012 im Zusammenhang mit der Sanierung von bleiben die Module auf dem Gründach kühler und da-
Die vielfältigen Funktionen des Bodens, die in § 2 Satz Zur Bewertung der Böden und ihrer Funktionen hat die Baumstandorten (siehe Pkt. 3.5). mit ein hoher Leistungsgrad erhalten. Die Verwaltung
2 des Bundesbodenschutzgesetzes beschrieben wer- Stadtverwaltung in 2009 eine digitale Bodenfunktions- strebt daher im eigenen Bestand an, auf Flachdächern
den, müssen vor möglichen negativen Auswirkungen karte erstellen lassen, die eine umfassende Bewer- parallel extensive Dachbegrünung und Photovoltaikan-
des Klimawandels geschützt und seine Ausgleichsfunk- tung der Schutzwürdigkeit der Böden im Stadtgebiet lagen zu verwirklichen und berät Dritte entsprechend.
tionen erhalten und verbessert werden. Naturnahe Bö- Hannovers ermöglicht. In einem weiteren Schritt soll Einschränkungen bestehen durch die erforderliche
den mit fruchtbarer Humusauflage und vielfältigen Ge- eine Erfassung der Böden erfolgen, die als besonders 3.4 Dachbegrünung Akzeptanz der erhöhten Kosten und aufgrund stati-
meinschaften von Bodenorganismen tragen erheblich klimawirksam eingestuft werden können. Klimawirksa- scher Verhältnisse, wenn diese eine Doppelnutzung
zur Verbesserung des Stadtklimas bei. Durch die gerin- me Böden sind als Kohlenstoffspeicher von besonderer Begrünte Dächer stellen oft die kleinsten Grünflächen gewichtsmäßig nicht zulassen.
gere Oberflächenerwärmung und höhere Verdunstung Bedeutung für den Klimaschutz (z. B. Moorböden) und im Stadtgebiet dar. Gerade in dicht besiedelten und
naturnaher Böden gegenüber versiegelten Flächen für die Minderung der Auswirkungen des Klimawandels stark versiegelten Stadtteilen, mit Straßenzügen, in Der Werkhof Stammestraße –
können die prognostizierten zunehmenden Hitzestaus (z. B. Böden mit einem hohen Wasserspeicherpoten- denen kein Platz mehr für Straßenbäume vorhanden ein Musterbeispiel für die Kombination von
lokal gemindert werden. Die Wasserspeicherfunktion zial). Gleichzeitig können klimawirksame Böden aber ist, bleibt häufig nur die Möglichkeit, Dächer als Vege- Dachbegrünung mit einer Photovoltaikanlage
naturnaher Böden trägt dazu bei, die Auswirkungen auch sehr empfindlich auf die Auswirkungen des Kli- tationsfläche zu erschließen.
von Starkregenereignissen und sommerlichen Tro- mawandels reagieren. Dachbegrünungen verbessern in erster Linie die mik- Als Ausgleichmaßnahme für zusätzliche Versiegelun-
ckenperioden durch die zu erwartenden Veränderun- Das durch den Klimawandel veränderte Niederschlags- roklimatischen Verhältnisse am Gebäude selbst, ohne gen sowie als Beitrag zum nachhaltigen ökologischen
gen im Niederschlagsregime zu vermindern. verhalten wird sich in jedem Fall auf die Grundwas- eine große Fernwirkung zu erzielen. Die thermischen Bauen wurde beim Neubau im Jahr 2007 auf dem So-
Eine besondere Rolle spielen kohlenstoffreiche Böden serstände auswirken, die Grundwasserschwankungen Effekte liegen hauptsächlich in der Abmilderung von zialgebäude des städtischen Werkhofs Stammestraße
(z. B. Moorböden und Grund- und Stauwasser beein- werden zunehmen. Dadurch bedingt kann es in be- Temperaturextremen im Jahresverlauf. Die Vegeta- 102 eine extensive Dachbegrünung aufgebracht. Die
flusste Mineralböden), die im Hinblick auf ihre Funk- stimmten Bereichen des Stadtgebietes im Sommer tionsschicht und deren Verdunstung vermindern das mit einer Substratschicht von mindestens 7 cm be-
tion als Treibhausgasspeicher sehr bedeutsam sind. durch Austrocknung des Bodens zu Setzungen kom- Aufheizen der Dachflächen bei intensiver Sonnen- deckte Fläche umfasst ca. 1.300 m2 (siehe Abb. 19).
Die Zerstörung dieser Böden führt zu einem deutlichen men, in den Wintermonaten hingegen zu „feuchten einstrahlung im Sommer und den Wärmeverlust des Durch die Dachbegrünung kann mehr als die Hälfte
Austrag an Kohlenstoffdioxid und anderer klimarele- Kellern“. Erhöhte Grundwasserstände können aber Hauses im Winter. Dies führt zu einer ausgeglichenen der Niederschlagsmengen zurückgehalten werden.
vanter Gase in die Atmosphäre und trägt somit in er- auch dazu führen, dass bislang nicht grundwasserbe- Klimatisierung der Räume und senkt den Heizenergie- Ein Großteil dieses Wassers verdunstet, der Rest fließt
heblichem Maße zum Fortschreiten des Klimawandels einflusste Bodenhorizonte mit Schadstoffbelastungen bedarf. zeitverzögert ab, wird in einer Zisterne zwischenge-
bei. (z. B. flächenhafte Auffüllungen im Innenstadtbereich) speichert und in der Waschhalle als Brauchwasser zum
Trotz der Nutzung, Bewirtschaftung und Überplanung zumindest zeitweise Grundwasserkontakt bekom- Reinigen der Betriebsfahrzeuge und Arbeitsmaschinen
der Böden durch den Menschen müssen die Risiken von men und dadurch ein erhöhter Schadstoffaustrag ins „Während Kiesdächer und schwarze Bitumenpappe genutzt.
Bodenverdichtung, Wasser- und Winderosion, starker Grundwasser erfolgt. Diese Aspekte gilt es sowohl bei sich auf etwa 50 °C bis über 80 °C aufheizen, Die Photovoltaikanlage besteht aus 120 Polykristalli-
Veränderung des Bodenwasserhaushalts, abnehmen- der Flächenentsiegelung als auch im Rahmen des qua- betragen die maximalen Temperaturen bei nen Solarmodulen mit einer Leistung von 24,6 kWp auf
der Humusgehalte und der Mobilisierung von Schad- litativen Grundwassermonitorings, das seit 2003 be- bepflanzten Dächern etwa 20 °C bis 25 °C.“ einer Fläche von 200 m2. Im Jahr 2014 lag der Ertrag
stoffen so weit wie möglich verringert werden. trieben wird, zu berücksichtigen. (Städtebauliche Klimafibel Stuttgart) dieser Anlage bei ca. 17.327 kWh.
Ziel des zukünftigen Umgangs mit den städtischen Bö- Die Boden- und Grundwasserinformationen fließen in
den ist es, die Bodennutzung und Überplanung derart die Stellungnahmen zur Bauleitplanung ein.Sie können auch lesen