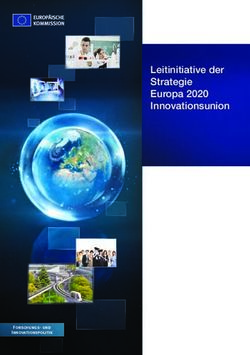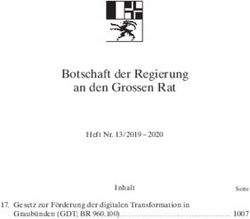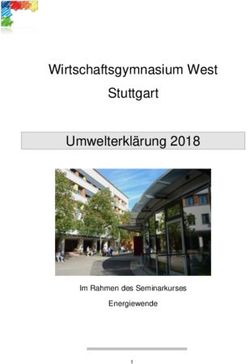Maritime Forschungsstrategie 2025 - BMWi
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Impressum
Herausgeber
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi)
Öffentlichkeitsarbeit
11019 Berlin
www.bmwi.de
Stand
April 2018
Druck
Druck- und Verlagshaus Zarbock GmbH & Co. KG,
Frankfurt
Gestaltung
PRpetuum GmbH, München
Bildnachweis
AIDA Cruises / S. 14, 15
ATLAS ELEKTRONIK GmbH / S. 9, 19
BMWi/Susanne Eriksson / S. 3
Briese Schiffahrt / S. 11, 25, 43
Dr. Lars Tiepolt / S. 4
EvoLogics GmbH / S. 38
Fotolia/green2 / S. 5
Getty Images
anucha sirivisansuwan / S. 6
Maximilian Stock Ltd. / S. 29
mikeuk / S. 18
Hapag-Lloyd AG / S. 33, 35
Hamburg Süd / S. 17, 36
iStock/gridcaha / S. 42
Marie Heidenreich/Projektträger Jülich / S. 26 Diese und weitere Broschüren erhalten Sie bei:
Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
SAL Heavy Lift GmbH, Hamburg / S. 7, 39, 40, 45 Referat Öffentlichkeitsarbeit
E-Mail: publikationen@bundesregierung.de
Siem Offshore Contractors GmbH / Titel, S. 8, 10 www.bmwi.de
Shutterstock Zentraler Bestellservice:
ARTSIOM ZAVADSKI / S. 8 Telefon: 030 182722721
Sailorr / S. 13 Bestellfax: 030 18102722721
Thinkstock Diese Publikation wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und
Tryaging / S. 12 Energie im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit herausgegeben. Die Publi-
vlarub / S. 30 kation wird kostenlos abgegeben und ist nicht zum Verkauf bestimmt.
Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern
Vattenfall Europe Windkraft GmbH / S. 20, 21, 23 während eines Wahlkampfes zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet
werden. Dies gilt für Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
www.raytheon-anschuetz.com / S. 16, 22, 24 sowie für Wahlen zum Europäischen Parlament.1
Inhalt
Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1. Ausgangslage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Herausforderungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nationale Perspektive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Internationale Perspektive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Ergebnisse der Programm-Evaluation „Maritime Technologien der nächsten Generation“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
2. Maritimes Forschungsprogramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Strategische Perspektive . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
3. Maritime Querschnittsthemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
MARITIME.green – Umweltschonende maritime Technologien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
MARITIME.smart – Maritime Digitalisierung und smarte Technologien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
MARITIME.safe – Maritime Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
MARITIME.value – Maritime Ressourcen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
4. Echtzeittechnologien für die Maritime Sicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Beobachtung von Seegebieten und der dortigen Infrastruktur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Multisensorielle Datenfusion und integrierte Lagebilderstellung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Dienstbasierte Assistenzsysteme und integrierte Verkehrs- und Transportleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Online-Zustandsüberwachung bei Schiffen und maritimen Strukturen zur Fernwartung und Intervention . . . . . . 24
5.
Säulen im Maritimen Forschungsprogramm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
5.1 Schiffstechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Innovative Schiffs- und Antriebskonzepte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Reduzierung von Energiebedarf und Emissionen mit Ziel Null Emissionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Erhöhung der Schiffs- und Systemsicherheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Schöpfen von Potenzialen durch Digitalisierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
5.2 Produktion maritimer Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Flexible und automatisierte Produktionstechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Effiziente Produktionsorganisation für hochkomplexe Produkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Digital vernetzte Produktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Einsatz innovativer Fertigungsverfahren und Materialien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
5.3 Schifffahrt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Innovationen für einen sicheren, effizienten und umweltschonenden Schiffsbetrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Maritime Digitalisierung, Assistenzsysteme und Autonomie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Mensch-Maschine-Interaktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
5.4 Meerestechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Intelligente und autonome Systeme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Nachhaltige und wirtschaftliche Offshoretechnik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Marine Ressourcen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
6. Rahmenbedingungen der Förderung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Zuwendungsempfänger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Zuwendungsvoraussetzungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Art, Umfang und Höhe der Zuwendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Verfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Informationsquellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
Vorwort
Vorwettbewerbliche Forschung und Entwicklung sind für nachhaltiger Technologien, bei der Sicherung sowie dem
die Wettbewerbsfähigkeit der maritimen Branche beson- Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit und beim Aufspüren
ders bedeutende Bausteine. Die Maritime Forschungs klima- und umweltverträglicher Lösungen. Im speziellen
strategie der Bundesregierung ist daher Bestandteil indus Interesse der öffentlichen Hand liegt dabei die Sicherung
triepolitischen Handelns und dient dazu, bestehende mari- und Schaffung hochwertiger maritimer Arbeitsplätze sowie
time Geschäftsfelder abzusichern und neue Geschäftsfelder die Verbesserung der maritimen Wertschöpfung im Land.
zu erschließen. Vor diesem Hintergrund wird die Maritime
Forschungsstrategie 2025 durch zwei neue Förderinstru- Die Komplexität dieser Aufgabe wird in den kommenden
mente gestärkt: dem „Maritimen Forschungsprogramm“ Jahren noch weiter wachsen. Denn künftige Forschungs-
und dem Forschungstitel „Echtzeittechnologien für die und Entwicklungserfolge werden ein Stück weit auch an
maritime Sicherheit“. die Fähigkeit gebunden sein, Synergien mit benachbarten
Industriezweigen stärker als bisher zu nutzen. Offenkun-
Die Maritime Forschungsstrategie der Bundesregierung dig sind die Wechselwirkungen zwischen Energie- und
zeichnet sich durch Kontinuität und Zuverlässigkeit aus. Mobilitätswende. Ähnlich gelagerte Synergien finden sich
Diese Werte gilt es auch in Zukunft zu bewahren, ohne aber beispielsweise auch bei den Paarungen Industrie 4.0
Hemmnisse für die dringend nötige Weiterentwicklung und Big Data oder künstliche Intelligenz und autonome
aufzubauen. Die Programmevaluation hat gezeigt, dass die Systeme.
Erfolge in der zurückliegenden Förderperiode von 2011 bis
2017 beachtlich waren. Gleichzeitig hat die Evaluation den Die Vernetzung der Branche auch über die Sektorgrenzen
Anstoß zu dringend nötigen Weiterentwicklungen der För- hinaus erfordert sowohl ausreichende operative Fähigkei-
derinstrumente gegeben. Die Neujustierung des maritimen ten als auch starke koordinierende Kapazitäten. Nur so las-
Forschungsprogramms ergab sich aus den für alle Industrie sen sich wichtige Synergieeffekte für die maritime Branche
sektoren relevanten Querschnittsthemen Industrie 4.0, nutzen. Bestmögliche Ergebnisse erzielt man durch eine
Energiewende, Mobilitätswende, Big Data, Digitalisierung, Verknüpfung der operativen Förderinstrumente mit den
Sicherheit, Klima- und Umweltschutz oder künstliche koordinierenden Funktionen des Nationalen Masterplans
Intelligenz und autonome Systeme. Maritime Technologien (NMMT).
Aus Sicht der Bundesregierung geht es um eine Vorsorge In der neuen Maritimen Forschungsstrategie 2025 gibt
für die maritime Branche durch Schaffung technologischer es ein neues Element neben den bekannten Forschungs-
Optionen. Die beiden neuen maritimen Förderinstrumente schwerpunkten Schiffstechniken, Produktion, Schiff-
dienen der Unterstützung der Branche bei der Entwicklung fahrts- und Meerestechniken. Bei diesem Element gehtV O R W O RT 3 es um Querschnittsthemen, die einen spartenübergreifen- den Charakter haben und bisweilen auch sektorübergrei- fend wirken. Im neuen Maritimen Forschungsprogramm wurden dazu vier Querschnittsthemen definiert. Es handelt sich hierbei um umweltschonende Maritime Technologien (MARITIME.green), Maritime Digitalisierung und smarte Technologien (MARITIME.smart), Maritime Sicher- heit (MARITIME.safe) sowie um Maritime Ressourcen (MARITIME.value). Die Entwicklung der neuen Maritimen Forschungsstrategie 2025 konnte letztendlich nur gelingen, weil sich große Teile der maritimen Branche in fünf Arbeitsgruppen engagiert und über einen beachtlichen Zeitraum von nahezu zwei Jahren aktiv mitgewirkt haben. Ich wünsche uns bei der Ausgestaltung der neuen Maritimen Forschungsstrategie 2025 das gleiche Engagement und den gleichen Teamgeist wie bei der Vorbereitung. Ich bin überzeugt, dass wir die Ziele der Maritimen Forschungsstrategie 2025 auf diesem Weg erreichen werden. Ihr Norbert Brackmann Koordinator der Bundesregierung für die maritime Wirtschaft
4
1. Ausgangslage
Die maritime Wirtschaft gehört zu den wichtigsten und bau und Schifffahrt international weiter zuspitzt. Die deut-
fortschrittlichsten Wirtschaftszweigen Deutschlands. Mit schen Werften konkurrieren mit staatlich subventionierten
400.000 Beschäftigten und einem jährlichen Umsatzvo- Unternehmen im Ausland, die einen fairen Wettbewerb
lumen von rund 50 Milliarden Euro ist sie nicht nur eine um Schiffbauaufträge teilweise unterlaufen. Der Serien-
Hochtechnologiebranche: Ihre Wettbewerbsfähigkeit schiffbau ist in Deutschland weitgehend zum Erliegen
sichert dem Land einen internationalen Spitzenplatz als gekommen und wird nur noch in wenigen Marktsegmen-
Technologie-, Produktions-, Logistik- und Energiestand- ten betrieben. Auch die derzeitige Verlagerung hin zum Bau
ort. Rund 90 Prozent des europäischen Außenhandels von Spezialschiffen, Yachten und Fahrgastschiffen eignet
und 35 Prozent des Binnenhandels erfolgen über die See- sich in einem Hochlohnland wie Deutschland nicht als
und Binnenschifffahrtswege. Etwa 60 Prozent der deut- einzige Überlebensstrategie, denn: Selbst die Konkurrenz
schen Exporte werden über den Seetransport abgewickelt. in den Nischen wird härter. Einige von ihnen haben sich
Rohstoffe wie Kohle, Öl und Erze sowie ein Großteil vieler inzwischen zu großvolumigen, werthaltigen Wachstums-
anderer Waren werden nahezu ausschließlich über Wasser- märkten entwickelt. Neue strategische Allianzen verschie-
wege beschafft. Erhebliche Mengen an Öl, Gas und regene- ben aufgrund von Marktbereinigungsprozessen die Kräfte
rativer Energie werden weltweit offshore produziert. Ohne gleichgewichte. Vor diesem Hintergrund ist es besonders
diese Ressourcen könnten andere wichtige Wirtschafts wichtig, Produktivität und Wirtschaftlichkeit durch kon-
sektoren wie Mobilität, Chemie, Mikroelektronik, Ener- kurrenzfähige Kosten zu verbessern.
gie oder Luft- und Raumfahrt nicht existieren. Und doch
befindet sich die maritime Wirtschaft aufgrund ihrer glo- Das Bewusstsein für Umwelt- und Klimaschutz wächst auf
balen Struktur wie kaum eine andere Branche in einem internationaler Ebene stetig. Konsequenterweise verschär-
stark umkämpften Wettbewerb. fen sich in den maritimen Bereichen die gesetzlichen Vor-
schriften. Die Internationale Seeschifffahrts-Organisation
der Vereinten Nationen (IMO) erarbeitet unter dem Motto
Herausforderungen „sichere, geschützte und effiziente Schifffahrt auf sauberen
Meeren“ international verbindliche Übereinkommen zur
Erhebliche Überkapazitäten führen dazu, dass sich der Reinhaltung der Meere und für mehr Sicherheit in der See-
ohnehin schon harte Verdrängungswettbewerb in Schiff- fahrt. Die bereits eingerichteten Emissionsüberwachungs-AU S G A N G S L A G E 5
Gebiete (ECA)1 in Nord- und Ostsee sowie in den USA und wird. Die digitale Transformation birgt für sie erhebliche
Kanada stehen beispielhaft für die angestrebten Ziele. Chancen, neue Geschäftsmodelle und -prozesse zu ent-
wickeln, Produktivität und Wirtschaftlichkeit zu steigern,
Klimaschutz und ein wachsendes Seehandelsvolumen Klima- und Umweltschutz zu verbessern sowie Energie und
erfordern die Entkopplung der maritimen Treibhausgas- Ressourcen zu gewinnen. In der Schifffahrt, die immer wie-
und Schadstoff-Emissionen von der steigenden maritimen der von Piraterie bedroht wird, sollen eine optimierte Lage-
Transportleistung. Die Suche nach Antriebs- und Kraft- bilderstellung und Informationsvernetzung mehr Sicher-
stoffalternativen sowie die Entwicklung zukunftsfähiger heit garantieren. Gleichzeitig beinhaltet die Digitalisierung
und marktkonformer Technologien sind unbedingte Vor- einen für die maritime Wirtschaft notwendigen Wandel,
aussetzungen, um die internationalen Übereinkommen um wettbewerbsfähig zu bleiben und neue Märkte erfolg-
rechtzeitig und erfolgreich umzusetzen. Aus den Beschlüs- reich zu besetzen.
sen zur Begrenzung der Erderwärmung und zur nachhal-
tigen Reduzierung der CO2-Emissionen ergeben sich auch
für die maritime Branche für die Zukunft enorme Heraus- Herausforderungen
forderungen.
• Verdrängungswettbewerb im Schiffbau und in
Der weltweit wachsende Energiebedarf stellt die gesamte der Schifffahrt
maritime Branche vor große Herausforderungen. Experten • Steigende Umwelt- und Klimaanforderungen
rechnen in einem moderaten Szenario mit einer Zunahme • Wachsendes See- und Binnenhandelsvolumen
von etwa 20 Prozent bis zum Jahr 2040. Aber auch stei- • Energiewende im maritimen Transportsektor
gende Energiekosten stellen erhöhte Anforderungen an • Wachsender Energiebedarf und steigende Energiekosten
maritime Aktivitäten. Der im Rahmen der Energiewende • Ausbau der Offshore-Wind-Kapazitäten
geplante Ausbau der Offshore-Windkapazitäten auf 15 • Sicherstellung der Rohstoffversorgung
Gigawatt bis zum Jahr 2030 bedeutet ein jährliches Investi- • Verbesserung der maritimen Sicherheit
tionsvolumen von etwa drei Milliarden Euro. Eine Summe, • Digitalisierung: Vernetzung, Autonomiefähigkeit,
die erhebliche Potenziale birgt – vor allem für die Bereiche Big Data und IT-Sicherheit
Transport, Installation, Überwachung und Wartung sowie
Sicherheit von Offshore-Windkraftanlagen.
Bei den fossilen Energieträgern genießen Sicherheit und Nationale Perspektive
Umweltschutz oberste Priorität. Laut Schätzungen der
Internationalen Energieagentur (IEA) decken im Jahr 2040 Die Maritime Agenda 2025 – von der Bundesregierung 2017
Erdöl und Erdgas noch 40 Prozent des Energiebedarfs – beschlossen – stärkt die Wettbewerbsfähigkeit der mariti-
selbst bei forcierter Nutzung von regenerativen Energien. men Wirtschaft Deutschlands langfristig. Die ressortüber-
Mit innovativen Technologien können bestehende Lager- greifende Strategie ist das Resultat eines umfangreichen
stätten nicht nur länger genutzt, sondern auch ganz neue Dialogprozesses zwischen Bundesregierung und maritimer
Quellen in größeren Wassertiefen erschlossen werden. Branche, den maßgeblich die Nationalen Maritimen Kon-
Begehrte Hightech-Metalle – beispielsweise aus Seltenen ferenzen prägen. Die Agenda benennt Wachstum, hohe
Erden – treiben den digitalen Fortschritt voran, ihr Ver- Beschäftigungspotenziale sowie anspruchsvolle Umwelt-
brauch wird in den kommenden Jahren immer weiter stei- und Naturschutzanforderungen als gleichberechtigte Ziele.
gen. Umso dringender benötigt der Wirtschaftsstandort
Deutschland Innovationen zur umweltgerechten Erschlie- Die Entwicklung innovativer maritimer Technologien im
ßung und Nutzung dieser zukunftsweisenden Rohstoffe. Schulterschluss von Wirtschaft und Wissenschaft trägt
dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit des maritimen Stand-
Spartenübergreifende Technologieansätze wie Digitalisie- orts Deutschland zu sichern. Als koordinierendes Instru-
rung, Systemvernetzung, Autonomisierung und Big Data ment und Vernetzungsplattform für die gesamte maritime
kündigen einen radikalen Wandel an, der das Leistungs- Branche wird der Nationale Masterplan Maritime Tech-
spektrum der maritimen Branche dramatisch verändern nologien (NMMT) weiter ausgebaut. So lassen sich Wachs-
1 ECA: Emission Control Area nach MARPOL Annex VI6 AU S G A N G S L A G E
tumspotenziale der maritimen Branche besser ausnutzen. und Beschäftigung und fordert einen verantwortungs
Die entsprechenden Förderinstrumente der Bundesregie- vollen und nachhaltigen Umgang mit Meer und Klima.
rung unterstützen Vernetzung und Innovation. Sie helfen
dabei, führende Technologien zu entwickeln und Märkte Klima-, Umwelt- und Naturschutz sind entscheidende
zu erschließen. Gleichzeitig ermuntern sie auch kleine Triebfedern, um wirtschaftlich-technologische Entwick-
und mittlere Unternehmen, neue Innovationswege zu lungen zu gestalten. Energie- und Mobilitätswende haben
beschreiten. erhebliche Auswirkungen auf die maritime Wirtschaft. Die
Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie (MKS) der Bundesregie-
Fachkräftemangel und fehlender Nachwuchs beschäftigt rung zeigt Wege auf, die Energiewende im Verkehr umzu-
die gesamte maritime Branche. Zukunftssichere Technolo- setzen. In der Schifffahrt leisten maritime Antriebstechno-
gien „Made in Germany“ sollen dazu beitragen, qualifizierte logien aktive Beiträge zur maritimen Energiewende. Die
Beschäftigung und Ausbildung sicherzustellen. Wirtschaft- Bereitstellung CO2-neutraler Kraftstoffe für alle wasser
lichkeit und Beschäftigung sind wichtige Ziele, die die gebundenen Verkehre erfordert in der Zukunft verstärkt
Bundesregierung im kontinuierlichen Austausch mit allen Kopplungen mit anderen Wirtschaftssektoren. Sektor- und
Akteuren der maritimen Wirtschaft verfolgt. Vor diesem programmübergreifende Förderinstrumente wie die För-
Hintergrund beteiligt sie sich zum Beispiel am Maritimen derinitiative Energiewende im Verkehr schaffen notwen-
Bündnis und an LeaderSHIP Deutschland und entwickelt dige Grundlagen auf dem Weg zur Treibhausgasneutralität.
diese Initiativen kontinuierlich weiter. Die dafür benötigten regenerativen Energiequellen wie
Offshore-Wind müssen wirtschaftlich erschlossen werden.
Die Digitale Strategie 2025 der Bundesregierung zeigt, Deshalb unterstützt die Bundesregierung die Vernetzung
welche Chancen ein digitales Deutschland bietet. In diesem des Offshore-Windsektors mit der maritimen Branche und
Sinne wird das Thema Maritim 4.0 künftig verstärkt Tech- stellt Mittel im Energieforschungsprogramm sowie in tech-
nologieentwicklungen und Wettbewerbsfähigkeit beein- nologieoffenen Programmen bereit.
flussen und Arbeitsprozesse prägen.
In den nächsten Jahren werden spartenübergreifende
Der Entwicklungsplan Meer, als Strategie für eine integ- Aspekte erheblich an Bedeutung gewinnen. Dazu zählen
rierte deutsche Meerespolitik, stärkt Wettbewerbsfähigkeit Kooperationen, um Prozesse zu digitalisieren, der sichereAU S G A N G S L A G E 7
Umgang mit großen Datenmengen oder neue Wege im Be- ten. Eine Stärkung der Innovations- und Leistungsfähigkeit
reich der Echtzeittechnologien für die maritime Sicherheit. kristallisiert sich zunehmend als gesamteuropäische Her-
ausforderung und Aufgabe heraus. Die Bundesregierung
Der Hightech-Standort Deutschland lässt sich nur sichern, sieht die nationale Forschungs- und Innovationspolitik im
wenn die benötigten Wissens- und Innovationsgrundlagen Kontext des europäischen Forschungsraums, den sie aktiv
ausgebaut werden. Die Zukunft der maritimen Wirtschaft mitgestaltet.
hängt daher maßgeblich von Investitionen in Forschung,
Entwicklung, Ausbildung und Qualifizierung ab. Darüber Mit der Initiative LeaderSHIP 2020 reagiert die EU-Kom-
hinaus müssen die vorhandenen Kernkompetenzen in mission auf die Folgen der Wirtschaftskrise für den Schiff-
Wirtschaft und Wissenschaft sinnvoll gebündelt werden. bausektor. Die gemeinsame strategische Vision zielt auf
Gerade Deutschland kann mit innovativen Technologien Innovation, Umweltschutz, Effizienz, Spezialisierung und
internationale Standards setzen und so wichtige Zukunfts- das Erschließen neuer Märkte. Die wesentlichen Erfolgs-
märkte maßgeblich mitgestalten. faktoren heißen dabei: Forschung, Entwicklung, Innova-
tion und Zugang zu qualifiziertem Personal. Die deutsche
Ob Energiewende, Klima- und Umweltschutz oder Roh- Schiffbauindustrie beteiligt sich aktiv an dieser Initiative.
stoffversorgung – die maritime Wirtschaft kann auf diese
zentralen Zukunftsfragen wichtige Antworten liefern. Mit der Einführung einer europäischen, integrierten
Meerespolitik soll eine nachhaltige Entwicklung der mari-
timen Wirtschaft europaweit unterstützt werden. Indem
Internationale Perspektive maritime Akteure über ihre Sektoren und Grenzen hin-
weg kooperieren, verbessern sie den Meeresumweltschutz
Die maritime Wirtschaft umspannt den gesamten Erdball. insgesamt. Ein einheitlicher europäischer Verkehrsraum
National ausgerichtete Aktivitäten oder etablierte Nischen erleichtert die Personen- und Güterbeförderung, senkt die
aus Deutschland reichen nicht mehr aus, um dem hohen Kosten und steigert die Nachhaltigkeit des Verkehrs.
Konkurrenzdruck – insbesondere aus Fernost – standzuhal-8 AU S G A N G S L A G E
Mit HORIZON 2020 orientiert sich die europäische For- 16 Nationen an dem ERA-NET Cofund MarTERA (Maritime
schungs- und Innovationsförderung weitgehend an den and Marine Technologies for a new ERA), das seit 2016
Bedarfen der Gesellschaft. Um drängende gesellschaftliche unter der Federführung Deutschlands vom Projektträger
Herausforderungen wie den Klimawandel, eine alternde Jülich koordiniert wird. Nach einem ersten gemeinsamen
Bevölkerung oder die Ressourcenknappheit zu bewältigen, Aufruf in 2017 wird diese erfolgreiche Initiative mit Aus-
sind intelligente Investitionen in die Zukunft von ent- schreibungen für 2019, 2020 und 2021 fortgesetzt.
scheidender Bedeutung. 2021 tritt das neue europäische
Rahmenprogramm für Forschung und Innovation (FP9) Ein weiterer Schlüssel für europäische Innovation,
in Kraft. Es befindet sich bereits im national-europäischen Wissenstransfer und internationale Wettbewerbsfähigkeit
Abstimmungsprozess. Die Bundesregierung bringt die ist ein regelmäßiger Dialog. So tauscht sich beispielsweise
maritimen Belange ein und schafft so die Voraussetzungen die Technologieplattform WATERBORNE mit der EU-Kom-
dafür, dass die Branche verstärkt am FP9 teilnehmen kann. mission über zukünftige Forschungsbedarfe der europä-
ischen maritimen Industrie aus. Diese Interessenvertre-
Gleichzeitig stellt die Bundesregierung sicher, dass die tung unterstützt die EU-Strategieprozesse in Bezug auf die
Nationalen Kontaktstellen alle nötigen Informationen wassergebundenen Transporte sowie zum sogenannten
zu den EU-Programmen mit der Branche austauschen. „Blauen Wachstum“.
Über die vielfältigen Möglichkeiten der europäischen For-
schungsförderung im Bereich der maritimen Technologien Der Vernetzungsgedanke spielt auch bei den Joint Pro-
informiert und berät kostenlos die Nationale Kontaktstelle gramming Initiativen (JPIs) eine zentrale Rolle. Die JPIs die-
Schifffahrt und Meerestechnik öffentliche und private nen u. a. als Plattform, um zwischen den Mitgliedsstaaten
Einrichtungen und Unternehmen im Auftrag des Bundes Positionen abzustimmen und in die Forschungsprogramme
ministeriums für Wirtschaft und Energie. einzubringen. Vor allem JPI Oceans stärkt in den kommen-
den Jahren auf europäischer Ebene die Netzwerke zwischen
Um den europäischen Netzwerkgedanken zu stärken, maritimer und mariner Forschung. Die Bundesregierung
unterstützt die Bundesregierung aktiv die Beteiligung an unterstützt die von ihr mitgestaltete EU-Strategie „Blaues
den ERA-NET-Instrumenten der EU. So beteiligen sich Wachstum“.AU S G A N G S L A G E 9
Ergebnisse der Programm-Evaluation Qualifikation von wissenschaftlichem Personal in der
„Maritime Technologien der nächsten maritimen Wirtschaft. Dank Förderung einer innovativen
Generation“ Forschungs- und Entwicklungstätigkeit wuchs das Know-
how, Forschungskooperationen bahnten sich an. Vor allem
Die Zahlen sprechen für sich: 225 Millionen Euro Förder Forschungseinrichtungen stellten mit Hilfe der Förderung
mittel in sieben Jahren für 485 Vorhaben mit einem wissenschaftliches Personal ein und qualifizieren damit
Gesamtvolumen von 317 Millionen Euro – das Forschungs- den Fachkräftenachwuchs für die maritime Wirtschaft.
programm „Maritime Technologien der nächsten Genera-
tion“ verzeichnete im Förderzeitraum von 2011 bis 2017 auf Ob Patente, marktfähige Technologien, Dienstleistungen
vielen Ebenen Erfolge. Die spiegeln auch die Evaluations- oder Geschäftsmodelle – die Forschungsergebnisse lassen
ergebnisse wider: Das Programm genoss hohen Bekannt- sich perspektivisch zumeist gut verwerten und besitzen
heitsgrad, wurde stark nachgefragt und voll ausgeschöpft. Kommerzialisierungspotenzial. Allerdings ist der Innova-
Relevante Technologiefelder wurden adressiert, die Ziel- tionszyklus innerhalb der Förderperiode noch nicht abge-
gruppen aus Unternehmen und wissenschaftlichen Ein- schlossen und die Entwicklungen werden von den Unter-
richtungen konnten mobilisiert werden. Besonders erfreu- nehmen bis zur Marktreife weiter fortgeführt.
lich: der mit über 25 Prozent hohe Anteil kleiner und mit-
telständischer Unternehmen (KMU) am Forschungsbudget. Neben der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Ver-
wertung ist eine projektübergreifende Netzwerkbildung
Durch die gezielte Unterstützung technologieoffener Ver- – teilweise bis über die Grenzen des maritimen Sektors
bundprojekte tauschen Forschungspartner aus verschie- hinaus – von besonderer Bedeutung. Gerade bei Zu-
denen Segmenten ihre technologische Expertise aus – und kunftsthemen wie Digitalisierung, smarte Systeme oder
zwar weit über den maritimen Sektor hinaus. KMU nutzten emissionsarme Antriebe ist die Förderung von branchen-
die Chance, um sich stärker in der Forschung zu engagie- übergreifenden Verbundprojekten oft vielversprechend.
ren, ihre Netzwerke in der Verbundarbeit zu erweitern oder
ihre Produkte weiterzuentwickeln. So gelang es ihnen, Insgesamt trägt die Förderung von Forschungs- und Ent-
neue Anwendungs- und Geschäftsfelder zu erschließen wicklungsvorhaben mit hohem Innovationspotenzial zur
und damit ihre eigene Marktposition zu stärken. Grö- Qualifikation des wissenschaftlichen Personals und zum
ßere Unternehmen schafften es, Vorhaben schneller und technologischen Vorsprung der deutschen maritimen
umfangreicher umzusetzen und damit technologische Industrie bei – und damit zu einer erhöhten Wettbewerbs-
Vorsprünge im internationalen Wettbewerb auszubauen. fähigkeit und vielfach langfristig zu einer verbesserten
Das Forschungsprogramm fungierte im Evaluationszeit- Marktposition der Unternehmen.
raum zudem als relevanter Treiber für Ausbildung und10
2. Maritimes
Forschungsprogramm
N
Programmziele
W E
• Stärkung der Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit
• Intensivierung der Digitalisierung der maritimen Branche S
• Steigerung der Effizienz, Nachhaltigkeit und Sicherheit
• Verbesserung der Vernetzung von maritimer Industrie und Forschung
• Gewinnung und Sicherung qualifizierter Fachkräfte sowie Know-how-Transfer
Für die Bundesregierung ist die maritime Wirtschaft von Ob Digitalisierung, Energie- oder Mobilitätswende – die
zentraler wirtschaftspolitischer Bedeutung. Ihre positiven Entwicklungen sind so rasant, dass verstärkt branchen-
Erfahrungen mit Forschung und Entwicklung als Grund- übergreifende Ansätze und angepasste Förderinstrumente
lage, um künftige Herausforderungen zu bewältigen und benötigt werden. Vier Querschnittsthemen sind daher erst-
die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, sind Gründe genug, mals Bestandteil der Maritimen Forschungsstrategie. Neu
die Forschungsförderung auch künftig sicherzustellen. Der ist zudem eine Fokussierung auf die Echtzeittechnologien
Kern des erfolgreichen Förderinstrumentes lebt im neuen im Bereich der Maritimen Sicherheit. Unabhängig von der
Programm weiter: Die vier bekannten Technologiesäulen thematischen Verwandtschaft zu den klassischen mariti-
Schiffstechnik, Produktionstechnik, Schifffahrt sowie Mee- men Sicherheitsthemen bekommt dieser Teilbereich auf-
restechnik bleiben Hauptbestandteile. Ziele und Schwer- grund seiner hohen Relevanz eine Sonderstellung.
punkte wurden auf die neuen Anforderungen zugeschnitten.MARITIMES FORSCHUNGSPROGRAMM 11
Das neue Forschungsprogramm stärkt weiterhin den High- Die mittelfristig angelegten Programmziele beinhalten
tech-Standort Deutschland. Die Vernetzung der maritimen wichtige Innovationsschritte und betreffen die direkte
Industrie mit der Forschungslandschaft und anderen Wirt- Wirksamkeit dieser Programmperiode. Die strategische
schaftszweigen fördert und beschleunigt Innovation. Qua- Perspektive hingegen beschreibt die langfristige Ausrich-
lifizierte Fachkräfte, die eine Brücke zwischen Forschung tung der maritimen Forschungsförderung. Diese wird kon-
und Wirtschaft bauen, werden benötigt, um den Gewinn tinuierlich unter Berücksichtigung aktueller Entwicklun-
und Transfer von Wissen sicherzustellen. Ein weiterer gen im Dialog mit Experten fortgeschrieben.
Fokus liegt auf den kleinen und mittleren Unternehmen:
Ihre Beteiligung am Programm ist ausdrücklich erwünscht,
da sie mit ihrer Innovationskraft maßgeblich dazu beitra- Langfristige Ausrichtung
gen, den maritimen Standort zu sichern.
• Maritime Energiewende zur Unterstützung der
Klimaschutzziele
Strategische Perspektive • Höchste Sicherheit und Umweltverträglichkeit
• Signifikante Produktivitätssteigerung und Kosten
Verlässlichkeit und Kontinuität sind in der vorwettbewerb- senkung
lichen Forschungsförderung wichtige Voraussetzungen, um • Sicherung der Energie- und Rohstoffversorgung
Know-how zu verstetigen. Nur so lassen sich forschungs- • Das Null-Emissions-Schiff
politische Ziele nachhaltig umsetzen und die Innovations- • Autonome maritime Systeme
kraft stärken. • Durchgängige Digitalisierung und Virtualisierung12
3. Maritime Querschnittsthemen
Stichworte wie Digitalisierung und Big Data verdeutlichen: Ein zweiter sektorübergreifender Trend lässt sich mit dem
Die maritime Branche befindet sich – wie alle anderen Begriff Mobilitätswende umschreiben. Es geht darum, die
Industriesektoren – inmitten der vierten industriellen zunehmende Mobilität zu Land, Wasser und in der Luft von
Revolution. Schnelligkeit, Reichweite und systemische Wir- ihren klima- und umweltschädigenden Wirkungen zu ent-
kung charakterisieren diesen Umbruch. Die medienbruch- koppeln. Hier sind neue Ansätze im Bereich der maritimen
freie Prozessvernetzung führt zu neuen wirtschaftlichen Antriebssysteme gefragt. Alternative Treibstoffe und Ener-
Strukturen, die erhebliches Potenzial in Bezug auf Kosten, giequellen stellen insbesondere die Überseetransporte vor
Zeit, Qualität von Produkten und Dienstleistungen besit- besondere Herausforderungen. Neue Kooperationsformen
zen. Die maritime Digitalisierung verfügt über beachtliche sind gefordert, um tragfähige technische Lösungen für den
Fähigkeiten, um die Konkurrenzfähigkeit des Standorts zu maritimen Bereich zu entwickeln.
erhalten und gleichzeitig Umwelt und Ressourcen zu scho-
nen. Daraus lassen sich ganz neue Geschäftsmodelle entwi- Deutschlands maritime Unternehmen gehören in vielen
ckeln und Märkte schaffen. grünen Technologiefeldern zur internationalen Spitze.
Das erhöht die Chancen, zukünftige internationale Märkte
Die Digitalisierung gilt in der maritimen Branche als wich- frühzeitig zu besetzen. Effektive Entwicklungen setzen
tiger Treiber künftiger innovativer Entwicklungen. Ver- voraus, dass sparten- und sektorübergreifenden Ansätzen
netzung und Big Data-Technologien bilden die Basis, um ausreichend Raum gegeben wird. Die damit verbundenen
Bau, Betrieb und Wartung sowohl von Schiffen als auch hohen Anforderungen an Qualifikation und Technologie
von maritimen Anlagen und Infrastrukturen offshore zu bieten der deutschen maritimen Branche wichtige Wachs-
sichern. Autonome Systeme und Robotik eröffnen neue tumsfelder.
Möglichkeiten bei der Gewinnung maritimer Ressourcen
sowie beim Transport von Menschen und Gütern.MARITIME QUERSCHNITTSTHEMEN 13
Nachhaltige und effiziente Technologien werden sich mit • MARITIME.green – Umweltschonende maritime
Blick auf die europäische Agenda, internationale Abkommen Technologien
zum Umweltschutz, neue Ressourcenbedarfe und klimati-
sche Entwicklungen zunehmend am Markt durchsetzen. • MARITIME.smart – Maritime Digitalisierung und
smarte Technologien
Digitalisierung und Mobilitätswende als globale Trends
sowie die neuen Herausforderungen im Bereich Sicherheit • MARITIME.safe – Maritime Sicherheit
und Ressourcenzugang bilden in der neuen Maritimen
Forschungsstrategie die Grundlage für die folgenden vier • MARITIME.value – Maritime Ressourcen
Querschnittsthemen:
Abbildung 1: Aktuelle Programmmatrix – Technologiesparten und Querschnittsthemen
Schiffs- Produktion Schiff- Meeres- Echtzeit-
technik maritimer fahrt technik technologien
Systeme für maritime
Sicherheit
MARITIME.green: Umweltschonende maritime Technologien
MARITIME.smart: Maritime Digitalisierung und smarte Technologien
MARITIME.safe: Maritime Sicherheit
MARITIME.value: Maritime Ressourcen14 MARITIME QUERSCHNITTSTHEMEN
MARITIME.green – Umweltschonende maritime Technologien
N
Strategische Ziele
W E
• Grüner Transport
• „Null Emission: Keine schädlichen Emissionen in Luft und Wasser“ S
• „Verhinderung von Umweltschäden jeglicher Art“
• „Vollständige Klimaneutralität“
• Grüne Produktion
• „Energie- und ressourcenminimale Fertigung“
• „Vollständige Recyclingfähigkeit maritimer Produkte“
Ein deutlicher Trend auf nationaler und internationaler ist der internationale Begriff Green Shipping ein wichti-
Ebene ist die Entkopplung der Mobilitätsbedürfnisse von ger Aspekt von MARITIME.green: Angesprochen werden
den Klima- und Umweltwirkungen. Vereinzelt ist bereits damit umwelt- und klimaschonende Schiffs- und Antriebs-
von einer Mobilitätswende die Rede – in Analogie zur technologien. Die Schifffahrt ist zwar – gemessen an ihrer
Energiewende. Die Mobilitätswende führt also nicht zu Transportleistung – der mit Abstand umweltfreundlichste
weniger Mobilität, sondern zu einer anderen Qualität: Der Verkehrsträger, dennoch existiert mit Blick auf Klima und
ökologische Fußabdruck von Transportsystemen soll mini- Umwelt weiterhin großer Verbesserungsbedarf. Da Ozeane
miert werden. Das trifft für Antriebsemissionen genauso sowie Eis- und Polargebiete die Klima- und Umweltpro-
zu wie für die Bereiche Energie- und Abfallmanagement, zesse wesentlich beeinflussen, trägt eine grüne Schiff-
Werkstoffe, Fertigungsmethoden oder Recycling. In diesem fahrt erheblich dazu bei, die globale Umwelt zu schützen.
Sinne rückt die „Circular Economy“ international zuneh- MARITIME.green ist aber nicht allein auf die Schifffahrt
mend ins Bewusstsein. beschränkt. Vielmehr geht es darum, sämtliche Schadstoff
emissionen zu reduzieren, Ressourcen sparsam zu nutzen
Für die wassergebundenen Transportsysteme gilt in ana- und Gefahrenstoffe über den gesamten Lebenszyklus mari-
loger Weise, dass der ökologische Fußabdruck verringert timer Produkte zu ersetzen. In den kommenden Jahren
und die Ressourcen effizienter genutzt werden sollen. So sollen vermehrt alternative Kraftstoffe wie LNG, MethanolMARITIME QUERSCHNITTSTHEMEN 15
und Wasserstoff in Antriebssystemen eingesetzt werden. Seeschifffahrtsorganisation IMO hat inzwischen verbind-
Gefragt sind auch Alternativen wie die Elektrifizierung liche Grundlagen auf unterschiedlichen Ebenen geschaf-
oder der Einsatz von Brennstoffzellen zur nachhaltigen fen, um umweltverträglichen Technologien den Weg zu
Senkung der CO2-Emissionen. Zukunftsthemen sind der ebnen: Dazu zählen die Einrichtung von Emissions-Über-
Einsatz CO2-armer und CO2-neutraler Kraftstoffe als Ein- wachungsgebieten (ECAs)2, die verbindliche Einführung
stieg in die maritime Energiewende. Durch Kopplung von Energieeffizienzmanagement an Bord (SEEMP)3, der
verschiedener Sektoren aus den Bereichen Energie und Energieeffizienz-Kennwert für Schiffsneubauten (EEDI)4
Verkehr werden Grundsteine für die zukünftige Bereitstel- sowie das Ballastwasser-Übereinkommen und die Schiffs-
lung CO2-neutraler Schiffskraftstoffe gelegt. Eine sparten- recycling-Konvention für das Abwracken von Schiffen. Mit
übergreifende Herangehensweise birgt da große Potenziale: der MRV-Seeverkehrsordnung5 wurde zudem eine syste-
Synergien und vernetzte Kooperationen schaffen wichtige matische Strategie auf den Weg gebracht, um Emissionen
Mehrwerte. Perspektivisch lassen sich neue Produktansätze des Seeverkehrs zu erfassen. Entwicklungen im Bereich
und Marktfelder schaffen. MARITIME.green schaffen Voraussetzungen, neue Tech-
nologieperspektiven in den umweltbezogenen IMO-Vor-
Weltweit steigen die Standards für Umweltverträglichkeit. schriften zu verankern und so notwendige Emissionsmin-
Neue, ganzheitliche Technologieansätze sind gefragt. Die derungen schneller zu erreichen.
2 ECA: Emission Control Area
3 SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan
4 EEDI: Energy Efficiency Design Index
5 MRV: Monitoring, Reporting, Verification16 MARITIME QUERSCHNITTSTHEMEN
MARITIME.smart – Maritime Digitalisierung und smarte Technologien
N
Strategische Ziele
W E
• Durchgängige Prozessdigitalisierung
• „Vollständige digitale Prozessintegration“ S
• „Digitalisierung aller Prozesse für Planung, Steuerung und Monitoring“
• Digitalisierung aller Komponenten
• „Einsatz digitaler Zwillinge“
• „Virtuelles, modulares Systemdesign“
• „Smarte Komponenten“
• Innovative Dienste
• „Neue modell- und datenbasierte Dienste“
• „Smarte Assistenzsysteme auf Basis von Big Data“
• „Volle Simulationsfähigkeit und virtuelle Erlebbarkeit“
Bau und Betrieb von umweltfreundlichen Schiffen und bei der Schiffsproduktion enorme Werte geschaffen wer-
Offshore-Konstruktionen sind technologische Herausfor- den, ist das wirtschaftliche Risiko entsprechend groß. Fak-
derungen, die der deutschen maritimen Branche wichtige toren wie Kosten, Zeit und Qualität bestimmen den mari-
Chancen auf dem Weltmarkt eröffnen. Gleichzeitig pro- timen Wettbewerb. Zudem werden wichtige Eigenschaften
fitiert die Gesellschaft, wenn Umweltschäden gar nicht des zukünftigen Produktes bereits sehr früh in einer Pro-
erst entstehen. Deshalb gilt: Grüne Technologien sind jektphase vereinbart – dafür ist ein effektives Informations-
richtungsweisend für maritime Innovationen. Die Digita- management von zentraler Bedeutung. Die Digitalisierung
lisierung als Eckpfeiler der Industrie 4.0 ist im maritimen der gesamten Wertschöpfungskette ist damit ein wichtiger
Bereich eng mit den Produktionstechniken verwoben. Da Baustein, um im harten Wettbewerb bestehen zu können.MARITIME QUERSCHNITTSTHEMEN 17
Smarte Produktionstechnologien verkürzen Durchlauf zient zu unterstützen, müssen diese Datenmengen nicht
zeiten, reduzieren Fehlerraten und verbessern die Produkt- nur geschützt, sondern auch anwenderfreundlich aufberei-
qualität. tet werden. Technologische Herausforderungen beispiels-
weise im Bereich von Big Data und Cyber-Sicherheit sind
Das Querschnittsthema MARITIME.smart beinhaltet mit anderen Industriesektoren vergleichbar, so dass hier
jedoch weit mehr als Anwendungen in den Produktions mit Synergien für maritime Bedarfe zu rechnen ist. Indem
techniken. So verbessert eine deutlich intelligentere Sen- sich maritime Prozesse lückenlos erfassen und aufbereiten
sorik die Informationsbeschaffung und erlaubt in vielen lassen, werden für Hersteller, Zulieferer und den maritimen
maritimen Sparten umfassende Technologiesprünge. Dienstleistungssektor Voraussetzungen für völlig neue Pro-
Beispielsweise gestattet die stetige Überwachung von dukt- und Marktmodellansätze geschaffen.
Systemen eine zustands- und vorhersagegesteuerte War-
tungsplanung, die zu mehr Flexibilität führt und damit Die technischen Entwicklungen in der Digitalisierung und
die betriebliche Wirtschaftlichkeit verbessert. Aber auch somit in der Nutzung großer Datenmengen, der Informa-
Navigation, Energiemanagement, Routenplanung sowie tions- und Kommunikationstechnologien, der Simulations-
Seeraumüberwachung profitieren vom effektiven Einsatz und Berechnungsverfahren sowie der additiven Fertigung
vernetzter Daten. verändern die maritime Branche. Angestrebt werden größt-
mögliche Kosteneffizienz, Umweltfreundlichkeit, Zuverläs-
Allerdings führt die Sensorik in Anlagen und Subsystemen sigkeit und Flexibilität – allesamt Garanten, um zusätzliche
zu enormen Datenflüssen. Um Entscheidungsprozesse effi- Arbeitsplätze zu schaffen und neue Märkte zu erschließen.18 MARITIME QUERSCHNITTSTHEMEN
MARITIME.safe – Maritime Sicherheit
N
Strategische Ziele
W E
• Null Verluste – ZERO FATALITIES
• „Keine Verluste menschlichen Lebens auf See und in der Produktion“ S
• „Keine schweren Verletzungen von Menschen“
• Null Wertverluste und eine intakte Umwelt
• „Vermeidung von Verkehrsgefährdungen, Havarien und Unfällen“
• „Maximale Verlässlichkeit technischer Systeme“
• Wirkungsvolle Gefahrenabwehr
• „Sicherung der Versorgungsketten und kritischer Infrastrukturen“
• „Minimale Auswirkungen von bewusster Störung“
• „Umfassende IT-Sicherheit in allen maritimen Anwendungen“
Ob Menschen auf See, marine Umwelt, Sachgüter oder von Havarien, Verkehrsgefährdungen und Unfällen spielt
Investitionen – sie alle müssen geschützt werden: Maritime sozial, ökologisch wie ökonomisch eine große Rolle.
Sicherheit ist nach wie vor als Querschnittsthema im Sinne
von Safety und Security in allen klassischen maritimen Neu und mit elementarem Einfluss auf technologische
Technologiesparten beheimatet. Innovative Sicherheitslö- Fähigkeiten und Risiken sind die Megatrends Digitalisie-
sungen sind in allen Segmenten gefragt. Die Vermeidung rung, smarte Systeme und Big Data. Die Bedeutung derMARITIME QUERSCHNITTSTHEMEN 19
Lagebilderstellung und das Angebot an Handlungsempfeh- Kreuzfahrtschiffen und dringen dabei auch in Gebiete mit
lungen für Besatzung und Landpersonal werden zuneh- sensiblen Umweltbedingungen vor. Die Sicherheits- und
men. Echtzeitfähige Sicherheitssysteme sind das Tor zu Rettungstechnologien müssen entsprechend angepasst und
autonomen Transportsystemen auf See und zur Prozess ausgebaut werden.
automatisierung.
Neben den klassischen Themen der Betriebssicherheit und
Die Sicherheit ist eine zentrale Anforderung an alle Berei- Unfallvermeidung sind in den vergangenen Jahren zuneh-
che der maritimen Prozesskette. Damit verbunden sind mend auch Aspekte wie Angriffssicherheit und -prävention
Chancen für die Industrie, um sich mit neuen Sicherheits in den Mittelpunkt der zivilen maritimen Sicherheit gerückt.
technologien und innovativen Produkten am Markt zu Piraterie und Terrorismus, aber auch Cyberangriffe und
behaupten. manipulierte Positionsdaten bedrohen die Schifffahrt ins-
gesamt. Gefragt sind Abwehr- und Präventionsmaßnahmen,
Neue – aus Perspektive der Sicherheit – anspruchsvollere um zivile Passagiere, Besatzung und Ladung zu schützen.
Einsatzgebiete wie die Tiefsee und arktische Regionen müs-
sen erschlossen, Offshore-Windparks errichtet werden. Eine weitere Herausforderung ergibt sich aus dem wach-
Dafür werden angepasste Sicherheitslösungen und Ret- senden Konflikt zwischen Sicherheit und Effizienz: Benö-
tungsmittel benötigt. Fehlende Langzeiterfahrungen mit tigt werden Lösungen, die einen wirtschaftlichen und
neuen Materialien und Techniken unter realen Betriebsbe- umweltschonenden Betrieb garantieren, ohne dabei die
dingungen sowie Extremwetter und veränderte Umwelt- Sicherheitsreserven – beispielsweise in Antriebssystemen –
bedingungen stellen weitere Herausforderungen dar. Die aus den Augen zu verlieren.
Arbeitssicherheit muss in allen Fällen gewährleistet sein.
Das Fokusthema „Echtzeittechnologien für die maritime
Der Boom im Kreuzfahrtsektor bringt es mit sich, dass Sicherheit“ greift die besondere Bedeutung der maritimen
Sicherheitskonzepte verstärkt in den Fokus der Auf- Sicherheit auf und konkretisiert die daraus resultierenden
merksamkeit rücken. Immer mehr Menschen reisen mit Chancen, die in Abschnitt 4 erläutert werden.20 MARITIME QUERSCHNITTSTHEMEN
MARITIME.value – Maritime Ressourcen
N
Strategische Ziele
W E
• Versorgungssicherheit
• „Sicherung der nationalen Energie- und Rohstoffversorgung“ S
• „Nachhaltige Erschließung mariner Ressourcen“
• Unterstützung der Energiewende
• „Bereitstellung wirtschaftlicher Technologien zur Steigerung der Produktion erneuerbarer Energien“
• Gestaltung entstehender Märkte
• „Erwerb von Marktanteilen durch intelligente und umweltkonforme Meerestechnik“
Langfristige volkswirtschaftliche Trends verdeutlichen: Versorgungssicherheit. Um den Zugang zu regenerativer
Maritime Ressourcen gewinnen künftig weltweit zuneh- Offshore-Energie, wertvollen Rohstoffen und nachhaltiger
mend an Bedeutung. Ob Energiewende, Mobilitätswende, Nahrung zu sichern, müssen umweltschonende, robuste
Elektromobilität oder Digitalisierung – diese Megatrends und wirtschaftliche Technologien entwickelt werden.
verändern die Bedarfe an Rohstoffen und Energie. Für die Deutschland hat die Chance, mit der Entwicklung geeig-
nationale Wirtschaft stellt sich zunehmend die Frage der neter Technologien internationale Standards zu setzen, umMARITIME QUERSCHNITTSTHEMEN 21
die Nutzung der Meeresressourcen nicht nur wirtschaftlich, gesamte Branche heraus: Notwendig sind neue Entwick-
sondern auch umweltschonend zu gestalten. lungen für umweltschonende Gewinnungsverfahren sowie
die Qualifikation, Verarbeitung, Inspektion und Wartung
Bis zum Jahr 2025 will Deutschland mindestens 40 Pro- von neuen Materialien für extreme Umweltbedingungen.
zent der Elektrizität aus erneuerbaren Quellen gewinnen.6 Das Spektrum reicht von intelligenter Überwachungstech-
Während Wind- und Sonnenenergie bereits intensiv nik bis hin zu autonom operierenden Unterwassersyste-
genutzt werden, steht die Energiegewinnung aus dem men. Die technologischen Anforderungen reichen weit
Meer erst am Anfang. über die Fähigkeiten einer einzelnen Sparte hinaus.
Neben den regenerativen Energiequellen bleiben aber auch Autonome Unterwassertechnologien, intelligente Sensor
Öl und Gas für eine Übergangszeit ein wichtiger Bestand- cluster, Unterwassernavigation oder Energiemanagement
teil im Versorgungsmix. systeme unterstützen die Technologieentwicklungen für
eine umweltschonende Überwachung und Wartung. Gelingt
Insbesondere mineralische Rohstoffe für Hightech-Pro- es, umweltverträgliche Technologien und Standards für
dukte stehen hoch im Kurs. Die Ressourcen der Meere Offshore-Energiegewinnung zu entwickeln und einzuset-
könnten die steigende Nachfrage befriedigen. Eine wirt- zen, kann Deutschland international Standards setzen und
schaftliche, umweltschonende und nachhaltige Erschlie- potenzielle Märkte erschließen.
ßung und Gewinnung maritimer Ressourcen fordert die
6 Vgl. BMWi: „Erneuerbare Energien in Zahlen“, 2016, S. 4Sie können auch lesen