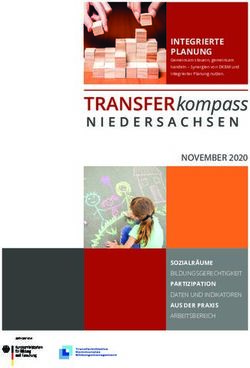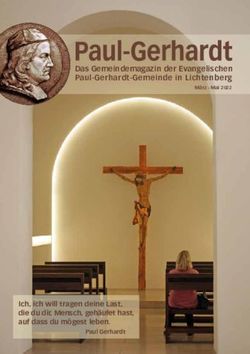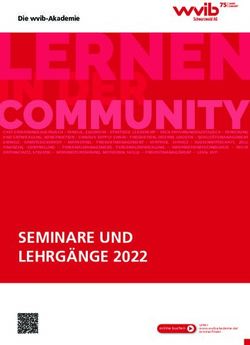Mitteilungen & Stimmen zur Schließung der Akademie für politische und soziale Bildung Haus am Maiberg Heppenheim am Tag des Heiligen St. Martin 2020
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Mitteilungen & Stimmen
zur Schließung der
Akademie für politische und soziale Bildung
Haus am Maiberg
Heppenheim am Tag des Heiligen St. Martin 2020Teilen & Mitteilen
Die Mitarbeiter*innen des Hauses am Maiberg, der Akademie für politische und soziale Bildung
des Bistums Mainz, sind am 30.09.2020 von einer unerwarteten Nachricht überrascht worden:
Das Haus am Maiberg soll am 31.12.2022 geschlossen werden. Unser Lockdown 2022.
Wir freuen uns über die vielen offenen, kritischen, zum Teil sehr pointierten und treffenden
Stellungnahmen, Briefe, Solidaritätsbekundungen, Appelle und Petitionen, die seither an den
Bischof, die Bistumsleitung und uns adressiert worden sind. Die ersten Stellungnahmen zu
bündeln und entsprechend der Intention der Schreiber*innen auch öffentlich zu machen, ist Sinn
und Zweck dieser Zusammenstellung in einem Mitteilungsblatt.
Als Direktor der Akademie bin ich gemeinsam mit allen Mitarbeiter*innen überwältigt und sehr
berührt von den vielen Stimmen, die die Vielfalt unserer Arbeit und unserer Netzwerke sehr
schön widerspiegeln. Unser Haus ist offenbar kirchenpolitisch, demokratiepolitisch,
gesellschaftspolitisch und bildungspolitisch ein wichtiger Ort.
Inspiriert durch den Patron des Bistums Mainz, den Heiligen Martin, hat sich Bischof Peter
Kohlgraf „das Teilen“ als Überschrift für den sogenannten „Pastoralen Weg“, einen
Reformprozess im Bistum, ausgewählt. Der Martinstag 2020 schien uns deshalb der richtige
Termin, mit der Bistumsleitung, mit den Mitarbeiter*innen des Bistums und allen Freundinnen und
Freunden die hier zusammengestellten Stimmen zur Schließung des Hauses zu teilen.
Das Vorgehen bei der Schließung widerspricht der Philosophie des Pastoralen Weges, bei dem
die Mitarbeiter*innen in die Entwicklung von neuen Perspektiven einbezogen werden sollen.
Bisher war geplant dabei zunächst gemeinsam über inhaltliche Fragen zu diskutieren. Erst ab
Sommer 2021 sollte dann darüber entschieden werden, welche strukturellen und institutionellen
Konsequenzen sich daraus ergeben – ein Schritt, der von der Bistumsleitung gerne als
„schmerzlicher Einschnitt“ beschrieben wird. Die überraschende und vorzeitige Entscheidung
über die Schließung von Einrichtungen, vor allem aber der Ausschluss der Betroffenen aus der
Kommunikation, ist gemessen an diesen Prinzipien kein gutes Zeichen.
Mit der Verkündung der Schließung der Akademie Haus am Maiberg war ein verhaltenes
Bekenntnis der Bistumsleitung zur Zukunft und Bedeutung der „sozialpolitischen und
sozialethischen Bildung“ verbunden. Bei näherer Prüfung stellt sich nun allerding heraus, dass
es dafür bisher keine konkreten Planungen gibt. Die für eine solche Weiterführung benannten
Einrichtungen verfügen bisher nur über geringe Erfahrungen in der politischen Bildung und sind
von den Erwartungen selbst überrascht worden.
Die für Ende 2022 geplante Schließung wird mit der wirtschaftlich schwierigen Situation des
Bistums begründet. Das Haus am Maiberg gehört jedoch mit einem Jahreshaushalt von ca. zwei
Millionen und einer Finanzierung zu etwa gleichen Teilen durch Gäste des Hauses bzw.
Teilnehmende der Akademiearbeit, durch Drittmittel und Eigenmittel des Bistums zu den aus
unserer Sicht wirtschaftlich solide aufgestellten Einrichtungen des Bistums Mainz.
Der Schock über die geplante Schließung hat im Kollegium der Akademie und des
Tagungshauses für Entsetzen und eine vorrübergehende Sprachlosigkeit gesorgt. Nachdem
aber aus unserem großen Umfeld sehr schnell viele kluge und kritische Solidaritätsbekundungen
kamen, ist diese Sprachlosigkeit inzwischen wieder dem visionären und freien Denken
gewichen, das seit Jahren Teil unserer Unternehmenskultur ist.
Heppenheim, 11.11.2020
Benedikt Widmaier1. Martin lüftet den Mantel des Schweigens
Bernd Sterzelmaier interviewt den Heiligen Martin
2. Offener Brief der Belegschaft zur geplanten Schließung
3. Das „Haus am Maiberg“ muss erhalten bleiben!
Petition auf: www.change.org, bis 09.11.2020 unterzeichnet von über 1500 Personen
4. Appell und Offener Brief aus der Wissenschaft
von Prof. Dr. Klaus-Peter Hufer (Universität Duisburg-Essen) und Jun. Prof. Dr. Alexander
Wohnig (Universität Siegen) sowie 85 Hochschullehrer*innen aus Deutschland
5. Offener Brief von Trägern und Institutionen der politischen Bildung
von Klaus Waldmann (Journal für politische Bildung) und Prof. Dr. Benno Hafeneger
(Universität Marburg) sowie 120 Kollegen*innen aus der politischen Bildung
6. Appell aus der Sozialethik und den Sozialwissenschaften
von Prof. Dr. Hermann-Josef Große Kracht (TU Darmstadt) und Prof. Dr. Matthias
Möhring-Hesse (Universität Tübingen) und 50 Wissenschaftler*innen aus Deutschland
7. Stellungnahme des Bundesvorstands der DVPB
Bundesvorstand der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung (DVPB) zur geplanten
Schließung des Haus am Maiberg in Heppenheim vom 05. Oktober 2020
8. Geplante Schließung der Akademie „Haus am Maiberg“
Offener Brief von Prof. Dr. Matthias Möhring-Hesse an Bischof Dr. Peter Kohlgraf
vom 30.09.2020 (schnelle und pointierte Reaktion am Tag der Bekanntmachung!)
9. Hessische Hochschullehrer*innen melden sich zu Wort
Offener Brief an Bischof Dr. Peter Kohlgraf vom 03. Oktober 2020
10. Sie schließen das Haus am Maiberg – wir verlieren unsere Heimat
Offener Brief von „50plus-aktiv an der Bergstraße“ an Weihbischof Dr. Udo Bentz
vom 14.10.2020
11. Erinnerung an Guernika – Baustein für die friedliche Zukunft Europas
Schreiben des Friedensforschungsinstituts Guernika Gogoratuz/Spanien an Bischof
Dr. Peter Kohlgraf vom 13.10.2020
12. Kooperation zwischen Mobiler Beratung & Politischer Bildung
Offener Brief des Bundesverbands Mobile Beratung an Bischof Dr. Peter Kohlgraf
vom 19.10.2020
13. Challenging and unique interactions between Palestinian and Jewish Israeli
youth and Polish and German youth
Offener Brief von Givat Haviva/Israel an Bischof Dr. Peter Kohlgraf vom 22.10.2020
14. Verlässlicher und hochgeschätzter Partner zum Thema „Martin Buber“
Schreiben von Dr. Wolfgang Krone, Vorsitzender der Martin Buber Gesellschaft, an
Bischof Dr. Peter Kohlgraf vom 06.10.2020
15. Kirchliche Bildungsarbeit für Menschen am Rande der Gesellschaft
Schreiben der Arbeitslosenseelsorge München an Bischof Dr. Peter Kohlgraf
16. Markante Einzelstimmen zur angekündigten SchließungMartin lüftet den Mantel des Schweigens Schutzpatron verlangt, dass die Kirche das Haus am Maiberg erhält Von Bernd Sterzelmaier Menschen, die getauft sind und im christlichen Glauben erzogen wurden, kehren der Kirche scharenweise den Rücken. Wer soll sie aufhalten? Eine Antwort könnte der Heilige Martin (316 bis 397) geben, der Schutzpatron des Bistums Mainz. Fragen wir ihn am 11.11., an seinem Namenstag, was er davon hält, eine katholische Schule und eine katholische Akademie zu schließen, um Kosten zu sparen. Wir können davon ausgehen, dass er sich auf sein Pferd setzen und im Galopp an die Bergstraße reiten würde, um beide Einrichtungen zu retten. Nicht nur die Mädchen und jungen Frauen, die im Geiste von Maria Ward in Bensheim gebildet werden, würde er schützen. Er würde auf den Maiberg eilen, um mit-zu-teilen, was Bildung für die Kirche des 21. Jahrhunderts bedeutet: Die Öffnung zur Welt, die Form der Begegnung, zu der es in sakralen Räumen kaum noch kommt und die sich nicht im virtuellen Raum simulieren lässt. „Alles wirkliche Leben ist Begegnung“, so hatte es ein anderer Martin gesagt. Martin Buber (1875 bis 1965), der jüdische Religionsphilosoph, der 22 Jahre lang in Heppenheim gelebt hat (1916 bis 1938), auch er wäre wahrscheinlich nach Bensheim zur Liebfrauenschule und nach Heppenheim auf den Maiberg geeilt, um unserem Martin zur Seite zu stehen, um Schule und Akademie zu verteidigen gegen die Ökonomen, die sparen meinen, wenn sie teilen sagen. Lassen wir noch einen Martin zu Wort kommen, der dem Bischof von Tour nacheiferte: „Die dringlichste und immer wieder aufkommende Frage im Leben ist: „Was tust Du für die anderen?“. Das soll Martin Luther King (1929 bis 1968) gesagt haben. Sankt Martin hat vieles mit-zu-teilen. Er war nicht getauft, er musste nicht als Märtyrer sterben, trotzdem gehört er zu den am meisten verehrten Heiligen der Christenheit, nicht nur der katholischen Kirche. Martins Bekenntnis zu Jesu und zu den christlichen Werten verliehen ihm die Kraft, für die ihn die Menschen bis heute verehren. Kosten-Nutzen- Rechnungen waren ihm fremd. Unternehmensberater hätten ihm wahrscheinlich empfohlen, den Mantel nicht zu teilen, sondern ihn zu vermieten oder in Erbpacht zu verleihen, um
Einnahmen zu generieren. Sich von etwas zu trennen, zu verkleinern, davon hätten die Berater abgeraten. Es sind die Tage im ersten Drittel des Monats November, die alles mit allem verbinden. Der Heilige Martin starb an einem 8. November. Drei Tage später wurde er in der Nähe von Tours zu Grabe getragen. An einem 10. November wurde ein Kind geboren, das am 11. November auf den Namen Martin Luther (1483 bis 1546) getauft wurde. Auch dieser Martin veränderte die Welt. Die Bedeutungen des 11.11. sind vielfältig. Früher markierte dieses Datum den Beginn einer Fastenzeit. Noch immer ist dies der Beginn einer närrischen Zeit. Für die Fastnachter ist Mainz eine Hochburg. Vom Mainzer Dom geht eine besondere Kraft aus, die weit über das Bistum hinausreicht. Schutzpatron ist der Heilige Martin. Ob sich Martin mit diesem Bistum auf einen „Pastoralen Weg“ begeben hätte? Wir wissen es nicht. Doch es passt nicht zu diesem Mann, der als Soldat gekämpft und als Bischof gestorben ist. Für das, was er getan hat, brauchte er keine Unternehmensberater: Der Bettler fror, Martin trug einen Mantel. Den teilte er mit dem Bettler. Teilen als höchste Form der Nächstenliebe, das ist es, was Martin verkörpert. Er ließ sich nicht beirren: In der folgenden Nacht erschien ihm Jesus im Traum und dankte ihm für die gute Tat. Denn in der Gestalt des Bettlers habe Martin dem Gottessohn selbst geholfen: „Martinus, der noch nicht getauft ist, hat mich mit diesem Mantel bekleidet“, soll Jesus gesagt haben. Von da an war das Leben des Martin von Tours ganz vom christlichen Glauben erfüllt. Er ließ sich taufen, verließ das Militär, wurde Priester und lebte zunächst als Einsiedler. Um 360 gründete er in Ligugé in der Nähe des französischen Poitiers das erste Kloster des Abendlandes. 375 baute er in der Nähe von Tours ein weiteres Kloster: Marmoutier. Dort fanden sich bald Gleichgesinnte, die mit ihm ein Leben in Einfachheit, Gebet und persönlicher Besitzlosigkeit lebten. Martin wurde als Ratgeber und Nothelfer bekannt. Als einige Jahre später ein neuer Bischof von Tours gesucht wurde, waren sich die Menschen schnell einig, dass es Martin werden sollte. -
In der Martinswoche 2020 kam der Heilige Martin auch nach Heppenheim an den Maiberg, wo er sich aus gegebenem Anlass einem Interview stellte: Bischof Martin, Sie sind empört, weil der Mainzer Kollege Peter und sein Weihbischof Udo das Haus am Maiberg schließen wollen, die Akademie für politische und soziale Bildung. Der Kirche laufen die Gläubigen, also die Kunden, und die Kosten davon. Die Akademie Haus am Maiberg ist schon immer - wie alle Bildung in kirchlicher und auch öffentlicher Trägerschaft - ein Zuschussbetrieb. Warum sehen Sie das nicht ein? Martin: Weil der Bischof nicht versteht, dass die Diözese verliert, statt zu gewinnen. Wir können die Menschen im 21. Jahrhundert nur erreichen, wenn wir teilen und mitteilen. Bildung ist seit 2000 Jahren der Kern unserer christlichen Botschaft. Wie meinen Sie das? Martin: In der Heiligen Schrift, im Alten wie im Neuen Testament, stehen Worte, die als Wissen vermittelt wurden, lange bevor Lesen und Schreiben zu allgemeinen Kulturtechniken wurden. Gottesdienst mit Predigt und Gebet, das waren die Seminarformen, wie sie von Christen entwickelt wurden. Mit dem Buchdruck, der in Mainz erfunden wurde, entstand eine neue Didaktik des Glaubens. Von nun an waren Christen in der Lage, sich aktiv an diesem Bildungsprozess zu be-teiligen. Was hat das mit dem Haus am Maiberg zu tun? Martin: Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil ist die katholische Kirche im vergangenen Jahrhundert in eine neue Phase der Glaubensvermittlung eingetreten. Als hätte Papst Johannes XXIII. es geahnt, dass sich neue Medien Bahn brechen, dass neue Formen der Bildung und neue Formen der Glaubensvermittlung entwickelt werden müssen. Gäbe es Einrichtungen wie das Haus am Maiberg nicht, die Kirche müsste sie erfinden. Was ist mit den Gottesdiensten, in denen nach wie vor gepredigt und gebetet wird? Martin: Die sakralen Räume werden noch gebraucht. Aber sie haben an Bedeutung verloren. Getaufte Christen kehren der Kirche den Rücken. Sie lassen sich weder von Pfarrern noch Bischöfen aufhalten, wenn die ihnen vom Altarraum aus nachrufen: Bleibt stehen, kehrt um! Ein solcher Aufruf verhallt im Kirchenschiff. Hinausgehen, sich diesem Trend entgegenstellen, die Menschen von Angesicht zu Angesicht ansprechen, das kann,
wenn überhaupt, nur außerhalb der Kirche geschehen. „Offen für Dialog“, dieses Angebot gilt in Heppenheim – besonders im Haus am Maiberg. Sie argumentieren so, als hielten die Bildungsreferent*innen im Haus am Maiberg die Patentrezepte bereit, mit den das Bistum sämtliche Probleme wie durch ein Wunder lösen könnte. Martin: Soweit müssen wir nicht gehen. Vielleicht stehen die Leute vom Maiberg nur mit beiden Beinen auf dem Boden der Realität. Sie zeigen der Kirche den Weg in die Zukunft und befinden sich doch in bester christlicher Tradition. Ich sehe in der Akademie ein „Kloster in neuem Gewand“. Was soll dieser Vergleich? Martin: Klöster waren die Stützen der Christenheit. Vom Maiberg aus geht der Blick zum Kloster Lorsch, das – lange nach meiner Zeit – das geistige und kulturelle Zentrum im Mittelalter war. Von dort wurde der Glaube verbreitet, indem Schriften und damit Wissen verbreitet wurden, solange es den Buchdruck noch nicht gab. Klingt nicht schlecht: Das Haus am Maiberg als kulturelles Zentrum des 21. Jahrhunderts, als Kloster 4.0 in einer digitalisierten Welt, Bildungsreferent*innen als moderne Mönche, denen nur die Kutte fehlt? Geht es auch eine Nummer kleiner? Martin: Mir fällt kein anderer Vergleich ein. Klöster waren Keimzellen und Kraftzentren des Glaubens. Sie haben das, was in den Gotteshäusern geschah, auf geniale Weise ergänzt und erweitert. In den Klöstern herrschte immer das Bewusstsein, dass es jenseits der Mauer eine Welt gibt, die überzeugt werden will und in der geteilt werden muss. Ganz nebenbei: Bevor ich mich überreden ließ, Bischof zu werden, war ich ein einfacher Mönch. Das mag überzeugend klingen, wie Sie den Mantel der Geschichte maßschneidern wollen. Dabei sind Sie elegant der Frage ausgewichen, wie die Kirche ihre finanziellen Probleme in den Griff bekommen soll. Die Einsicht, dass gespart werden muss, klingt im Haus am Maiberg wie: Wasch‘ mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Was würden Sie tun, wenn sie nicht vor 1700 Jahren Bischof von Tours, sondern heute Bischof von Mainz wären? Martin: Natürlich käme auch ich um eine Inventur nicht herum. Ich will wissen, wie arm oder wie reich meine Kirche ist. Mit dem offiziellen Haushaltsplan der Diözese würde ich
mich nicht abspeisen lassen. Nicht nur, wenn es um Geld geht: Die Kirche hüllt zu oft den Mantel des Schweigens über die Themen, die die Gläubigen am meisten interessieren. Verschwiegenheit löst Austrittswellen aus. Das Schweigen zum Missbrauch hat es gezeigt. Der Bischof von Limburg hatte sein Vertrauen verspielt, weil nicht herauskommen sollte, wie er das Geld ausgibt, das ihm in Form von Kirchensteuern anvertraut war. Sie behaupten also, auch das Bistum Mainz könne nicht belegen, dass ein harter Sparkurs nötig ist? Martin: Solange der Besitz von Liegenschaften und Immobilien nicht beziffert wird, solange nicht klar ist, welche Finanzmittel in Stiftungen und Schattenhaushalten verborgen sind, solange glaube ich nicht, dass das Haus am Maiberg abgestoßen werden muss. Nur zur Erinnerung: Es waren die dunklen Finanzgeschäfte der Kirche, die meinen Namensvetter Martin zur Weißglut brachten und zur Reformation führten. Jetzt müssen Sie nur noch erklären, wie ihre betriebswirtschaftlichen Überlegungen zur Legende vom Mantelteilen passt. Martin: Die Legende kennt jedes Kind. Aber niemand hat bisher nachgefragt, wie ich zu meinem Entschluss kam. Dann erzählen Sie es uns bitte. Martin: Ich hätte dem Bettler den ganzen Mantel gegeben und so zum Märtyrer werden können. Er hätte überlebt, doch ich wäre erfroren. Deshalb kam für mich nur das Teilen in Frage. Jesus hat von mir nicht verlangt, dass ich mich um Gottes Willen bis auf die Knochen ausziehe. Das verlangt er auch nicht vom Mainzer Bischof. Wer helfen will, muss helfen können, muss Stärke bewahren. Vergleichen Sie Ihre gute Tat mit dem, was die Kirche des Bistums Mainz mit ihrem Pastoralen Weg erzielen will. Martin: Dieser Vergleich hinkt. Ein Unternehmensberater hätte mir damals empfohlen, meinen Mantel zu vermieten oder einem Investor zu geben, damit ich meinen Cashflow verbessere. Jetzt rede ich schon wie auf den Finanzmärkten. Ich hatte nur einen Mantel, den ich teilen musste, um helfen zu können. Ich habe den Verdacht, dass die Kirche noch viele Mäntel in ihren geheimen Schränken hängen hat. Einige sind sogar mit Pelz und Edelsteinen
besetzt. Von diesen Mänteln soll sie sich trennen. Sie sind der Ballast, den es abzuwerfen
gilt. Frieren muss sie noch lange nicht. Die Liebfrauenschule und das Haus am Maiberg
kann sie behalten.
Warum kommen der Bischof und seine Berater nicht selbst auf diese Idee? Warum erkennen
sie nicht den immateriellen Wert, der im Haus am Maiberg steckt? Warum begreifen sie
nicht, dass in der Liebfrauenschule die Generation junger Frauen heranwächst, die die
Kirche braucht?
Martin: Diese Frage müssten Sie in Mainz stellen. Ich kann mich nur wundern. In der
Broschüre „Pastoraler Weg im Bistum Mainz“ stehen zwischen den Zeilen die Antworten
schwarz auf weiß: „Dieser Prozess steht unter dem Motto ,Eine Kirche, die teilt‘“, heißt es.
Dann lese ich weiter: „Kirche und Gesellschaft verändern sich. Deshalb lädt Bischof
Kohlgraf dazu ein, diese Veränderung mitzugestalten“. Der Bischof fragt: „Was brauchen die
Menschen heute von der Kirche? Wie gelingt es uns, die Botschaft des Evangeliums zu
verkünden, gerade auch jenen, die sie für ihr Leben noch nicht (so intensiv) entdeckt
haben?“ Wer den Pastoralen Weg beschreitet, der kommt um den Maiberg nicht herum.
Bischof Martin, wir danken Ihnen für das Gespräch.
St. Martin auf dem Dom zu MainzHeppenheim, im Oktober 2020
OFFEN ER B R I EF D ER B EL EGS CH A FT
Das Bistum Mainz hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des „Haus am Maiberg“ am 30. September
2020 davon in Kenntnis gesetzt, dass die Einrichtung zum 31. Dezember 2022 geschlossen werden soll.
Begründet wird dies mit der wirtschaftlich schwierigen Situation des Bistums und einer notwendigen
Weichenstellung für die Zukunft. Mit dieser Mitteilung möchten wir – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
– unsere Trauer sowie unser Unverständnis über diese Entscheidung zum Ausdruck bringen und an die
Entscheidungsträger des Bistums Mainz appellieren, noch einmal den Dialog über eine Fortführung
unserer Arbeit am Standort in Heppenheim zu suchen.
Das Haus am Maiberg ist seit 30. September 1955 – also auf den Tag genau seit 65 Jahren – eine
Bildungseinrichtung des Bistums Mainz und wurde durch den vorherigen Bischof, Karl Kardinal Lehmann,
im Jahr 1998 zur Akademie für politische und soziale Bildung ernannt. Seitdem hat sich das Haus am
Maiberg zu einer der wichtigsten Akademien für die politische und soziale Jugend- und
Erwachsenenbildung in Deutschland entwickelt. Das Haus gilt als innovativer und impulsgebender Ort für
die Weiterentwicklung der politischen Bildung. Unsere Bildungsarbeit wird institutionell und über
unterschiedliche Programme beispielsweise von der Europäischen Union, vom Bund, vom Land Hessen
und vom Kreis Bergstraße gefördert. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Jahren mehrjährige
Projekte durchgeführt, die u.a. von der Bundeszentrale für politische Bildung, der Aktion Mensch und der
Robert Bosch Stiftung finanziert wurden. Durch eine hohe Drittmittelquote steht die Bildungsarbeit der
Einrichtung wirtschaftlich auf vergleichsweise soliden Beinen.
In unserer Einrichtung sind derzeit 32 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen und
Professionen sowie zahlreiche freiberufliche Referentinnen und Referenten auf Honorarbasis beschäftigt.
Im hausinternen Bildungsbereich arbeiten sechs Bildungsreferentinnen und Bildungsreferenten sowie drei
Verwaltungskräfte und zwei Freiwilligendienstleistende in der Erwachsenenbildung, der Jugendbildung,
der Internationalen Jugendarbeit sowie der Mobilen Beratungsarbeit gegen Extremismus und für
Demokratieförderung. Im Tagungshaus sorgen 21 Kolleginnen und Kollegen für reibungslose Abläufe,
Hygiene und Sauberkeit in den Gästezimmern und funktionierende Technik in den Seminarräumen sowie
eine hochwertige, saisonale sowie regionale kulinarische Verpflegung unserer Gäste.
Damit können wir jährlich ca. 10.000 Gäste in unserem Tagungshaus begrüßen. Neben der Aus- und
Weiterbildung verschiedener Berufsgruppen gehört dazu beispielsweise die religionspädagogische
Fortbildung von Lehrkräften sowie Tagungen unterschiedlichster kirchlicher Gremien. Mit der
hausinternen Bildungsarbeit werden durch Workshops, Seminare, Fachtagungen und internationale
Begegnungen im eigenen Tagungshaus zusätzlich etwa 2.500 Teilnehmende pro Jahr aus der ganzen
Bundesrepublik und zahlreichen europäischen Ländern erreicht. Darüber hinaus sind wir im Kreis
Bergstraße in der Jugendbildung sowie der Bildungsarbeit mit Seniorinnen und Senioren präsent und
bieten Bildungsreisen sowie internationale Begegnungen an.
Wir arbeiten inhaltlich sowie methodisch am Puls der Zeit: unsere Veranstaltungen finden in
verschiedenen Formaten wie Workshops, Seminaren, Begegnungen, Vorträgen, Exkursionen oder
Bildungsurlauben statt. Neben Wissensvermittlung, Diskussion und Reflexion ist die aktivierendeBeteiligung aller Teilnehmenden eines der wichtigsten Ziele unserer Bildungsarbeit. Bei der Ausrichtung unserer Arbeit dienen uns christliche Grundwerte wie Frieden, Gemeinschaft, Nächstenliebe, Solidarität und die Bewahrung der Schöpfung als wichtige Leitlinie. Im Haus am Maiberg tagen Menschen aus zahlreichen gesellschaftlichen sowie beruflichen Kontexten, aus den unterschiedlichsten Gruppierungen des Dekanats, des Bistums und der bundesdeutschen katholischen Kirche sowie aus christlichen und nichtchristlichen Vereinen, Verbänden, Unternehmen und Nichtregierungsorganisationen. Wir bieten einen Ort der Begegnung, die Möglichkeit zum zwischenmenschlichen Austausch und ein Zusammentreffen mit der katholischen Kirche, das von vielen Gästen und Teilnehmenden positiv wahrgenommen wird. Unsere Gäste kommen aus zahlreichen Gründen ins Haus am Maiberg: weil sie nicht durch alltägliche Sorgen abgelenkt werden wollen, weil unsere Preise noch bezahlbar sind, weil unsere Lage unvergleichlich schön und doch gut erreichbar ist, weil unser Umgang persönlich und die Seminarorganisation individuell auf die Gästewünsche abgestimmt ist. Dennoch kann im Bereich Tagungshaus durch weitere betriebswirtschaftliche Maßnahmen die Wirtschaftlichkeit verbessert werden. Aufwändige bauliche Sanierungen werden – nicht nur aus unserer Sicht, sondern auch durch einen Architektonischen Gutachter bestätigt – in den kommenden Jahren nicht erforderlich sein, um die bisherigen Gäste auch zukünftig professionell empfangen zu können. Da in den letzten Jahren viel in unsere Einrichtung investiert wurde, erscheint uns ein Verkauf besonders fragwürdig. Wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind – ebenso wie die Leitung unserer Einrichtung – von der Entscheidung des Bistums überrascht worden und aus mehreren Gründen sehr betroffen: Zum einen empfinden wir die Tatsache, dass die Schließung am Tag des 65. Jubiläums der Einrichtung sowie zwei Tage nach der Corona-bedingten Wiedereröffnung kommuniziert wurde, sehr unpassend. Zum anderen halten wir die Schließung der Einrichtung aus unserer christlichen Überzeugung und unserer jahrzehntelangen erfolgreichen Arbeit kirchen- und bildungspolitisch für ein falsches Signal. Die Bildungsreferentinnen und -referenten unseres Hauses bringen sich seit langem und an mehreren Stellen aktiv in die Gestaltung unseres Dekanats und dessen Weiterentwicklung im Rahmen des Pastoralen Wegs ein. Auf dem gemeinsamen Weg zu einer „Kirche des Teilens“ betrachten wir das Haus am Maiberg als einen zentralen Kirchort, an dem Menschen aus verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen an einem katholischen Ort zusammenkommen. Daher m öchten w ir diesen ein dringlichen Appell an die Bistu m sleitu ng u n d alle P ersonen richten, die in die En tscheidu ng zu r Schließu n g inv olv iert w aren: Geben Sie u ns die Ch an ce zu m Dialog ü ber die K irche der Zu k u nft! Gem einsam m it Ihnen m öch ten w ir disk u tieren, w elches P oten zial das Hau s am Maiberg in Heppen heim au f dem gem einsam en Weg zu einer zu k u nftsorientierten K irche bietet. Wir bitten Sie eindrin glich , u n sere Bedenk en au ch in Ih re Überlegu ngen ein zu beziehen u n d die Entscheidu ng zu r Schließu ng des Hau s am Maiberg n och ein m al zu ü berdenk en! Die Überfü hru ng u n serer v ielfältigen Bildu ngsangebote in einen rein sozialethischen u nd sozialpolitischen Bereich in neu trale n R äu m lichk eiten w ü rde das Selbstv erstän dnis sow ie den Ch arak ter u n serer Arbeit m assiv v erän dern . Unzählige Menschen au s Gesellschaft, K irche u nd P olitik v erbinden tiefgehen de Erfahru ngen m it dem Hau s am Maiberg als christlicher Lernort. Trag en Sie du rch Ihre Entscheidu n g dazu bei, dass w ir au ch w eiterhin als B rü ck e v on K irche in die Welt u nd u m gek ehrt w irk en k ön nen ! ___________________________________________________________________________ Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Haus am Maiberg
Am 23.10.2020 hat Steve Kenner/Universität Hannover und Landesvorsitzender
der DVPB Niedersachsen die folgende Petition gestartet. Bis zum 09.11.2020
haben über 1.500 Personen die Petition gezeichnet.
Für weitere Zeichnungen gehen Sie auf:
https://www.change.org/p/bischof-dr-peter-kohlgraf-das-haus-am-maiberg-
muss-erhalten-bleiben?redirect=false
Das „Haus am Maiberg“ muss erhalten bleiben!
Solidaritätserklärung aus der politischen Bildung
In diesem Jahr feiert das „Haus am Maiberg“ sein 65-jähriges Bestehen. Jetzt steht die
Akademie für politische und soziale Bildung vor dem Aus. Das Bistum Mainz, Träger der
Bildungseinrichtung, hat kürzlich die Schließung der Einrichtung zum 31.12.2022 verkündet.
Die Unterzeichner*innen dieser Petition sind betroffen und erklären sich solidarisch mit dem
„Haus am Maiberg“. Die Schließung wäre ein fatales Signal und ein schwerer Verlust für die
politische Bildung.
Das „Haus am Maiberg“ ist mehr als eine außerschulische Bildungseinrichtung
Wie kaum eine andere Bildungsstätte der politischen Jugend- und Erwachsenenbildung hat das
„Haus am Maiberg“ das Feld der politischen Bildung in den vergangenen Jahrzehnten
nachhaltig geprägt. Es ist immer wieder gelungen, mit herausragenden Projekten in der Praxis
der (internationalen) Jugend- und Erwachsenenbildung Menschen allen Alters für die Themen
der politischen Bildung zu sensibilisieren und sie für die Demokratie zu begeistern. Jedes Jahr
werden mehr als 2.000 Teilnehmer*innen aus Deutschland und zahlreichen europäischenLändern mit Seminaren, Workshops, Tagungen und weiteren Bildungsformaten erreicht. Über die Jahre haben so unzählige Träger und Akteure der Jugend- und Erwachsenenbildung von den Erfahrungen profitiert, die sie an diesem einzigartigen Bildungsort sammeln durften. Das „Haus am Maiberg“ bringt Wissenschaft und Praxis zusammen Wie kaum ein anderer Ort der außerschulischen Jugend- und Erwachsenenbildung gelang es den Verantwortlichen dieses Bildungsortes, Wissenschaft und Praxis zusammenzudenken und immer wieder neue Impulse zu setzen. Das „Haus am Maiberg“ ist ein Ort, der immer wieder Raum geschaffen hat für den Austausch zwischen universitärer Forschung in den Feldern Politikdidaktik sowie außerschulischer Jugend- und Erwachsenenbildung und den Akteuren der Bildungspraxis. Hier treffen sich Forscher*innen, Sozialarbeiter*innen, Pädagog*innen, Schüler*innen, Kinder und Jugendliche. Wie an kaum einem anderen Ort, findet hier seit Jahrzehnten ein konstruktiver, ein fruchtbarer Austausch auf Augenhöhe statt. Das „Haus am Maiberg“: ein Leuchtturm der politischen Bildung mit internationaler Strahlkraft Aus dem Zusammenwirken von Wissenschaft und Praxis sind zahlreiche Projekte entstanden, die die politische Bildung bis heute nachhaltig prägen. Dazu zählen gut besuchte und hochrangig besetzte Fachtagungen, einschlägige Publikationsprojekte, aber auch bedeutsame Forschungsprojekte, u.a. gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung, der Aktion Mensch und der Robert Bosch Stiftung, die stets das Ziel verfolgten, einen Transfer von Wissenschaft und Praxis zu etablieren. So hat sich das „Haus am Maiberg“ zu einem Leuchtturm der politischen Bildung entwickelt, dessen Strahlkraft weit über die Grenzen der Region, des Landes Hessen und der Bundesrepublik hinaus reicht. Die Unterzeichner*innen und Unterzeichner dieser Petition fordern daher, dass alles unternommen wird, um die Schließung der Akademie „Haus am Maiberg“ zu verhindern. Dabei geht es nicht nur um die Sicherung des über Jahrzehnte aufgebauten Wissens, es geht um den Erhalt eines einzigartigen Freiraumes politischer Bildung. Das „Haus am Maiberg“ muss der politischen Bildung erhalten bleiben! Erstunterzeichner*innen: Prof. Dr. Tonio Oeftering, Vorsitzender der Deutschen Vereinigung für Politische Bildung (DVPB) Prof. Dr. Monika Oberle, Sprecherin der Gesellschaft für Politikdidaktik und politische Jugend- und Erwachsenenbildung (GPJE) Barbara Menke, Vorsitzende des Bundesausschusses Politische Bildung (bap) Boris Brokmeier, Vorsitzender des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten (AdB) Dr. Tessa Debus, Verlegerin WOCHENSCHAU Verlag
An
Bischof Dr. Peter Kohlgraf
Bischöfliches Ordinariat
Postfach 1560
55005 Mainz
Jun.-Prof. Dr. Alexander Wohnig Prof. Dr. Klaus-Peter Hufer
Universität Siegen Universität Duisburg Essen
Philosophische Fakultät Fakultät für Bildungswissenschaften
Adolf-Reichwein-Str. 2 Universitätsstr. 2
57068 Siegen 45141 Essen
alexander.wohnig@uni-siegen.de Klaus-Peter.Hufer@t-online.de
Siegen/Essen, 07.10.2020
Das Haus am Maiberg muss erhalten bleiben - Appell und Offener Brief aus der
Wissenschaft
Sehr geehrter Bischof Dr. Peter Kohlgraf,
am 30.09.2020 verkündete das Bistum Mainz die Schließung des Hauses am Maiberg in
Heppenheim (Südhessen). Wir bedauern diese Entscheidung aus Perspektive der Wissenschaft
der Politischen Bildung sehr und appellieren an das Bistum Mainz, diese rückgängig zu machen.
Das Haus am Maiberg hat sich in den vergangenen 30 Jahren als Akademie für politische und
soziale Bildung bundesweit zu einem zentralen Ort für die Praxis und die Wissenschaft der
Politischen Bildung entwickelt. Es ist einer der wenigen Orte in der Bundesrepublik, in denen die
Perspektiven von Wissenschaft und Bildungspraxis nicht nur auf Veranstaltungen
zusammenkommen, sondern auch in der Arbeit im Haus zusammengedacht werden. Davon
zeugen u.a. unzählige wissenschaftliche Publikationen, die aus dem Haus heraus den Diskurs
der außerschulischen politischen Jugend- und Erwachsenenbildung maßgeblich mitgeprägt
haben. Zudem ist das Haus am Maiberg der zentrale Ort des Austausches von (universitärer)
schulischer Politikdidaktik, außerschulischer politischer Jugendbildung und politischer
Erwachsenenbildung. Im Haus am Maiberg können Wissenschaftler/-innen und Praktiker/-innen
ihre Forschungsergebnisse austauschen und gemeinsam darüber nachdenken, wie durch
politische Bildung der Zusammenhalt der Gesellschaft gefördert und eine offene, demokratische
Gesellschaft gestärkt werden kann. Daraus sind zahlreiche, in der Bildungspraxis fruchtbare
Aktivitäten entstanden. Das hat maßgeblich zur Weiterentwicklung der demokratischen Kultur
beigetragen.
Das Haus am Maiberg ist daher ein unverzichtbarer Begegnungsort, ein Ort der Zusammenkunft
verschiedener Perspektiven politischer Bildung und des Austragens der Diskurse im Feld, der
weit über die Grenzen der Bundesrepublik bekannt ist. Es hat eine zentrale Bedeutung für den
Wissenschafts-Praxis-Transfer: Besonders deutlich wird dieser Aspekt in den jährlich
stattfindenden und sehr gut besuchten sowie hochrangig besetzten fachwissenschaftlichen
Tagungen.
Nicht zuletzt sind das Haus am Maiberg und die darin tätigen Personen zentrale Akteur/-innen
im Feld politischer Bildung, sei es mit Beiträgen in einschlägigen Publikationen, mit Vorträgen
auf nationalen und internationalen Fachtagungen, als Expert/-innen in Gremien oder durch dieEntwicklung hochrelevanter Modellprojekte. So ist das Haus am Maiberg auch ein Forschungsfeld für die Wissenschaft der Politischen Bildung und trägt zur wissenschaftlich reflektierten Weiterentwicklung von Zugängen, Konzepten und Methoden der politischen Bildung und damit der gesamten Profession bei. Gerade in Zeiten gesellschaftlicher, sozialer und politischer Turbulenzen, einer zunehmenden Fragmentierung der Gesellschaft, der Zustimmung zu populistischen Parolen, ist eine Arbeit, wie die des Hauses am Maiberg, unverzichtbar. Mit freundlichen Grüßen Jun.-Prof. Dr. Alexander Wohnig und Prof. Dr. Klaus-Peter Hufer Liste der Unterzeichner/-innen Jun.-Prof. Dr. Alexander Wohnig (Universität Siegen, Didaktik der Sozialwissenschaften) Prof. Dr. Klaus-Peter Hufer (Universität Duisburg Essen, Politische Erwachsenenbildung) Prof. Dr. Michael Haus (Universität Heidelberg, Moderne Politische Theorie) Prof. Dr. Dirk Lange (Universität Wien/Leibniz Universität Hannover, Didaktik der Politischen Bildung) Prof. Dr. Matthias Busch (Universität Trier, Fachdidaktik Gesellschaftswissenschaften) Dr. Sven Rößler (PH Weingarten, Politikwissenschaften und ihre Didaktik) Dr. Falk Scheidig (Pädagogische Hochschule FHNW, Schweiz) Dr. Susann Gessner (Philipps-Universität Marburg, Didaktik der politischen Bildung) Prof. Dr. Kerstin Pohl (Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, Didaktik der politischen Bildung) Prof. Dr. habil. Albert Scherr (Pädagogische Hochschule Freiburg, Institut für Soziologie) Steve Kenner (Leibniz Universität Hannover, Institut für Didaktik der Demokratie) Prof. Dr. Helmut Bremer (Universität Duisburg-Essen, Politische Erwachsenenbildung) Prof.in Dr. in Bettina Lösch (Universität Köln, Politikwissenschaft und politische Bildung) Philipp Klingler (Philipps-Universität Marburg, Didaktik der politischen Bildung) Prof. Dr. Sabine Achour (Freie Universität Berlin, Politikdidaktik und Politische Bildung) Oliver Emde (Universität Hildesheim, Politikdidaktik und politische Bildung) Prof. Dr. Markus Emanuel (University of Applied Sciences Darmstadt, Sozialwirtschaft) Achim Albrecht (Universität Kassel, Didaktik der politischen Bildung) Dr. Moritz Peter Haarmann (Leuphana Universität Lüneburg, Politikdidaktik) Prof. Dr. Benno Hafeneger (Universität Marburg, Erziehungswissenschaften/außerschulische Jugendbildung) Prof. Dr. Sophie Schmitt (Justus-Liebig-Universität Gießen, Didaktik der Sozialwissenschaften) V.-Prof. Dr. Carsten Bünger (Pädagogische Hochschule Schwäbisch-Gmünd, Allgemeine Pädagogik) Dr. Manfred Wittmeier (Goethe Universität Frankfurt/M, Fachbereich Erziehungswissenschaften)
Dr. Julia Oppermann (Leuphana Universität Lüneburg, Politikdidaktik) Prof. i. R. Dr Bernd Overwien (Universität Kassel, Didaktik der politischen Bildung) Prof. Dr. Matthias Möhring-Hesse (Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Theologische Ethik/Sozialethik) Prof. Dr. Andreas Thimmel, (Technische Hochschule Köln, Wissenschaft der Sozialen Arbeit) Prof. Dr. Astrid Messerschmidt (Bergische Universität Wuppertal, Erziehungswissenschaft/ Geschlecht und Diversität) Prof. Dr. Bernhard Emunds (Phil.-Theol. Hochschule Sankt Georgen Frankfurt am Main, Oswald von Nell-Breuning-Instituts für Wirtschafts- und Gesellschaftsethik) Michael Brugger (Universität Tübingen, Theologische Ethik/Sozialethik,) Johanna Weckenmann, M.A. (Goethe-Universität Frankfurt, Theorie und Geschichte von Erziehung und Bildung) Prof. Dr. Ingo Juchler (Universität Potsdam, Politische Bildung) Prof. Dr. Tilman Grammes (Universität Hamburg, Erziehungswissenschaft/ Didaktik der Sozialwissenschaften) Prof. Dr. Andreas Eis (Universität Kassel, Didaktik der Politischen Bildung) Prof. Dr. habil. Klaus Moegling (Universität Kassel, Gesellschaftswissenschaften) Prof. Dr. Frank Nonnenmacher (Goethe-Universität Frankfurt am Main, Gesellschaftswissenschaften) Dr. Jens Geldner (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Institut für Rehabilitationspädagogik) Vertr.-Prof. Dr. Sabrina Schenk (Universität Koblenz-Landau, Erziehungswissenschaft mit dem Schwerpunkt für Erziehungs- und Bildungstheorie) Prof. Dr. Sören Torrau (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Didaktik der Sozialkunde / Politik und Gesellschaft) Prof. Dr. Wolfgang Sander (Justus-Liebig-Universität Gießen, Didaktik der Gesellschaftswissenschaften) M.A. Sarah Jasmine Ernst (Universität Duisburg-Essen, Erwachsenenbildung/ Politische Bildung) Prof. Dr. Dirk Jörke (Technische Universität Darmstadt, Institut für Politikwissenschaft) Dr. Veith Selk (Technische Universität Darmstadt, Institut für Politikwissenschaft) Matthias Heil (Universität Heidelberg, Institut für Politische Wissenschaft) Dr. Jana Trumann (Universität Duisburg-Essen, Fakultät für Bildungswissenschaften) Ulrich Ballhausen (Leibniz Universität Hannover, Institut für Didaktik der Demokratie) Jürgen Gerdes (Pädagogische Hochschule Freiburg, Fakultät für Bildungswissenschaften) M.A. Jan-Hendrik Herbst, (TU Dortmund, katholische Religionspädagogik) Dipl. Soz. Päd. Angela Merkle (Hochschule RheinMain Wiesbaden, Sozialwesen) Dr. Susanne Umbach (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg, Erwachsenenbildung)
M.A. Laura Schudoma (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg, Erwachsenenbildung) M.A. Helene Bergmann (Pädagogische Hochschule Freiburg, Institut für Politik- und Geschichtswissenschaft) Prof. Dr. Carsten Wirth (Hochschule Darmstadt, Gesellschaftswissenschaften) Prof. Dr. Volker Reinhardt (Pädagogische Hochschule Freiburg, Institut für Geschichts- und Politikwissenschaft,) Dipl.Päd. Felix Ludwig (Universität Duisburg-Essen) Prof. Dr. Christine Zeuner (Helmut Schmidt Universität, Erwachsenenbildung) Helen Breit (Pädagogische Hochschule Freiburg, Institut für Soziologie) Prof. Dr. Uwe H. Bittlingmayer (Pädagogische Hochschule Freiburg, Institut für Soziologie) Prof. Dr. Monika Oberle (Universität Göttingen, Politikwissenschaft/Didaktik der Politik) Jun.-Prof. Dr. Inken Heldt (Technische Universität Kaiserslautern, Didaktik der Politischen Bildung) Dr. Frank Lesske (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Bereich Politikwissenschaft) Dr. Martin Kenner (Universität Stuttgart, Institut für Erziehungswissenschaft) Dr. Reiner Becker (Philipps-Universität Marburg, Institut für Erziehungswissenschaft) Vertr.-Prof. Dr. Katrin Hahn-Laudenberg (Bergische Universität Wuppertal, Didaktik der Sozialwissenschaften) M.A. Elizaveta Firsova, (Universität Hannover, Institut für Didaktik der Demokratie) Prof. Dr. Karim Fereidooni (Ruhr-Universität Bochum, Juniorprofessur Didaktik der sozialwissenschaftlichen Bildung) Dr. Sebastian Jacobs (Universität Siegen, Erziehungswissenschaft/Psychologie) Prof. Dr. Kerstin Jergus (Technische Universität Braunschweig, Allgemeine Pädagogik) Prof. Dr. Ulrich Klemm (Leipziger Institut für angewandte Weiterbildungsforschung) Charlotte Keuler (Universität Trier, Didaktik der Gesellschaftswissenschaften) PD Dr. Stefan Müller (Justus-Liebig-Universität Gießen, Didaktik der Sozialwissenschaften) Prof. i.R. Dr. Peter Euler (Technische Universität Darmstadt, Allgemeine Pädagogik mit dem Schwerpunkt Pädagogik der Natur- und Umweltwissenschaften) Prof. i.R. Dr. Sibylle Reinhardt (Martin-Luther-Universität Halle, Didaktik der Sozialkunde) Elia Scaramuzza (Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Didaktik der politischen Bildung) Andreas May (Philipps-Universität Marburg, Didaktik der politischen Bildung) Prof. em. Dr. Ludwig Pongratz (TU Darmstadt, Institut für Allgemeine Pädagogik und Berufspädagogik) JProf. Dr. Dorothee Gronostay (Technische Universität Dortmund, Institut für Didaktik integrativer Fächer) Dr. Luisa Girnus (Universität Potsdam, Lehrstuhl für Politische Bildung) Prof. Dr. Tonio Oeftering (Universität Oldenburg, Politische Bildung/Politikdidaktik)
Birgit Redlich (Institut für Demokratieforschung) Apl. Prof. Dr. Hans-Peter Burth (Pädagogische Hochschule Freiburg, Institut für Politik- und Geschichtswissenschaft) Prof. Dr. Reinhold Hedtke (Goethe Universität Frankfurt, Institut für Politikwissenschaft) Alena Plietker (Universität zu Köln, Didaktik der Sozialwissenschaften) Sara Alfia Greco (Universität Hannover, Didaktik der Politischen Bildung) Paul Ernst (Universität Augsburg, Politikdidaktik) Prof. Dr Stefan Rappenglück (Hochschule München, Politikwissenschaft-Schwerpunkt European Studies, Migration) Dr. David Salomon (TU-Darmstadt, Institut für Politikwissenschaft)
Prof. Dr. Benno Hafeneger
Dipl. Päd. Klaus Waldmann
An
Bischof Dr. Peter Kohlgraf Kontakt: Klaus Waldmann
Bischöfliches Ordinariat Samariterstraße 31
Postfach 1560 10247 Berlin
55005 Mainz Klaus.Waldmann@gmail.com
per E-Mail an: bischof@bistum-mainz.de Berlin, 15.10.2020
Sehr geehrter Herr Bischof Dr. Kohlgraf,
mit diesem Offenen Brief wenden wir uns mit der dringlichen Bitte an Sie, das „Haus am Maiberg“ als
Akademie für politische und soziale Bildung in Heppenheim zu erhalten. Wir haben mit Betroffenheit
und Verwunderung zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Diözese Mainz plant, die Akademie zum
Ende des Jahres 2022 zu schließen.
Aus unserer Sicht – von Trägern, Mitarbeiter*innen in der politischen und sozialen Bildung – ist dies
unverständlich und macht uns zutiefst betroffen. Die Akademie hat regional, national und auf
europäischer Ebene einen hervorragenden Ruf und gehört zu den bundesweit anerkannten Akteuren
der politischen und sozialen Bildung. Das gilt für die vielfältigen und qualifizierten Angebote und
Aktivitäten der Akademie selbst wie für die vielen Foren und fachlichen Tagungen, die Entwicklung
von Konzepten und den Erfahrungsaustausch sowie für viele Publikationen, die die Akademie zu
einem Ort der Vernetzung engagierter Akteure und des Austauschs zwischen Wissenschaft und Praxis
haben werden lassen. Die Akademie spielt eine beispielhafte und renommierte Rolle als Bildungsort
in der Demokratie; das gilt gerade auch in schwierigen gesellschaftlichen Zeiten und Umbrüchen, in
denen solche Orte und Gelegenheiten dringlich gebraucht werden. Dabei ist vor allem auch auf die
Leitideen und das Profil der Akademie als einer Einrichtung der katholischen Kirche hinzuweisen, die
von christlichen, sozial-ethischen Werten und dem Einsatz für die Demokratie geprägt sind. Gerade in
der Demokratiebildung mit Jugendlichen und Erwachsenen hat die Akademie einen bundesweit
hervorragenden Ruf erworben, von dem viele Träger und Mitarbeiter*innen profitiert haben.
Nicht zuletzt ist das Haus am Maiberg ein wichtiger Akteur und Partner in der Europäischen
Jugendarbeit und ein engagierter Ort für internationale Jugendbegegnungen.
Die katholische Kirche hat mit der Akademie eine Ausstrahlung erworben, die neben der Bedeutung
innerhalb der AKSB und in der gesamten Trägerlandschaft der politischen und sozialen Bildung, auch
in Bereiche der Gesellschaft wirkt, die eher kirchenfern sind. Ihr kommt mit ihrer sozial-ethisch
fundierten und demokratiebildenden Arbeit somit auch eine wichtige Kommunikations- und
Brückenfunktion im Diskurs „Kirche und Gesellschaft“ zu. Ein Rückzug der Kirche aus diesem
Arbeitsbereich wäre unseres Erachtens ein fatales kirchen- und bildungspolitisches Signal.
Uns ist auch eine persönliche Anmerkung wichtig: Viele von uns verbinden fachliche und persönliche
Erfahrungen mit dieser katholischen Akademie als einem lebendigen Ort der Begegnung, der
Kommunikation und des Dialogs, der prägende Bedeutung hatte und den wir nicht missen wollen.
Solche Erfahrungen gelten auch – das zeigen vielfache Wirkungsstudien - für Jugendliche und
Erwachsene, die an Veranstaltungen und Aktivitäten des Hauses teilgenommen haben. Das dies nun
nicht mehr möglich sein soll, kann kirchen- und demokratiepolitisch nicht gewollt sein.Wir bitten Sie daher, die Argumente noch mal zu prüfen und die Entscheidung noch mal zu überdenken, um einen Weg zu finden, die Akademie mit ihrem Profil zu erhalten. Hochachtungsvoll mit freundlichen Grüßen Prof. Dr. Benno Hafeneger und Klaus Waldmann Liste der Unterzeichnerinnen und Unterzeichner Klaus Waldmann, Dipl. Pädagoge, Leitender Redakteur der Zeitschrift „Journal für politische Bildung“, Coach und Prozessbegleiter Prof. em. Dr. Benno Hafeneger, Philipps-Universität Marburg, Jugendforschung und außerschulische Jugendbildung Romani Rose, Vorsitzender, Zentralrat Deutscher Sinti und Roma Christine Kone, wiss. Mitarbeiterin für den Verband Deutscher Sinti und Roma – Landesverband Hessen Pfarrer Dr. Andreas Hoffmann-Richter, Landeskirchlicher Beauftragter für die Zusammenarbeit mit Sinti und Roma der Ev. Landeskirche Württemberg Boris Brokmeier, Vorsitzender des Arbeitskreises deutscher Bildungsstätten (AdB) Ina Bielenberg, Geschäftsführerin, Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V. (AdB) Dr. Friedrun Erben, Referentin für Kommunikation und Medien, Redakteurin der Fachzeitschrift „Außerschulische Bildung“, Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V. (AdB) Sascha Rex, Leiter Stabsstelle Grundsatz und Verbandsentwicklung, Deutscher Volkshochschulverband, Bonn Barbara Menke, Bundesgeschäftsführerin, für ARBEIT und LEBEN e.V. und als Vorstandsvorsitzende des Bundesausschuss politische Bildung e.V. (bap) Dr. Klaus Holz, Generalsekretär, für die Evangelischen Akademien in Deutschland e.V. Hanna Lorenzen, Bundestutorin, für die Evangelische Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung Mark Medebach, Koordinator des Projekts „Zukunft inklusive?“, Evangelische Akademien in Deutschland e. V. Ole Jantschek, Päd. Leiter, Evangelische Trägergruppe für gesellschaftspolitische Jugendbildung, Mitglied der Redaktion „Journal für politische Bildung“ Rolf Witte, Vorsitzender von IJAB – Fachstelle für Internationale Jugendarbeit der Bundesrepublik Deutschland e. V., Bonn Hans-Georg Wicke, Leiter von JUGEND für Europa - Nationale Agentur, Bonn Claudius Siebel, Koordinator Grundsatzfragen, JUGEND für Europa, Nationale Agentur, Bonn Prof. Dr. Ulrich Eith, Direktor des Studienhaus Wiesneck, Institut für politische Bildung Baden- Württemberg e.V, Buchenbach, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Freiburg
Ina Nottebohm, Geschäftsführerin Haus Neuland, Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Demokratischer Bildungswerke e.V., Bielefeld Iris Witt, Geschäftsführerin, Heinrich Böll Stiftung Nordrhein-Westfalen Michael Grunewald, Referent für Digitale Welt, Zentrum Gesellschaftliche Verantwortung der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, Mainz Matthias Blöser, Politikwissenschaftler und politischer Bildner, Frankfurt am Main Hanna-Lena Neuser, Evangelische Akademie Frankfurt, stellvertr. Direktorin, Studienleiterin für Europa & Jugend Dr. Susanne Benzler, Studienleitung Bildung/Jugendbildung, Evangelische Akademie Loccum Christian Kurzke, Bildungsreferent, Dresden Ansgar Drücker, Geschäftsführer des Informations- und Dokumentationszentrums für Antirassismusarbeit e. V. (IDA) Martin Kaiser, Institutsleiter, Gustav Stresemann Institut in Niedersachsen e.V., Bad Bevensen Dr. Helle Becker, Geschäftsführerin, Transfer für Bildung e.V, Essen Dr. Meron Mendel, Direktor der Bildungsstätte Anne Frank, Zentrum für politische Bildung und Beratung Hessen Antje Windler, Geschäftsführerin, Die Neue Gesellschaft e.V. Vereinigung für politische Bildung, Hamburg Stéphanie Bruel, Geschäftsführung für die Europäische Akademie Otzenhausen Dr. Uwe Berndt, Studienleiter, Studienhaus Wiesneck - Institut für politische Bildung Baden- Württemberg e.V. Jörn Didas, Geschäftsführer, Adolf-Bender-Zentrum e.V., St. Wendel Arthur Groth, Bildungsreferent, für das verdi Bildungwerk Hessen e.V. Birgit Groß, Leiterin, DGB Bildungswerk Hessen e.V. Uli Wessely, Bildungsreferent, DGB Bildungswerk Hessen e.V. Steffen Wachter, Referatsleitung Gesellschaft, Politik, Kultur und Gesundheitsbildung, Hessischer Volkshochschulverband e.V. Grit Hanneforth, Geschäftsführerin, für den Bundesverband Mobile Beratung e.V. Robert Feil, Fachbereichsleiter Schule und Bildung/Migration und Integration, Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg Wilfried Wienen, Referent für Verbandsentwicklung und Arbeitnehmer*innen-Bildung der Katholischen Arbeitnehmer-Bewegung Deutschlands (KAB) in Köln Dr. Dr. Heribert Zingel, ehem. Direktor der Frankfurter Sozialschule im Bistum Limburg Eric Wrasse, Pädagogischer Leiter, für die Stiftung »Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar« Steve Eichler, Bildungsreferent für Europapolitische Bildung, Stiftung »Europäische Jugendbildungs- und Jugendbegegnungsstätte Weimar«
Stephan Schwieren, Bildungsreferent beim Landesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement Bayern e.V. Martin Becher, Geschäftsführer des Bayerischen Bündnisses für Toleranz - Demokratie und Menschenwürde schützen und Leiter der Projektstelle gegen Rechtsextremismus im Evangelischen Bildungs- und Tagungszentrum Bad Alexandersbad Andreas Michelbrink, Berlin, Geschäftsführer, ver.di GPB gGmbH Ute Rawert, Geschäftsführerin, Verein zur Förderung politischen Handelns e.V. (v.f.h.), Bonn Dr. Holger Oppenhäuser, Bildungsreferent Attac Bundesbüro, Frankfurt Ramona Kemper, Referentin für politische Bildung, Fridtjof-Nansen-Akademie für politische Bildung Hartmut Boger, Vorsitzender, Förderverein Akademie für Ältere/Vorstand vhs Wiesbaden Dr. Sebastian Scharte, Pädagogischer Leiter, Willi-Eichler-Bildungswerk, Köln Georg Roessler M.A, Gründer und ehrenamtlicher Co-Direktor von SOS-Gewalt/Zentrum für Friedenspädagogik in Israel e.v. Elisabeth Keil, Bildungsreferentin, St. Jakobshaus, Akademie der Diözese Hildesheim Dr. Theresa Beilschmidt, Goslar Dr. Anke Hoffstadt, Bildungsreferentin, Bildungswerk der Humanistischen Union NRW, Essen Dr. Heidi Behrens, Bildungswerk der Humanistischen Union NRW, Essen Dr. Paul Ciupke, vormals Bildungsreferent, Bildungswerk der Humanistischen Union NRW, Essen Edgar Weick, Frankfurt a.M. Christiane Toyka-Seid, freiberufl. Mitarbeiterin in der politischen Bildung, Leitung von Projekten der politischen Bildung Susanne Hilf, Geschäftsführung, Landesvereinigung Kulturelle Bildung Hessen e.V. Sebastian Nowak, Dipl. Politologe, Internationaler Bund Südwest gGmbH (IB), Jugendbildung Hessen Philipp Funke, Projektleiter „FIT in der Diakonie Hessen. Für Integration und Teilhabe!“ Dr. Rainer Behrendt, vormals Bildungsreferent Lisa Sophie Sebold, Islamwissenschaftlerin und politische Bildnerin Eva Ettingshausen, Politikwissenschaftlerin und politische Bildnerin Gerhart Schöll, Rentner, bis 2008 päd. Mitarbeiter des LWL-Bildungszentrums Jugendhof Vlotho, bis 2017 Vorsitzender des Arbeitskreises Entwicklungspolitik e.V. Ingeborg Pistohl, Rentnerin, vormals Redakteurin der Fachzeitschrift „Außerschulische Bildung“, Arbeitskreis deutscher Bildungsstätten e.V. (AdB) Rainer Ratmann, vormals Mitarbeiter für politische Bildung, der Frankfurter Sozialschule im Bistum Limburg Barbara Mühlfeld, Pressesprecherin Landesverband Hessen des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte
Sie können auch lesen