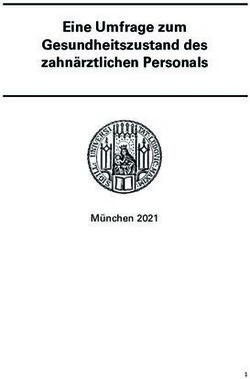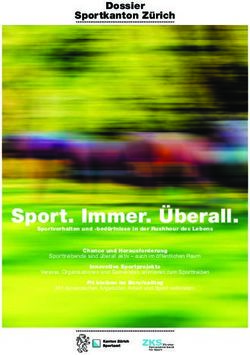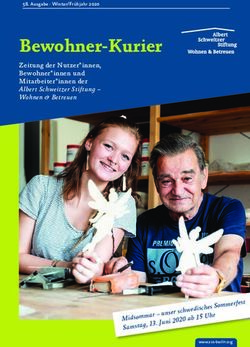Pflege aus Sicht der pflegenden Angehörigen (Laienpflege)
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Pflege aus Sicht der pflegenden
Angehörigen (Laienpflege)
Empirische Untersuchung bezüglich Belastungen
pflegender Angehörigen und deren
Entlastungsmöglichkeiten
Fachbereichsarbeit
Zur Erlangung des Diploms
in der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege
an der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Kufstein
vorgelegt von
Christoph Gensluckner
Johannes Holzer
Betreuer:
Stefan Thaler, Lehrer für GuKP
Kufstein, Juli 2005Inhaltsverzeichnis Seite Vorwort.................................................................................................................... 1 1. Einleitung……………………………………………………………………............... 3 2. Gesellschaftliche Veränderungen..............................…………………................. 5 2.1. Altersentwicklung in Österreich…….........…………………....…….................... 5 2.2. Demographische Entwicklung der Altersstruktur Tirols.....…..........…....…....... 5 2.3. Pflegebedürftigkeit in Österreich....................................................................... 6 3. Definitionen…………………………….................................................................. 7 3.1. Pflegende Angehörige (Laienpflege)……..........……………………….............. 7 3.2. Pflegebedürftige Person.......................….………..……………………….......... 7 4. Motivation zur Pflege...........……………………………..............…............……... 8 4.1. Christliche Nächstenliebe und Mitleid............................................................... 9 4.2. Wiedergutmachung........................................................................................... 9 4.3. Abhängigkeit und Akzeptanz………...........…………………………................... 9 4.4. Finanzielle Motive............................................................................................. 9 5. Definition von Belastung....................………….................................................. 10 5.1. Belastungen pflegender Angehöriger.............................................................. 10 5.2. Körperliche Belastungen................................................................................. 11 5.3. Psychische Belastungen................................................................................. 12 5.4. Zeitliche Belastungen...................................................................................... 12 5.5. Finanzielle Belastungen.................................................................................. 13 5.6. Sonstige Belastung......................................................................................... 14 6. Entlastungsmöglichkeiten.................................................................................. 15 6.1. Hauskrankenpflege......................................................................................... 15 6.2. Schulungen für pflegende Angehörige........................................................... 16 6.3. Selbsthilfegruppe/ Gesprächskreise............................................................... 16 6.4. Finanzielle Gebarung- Pflegegeldleistungen.................................................. 17 6.5. Versicherungsmöglichkeiten........................................................................... 19 6.6. Essen auf Räder............................................................................................. 20 6.7. Lebens- und Wohnsituation............................................................................ 21 6.8. Betreutes Wohnen.......................................................................................... 23
6.9. Kurzzeitpflegeplätze........................................................................................ 24
6.10. Heilbehelfe und Hilfsmittel............................................................................. 24
6.11. Hausnotruf.................................................................................................... 25
6.12. Überleitungspflege (= Übergangspflege)...................................................... 26
6.13. Entlassungsziel/ Entlassungsbericht/ Entlassungsgespräch........................ 27
7. Empirische Erhebung/ Fragebogen................................................................... 31
7.1. Forschungsmethode....................................................................................... 31
7.2. Ergebnisse und Darstellung der Erhebung..................................................... 32
8. Schluss.............................................................................................................. 43
9. Zusammenfassung............................................................................................. 47
10. Literaturverzeichnis.......................................................................................... 48
11. Anhang............................................................................................................. 51
FragebogenVorwort
In dieser Fachbereichsarbeit greifen wir die Thematik der Pflege zu Hause, die
Angehörige leisten, auf (Laienpflege). Wir sind der Meinung, dass Laienpflege mit
all ihren Belastungen in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen bzw. oft sogar als
Selbstverständlichkeit hingenommen wird. Dabei wird oftmals auf die Sorgen und
Nöte der Angehörigen nur unzureichend eingegangen. Die Motivation, dieses
Thema zu wählen, ergab sich, da wir vor der Gesundheits- und Krankenpflege-
ausbildung Pflege bei einem Angehörigen leisten mussten. In konkreter Erinne-
rung bleibt mir (Christoph Gensluckner) stets, als mein Vater, 57-jährig, im Juli
1993 durch eine zu spät diagnostizierte Sinusthrombose (Hirnvenenthrombose)
zum Vollpflegefall wurde. Nach einem halben Jahr stationären Aufenthaltes in den
diversen Abteilungen der Klinik Innsbruck wurde er ins BKH St. Johann i. T. über-
wiesen. Dort wurde er soweit wieder rehabilitiert, dass er feste Nahrung aufneh-
men konnte, das Sprechen wieder erlernte und frühere Erinnerungen aus dem
Langzeitgedächtnis wieder abrufbar waren, danach wurde er als „austherapiert“
aus dem Krankenhaus entlassen. Nun folgte auf Anraten des medizinischen
Teams die Einweisung ins Pflegeheim, in dem er dann zwei Monate verbrachte;
welches aber zur damaligen Zeit für dieses schwere Krankheitsbild nicht adaptiert
war. Mehrere Gründe, zum Teil auch die hohe finanzielle Belastung, veranlassten
uns, unseren Vater in häusliche Pflege zu nehmen, von der wir keine genauen
Vorstellungen hatten. Dabei erlangte das Sprichwort „Man wächst mit der Heraus-
forderung“ eine ganz bestimmte Bedeutung. Wir konnten durch die Hilfe aller Be-
teiligten (meiner Geschwister, aller Verwandten, Freunde, Therapeuten, Mitarbei-
ter des Sozialsprengels und des Roten Kreuzes, des Pflegepersonals, der Ärzte
und insbesondere durch den unermüdlichen Einsatz unserer Mutter) die anste-
henden Pflegemaßnahmen bewältigen. Seine Enkelkinder, die ohne große Vorbe-
halte auf ihn als Opa zugingen, waren wohl die beste Therapie für ihn. Trotz der
großen Belastungen, die sich ergaben, konnten wir mit unserem Vater noch recht
gute Erfolge und schöne Momente erleben. Mein Vater verstarb nach acht Jahren
Pflege zu Hause in seiner gewohnten Umgebung, im September 2001. Dieser
lange Pflegeprozess war für mich mit großen Entbehrungen verbunden, aber ich
möchte diese Erfahrung nicht missen.
-1-Wir bedanken uns herzlich bei all jenen, die uns bei der Erstellung der Fachbe-
reichsarbeit unterstützt haben, besonders bei unserem Betreuer Hr. Stefan Thaler.
Dank gebührt auch dem Bundessozialamt Landesstelle Tirol und dem Amt der
Tiroler Landesregierung (Referat Pflegegeld), sowie der Landessanitätsdirektion,
die uns vielfältiges Datenmaterial zur Verfügung gestellt haben. Die Gesundheits-
und Sozialsprengel Nußdorf-Debant/ Umgebung und Virgental mit ihren Mitarbei-
tern (besonders Günther Ebner und Magda Bacher) haben durch ihren persönli-
chen Einsatz ebenso zum Gelingen dieser Arbeit beigetragen.
-2-1. Einleitung
Mit der Zunahme der Anzahl hilfs- und pflegebedürftiger Menschen in unserer Ge-
sellschaft steigt auch die Anzahl der pflegenden Angehörigen, die häusliche Pfle-
ge leisten. Pflegende Angehörige, Freunde, Nachbarn leisten aus moralischer,
emotioneller, loyaler sowie solidarischer Bindung oder Verpflichtung einen un-
schätzbaren Dienst für unsere Gesellschaft. Die Familie ist der größte Pflege-
dienst im Staat. Dieses Netzwerk ist unverzichtbar und ist das tragende Funda-
ment des Sozial- und Gesundheitssystems, wie wir es kennen. Die tatsächliche
geleistete Betreuungs- und Pflegearbeit in den Familien ist beeindruckend und auf
keinen Fall als selbstverständlich anzusehen, da der Umfang an pflegerischen und
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten von professionellen Pflegediensten, niemals er-
bracht werden könnte. Eine vermehrte Unterbringung pflegebedürftiger Personen
in staatlichen Einrichtungen würde außerdem eine enorme Mehrbelastung für die
Staatskasse darstellen. Und ohne das Engagement von Angehörigen könnten au-
ßerdem insbesondere Schwerpflegebedürftige oftmals nicht in ihren eigenen vier
Wänden bleiben. Täglich werden mehrere hunderte zumeist ältere Männer und
Frauen neu pflegebedürftig. Das sind Schicksale, wo plötzlich Menschen auf die
Hilfe anderer angewiesen sind. Das Los „Pflegebedürftigkeit“ trifft immer auch die
Angehörigen: Ehe- oder Lebenspartner, Kinder und Schwiegerkinder und immer
wieder trifft es sie überraschend. Der Gedanke an eine drohende Pflegebedürftig-
keit eines nahen Angehörigen wird trotz warnender Vorboten noch immer weitge-
hend verdrängt. Dabei sorgen wir doch sonst für alles vor: Wir planen unser Le-
ben, unsere Familie, unseren Erfolg, unser Rentnerdasein, ja sogar für den Fall
unseres unerwarteten Ablebens sichern wir uns und unsere Angehörigen mit Le-
bensversicherungen ab. Doch auf die eventuell eintretende Pflegebedürftigkeit
eines nahen Angehörigen sind wir in der Regel nicht vorbereitet. In vielen Fällen
sind die Zeichen offensichtlich: Mutter vergisst auf die eingeschaltete Herdplatte,
Vater stürzt zum wiederholten Male schwer, ältere Verwandte zeigen alle mögli-
chen Gebrechen. Gebrechlichkeit ist nämlich die Vorstufe zur Pflegebedürftigkeit.
Auch ein permanent hoher Blutdruck, chronischer Diabetes (Zuckerkrankheit) oder
ein diagnostizierter Morbus Parkinson, ein plötzlicher Schlaganfall oder Unfall,
usw. ... erhöhen signifikant das Risiko der Pflegebedürftigkeit. Es ist uns ein Anlie-
-3-gen die Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren, und für den Ernstfall Vor-
sorge zu treffen, sei es rechtlich durch Vorsorgevollmachten und andere Verfü-
gungen, finanzielle Absicherung durch Versicherungen, sozial durch ein intaktes
und aktives soziales Umfeld. Sie sollten sich auch rechtzeitig umsehen, welcher
Pflegedienst sie im Pflegefall umsorgen soll, wem sie sich anvertrauen wollen -
gegebenenfalls Tag und Nacht, dass man trotz eventuell einsetzender Pflegebe-
dürftigkeit in der gewohnten häuslichen Umgebung weiter wohnen kann. Angehö-
rige sind einer Vielzahl von Belastungen ausgesetzt. Diese können sie oft zu Be-
ginn der Pflege nicht richtig abschätzen. Als Folge ergibt sich, Vernachlässigung
der eigenen Bedürfnisse, Überforderungssyndrom bis hin zum Burnout (englisch:
burn out = ausbrennen). Um diese Situationen zu verstehen bzw. damit umgehen
zu können, möchten wir in dieser Fachbereichsarbeit hinweisen auf die demogra-
phische Entwicklung, die Motivation zur Pflege von Angehörigen, die Belastungen,
die Entlastungsmöglichkeiten aufzeigen und darstellen, warum es so wichtig ist,
die Kommunikation mit allen Beteiligten im Pflegeprozess aufrecht zu halten und
zu fördern.
-4-2. Gesellschaftliche Veränderungen
Durch den medizinisch-technischen Fortschritt erreichen immer mehr Personen
ein höheres Alter. Für den Einzelnen ist dies sicher eine große Chance auf ein
längeres Leben. Leider steigt auch mit dem höheren Alter zumeist der Betreu-
ungsbedarf. Jene sozialen Netze, die bisher den Hauptanteil der Pflegeleistungen
übernommen haben, sind grundlegenden Veränderungen unterworfen. Bis heute
sind es überwiegend die Frauen, die die Hauptlast der notwendigen Betreuungs-
arbeiten für die Pflege zu Hause tragen. Mit der zunehmenden Erwerbstätigkeit
der Frauen sinkt jedoch die Zahl derer, die der Gesellschaft durch die Pflege ihrer
Nächsten einen unschätzbaren Dienst erweisen. Auch die Veränderungen in den
Familien- und Haushaltsstrukturen dürfen nicht unerwähnt bleiben. Derzeit ist ein
vermehrter Trend zu Single-Haushalten festzustellen. Der Geburtenrückgang wirkt
sich ebenso aus wie auch die steigende Scheidungsrate. Die Gesellschaft ist
durch diese Umstände mehr als je zuvor gefordert Antworten auf diese Umbrüche
zu geben. Wie sich die Bevölkerung in Hinblick auf ihre Altersstruktur verändern
wird, erläutern wir in den nächsten Ausführungen.
2.1. Altersentwicklung in Österreich
„Die Zahl der über 65-Jährigen wird in Österreich in den nächsten 25 Jahren um
fast ein Drittel steigen, die der über 85-Jährigen sich fast verdoppeln. Diese Ent-
wicklung wird in den einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich verlaufen.
Während in Wien bis zum Jahr 2020 mit einem demographisch bedingten Rück-
gang der Zahl der pflegebedürftigen Menschen um mehr als 10 % gerechnet wer-
den kann, wird deren Zahl in Salzburg und Tirol um etwa 70 % und in Vorarlberg
um 100 % ansteigen“ (Rubisch & et al., 2004, S. 6).
2.2. Demographische Entwicklung der Altersstruktur Tirols
„Die Tiroler Bevölkerung wird insgesamt in den nächsten 20 Jahren geringfügig
wachsen (siehe Tabelle 1), und zwar bis 2021 um +4,44 % (laut Spitalsky um
+4,58 %, STATA um +6,98 %, ÖAW/ÖROK +6,48 %). Diese Entwicklung differiert
-5-kaum zwischen den Bezirken. Der Anteil der Personen, die 75 oder älter sind, wird
in Tirol bis 2021 durchschnittlich von 40.775 auf 64.721 Personen (+58,73%) zu-
nehmen. Die stärksten Anstiege werden für die Bezirke wie folgt erwartet: Inns-
bruck-Land (+90,34 %), Imst (+63,29 %), Kufstein (+62,30 %). Der Anteil an hoch-
betagten Personen (über 85-Jährige) wird in Tirol durchschnittlich von 10.361 auf
16.267 Personen (+57,00 %) zunehmen. Die stärksten Anstiege werden für die
Bezirke Imst (+92,53 %), Innsbruck-Land (+84,31 %), Landeck (+82,06 %) erwar-
tet“ (Mallaun& et al, 2003, S. 8).
Bevölkerungsentwicklung in Tirol 2001 – 2021
Tirol Steigerung in %
2001 2006 2011 2016 2021 2001/2021
0-59 548.400 542.891 534.148 529.319 518.320 -5,49
60-64 34.910 35.346 39.227 39.447 48.220 38,13
65-69 25.567 32.788 33.311 37.132 37.453 46,49
70-74 23.852 23.434 30.351 30.943 34.717 45,55
75-79 19.619 20.458 20.285 26.756 27.355 39,43
80-84 10.795 14.863 15.584 15.678 21.099 95,45
85+ 10.361 10.345 13.129 15.311 16.267 57,00
Gesamt 673.504 680.125 686.037 694.585 703.430 4,44
Abb. 1, Sozialbericht Land Tirol, 2003, S. 8
2.3. Pflegebedürftigkeit in Österreich
Derzeit leben in Österreich ca. 540.000 Personen (ca. 4 % der Gesamtbevölke-
rung), die hilfs- und pflegebedürftig sind. Somit ist derzeit jede 4. Familie in Öster-
reich (statistisch gesehen) mit der Problematik von Hilfs- oder Pflegebedürftigkeit
befasst. Die Anzahl der zu betreuenden Personen wird sich bis zum Jahr 2011
ebenso drastisch erhöhen, auf geschätzte 800.000! Davon werden derzeit etwa
17% stationär oder mit Hilfe von ambulanten Dienste (13%) betreut. 70% werden
ausschließlich von Angehörigen zu Hause betreut bzw. gepflegt, dabei überneh-
men zu 80% die Frauen die Rolle der Hauptpflegeperson, diese weiblichen Pfle-
genden sind meist zwischen 50 -70 Jahre alt. Sie pflegen häufig über 5 -10 Jahre
hindurch Eltern, Schwiegereltern, Partner und betreuen häufig auch gleichzeitig
-6-ihre Enkelkinder. Der tägliche Betreuungsaufwand beträgt durchschnittlich 6 Stun-
den, nicht selten sind 24 Stunden Anwesenheit erforderlich (Land Tirol). Um abzu-
klären, was man unter einem „pflegenden Angehörigen“ und einer „pflegebedürfti-
gen Person“ versteht, werden diese zwei wesentlichen Begriffe nachstehend er-
klärt.
3. Definitionen
3.1. Pflegende Angehörige (Laienpflege)
Wie Geister (2004) anführte, gibt es neben dem anerkannten öffentlichen Sozial-
und Gesundheitssystem, dem formellen, professionellen, noch ein verborgenes
informelles Hilfesystem (Lebenspartner, Verwandte, Freunde und Nachbarn), das
auf Emotionen, Bindungen, Loyalität, Solidarität und moralischer Verpflichtung
basiert. Damit sind also jene Personen gemeint, die nicht erwerbsmäßig einen
Pflegebedürftigen in seiner häuslichen Umgebung pflegen Die Unterstützung
durch die oben erwähnten Personen setzt nicht erst dann ein, wenn notwendiger
Handlungsbedarf besteht, sondern oft bereits erleichternd oder unterstützend auf
Grund eines Zuwendungsbedürfnisses der Gebenden oder auf Grund eines direkt
oder indirekt geäußerten Wunsches des Nehmenden.
3.2. Pflegebedürftige Person
Das Verständnis von Pflegebedürftigkeit orientiert sich dabei an der Definition des
Pflegegeldgesetzes. „Pflegebedürftig im Sinne des SGB XI sind Personen, die
wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung
für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf
des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in
erheblichen oder höheren Maße (§15) der Hilfe bedürfen (§14 Abs. 1 SGB XI). Als
pflegebedürftig im Sinne des Gesetzes gilt also, wer einen mehrfach wöchentli-
chen Bedarf an Unterstützung bei der Ausführung körperbezogener alltäglicher
Verrichtung hat. Hilfe- und Pflegeleistungen zielen demnach auf die Kompensation
-7-von Funktionsdefiziten in den Bereichen Mobilität, Ernährung, Körperpflege, Aus-
scheidung und Hauswirtschaft ab. Der Pflegebedürftige wird nicht auf seine
Krankheit reduziert, sondern als Mensch mit funktionalen Einschränkungen be-
trachtet“ (Geister, 2004, S.15-16). Welche Beweggründe veranlassen nun Ange-
hörige, Pflegetätigkeiten zu übernehmen?
4. Motivation zur Pflege
„Günstig ist, wenn sich die Hauptpflegeperson ihrer Motivation zur Pflegeüber-
nahme bewusst ist. Oft spielen dabei mehrere Faktoren eine Rolle (Zuneigung,
Dankbarkeit, Mitleid, Verpflichtung, Schuldgefühl und Selbstbestätigung). Auch die
Einstellung der übrigen Familienmitglieder zur Familienpflege soll berücksichtigt
werden“ (Fleissner, 2005).
„Außerdem erfahren pflegende Angehörige vielfach durch die Einbeziehung in die
Pflege eines Familienmitgliedes ihre eigene Bedeutsamkeit. Pflegen bedeutet für
sie nicht nur Unterstützung, sondern stellt ein bedeutsames Handeln im Kontext
der Lebens- und Familiengeschichte dar“ (Geister, 2004, S. 16).
Für einen Großteil der Betreuungspersonen ist das Verwandtschaftsverhältnis zur
betreuten Person ein Grund für die Übernahme der Betreuung. Durch diese Ver-
bundenheit ist quasi eine Erwartungshaltung seitens der Gesellschaft gegeben.
Was auch ein starkes Motiv zur Übernahme der Pflege sein kann, ist die Liebe
und Zuneigung zur betreuten Person. Andere Pflegende sehen ihre Motivation zur
häuslichen Pflege aus einem moralischen Hintergrund heraus. Häufig sind sie in
der Vergangenheit von dem zu Pflegenden versorgt worden und fühlen sich nun
verpflichtet, etwas von dieser selbst erlebten Umsorgung zurückzugeben. Beson-
ders im ländlichen Raum wird die Pflege aus Angst vor dem Gerede der Nachbarn
übernommen, so wird der Druck, es schaffen zu müssen, bei zusätzlich auftau-
chenden Problemen immer größer. Auch aus dem Versprechen heraus, den Le-
benspartner oder die Eltern nicht im Stich zu lassen, erfolgt häufig die Übernahme
-8-der Pflege.
4.1. Christliche Nächstenliebe und Mitleid
Sie ist verbunden mit der caritativen Einstellung: „Ich habe immer versucht, allen
zu helfen, und bezieht sich weniger auf das konkrete Verhältnis zum Gepflegten
selbst als auf eine allgemeine Handlung Menschen gegenüber, insbesondere Fa-
milienangehörigen, die Hilfe brauchen“ (Hedtke-Becker, 1999, S. 26).
4.2. Wiedergutmachung
„Die Wiedergutmachung beruht auf einer ganz konkreten Erfahrung und Bezie-
hung zum Gepflegten. Sie kann sich auch auf die nähere Vergangenheit beziehen
und ohne Schuldgefühle als Dankbarkeit wahrgenommen werden. Allerdings wird
von den Angehörigen der Umfang der übernommenen Pflege auch an dem ge-
messen, was ihnen früher gegeben wurde“ (Hedtke- Becker, 1999, S. 26).
4.3. Abhängigkeit und Akzeptanz
„Oft resultiert die Pflegebereitschaft aus ungelösten kindlichen Abhängigkeitsbe-
dürfnissen oder aus dem Bestreben, wenigstens im Alter einmal von den Eltern
akzeptiert zu werden“ (Geister, 2004, S. 20).
4.4. Finanzielle Motive
„Auch finanzielle Motive haben, besonders auf dem Land, eine große Bedeutung.
Der Hof, der auf der Basis von Verträgen übergeben wurde, in denen die Auflage
besteht „zu erhalten in gesunden und in kranken Tagen“, ein Haus, das die Groß-
eltern mit der jungen Familie finanziert haben mit der Verpflichtung, im Pflegefall
für sie zu sorgen. In solchen Fällen ist es für Angehörige fast unmöglich, die Pfle-
ge nicht selbst zu leisten. Geschwister fühlen sich, auch wenn sie das bessere
Verhältnis hatten, nur selten mitverantwortlich, da das Finanzielle stark normie-
rend zu wirken scheint“ (Hedtke- Becker, 1999, S. 27).
Der Motivation einerseits stehen jedoch die Belastungen andererseits gegenüber.
-9-In den nun folgenden Kapiteln sollen die Belastungen, denen Pflegende ausge-
setzt sind, aufgezeigt werden.
5. Definition von Belastung
Belastungen, die auch in Abb. 2 angeführt sind, stehen in engem Zusammenhang
mit Beanspruchung. Es geht um Ansprüche, die jemand einem anderen gegen-
über hat. In der Physik bedeutet Belastung, dass auf einen Körper Kräfte einwir-
ken, die mit Druck, Biegung, Drehung, Zug und Verdrehung zu tun haben. Ein
Bild, das auf Pflegesituationen übertragbar ist. Belastungen können zu Wandlun-
gen und Wachstum führen ebenso wie zu völliger Zerstörung. Kurz gesagt, Belas-
tungen verändern. Jede Lebenssituation mit einer Dauerpflege hat ihre eigenen
Schwierigkeiten und Problemstellungen. „Die Schwelle der Belastbarkeit und die
Fähigkeit, mit Belastungen umzugehen, sind bei den pflegenden Angehörigen un-
terschiedlich und hängen zum Teil mit der eigenen Biographie, dem sozialem Um-
feld, den Entlastungsmöglichkeiten, der Beziehung zum Pflegeempfänger und den
entwickelten Bewältigungsstrategien zusammen. Die Belastungen sind in der Re-
gel keine einmaligen Ereignisse, sondern stellen einen sich ständig verändernden
Prozess dar“ (Geister, 2004, S. 26-27).
5.1. Belastungen pflegender Angehöriger
Vielen Menschen ist wohl aus persönlicher Erfahrung bekannt, welch enorme phy-
sische, psychische und finanzielle Belastung die Pflege und Betreuung hilfsbedürf-
tiger Menschen mit sich bringt. Niemand kann dies so gut verstehen, wie die Men-
schen, die in einer ähnlichen Situation sind oder waren. Diese Menschen wissen,
wie schwierig es sein kann, jemanden zu pflegen, leiden zu sehen und nicht helfen
zu können. Pflegende Angehörige müssen diese Belastungen oftmals Tag und
Nacht über Monate, Jahre, manchmal sogar über Jahrzehnte aushalten. Gesund-
heitliche Schäden sind vorprogrammiert. Viele der Angehörigen stehen nicht sel-
ten dieser Aufgabe, die von heute auf morgen auf sie zukommt, unsicher und
ängstlich gegenüber. Die Veränderung bisheriger Lebensgewohnheiten, das „Ein-
- 10 -gespannt“ sein, erfordern viel Kraft. Oft fühlen sie sich mit dieser Aufgabe alleinge-
lassen (Nehmeth, Pochobradsky, 2002).
Belastungen der privaten Hauptpflegepersonen durch die Pflege:
Keine Belastungen 435
Belastungen
Sonstige
Andere Belastungen 28
Finanzielle Belastung 154
Zeitliche Belastungen 155
Keine Belastungen 175
212
Psychische Belastungen
Sonstige Belastungen
Famliäre Probleme 37
Überforderung 245
Aussichtslosigkeit 79
Verantwortung 393
Isolation 126
Keine Belastungen 258
Körperliche
Belstungen
Sonstige Belastungen 197
Kreuzschmerzen 411
Schulterbeschwerden 174
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Abb. 2, Qualität in der Pflege, 2002, S. 22
5.2. Körperliche Belastungen
Durch die pflegerischen Maßnahmen und Tätigkeiten, die verrichtet werden, treten
häufig Kreuzschmerzen bei den Betreuungspersonen auf. Besonders wenn immo-
bile Menschen öfters gehoben, getragen, gestützt oder umgelagert werden müs-
sen. Selten ist nur der Rücken alleine betroffen, auch Verspannungen im Schul-
terbereich, Magenschmerzen, Herz-Kreislaufprobleme, allgemeines Unwohlsein
bis hin zur körperlichen Erschöpfung können auftreten. Zusätzlich zu den Belas-
tungen des Körpers kommen noch die zum Teil starken psychischen Belastungen
hinzu (Nehmeth, Pochobradsky, 2002).
5.3. Psychische Belastungen
- 11 -Große Schwierigkeiten ergeben sich insbesondere dann, wenn die zu betreuende
Person ständig unterwegs ist, gesucht und wieder heimgeholt werden muss oder
wenn sie aggressiv ist, ständig um sich schlägt oder gar gewalttätig wird. Ebenso
schwierig erscheint es, wenn der zu Pflegende im Gegenzug in sich gekehrt ist
und durch nichts und niemand motiviert werden kann. Auch wenn jemand den
ganzen Tag schreit, ohne dass man weiß, warum und ohne dass man ihn irgend-
wie beruhigen kann, wird die pflegende Person an ihre seelischen Belastungs-
grenzen stoßen. Ebenso anstrengend ist, wenn jemand ständig laut und falsch
singt oder irgendwelche Geschichten zum hundertsten Male erzählt oder, wenn
sich der Pflegling immer wieder von oben bis unten mit Kot beschmiert und überall
hinspuckt. Wie psychisch belastend dies auf Dauer sein kann, ist leicht nachvoll-
ziehbar nach diesen Ausführungen. Der Pflegeaufwand im Fall „geistiger Verwirrt-
heit“ ist enorm und für Außenstehende kaum nachvollziehbar. Der hohe Betreu-
ungsaufwand im Fall behinderter Kinder ist häufig mit Hoffnungslosigkeit hinsicht-
lich der zukünftigen Entwicklung des Kindes gepaart. Ebenso besteht die Gefahr
der sozialen Ausgrenzung der ganzen Familie. Klagen des erkrankten Menschen
über seine Krankheit sowie über Schmerzzustände stellen für viele Angehörige
eine weitere Belastung dar. Die Verantwortung für den Pflegenden ist eine Her-
ausforderung. Die Pflegenden haben Sorge etwas falsch zu machen und befürch-
ten, dem Pflegebedürftigen eventuell sogar zusätzlich Schmerzen und Schaden
zuzufügen. Aussichtslosigkeit im Hinblick auf die Erkrankung des zu Pflegenden
und auf die Unabsehbarkeit der zeitlichen Inanspruchnahme durch den Hilfsbe-
dürftigen scheint die Situation noch zu erschweren. Länger andauernde Schlafstö-
rungen und gestörte Nachtruhe sind genauso belastend für den eigenen Organis-
mus (Nehmeth, Pochobradsky, 2002).
5.4. Zeitliche Belastung
Das Pflegen eines pflegebedürftigen Angehörigen bringt sehr große zeitliche Be-
lastungen mit sich. Verschärft kann diese Situation werden, wenn die Notwendig-
keit der ständigen Anwesenheit beim Pflegling gegeben ist. Insbesondere wenn
sie dazu führt, dass jahrelang kein Urlaub oder gar kein Ausflug gemacht werden
kann, oder dass bereits kleine Besorgungen wie Einkaufen oder ein Friseurbesuch
- 12 -zum Problem werden. Auch wenn keine 24-Stunden-Pflege von Nöten ist, so ü-
bernehmen Angehörige doch gewisse kleinere Hilfs- und Pflegehandlungen, wie
die ganz alltäglichen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten, die in einem Haushalt anfal-
len, die Erledigung von Behördenwegen, das Einkaufen, Instandhaltung des Gar-
tens usw. Durch dieses ständige Angebundensein der Pflegenden werden Kontak-
te außerhalb der Wohnung zunehmend seltener. Eigene Hobbys oder Interessen,
der Besuch von Kursen oder die aktive Teilnahme am Vereinsleben bleiben auf
der Strecke. Aus Zeitmangel können sich Pflegende kaum mehr mit Freunden o-
der Bekannten treffen. Bei Erledigungen außerhalb der Wohnung ist meist große
Eile geboten, denn zu groß ist Angst, dass während ihrer Abwesenheit der Pflege-
bedürftige derweilen weglaufen, sich verirren, stürzen, im Extremfall sogar einen
Brand verursachen könnte. Zwischenmenschliche Kontakte gehen durch diesen
hohen Grad der Anwesenheit stark verloren und führen auf direktem Wege zur
Isolation. Keineswegs besteht diese Art der Vereinsamung nur einseitig, auch die
Zahl der Besucher im Haushalt des Pfleglings nimmt ab. Krankheit und Gebrech-
lichkeit sind gesellschaftlich tabuisiert. Viele Besucher wissen nicht damit umzu-
gehen und gehen deshalb auf Distanz. (Nehmeth, Pochobradsky, 2002).
5.5. Finanzielle Belastungen
Um Einkommen und damit auch später Anspruch für eine eigene Pension zu er-
werben, ist in unserem Wirtschaftssystem immer noch die Teilnahme am Arbeits-
markt erforderlich. Wenn Pflegende ihre Erwerbstätigkeit zugunsten der Pflege
einschränken oder ganz aufgeben, müssen sie mit Einkommenseinbußen bis hin
zum völligen Einkommensverlust rechnen. Sie können dann weniger oder gar kei-
ne eigenen Versorgungsansprüche aufbauen, weil die Pflegezeiten derzeit noch
nicht als pensionsbegründend gewertet werden. Dadurch verfügen Pflegende oft
nur über wenig oder gar kein eigenes Geld und sind in ihrer Existenzsicherung
teilweise oder gänzlich von anderen Personen oder vom Staat abhängig. Um eine
adäquate Pflege daheim erst zu gewährleisten, bedarf es zuweilen größerer Um-
oder Zubauten in den eigenen vier Wänden. Die Wohnung muss gegebenenfalls
rollstuhltauglich ausgestattet und eventuell ein Lift eingebaut werden. Weitere
Ausgaben ergeben sich durch die Anschaffung von Pflegehilfsmitteln und Heilbe-
helfen. Manchmal sind es auch verstärkte Sicherheitsvorkehrungen (Spezial-
- 13 -schlösser und -griffe, Installation eines Rauchmelders, ect.), die sich finanziell zu
Buche schlagen. Mehraufwand kann entstehen durch notwendige Kostformen
(Sondennahrung, Diätkost,...), passende Kleidung, Inkontinenzhosen oder ande-
res Inkontinenzmaterial. Vor allem aber die professionelle Unterstützung bei der
Pflege kostet viel Geld. Auch als wesentlich zu betrachten sind die nur mehr ein-
geschränkten Möglichkeiten, die sich für die eigene Berufsentwicklung und per-
sönliche Entfaltung ergeben.
5.6. Sonstige Belastungen
Eine besondere Belastung für Angehörige sind spontane Krankenhausentlassun-
gen, wie sie häufig oder vielfach täglich im Alltag passieren, wo Angehörige inner-
halb kürzester Zeit dafür Sorge tragen müssen, Räumlichkeiten zu adaptieren,
Pflegematerial bereit zu stellen, Botengänge zu absolvieren (Behörden, Apotheke,
Einkäufe für das tägliche Leben,...), Verbandwechsel vorzunehmen, neue Kost-
formen (Sondennahrung, Diätkost,...), Therapien, Arztbesuche zu koordinieren,
geeignete Betreuungspersonen zu finden, etc. Dabei müssen die Pflegenden auf
ihre eigenen Pläne völlig verzichten. Oft bekommen sie noch schnell eine kurze
Einschulung für Geräte wie Inhalator, Pflegebetten, Medikamentenapplikation, de-
ren Handhabung sie zu Hause überfordert. Die Tragweite der übernommen Ver-
antwortung, wird den meisten erst zu Hause bewusst. Um einer Überforderung
vorzubeugen, sollte jeder pflegende Angehörige gut über die Entlastungsmöglich-
keiten informiert sein und auch in Anspruch nehmen.
- 14 -6. Entlastungsmöglichkeiten
Zu Beginn der Pflege möchten die Angehörigen alles alleine schaffen und nehmen
häufig keine Hilfe und Unterstützung von außen in Anspruch. Erst dann, wenn sich
erste Anzeichen einer Überbelastung abzeichnen, nehmen sie Hilfe von außen in
Anspruch. Soweit darf und soll es erst gar nicht kommen. Angehörige müssen ler-
nen sich selbst wertvoll zu sein, Wünsche und Bedürfnisse klar und ohne Scheu
zu äußern. Maximale Entlastung muss schon zu Beginn der Pflege einsetzen.
Nachstehend werden einige Möglichkeiten der Entlastung aufgezeigt.
6.1. Hauskrankenpflege
„Definition: Hauskrankenpflege ist die fachliche Pflege von Patienten in deren
Wohnbereich durch Pflegepersonen im Sinne des Bundesgesetzes. Die Pflege
umfasst Erkrankungen aller Art und Altersstufen. Sie beinhaltet auch die Anlei-
tung, Beratung und Begleitung von Angehörigen und anderen an der Betreuung
und Pflege beteiligter Personen (GuKG BGBL. I Nr. 108/ 1997)" (Fleissner, 2005).
Professionell Pflegende pflegen sich selbst und unterstützen die pflegenden An-
gehörigen in ihrer Selbstpflege. Sie erhalten und verbessern dadurch Gesundheit
und Pflegefähigkeit aller an der Pflege beteiligten. Sie motivieren, informieren, be-
raten und leiten pflegende Angehörige an, um ihre Pflegefähigkeit zu fördern und
sie zu entlasten. Sie berücksichtigen das soziale Umfeld des Klienten, sie erken-
nen Probleme, Ressourcen und reagieren rechtzeitig darauf. Weiters kooperieren
sie mit dem medizinischen System und den sozialen Diensten. Sie fördern Ange-
bote der Gesundheitsvorsorge sowie die Verbesserung der Pflegekapazität. Im
Sinne des Care Management ist die Hauskrankenpflegeperson zuständig für die
Etablierung klarer Grundvereinbarungen mit unterschiedlichen Kooperationspart-
nern (Ärzten, Bandagisten, Krankenhaus, Therapeuten, ect.), die die Zusammen-
arbeit gewährleisten und eine wichtige Voraussetzung für den reibungslosen Ab-
lauf darstellen. Das diplomierte Pflegepersonal hat ein Vorschlags- und Mitent-
scheidungsrecht für pflegerische Maßnahmen, das im GuKG (Gesundheits- und
Krankenpflegegesetz) §15 interdisziplinären Tätigkeitsbereich festgehalten ist.
Dazu gehört auch die Planung der Wohnraumanpassung, Hilfe bei der Antragstel-
- 15 -lung für Leistungen aus dem Pflegegeld (Fleissner, 2005).
6.2. Schulungen für pflegende Angehörige
„Manche Organisationen (wie z. B. das Rote Kreuz, Sozialsprengel,...) bieten regi-
onale Schulungskurse für Angehörige an. In diesen Kursen wird oft neben der
Schulung in pflegerischen Handlungen ein Schwerpunkt auf Prävention bzw. Pro-
phylaxe gelegt. Im Rahmen der Prävention und Prophylaxe wird Wissen vermittelt,
um beim pflegebedürftigen Menschen bereits vorhandene Beeinträchtigungen zu
verbessern bzw. um das Eintreten weiterer Beeinträchtigungen zu vermeiden. Im
Bereich der pflegenden Angehörigen werden Techniken für körperschonendes
Arbeiten, wie das Erlernen von rückenschonenden Hebe- und Tragetechniken, um
Rückenschmerzen, Hüftleiden und Bandscheibenschäden zu vermeiden, vermit-
telt. Diese Kurse haben neben der fachlichen Bedeutung auch einen zweiten wich-
tigen Aspekt. Auf diese Weise können sich pflegende Angehörige in ähnlichen
Situationen kennen lernen und so Gelegenheit zu einem Erfahrungsaustausch
bekommen. Dieser Erfahrungsaustausch ist wichtig bei der Bewältigung der priva-
ten Pflegesituation. Innerhalb dieser Schulungen lernen pflegende Angehörige
Heimhilfen und Pflegefachkräfte näher kennen und legen eventuelle Berührungs-
ängste ab. Diese Situation erleichtert es, Hilfe von Profis anzunehmen" (Biringer,
Grasser, 2004, S. 44).
6.3. Selbsthilfegruppe/ Gesprächskreise
Wie kann der Besuch einer Selbsthilfegruppe pflegenden Angehörigen helfen?
Mit dem Kürzel „A- E- I- O- U" lässt sich die Wirkungsweise der Selbsthilfegruppen
sehr gut beschreiben.
A- Auffangen
Gefühle von Angst, Unsicherheit und/oder Einsamkeit werden vermindert, wenn
man über eine schwierig gewordene Lebenssituation sprechen kann und dabei
ernst genommen und verstanden wird. In der Selbsthilfegruppe erhalten die Teil-
nehmer das Gefühl nicht allein zu sein
E- Ermutigen
Die Gruppenteilnehmer ermutigen einander, indem sie gemeinsam versuchen das
- 16 -Leben zu meistern und Lebensqualität und Lebensfreude zu erhalten bzw. zurück-
zugewinnen.
I- Information
Um mit einer krankmachenden Belastung leben zu können, ist es wichtig, diese
als solche zu erkennen und Informationen zur Vermeidung dieser zu erhalten. Da-
her werden immer wieder Experten zu diversen Themen zu diesen Treffen einge-
laden.
O- Orientierung
Gegenseitiger Erfahrungsaustausch gibt den Teilnehmern die Möglichkeit mit
Menschen zu sprechen, die in der gleichen oder in einer ähnlichen Situation sind.
Sie erleben, dass andere Menschen auch mit ähnlichen Problemen konfrontiert
sind und diese zum Teil schon bewältigt haben. Dieser Austausch gibt allen immer
neuen Mut und neue Kraft. Die regelmäßige Teilnahme an einer Selbsthilfegruppe
stärkt auch die Motivation notwendige Lebensveränderungen in Angriff zu nehmen
und vor allem durchzuhalten.
U- Unterhaltung
Teilnehmer haben auch die Möglichkeit sich außerhalb der Gruppentreffen zu ver-
abreden, z. B. zu einem Theaterbesuch oder auch zu gemeinsamer sportlicher
Betätigung.
In einer deutschen Studie wurde nachgewiesen, dass Teilnehmer einer Selbsthil-
fegruppe ihr Leben mit mehr Optimismus und höherer Lebensqualität meistern
(Kunz, 2005).
6.4. Finanzielle Gebarung- Pflegegeldleistungen
Österreich zahlt bereits seit 1993 ein einkommensunabhängiges Pflegegeld. Das
Bundespflegegeldgesetz (BPGG) in der Fassung des 1. Teiles des Bundesgeset-
zes BGBL. Nr. 110/1993 und unter Berücksichtigung der seither ergangenen No-
vellen und die korrespondierenden Landespflegegesetze sehen eine Kombination
von Geld- und Sachleistungen vor. Zweck des Pflegegeldes ist es, in Form eines
Beitrages pflegebedingte Mehraufwendungen pauschaliert abzugelten, um pflege-
bedürftigen Personen soweit wie möglich die notwendige Betreuung und Hilfe zu
sichern, sowie ihnen zu helfen möglichst lange in der gewohnten Umgebung zu
bleiben und ein selbstbestimmtes, bedürfnisorientiertes Leben zu führen. Das
- 17 -Pflegegeld wird gewährt, bei Vorliegen einer körperlichen, geistigen, psychischen
Behinderung oder Sinnesbehinderung (z. B.: hochgradige Sehbehinderung,...) und
der ständige Betreuungs- und Pflegeaufwand voraussichtlich mindestens sechs
Monate andauern wird sowie ein Pflegeaufwand von mehr als 50 Stunden monat-
lich gegeben ist. Weiters gilt als Grundsatz, dass die Pflegebedürftigen ihre
Betreuung und Hilfe frei wählen können. Das Pflegegeld gebührt jedem Pflegebe-
dürftigen unabhängig von der Ursache der Beeinträchtigung sowie unabhängig
vom Einkommen und Vermögen der/des Pflegebedürftigen. Auf die Gewährung
des Pflegegeldes besteht ein Rechtsanspruch! Das wiederum bedeutet, dass An-
sprüche einklagbar sind! Das Pflegegeld wird in sieben Pflegestufen eingeteilt und
wird bei erfüllten Voraussetzungen zwölfmal jährlich ausbezahlt. Die Einstufung
erfolgt im Bezug zum Pflegeaufwand und wird durch ein ärztliches Sachverständi-
gengutachten in Form von Hausbesuchen entschieden, dabei stehen dem Gutach-
ter in der Verordnung zu den einzelnen Betreuungs- und Hilfsverrichtungen zeitli-
che Anhaltspunkte zur Einschätzung zur Verfügung. Allerdings werden Mindest-
einstufungen für blinde und taubblinde Personen, sowie für Menschen, die über-
wiegend auf den Gebrauch eines Rollstuhls angewiesen sind, vorgesehen. Falls
erforderlich, werden zusätzlich zur ganzheitlichen Beurteilung der Pflegesituation,
Personen aus dem Pflegedienst, aus der Heil- und Sonderpädagogik, der Sozial-
arbeit oder der Psychologie beigezogen. Wie kommt man zum Pflegegeld? Es
genügt ein formloser Antrag beim zuständigen Leistungsträger (z. B.: PVA (Pensi-
onsversicherungsanstalt) der Arbeiter, SVA (Sozialversicherungsanstalt) der Bau-
ern, Bundessozialamt,... bzw. bei der Gemeinde/Magistrat. Personen ohne Pensi-
ons- oder Rentenansprüche bringen ihre Anträge bei der Bezirksverwaltungsbe-
hörde oder beim zuständigen Amt der Landesregierung ein (Bundesministerium
für soziale Sicherheit und Generationen, 2003).
Hier ist das Pflegegeld das für die verschiedenen Pflegestufen derzeit gültig ist
aufgelistet.
Pflegestufen:
Stufe 1: € 148,30
- 18 -Voraussetzungen sind mindestens 50 Stunden Pflegebedarf monatlich.
Stufe 2: € 273,40
Mehr als 75 Stunden Pflegebedarf
Stufe 3: € 421,80
Mehr als 120 Stunden Pflegebedarf
Stufe 4: € 632,70
Mehr als 160 Stunden Pflegebedarf
Stufe 5: € 859,30
Mehr als 180 Stunden Pflegebedarf
Stufe 6: € 1.171,70
Mehr als 180 Stunden Pflegebedarf und wenn zeitlich unkoordinierbare, nicht vor-
hersehbare Betreuungsmaßnahmen erforderlich sind.
Stufe 7: € 1.562,10
Mehr als 180 Stunden Pflegebedarf bzw. wenn die Unmöglichkeit zielgerichteter
Bewegungen aller vier Extremitäten oder ein gleichzuachtender Zustand vorliegt;
etwa wenn noch eine gewisse Mobilität vorhanden ist, diese aber nicht nutzbar ist,
weil zur Aufrechterhaltung einer lebenswichtigen Funktion technische Hilfe erfor-
derlich ist (Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen, 2003).
„Wird ein Bezieher von Pflegegeld in einer Krankenanstalt behandelt und trägt ein
Sozialversicherungsträger oder der Bund die dadurch entstehenden Kosten, ruht
das Pflegegeld" (Rubisch & et al., 2004, S. 14).
6.5. Versicherungsmöglichkeiten
Zahlreiche Möglichkeiten ergeben sich, trotz Pflege eines Angehörigen, weiter
versichert zu sein. So können Pensionsversicherungszeiten erworben werden,
indem eine freiwillige (kostenpflichtige) Versicherung beantragt wird. Die Selbst-
versicherung beispielsweise hat den Zweck, die Vorraussetzung für eine anschlie-
ßende Weiterversicherung zu schaffen. Personen, die mit Hauptwohnsitz in Öster-
reich leben und das 15. Lebensjahr vollendet haben, sind zur Selbstversicherung
im Rahmen der Pensionsversicherung berechtigt. Der Beitragssatz für sich selbst
versichernde Personen, die einen nahen Angehörigen mit Anspruch auf ein Pfle-
gegeld zumindest in der Höhe der Stufe 4 pflegen, wurde von 22,8 % auf 10,25 %
- 19 -der Beitragsgrundlage reduziert. Für Personen, die zum Zwecke der Pflege ihre
Berufstätigkeit aufgeben und somit keine Anwartszeiten für die Pension erwerben
können, sehen die Pensionsversicherungen besondere Regelungen vor. Auf die
genauen Bestimmungen gehen wir nicht näher ein, da sich die Richtlinien ständig
ändern und die gesetzlichen Bestimmungen an und für sich als komplexes Gebil-
de darstellen. Über die aktuellen Bestimmungen geben die Sozial- und Pensions-
versicherungsträger gerne Auskunft (Land Tirol).
6.6. Essen auf Rädern
Warme Mahlzeiten, schmackhaft zubereitet, gehören zu den angenehmen Dingen
des Lebens, auf die niemand gerne verzichten möchte. Die täglichen Mahlzeiten
spielen eine große Rolle, nicht nur um den momentanen Appetit zu stillen, viel-
mehr gilt es dem Körper die ausreichende Energie zuzuführen und den Körper
durch ausgewogene Zufuhr von Nährstoffen, Vitaminen und Mineralstoffen gegen
Erkrankungen zu wappnen. Das ist besonders bei alten Menschen wichtig, da bei
diesen Personen der Appetit und das Durstgefühl nicht mehr so wie in jungen Jah-
ren gegeben sind. In vielen Kulturkreisen nimmt das (gemeinsame) Essen außer-
dem einen nicht zu unterschätzenden gesellschaftlichen Stellenwert ein. Einkau-
fen und die Zubereitung von Essen können mit zunehmendem Alter beschwerlich
werden. Abwechslungsreiche Kost und gesundes Essen kommen daher oft zu
kurz. Damit auch Menschen, die nicht mehr in der Lage sind, selbst zu kochen,
oder das nicht mehr möchten, trotzdem gut und ausreichend ernährt werden, bie-
ten verschiedenste Organisationen die Möglichkeit der Essenszustellung an. Es
besteht sowohl die Möglichkeit der täglichen Essenszustellung, wie auch das An-
gebot mit Tiefkühlkost versorgt zu werden. Die Darreichungsformen der Speisen
reichen von Normalkost über Schonkost bis hin zu Diabetikerkost. So wird eine
individuelle, im Einzellfall vorgeschriebene Diät berücksichtigt. Die Möglichkeit der
Essenszustellung stellt also für pflegende Personen, die nicht immer anwesend
sein können oder wollen als auch für den zu Pflegenden eine enorme Hilfestellung
dar.
6.7. Lebens- und Wohnsituation
- 20 -Um Angehörige in der Pflege zu entlasten, ist es wichtig, die Selbständigkeit des
Patienten solange wie möglich aufrecht zu halten. Dabei ist es wichtig, den Wohn-
raum entsprechend zu adaptieren oder noch besser gleich in der Erstplanung
nicht nur auf Design und momentane Nutzung zu denken, sondern auch für einen
eventuell eintretenden Notfall zu planen. Die Räumlichkeiten und die Umgebung
des Hauses sollten im Hinblick auf, eine hilfs- oder pflegebedürftige Person ausge-
richtet werden. Wenn zum Beispiel ein schneller Abtransport einer Person mittels
Krankentrage erforderlich ist, stößt man oft sehr schnell auf diverse Probleme, die
wertvolle Zeit kosten. Manchmal fehlt eine Zufahrt ganz oder sie ist verparkt, so-
dass Einsatzfahrzeuge nur schwer zum Haus gelangen können. Auch zu enge
Stiegenhäuser oder „verschachtelte“ Räumlichkeiten erschweren ein waagrechtes
Tragen der Krankentrage, das für einen schonenden Abtransport oft von Nöten ist.
Ist nun wirklich der Ernstfall einer Gehbehinderung eingetreten und der Patient
benötigt einen Gehbehelf wie Krücken oder gar einen Rollstuhl, ist es wichtig, für
barrierefreie Räumlichkeiten zu sorgen. Das setzt voraus, dass an entsprechende
bauliche Vorkehrungen gedacht wird und bestimmte langfristige Anforderungen
schon in die Planung einbezogen werden. Wird ein Autoabstellplatz benötigt, so
soll dieser möglichst nah am Hauseingang liegen. Er soll nach Möglichkeit über-
dacht und ausreichend breit sein, damit die Tür vollständig geöffnet bzw. mit dem
Rollstuhl neben das Auto gefahren werden kann. Hierfür ist eine Mindestbreite für
Autoabstellplätze oder Garagen von 350 cm erforderlich. Ist dieses Hindernis ge-
schafft, gilt es für Schwellenfreiheit innerhalb der Wohnung zu sorgen. Dies gelingt
durch den Einsatz von Streiftüren. Maße die nicht unterschritten werden sollen:
Die Durchgangsbreite der Hauseingangstüre liegt bei 100 cm, für die Wohnungs-
eingangstüre 85 cm, für alle sonstigen Türen 80 cm. Die Breite der Verkehrswege
wie Treppen, Gänge beträgt 120 cm. Diese Werte sind für öffentliche Gebäude
zwingend vorgeschrieben. Sanitärräume sollen mit unterfahrbaren Waschbecken
ausgestattet sein, die Dusche und das WC sollten niveaugleich, also schwellenfrei
befahrbar sein und mit sicheren Haltegriffen ausgestattet werden. Der Fußboden
muss rutschfest und frei von Stolpergefahren, wie lose aufstehende Teppichvorle-
ger oder Teppiche sein. Diese könnten durch die hohe Beanspruchung beispiels-
weise Wellen schlagen. Stiegenhandläufe sollen mit einem gut umgreifbaren Profil
und auf beiden Seiten angebracht sein. Farblich sollen sie einen Kontrast zur
Wand bilden, dies ist besonders für Sinnesbehinderte von Bedeutung, nach Mög-
- 21 -lichkeit sollen sie über die erste und letzte Stufe hinaus weiterführen. Die Beleuch-
tung muss im gesamten Wohn- und Eingangsbereich ausreichend angebracht
werden, damit wird wesentlich für eine Unfallfreiheit gesorgt. Das Vorhandensein
einer Gegensprechanlage mit automatischer Türöffnung, sowie multifunktionelle
Fernbedienungen für Heizung, Fernseher, Vorhang, Jalousien, Fensteröffnung,...
sind für inmobile Personen von großer Bedeutung und heben die Lebensqualität
bedeutend. Niveauunterschiede können bis zu einem Längsgefälle von 6% mit
einer Rampe überwunden werden. Wenn die Steigung mehr beträgt, sind eine
Hebebühne oder ein Lift von großem Vorteil. Die Räumlichkeiten sollen ausrei-
chend Bewegungsfreiheit (siehe Abb. 3) bieten, beispielsweise für das Wenden
mit dem Rollstuhl. Alle wichtigen Elemente sollen in greifbarer Nähe/ Höhe sein.
Für die Wasserentnahme sind Einhand-Mischbatterien mit thermostatgesteuerten
Temperaturbegrenzer zu verwenden, lange Bedienhebel erleichtern eine feine
Dosierung. Für die heutige Gesellschaft sollte auch auf die neuen Technologien
wie Internetanschluss nicht vergessen werden, da das Internet für die Kommuni-
kation nach außen sehr gute Dienste ermöglicht. Sinnesbehinderte erhalten durch
akustische, visuelle oder ertastbare Informationen gute Unterstützung. Rauchmel-
der sollen in keinem Haus fehlen, dabei wird wertvolle Zeit zum Eingreifen im
Brandfalle für sich selbst und für die Einsatzkräfte gewonnen. Alle hier genannten
Ausführungen stellen keine Vollständigkeit dar und können nur als Anregung ge-
dacht sein. Jeder Einzelfall gehört für sich separat begutachtet, weiters bieten di-
verse Organisationen (Bundessozialamt, Lions-Club, private Stiftungen,... ) hierfür
finanzielle Unterstützung an (Hohenester, 2003).
- 22 -Rollstuhlgerechte Wohnung für zwei Personen. Entwurf: Ette, Höfs, Loeschke
Abb. 3, Ganzheitliche Pflege, 2003, S. 133
6.8. Betreutes Wohnen
Dieses Angebot richtet sich an Menschen mit geistiger und mehrfacher Behinde-
rung, mit dem Ziel höchstmögliche Eigenständigkeit in allen Bereichen des tägli-
chen Lebens zu erhalten. Betreutes Wohnen ist eine moderne Wohn- u. Lebens-
form für Menschen mit geringem Betreuungsbedarf. Die Betreuer unterstützen die
Mieter nach ihren individuellen Bedürfnissen. Sie kommen zu den Mietern, wenn
es nötig ist und sorgen für fachgerechte Pflege im Krankheitsfall. Es werden
Wohnformen unterschieden: Das ambulant begleitete Wohnen, für Personen die
keine permanente Begleitung benötigen, oder das Vollzeit begleitete Wohnange-
bot mit einem sehr hohen Bedarf an Unterstützung (Lebenshilfe, 2005).
- 23 -6.9. Kurzzeitpflegeplätze
Die Kurzzeitpflege ist eine Form der „kurzen“, vorübergehenden Unterbringung
und Pflege von Menschen im Wohn- und Pflegeheim. Diese Form der stationären
Pflege und Betreuung ist eine Dienstleistung mit dem Ziel, pflegende/betreuende
Angehörige bzw. andere Bezugspersonen von der Pflege zu entlasten, um so die
Pflege zu Hause nach einer Zeit der Erholung wieder bewältigen zu können. Wei-
ters ist es auch wichtig, bei Urlaub, Krankheit, Weiterbildung, Kur oder sonstiger
kurzzeitiger Verhinderung der privaten Pflegeperson weiterhin eine Versorgung zu
gewährleisten. Gedacht ist die Kurzzeitpflege auch als Übergang vom Kranken-
haus zur Pflege und Betreuung zu Hause, wobei eine Entlassung in die häusliche
Betreuung nach spätestens 30 Tagen erfolgen soll. Wie das Land Tirol anführt,
hilft die Kurzzeitpflege also, vorübergehend vorliegende Engpässe bei der Pflege
in der Familienstruktur zu überbrücken und dadurch die häusliche Pflege zu er-
möglichen und zu unterstützen. Das Land Tirol fördert aus diesen Gründen die
Kurzzeitpflege mit einem Betrag bis zu € 30,-- pro Tag. Kurzzeitpflege kann von
wenigen Tagen bis maximal 6 Wochen in Anspruch genommen werden. Die Auf-
enthaltsdauer beträgt meist 1 - 4 Wochen, Verlängerung ist möglich, falls ein Bett
im betreffenden Wohn- und Pflegeheim frei ist. Wichtig dabei ist, den Aufenthalt
früh genug zu planen, da die Kurzzeitpflegebetten oft über Monate ausgebucht
sind.
6.10. Heilbehelfe und Hilfsmittel
Heilbehelfe und Hilfsmittel, wie Verbandsmaterial, Inkontinenzhilfen, Gehilfen,
Kommunikationsmittel, Orientierungshilfen, Sehhilfen, Lagerungshilfsmittel zur
Dekubitusvorbeugung, Messinstrumente, wie Blutzucker-, Blutdruck- und Pulsoxi-
meter, ect. (all diese Produkte zu nennen, sprengt den Rahmen dieser Arbeit) er-
leichtern eine fachgerechte Betreuung der hilfs- oder pflegebedürftigen Personen.
Eine Einschulung durch eine fachkompetente Person ist für jeden Bediener von
Hilfsmitteln unumgänglich. Weiters ist vor dem Kauf zu klären, ob es die Möglich-
keit einer Kostenübernahme durch Versicherungen oder Hilfsfonds gibt, da diese
meist eine ärztliche Verordnung oder eine von ihnen ausgestellte Bewilligung vor-
aussetzen. Leider wurden durch diverse Einsparungspakete diverse Artikel aus
- 24 -Sie können auch lesen