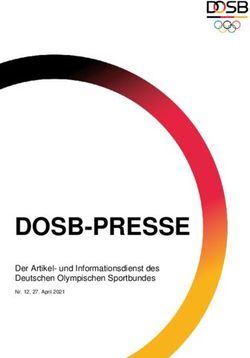PFLEGE BILDET Edukation als Kernkompetenz in der Primärversorgung - unipub
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Herlinde M. Ressler
PFLEGE BILDET
Edukation als Kernkompetenz
in der Primärversorgung
NURSING EDUCATES
Education as a core competence in Primary Health Care
Masterarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
Master of Science
im Rahmen des Universitätslehrganges
Lehrerinnen und Lehrer der
Gesundheits- und Krankenpflege
betreut von
Dr. Martin Sprenger MPH
Karl-Franzens-Universität Graz
und UNI for LIFE
Graz, März 2021Danksagung An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mich während der Erstellung meiner Masterarbeit unterstützt und motiviert haben. Zuerst gilt mein Dank Dr. Martin Sprenger, der meine Masterarbeit betreut und begutachtet hat. Danke für die hilfreichen Anregungen. Bedanken möchte ich mich auch bei Mag.a Ursula Auer und Mag.a Sabine Penker-Hatzl für das Korrekturlesen. Ebenfalls möchte ich meinen Mitstudentinnen Melanie Kolb und Anna Joho-Klinger für die emotionale Unterstützung, den regen Austausch und die motivierenden Gespräche danken. Dr.in Eva Petz und Dr. Oliver Petz: danke für die Freundschaft! Ich wünsche euch einen langen Atem und viel Kraft für die Arbeit in der Primärversorgung. Abschließend bedanke ich mich bei meinem Mann für den technischen Support und den Rückhalt in allen Belangen über die Dauer meines gesamten Studiums. Graz, März 2021
Abstract Das Österreichische Primärversorgungsgesetz führt Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen gemeinsam mit Mediziner*innen und Ordinationsassistent*innen als Mitglieder des Kernteams einer Primärversorgungseinheit (PVE) an. Obwohl in Österreich derzeit der Ausbau solcher Primärversorgungseinheiten forciert wird, befinden sie sich immer noch in der Pionierphase. In diesem Zusammenhang muss die Berufsgruppe der Pflegenden erst ihre Rolle definieren und ausfüllen. Schulen, informieren, beraten und moderieren sind ein Teil der Arbeitsfelder, welche Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen im Rahmen der im Österreichischen Gesundheits- und Krankenpflegegesetz vorgegebenen Kernkompetenzen anbieten. Diese Tätigkeiten werden in der Pflegewissenschaft unter dem Titel ‚Patient*innenedukation‘ zusammengefasst. Im Kontext der beiden Bereiche ‚Primärversorgung‘ und ‚Patient*innenedukation‘ stellt sich die Frage, in welcher Weise Pflegepersonen Patient*innenedukation in Primärversorgungseinheiten übernehmen können und über welche Kompetenzen und Skills sie dafür verfügen sollten. Das Anliegen der vorliegenden Literaturarbeit ist es, die beiden Themenbereiche ‚Primärversorgung‘ und von Pflegepersonen durchgeführte ‚Patient*innenedukation‘ zusammenzuführen und die dafür nötigen Kompetenzen herauszuarbeiten. Die Entwicklung der Primärversorgung bzw. der Primärversorgungseinheiten in Österreich wird ebenso beleuchtet wie die dafür maßgeblichen Grundlagentexte. Des Weiteren werden die theoretischen Hintergründe der Patient*innenedukation und des Themas ‚Kompetenz‘ behandelt. Anhand der Auseinandersetzung mit der vorhandenen wissenschaftlichen Literatur und der entsprechenden Gesetzestexte soll neben der Beantwortung der Forschungsfragen ein entsprechender Katalog für die erforderlichen Kompetenzen bzw. Skills entworfen werden.
Abstract The Austrian ‘Primary Care Act’ lists qualified health care workers and nurses together with physicians and medical assistants as members of the core team of a primary care unit. Although the expansion of such primary care units is currently being promoted in Austria, they are still in the pioneering phase. In this context, the nursing profession must first define and fulfill its role. Training, informing, advising and moderating are part of the fields of work that qualified health care and nursing personnel offer within the framework of the core competencies specified in the Austrian Health Care and Nursing Act. These activities are summarized in nursing science under the title of ‘patient education’. In the context of the two topics of ‘primary care’ and ‘patient education’, the question arises how nurses can take on patient education in primary care units and what competencies and skills are essential. The aim of this literature based thesis is to bring together the two topics of primary care and patient education carried out by nurses and to work out the competencies required for this job. The development of primary care and primary care units in Austria is examined as well as the relevant basic documents. Furthermore, the theoretical background of patient education and the topic of 'competence' will be discussed. Based on the discussion of the existing scientific literature and the relevant legal documents, in addition to answering the research questions, a corresponding catalogue for the required competencies or skills will be drafted.
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung ............................................................................................. 5
1.1 Problemstellung, Fragestellung und Zielsetzung der Arbeit ........................ 6
1.2 Methodische Vorgehensweise .................................................................... 7
1.3 Grundlagen ................................................................................................. 8
2 Primary Health Care und die Primärversorgungseinheit in
Österreich ............................................................................................... 10
2.1 Primary Health Care / Primärversorgung .................................................. 10
2.2 Entwicklung .............................................................................................. 11
2.3 Die Primärversorgung in Österreich .......................................................... 13
2.4 Primärversorgungseinheiten ..................................................................... 17
2.5 Die Pflegeperson und ihre Rolle in den Primärversorgungseinheiten ........ 21
2.6 Finanzierung der pflegerischen Tätigkeiten in der PVE ............................. 25
3 Patient*innenedukation ..................................................................... 27
3.1 Pädagogische bzw. didaktische Vorbemerkungen .................................... 28
3.1.1 Edukation und Bildung ....................................................................... 28
3.1.2 Das didaktische Dreieck .................................................................... 30
3.1.3 Spezifische Aspekte des Lernens bei Erwachsenen .......................... 31
3.2 Patient*innenedukation im Zusammenhang mit Information, Schulung,
Beratung und Moderation ................................................................................ 32
3.2.1 Anmerkungen zu Information – Beratung – Schulung - Moderation ... 34
3.2.2 Rückschau: Die Entwicklung der Patient*innenedukation .................. 35
3.2.3 Schulen, Informieren und Beraten im GuKG ...................................... 36
3.2.4 Ziel und Nutzen von Patient*innenedukation...................................... 38
3.2.5 Theoretische Begründung pflegebezogener PE ................................. 42
3.2.6 Patient*innenedukation im Kontext des Pflegeprozesses ................... 50
3.2.7 Die Pflegeperson als Lehrende .......................................................... 54
3.3 Ethische Aspekte der Patient*innenedukation........................................... 55
4 Patient*innenedukation als Leistung des gehobenen
Pflegedienstes in den PVE .................................................................... 56
4.1 Maßnahmen PE in der PVE ...................................................................... 56
4.1.1 Informieren anhand von Broschüren .................................................. 56
4.1.2 Schulen anhand von Mikroschulungskonzepten ................................ 58
4.1.3 Beraten unter Zuhilfenahme der Wittener Werkzeuge........................ 60
4.1.4 Moderieren: Familienmoderation........................................................ 63
4.2 Voraussetzungen für PE in der PVE – das optimale Setting ..................... 65
I5 Skills und Kompetenzen – Die DGKP als ‚PE-Universalgenie‘ in der
PVE.......................................................................................................... 68
6 Fazit und Ausblick ............................................................................. 76
Literaturverzeichnis ............................................................................... 78
IIAbbildungsverzeichnis
Abbildung 1: Teambasierte Primärversorgung in Österreich
(Österreichische Sozialversicherung 2021) ............................................. 15
Abbildung 2: Primärversorgungsteam und Primärversorgungspartner .... 18
Abbildung 3: Das Team rund um den Patienten ...................................... 19
Abbildung 4: Leistungsprofil (eigene Darstellung, vgl. Österreichischer
Gesundheits- und Krankenpflegeverband Landesverband Steiermark
2018, o.S.) ............................................................................................... 22
Abbildung 5: Didaktisches Dreieck (eigene Darstellung) ......................... 30
Abbildung 6: Strukturmodell der Gesundheitskompetenz (eigene
Darstellung, vgl. Lenartz/Soellner/Rudinger 2014, S.30) ......................... 45
Abbildung 7: Pflegeprozess (eigene Darstellung, .................................... 50
Abbildung 8: Edukationsprozess nach Redmann (eigene Darstellung, .... 51
Abbildung 9: Pflegeprozess und PE nach London (eigene Darstellung) .. 53
Abbildung 10: Das didaktische Dreieck im Kontext der PE (eigene
Darstellung).............................................................................................. 54
Abbildung 11: Wittener Stern (Segmüller o.J.,o.S.).................................. 62
Abbildung 12: Relevante Hard Skills und Soft Skills (eigene Darstellung) 73
Tabellenverzeichnis
Tabelle 1: Hauptstrategien der PE und ihre Ziele (vgl. Kocks/Segmüller
2017, S.221) ............................................................................................ 34
IIIAbkürzungsverzeichnis
ANP Advanced Nurse Practioner(s)
DGKP Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegeperson
GuKG Gesundheits- und Krankenpflegegesetz
FH Fachhochschule
PE Patient*innenedukation
PHC Primary Health Care
PrimVG Primärversorgungsgesetz
PV Primärversorgung
PVE Primärversorgungseinheit/-en
SV Österreichische Sozialversicherung
WHO Weltgesundheitsorganisation
IV„Gib einem Mann einen Fisch und du ernährst ihn für einen Tag. Lehre
einen Mann zu fischen und du ernährst ihn für sein Leben“ (Konfuzius).
1 Einleitung
‚Nursing is teaching‘ - unter diesem Motto nehmen seit Jahren
Pflegekräfte im Ausland ihren pädagogischen Auftrag wahr (vgl. Harking
2005, S.72). Das Bewusstsein über den Auftrag von Beraten, Schulen und
Informieren als Kompetenzen der Pflege durchdringt auch in
deutschsprachigen Ländern vermehrt die dementsprechende Literatur. In
Österreich vollzog sich 2016 dahingehend die gesetzliche Verankerung.
Das österreichische Gesundheits- und Krankenpflegegesetz benennt die
Kernkompetenzen des gehobenen Dienstes der Gesundheits- und
Krankenpflege (GuKG §14). Darunter fallen unter anderem Prävention,
Gesundheitsförderung, Beratung und Durchführung von Schulungen (vgl.
Bundeskanzleramt 1997, S.12).
Im Bereich der Primärversorgung ergibt sich ein breites
Aufgabenspektrum für Diplomierte Gesundheits- und
Krankenpflegepersonen (DGKP). Durch die steigende Anzahl chronisch
kranker Menschen, die es nicht nur zu versorgen, sondern auch zu
informieren, zu beraten und zu schulen gilt, können Pflegekräfte innerhalb
ihrer Kernkompetenzen tätig werden. 2014 litten in Österreich 36% der
Bevölkerung ab 15 Jahren an einem chronischen Gesundheitsproblem
oder an einer dauerhaften Erkrankung (vgl. Griebler et al. 2017, S.21).
Demgegenüber steht ein hoher Anteil der Bevölkerung mit einer im
europäischen Vergleich begrenzten Gesundheitskompetenz (vgl. ebd.,
S.76).
2013 wurden die Gesundheitsziele Österreichs von der
Bundesgesundheitskommission gemeinsam mit dem Ministerrat
beschlossen (vgl. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und
5Konsumentenschutz 2020a, o.S.; Bundesministerium für Soziales,
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 2021a, o.S). Gesundheitsziel
3 stellt sich dem Thema „Gesundheitskompetenz der Bevölkerung
stärken“ (vgl. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz 2020b, o.S.). Dieses Ziel ist auch im GuKG §14 und
§16 verankert. Obwohl im Gesundheitsziel 3 die Primärversorgung (PV)
bei den umsetzenden Institutionen nicht ausdrücklich genannt wird, sind
Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention und folglich auch
die Stärkung der Gesundheitskompetenz im Rahmen des
Primärversorgungsgesetzes von öffentlichem Interesse und im
Leistungsumfang einer Primärversorgungseinheit enthalten (PrimVG §3
und §5) (vgl. Bundeskanzleramt 2017, S.2f.).
1.1 Problemstellung, Fragestellung und Zielsetzung der
Arbeit
Soll eine DGKP im Rahmen ihrer Berufsausübung in der PV einerseits
ihren Kernkompetenzen und andererseits den Anforderungen des
Primärversorgunggesetzes (PrimVG) gerecht werden, so wird sie
Beratung, Schulung und Information anbieten. Diese drei Themenfelder
werden der sogenannten Patient*innenedukation (PE) zugeschrieben.
Oftmals findet diese allerdings im informellen und unbewussten Bereich
statt. Da PE eine der Kernkompetenzen des gehobenen Dienstes für
Gesundheits- und Krankenpflege darstellt, muss sie im professionellen
Rahmen verankert sein. Die Primärversorgungseinheiten (PVE) befinden
sich in Österreich nach wie vor im Auf- und Ausbau. Gerade in dieser
Pionierphase ergeben sich im Rahmen der Vorgaben vielerlei Chancen,
die es zu nutzen gilt. Die Intensivierung und Professionalisierung der PE
ist eine davon.
Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit den
folgenden zentralen Fragestellungen:
6In welcher Weise können Angehörige des gehobenen Dienstes der
Gesundheits- und Krankenpflege Patient*innenedukation in
Primärversorgungseinheiten übernehmen? Über welche Kompetenzen
müssen sie verfügen, um PE anbieten zu können?
Mögliche Herausforderungen können sich auch in Hinblick auf die
Rahmenbedingungen und Voraussetzungen ergeben. Dabei stellen sich
Fragen nach den geeigneten räumlichen, zeitlichen und finanziellen
Ressourcen. Und zusätzlich dabei wäre auch eine Rollenbeschreibung im
Team vonnöten.
Hauptanliegen der vorliegenden Arbeit ist es, die beiden Felder der PV
und der PE zusammenzuführen, den Stand der wissenschaftlichen
Erkenntnis sowie die rechtlichen Grundlagen herauszuarbeiten und
mögliche Potenziale bzw. Entwicklungsmöglichkeiten zu nennen.
Die Entwicklung eines Anforderungsprofils, das die nötigen Kompetenzen
bzw. Skills der DGKP bezüglich PE in der PV anführt ist ein weiteres Ziel
dieser Arbeit.
Mit Hilfe einschlägiger Literatur soll ein Beitrag für das umfassendere
Verständnis von PE in PVE geleistet werden.
1.2 Methodische Vorgehensweise
Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um eine Literaturarbeit. Es
wird versucht, die beiden Themen der PE und der PV auf Basis der
vorhandenen Fachliteratur zusammenzuführen. Die Recherche erfolgte
vorrangig in Internetsuchmaschinen, den Datenbanken von Cochrane und
PubMed sowie in den Bibliothekskatalogen der Karl-Franzens-Universität
Graz und der FH Joanneum.
Folgende Keywords wurden für die Recherche herangezogen: ‚Primary
Care‘, ‚Primary Health Care‘, ‚Nurse‘, ‚Nursing‘, ‚Patient education‘,
7‚Education‘ und ‚Krankenpflege‘. Diese Begriffe wurden sowohl in der
englischen als auch in der deutschen Form unterschiedlich verknüpft.
Die Arbeit ist in vier große Bereiche gegliedert. Im ersten Abschnitt wird
das Thema der PV bzw. der PVE in Österreich behandelt und im
Besonderen auf die Rolle des gehobenen Pflegedienstes und der
Finanzierung der pflegerischen Tätigkeiten eingegangen.
Der zweite Abschnitt beschäftigt sich mit der pflegerelevanten PE im
Allgemeinen. Didaktische Grundlagen und die Anführung ethischer
Aspekte ergänzen die Ausführungen über Information, Beratung,
Schulung und Moderation.
Abschnitt drei führt die beiden vorangegangenen Themen zusammen und
beleuchtet die PE als Leistung des gehobenen Pflegedienstes in den PVE.
Der vierte Abschnitt fokussiert schließlich auf das Thema ‚Kompetenzen
und Skills‘. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Skills, die eine Pflegekraft
für die Ausübung von PE in PVE aufweisen sollte.
1.3 Grundlagen
Zunächst werden die zentralen Begriffe und Definitionen geklärt, um ein
Grundverständnis für das Thema zu entwickeln.
Edukation: Erziehung, Bildung (vgl. Dudenredaktion 2020a, o.S.; LEO
2006-2020, o.S.).
Kernkompetenz: grundlegende, wesentliche Fähigkeit, stärkste
Kompetenz (vgl. Dudenredaktion 2020b, o.S.).
Kompetenz: Sachverstand, Fähigkeit, Zuständigkeit (vgl. Dudenredaktion
2020c, o.S.).
8Patient*innenedukation (PE): Handlungen, die auf Information,
Schulung, Beratung und Moderation für Patient*innen abzielen (vgl.
Netzwerk Patienten- und Familienedukation in der Pflege e.V. 2020a,
o.S.).
Primärversorgung (PV): erste Anlaufstelle für alle Personen mit Fragen
zu Gesundheit und Krankheit (vgl. Bundesministerium für Soziales,
Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 2019a, o.S.).
Primärversorgungseinheit (PVE): erweiterte Praxis für Allgemeinmedizin
mit einem Kernteam (Ärzt*in und DGKP) und zusätzlichen Gesundheits-
und Sozialberufen (vgl. Bundeskanzleramt 2017, S.1).
Skills: die Fähigkeit, eine Aktivität oder einen Job gut zu machen,
insbesondere weil sie eingeübt wurde – wird oft mit ‚Kompetenz‘
gleichgesetzt (vgl. North et al. 2013, S.56; Cambridge University Press
2014, o.S.).
Hard Skills: rein fachliche Qualifikation (Dudenredaktion 2021a, o.S.).
Soft Skills: Kompetenz im zwischenmenschlichen Bereich. Fähigkeit im
Umgang mit anderen Menschen (Dudenredaktion 2021b, o.S.).
92 Primary Health Care und die
Primärversorgungseinheit in Österreich
Dieses Kapitel beschäftigt sich einerseits mit PV und andererseits mit den
PVE. Es handelt sich hierbei um zwei Begriffe, die voneinander zu
unterscheiden sind und dennoch häufig synonym abgehandelt werden.
2.1 Primary Health Care / Primärversorgung
Das österreichische Gesundheitsministerium beschreibt PV als „die erste
Kontaktstelle für alle Personen mit gesundheitsbezogenen
Fragestellungen“ (Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege
und Konsumentenschutz 2019a, o.S.). Diese Kernaussage stellt die
Kurzform der allgemein gültigen Definition der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) dar.
„Primary health care is essential health care based on practical,
scientifically sound and socially acceptable methods and
technology made universally accessible to individuals and
families in the community through their full participation and at a
cost that the community and country can afford to maintain at
every stage of their development in the spirit of self-reliance and
self-determination. It forms an integral part both of the country's
health system, of which it is the central function and main focus,
and of the overall social and economic development of the
community. It is the first level of contact of individuals, the family
and community with the national health system bringing health
care as close as possible to where people live and work, and
constitutes the first element of a continuing health care process”
(WHO 1978, o.S.).
Demgemäß soll die Gesundheitsversorgung zu leistbaren Kosten für alle
Menschen vor Ort die erste Kontaktebene mit dem Gesundheitssystem
sein (vgl. WHO 1978, o.S.). Diese Definition wurde bei der Erklärung von
Alma-Ata festgeschrieben und bildet die Grundlage für alle weiteren
10Definitionen im Zusammenhang mit Primary Health Care (PHC) bzw.
Primärversorgung (PV).
Das Expertengremium der Europäischen Union, das sich 2014 zum
Thema Wirksame Wege im Bereich der Gesundheitsausgaben‘ geäußert
hat, definiert Primary Care als Grundversorgung, welche die Bereitstellung
allgemein zugänglicher, integrierter, personenzentrierter, umfassender
Gesundheits- und Sozialdienste sichert. Ein Team von Fachleuten zeigt
sich für die Abdeckung der Gesundheitsbedürfnisse der Bevölkerung
verantwortlich. Die Dienstleistungen werden in einem partnerschaftlichen
Rahmen gemeinsam mit Patient*innen, Betreuer*innen, Familie und
Gemeinde erbracht und spielen eine zentrale Rolle für die allgemeine
Koordination und Kontinuität der Versorgung. Die in der Grundversorgung
tätigen Fachleute sind Allgemeinmediziner*innen/Hausärzt*innen,
Zahnärzt*innen, Diätassistent*innen, Pflegepersonen,
Sozialarbeiter*innen, Psycholog*innen, Physiotherapeut*innen,
Ergotherapeut*innen, Optiker*innen und Apotheker*innen (vgl. EXPH
2014, S.18).
2.2 Entwicklung
Lord Dawson of Penn (England) hat 1920 den Begriff der ‚Primary Health
Centers‘ geprägt. Bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde bemerkt,
dass die Organisation der Gesundheitsversorgung unzureichend sei und
der Fortschritt in der Medizin die Bevölkerung nicht umfassend erreichen
würde. Allgemeinärzte (zu jener Zeit handelte es sich tatsächlich
ausschließlich um männliche Personen) sollten in einem Primären
Gesundheitszentrum kurative und präventive Medizin anbieten. Die
Zusammenarbeit mit anderen Berufsgruppen und medizinischen Diensten
(Hebammen, Apotheken, Pflege und sogenannte ‚Gesundheitsbesucher‘)
wird bereits angeführt (vgl. Ministry of Health 1920, o.S.; The Health
Foundation 2020, o.S.).
11Mit der Deklaration der Menschenrechte wurde 1948 von den Vereinten
Nationen (UNO) auch auf das Recht auf Gesundheit hingewiesen:
„Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und
seiner Familie Gesundheit und Wohl gewährleistet,
einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche
Versorgung und notwendige soziale Leistungen, sowie das
Recht auf Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit,
Invalidität oder Verwitwung, im Alter sowie bei anderweitigem
Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände“
(Vereinte Nationen 1948, S.5).
Um dieses Menschenrecht zu fördern, hat die WHO 1978 die Erklärung
von Alma-Ata abgegeben. Sie nennt die primäre Gesundheitsversorgung
(engl. Primary Health Care) einen Schlüssel zur Gewährleistung dieses
Rechts aller Menschen auf Gesundheit. PHC wird als erstes Element
eines kontinuierlichen Prozesses der Gesundheitsversorgung gesehen.
Die WHO ruft die Regierungen auf, Konzepte, Strategien und
Aktionspläne zu entwickeln, um PHC zu etablieren bzw. zu erhalten. Bis
zum Jahr 2000 sollten die Ziele von Alma-Ata umgesetzt werden.
Allerdings verwirklichten vornehmlich Entwicklungsländer die Grundsätze
der Erklärung von Alma-Ata. Für die WHO war das nicht ausreichend, so
dass sie 2008 ihren Weltgesundheitsbericht „Primary Health Care: Now
more than ever“ betitelte. Menschen an die erste Stelle zu setzen ist die
Absicht von PHC. Gesundheit, Wohlbefinden, Werte und Fähigkeiten
sowohl der Bevölkerung als auch des Gesundheitspersonals müssen
umfassend berücksichtigt werden, um dies zu erreichen (vgl. WHO 1978,
S.1-3; Müller/Razum 2008, S.408; WHO 2008, S.41).
Das WHO-Regionalbüro für Europa setzt sich zum Ziel, die
Leistungsfähigkeit der Gesundheitssysteme der Mitgliedsstaaten zu
verbessern. 2009 verfasste es den Europäischen Gesundheitsbericht.
Hauptanliegen ist die Entwicklung von Lösungswegen, die einen
durchgängigen Zugang zu einer qualitätsvollen Gesundheitsversorgung
12sicherstellen. Im Zuge der Pandemiebekämpfung (Virus H1N1/2009)
wurde bereits zehn Jahre vor Auftreten des SARS-CoV-2-Erregers auf
den Wert hingewiesen, der einem allgemeinen Zugang zur
Gesundheitsversorgung und einer stabilen PHC zukommt. PHC soll
modernisiert werden und ein abgestimmtes, integriertes,
bürger*innennahes und umfassendes Versorgungangebot darstellen.
Bürger*innennahe PV legt im Gegensatz zur konventionellen ambulanten
Gesundheitsversorgung in Krankenhäusern oder Ambulanzstationen das
Augenmerk auf folgende Punkte:
Gesundheitliche Bedürfnisse als Schwerpunkt,
Dauerhafte persönliche Beziehung,
Umfassende, kontinuierliche patient*innenorientierte Versorgung,
Verantwortung für die Gesundheit aller Mitglieder der Gemeinschaft
während ihres gesamten Lebens sowie Verantwortung für die
Steuerung der bestimmenden Größen von Krankheit und
Menschen, die sich in partnerschaftlicher Zusammenarbeit für ihre
eigene Gesundheit und den Gesundheitszustand ihrer
Gemeinschaft einsetzen.
Österreich findet im Hinblick auf diese Punkte im Europäischen
Gesundheitsbericht 2009 keine relevante Erwähnung (vgl. WHO 2010,
S.1-172).
2.3 Die Primärversorgung in Österreich
Die Republik Österreich ist seit Jahrzehnten bestrebt, die ambulante
Versorgung auszubauen und so die stationäre Behandlung in einem
gewissen Umfang zu ersetzen. Der Erfolg ist bislang mäßig. Nach wie vor
spielen Spitalsambulanzen eine wichtige Rolle in der PV. Die Bevölkerung
profitiert von deren Kund*innenfreundlichkeit im Hinblick auf die zeitliche
Flexibilität. Eine Trennung von ‚primary care‘ und ‚secondary care‘
(niedergelassener bzw. stationärer Bereich) ist durch diese
Verschränkung schwer möglich. Hauptkonfliktpunkt dabei scheint die
Leistungsfinanzierung durch Länder bzw. Sozialversicherungsträger zu
sein (vgl. Hofmarcher-Holzhacker 2013, S.185-199).
13Um die nachhaltige Finanzierung des Gesundheitswesens zu
gewährleisten, wurde 2013 die österreichische Gesundheitsreform
beschlossen und die Realisierung mit dem ersten Zielsteuerungsvertrag
festgelegt. Die unmissverständliche Vorgabe lautet, die
Versorgungsstrukturen zu verbessern, mehr Leistungen für kommende
Generationen zu bieten und somit dem Wohl der Patient*innen zu dienen.
Eine der Maßnahmen zur Umsetzung dieser Ziele ist die Stärkung der PV
im niedergelassenen Bereich nach internationalem Vorbild (vgl.
Bundeskanzleramt 2013, S.9; Gesundheit Österreich GmBH 2019, o.S.).
Der zweite Bundeszielsteuerungsvertrag (2017-2021) zwischen Bund,
Sozialversicherungsträgern und Ländern führt diese Thematik fort und
entwickelt sie weiter (vgl. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit,
Pflege und Konsumentenschutz 2020f, o.S.). Das Zukunftsbild, das
entworfen wird, zeigt
den Einsatz für ein selbstbestimmtes, längeres Leben bei guter
Gesundheit für alle Menschen,
die Arbeit an einem niederschwelligen Zugang zur
Gesundheitsversorgung,
ein solidarisches Gesundheitssystem, das den sozialen
Grundprinzipien gerecht wird und eine bedarfsgerechte,
qualitätsgesicherte und wirkungsorientierte Gesundheitsversorgung
sicherstellt,
den hohen Stellenwert von Gesundheitsförderung und Prävention,
die richtige Leistungserbringung zum richtigen Zeitpunkt am
richtigen Ort (Versorgung am ‚Best Point of Care‘),
multiprofessionelle und interdisziplinäre PVE, die zur Verfügung
stehen,
die Gewährleistung von Patient*innensicherheit durch umfassendes
Qualitäts- und Risikomanagement und
die Beteiligung der Menschen an Entscheidungsprozessen, die
ihren Gesundheitszustand betreffen.
14Der Auf- und Ausbau von Primärversorgungsmodellen wird ausdrücklich
genannt. Der Bund verpflichtet sich, die erforderlichen Voraussetzungen
zu schaffen, Eckpfeiler für Verträge und Honorierungssysteme festzulegen
und Informationen zu PV und zur Gründung von PVE bereitzustellen. Die
Länder analysieren die Versorgungssituation und setzen die
Implementierung von PVE um. Die österreichische Bevölkerung sollte auf
diese Weise bis 2021 mit 75 PVE versorgt sein (vgl. Bund, Länder
Sozialversicherung o.J., S.3f. und S.10-13; Bundesministerium für
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 2020d, o.S.).
Abbildung 1 macht den Stand zum Zeitpunkt Jänner 2021 ersichtlich. Von
den geplanten 75 PVE sind 24 umgesetzt. Andere befinden sich in der
Gründungs- bzw. Planungsphase (vgl. Österreichische Sozialversicherung
2021, O.S.).
umgesetzt
Abbildung 1: Teambasierte Primärversorgung in Österreich (Österreichische
Sozialversicherung 2021)
Die türkis-grüne Regierung in Österreich nimmt die Erweiterung der
Primärversorgung in ihrem Regierungsprogramm 2020-2024 auf. Im Zuge
einer hochqualitativen, abgestuften, flächendeckenden und wohnortnahen
Gesundheitsversorgung fordert sie den Ausbau der PV und speziell der
PVE, um den Bedürfnissen der Versicherten entgegenzukommen (vgl.
Bundeskanzleramt Österreich 2020, S.187).
15Daraus wird ersichtlich, dass es in Österreich wiederkehrende Versuche
gibt, die PV zu stärken. Ein Höhepunkt dieser Bemühungen ist aber
zweifelsohne die Verabschiedung des Primärversorgungsgesetzes 2017.
Die damalige Bundesministerin Pamela Rendi-Wagner spricht von einem
Gesetz, das Vorteile für alle bringe. Sie hebt die Wohnortnähe, das
umfassende Leistungsangebot, die kontinuierliche und koordinierte
Versorgung, die bedarfsgerechten Öffnungszeiten und die Reduktion der
Wartezeiten für Patient*innen hervor. Darüber hinaus könnten
Mediziner*innen ihrem Wunsch gemäß in multiprofessionellen Teams
arbeiten und hätten so die Möglichkeit zu einer besseren Work-Life-
Balance. Im Mittelpunkt des Gesetzes stehe, abgesehen vom kurativen
Ansatz, die Gesundheitsförderung, die Prävention und die Vorsorge unter
Einbindung verschiedener Gesundheitsberufe. Das PrimVG schafft den
rechtlichen Rahmen für Qualitäts-, Kompetenz- und
Organisationskriterien, Vertragsverhältnisse und Honorierungssysteme.
Allerdings äußern Vertreter*innen der anderen Parteien in der
Plenarsitzung des Nationalrates vom 28.06.2017 ihre Kritikpunkte:
mangelnde Anstellungsmöglichkeiten von Ärzt*innen, die fehlende
Berücksichtigung der nicht-ärztlichen Gesundheitsberufe sowie das
drohende Ende der Hausärzt*innen (vgl. Republik Österreich Parlament
2017, o.S.).
Bemerkenswert ist die Tatsache, dass die Rechtsvorschrift mit
‚Primärversorgungsgesetz‘ betitelt ist, tatsächlich jedoch regelt es die
„Primärversorgung (…), soweit diese durch multiprofessionelle und
interdisziplinäre Primärversorgungseinheiten (…) erbracht wird“
(Bundeskanzleramt 2017, S.1).
Die PVE, auf die im weiteren Verlauf eingegangen wird, sind als Teil der
PV bzw. als deren Ausgestaltung zu sehen.
162.4 Primärversorgungseinheiten
Die Aufgabe von PVE als erste Anlaufstelle im
Gesundheitsversorgungssystem ist es, Gesundheitsförderungs- und
Präventionsmaßnahmen anzubieten und die Behandlung von akuten und
chronischen Erkrankungen zu gewährleisten. Darüber hinaus sollen
Maßnahmen im Bereich der Gesundheitsvorsorge und der
Krankenversorgung koordiniert werden. PVE decken das öffentliche
Interesse unter anderem in Bezug auf verbesserte zeitliche und örtliche
Verfügbarkeit und ein erweitertes Leistungsangebot ab. Bestehend aus
einem Kernteam von Allgemeinmediziner*innen und diplomierten
Pflegekräften wird die PVE durch Angehörige anderer Gesundheits- und
Sozialberufe ergänzt. Das Primärversorgungsgesetz nennt als in Frage
kommende Berufsgruppen: Hebammen, Psycholog*innen,
Psychotherapeut*innen, Angehörige medizinischer Assistenzberufe,
Medizinische (Heil-)masseur*innen sowie gehobene medizinisch-
technische Dienste (vgl. Bundeskanzleramt 2017, S.1; Bundesministerium
für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 2020d, o.S.).
Demnach sind PVE als erweiterte Praxen für Allgemeinmedizin zu sehen.
Das 2014 von der Bundes-Zielsteuerungskommission beschlossene
‚Konzept zur multiprofessionellen und interdisziplinären Primärversorgung
in Österreich‘ bezieht in das Kernteam auch die
Ordinationsassistent*innen ein und führt noch weitere bedeutsame
Berufsgruppen an. Dazu gehören: Diätolog*innen, Ergo- und
Physiotherapeut*innen, Fachärzt*innen für Kinder- und Jugendheilkunde,
Logopäd*innen und Sozialarbeiter*innen. Die Zusammensetzung des PV-
Teams richtet sich dabei nach den regionalen Erfordernissen (vgl.
Bundesministerium für Gesundheit 2014, S.15f.).
Abbildung 2 stellt das Team rund um die Hausärzt*in gut ersichtlich dar.
Auch mögliche Partnerschaften in der Zusammenarbeit (Apotheken,
Pflegeeinrichtungen, Schulen etc.) sind genannt.
17Abbildung 2: Primärversorgungsteam und Primärversorgungspartner
(Bundesministerium für Gesundheit 2014, S.16)
Der bereits beschriebene Zielsteuerungsvertrag ‚Gesundheit 2017-2021‘
stellt den Menschen und die Patient*innenorientierung in den Mittelpunkt
(vgl. Bund, Länder, Sozialversicherung o.J., S.6). Die Österreichische
Sozialversicherung greift dies auf und gruppiert das Team anstatt rund um
den*die Allgemeinmediziner*in rund um den*die Patient*in (siehe
Abbildung 3).
18Abbildung 3: Das Team rund um den Patienten
(vgl. Österreichische Sozialversicherung 2020a, o.S.)
Betrachtet man die Tatsache, dass Sprenger einen eklatanten
Nachwuchsmangel bei Hausärzt*innen (= allgemeinmedizinische
Kassenstellen) diagnostiziert, der durch einen Generationenwechsel
bedingt ist, stellt sich die Frage, ob PVE als Retter in der Krise der
Allgemeinmedizin gesehen werden können. Es scheint keine konkrete
Personalplanung diesbezüglich zu geben. Sprenger fragt nach den
Strategien, um in Zukunft die Allgemeinmedizin und die Arbeit im PV-
Bereich attraktiv und qualitativ hochwertig gestalten zu können. Er beruft
sich in seiner Analyse auf den ‚Masterplan Allgemeinmedizin‘, dessen Ziel
es ist, den Herausforderungen mit einem Bündel an Maßnahmen zu
begegnen (vgl. Rabady/Poggenburg/Wendler/Huter/Fürthauer 2018, S.2;
Sprenger 2019, S.477f.). Ein genannter Ansatz ist die „Erleichterung der
Bildung von Gruppenpraxen ohne finanzielle Abschläge“
(Rabady/Poggenburg/Wendler/Huter/Fürthauer 2018, S.69) mit dem Ziel
„der Vereinfachung von Zusammenarbeitsformen wie Gruppenpraxen
durch flexible und gerechte Partner_innenwahl, keine finanziellen
19Abschläge“ (Rabady/Poggenburg/Wendler/Huter/Fürthauer 2018, S.69).
Dies wird als Voraussetzung für die Entstehung neuer PVE gesehen, die
durchaus als flexible Option für Allgemeinmediziner*innen gelten (vgl.
Rabady 2018, S.82). Nur durch Modernisierung und Anpassung des
Leistungskataloges kann der Primärversorgungsauftrag auf Dauer
gesichert werden. Die PVE befinden sich derzeit noch in der sogenannten
Pilotfinanzierung, für eine entsprechende Honorierung muss aber auch
danach gesorgt sein (vgl. ebd., S.114). Die Bildung von Kernteams aus
Allgemeinmediziner*innen, Ordinationsassistent*in und/oder Diplomierter
Pflegefachkraft stellt eine weitere Maßnahme dar (vgl. ebd., S.91). Als
Argumentation hierfür wird der Faktor Zeit pro Patient*in herangezogen,
der je nach regionalen Besonderheiten sehr unterschiedlich ausfallen
kann. Die klassische Abrechnungsform mittels Krankenschein kann dem
nicht gerecht werden (vgl. ebd., S.92). Vor allem für die im weiteren
Verlauf dieser Arbeit beschriebene Patient*innenedukation durch eine*n
DGKP müssen entsprechende Finanzierungsformen bedacht werden.
Obwohl der Maßnahmenkatalog ausdrücklich anführt, dass die PVE zwar
auch weiterhin nur einen sehr kleinen Teil der Versorgung leisten können
(vgl.ebd., S.7), erwartet sich die Österreichische Sozialversicherung durch
eben deren Implementierung wesentliche Verbesserungen für die
wohnortnahe Versorgung im niedergelassenen Bereich und Reduktion der
stationären Spitalsaufenthalte. Allgemeinmediziner*innen arbeiten in
Teams mit anderen Gesundheitsberufen, die ihre Expertise einbringen.
Als Vorteile für die Patient*innen sieht sie längere Öffnungszeiten,
verkürzte Wartezeiten, mehr Zeit für Gespräche, gut koordinierte
Betreuung für chronisch Kranke, Kinder, Jugendliche und ältere Menschen
und die umfassende Krankenbehandlung und Gesundheitsberatung (vgl.
Österreichische Sozialversicherung 2020b, o.S.; Bundesministerium für
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 2020c, o.S.).
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die PVE einen
qualitativ hochwertigen Beitrag zur Versorgung der Bevölkerung leisten
und ein Anreiz für Mediziner*innen sein könnten, sofern die Finanzierung
langfristig geklärt ist (siehe auch Abschnitt 2.6). Um die besagte Krise der
20Allgemeinmedizin bewältigen zu können, sind allerdings eine Vielzahl von
Maßnahmen nötig.
2.5 Die Pflegeperson und ihre Rolle in den
Primärversorgungseinheiten
Pflegerische Leistungen im Rahmen von PVE, ein diesbezüglich
erweitertes Angebot und optimale pflegerische Qualität dienen dem
öffentlichen Interesse. Der gehobene Dienst der Gesundheits- und
Krankenpflege stellt gemeinsam mit Ärzt*innen für Allgemeinmedizin das
Kernteam der PVE dar. Im Leistungsumfang ist neben der diagnostischen
und therapeutischen, die pflegerische Kompetenz für die Versorgung von
Kindern, Jugendlichen, älteren Menschen, chronisch Kranken und
multimorbiden Personen enthalten. Hinzu kommen die Kompetenzen für
die psychosoziale Versorgung, das Arzneimittelmanagement sowie
Gesundheitsförderung und Prävention (Bundeskanzleramt 2017, S.1-3).
Von Seiten des Primärversorgungsgesetzes ist die Aufgaben- und
Rollenverteilung nicht klar geregelt. Die Tätigkeit in PVE stellt ein bisher
unbekanntes Berufsfeld dar. Allerdings stehen anhand der im GuKG
geregelten Kompetenzen vielfältige Tätigkeitsbereiche offen. Im Hinblick
darauf haben Expert*innen des Österreichischen Gesundheits- und
Krankenpflegeverbandes Steiermark ein Leistungsprofil für den
gehobenen Dienst in einer PVE erstellt. So übernimmt die Pflegefachkraft
medizinisch-diagnostische, medizinisch-therapeutische und pflegerische
Aufgaben, organisiert und koordiniert patient*innenbezogene Faktoren,
führt verschiedene Berufsgruppen zusammen, arbeitet im Bereich des
Qualitäts- und Risikomanagements, leitet Patient*innen an, schult und
berät sie und wirkt darüber hinaus an Forschungsarbeiten mit und wendet
Forschungsergebnisse an. Der gehobene Dienst erfüllt so die
unterschiedlichen Rollen der Pflegefachkraft, der*des Koordinierenden
und Organisierenden, der*des Netzwerkenden, des*der Risikomanager*in,
des*der Edukator*in und des*der Forschenden (siehe Abbildung 4).
21PFLEGE-
FACHKRAFT
KOORDI-
NATOR*IN EDUKA-
ORGANI- TOR*IN
SATOR*IN
LEISTUNGS
PROFIL
QUALITÄTS- &
NETZ-
RISIKO-
WERKER*IN
MANAGER*IN
FORSCHER*IN
Abbildung 4: Leistungsprofil (eigene Darstellung, vgl. Österreichischer Gesundheits- und
Krankenpflegeverband Landesverband Steiermark 2018, o.S.)
Die einzelnen Bereiche werden mit unterschiedlichen Tätigkeiten
ausgefüllt:
Pflegefachkraft
• Triage
• Clinical Assessment
• Wundmanagement
• Screening, Risikoidentifikation
• Mitwirkung bei Vorsorgeuntersuchung
• Case Management
• Beratung und Schulung
• Erste Hilfe
22• Durchführung diagnostischer Programme/Tests
• Hausbesuche
• Medizinprodukte- und Arzneimittelmanagement
Edukator*in
• Anleitung, Beratung und Schulung von Patient*innen, deren Zu-
und Angehörigen
• Pflegemaßnahmen
• diagnostische oder therapeutische Maßnahmen
• Gesundheitsförderung/Prävention und
Gesundheitskompetenz
• Disease-Management-Programme
• Pädagogische Aufgaben für Auszubildende und Berufsangehörige
• Anleitung
• Evaluierung
• Wissensmanagement
Netzwerker*in
• Optimierung von Nahtstellen
• Unterstützung bei Interessen der Patient*innen
• Netzwerkarbeit im erweiterten PVE-Team
• Mitwirkung bei Fallbesprechungen
Forscher*in
• Evaluierung und Entwicklung von pflegefachlichen Leitlinien
• Mitwirkung an der Versorgungsforschung
• bevölkerungsbezogene Maßnahmen und Bedarfserhebung
• Entwicklung und Verwendung neuer pflegefachlicher Technologien
• Publikationen
Qualitäts- und Risikomanagerin
• Identifikation von Risikopotenzialen
• Optimierung der Sicherheit von Patient*innen
• Bewertung der Effektivität und Qualität der Pflege
23• Mitwirkung bei Zertifizierungen und Qualitätssicherungssystemen
• Hygienemanagement
• Mitwirkung beim Schutz der Arbeitnehmer*innen
Koordinator*in und Organisator*in
• Disease-Management-Programme
• Behandlungs-, Pflege- und Betreuungsprozess
• Routine Monitoring
• Mitwirkung bei der Erstellung und Evaluation von Notfallplänen
• Öffentlichkeitsarbeit
• Betriebliche Gesundheitsförderung
• Mitwirkung bei der Überwachung von lokalen
Gesundheitsproblemen in der Bevölkerung
• Gruppen- und bevölkerungsbezogene Public-Health Maßnahmen
(vgl. Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband
Landesverband Steiermark 2018, o.S.).
Das Leistungsspektrum der kompetenzorientierten Aufgaben und
Fähigkeiten umfasst die ambulante Grundversorgung sowie die
Verlaufskontrolle bei akuten und komplexen Fällen, die
Langzeitversorgung chronisch Kranker und Multimorbider, die Versorgung
psychisch erkrankter Menschen, die Versorgung von Kindern und
Jugendlichen, die Versorgung alter Menschen, den Bereich der
Rehabilitation, die Versorgung von Palliativpatient*innen, Beratung und
Betreuung im Zusammenhang mit Familienplanung, Schwangerschaft und
Säuglingsuntersuchung, die Prävention und Gesundheitsförderung,
Aufgaben im Bereich der öffentlichen Gesundheit ebenso wie das
Praxismanagement (vgl. Brandstätter/Klampfl-Kenny/Mircic/Pesl-
Ulm/Raiger/Rappold/Riedler 2018, S.3-10).
Eine Projektgruppe hat im Rahmen des Zielsteuerungsvertrages ebenso
Kompetenzprofile der Berufsgruppen in PVE entworfen. Der Fokus liegt
auf dem Gesundheitsziel: ‚Die Gesundheitskompetenz der Bevölkerung
stärken‘ (vgl. Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und
24Konsumentenschutz 2021b, o.S.). Es darf nicht außer Acht gelassen
werden, dass eine Kompetenzvertiefung für den gehobenen Pflegedienst
als zielführend gesehen wird. Die Autor*innen empfehlen entsprechende
Weiterbildungen nach §64 GuKG, je nach der Aufgabe, die ein*eine
DGKP übernimmt (vgl. Bundesministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit und Konsumentenschutz 2019, S.7-17).
2.6 Finanzierung der pflegerischen Tätigkeiten in der PVE
Eine besondere Herausforderung liegt in der Finanzierung der durch den
gehobenen Pflegedienst angebotenen Leistungen. Österreich finanziert
sein Gesundheitswesen pluralistisch. Trennt man zwischen ‚primary care‘
(haus- und fachärztliche Versorgung), ‚secondary care‘ (fachärztliche und
stationäre Versorgung) und ‚tertiary care‘ (hoch spezialisierte Leistungen
im Rahmen der stationären Versorgung), so sind die
Sozialversicherungsträger die wesentlichen Finanzierungspartner der
‚primary care‘. ‚Secondary‘ und ‚tertiary care‘ hingegen fallen in den
Zuständigkeitsbereich der Länder und ihrer
Krankenanstaltenbetriebsgesellschaften (vgl. Hofmarcher-Holzhacker
2013, S.206).
Im Herbst 2019 erfragten Forscher*innen der Donau-Universität Krems die
Herausforderungen in einer PVE aus ärztlicher Sicht. Unter anderem wird
die rechtliche Unklarheit hinsichtlich der Leistungsfinanzierung des nicht-
ärztlichen Personals genannt (vgl. Franczukowska/Krczal/Braun 2020, S.
469). Die entsprechenden Verträge waren zu diesem Zeitpunkt allerdings
schon ausverhandelt. Im April 2019 wurde der bundesweite
Gesamtvertrag für PVE zwischen Österreichischer Ärztekammer und dem
Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger
abgeschlossen.
Insgesamt gelten vier Vertragstypen zwischen PVE und
Sozialversicherungsträgern:
25 Der Primärversorgungs-Gesamtvertrag und gesamtvertragliche
Honorarvereinbarungen auf Landesebene (Regelungen zum
Mindestleistungsspektrum, Vergütungsgrundsätze, allgemeine
Bestimmungen),
Der Primärversorgungsvertrag (konkrete Vereinbarungen über die
Leistungserbringung und Honorierung),
Der Primärversorgungs-Einzelvertrag (zwischen freiberuflichen
Mediziner*innen und SV) und
Der Primärversorgungs-Sondervertrag (Regelung der Beziehungen
der Krankenversicherungsträger zu einzelnen PVE) (vgl.
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und
Konsumentenschutz 2020e, o.S.).
Die im Primärversorgungsvertrag geregelte Vergütung soll vermehrt auf
pauschaliertem Weg erfolgen. Das bisher bekannte Modell bezieht sich
auf Einzelleistungen. Grundlegend ist stets der Gesamtvertrag, aus dem
heraus Höhe und Zusammensetzung der Honorare regional zu
vereinbaren sind. Es gibt allerdings verschiedene Elemente, die
verwendet werden (können). Diese sind:
Grundpauschale,
Einzelleistungen,
Bonuszahlungen,
Anschubfinanzierung und
PVE-Manager-Finanzierung (vgl. Österreichische
Sozialversicherung 2020c, o.S.)
Grundsätzlich werden die Leistungen der DGKP als Angestellte der PVE
pauschal abgegolten. Je nach Bundesland ist dies jedoch unterschiedlich
geregelt. In der Steiermark wird derzeit an einem entsprechenden
Gesamtvertrag gearbeitet, bis dato allerdings wird mit jeder PVE ein
eigener Vertrag ausgehandelt (vgl. Telefonat mit Maga. Marianne Hartner
am 14.01.2020). Exakt diese Tatsache dürfte zum obengenannten
Ergebnis der Donau-Universität Krems hinsichtlich der Herausforderungen
geführt haben (vgl. Franczukowska/Krczal/Braun 2020, S. 469).
263 Patient*innenedukation
„Die Gewalt fängt nicht an,
wenn einer einen erwürgt.
Sie fängt an, wenn einer sagt:
‚ich liebe dich,
du gehörst mir!‘
Die Gewalt fängt nicht an,
wenn Kranke getötet werden.
Sie fängt an,
wenn einer sagt:
‚du bist krank
und du mußt tun, was ich dir sage!‘“ (Fried 1989, S.132).
Koch-Straube zitiert Erich Fried zu Recht. Patient*innen sind es über
Jahrhunderte hinweg gewohnt, zu tun, was ihnen gesagt wird.
Professionalität muss jedoch mit Achtung der Menschenwürde und der
Eigenständigkeit eines jeden Menschen einhergehen (vgl. Koch-Straube
2001, S.7-9). Bereits 1953 wurde vom ICN (International Council of
Nurses) ein Ethikkodex für Pflegende verabschiedet. Darin wird die
Untrennbarkeit von Pflege und Achtung der Menschenrechte betont: „Die
Pflegende zeigt in ihrem Verhalten professionelle Werte wie Respekt,
Aufmerksamkeit und Eingehen auf Ansprüche und Bedürfnisse (…)“ (ICN
2012, S.2). Um das adäquate Eingehen auf den*die Pflegebedürftige*n
und seine Bedürfnisse gewährleisten zu können, bedarf es gezielter
Informationen. „Die Pflegende gewährleistet, dass die pflegebedürftige
Person zeitgerecht die richtige und ausreichende Information auf eine
kulturell angemessene Weise erhält, auf die sie ihre Zustimmung zu ihrer
pflegerischen Versorgung und Behandlung gründen kann“ (ebd., S.2), so
der Ethikkodex weiter. Professionelle Patient*innenedukation wird diesem
international geltenden Postulat gerecht.
273.1 Pädagogische bzw. didaktische Vorbemerkungen
Um edukativ tätig zu sein, bedarf es zunächst relevanter Grundkenntnisse
der Pädagogik und Didaktik.
3.1.1 Edukation und Bildung
Edukation wird im Deutschen meist mit dem Ausdruck ‚Erziehung‘
gleichgesetzt (vgl. Dudenredaktion 2020a, o.S.). Geht man vom
englischen ‚education‘ aus, umfasst der Begriff ein weites Spektrum von
Bildung und darf eben nicht mit ‚Erziehung‘ synonym gesetzt werden (vgl.
LEO 2006-2020, o.S.; Kocks/Segmüller 2017, S.221). Die vorliegende
Arbeit übernimmt die Denkweise von Edukation im Sinne von Bildung.
‚Bildung macht frei!‘ ist der Leitsatz, den Joseph Meyer 1850 seiner
‚Groschen-Bibliothek der deutschen Klassiker für alle Stände‘ voranstellt.
Meyer prägt damit ein liberales Bildungsverständnis, das bis heute gilt
(vgl. Universal-Lexikon 2012, o.S.). Schon Platon hat Bildung als Vorgang
der Befreiung verstanden (vgl. Thompson 2020, S.95). Der
wissenschaftliche Diskurs über ‚Bildung‘ geht somit zurück bis in die
Antike. Nach wie vor gibt es je nach zugrundeliegender Philosophie
unterschiedliche Deutungen des Begriffes. Die Interpretation von Elke
Gruber (Universität Klagenfurt) lautet folgendermaßen: „Sie ist zugleich
Prozess, des Bildens und Produkt, die Bildung. Bildung dient der
Befähigung anderer Menschen, stellt zugleich aber auch Selbstbefähigung
der/des Einzelnen dar. Bildung ist zum einen auf ein Ziel gerichtet
(Persönlichkeit, Vollkommenheit), lässt aber auch Optionen offen (Freiheit,
Glück)“ (Gruber o.J., o.S.). Und weiter: „Definiert man Bildung als
reflektiertes Denken und darauf aufbauendes Handeln, dann ist Bildung
eindeutig mehr als Informationsaufnahme und Verarbeitung von Wissen.
Bildung enthält vielmehr die Vorstellung der Entfaltung einer
Persönlichkeit mit aufrechtem Gang und freiem Entscheidungswissen, die
versucht, möglichst allen menschlichen Rollen (…) gerecht zu werden“
(ebd., o.S.). Gruber betont außerdem „die Ausstattung der Menschen mit
dem Wissen und Können, den Einstellungen und Verhaltensweisen, die
28für Orientierung, Überleben und Gestaltung unserer Welt notwendig sind“
(Gruber o.J., o.S.). Liegt der Fokus vor allem auf den beiden Aspekten
‚Selbstbefähigung‘ und ‚Persönlichkeitsentfaltung‘, so wird deutlich, dass
Bildung immer eine Art von Fortschritt und Entwicklung bedeutet.
Selbstbefähigung und Persönlichkeitsentfaltung bedingen aber auch ein
erhöhtes Maß an Freiheit und damit einhergehend Entscheidungsfreiheit.
Fortschritt und Entwicklung zur Freiheit im Sinne von Bildung korrelieren
stets mit Horizonterweiterung. Infolgedessen verändert sich die Selbst-
und Weltdeutung eines Menschen nachhaltig (vgl. Thompson 2020, S.92).
Der Pädagoge Rolf Arnold entwickelte den ‚Kaiserslauterer Ansatz zum
Lernen Erwachsener‘. Er versteht Bildung folgendermaßen:
„‘Bildung‘ wird somit als ein Transformationsprozess
verstanden, in welchem die Menschen lernen, ihre entwickelten
Muster des Weltverstehens und des Sich-Fühlens in der Welt
allmählich zu überschreiten. Bildung ist somit ein Loslassen von
Altem und Vertrautem und der Versuch, sich auf neue Sicht-
und Verhaltensweisen einzulassen. Je mehr dabei Menschen
eine mehr und mehr spielerische Distanz zu ihren eingelebten
Gewissheiten entwickeln können, desto stärker bilden sie
Kompetenzen heraus, die auch und gerade für die Gestaltung
von Ungewissheit grundlegend sind. Bildung ist so betrachtet
eine Ausstattung zum selbstbestimmten Verhalten in der Welt,
sie ist als solche jedoch mehr und mehr eine ‚reflexive
Kompetenz‘, da wir immer weniger inhaltlich zu bestimmen
vermögen, was morgen gewusst und gekonnt werden muss.
Insofern ist jede Pädagogik eine Erwachsenenpädagogik, d.h.
eine Bildung zur Autonomie, Selbstbestimmung und
Veränderung“ (Arnold 2009, S.5).
Betrachtet Arnold Bildung als Veränderungsprozess (Transformation), so
impliziert auch er damit Fortschritt und Entwicklung. Autonomie,
29Selbstbestimmung und Veränderung bedeuten wiederum Freiheit und
Horizonterweiterung.
3.1.2 Das didaktische Dreieck
Das didaktische Dreieck (Abbildung 5) illustriert die Eckpunkte von Lehren
und Lernen. Im Zentrum der Didaktik steht die Beziehung zwischen
Lehrperson, Schüler*in und Unterrichtsinhalt.
Abbildung 5: Didaktisches Dreieck (eigene Darstellung)
Ausdrücklich zu bemerken ist, dass alle drei Komponenten gleichwertig
sind. Es besteht keinerlei Hierarchie. Bewusst wurde in Abbildung 5 die
Lehrperson nicht an den obersten Eckpunkt gestellt (wie in ähnlichen
Darstellungen üblich). Meyer hebt hervor, dass sowohl Lehrperson als
auch Schüler*in zugleich Lehrende und Lernende sind. Sie unterstützen
sich gegenseitig in ihrer Lehr- und Lerntätigkeit und sind für den
gegenseitigen Erfolg verantwortlich (vgl. Meyer 2016, S.232-237).
Diese Gleichwertigkeit von Lehrenden und Lernenden ist insbesondere in
der Erwachsenenbildung von erheblicher Bedeutung.
30Sie können auch lesen